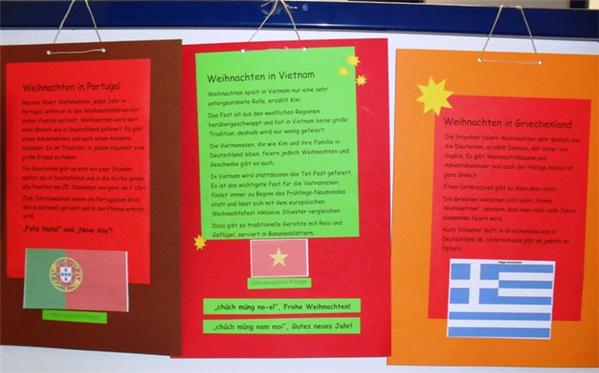weitere Berichte von LOS
21.08.2014
Bundesweiter Aktionstag für Legasthenie und Dyskalkulie
 Speyer-
Am 30. September fand der bundesweite Aktionstag für Legasthenie
und Dyskalkulie statt. Auch das LOS Speyer war im
Interesse der betroffenen Kinder gerne bereit, diesen Tag in den
Mittelpunkt zu rücken.
Speyer-
Am 30. September fand der bundesweite Aktionstag für Legasthenie
und Dyskalkulie statt. Auch das LOS Speyer war im
Interesse der betroffenen Kinder gerne bereit, diesen Tag in den
Mittelpunkt zu rücken.
Marc ist heute mit seiner Mutter, seiner Oma und seiner kleinen
Schwester zum LOS-Unterricht gekommen. Normalerweise bringen sie
Marc nur zum Unterricht. Heute dürfen sie da bleiben. Denn heute
hat das LOS Speyer für Marc und die anderen Schüler, die in die
LOS-Förderung gehen, einen Spielenachmittag vorbereitet. Ein
Spielenachmittag, bei dem es erwünscht ist, dass er auch seine
Familie mitbringt. Also sitzt Marc nun zusammen mit Mama, Oma und
der kleinen Schwester beim Ubongo, einem Denk- und
Strategiespiel.
In diesem Jahr hat der Bundesverband für Legasthenie und
Dyskalkulie zum ersten Mal den bundesweiten Aktionstag für
Legasthenie und Dyskalkulie veranstaltet – und aufgefordert, daran
teilzunehmen. Denn in Deutschland sind noch immer drei bis acht
Prozent der Kinder von einer Legasthenie betroffen. Noch schlimmer:
Es gibt hierzulande auch rund 7,5 Millionen so genannte funktionale
Analphabeten.
Auch Marc gehört zu den drei bis acht Prozent, weshalb er seit
einem Jahr in die Förderung im LOS geht. Normalerweise übt er
zweimal die Woche, um Fortschritte im Lesen und Schreiben zu
machen. Heute jedoch darf er mit seiner Familie spielen. Der
Spielenachmittag zielt darauf ab, Spaß zu haben, und zu lernen,
Spielregeln einhalten und gewinnen zu genießen beziehungsweise
verlieren zu ertragen. Nicht zuletzt ist es auch ein
gemeinschaftliches Erlebnis.
Für Marc hat es bei der Spiele-Rallye nicht ganz zum Sieg
gereicht. Auf Omas Punktekarte stand am Ende ein halber Zähler
mehr. Marc hat sich darüber ein bisschen aufgeregt. Aber er konnte
sich dann doch noch freuen. Denn bei der Verlosung zum Abschluss
der Spiele-Rallye hat er den Hauptpreis gewonnen. Ein Spiel, das er
noch an diesem Abend mit seiner Familie ausprobieren wollte.
Text und Foto: LOS Speyer
01.10.2016
Was hilft in der Lese- und Rechtschreibförderung?
 Prof. Dr. Matthias Grünke
Prof. Dr. Matthias Grünke
Fragen an Prof. Dr. Matthias Grünke, Universität Köln
Herr Prof. Grünke, wodurch zeichnen sich gute Lerner
aus?
Grünke: Man lernt vor allem dann gut, wenn man
über effektive Lernstrategien verfügt, diese zielgerichtet einsetzt
und seine Aufmerksamkeit über längere Zeit einer bestimmten Sache
zuwenden kann.
Viele Kinder haben keine Probleme, Lesen und Schreiben zu
lernen. Andere jedoch schon. Woran liegt das?
Grünke: Die Ursachen können vielfältig sein.
Manchmal hatten Kinder in ihrer Vorschulzeit zu selten die
Gelegenheit, ihren Eltern beim Vorlesen zuzuhören. Auch zu viel
Zeit vor dem Fernseher oder dem Computer kann die Entwicklung
negativ beeinflussen.
Wie kann es zu solchen Unterschieden kommen? Immerhin haben
alle Kinder das gleiche Unterrichtsangebot …
Grünke: Würden alle Kinder einem
Leichtathletikverein beitreten und dort regelmäßig die gleichen
Trainingsangebote erhalten, wären sie deswegen im Hinblick auf ihre
Weitsprung-, Sprint- oder Speerwurfleistungen auch nicht gleich
gut. Das besondere Problem beim Sprachunterricht ist, dass es
Kinder ohne ausreichende Lese- und Rechtschreibkompetenzen auf
Dauer sehr schwer haben werden. Deswegen ist es wichtig, gerade
solche Mädchen und Jungen wirksam zu unterstützen.
Nicht alle Fördermethoden sind dabei erfolgreich …
Grünke: Viele Schulen arbeiten nach sehr
offenen Methoden und vermeiden in den ersten beiden Jahren direkte
Rückmeldungen, um die Mädchen und Jungen nicht zu entmutigen. Das
klappt bei den meisten Kindern auch. Sie lernen trotz (nicht wegen)
der Methode des Lehrers und nehmen von einem solchen Vorgehen
keinen Schaden. Bei den weniger Begabten ist das anders.
Einschlägige Studien zeigen, dass sich der Anteil der Kinder mit
Lese-Rechtschreibstörungen durch diese Methoden vervielfacht.
Solche Schüler sind darauf angewiesen, dass ihnen jemand mit
fundierten Lernmethoden unter die Arme greift.
Das heißt, viele Nachhilfeeinrichtungen benutzen falsche
Ansätze, beim Versuch, den Kindern zu helfen?
Grünke: Ja. Nicht jeder Ansatz ist gleich
sinnvoll. Manche Methoden schaden mehr als sie nutzen.
Wie sollte Ihrer Meinung nach ein Förderkonzept aussehen, das
Schülern mit einer Lese- und/oder Rechtschreibschwäche helfen
kann?
Grünke: Die Basis an Forschungsbefunden ist
sehr breit und stabil. Ein Wiederholen des Stoffes ist bei solchen
Konzepten zentral. Dies ist keine Frage des persönlichen Ermessens.
Genauso wenig ist es Ansichtssache, ob man beim Bau einer Brücke
die Regeln der Statik beachten sollte oder nicht – auch wenn
Menschen ungleich komplexer sind als Gebäude.
20.04.2016
Was hilft bei einer Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) – und was nicht?
 Von Dr. Gerd
Eisenhofer
Von Dr. Gerd
Eisenhofer
Speyer- Ist es heutzutage noch erforderlich,
dass Texte, Briefe, E-Mails und sonstige Formen der schriftlichen
Kommunikation auf einer (weitgehend) korrekten Rechtschreibung
basieren? Würde es nicht ausreichen (und damit mit weniger
Mühe verbunden sein), wenn der Empfänger unserer schriftlichen
Nachricht den Inhalt versteht?
Nun gelten Lesen und Schreiben - neben dem Rechnen - als die
gängigen Kulturtechniken unserer zivilisierten Welt. Insofern ist
die Rechtschreibung kein Selbstzweck, sondern soll jungen Menschen
helfen, Texte sicher und flüssig zu lesen und zu schreiben, um sich
in unserer zunehmend komplexeren Welt zurechtzufinden. Die
Vermittlung dieser Kompetenz obliegt der Grundschule.
Seit mehreren Jahrzehnten streiten Wissenschaftler und
Bildungspolitiker trefflich über die „richtige“ Methode beim
Erlernen der Rechtschreibung. Zu den umstrittenen Methoden, mit
denen Kindern in der Grundschule das Schreiben beigebracht wird,
zählt „Schreiben nach Gehör“. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet
diese: Die Schüler dürfen die Wörter so schreiben, wie sie diese
hören (z. B. „Farat“ für „Fahrrad“). Dazu führt der
Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann in einem Artikel in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29. April 2014 aus, dass
Schreiben, wie man spricht, ohne entsprechende Korrekturen
vorzunehmen, um einer angeblichen Traumatisierung der Schüler
vorzubeugen, letztendlich zum Ende der Orthografie führen wird.
Auch bemängelt er den Versuch, die Lesefähigkeit durch eine
drastische Vereinfachung von Texten zu steigern.
Nun gibt es sicherlich nicht die ideale Methode im
Lese-Rechtschreiblernprozess (und jeder Mensch lernt bekanntlich
anders), auffällig ist jedoch, dass sich die Rechtschreibkompetenz
deutscher Schüler in den vergangenen Jahrzehnten permanent
verschlechtert hat (dies besagt bspw. Die Längsschnittstudie von
Wolfgang Steinig von der Universität Siegen, vorgestellt bei der
49. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim
2013). Und noch auffälliger ist die Tatsache, dass
Lese-Rechtschreibprobleme bei Schülern häufig erst zu Beginn der
weiterführenden Schule erkannt werden, nämlich dann, wenn diese
Kompetenz (zumindest) in den sprachlichen Fächern abverlangt wird.
Für sie wäre es mit Sicherheit vorteilhaft gewesen, in der
Grundschule durch häufigeres und intensiveres Üben gefordert bzw.
gefördert zu werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob
Wörter im fotografischen Gedächtnis dauerhaft abgespeichert werden,
wenn im Unterricht nur die Überprüfung von Schreibstrategien
erfolgt (Beispiel: Schreibt man „backen“ mit „k“ oder mit
„ck“?).
Lesen lernt man durch Lesen und Schreiben durch Schreiben. Diese
Aussage klingt einerseits banal, erfordert andererseits jedoch eine
systematische und strukturierte Vorgehensweise und bedeutet
letztendlich ein hartes Stück Arbeit, insbesondere für Schüler mit
einer Lese-Rechtschreibschwäche. Sogenannte alternative Methoden,
die vom Training auditiver und/oder visueller Funktionen bis hin
zur Davis-Methode reichen, sind hier wenig hilfreich, wie die
Arbeiten von Professor Waldemar von Suchodoletz von der Universität
München auf eindrucksvolle Weise gezeigt haben.
 Dr. Gerd
Eisenhofer ist Leiter des Lehrinstituts für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer ( www.LOS-Speyer.de ).
Dr. Gerd
Eisenhofer ist Leiter des Lehrinstituts für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer ( www.LOS-Speyer.de ).
LOS Speyer
Bahnhofstraße 62-64
67346 Speyer
Telefon: 06232/291603
E-Mail: LOS-Speyer@t-online.de
www.los-speyer.de
22.02.2016
Damit auch Ihre Kinder ihre Leistungsfähigkeit voll ausschöpfen können
 Böhl-Iggelheim- Der Start nach den
Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern für Freude. Vor
allem bei denen nicht, die mit Bammel den Halbjahresinformationen
Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele Schüler und deren
Eltern fallen die Noten weniger gut aus als erhofft. Im Interview
erzählt Christine Eisenhofer, Pädagogin, Lerntherapeutin und
Leiterin des LOS Speyer, wie man mit Zweifeln umgehen und was man
nun tun sollte.
Böhl-Iggelheim- Der Start nach den
Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern für Freude. Vor
allem bei denen nicht, die mit Bammel den Halbjahresinformationen
Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele Schüler und deren
Eltern fallen die Noten weniger gut aus als erhofft. Im Interview
erzählt Christine Eisenhofer, Pädagogin, Lerntherapeutin und
Leiterin des LOS Speyer, wie man mit Zweifeln umgehen und was man
nun tun sollte.
Laut einer aktuellen forsa-Umfrage nehmen bis zu einem
Viertel aller Schüler in Deutschland kommerzielle Nachhilfe. Ist
das immer das richtige Unterstützungsangebot?
Christine Eisenhofer: Nein, weil es unter den Kindern mit
Lernproblemen immer wieder welche geben wird, für die diese
Unterstützung nicht passt.
Warum schlägt Nachhilfe nicht bei allen Kindern an?
Wichtig ist zu wissen, dass nicht alle Schüler, die schlechte
Noten bekommen, die gleichen Probleme haben. Manche brauchen „nur“
Nachhilfe, andere brauchen eine Art Lernbegleitung. Wichtig hierbei
ist die Tatsache, dass Nachhilfe nicht über das Aufholen von
Wissenslücken des aktuellen Lernstoffes hinausgeht.
Wann ist dann Nachhilfe notwendig?
Wenn Unterrichtsstoff versäumt wurde, wenn Vertiefungen
notwendig sind oder wenn eine andere Art von Erklärung als die des
Lehrers gebraucht wird.
Wann aber ist Nachhilfe das falsche Hilfsmittel?
Wenn es darum geht, ein Handicap in Form einer Lernschwäche in
einem bestimmten Bereich auszugleichen. Eine nicht passende
Unterstützung kann dazu führen, dass sich keine besseren Resultate
einstellen. Schüler verlieren dann schnell die Lust, Eltern
zweifeln an der Lernkompetenz ihrer Kinder.
Wie kann man mit diesen Zweifeln umgehen?
Kinder dürfen ihre Lernschwäche nicht als Bestrafung empfinden.
Eltern müssen die erfolglosen Anstrengungen ihrer Kinder als eine
Art Hilfeschrei verstehen und ihnen gezielt helfen lassen.
Und wie kann man bei einer Lernschwäche helfen?
Ohne eine genaue Diagnose des Problems sollte nie eine
Lernunterstützung starten – egal ob es sich um Probleme im
Schreiben, im Rechnen oder bei Fremdsprachen handelt.
Glücklicherweise gibt es im Bereich der Förderung genug
erfolgreiche Methoden und Materialien.
Was unterscheidet eine Förderung in Form einer Lerntherapie
von der Nachhilfe?
Im Vordergrund steht das systematische Hinführen zum richtigen
Schreiben, zum Erlernen der Lesebausteine oder zum Finden des
Rechenweges. Dies erfolgt auf Basis der erstellten Diagnose. Im
Laufe der Förderung muss es den Schülern zunehmend gelingen,
erlerntes Regelwissen anzuwenden und Schreibweisen zu
automatisieren. Das verlangt natürlich sehr viel Übung, was in
kleineren Lerngruppen leichter fällt.
Was muss Förderung noch leisten?
Die Schüler müssen lernen, strukturiert zu arbeiten. Bei den
Kindern kehrt die durch Misserfolge oftmals verlorene Lernlust
zurück. Das führt dann fast automatisch zu einer besseren Note.
Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS Speyer, Bahnhofstraße
62-64, Telefon: 06232/291603
Die ersten drei Eltern aus Böhl-Iggelheim, die sich für
eine Förderung ihres Kindes entscheiden, erhalten einen Gutschein
für das Rofu Kinderland in Speyer. Text und Foto: LOS
Speyer
01.02.2016
So setzen Sie gemeinsam um, was Ihr Kind leisten kann
 Speyer-
Der Start nach den Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern
für Freude. Vor allem bei denen nicht, die mit Bammel den
Halbjahresinformationen Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele
Schüler und deren Eltern fallen die Noten weniger gut aus als
erhofft.
Speyer-
Der Start nach den Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern
für Freude. Vor allem bei denen nicht, die mit Bammel den
Halbjahresinformationen Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele
Schüler und deren Eltern fallen die Noten weniger gut aus als
erhofft.
Im Interview erzählt Christine Eisenhofer, Pädagogin,
Lerntherapeutin und Leiterin des LOS Speyer, wie man mit Zweifeln
umgehen und was man nun tun sollte.
Laut einer aktuellen forsa-Umfrage nehmen bis zu einem
Viertel aller Schüler in Deutschland kommerzielle Nachhilfe. Ist
das immer das richtige Unterstützungsangebot?
Christine Eisenhofer: Nein, weil es unter den Kindern mit
Lernproblemen immer wieder welche geben wird, für die diese
Unterstützung nicht passt.
Warum schlägt Nachhilfe nicht bei allen Kindern an?
Wichtig ist zu wissen, dass nicht alle Schüler, die schlechte
Noten bekommen, die gleichen Probleme haben. Manche brauchen „nur“
Nachhilfe, andere brauchen eine Art Lernbegleitung. Wichtig hierbei
ist die Tatsache, dass Nachhilfe nicht über das Aufholen von
Wissenslücken des aktuellen Lernstoffes hinausgeht.
Wann ist dann Nachhilfe notwendig?
Wenn Unterrichtsstoff versäumt wurde, wenn Vertiefungen
notwendig sind oder wenn eine andere Art von Erklärung als die des
Lehrers gebraucht wird.
Wann aber ist Nachhilfe das falsche Hilfsmittel?
Wenn es darum geht, ein Handicap in Form einer Lernschwäche in
einem bestimmten Bereich auszugleichen. Eine nicht passende
Unterstützung kann dazu führen, dass sich keine besseren Resultate
einstellen. Schüler verlieren dann schnell die Lust, Eltern
zweifeln an der Lernkompetenz ihrer Kinder.
Wie kann man mit diesen Zweifeln umgehen?
Kinder dürfen ihre Lernschwäche nicht als Bestrafung empfinden.
Eltern müssen die erfolglosen Anstrengungen ihrer Kinder als eine
Art Hilfeschrei verstehen und ihnen gezielt helfen lassen.
Und wie kann man bei einer Lernschwäche helfen?
Ohne eine genaue Diagnose des Problems sollte nie eine
Lernunterstützung starten – egal ob es sich um Probleme im
Schreiben, im Rechnen oder bei Fremdsprachen handelt.
Glücklicherweise gibt es im Bereich der Förderung genug
erfolgreiche Methoden und Materialien.
Was unterscheidet eine Förderung in Form einer Lerntherapie
von der Nachhilfe?
Im Vordergrund steht das systematische Hinführen zum richtigen
Schreiben, zum Erlernen der Lesebausteine oder zum Finden des
Rechenweges. Dies erfolgt auf Basis der erstellten Diagnose. Im
Laufe der Förderung muss es den Schülern zunehmend gelingen,
erlerntes Regelwissen anzuwenden und Schreibweisen zu
automatisieren. Das verlangt natürlich sehr viel Übung, was in
kleineren Lerngruppen leichter fällt.
Was muss Förderung noch leisten?
Die Schüler müssen lernen, strukturiert zu arbeiten. Bei den
Kindern kehrt die durch Misserfolge oftmals verlorene Lernlust
zurück. Das führt dann fast automatisch zu einer besseren Note.
Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS Speyer, Bahnhofstraße
62-64, Telefon: 06232/291603
www.LOS-Speyer.de
Text und Foto: LOS Speyer
27.01.2016
LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen beteiligte sich am Bundesweiten Vorlesetag
 Mit einer Lesung
und dem Besuch von zwei echten Ritter
Mit einer Lesung
und dem Besuch von zwei echten Ritter
Speyer- Rund 20 Schüler des LOS
Speyer/Wiesloch/Schwetzingen und ihre Eltern, Geschwister und
Großelter haben am vergangenen Freitag einen spannenden Nachmittag
erlebt. Sie bekamen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages Besuch
des Mittelaltervereins „Die Brüder des Wolfes“. Frau Troubal und
ihre Tochter schauten als Rittersfrauen verkleidet im LOS vorbei,
berichteten den Kindern in einem zum Rittersaal umgestalteten Raum
aus dem Leben im Mittelalter, zeigten ihnen Utensilien aus der
damaligen Zeit wie Küchenwerkzeuge, „Geldbeutel“ oder Handwerkzeuge
und ließen die staunenden Kinder auch eigene Lederbeutel für ihre
Schätze herstellen – das passte dann bestens zum Buch des
Bundesweiten Vorlesetages, „Der kleine Ritter Trenk“.
In dem Buch, aus dem während des Besuchs der Ritter auch
(vor-)gelesen wurde, geht es darum, dass Trenk, um seine
Familie aus der Knechtschaft zu befreien, sich mit einem Schwein
auf den Weg macht, um Ritter zu werden. Dank der Hilfe der
Ritterstochter Thekla gelingt ihm das auch.
Geschrieben hat das Buch die bekannte Kinderbuchautorin Kirsten
Boie, die unlängst gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen
Sonntagszeitung“ verriet, dass sie „Der kleine Ritter Trenk“
geschrieben habe, weil Jungs grundsätzlich weniger lesen als
Mädchen. Sie hat das Buch ganz bewusst als „Vorlesebuch“
konzipiert, um das Interesse der Jungs am Lesen über das Vorlesen
zu wecken. Das für Jungen spannende Thema Ritter benutzt sie dabei
als eine Art Lockmittel. Das Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS), welches Kinder und Jugendliche mit Lese- und
Rechtschreibproblemen fördert, führt seit Jahren Veranstaltungen
zur Lesemotivation durch und verweist darauf, dass sich vor allem
Jungs oftmals schwer damit tun, zum Buch zu greifen. Daher werden
auch die Eltern von LOS-Schülern dazu animiert, ihren Kindern immer
wieder vorzulesen, weil der Weg zum Lesen nun mal über das Vorlesen
führt, wie Christine Eisenhofer, Leiterin des LOS Speyer,
betont.
Am 20. November fand nicht nur im LOS Speyer, sondern
deutschlandweit der Bundesweite Vorlesetag statt. Der Bundesweite
Vorlesetag wird seit 2004 veranstaltet. Als Vorleser fungieren
dabei auch Prominente aus Politik, Kultur, Medien und Sport, denn
Vorlesen fördert die Lesefreude der Zuhörer, die Sprachkompetenz
und die Motivation, später selbst zum Buch zu greifen. Text und
Foto: LOS
21.11.2015
Der Weg zum erfolgreichen Lernen
 Von Christine
Eisenhofer
Von Christine
Eisenhofer
Das Lesen des außergewöhnlichen Wortes Wunschpunsch ist für
einen geübten Leser möglich, weil ihm sowohl das Wort Wunsch, als
auch das Wort Punsch bekannt sind. Schwieriger wird es beim Wort
satanarchäolügenialkohöllische – die Einzelwörter lassen sich
hier nicht von etwas Bekanntem oder Ähnlichem ableiten.
Das Gehirn als Mittelpunkt jedes Lernprozesses ist quasi eine
„Wundermaschine“, die unzählige Informationen zu verarbeiten hat.
Welche der Informationen, die ankommen, auch hängenbleiben, das
bestimmt das Gehirn. Das Gehirn verarbeitet allerdings nur solche
Informationen weiter, die es für wichtig hält – und eben nur solche
Informationen werden von Kindern auch gelernt werden. Eine wichtige
Regel gilt hier allerdings: Das neu zu Lernende muss zum Vorwissen
passen.
Das menschliche Gehirn ist darauf getrimmt, alle Erlebnisse,
Informationen und Gedanken ständig zu bewerten. Sind sie
interessant oder langweilig, mag ich sie oder nicht, kann ich damit
etwas anfangen oder nicht?
Kindern geht es bei den Entschlüsselungen von Wortbildern
ähnlich, weil viele nur langsam oder überhaupt nicht gespeichert
werden. Und wer schon Probleme beim Entschlüsseln von Wörtern hat,
für den wird es natürlich noch viel schwieriger, Sätze oder ganze
Texte zu verstehen.
Zum Lernen gehören Offenheit, Neugierde und Freude. Gerade
Kinder lernen ständig und überall. Unbemerkt stellen sich
Glücksgefühle ein, wenn etwas Neues entdeckt, verstanden und
automatisiert wurde. Ähnlich läuft es auch beim schulischen Lernen
ab. Wenn an das Gehirn neue Wissensinhalte oder andere
(Lern-)Stoffe andocken konnten, stellt sich ein gutes Gefühle,
Zufriedenheit ein. Die Überraschung, etwas gelernt zu haben, führt
zur Ausschüttung von Dopamin, einem Wohlfühlstoff, quasi einem
körpereigenen Opium. Dieses Erfahren und Erleben von Gefühlen führt
zum Merken.
Es gibt aber auch Dinge, die ein erfolgreiches Lernen behindern
und verhindern. Angst zum Beispiel. Fühlt sich ein Kind von einer
Aufgabe überfordert, werden Stresshormone ausgeschüttet, was die
Denkfähigkeit hemmt. Die Folge: Die Aufgabe wird meistens falsch
bearbeitet. Zudem hat das Arbeitsgedächtnis nur eine begrenzte
Kapazität. Reize, die das Gehirn ebenfalls beanspruchen, wie Handy,
Fernseher oder spielende Geschwister, bergen Ablenkungsgefahr.
Für ein erfolgreiches Lernen sind vor allem diese vier Punkte
wichtig, auf die Eltern einwirken können.
- Ausreichend Schlaf: Vereinfacht ausgedrückt, werden Dinge, die
man tagsüber gelernt hat, erst nachts abrufbar gemacht.
- Lernsituation üben: Wenn man den Lernstoff in simulierten
Prüfungssituation lernt, also am Schreibtisch sitzend, hilft das,
„Black-out-Situationen“ in Prüfungen zu vermeiden. Das Gehirn lernt
so die Rahmenbedingungen kennen.
- Positive Einstellung: In einer positiven Atmosphäre und mit
einer positiven Grundeinstellung lernt es sich leichter.
- Lernrituale: Lernende brauchen ständig gleichbleibende Abläufe
und Arbeitsstrukturen. Sie bieten ihnen Verlässlichkeit und
belasten das Gehirn weniger.
Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS in Speyer. Weitere
Informationen unter www.LOS-Speyer.de
05.11.2015
Ohne Laute und Silben geht es nicht
 Der Lehrer sagt:
„Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche machen spezielle
Fehler“
Der Lehrer sagt:
„Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche machen spezielle
Fehler“
Von Christine Eisenhofer
Speyer- Viele Jahre war es ein Rätsel, was die
Ursache für eine Lese-Rechtschreibschwäche ist. Die Forscher waren
sich nicht einig. Mittlerweile, die Legasthenie-Forschung ist über
100 Jahre alt, kennt man die Ursachen. Verantwortlich kann die
Genetik sein. Verantwortlich können aber auch neurobiologische
Prozesse durch eine Unteraktivierung in den für das Lesen und
Schreiben zuständigen Bereichen in der linken Gehirnhälfte
sein.
Auch zu Beginn des neuen Schuljahres hoffen wieder viele Eltern
und Schüler auf bessere Leistungen in der Rechtschreibung – im Fach
Deutsch, aber auch in den Fremdsprachen. Es werden, das kann man
jetzt schon sagen, sich nicht alle Hoffnungen erfüllen. Vor allem
nicht bei jenen Kindern, die zusammen mit ihren Eltern nicht aktiv
etwas gegen die Schwächen unternehmen.
In der Arbeit gegen die Lese-Rechtschreibschwäche hat sich in
den vergangenen Jahren viel getan. Aktuelle Forschungen stellen den
einen oder anderen Förderansatz infrage, wie beispielsweise die
Diplom-Pädagogin Rita Brehm in einem Beitrag für die Zeitschrift
„Schule im Blickpunkt“ schreibt. Der Aspekt der visuellen und
auditiven Wahrnehmung, also das Hören und Sehen, ist unbestreitbar
ein wichtiger Aspekt im Lesen und Schreiben lernen. Für das
Erlernen des Schreibens sind laut Brehm aber vor allem
Sprachwahrnehmung und Sprachverarbeitung wichtig. Lehrer müssten
berücksichtigen, dass nicht alle Schüler Worte, die sie hören, beim
Schreiben in Buchstaben umwandeln können – und somit das was sie
hören auch nicht oder nur unvollständig aufs Papier bringen.
Nach einer Untersuchung der Krankenkasse Barmer GEK aus dem Jahr
2012 ist etwa jedes dritte Vorschulkind in seiner Sprachentwicklung
gestört. Das Fehlen der Basisfunktion Phonologische Bewusstheit hat
beim Schreiben zur Folge, dass Worte als ein Sprachklang
registriert werden. Silben und Laute werden also nicht
unterschieden. Wenn ein Kind Laute aber nicht unterscheiden kann,
weiß es auch nicht, welcher Buchstabe zu dem gesprochenen Laut
gehört und kann daher Wörter nicht fehlerfrei schreiben
beziehungsweise abspeichern.
Prof. Schulte-Körne, der „Legsthenie-Papst“ in Deutschland, hat
in einer aktuellen Studie (veröffentlicht 2014 im
Wissenschaftsjournal PLoS One) nachgewiesen, dass letztendlich nur
diejenigen Fördermethoden erfolgreich sind, die zwei Dinge
berücksichtigen. Zum einen die Laut-Buchstabenfolgen bei der
Zerlegung und Zusammensetzung von Wörtern. Zum anderen die
Aufgliederung von Wörtern in Silben. Die gleiche Erfahrung erlebe
ich seit über 15 Jahren in meiner Förderung von Kindern und
Jugendlichen mit Lese- und/oder Rechtschreibproblemen. Denn alle
Kinder machen zunächst (die gleichen) Fehler, nur Kinder mit einer
Lese-Rechtschreibschwäche machen von Anfang an mehr Fehler und
diese deutlich länger.
Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS in Speyer.
25.09.2015
Elternseminar „Fit ins neue Schuljahr“
 Speyer- Nicht
mehr lange, dann ist das laufende Schuljahr schon wieder Geschichte
und es beginnen die Sommerferien. Einerseits freuen Sie sich
sicherlich darauf, mit Ihrer Familie in den Urlaub zu fahren und
gemeinsam mit Ihrem Kind aus dem Alltagstrott zwischen Schule,
Hausaufgaben und Sportverein oder Musikschule auszubrechen.
Andererseits sind die Ferien auch sehr lang, rechnet man die
letzten Wochen vor den Ferien und die ersten Tage danach dazu, sind
es rund zwei Monate, in denen die Kinder schulisch nicht so
gefordert werden wie sonst. Der eine oder andere Schüler mag solch
eine lange lernfreie Zeit locker wegstecken, für die meisten
Schüler bedeuten zwei Monate ohne Lernen aber auch zwei Monate, in
denen schon Gelerntes wieder vergessen wird - insbesondere bei
Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Zwei Monate, die für
die schulische Entwicklung des Kindes also einen Rückschritt
bedeuten.
Speyer- Nicht
mehr lange, dann ist das laufende Schuljahr schon wieder Geschichte
und es beginnen die Sommerferien. Einerseits freuen Sie sich
sicherlich darauf, mit Ihrer Familie in den Urlaub zu fahren und
gemeinsam mit Ihrem Kind aus dem Alltagstrott zwischen Schule,
Hausaufgaben und Sportverein oder Musikschule auszubrechen.
Andererseits sind die Ferien auch sehr lang, rechnet man die
letzten Wochen vor den Ferien und die ersten Tage danach dazu, sind
es rund zwei Monate, in denen die Kinder schulisch nicht so
gefordert werden wie sonst. Der eine oder andere Schüler mag solch
eine lange lernfreie Zeit locker wegstecken, für die meisten
Schüler bedeuten zwei Monate ohne Lernen aber auch zwei Monate, in
denen schon Gelerntes wieder vergessen wird - insbesondere bei
Kindern mit einer Lese-Rechtschreibschwäche. Zwei Monate, die für
die schulische Entwicklung des Kindes also einen Rückschritt
bedeuten.
Viele Eltern schauen den Sommerferien aus diesem Blickwinkel
betrachtet daher skeptisch, ja fast schon ein bisschen ängstlich
entgegen. Sie wissen, vieles, was sie mit ihren Kindern in den
vergangenen Wochen und Monaten erarbeitet haben, müssen sie im
kommenden Schuljahr nochmals erarbeitet. Und das kostet viel Zeit
und Geduld – auf beiden Seiten. Doch soweit muss es nicht
kommen.
Das Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) in
Speyer bietet am Mittwoch, den 24. Juni 2015 ein
Elternseminar „Fit ins neue Schuljahr“ an. Wir wollen Eltern Tipps
und Ratschläge aufzeigen sowie Angebote machen, wie sie ihr Kind,
ohne es in den Ferien zu überlasten und zu stressen, so
vorbereiten, dass sie beruhigt den ersten Schultagen im September
entgegenblicken können. Telefonische Anmeldung 06232/291603.
10.06.2015
Wenn ich groß bin, werde ich Detektiv
 LOS wieder beim
Welttag des Buches mit dabei
LOS wieder beim
Welttag des Buches mit dabei
Speyer- Vorsichtig betreten Danilo und Mike die
Martinsburg. Eigentlich dürfen sie, die Hobbydetektive, hier gar
nicht rein. Die Burg ist seit Jahren wegen Einsturzgefahr gesperrt.
Doch die beiden Jungs sind offenbar nicht die einzigen, die sich
über das Verbot hinweggesetzt haben, denn sie entdecken frische
Fußspuren im Sand, die in den Keller führen. Vorsichtig folgen sie
diesen und machen im Keller eine überraschende Entdeckung. Sie
finden zahlreiche Terrarien und sogar ein Babykrokodil.
So beginnt die eigentliche Geschichte in dem Buch „Die
Krokodilbande in geheimer Mission“, das dieses Jahr das
„Welttagsbuchs“ ist. Am 23. April war in Deutschland wieder der
Welttag des Buches, der Tag, an dem hierzulande jährlich ein
Lesefest stattfindet. Nicht nur Verlage, Buchhandlungen und
Bibliotheken, sondern auch Schulen und Lesebegeisterte begehen an
diesem Tag den UNESCO-Welttag des Buches. Auch in Deutschland
finden an diesem Tag, initiiert vom Börsenverein des Deutschen
Buchhandels und der Stiftung Lesen, zahlreiche Aktionen in und um
das Lesen statt. Unter dem Motto „Ich schenke Dir eine Geschichte“
bekommen Schulen und andere Leseeinrichtungen jedes Jahr das
„Welttagsbuch“ gratis. Dieses Jahr eben „Die Krokodilbande in
geheimer Mission“.
Auch das Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS)
in Speyer/Wiesloch/Schwetzingen hat sich in diesem Jahr erneut am
Welttag des Buches beteiligt. An diesem Nachmittag wurden die
Schüler des LOS, inspiriert durch das Thema des diesjährigen
Welttagsbuches, den Tierschmuggel, zu Forschern im Bereich des
weltweiten Tierschmuggels. Anhand des Buches, von
Zeitungsauschnitten und Recherchen im Internet setzten sich die
Kinder mit dem Thema auseinander, erstellten wunderbare
Berichte und Geschichten.
Ziel des Welttags des Buches ist es, die Lesemotivation der
Kinder zu erhöhen und sie zum Lesen von Büchern zu animieren. Denn
das Buch gilt noch immer als das Medium, mit dem wir es schaffen,
uns von der Gegenwart einfach abzuschotten und in eine andere Welt
einzutauchen. In Deutschland gibt es allerdings rund 7,5 Millionen
Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können.
Doch an das Lesen sollte nicht nur an diesem einen Tag im Jahr
gedacht werden. Kinder sollten so oft wie nur möglich zum Lesen
animiert werden, um frühestmöglich gut und sicher lesen zu können.
Das gilt natürlich auch für die LOS-Schüler, die schon ganz
gespannt sind, wie die Geschichte des Buches ausgeht. Text und
Foto: LOS Speyer
Weitere Informationen unter www.los-speyer.de
27.04.2015
LOS-Symposium „Gute Lehrer müssen führen"
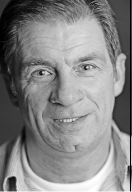 Wie
Lehrkräften gut geführter Unterricht gelingen kann
Wie
Lehrkräften gut geführter Unterricht gelingen kann
Von Dr. Gerd Eisenhofer
Speyer- Das deutsche Bildungssystem wird seit
Jahrzehnten durch zahlreiche sogenannte Bildungsreformen geprägt,
die stets auf dem Rücken von zwei Gruppen ausgetragen werden: Den
Schülern und ihren Eltern sowie den Lehrkräften an den Schulen. Um
herauszuarbeiten, was diese Entwicklung für den Unterricht
bedeutet, hatten die LOS (Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz) im Rhein-Neckar-Raum zu einer Fachkonferenz nach
Mannheim geladen. Hauptreferent Dr. Günther Hoegg,
seit Jahrzehnten im Schuldienst tätig, erläuterte vor über 50
fachkundigen Zuhörern anhand zahlreicher Beispiele, dass
Lehrerinnen und Lehrer der Herausforderung Bildungsreform
erfolgreich durch eine stärkere individuelle Förderung des
Einzelnen begegnen und vor allem Führungsqualitäten entwickeln
sollten.
Lehrkräfte müssten lernen, sich stärker in die Denkweise von
Jugendlichen hineinzuversetzen. So zeigten mehrere neurobiologische
Untersuchungen, dass sich jeder Bereich des Gehirns trainieren
lässt. Hoegg zeigte das am Beispiel des Gebrauchs des rechten
Daumens bei der Bedienung eines Smartphones. Kinder und Jugendliche
machten hier durch die regelmäßige Smartphone-Nutzung große
Fortschritte. In einem weiteren Beispiel wies er darauf hin, dass
Schüler ein anderes Zeitgefühl als Erwachsene haben. Eine Woche
erscheint ihnen wie ein Monat, ein Monat wie ein Jahr. Auch dies
sei im Unterricht und dessen Planung zu berücksichtigen.
Schüler suchen zudem stets neue Herausforderungen, denen
Lehrkräfte durch einen interessant gestalteten Unterricht gerecht
werden können. Wichtig sei auch, so Hoegg, das Vermittelte am Ende
der Unterrichtsstunde nochmals zu wiederholen, damit es bei den
Lernenden haften bleibe. Er verwies dabei auch auf die Tatsache,
dass ein Schüler etwa 50 Wiederholungen benötige, um etwas falsch
Gelerntes zu vergessen. Überträgt man die Erkenntnis auf die
Rechtschreibmethode „Schreiben nach Gehör“, bei der Schüler Wörter
so schreiben dürfen wie sie diese hören (Beispiel: „Farat“ für das
Wort Fahrrad) und die in vielen Grundschulklassen im ersten und
teilweise auch noch im zweiten Schuljahr angewendet wird, für einen
Schüler mit Lese-Rechtschreibschwäche (LRS), so lässt sich erahnen,
welchen Schwierigkeiten diese Kinder und Jugendlichen ausgesetzt
sind.
Abschließend ging Hoegg in seinem Vortrag auf die erforderlichen
Führungsqualitäten von Lehrkräften ein, gerade im Umgang mit
schwierigen Schülern. Ein Lehrer sollte sich nicht in die Defensive
drängen lassen und schnelle und klare Entscheidungen treffen. Denn
Schüler reagieren – im Gegensatz zu Erwachsenen – nicht auf Worte,
sondern auf Handlungen. Foto: LOS
Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des LOS
Speyer/Schwetzingen/Wiesloch
22.04.2015
Welttag des Buches am 23. April
 Von
Christine Eisenhofer
Von
Christine Eisenhofer
Speyer- Der 23. April ist in Deutschland
jährlich der Tag, an dem hierzulande ein Lesefest stattfindet.
Nicht nur Verlage, Buchhandlungen und Bibliotheken, sondern auch
Schulen und Lesebegeisterte begehen an diesem Tag den
UNESCO-Welttag des Buches. Auch in Deutschland finden an diesem
Tag, initiiert vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels und der
Stiftung Lesen, zahlreiche Aktionen in und um das Lesen statt.
Vielleicht ja auch an der Schule Ihres Sohnes oder Ihrer
Tochter. Unter dem Motto „Ich schenke Dir eine Geschichte“ bekommen
Schulen und andere Leseeinrichtungen jedes Jahr das „Welttagsbuch“
gratis. In diesem Jahr wird das Buch „Die Krokodilbande in geheimer
Mission“ gelesen. Autoren und Übersetzer verzichten auf ihr
Honorar, an über 3000 Buchhandlungen und Bibliotheken kann das Buch
abgeholt werden. Der Welttag des Buches wird heute in über 100
Ländern gefeiert, in Deutschland seit 1996. Ziel der Aktion ist es,
die Lesemotivation der Kinder zu erhöhen und sie zum Lesen von
Büchern zu animieren.
Das Buch gilt noch immer als das Medium, mit dem wir es
schaffen, uns von der Gegenwart einfach abzuschotten und in eine
andere Welt einzutauchen. Egal, ob wir in die Welt anderer
eintauchen, Wissen aufsaugen oder andere Gedanken herangetragen
bekommen. Allerdings gibt es in Deutschland rund 7,5 Millionen
Erwachsene, die nicht richtig lesen und schreiben können, also
dieses Erlebnis nicht teilen können.
Doch an das Lesen sollte nicht nur an diesem einen Tag im Jahr
gedacht werden, Eltern von lesemuffeligen Kindern sollten natürlich
so oft wie nur möglich versuchen, ihre Kinder zum Lesen zu
motivieren und zu animieren. Denn Kinder, die nicht richtig lesen
können, verpassen nicht nur etwas, sie haben auch in der Schule
Probleme und verschlechtern damit ihre späteren Berufschancen.
 Hilfreich
ist es beispielsweise, lesemuffelige Kinder bei ihren Interessen zu
packen. Der feuerwehrbegeisterte Junge soll dann eben sein
Feuerwehrbuch lesen und das pferdebegeisterte Mädchen sein
Pferdebuch. Finden die Kinder das Buch spannend, lesen sie gleich
mit viel mehr Eifer. Das gilt auch für Bücher, die bei Freunden
angesagt sind.
Hilfreich
ist es beispielsweise, lesemuffelige Kinder bei ihren Interessen zu
packen. Der feuerwehrbegeisterte Junge soll dann eben sein
Feuerwehrbuch lesen und das pferdebegeisterte Mädchen sein
Pferdebuch. Finden die Kinder das Buch spannend, lesen sie gleich
mit viel mehr Eifer. Das gilt auch für Bücher, die bei Freunden
angesagt sind.
Wichtig ist, über den Tellerrand des Buches hinauszublicken:
Filme sind oftmals als „Appetitmacher“ gut. Gefällt einem Kind die
Geschichte, greift es viel lieber zum Buch. Es gibt auch Reihen,
die mit einem Hörbuch beginnen. Das Hörbuch endet mit einer
unfertigen Geschichte, der Spannungsbogen bleibt also erhalten, und
die Kinder möchten das erste Buch der Reihe, weil es sie
interessiert, wie die Geschichte weiter geht. Auch Comics, Apps und
Magazine, die oftmals kürzere Texte beinhalten, können für Leser,
besonders schwächere, ein Anreiz sein.
Für Jungs sind vor allem die Väter als Lesevorbilder wichtig.
Denn liest der Papa nicht (vor), denken Jungs schnell, dass Lesen
nur etwas für das weibliche Geschlecht ist – und damit uncool. Bei
schwächeren Lesern können auch speziell konzipierte Bücher
beziehungsweise Reihen helfen, die man zusammen liest. Der Vorleser
liest den schwierigeren, anspruchsvolleren und langen Teil, das
Kind die kurzen Passagen, die zudem oftmals in größerer Schrift
gedruckt sind. Das macht das Lesen zu einem Gemeinschaftserlebnis
und sorgt für jede Menge Spaß. Das ist dann auch so eine Art
Lesefest – nur eben in klein. Christine Eisenhofer ist Leiterin
des LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen
20.04.2015
Gute Lehrer müssen führen
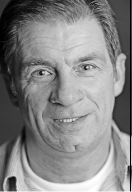 Symposium
des LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen am 25. März 2015
Symposium
des LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen am 25. März 2015
Von Dr. Gerd Eisenhofer
Debatten, wie sich Lehrer verhalten müssen, wie sie auftreten
sollen, gibt es ungefähr schon so lange wie den Lehrerberuf an
sich. Die einen sagen, Lehrer müssen streng und autoritär
unterrichten. Die anderen sagen, so sieht das Lehrerbild von früher
aus und Pädagogen müssen heute ganz anders führen, ohne die strenge
Hand.
Einen neuen Beitrag zu dieser Debatte hat der Autor und
Gymnasiallehrer Günther Hoegg mit seinem Buch „Gute Lehrer müssen
führen“ geliefert. Hoegg, über den es heißt, nur wenige schreiben
so klar und praxisnah auf dem Markt der Pädagogikbücher wie er,
orientiert sich am angelsächsischen Konzept des „classroom
managements“. Es geht ihm nicht darum, den alten Pauker
wiederzubeleben, der mit dem Rohrstock durchgreift. Vielmehr will
er Führungsqualitäten vermitteln, die in anderen Bereichen wie der
Wirtschaft selbstverständlicher Gegenstand von Seminaren sind.
„Schüler brauchen klare Anweisungen“, sagt Hoegg. Doch gerade junge
Lehrer würden darauf verzichten, gäben zu oft nach, versuchten es
lieber mit ständigem Ermahnen anstatt konsequentem
Durchgreifen.
Hoegg, seit über 20 Jahren als Lehrer tätig, beschreibt Lehrer
als hochqualifizierte Führungskräfte, die ihre Führungsaufgaben zum
Wohle der Schüler wahrnehmen müssen. Denn Führung gebe den Schülern
Sicherheit. Wichtig seien bei einem Lehrer der äußere Eindruck
(professionelle Kleidung, keine fettigen Haare), Körperhaltung
(bestimmend) oder Bewegungsverhalten („Revier markieren“) und der
Anfang der Schulstunde. Das ist der Moment, in der der Lehrer seine
Autorität demonstrieren müsse. Beispielsweise, in dem er die
Schüler auf seine Seite ziehe, die Störer isoliere.
Doch das gelinge nur, wenn der Pädagoge gegenüber Störenfrieden
konsequent agiere. Warnen, warnen und nochmals warnen führe dazu,
dass die Schüler schnell kapieren, dass sie ziemlich lange stören
können bis etwas passiert. Daher empfiehlt Hoegg eine Verwarnung
plus eine Strafandrohung (z. B. einem mit Smartphone spielenden
Schüler wird Wegnahme angedroht) und bei der zweiten Störung eine
Ausführung der angedrohten Strafe (Smartphone wird weggenommen).
Ein Lehrer solle quasi wie ein Schiedsrichter mit Gelben und Roten
Karten agieren. „Zwei Warnungen sind bereits eine zu viel“,
schreibt er in seinem Buch.
In den vergangenen 30, 40 Jahren habe sich viel geändert, die
Schüler treten nun in einem viel jüngeren Alter selbstbewusst auf,
am schwierigsten sei für Lehrer nun nicht mehr der Umgang mit
Neuntklässlern, sondern Schülern in Klassenstufe sieben. Doch nicht
nur hier hat sich laut Hoegg etwas gewandelt. Auch der Umgang von
Eltern, insbesondere mit Junglehrern, sei schwieriger geworden.
„Viele Eltern haben Strategien entwickelt, mit denen sie vor allem
Junglehrer in die Ecke treiben“, schreibt Hoegg in dem sehr
praxisorientierten mit vielen Beispielen geschmückten Buch.
Zum Thema „Gute Lehrer müssen führen – Wie gut geführter
Unterricht gelingt“ referiert Dr. Günther Hoegg auf einem Symposium
des LOS Speyer/Wiesloch/Schwetzingen am Mittwoch, 25. März
2015, im Maritim Hotel Mannheim, Friedrichsplatz 2. Der Vortrag
soll Lehrkräften helfen, Schüler und ihr Handeln zu verstehen und
sie so zu führen, dass ein störungsarmer und erfolgreicher
Unterricht entsteht. Telefonische Anmeldung unter
06232/291603.
Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des LOS
Speyer/Wiesloch/Schwetzingen
06.03.2015
Was hilft bei einer Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) – und was nicht?
 Von Dr. Gerd
Eisenhofer
Von Dr. Gerd
Eisenhofer
Speyer- Ist es heutzutage noch erforderlich,
dass Texte, Briefe, E-Mails und sonstige Formen der schriftlichen
Kommunikation auf einer (weitgehend) korrekten Rechtschreibung
basieren? Würde es nicht ausreichen (und damit mit weniger
Mühe verbunden sein), wenn der Empfänger unserer schriftlichen
Nachricht den Inhalt versteht?
Nun gelten Lesen und Schreiben - neben dem Rechnen - als die
gängigen Kulturtechniken unserer zivilisierten Welt. Insofern ist
die Rechtschreibung kein Selbstzweck, sondern soll jungen Menschen
helfen, Texte sicher und flüssig zu lesen und zu schreiben, um sich
in unserer zunehmend komplexeren Welt zurechtzufinden. Die
Vermittlung dieser Kompetenz obliegt der Grundschule.
Seit mehreren Jahrzehnten streiten Wissenschaftler und
Bildungspolitiker trefflich über die „richtige“ Methode beim
Erlernen der Rechtschreibung. Zu den umstrittenen Methoden, mit
denen Kindern in der Grundschule das Schreiben beigebracht wird,
zählt „Schreiben nach Gehör“. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet
diese: Die Schüler dürfen die Wörter so schreiben, wie sie diese
hören (z. B. „Farat“ für „Fahrrad“). Dazu führt der
Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann in einem Artikel in der
Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 29. April 2014 aus, dass
Schreiben, wie man spricht, ohne entsprechende Korrekturen
vorzunehmen, um einer angeblichen Traumatisierung der Schüler
vorzubeugen, letztendlich zum Ende der Orthografie führen wird.
Auch bemängelt er den Versuch, die Lesefähigkeit durch eine
drastische Vereinfachung von Texten zu steigern.
Nun gibt es sicherlich nicht die ideale Methode im
Lese-Rechtschreiblernprozess (und jeder Mensch lernt bekanntlich
anders), auffällig ist jedoch, dass sich die Rechtschreibkompetenz
deutscher Schüler in den vergangenen Jahrzehnten permanent
verschlechtert hat (dies besagt bspw. Die Längsschnittstudie von
Wolfgang Steinig von der Universität Siegen, vorgestellt bei der
49. Jahrestagung des Instituts für Deutsche Sprache in Mannheim
2013). Und noch auffälliger ist die Tatsache, dass
Lese-Rechtschreibprobleme bei Schülern häufig erst zu Beginn der
weiterführenden Schule erkannt werden, nämlich dann, wenn diese
Kompetenz (zumindest) in den sprachlichen Fächern abverlangt wird.
Für sie wäre es mit Sicherheit vorteilhaft gewesen, in der
Grundschule durch häufigeres und intensiveres Üben gefordert bzw.
gefördert zu werden. Darüber hinaus stellt sich die Frage, ob
Wörter im fotografischen Gedächtnis dauerhaft abgespeichert werden,
wenn im Unterricht nur die Überprüfung von Schreibstrategien
erfolgt (Beispiel: Schreibt man „backen“ mit „k“ oder mit
„ck“?).
Lesen lernt man durch Lesen und Schreiben durch Schreiben. Diese
Aussage klingt einerseits banal, erfordert andererseits jedoch eine
systematische und strukturierte Vorgehensweise und bedeutet
letztendlich ein hartes Stück Arbeit, insbesondere für Schüler mit
einer Lese-Rechtschreibschwäche. Sogenannte alternative Methoden,
die vom Training auditiver und/oder visueller Funktionen bis hin
zur Davis-Methode reichen, sind hier wenig hilfreich, wie die
Arbeiten von Professor Waldemar von Suchodoletz von der Universität
München auf eindrucksvolle Weise gezeigt haben. Text und
Foto: LOS
Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des Lehrinstituts für
Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) Speyer (www.LOS-Speyer.de).
LOS Speyer
67346 Speyer
Telefon: 06232/291603
E-Mail: LOS-Speyer@t-online.de
01.02.2015
Ab in die Eiszeit - LOS Speyer beteiligte sich am Bundesweiten Vorlesetag mit einer Lesung
 Speyer- Rund 25 Schüler des LOS Speyer und ihre
Eltern haben am vergangenen Freitag einen spannenden Nachmittag
erlebt. Sie bekamen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages von
älteren LOS-Schülern vorgelesen.
Speyer- Rund 25 Schüler des LOS Speyer und ihre
Eltern haben am vergangenen Freitag einen spannenden Nachmittag
erlebt. Sie bekamen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages von
älteren LOS-Schülern vorgelesen.
Es ist ein bisschen düster, die Fenster sind abgedeckt,
Malereien hängen von der Decke. Ein Unterrichtsraum im LOS Speyer
ist umgestaltet worden, wirkt von Anblick und Ambiente wie eine
Höhle. Soll er ja auch, schließlich spielt die Geschichte, die
gleich vorgelesen werden soll, ja auch in einer Höhle. An der einen
Seite des zur Höhle umfunktionierten Raumes sitzen die älteren
Kinder, die Vorleser. Auf der anderen Seite sitzen die jüngeren
Kinder, die gebannt verfolgen, was man sich im LOS für sie
ausgedacht hat.
Am 21. November fand nicht nur im LOS Speyer, sondern
deutschlandweit der Bundesweite Vorlesetag statt. Rund 25 Kinder
und ihre Eltern, die daran erinnert werden sollen, wie wichtig
Vorlesen ist, waren ins LOS gekommen, um der Lesung aus dem Buch
„Achtung, Knud, die Eiszeit kommt!“ zu lauschen.
Und weil das Motto des Vorlesetags „Erwecke Geschichten zum
Leben“ lautet, ging es nicht nur darum, dass Buch, das eine
Geschichte aus der Eiszeit erzählt, in Dialogform vorzulesen.
Sondern es ging auch darum, die Geschichte möglichst lebendig zu
erzählen. Die Vorleser unterstützten ihre vorgelesenen Zeilen mit
entsprechenden Gesten. Jeder hatte sich vorher zudem ein Art
überdimensioniertes Namensschild gebastelt, auf dem der Name der
Person auf dem Buch stand und diese auf einer Zeichnung zu sehen
war.
Der Bundesweite Vorlesetag wird seit 2004 veranstaltet. Als
Vorleser fungieren dabei auch Prominente aus Politik, Kultur,
Medien und Sport, denn Vorlesen fördert die Lesefreude der Zuhörer,
die Sprachkompetenz und die Motivation, später selbst zum Buch zu
greifen. Das Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz,
welches Kinder und Jugendliche mit Lese- und Rechtschreibproblemen
fördert, führt seit Jahren Veranstaltungen zur Lesemotivation
durch. cege
Weitere Informationen unter www.LOS-Speyer.de
23.11.2014
Warum brauchen Kinder Vorlesen?
 Von Christine Eisenhofer
Von Christine Eisenhofer
Mit dem Erscheinen der ersten Pisa-Studie im Jahr 2003 wurde die
Schul- und Bildungswelt aufgerüttelt. Seit dieser Zeit sind in
Deutschland viele Maßnahmen zur Leseförderung von Schülern
getroffen worden – nicht nur durch die Schulen.
Während im Bildungsbereich die Förderung der Lesekompetenz im
Vordergrund stand und steht, versuchen Angebote außerhalb der
Schulen - insbesondere die Stiftung Lesen mit dem Bundesweiten
Vorlesetag und die Bibliotheken mit dem Welttag des Buches – die
Lesemotivation zu erhöhen.
Unbestritten ist mittlerweile, dass Lesevorbilder und das
Vorlesen innerhalb der Familie einen äußerst positiven Einfluss auf
die Leselust der Kinder haben. Auch deshalb stellen sich jedes Jahr
im Herbst beim Bundesweiten Vorlesetag viele Prominente als
Vorleser zur Verfügung.
Eine neue Studie der Stiftung Lesen hat nun weitere positive
Aspekte des Vorlesens herausgestellt. So fördert das Vorlesen nicht
nur Sprachkompetenz und Wortschatz, es hat auch einen positiven
Aspekt auf den Zusammenhalt von Familien. Zuwendung und
vertrauensvolle Atmosphäre würden dazu einladen, über schwierige
Situationen zu reden und damit die sozialen Bindungen zu
stärken.
Fast 70 Prozent binden laut der Studie das Vorlesen in den
Alltag ein. Trotz dieser positiven Aspekte lesen aber auch ein
Drittel der Eltern ihren Kindern gar nicht oder nur selten vor.
Überproportional gewachsen ist die Lesebereitschaft allerdings in
bildungsfernen Familien und bei Vätern.
Das LOS beteiligt sich mit dem Motto „Erwecke Geschichten zum
Leben“am Bundesweiten Vorlesetag.
Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS
Speyer
www.LOS-Speyer.de
16.11.2014
Nicht abschreiben
 Wie junge Menschen
mit einer Lese-Rechtschreibschwäche ihr Bildungsziel erreichen und
ihr (Berufs-)Leben in den Griff bekommen können
Wie junge Menschen
mit einer Lese-Rechtschreibschwäche ihr Bildungsziel erreichen und
ihr (Berufs-)Leben in den Griff bekommen können
Von Dr. Gerd Eisenhofer
Beim Festival des deutschen Films in
Ludwigshafen lief in den vergangenen Wochen der Film „Dyslexie –
Der Kampf mit den Buchstaben“, der ein oftmals verkanntes
gesellschaftliches Problem aufgreift (Dyslexie ist der Fachbegriff
für Lese- und Rechtschreibschwierigkeiten). Der Film schildert die
Probleme eines Mannes mit Lese-Rechtschreibproblemen. Philipp Halbe
(30), der Hauptdarsteller, kann weder Anträge ausfüllen, noch
Packungsbeilagen lesen. Doch er versucht sich trotz dieser Schwäche
irgendwie durch den Alltag zu mogeln. Mehr schlecht als recht
übrigens. Denn am Ende des Films wird ihm das Sorgerecht für seine
Tochter entzogen.
Eine Situation, die immer mehr Erwachsene so
oder so ähnlich kennen. Manchmal hat man den Eindruck, dass die
Kulturtechniken Lesen und Schreiben mehr und mehr verkümmern. So
klagen viele Ausbildungsleiter seit Jahren zu Recht, dass sich die
Lese- und Rechtschreibfertigkeiten der Auszubildenden gegenüber
früheren Ausbildungsgenerationen permanent verschlechtert haben.
Und auch Universitätslehrer weisen darauf hin, so schreibt es der
Philosophieprofessor Konrad Paul Liessmann am 26.09.2014 in einem
Beitrag für die FAZ, dass ihre Studenten weder die Rechtschreibung
noch die Grammatik ausreichend beherrschen und auch nicht über eine
präzise Ausdrucksfähigkeit verfügen.
Und wie reagiert die Bildungspolitik darauf?
Zu Beginn ihrer Schullaufbahn wird Schülern das
Schreiben nach der – um es vorsichtig zu formulieren – fragwürdigen
Methode Schreiben nach Gehör vermittelt, Lesetexte werden drastisch
vereinfacht, und viele Aufgaben sollen durch Ankreuzen oder
Einsetzen einzelner Wörter bearbeitet werden. Die Schulung des
eigentlichen Schreibens, d. h. das Verfassen von Texten, bleibt
dabei meist auf der Strecke, so schreibt Liessmann weiter.
Dabei könnte – folgt man der Argumentation
Liessmanns – alles ganz einfach sein: Lesen und Schreiben sind
Kulturtechniken, auf in unserer heutigen komplexen Welt mehr denn
je nicht verzichtet werden darf. Es kann nicht der richtige Weg
sein – so Liessmann – „das Betrachten von Bildern zu einem Akt des
Lesens und das Ankreuzen von Wahlmöglichkeiten zu einem Akt des
Schreibens hochzustilisieren“, auch wenn es Menschen gibt, denen
das Lesen- und Schreibenlernen schwer fällt. Viel sinnvoller wäre
es dagegen, diese Menschen mit geeigneten, auf ihr Problem
zugeschnittenen Methoden effektiv zu unterstützen, damit sie ihr
Bildungsziel erreichen und ihr (Berufs-)Leben in den Griff bekommen
können.
Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des
Lehrinstituts für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) Speyer
(www.LOS-Speyer.de).
Gut vorbereitet für die Weiterführende Schule - Drohen schlechte Noten in Deutsch und Englisch?
 Gut vorbereitet
für die Weiterführende Schule - Drohen schlechte Noten in
Deutsch und Englisch?
Gut vorbereitet
für die Weiterführende Schule - Drohen schlechte Noten in
Deutsch und Englisch?
Speyer- Noch ein paar Wochen, dann
geht die Grundschulzeit für die Viertklässler zu Ende. Davor haben
Sie mit ihren Eltern noch eine wichtige Aufgabe zu bewältigen – die
Suche nach einem „neuen Arbeitsplatz“, d. h. die
passende Weiterführende Schule finden. Und mit diesem Schulwechsel
steht ein neuer Abschnitt in ihrer Schullaufbahn an. Nur, sind die
Viertklässler, ist Ihr Sohn, Ihre Tochter darauf auch
vorbereitet?
Simon ist es nicht. Wie auch viele andere
Viertklässler hat er am Ende seiner Grundschulzeit noch Probleme,
die Rechtschreibstrategien richtig anzuwenden, kann eigene Texte
noch nicht weitgehend fehlerfrei verfassen, stockt noch häufig beim
Lesen. Das Problem: In der Grundschule hat sich das bislang nicht
sonderlich auf seine Noten ausgewirkt. Die Lehrerin hat oftmals
drüber weggesehen, schließlich ist Simon ja ein lieber Kerl. „Das
wird schon“, hat sie immer gesagt. Nur, wenn es nun im nächsten
Schuljahr „nicht wird“, dann wird Simon demnächst schlechtere Noten
bekommen, vor allem wegen der Rechtschreibfehler – und das nicht
nur in Deutsch. Auch in den Nebenfächern kann er nicht einfach
Klassenarbeiten mit vielen Rechtschreibfehlern abgeben. Auch ein
sicheres Leseverständnis wird auf der Schule, auf die Simon nach
den großen Ferien gehen wird, vorausgesetzt. Wie auch das
weitgehend fehlerfreie Schreiben ungeübter Diktate.
Im Vergleich zur Grundschule gleicht das Lerntempo
auf den Weiterführenden Schulen einer Fahrt mit dem ICE, auf
langsamere Schüler wird wenig Rücksicht genommen. Das weiß auch
Simons Mutter, Angelika Rabe. Sie hat dies ja alles schon einmal
erlebt, bei Simons großem Bruder Felix. Da sind ihr die Probleme
allerdings erst bewusst geworden, als ein Lehrer sie darauf
ansprach. Ende der fünften Klasse war das. Felix bekam dann eine
außerschulische Förderung, gehört nun, drei Jahre später, zum
besseren Durchschnitt in seiner Klasse. Bei Simon will Angelika
Rabe nicht wieder warten, bis sie von Lehrern angesprochen wird,
nicht nochmal denselben Fehler machen. Sie hat bereits
gehandelt.
Simon geht nun seit Kurzem in die Förderung, in das
Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) Speyer, ein
Institut, das auf 30 Jahre Erfahrung in der
Lese-Rechtschreib-Therapie zurückblickt. Angelika Rabe schaut dem
neuen Schulabschnitt von Simon nun zuversichtlicher entgegen als
noch vor ein paar Wochen – und zuversichtlicher als damals bei
seinem älteren Bruder Felix.
Eine eingehende Diagnose und Beratung erhalten
Eltern nach vorheriger Terminvereinbarung im LOS.
Telefonische Kontaktaufnahme unter
06232/291603.
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter:
www.los-speyer.de
Text und Foto: LOS Speyer, Presse
03.07.2014
LOS Speyer feiert Welttag des Buches nach
 LOS Speyer feiert Welttag des Buches nach
LOS Speyer feiert Welttag des Buches nach
Speyer- Einige Schüler des
Lehrinstituts für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS) Speyer und
ihre Eltern haben vergangenen Mittwoch an einer
Lese/Vorleseveranstaltung im Rahmen des Welttags des Buches
teilgenommen.
Die Blicke gehen gebannt Richtung Vorleser, im
Gesicht jedes einzelnen Kindes lässt sich die Spannung ablesen. Sie
alle hören gespannt zu, sie alle wollen wissen, wie die Geschichte
weitergeht, wie sie endet. Sie alle, das sind Schüler des LOS
Speyer, die an einer (Vor-)Leseveranstaltung im Rahmen des Welttag
des Buches teilnehmen, die dem diesjährigen Welttagsroman „Die Jagd
nach dem Leuchtkristall“ lauschen.
Der Welttag des Buches steht stets unter dem Motto
„Ich schenk dir eine Geschichte“. Daher ist es möglich, im Rahmen
der Veranstaltung kostenlos das jeweilige Welttagsbuch in einer
Buchhandlung zu erhalten. Ziel der Aktion ist es, die
Lesemotivation der Kinder zu erhöhen und sie zum Lesen von Büchern
zu animieren, was natürlich auch ein besonderes Anliegen des LOS
ist.
Die Veranstaltung des LOS ging dabei weit über das
Lesen des diesjährigen Welttagsbuchs hinaus. So lasen Eltern und
Pädagogen den Kindern aus Büchern vor, in denen es – wie in „Die
Jagd nach dem Leuchtkristall“ – um mystisches und
unheimliches geht. So bekamen die LOS-Schüler beispielsweise aus
Cornelia Funkes „Gespensterjäger auf eisiger Spur“, Den Kindern
sollte also nicht nur eine, sondern gleich mehrere Geschichten
vorlesend geschenkt werden.
Der diesjährige Welttag des Buches, initiiert durch
die Stiftung Lesen, fand eigentlich Ende April, also in den
Osterferien statt. Da das LOS seinen Schülern aber trotzdem eine
Teilnahme am Welttag des Buches ermöglichen wollte, wurde er im LOS
auf nach den Osterferien verlegt.
Weitere Informationen:
LOS Speyer - Christine Eisenhofer und Dr. Gerd
Eisenhofer
67346 Speyer, Bahnhofstrasse 64
06232 291603
www.LOS-Speyer.de
Text: LOS Speyer, Presse
25.06.2014
Viele Schüler bei den Rechtschreibregelwochen im LOS mit Eifer dabei
 Speyer- Zum Thema Eselsbrücken und Anwendungen
von Rechtschreibregeln fanden im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer vom 17. bis 29. März
Rechtschreibregelwochen statt.
Speyer- Zum Thema Eselsbrücken und Anwendungen
von Rechtschreibregeln fanden im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer vom 17. bis 29. März
Rechtschreibregelwochen statt.
Schreibt man die Pute nun Pute oder Putte? Marie
ist sich unsicher, sie überlegt hin und her, schwankt, ob sie ein
oder zwei t schreiben soll. Wie viele andere Schüler des LOS machte
Marie in den vergangenen Tagen bei den Rechtschreibregelwochen im
LOS mit. „Die Kinder sollten vor allem lernen, den Unterschied
eines kurz- beziehungsweise eines langgesprochenen Vokals zu
erkennen“, sagte Christine Eisenhofer, Leiterin des LOS in Speyer.
Ihre Schüler setzten sich also damit auseinander, den Unterschied
zwischen Risse und Riese, Rosen und Rossen oder Fühler und Füller
herauszuhören und entsprechend umzusetzen. Denn, so eine
Rechtschreibspruch: „Ob kurz oder lang, betont oder nicht, fällt
beim Richtigschreiben erheblich ins Gewicht.“
Lukas und seine Gruppe haben sich lustige Verse
ausgedacht, wie etwa „Hopfen und Malz, Butter und Schmalz, Pfeffer
und Salz kennt man nicht nur in der Pfalz“. Sie haben verstanden,
die altbekannte Rechtschreibregel „Nach l, n, r, das merke dir ja,
steht nie tz und nie ck“ als ihren unsichtbaren Freund und
Begleiter zur Prüfung zu nutzen. Ähnliches übten sie auch anhand
vieler Beispielswörter zu der Regel in Reimform „Nimm die Regel mit
ins Bett, nach Doppellaut steht nie tz“ und Sätzen wie „Merk‘ dir
die Regel, sie ist wahr und schreib die Schaukel nur mir k, das
Kreuz mit z, so ist es nett“.
Timo, 9 Jahre alt, sitzt zusammen mit seiner
Mama an einem Tisch im LOS. Die Rollen sind diesmal umgedreht,
nicht so wie zu Hause, wenn Mama Timo ein Übungsdiktat diktiert.
Diesmal sitzt die Mama mit einem Stift in der Hand vor einem
Lückendiktat und Timo lautiert ihr die fehlenden Wörter. „Gar nicht
so einfach“, stöhnte Timos Mama, während sie Wörter wie Wissen und
Wiesen oder Hasen und hassen in die Lücken eintrug. Und auch die
anderen Eltern an den Tischen rundherum schauten angestrengt.
„Wir wollen vorstellen und auch prüfen, wie
sicher sind Sie bei Selbstlauten im Differenzieren“, erklärte
Christine Eisenhofer den Eltern den Sinn des kleinen Tests für sie.
Denn die Rechtschreibregelwochen sollen nicht nur den Kindern
helfen, sondern auch ihre Eltern noch mehr für das Thema
sensibilisieren.
Nimm die Regel mit ins Bett, nach Doppellaut steht nie
tz!
Beispiele sind: Heizung, geizig, Schnauze,
Kauz
Text und Foto: LOS Speyer, Presse
28.03.2014
Diplom-Pädagogen Manfred Selg: „Auch Du kannst Lesen und Schreiben lernen“
 Speyer-
Für großes Interesse sorgte diese Woche eine Lesung des
Diplom-Pädagogen Manfred Selg aus seinem Buch „Auch Du kannst Lesen
und Schreiben lernen“ im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer.
Speyer-
Für großes Interesse sorgte diese Woche eine Lesung des
Diplom-Pädagogen Manfred Selg aus seinem Buch „Auch Du kannst Lesen
und Schreiben lernen“ im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer.
„Wie die meisten Kinder freute ich mich auf die
Schule. Endlich war ich ein großes Schulkind und kein kleines
Kindergartenkind mehr.“ So beginnt das Buch von Selg „Auch Du
kannst Lesen und Schreiben lernen“. Und so begann auch die Lesung
im LOS.
Es ist eine eher ungewöhnliche, aber sehr spannende
Herangehensweise an das Thema Lese-Rechtschreibschwäche. Denn das
Buch erzählt den Leidensweg des Schülers Alex, der Probleme beim
Lesenlernen hat, aus der Ich-Perspektive. Es ist die Geschichte
eines Jungen, der sich wie die meisten Kinder auf die Schule freut,
anfangs auch keine großen Probleme hat. Bis zu einem Tag kurz vor
dem Ende des ersten Schuljahres. Die Lehrerin teilt einen
unbekannten Text aus, er wird nicht laut vorgelesen, die Schüler
sollen in Stillarbeit Fragen dazu beantworten. Die meisten Schüler
schaffen das problemlos. Alex nicht. Es ist der Beginn seines
Leidensweges.
Selg stammt aus dem Allgäu und ist selbst Leiter
eines Förderinstituts für lese- und rechtschreibschwache Kinder. Er
kennt also die Sorgen und Nöte von Kindern, die einfach nicht so
leicht Lesen und Schreiben lernen wie viele ihrer Mitschüler. Die
tägliche Arbeit mit solchen Kindern weckte in ihm den Wunsch, mit
einem Buch solchen Kindern eine Stimme zu geben, wie er
erzählt.
Kindern wie Alex. Der übt nach dem Desaster Ende
der ersten Klasse die ganzen Sommerferien hindurch Lesen.
Entsprechend elanvoll startet er in das zweite Schuljahr. Doch es
wird nicht besser. Im Gegenteil: Bereits beim ersten
Leseverständnistest hängt er weiter hinter dem Klassendurchschnitt
zurück. Die Lehrerin empfiehlt Alex, mehr zu üben. Aber der übt ja
schon die ganze Zeit und wird zunehmend frustrierter.
So geht es Woche für Woche, Monat für Monat,
Schuljahr für Schuljahr. Bis seine Eltern die Initiative ergreifen
und Alex in der vierten Klasse mit einer Förderung beginnt. Es ist
die letzte Chance, um die Weiterführende Schule zu erreichen, auf
die er es schaffen will. Denn in den anderen Fächern ist er richtig
gut. Und langsam kommen Erfolge. Erst in der Förderung. Dann in der
Schule.
„Klar. Eine intensive Förderung kostet Zeit, die
von der Freizeit abgeht. Aber oftmals ist es der letzte Ausweg, den
Kindern zu helfen“, sagt Selg. Man merkt ihm während der Lesung an,
wie tief er in dem Thema drin ist, wie locker und doch ernsthaft er
darüber mit den Zuhörern plaudert, wie gekonnt er ihre Fragen
beantworten kann. Und das sind viele, schließlich ist Alex beileibe
kein Einzelfall.
Natürlich erzählt das Buch vor allem die Geschichte
aus der Perspektive eines betroffenen Kindes. Aber es hilft auch,
so versichert Selg, besorgten Eltern ihre Ängste und Zweifel zu
nehmen, soll ihnen eine Entscheidungshilfe bei der Frage sein, wie
sie ihrem Kind bei Lese- und Rechtschreibproblemen helfen können.
Im letzten Kapitel des Buches kommt etwa die Mutter von Alex zu
Wort.
Ende der vierten Klasse wird es für Alex dann
richtig spannend. Schließlich will er es auf die Realschule
schaffen. Und er schafft es auch. Aber er hat Angst, dort zu
versagen. Doch die Angst ist unbegründet. Er hat zwar anfangs ein
paar Probleme, stabilisiert sich aber im Laufe des fünften
Schuljahres. Ende der sechsten Klasse hat er sogar eine zwei in
Deutsch im Zeugnis stehen. www.LOS-Speyer.de Text und
Foto: LOS
Selg, Manfred (2013): „Auch Du kannst Lesen und
Schreiben lernen“.
Ein LRS-Ratgeber aus der Sicht eines
Kindes.
Aachen: Shaker Media. ISBN:
978-3-95631-032-4
04.02.2014
Sprachkompetenz wird immer wichtiger
 Für die schulische und berufliche Entwicklung von
Heranwachsenden wird die Sprachkompetenz immer wichtiger, nicht nur
in der Muttersprache, sondern auch in der Fremdsprache. Vor allem
Kindern, die schon in Deutsch Probleme haben, drohen diese auch in
Englisch.
Für die schulische und berufliche Entwicklung von
Heranwachsenden wird die Sprachkompetenz immer wichtiger, nicht nur
in der Muttersprache, sondern auch in der Fremdsprache. Vor allem
Kindern, die schon in Deutsch Probleme haben, drohen diese auch in
Englisch.
Speyer- „Pi-pl“ diktiert die
Englisch-Lehrerin. „Pi-pl“ hört auch Joshua, Sechstklässler eines
Gymnasiums. Doch wie nun schreiben? Vorne ein p, klar. Aber dann.
Ein i, ein e? Joshua hat Probleme in Englisch - vor allem beim
Verstehen des Gehörten und der Umsetzung des Gehörten in
geschriebene Wörter.
Doch Joshua hat nicht nur Probleme in Englisch.
Sondern auch in Deutsch. Und in seiner Muttersprache mangelt es ihm
wie in seiner ersten gewählten Fremdsprache nicht nur an der
Umsetzung des Gehörten in ein Schriftbild, sondern auch am Erlernen
und Verstehen der inhaltlichen Bedeutung von Wörtern, der
Aussprache oder an der richtigen Nutzung seiner grammatikalischen
Kenntnisse.
Joshua ist kein Einzelfall. So wie dem 11-Jährigen
ergeht es vielen Kindern hierzulande. Denn bei fast allen Kindern,
die Probleme beim Fremdsprachen-Erlernen haben, waren zuvor auch
schon Probleme beim Lesen und Schreiben der Muttersprache zu
beobachten.
Doch wie kann man solchen Kindern helfen? Der
Einstieg in eine Fremdsprache sollte langsam und schrittweise
erfolgen, schließlich fällt den Schülern das Erlernen ja besonders
schwer. Eine professionelle Unterstützung neben dem schulischen
Unterricht ist dabei zumeist sinnvoll und vonnöten, denn nur das
Nachkauen des schulischen Unterrichtsstoffes hilft solchen Kindern
zumeist nicht. Stattdessen benötigen sie spezifische
Förder-Programme, um ihre Rückstände aufzuholen.
Das Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer/Wiesloch/Schwetzingen bietet neben dem
bewährten Förderkonzept in Deutsch auch eine wissenschaftlich
fundierte Englischförderung an. Die spezielle Englischförderung im
LOS gibt den Kindern ein Gerüst aus Strategien und Wissen, das es
ihnen ermöglicht, Englisch trotz ihrer besonderen Schwierigkeiten
erfolgreich zu lernen und die Anforderungen der Schule zu meistern.
Denn Englisch sicher zu beherrschen, ist immer häufiger auch eine
Grundvoraussetzung für den (beruflichen) Erfolg. Auch für
Joshua.
LOS - Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz, Presse
14.05.2013
Auch das LOS in Speyer hat sich am UNESCO-Welttag des Buches beteiligt
 Speyer- In
diversen Unterrichtsgruppen standen Bücher und das Thema Lesen
im Vordergrund, u.a. bekam eine Gruppe in einer Höhle
vorgelesen.
Speyer- In
diversen Unterrichtsgruppen standen Bücher und das Thema Lesen
im Vordergrund, u.a. bekam eine Gruppe in einer Höhle
vorgelesen.
Es ist dunkel in der Höhle. Stockdunkel. Taschenlampen leuchten
auf. Eine, zwei, drei. Die Kinder lauschen gebannt, wirken
aufgeregt. Und lauschen gebannt der Geschichte, die sie vorgelesen
bekommen. Was auf den ersten Blick wie eine Abenteuerreise der
Kinder anmutet, ist in Wahrheit eine Unterrichtsstunde am Welttag
des Buches (23. April 2013) im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) in Speyer. Der Unterrichtsraum wurde flugs
abgedunkelt, die Tische zusammengeschoben und mit einem Laken
überhängt, ein paar Äste dazugelegt und schon ähnelte dieser
plötzlich einer richtigen Höhle.
Und damit passte das Ambiente wunderbar zum Titel des
diesjährigen Welttagsbuch namens „Der Wald der Abenteuer“. In dem
Kurzroman von Jürgen Banscherus sondern sich zwei Schüler auf einer
Nachtwanderung von dem Rest ihrer Schulklasse ab - und erleben in
einem dunklen Wald mehrere Abenteuer.
Am Welttag des Buches, feiern deutschlandweit Buchhandlungen,
Verlage, Bibliotheken, Schulen und Lesebegeisterte ein großes
Lesefest. Bereits zum 17. Mal erhalten rund um diesen Tag über
700.000 Schülerinnen und Schüler das Welttagsbuch „Ich schenk dir
eine Geschichte“. Den UNESCO-Welttag des Buches gibt es seit
1995.
In der selbstgebauten Höhle im LOS sitzen sieben Kinder und
lauschen gebannt der Geschichte, leuchten ihrer Lehrerin mit der
Taschenlampe, die ihnen die Geschichte vorliest. Zwischendurch
dürfen die Kinder Fragen stellen oder raten, wie die Geschichte
denn weitergehen könnte. Das Ende, das bekommen sie aber nicht
verraten. Schließlich soll der Welttag des Buches Kinder zum Lesen
anregen. Auch Kinder, die sich beim Lesen noch nicht so sicher
fühlen.
In weiteren LOS-Gruppen stellten die Schüler am Welttag des
Buches beispielsweise den anderen Kindern ihre Lieblingsbücher vor,
bekamen von LOS-Pädagogen vorgelesen oder genossen zusammen mit
ihren Müttern eine ganz originelle Unterrichtsstunde – die ganz
unter dem Motto Lesen stand.
Am Ende ihrer besonderen Unterrichtsstunde bekamen alle
LOS-Schüler noch ein von den Pädagogen selbstgebasteltes Buch
geschenkt.
www.LOS-Speyer.de LOS -
Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz, Presse
25.04.2013
Was hilft in der Lese- und Rechtschreibförderung?
 Fragen an Prof.
Dr. Matthias Grünke, Universität Köln
Fragen an Prof.
Dr. Matthias Grünke, Universität Köln
Herr Prof. Grünke, wodurch zeichnen sich gute
Lerner aus?
Grünke: Laut dem „Good Strategy
User Model“ lernt man dann gut, wenn man über effektive
Lernstrategien verfügt, diese zielgerichtet einsetzt sowie viele
Fertigkeiten, wie etwa die Verwendung von Rechtschreibregeln,
beherrscht. Und wenn man in der Lage ist, seine Aufmerksamkeit über
längere Zeit einer bestimmten Sache zuzuwenden.
Viele Kinder haben keine Probleme, Lesen und
Schreiben zu lernen. Andere jedoch schon. Woran liegt das?
Grünke: Die Ursachen können
vielfältig sein. Manche Kinder tun sich hier von Grund auf schwerer
als andere. Manchmal kommt dazu, dass einige Mädchen und Jungen in
ihrer Vorschulzeit zu selten die Gelegenheit hatten, ihren Eltern
beim Vorlesen zuzuhören. Auch zu viel Zeit vor dem Fernseher oder
dem Computer kann die Entwicklung negativ beeinflussen.
Wie kann es zu solchen Unterschieden kommen?
Immerhin haben alle Kinder das gleiche Unterrichtsangebot …
Grünke: Würden alle Kinder
einem Leichtathletikverein beitreten und dort regelmäßig die
gleichen Trainingsangebote erhalten, wären sie deswegen im Hinblick
auf ihre Weitsprung-, Sprint- oder Speerwurfleistungen auch nicht
gleich gut. Das besondere Problem beim Sprachunterricht ist, dass
es Kinder ohne ausreichende Lese- und Rechtschreibkompetenzen auf
Dauer sehr schwer haben werden. Deswegen ist es wichtig, gerade
solche Mädchen und Jungen wirksam zu unterstützen, die sich hier in
auffallender Weise schwer tun. Mit den richtigen Angeboten könnte
man viel erreichen.
Sie haben verschiedene Fördermethoden, die
Kindern mit Lese- und Rechtschreibproblemen helfen sollen,
miteinander verglichen. Dabei sind Sie zu überraschenden
Ergebnissen gekommen …
Grünke: Überraschend sind die
Ergebnisse eigentlich nicht. Wenn ich einem Kind zeige, wie es eine
Geige halten soll, mit ihm einfache Fingerübungen durchführe,
Fehler unmittelbar korrigiere, es nicht überfordere, den Anspruch
langsam erhöhe und es für alle Fortschritte ausgiebig lobe, werde
ich als Lehrer natürlich erfolgreicher sein, als wenn ich das Kind
seinen „eigenen Weg“ entdecken lasse.
Das wird allerdings nicht überall so
gehandhabt.
Grünke: Viele Schulen arbeiten
nach sehr offenen Methoden und vermeiden in den ersten beiden
Jahren direkte Rückmeldungen, um die Mädchen und Jungen nicht zu
entmutigen. Einschlägige Studien zeigen, dass sich der Anteil der
Kinder mit Lese-Rechtschreibstörungen im Laufe der Jahre dadurch
vervielfacht. Überraschend ist das nicht. Wir wissen aus unserer
Alltagserfahrung, wie schwer es ist, eine falsche Information aus
unserem Kopf herauszukriegen. Haben wir auf einer Party einmal die
Namen von Paul und Georg verwechselt, kommen wir vermutlich auch in
Zukunft immer wieder ins Grübeln, wenn wir einen der beiden
treffen. Besser ist es, Dinge von Beginn an unter kompetenter
Anleitung richtig zu lernen, anstatt sich später mühsam umgewöhnen
zu müssen. Das gilt für den Sprachunterricht genauso wie für viele
andere Lebensbereiche.
Warum schneiden gerade die beliebten Methoden
so schlecht ab?
Grünke: Ich würde der Aussage
nur bedingt zustimmen, dass beliebte Methoden schlecht abschneiden.
Viele Kinder fühlen sich sehr motiviert, wenn jemand da ist, der
ihnen ganz konkret etwas beibringt, sie mit lösbaren Aufgaben
konfrontiert und ihnen viele Erfolgserlebnisse ermöglicht. Auch
intensive Wiederholungen werden von den meisten Mädchen und Jungen
im Grundschulalter unter diesen Umständen nicht abgelehnt – im
Gegenteil. Außerdem wollen Kinder normalerweise sogar eine
Rückmeldung im Hinblick darauf, ob sie etwas richtig oder falsch
gemacht haben. Selbst viele Lehrkräfte freuen sich meiner Erfahrung
nach, wenn sie auch einmal in den Lernprozess eingreifen und ihren
Schülern etwas direkt vermitteln dürfen.
Dieser Lernprozess entspricht jedoch nicht
der derzeitigen Modewelle.
Grünke: Von Seiten der
Schulpolitik ist ein solches lehrkraftzentriertes Vorgehen nicht
angebracht. Stattdessen soll alles handlungsorientiert erschlossen
und selbst entdeckt werden. Das klappt bei den meisten Kindern
auch. Sie lernen trotz (nicht wegen) der Methode des Lehrers und
nehmen von einem solchen Vorgehen keinen Schaden. Bei den weniger
begabten ist das anders. Sie sind darauf angewiesen, dass ihnen
jemand mit fundierten Lernmethoden unter die Arme greift. Die stark
konstruktivistisch ausgerichteten Ansätze schneiden bei diesen
Kindern deswegen so schlecht ab, weil sie mit grundlegenden
Lernprinzipien in vielerlei Hinsicht ganz krass im Widerspruch
stehen.
Das heißt, viele Nachhilfeeinrichtungen
benutzen falsche Ansätze, beim Versuch, den Kindern zu
helfen?
Grünke: Ja. Nicht jeder Ansatz
ist gleich sinnvoll. Manche Methoden schaden mehr als sie
nutzen.
Wie sollte Ihrer Meinung nach ein
Förderkonzept aussehen, das Schülern mit einer Lese- und/oder
Rechtschreibschwäche helfen kann?
Grünke: Die Basis an
Forschungsbefunden ist sehr breit und stabil. Ein Wiederholen des
Stoffes ist bei solchen Konzepten zentral. Dies ist keine Frage des
persönlichen Ermessens. Genauso wenig ist es Ansichtssache, ob man
beim Bau einer Brücke die Regeln der Statik beachten sollte oder
nicht – auch wenn Menschen ungleich komplexer sind als Gebäude.
Und welche Förderansätze müsste dieses
berücksichtigen?
Grünke: Es sind solche Ansätze
am effektivsten, bei denen die relevanten Kompetenzen explizit
vermittelt, die Hilfestellungen systematisch aufeinander aufgebaut,
ausgiebige einschleifende Übungen angeboten, Fehler unmittelbar
korrigiert und Fortschritte sehr häufig erfasst werden.
 Die Fragen
stellte Dr. Gerd Eisenhofer, Leiter des LOS
Speyer-Schwetzingen-Wiesloch.
Die Fragen
stellte Dr. Gerd Eisenhofer, Leiter des LOS
Speyer-Schwetzingen-Wiesloch.
Das LOS veranstaltet am Donnerstag, dem
28.02.2013 um 15.30 Uhr ein Symposium mit zum Thema „Wirksame
Methoden in der Lese- und Rechtschreibförderung“. Veranstaltungsort
ist das Palatin Kongresshotel in Wiesloch. Nähere Informationen
unter www.LOS-Speyer.de
oder beim LOS Speyer (06232/291603).
15.02.2013
Schlechte Lernleistungen in Deutsch, Englisch und Mathe
 Warum Eltern bei
schlechten Zeugnissen mit Schimpfen nichts erreichen
Warum Eltern bei
schlechten Zeugnissen mit Schimpfen nichts erreichen
Von Christine Eisenhofer
Wenige Wochen nach Weihnachten, dem Fest der
Liebe und Harmonie, schlägt in vielen Familien die Stimmung oftmals
in das andere Extrem um: Ärger, Stress und dicke Luft. Denn nicht
der Nikolaus, sondern die Zeugnisvergabe steht dann plötzlich vor
der Tür. Und fallen Noten - oder bei den jüngeren Schülern
Beurteilungen - nicht so positiv aus wie erwartet, ist der erste
Impuls vieler Eltern: Schimpfen, verbieten und die gerade erst
verschenkten Spielsachen wieder wegsperren.
Das Kind unter Druck zu setzen ist jedoch keine
Lösung. Denn das Problem wird dadurch nicht behoben, sondern
verschärft. Die richtige Reaktion kann daher nur sein, das Kind zu
trösten, es aufzumuntern und gemeinsam mit ihm nach einer Lösung zu
suchen. Zunächst gilt es nämlich, die Ursachen für die schlechten
Lernleistungen zu finden. Hier wird allzu oft eine
Konzentrationsschwäche genannt. Doch ist Konzentrationsmangel
wirklich der Hauptgrund für schlechte Schulleistungen? Und was ist
eigentlich Konzentration?
Konzentration ist die Fähigkeit, seine
Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Sache zu richten und alles
Unwichtige auszublenden - sagt die Wissenschaft. Ich erlebe in
meiner täglichen Arbeit viele Kinder, die sich in der Schule nur
schwer konzentrieren können, aber sich gründlich und vertieft einer
Sache widmen, die ihnen Spaß macht, beispielsweise die Arbeit mit
ihrem Technikbaukasten. Demzufolge leiden diese Kinder
(glücklicherweise) nicht an einer Konzentrationsstörung.
Aber warum tun sich diese Kinder dann so schwer,
die Aufmerksamkeit auf schulische Leistungen zu übertragen? Hinter
der angeblichen Faulheit stecken oft ganz andere Probleme. Manchmal
spielen seelische und emotionale Fähigkeiten eine Rolle. Manchmal
ist es auch einfach der falsche Schultyp, den die Kinder besuchen.
Und manchmal hapert es einfach beim Lesen und Schreiben. Dann kann
das Vorlesen, Verstehen oder Verfassen eines Textes zur fast
unlösbaren Aufgabe werden. Das Kind konzentriert sich erfolglos -
und gibt schließlich erschöpft auf.
Doch wie kann dann erfolgreiches Lernen
aussehen? Erstens sollte jede Form der Ablenkung beim Lernen
vermieden werden - weil das Arbeitsgedächtnis nur eine bestimmte
Kapazität umfasst und die Aufmerksamkeitsspanne eines Schülers
zeitlich begrenzt ist. Zweitens wird auch die Bedeutung von
ausreichendem Schlaf häufig unterschätzt. Müdigkeit ist einer der
Hauptfaktoren für mangelnde Konzentration. Drittens sollte man
feste Lernrituale einführen, Prüfungssituationen zur Reduzierung
der Angst vor Arbeiten und Tests simulieren und eine positive
Lernatmosphäre schaffen.
Berücksichtigt man diese Ratschläge, dann
versteht der Schüler vielleicht zum ersten Mal: Er muss üben. Und
vor allem üben wollen. Das braucht Zeit, Geduld und fachliche
Begleitung – auch außerhalb der Schule.
Christine Eisenhofer ist Leiterin des LOS
Speyer (www.LOS-Speyer.de)
24.01.2013
„Beste Grundlage gegen Zeugnisangst!“
Im LOS helfen individuelle Zielvereinbarungen,
langfristig gute Noten zu erreichen
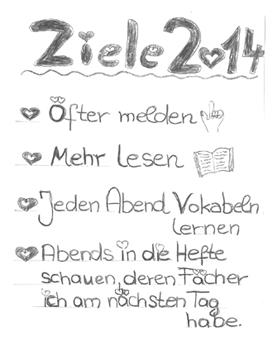 Speyer- Wenn es
auf die Zeugnisse zugeht, greift oftmals die große Enttäuschung um
sich. Bei denjenigen Kindern, die nun ihre in diesem Schuljahr
bislang nicht so guten Leistungen schwarz auf weiß in wenigen
Zeilen zusammengefasst sehen. Und ihren Eltern, die enttäuscht von
den schlechten Leistungen ihrer Kinder sind. Das dann meist eh
schon angekratzte Selbstvertrauen der Kinder wird durch das
Schimpfen der Eltern zusätzlich angegriffen.
Speyer- Wenn es
auf die Zeugnisse zugeht, greift oftmals die große Enttäuschung um
sich. Bei denjenigen Kindern, die nun ihre in diesem Schuljahr
bislang nicht so guten Leistungen schwarz auf weiß in wenigen
Zeilen zusammengefasst sehen. Und ihren Eltern, die enttäuscht von
den schlechten Leistungen ihrer Kinder sind. Das dann meist eh
schon angekratzte Selbstvertrauen der Kinder wird durch das
Schimpfen der Eltern zusätzlich angegriffen.
Schimpfen ist also ein Weg, der meistens zu
nichts führt – außer vielleicht in eine Sackgasse. Viel wichtiger
ist es daher, die Kinder aufzubauen, sie zu ermuntern, weiter zu
machen, an sich zu glauben. Beispielsweise, in dem man neue
Zielsetzungen mit den Kindern erarbeitet. Zielsetzungen, die diese
auch erreichen können. Zielsetzungen, die sie Schritt für Schritt
zu neuem Selbstvertrauen und dann auch zu besseren Noten
führen.
Wir im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) arbeiten mit solchen Zielsetzungen, die die
Kinder regelmäßig erarbeiten, wie sie auch auf dem Bild sehen
können. Dazu Jana: „Meine Deutschnote ist natürlich immer noch
nicht so, wie ich sie mir wünsche. Es ist einfach blöd, dass meine
Rechtschreibprobleme auch bei Aufsätzen und manchmal auch in den
Nebenfächern zu Punktabzug führen. Aber ich bin schon besser
geworden! Ich fühle mich gut, wenn Frau Eisenhofer mir aufzeigt,
dass ich wieder eine kleinere Etappe auf meinem Weg geschafft habe.
Ich weiß, dass ich schon einiges kann, ich weiß aber auch, was ich
noch lernen muss.“
Und Frau Eisenhofer, Leiterin des LOS Speyer,
fügt hinzu: „Wichtig ist das Erarbeiten von Zielen auch, um den
Kindern zu zeigen, was sie schon erreicht haben und deutlich zu
machen, was sie, Schritt für Schritt, noch erreichen können - und
auch müssen. Eine Voraussetzung dafür ist aber, dass die Eltern
erkennen, dass sie ihre Kinder stärken und unterstützen
sollten.“
Die LOS bietet eine gezielte pädagogische
Förderung bei Problemen im Lesen und Schreiben. www.LOS-Speyer.de
LOS Speyer, Presse
27.01.2014
Heute ist UNESCO-Tag der Muttersprache
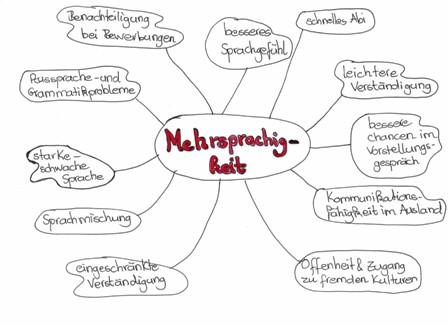 Auch das LOS
in Speyer hat sich mit einer Aktion an dem Tag
beteiligt.
Auch das LOS
in Speyer hat sich mit einer Aktion an dem Tag
beteiligt.
Speyer- Der UNESCO-Tag der Muttersprache findet
jährlich am 21. Februar statt. Ziel ist es darauf hinzuweisen, dass
Kriege, Vertreibung oder Stigmatisierung dazu führen können, dass
Sprachen für immer verschwinden - wie auch der Einfluss großer
Sprachgruppen, wie zum Beispiel Englisch. Laut der UNESCO ist rund
die Hälfte der weltweit rund 6000 Sprachen vom Aussterben
bedroht.
Trotz des Verschwindens von Sprachen wachsen mehr und mehr
Kinder zweisprachig auf. Sie haben damit die einmalige Chance, ihr
Leben lang zwei Sprachen perfekt zu sprechen – damit haben sie
vielen Menschen etwas voraus. Zweisprachigkeit kann allerdings auch
zu Problemen führen, etwa wenn Eltern von Migranten mit ihren
Kindern Deutsch sprechen, obwohl sie die Sprache nur rudimentär
beherrschen. Forscher empfehlen in diesem Fall, dass Eltern mit
ihren Kindern nur in der Muttersprache sprechen sollten. Die andere
Sprache lernen die Kinder dann im Kindergarten oder in der Schule –
gegebenenfalls mit Hilfe einer Förderung. Die schwierigste Phase
ist die Schulzeit. Kinder entwickeln dann oft eine starke und eine
schwache Sprache.
Neben den Schulen, die mit zweisprachig aufwachsenden Kindern
konfrontiert sind, werden auch im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer zahlreiche Kinder gefördert, die einen
mehrsprachigen Hintergrund haben. Diese Förderung ist notwendig,
weil es zwar einerseits gut ist, wenn sie die Sprache ihrer Eltern
nicht verlernen, andererseits aber Deutsch als Bildungschance
nutzen sollen und müssen – wenn sie sich in Deutschland beruflich
engagieren und gesellschaftlich integrieren wollen.
Das LOS Speyer hat am Tag der Muttersprache mit einer Gruppe von
Kindern – unter ihnen welche mit einer, und welche mit zwei
Muttersprachen – Mindmaps zum Thema Mehrsprachigkeit erstellt.
Dabei kamen sehr interessante Ergebnisse heraus: Kinder, die nur
eine Muttersprache haben, fanden, dass „Mehrsprachler“ vor allem
Aussprache- und Grammatikprobleme haben und mit Sprachmischungen zu
kämpfen haben. Kinder, die selbst zwei Muttersprachen haben,
stellten bei sich ähnliche Probleme fest. Als Vorteil von zwei
Muttersprachen schrieben die Kinder in ihre Mindmaps – unabhängig
davon, wieviele Muttersprachen sie sprechen -, dass Kinder mit
mehreren Muttersprachen Vorteile bei der Jobsuche und bei der
Berufswahl haben. Dr. Gerd Eisenhofer
21.02.2013
"Der Froschkönig" in Wort und Bild - LOS beim bundesweiten Vorlesetag mit Erfolg dabei
 „In den alten
Zeiten, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die
jüngste war so schön, dass …“ Weiter kam der Vorleser erstmal
nicht, schon rief der kleine Lukas: „Der Froschkönig.“ Er hatte das
Märchen der Gebrüder Grimm als Erster erkannt. Gebannt hingen er
und die anderen Kinder an den Lippen des Erzählers, der nicht nur
mit seiner Stimme das Märchen vortrug, sondern auch unter dem
Einsatz von Gestik und Mimik - und die Kinder damit in seinen Bann
zog.
„In den alten
Zeiten, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die
jüngste war so schön, dass …“ Weiter kam der Vorleser erstmal
nicht, schon rief der kleine Lukas: „Der Froschkönig.“ Er hatte das
Märchen der Gebrüder Grimm als Erster erkannt. Gebannt hingen er
und die anderen Kinder an den Lippen des Erzählers, der nicht nur
mit seiner Stimme das Märchen vortrug, sondern auch unter dem
Einsatz von Gestik und Mimik - und die Kinder damit in seinen Bann
zog.
Das Lehrinstitut für Orthographie Sprachkompetenz (LOS) Speyer
hat sich am Freitag, 16. November, am Bundesweiten Vorlesetag
beteiligt. Neben dem Märchen „Der Froschkönig“ bekamen LOS-Schüler
auch aus „Gregs Tagebuch“ vorgelesen. Doch nicht etwa ein
Märchenonkel oder eine Märchentante hatte im LOS vorbeigeschaut.
Vielmehr lasen die etwas älteren Kinder den jüngeren Schülern vor.
„Es ist sehr motivierend für die kleineren Kinder, wenn sie sehen,
was die älteren Schüler durch regelmäßiges Üben geschafft haben“,
erklärt Christine Eisenhofer, Leiterin des LOS, den Ansatz.
 Schon in den
vergangenen Jahren hatte das LOS am Bundesweiten Vorlesetag
teilgenommen. Beispielsweise besuchten einige Schüler das
Seniorenzentrum Storchenpark in Speyer und lasen dort historische
Geschichten vor und lauschten den Erzählungen der Senioren aus
dieser Zeit. Beispielsweise wurde ein Lesespektakel veranstaltet,
bei dem die Kinder ihren Eltern Geschichten vorlasen.
Beispielsweise haben LOS-Schüler Kindergartenkindern vorgelesen.
Der Bundesweite Vorlesetag soll die Lust und die Motivation von
Kindern am Lesen fördern. „Es ist vor allem wichtig, dass ganz
junge Schüler nicht die Lust am Lesen verlieren“, sagt Christine
Eisenhofer, Leiterin des LOS.
Schon in den
vergangenen Jahren hatte das LOS am Bundesweiten Vorlesetag
teilgenommen. Beispielsweise besuchten einige Schüler das
Seniorenzentrum Storchenpark in Speyer und lasen dort historische
Geschichten vor und lauschten den Erzählungen der Senioren aus
dieser Zeit. Beispielsweise wurde ein Lesespektakel veranstaltet,
bei dem die Kinder ihren Eltern Geschichten vorlasen.
Beispielsweise haben LOS-Schüler Kindergartenkindern vorgelesen.
Der Bundesweite Vorlesetag soll die Lust und die Motivation von
Kindern am Lesen fördern. „Es ist vor allem wichtig, dass ganz
junge Schüler nicht die Lust am Lesen verlieren“, sagt Christine
Eisenhofer, Leiterin des LOS.
Die Schüler, die dem Märchen „Der Froschkönig“ lauschten, waren
jedenfalls mit Feuereifer bei der Sache. Sie durften nämlich
anschließend noch ihre Version des Froschkönigs zu Papier bringen –
wenn auch eher als Nachwuchs-Picassos denn als kleine Brüder
Grimm.
LOS - Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz,
Presse www.LOS-Speyer.de
16.11.2012
Am Freitag, 20. September, war Weltkindertag
.jpg) Ein Tag, der
weltweit den Kindern gewidmet ist – so auch im LOS
Speyer
Ein Tag, der
weltweit den Kindern gewidmet ist – so auch im LOS
Speyer
Speyer- „Ich hab‘ die Lösung“,
ruft Marie. Sie strahlt über das ganze Gesicht. Minutenlang hat sie
über der Aufgabe gebrütet, hin und her überlegt, die Frage war ja
auch kniffelig. Doch jetzt hält sie den Zettel in die Höhe, auf dem
die Lösung steht. Zusammen mit 20 weiteren Kindern nimmt Marie an
der Lese- und Spielrallye des LOS Speyer im Rahmen des
Weltkindertags im Speyerer Konrad-Adenauer-Park teil.
Der 20. September ist jährlich der Weltkindertag.
Ein Tag, an dem rund um den Globus die Kinder im Mittelpunkt stehen
sollen. Ein Tag, unterstützt von UNICEF, an dem Aktion für Kinder
durchgeführt werden. Ein Tag, der für die Kinder da ist.
.jpg) Eben auch
für die Schüler des LOS in Speyer. Die hatten von Ihren Lehrern
einige Lese- und Kniffelaufgaben rund um die bekannte
Kinderbuchserie „Kugelblitz“ bekommen, einem Kommissar, der
kindgerecht Fälle löst, bei denen die jungen Leser mit überlegen
können. Die Aufgaben für die LOS-Schüler drehten sich um eine
Geschichte, bei der der Täter aufgrund seiner Rechtschreibfehler
überführt wird.
Eben auch
für die Schüler des LOS in Speyer. Die hatten von Ihren Lehrern
einige Lese- und Kniffelaufgaben rund um die bekannte
Kinderbuchserie „Kugelblitz“ bekommen, einem Kommissar, der
kindgerecht Fälle löst, bei denen die jungen Leser mit überlegen
können. Die Aufgaben für die LOS-Schüler drehten sich um eine
Geschichte, bei der der Täter aufgrund seiner Rechtschreibfehler
überführt wird.
Zum Abschluss malten die LOS-Kinder dann noch ein
Bild, wie sie sich das Leben von anderen Kindern vorstellen, die in
Ländern wohnen, wo nicht so viel für die Bildung getan wird, wie
für sie selbst in Deutschland.
Im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) stehen die Kinder natürlich nicht nur am
Weltkindertag im Mittelpunkt, sondern immer, an jedem
Unterrichtstag, in jeder Unterrichtsstunde. Schließlich soll ja
insbesondere ihre Lese- und Rechtschreibleistung verbessert werden.
Das LOS Speyer besteht seit 1999. Es unterstützt Kinder, die
Probleme beim Lesen und Schreiben haben. Text und Foto:
LOS
Weitere Informationen: www.LOS-Speyer.de
21.09.2013
Berufliche Chancen nutzen
 Wie können
junge Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche das Berufsleben
meistern?
Wie können
junge Menschen mit einer Lese-Rechtschreibschwäche das Berufsleben
meistern?
Von Dr. Gerd Eisenhofer
Gregor M., 28 Jahre, arbeitet als Werbetexter in
einer großen Werbeagentur. Nach dem Studium der Geografie schien
ihm das der richtige Einstieg ins Berufsleben. Kreativ war er ja
schon immer, schon als kleiner Junge hat er gerne Einladungen und
ähnliches entworfen. Für sich und für andere. Der Job macht ihm
Spaß, richtig Spaß. Sein Chef hat auch schon mehrfach seine
fachliche Kompetenz gelobt.
Dennoch kämpft Gregor M. mit einem großen
Problem. Einem Problem, das ihn auch bei seiner Arbeit behindert,
das dafür sorgt, dass er sich oftmals vor Kollegen schämt und das
ihm sogar den Job kosten könnte. Gregor M. hapert es schlichtweg an
den notwendigen Lese- und Rechtschreibfertigkeiten. Im Alter von 28
Jahren.
In der Schule hat er sich so durchgemogelt. In
manchen Fächern sind die Probleme nicht so aufgefallen, in anderen
konnte er sie immer irgendwie kaschieren - mal besser, mal
schlechter. Nachhilfeunterricht hat er auch besucht. Natürlich.
Über drei, vier Jahre. Bloß gebracht hat ihm dieser nicht wirklich
viel. Die Fehler wurden und wurden nicht weniger.
Die Lehrer sagten immer alle: „So dumm ist er
doch nicht.“ Damals fand er das toll, schließlich hatte er dann
irgendwann sein Abitur in der Tasche. Heute wünscht er sich
rückblickend, die Lehrer hätten damals erkannt, dass er an einer
Lese- und Rechtschreibschwäche leidet, ihm geholfen, geeignete
Fördereinrichtungen zu finden.
Dann hätte er jetzt vermutlich nicht solche
Probleme im Beruf. Zu Beginn seiner Tätigkeit hat die
Abteilungssekretärin die von ihm verfassten Texte korrigiert. Die
Fehler sind dadurch verschwunden. Allerdings hat sich das auch
schnell im Kollegenkreis herumgesprochen. Gregor M. ist das richtig
peinlich, für sein Selbstbewusstsein ist dies nicht gerade
förderlich. Dabei hat er – trotz seiner vielen Fehler beim
Schreiben - eine ausgeprägte mündliche Artikulationsfähigkeit, die
auch seinem Chef imponiert.
Er war drauf und dran, alles hinzuwerfen.
Schließlich kann er ja nicht jedem Text immer erstmal von der
Abteilungssekretärin korrigieren lassen. Angst, dass sein Chef
seine hohe Fehleranzahl mal ansprechen werde, hat er auch. Er
schämt sich, dass er solche Defizite hat – schließlich erwarten
Unternehmen ja gut qualifiziertes, mit den erforderlichen
Kompetenzen ausgestattetes, Personal
Irgendwann hat dann er dann endlich ein paar
Leute um Rat gefragt. Seine Eltern, einen Arbeitskollegen, seine
Freundin. Nun will Gregor M. die Flucht nach vorn antreten - und
eine zielgerichtete Förderung seiner unzureichenden
Rechtschreibkompetenz in Anspruch nehmen. Denn eines ist ihm klar
geworden: Es geht hier nicht darum, Spitzenleistungen zu erbringen,
sondern sich das nötige Rüstzeug für den Alltag zu verschaffen.
Dr. Gerd Eisenhofer ist Leiter des LOS Speyer (www.LOS-Speyer.de).
22.01.2013
Tag der Migranten soll zwischen den unterschiedlichen Kulturen Brücken bauen
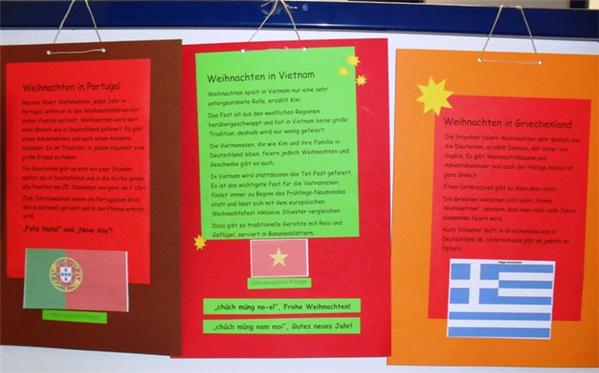
Am 18.12. fand der Internationale Tag der Migranten,
ausgerufen von der UNO, statt.
Auch das Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz (LOS)
hat sich daran in diesem Jahr beteiligt. Schüler mit
Migrationshintergrund haben ihren Mitschülern berichtet, wie
Weihnachten in ihren Herkunftsländern bzw. den Herkunftsländern
ihrer Eltern gefeiert wird, und wie es für sie und ihre Eltern ist,
in Deutschland zu leben.
Oftmals erreichen, was auch Studien bestätigen, Schüler mit
Migrationshintergrund einen schlechteren Schulabschluss, weil ihre
Eltern sie aufgrund nicht ausreichender Deutschkenntnisse nicht
ausreichend unterstützen können.
„Feliz Natal“ und „Novo Ano“!
Seine Mitschüler machen große Augen, während Martim erzählt,
dass er seine Weihnachtsgeschenke stets ein paar Stunden später
bekommt. Und am 25. Dezember immer um 7 Uhr in die Kirche gehen
muss. Martim ist Portugiese, sagt statt Frohe Weihnachten stets
„Feliz Natal“, wenn er mit seiner Familie über Weihnachten nach
Portugal in die Heimat reist. Das alles erzählte er seinen
Mitschülern im Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz
(LOS) Speyer am Tag der Migration, an dem Migrantenkindern ihren
Mitschülern berichteten, wie in ihrem jeweiligen Heimatland
Weihnachten gefeiert wird.
Und die bekamen nicht nur berichtet, wie die
Portugiesen Weihnachten feiern, sondern auch von Kim zu hören, dass
in Vietnam Weihnachten eigentlich gar keine Rolle spielt. Und
Ioannis erzählte, dass der Heilige Abend in Griechenland fast
genauso verläuft wie in Deutschland.
Der Internationale Tag der Migranten wird stets
am 18. Dezember begangen. Es ist ein Tag, der Brücken bauen soll
zwischen den unterschiedlichen Kulturen. Heterogenität von Sprache
und Kultur bedeutet sowohl ein Voneinander lernen als auch ein
Miteinander leben. Nie zuvor lebten so viele Migranten auf der Welt
wie heute. Und fast immer haben die Migranten ein Problem: die
fremde Sprache. Die Eltern von Martim beispielsweise würden ihren
Sohn gerne beim Lernen für die Schule mehr unterstützen. Sie können
es aber nur bedingt, weil ihre Deutschkenntnisse nur rudimentär
sind.
So wie Martim geht es oftmals Kindern mit
Migrationshintergrund. Sie bekommen keine Gute-Nacht-Geschichte
vorgelesen – zumindest nicht auf Deutsch, ihrer Alltagssprache. Sie
bekommen keine oder nur wenig Hilfe bei den Hausaufgaben. Manche
Eltern, wie die von Martim, Kim oder Ioannis, bieten ihren Kindern
eine zielgerichtete Unterstützung zur Verbesserung ihrer Lese- und
Schreibkompetenz. Ihr Wunsch, der nächsten Generation solle es
besser gehen, konkretisieren sie dahingehend, dass ihre Kinder
Deutsch nicht nur sprechen, sondern auch als Bildungssprache
verwenden können, was über ihren schulischen und beruflichen Erfolg
entscheidet.
Eine Studie des Mannheimer Zentrums für
Europäische Sozialforschung (MZES) aus dem Jahr 2010 bestätigt
genau dies: Türkische Grundschüler wechseln bei gleichen Leistungen
und ähnlichem sozialen Hintergrund zwar häufiger auf höhere Schulen
als ihre deutschstämmigen Alterskollegen, scheitern dann aber
aufgrund der mangelnden Unterstützung an dem Bildungsniveau der
höheren Schulen. Die Bildungseinrichtungen können die bestehenden
Defizite in Bezug auf Sprache nicht hinreichend kompensieren – sie
suchen Hilfe in privaten Einrichtungen wie dem Lehrinstitut für
Orthographie und Sprachkompetenz (LOS), das ihnen hilft, sich
angepasst ausdrücken zu lernen.
Es hat sich seit dem Pisa-Schock vor
mittlerweile elf Jahren zwar einiges gebessert, vor allem die
Sprach- und Lesekompetenz von Migranten, in der Pisa-Studie als
„Risiko-Schüler“ betitelt, ist besser geworden. Deutschland, das
sich durchaus als Zuwanderungsland bezeichnen lässt, bietet
Migranten jedoch noch immer keine Chancengleichheit: Fast 50
Prozent besuchen eine Hauptschule. Jedes zehnte Migrantenkind
verlässt die Schule ohne Abschluss – die Zahl liegt laut
Berufsbildungsbericht knapp doppelt so hoch wie bei deutschen
Schülern. Kinder wie Martim hoffen jedoch auf eine erfolgreiche
berufliche Zukunft in Deutschland. Text und Bild: LOS -
Lehrinstitut für Orthographie und Sprachkompetenz
19.12.2012






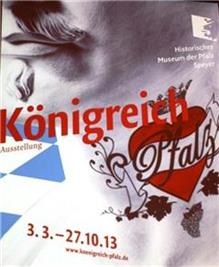



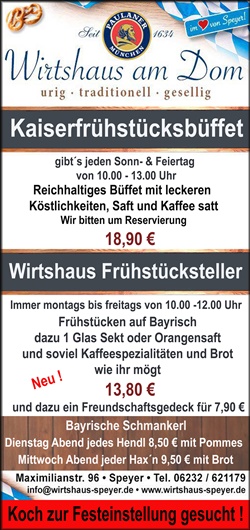
.jpg)



.png)

 Speyer-
Am 30. September fand der bundesweite Aktionstag für Legasthenie
und Dyskalkulie statt. Auch das LOS Speyer war im
Interesse der betroffenen Kinder gerne bereit, diesen Tag in den
Mittelpunkt zu rücken.
Speyer-
Am 30. September fand der bundesweite Aktionstag für Legasthenie
und Dyskalkulie statt. Auch das LOS Speyer war im
Interesse der betroffenen Kinder gerne bereit, diesen Tag in den
Mittelpunkt zu rücken.
 Von Dr. Gerd
Eisenhofer
Von Dr. Gerd
Eisenhofer Dr. Gerd
Eisenhofer ist Leiter des Lehrinstituts für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer (
Dr. Gerd
Eisenhofer ist Leiter des Lehrinstituts für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer (  Böhl-Iggelheim- Der Start nach den
Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern für Freude. Vor
allem bei denen nicht, die mit Bammel den Halbjahresinformationen
Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele Schüler und deren
Eltern fallen die Noten weniger gut aus als erhofft. Im Interview
erzählt Christine Eisenhofer, Pädagogin, Lerntherapeutin und
Leiterin des LOS Speyer, wie man mit Zweifeln umgehen und was man
nun tun sollte.
Böhl-Iggelheim- Der Start nach den
Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern für Freude. Vor
allem bei denen nicht, die mit Bammel den Halbjahresinformationen
Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele Schüler und deren
Eltern fallen die Noten weniger gut aus als erhofft. Im Interview
erzählt Christine Eisenhofer, Pädagogin, Lerntherapeutin und
Leiterin des LOS Speyer, wie man mit Zweifeln umgehen und was man
nun tun sollte. Speyer-
Der Start nach den Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern
für Freude. Vor allem bei denen nicht, die mit Bammel den
Halbjahresinformationen Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele
Schüler und deren Eltern fallen die Noten weniger gut aus als
erhofft.
Speyer-
Der Start nach den Weihnachtsferien sorgt nicht bei allen Schülern
für Freude. Vor allem bei denen nicht, die mit Bammel den
Halbjahresinformationen Ende Januar entgegenblicken. Denn für viele
Schüler und deren Eltern fallen die Noten weniger gut aus als
erhofft. Mit einer Lesung
und dem Besuch von zwei echten Ritter
Mit einer Lesung
und dem Besuch von zwei echten Ritter LOS wieder beim
Welttag des Buches mit dabei
LOS wieder beim
Welttag des Buches mit dabei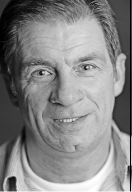 Wie
Lehrkräften gut geführter Unterricht gelingen kann
Wie
Lehrkräften gut geführter Unterricht gelingen kann Von
Christine Eisenhofer
Von
Christine Eisenhofer Hilfreich
ist es beispielsweise, lesemuffelige Kinder bei ihren Interessen zu
packen. Der feuerwehrbegeisterte Junge soll dann eben sein
Feuerwehrbuch lesen und das pferdebegeisterte Mädchen sein
Pferdebuch. Finden die Kinder das Buch spannend, lesen sie gleich
mit viel mehr Eifer. Das gilt auch für Bücher, die bei Freunden
angesagt sind.
Hilfreich
ist es beispielsweise, lesemuffelige Kinder bei ihren Interessen zu
packen. Der feuerwehrbegeisterte Junge soll dann eben sein
Feuerwehrbuch lesen und das pferdebegeisterte Mädchen sein
Pferdebuch. Finden die Kinder das Buch spannend, lesen sie gleich
mit viel mehr Eifer. Das gilt auch für Bücher, die bei Freunden
angesagt sind. Speyer- Rund 25 Schüler des LOS Speyer und ihre
Eltern haben am vergangenen Freitag einen spannenden Nachmittag
erlebt. Sie bekamen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages von
älteren LOS-Schülern vorgelesen.
Speyer- Rund 25 Schüler des LOS Speyer und ihre
Eltern haben am vergangenen Freitag einen spannenden Nachmittag
erlebt. Sie bekamen im Rahmen des Bundesweiten Vorlesetages von
älteren LOS-Schülern vorgelesen. Von Christine Eisenhofer
Von Christine Eisenhofer Wie junge Menschen
mit einer Lese-Rechtschreibschwäche ihr Bildungsziel erreichen und
ihr (Berufs-)Leben in den Griff bekommen können
Wie junge Menschen
mit einer Lese-Rechtschreibschwäche ihr Bildungsziel erreichen und
ihr (Berufs-)Leben in den Griff bekommen können Speyer- Zum Thema Eselsbrücken und Anwendungen
von Rechtschreibregeln fanden im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer vom 17. bis 29. März
Rechtschreibregelwochen statt.
Speyer- Zum Thema Eselsbrücken und Anwendungen
von Rechtschreibregeln fanden im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer vom 17. bis 29. März
Rechtschreibregelwochen statt. Speyer-
Für großes Interesse sorgte diese Woche eine Lesung des
Diplom-Pädagogen Manfred Selg aus seinem Buch „Auch Du kannst Lesen
und Schreiben lernen“ im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer.
Speyer-
Für großes Interesse sorgte diese Woche eine Lesung des
Diplom-Pädagogen Manfred Selg aus seinem Buch „Auch Du kannst Lesen
und Schreiben lernen“ im Lehrinstitut für Orthographie und
Sprachkompetenz (LOS) Speyer. Speyer- In
diversen Unterrichtsgruppen standen Bücher und das Thema Lesen
im Vordergrund, u.a. bekam eine Gruppe in einer Höhle
vorgelesen.
Speyer- In
diversen Unterrichtsgruppen standen Bücher und das Thema Lesen
im Vordergrund, u.a. bekam eine Gruppe in einer Höhle
vorgelesen. Fragen an Prof.
Dr. Matthias Grünke, Universität Köln
Fragen an Prof.
Dr. Matthias Grünke, Universität Köln Warum Eltern bei
schlechten Zeugnissen mit Schimpfen nichts erreichen
Warum Eltern bei
schlechten Zeugnissen mit Schimpfen nichts erreichen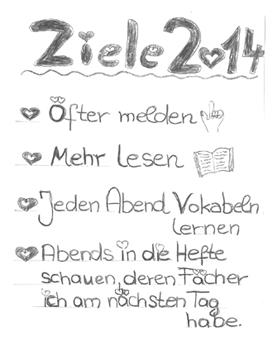 Speyer- Wenn es
auf die Zeugnisse zugeht, greift oftmals die große Enttäuschung um
sich. Bei denjenigen Kindern, die nun ihre in diesem Schuljahr
bislang nicht so guten Leistungen schwarz auf weiß in wenigen
Zeilen zusammengefasst sehen. Und ihren Eltern, die enttäuscht von
den schlechten Leistungen ihrer Kinder sind. Das dann meist eh
schon angekratzte Selbstvertrauen der Kinder wird durch das
Schimpfen der Eltern zusätzlich angegriffen.
Speyer- Wenn es
auf die Zeugnisse zugeht, greift oftmals die große Enttäuschung um
sich. Bei denjenigen Kindern, die nun ihre in diesem Schuljahr
bislang nicht so guten Leistungen schwarz auf weiß in wenigen
Zeilen zusammengefasst sehen. Und ihren Eltern, die enttäuscht von
den schlechten Leistungen ihrer Kinder sind. Das dann meist eh
schon angekratzte Selbstvertrauen der Kinder wird durch das
Schimpfen der Eltern zusätzlich angegriffen.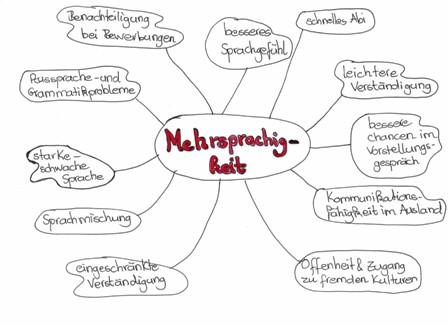 Auch das LOS
in Speyer hat sich mit einer Aktion an dem Tag
beteiligt.
Auch das LOS
in Speyer hat sich mit einer Aktion an dem Tag
beteiligt. „In den alten
Zeiten, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die
jüngste war so schön, dass …“ Weiter kam der Vorleser erstmal
nicht, schon rief der kleine Lukas: „Der Froschkönig.“ Er hatte das
Märchen der Gebrüder Grimm als Erster erkannt. Gebannt hingen er
und die anderen Kinder an den Lippen des Erzählers, der nicht nur
mit seiner Stimme das Märchen vortrug, sondern auch unter dem
Einsatz von Gestik und Mimik - und die Kinder damit in seinen Bann
zog.
„In den alten
Zeiten, lebte ein König, dessen Töchter waren alle schön; aber die
jüngste war so schön, dass …“ Weiter kam der Vorleser erstmal
nicht, schon rief der kleine Lukas: „Der Froschkönig.“ Er hatte das
Märchen der Gebrüder Grimm als Erster erkannt. Gebannt hingen er
und die anderen Kinder an den Lippen des Erzählers, der nicht nur
mit seiner Stimme das Märchen vortrug, sondern auch unter dem
Einsatz von Gestik und Mimik - und die Kinder damit in seinen Bann
zog. Schon in den
vergangenen Jahren hatte das LOS am Bundesweiten Vorlesetag
teilgenommen. Beispielsweise besuchten einige Schüler das
Seniorenzentrum Storchenpark in Speyer und lasen dort historische
Geschichten vor und lauschten den Erzählungen der Senioren aus
dieser Zeit. Beispielsweise wurde ein Lesespektakel veranstaltet,
bei dem die Kinder ihren Eltern Geschichten vorlasen.
Beispielsweise haben LOS-Schüler Kindergartenkindern vorgelesen.
Der Bundesweite Vorlesetag soll die Lust und die Motivation von
Kindern am Lesen fördern. „Es ist vor allem wichtig, dass ganz
junge Schüler nicht die Lust am Lesen verlieren“, sagt Christine
Eisenhofer, Leiterin des LOS.
Schon in den
vergangenen Jahren hatte das LOS am Bundesweiten Vorlesetag
teilgenommen. Beispielsweise besuchten einige Schüler das
Seniorenzentrum Storchenpark in Speyer und lasen dort historische
Geschichten vor und lauschten den Erzählungen der Senioren aus
dieser Zeit. Beispielsweise wurde ein Lesespektakel veranstaltet,
bei dem die Kinder ihren Eltern Geschichten vorlasen.
Beispielsweise haben LOS-Schüler Kindergartenkindern vorgelesen.
Der Bundesweite Vorlesetag soll die Lust und die Motivation von
Kindern am Lesen fördern. „Es ist vor allem wichtig, dass ganz
junge Schüler nicht die Lust am Lesen verlieren“, sagt Christine
Eisenhofer, Leiterin des LOS..jpg) Ein Tag, der
weltweit den Kindern gewidmet ist – so auch im LOS
Speyer
Ein Tag, der
weltweit den Kindern gewidmet ist – so auch im LOS
Speyer.jpg) Eben auch
für die Schüler des LOS in Speyer. Die hatten von Ihren Lehrern
einige Lese- und Kniffelaufgaben rund um die bekannte
Kinderbuchserie „Kugelblitz“ bekommen, einem Kommissar, der
kindgerecht Fälle löst, bei denen die jungen Leser mit überlegen
können. Die Aufgaben für die LOS-Schüler drehten sich um eine
Geschichte, bei der der Täter aufgrund seiner Rechtschreibfehler
überführt wird.
Eben auch
für die Schüler des LOS in Speyer. Die hatten von Ihren Lehrern
einige Lese- und Kniffelaufgaben rund um die bekannte
Kinderbuchserie „Kugelblitz“ bekommen, einem Kommissar, der
kindgerecht Fälle löst, bei denen die jungen Leser mit überlegen
können. Die Aufgaben für die LOS-Schüler drehten sich um eine
Geschichte, bei der der Täter aufgrund seiner Rechtschreibfehler
überführt wird.