Nachlass von Hanni Schoen-Knauff im Landesbibliothekszentrum Speyer
 Autograph des zweistimmigen Gesangs „An den Unendlichen“ aus Werk 17 von 1936
Autograph des zweistimmigen Gesangs „An den Unendlichen“ aus Werk 17 von 1936
Speyer- Das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz konnte im letzten Monat den musikalischen Nachlass
der Komponistin Hanni Schoen-Knauff (1905-1991) übernehmen. Da
Leben und Werk der Wahl-Pfälzerin bisher kaum erforscht sind und
ihre Werke nur in Handschriften überliefert wurden, ist es ein
Glücksfall, dass diese nun in der Pfälzischen Landesbibliothek der
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können.
Hanni Schoen-Knauff, 1905 in München geboren, studierte am
Badischen Konservatorium, der späteren Hochschule für Musik, in
Karlsruhe und arbeitete seit den 1930er Jahren in Neustadt an der
Weinstraße als Komponistin, Pianistin und Musikpädagogin. Sie
leitete dort unter anderem die Erste Arbeitsgemeinschaft für
Hausmusik (der Reichsmusikkammer unterstellt) und trat zudem als
Gauunterabteilungsleiterin für Musik- und Feiergestaltung in
Erscheinung. Ihre Werke, die vor allem Kammermusik und Lieder
umfassen und im deutschen Volkslied wurzeln, wurden in
verschiedenen Reichssendern gespielt. Nach dem Zweiten Weltkrieg
setzte Hanni Schoen-Knauff ihre musikalischen Aktivitäten
ungebrochen fort; ihre Werke wurden etwa beim Heidelberger
Musikforum uraufgeführt und erklangen im Süddeutschen Rundfunk.
Zudem hatte sie einen großen Schülerkreis, mit dem sie auch
Konzerte veranstaltete.
Trotz ihrer regionalen Bekanntheit erging es Schoen-Knauff wie
vielen ihrer Kolleginnen: Sie hat es in der allgemeinen Wahrnehmung
bis heute recht schwer. Vielleicht könnte eine
musikwissenschaftliche Aufarbeitung ihres Oeuvres diesem Umstand
Abhilfe schaffen – oder die Gründe dafür herausfinden. Mit der
Übernahme des Nachlasses in das LBZ Speyer sind zumindest dafür die
Grundlagen gelegt. Weitere Informationen und ein Verzeichnis der im
Nachlass enthaltenen Werke finden Sie auf unserer Homepage:
https://lbz.rlp.de/de/ueber-uns/besondere-bestaende/musiker-nachlaesse/nachlass-schoen-knauff/.
Text und Foto: LBZ Speyer
22.08.2016
Medienrückgabe auch während der Schließungszeiten möglich
 Medienrückgabebox vor dem Eingang des LBZ / Pfälzische Landesbibliothek
Medienrückgabebox vor dem Eingang des LBZ / Pfälzische Landesbibliothek
Speyer- Seit dem 17. Dezember 2015 im
Landesbibliothekszentrum / Pfälzische Landesbibliothek Speyer für
Benutzer eine neue Mitarbeiterin außerhalb der Öffnungszeiten zur
Verfügung: Vor dem Eingang der Bibliothek erwartet eine
Medienrückgabebox Medienrückgaben außerhalb der Öffnungszeiten.
Unter der Woche ist damit eine Medienrückgabe auch nach 18 Uhr
bis zum nächsten Morgen 9 Uhr möglich, am Samstag nach 12 Uhr bis
Montagmorgen 9 Uhr. Die Rückbuchung erfolgt am nächsten
Öffnungstag.
Von besonderem Interesse wird die Medienrückgabebox für Benutzer
sein, die vergessen haben, ihre Medien in der Bibliothek
zurückzugeben bevor sie in den Urlaub fahren.
Öffnungszeiten
Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr
Am Montag, den 4. Januar 2016 sind die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Landesbibliothek wieder zu den gewohnten
Öffnungszeiten für die Besucher da.
LBZ / Pfälzische Landesbibliothek
Otto-Mayer-Str. 9, 67346 Speyer
Tel.: 06232 9006-224, E-Mail: info.plb@lbz-rlp.de
www.lbz.rlp.de
Text und Foto: LBZ
02.01.2016
Antiquarische Erwerbung eines Boßler-Drucks im LBZ Speyer
Speyer- Im Herbst 2015 konnte das
Landesbibliothekszentrum Speyer mit großzügiger Unterstützung der
Sparkassenstiftung der ehemaligen Kreis- und Stadtsparkasse Speyer
einen Erstdruck von Justinus Heinrich Knechts (1752-1817)
„Gemeinnützliches Elementarwerk der Harmonie und des Generalbasses“
antiquarisch erwerben.
Dieses theoretische Lehrwerk, das stark durch die Harmonielehre
des am Mannheimer Hof tätigen Georg Joseph Vogler beeinflusst ist,
erschien zwischen 1792 und 1797 in vier Abteilungen, die neben dem
Text auch Notentafeln enthalten. Für den Stich der Notentafeln der
ersten drei Abteilungen zeichnet Heinrich Philipp Boßler
(1744-1812) verantwortlich, der 1780 eine überaus erfolgreiche
Notendruckerei in Speyer gründete. Nicht nur durch handwerkliches
Geschick, sondern auch durch die Verlegung von Originalbeiträgen
zahlreicher Komponisten – darunter des jungen Beethoven – machte
sich Boßler rasch einen Namen in der Musikwelt seiner Zeit.
Die Notentafeln der ersten Abteilung entstanden noch in Speyer,
bevor Boßler im Jahr 1792 nach Darmstadt übersiedelte, wo die
Tafeln der zweiten und dritten Abteilung gedruckt wurden. Für die
Noten der vierten Abteilung wandte schließlich Makarius Falter in
München ein völlig neues Verfahren, die Lithographie, an. Das
vierteilige Werk dokumentiert somit nicht nur die Speyerer
Druckkunst des ausgehenden 18. Jahrhunderts, sondern illustriert
auch die Entwicklungsgeschichte des Notendrucks. Es zeigt die
überregionale Zusammenarbeit Boßlers und stellt zugleich ein
wichtiges Stück Kulturgut der Kurpfalz dar, das die Musikbestände
des Landesbibliothekszentrums, insbesondere die bereits vorhandenen
„Bossleriana“, wunderbar ergänzt.
LBZ / Pfälzische Landesbibliothek
Otto-Mayer-Str. 9, 67346 Speyer
Tel.: 06232 9006-224, E-Mail: info.plb@lbz-rlp.de
Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr
Nach Weihnachten: 28.-30.12.2015 jeweils von 9-18 Uhr
geöffnet.
Ab 4. Januar 2016 zu den gewohnten Zeiten geöffnet.
28.12.2015
Bibliotheken in Rheinland-Pfalz heissen Flüchtlinge und Asylsuchende Willkommen
 Mitgliederversammlung
des dbv-LV am 12.10.2015 in Schifferstadt - Mitglieder heißen
Flüchtlinge in Bibliotheken willkommen
Mitgliederversammlung
des dbv-LV am 12.10.2015 in Schifferstadt - Mitglieder heißen
Flüchtlinge in Bibliotheken willkommen
Schifferstadt- „Bibliotheken spielen eine
wichtige Rolle bei der Integration von Flüchtlingen“, so Manfred
Geis, Vorsitzender des Landesverbandes Rheinland-Pfalz im Deutschen
Bibliotheksverbandes e.V. (dbv) und Vorsitzender des
Kulturausschusses im Landtag (SPD) auf der Mitgliederversammlung am
12. Oktober 2015 im Alten Rathaus in Schifferstadt. Der Erste
Beigeordnete Peter Kubina begrüßte die Anwesenden im Namen der
Bürgermeister Ilona Volk herzlich im „Schmuckstück“ der Stadt, zu
dem nur ganz besonderen Gästen der Zugang gewährt werde. Er
wünschte der Mitgliederversammlung viel Erfolg. Erfolg und
Unterstützung wünschen sich die Bibliotheken auch bei ihren
aktuellen Bemühungen, den Flüchtlingen in Deutschland als
öffentlicher Ort den freien Zugang zu allgemeiner und beruflicher
Bildung, zu Information und Kultur zu ermöglichen – ein
grundlegendes Recht aller Menschen, das vom Grundgesetz und auch
der Landesverfassung des Landes Rheinland-Pfalz geschützt wird.
Bibliotheken bieten Medien und Information zur Aus- und
Weiterbildung, Unterhaltung und Freizeitgestaltung für alle
Bevölkerungsgruppen an. Sie haben eine wichtige Funktion als Orte
der Begegnung und der Integration sowie als Lernorte. Bibliotheken
sind Teil der Willkommenskultur in Deutschland.
Es gibt bereits viele gute Beispiele von entsprechenden
Bibliotheksangeboten in Rheinland-Pfalz, wo Bibliotheken sich im
Bereich interkultureller Bibliotheksarbeit und auch in der
Zusammenarbeit mit Volkshochschulen engagiert haben: ein breites
Lernangebot „Deutsch als Fremdsprache“, mehrsprachige Bilderbücher,
fremdsprachige Medien, Bildwörterbücher, Gastgeber von
Gesprächskreisen – in diesen Bereichen haben sich Bibliotheken
bereits profiliert. In der aktuellen Situation werden zum Teil
Medienboxen in den Flüchtlingsunterkünften selbst zur Verfügung
gestellt, die in der Regel mehrsprachige Medienangebote enthalten;
der vorhandene Bestand für „Deutsch als Fremdsprache“ und
mehrsprachigen Angeboten wird aufgestockt, Willkommenskreise nutzen
die Bibliothek als Treff- und Anlaufpunkt in der Kommune. Diese
Angebote flächendeckend auszubauen bedarf es der Unterstützung auf
allen politischen und administrativen Ebenen.
Ein weiteres Thema war in Schifferstadt die Vorbereitung der
Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2016, die im kommenden Jahr vom
24.10. – 06.11.2016 stattfinden werden. Unter dem Motto
„Bibliotheken öffnen neue Welten“ soll erneut ein vielfältiges
Angebot ein breites Publikum ansprechen. Besonders wichtig sind die
zentral organisierten „Lesereisen“, die der dbv-Landesverband in
Zusammenarbeit mit dem Landesbibliothekszentrum, dem Beirat für das
öffentliche Bibliothekswesen und den Fachstellen der Bistümer allen
interessierten Bibliotheken im Land anbietet. Ausstellungen zur
Buchkunst öffnen junger Nachwuchskünstlerinnen und –künstlern Wege,
bieten aber auch arrivierten Kunstschaffenden ein Podium.
Der Deutsche Bibliotheksverband e.V. (dbv)
Im Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) sind ca. 2.100
Bibliotheken aller Sparten und Größenklassen Deutschlands
zusammengeschlossen. Der gemeinnützige Verein dient seit 65 Jahren
der Förderung des Bibliothekswesens und der Kooperation aller
Bibliotheken. Sein Anliegen ist es, die Wirkung der Bibliotheken in
Kultur und Bildung sichtbar zu machen und ihre Rolle in der
Gesellschaft zu stärken. Zu den Aufgaben des dbv gehören auch die
Förderung des Buches und des Lesens als unentbehrliche Grundlage
für Wissenschaft und Information sowie die Förderung des Einsatzes
zeitgemäßer Informationstechnologien. Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz, Presse
18.10.2015
In Erinnerung an eine der ganz „Großen“ ihrer Kunst
 Gute
Nachricht zum 90. Geburtstag von Erika Köth - Ihr künstlerischer
Nachlass bleibt dauerhaft im LBZ Speyer.
Gute
Nachricht zum 90. Geburtstag von Erika Köth - Ihr künstlerischer
Nachlass bleibt dauerhaft im LBZ Speyer.
spk. Speyer. Am 15. September.2015 würde eine
der „ganz Großen ihrer Kunst“ und eine der herausragenden
Sängerinnen ihrer Zeit, Kammersängerin Erika Köth
ihren 90. Geburtstag feiern können. Viel zu früh jedoch verstarb
die bedeutende Sopranistin mit ihrem unvergleichlich
silbrig-glänzenden Timbre bereits am 20. Februar1989 in Speyer,
jener Stadt, mit der sie sich durch ihren Mann, den
Schauspieler und Regisseur Ernst Dorn, engstens
verbunden fühlte und wo sie zahlreiche persönliche Freunde gefunden
hatte.
Bereits im Mai 2006 überließ ihre Familie den künstlerischen
Nachlass der Sängerin auf zehn Jahre der damaligen „Pfälzischen
Landesbibliothek“, dem heutigen „Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz“ (LBZ) in Speyer. Der Nachlass Erika Köths umfasst
neben viel Persönlichem vor allem umfangreiches theater- und
musikhistorisch wertvolles Bildmaterial, Pressedokumentationen zu
ihren zahllosen Bühnenerfolgen, Belege ihrer zahlreichen Ehrungen,
Korrespondenzen und Tonträger sowie Zeugnisse der großen Verehrung
von Bewunderern ihrer Kunst. Das LBZ nutzte den Nachlass für eine
große Ausstellung, die bereits anlässlich des 85. Geburtstags der
Sängerin am 15. September 2010 eröffnet wurde.
Rechtzeitig vor dem 90. Geburtstag von Erika Köth hat jetzt ihre
Familie entschieden, ihren künstlerischen Nachlass voll umfänglich
dem Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Speyer dauerhaft zu
überlassen, so dass er nun auch für die wissenschaftliche
Erschließung zur Verfügung gestellt werden kann.
 Anlässlich des runden Geburtstages von Erika Köth
präsentiert das LBZ / Pfälzische Landesbibliothek in Speyer deshalb
jetzt eine kleine Vitrinenausstellung im 1. OG im Bereich des
Zeitschriften-Lesesaals.
Anlässlich des runden Geburtstages von Erika Köth
präsentiert das LBZ / Pfälzische Landesbibliothek in Speyer deshalb
jetzt eine kleine Vitrinenausstellung im 1. OG im Bereich des
Zeitschriften-Lesesaals.
Erika Köth wurde am 15.September 1925 in Darmstadt geboren und
studierte nach den Wirren des Krieges Gesang an der Darmstädter
Akademie für Tonkunst. Ihre Bühnenlaufbahn als hoher Sopran begann
sie im Jahr 1947, nachdem sie zuvor mit der berühmten Koloraturarie
aus einer ihrer späteren Glanzpartien, der „Königin der Nacht“ aus
Mozarts „Zauberflöte“, einen Gesangswettbewerbs beim damaligen
„Radio Frankfurt“ mit über 300 Mitbewerbern für sich entschieden
hatte, am Pfalztheater in Kaiserslautern.
Dort entstanden in der Folge gemeinsam mit dem Rundfunkorchester
des damaligen Südwestfunks (heute: SWR) unter der Leitung von
Emrich Smola ihre ersten Tonaufnahmen. Aus der musikalischen
„Provinz“ in Kaiserslautern führte sie dann eine steile Karriere
über Karlsruhe nach München, Wien, Salzburg und Berlin sowie – vor
allem als umjubelte Mozart-Sängerin an der Seite von „Sängergrößen“
ihrer Zeit wie dem unvergessenen Fritz Wunderlich, wie Hermann Prey
und Gottlob Frick – mit Gastspielen in alle Welt.
Nach ihrem Abschied von der Bühne im Jahr 1978 zog Erika Köth
sich mit ihrem Ehemann, dem aus einer Speyerer
„Brezelbäcker-Dynastie“ stammenden Schauspieler und Regisseur Ernst
Dorn, nach Königsbach bei Neustadt zurück. Als Professorin an der
Mannheimer Musikhochschule gab sie ihre Erfahrungen an den
sängerischen Nachwuchs weiter und förderte Karrieren junger
Sängerinnen und Sänger auch aus Speyer mit großer Hingabe.
Schließlich trat sie auch als „Botschafterin der klassischen Musik“
in zahlreichen Fernsehsendungen auf.
Nach schwerer Krankheit verstarb die lebenslang unprätentiöse
Sängerin, die sich auch nie zu schade war, neben der „großen
Opern-, Operetten- und Liedliteratur“ auch leichte, volkstümliche
Musik meisterhaft zu musizieren, am 20. Februar 1989 in einer
Speyerer Klinik und wurde von einem ihrer in Speyer gewonnenen
Freunde, dem damaligen Speyerer Bischof Dr. Anton
Schlembach in ihrem Geburtsort Darmstadt beerdigt.
Bis heute werden ihre Interpretationen der großen Opern und
Operetten als Referenzen ihres Fachs verstanden, die aber zumeist
unerreicht bleiben. So sind es vor allem ihre noch immer Chart
„verdächtigen“ Schallplatten und CDs, die gemeinsam mit dem
alljährlich in der Landauer Jugendstil-Festhalle ausgetragenen
„Erika-Köth-Wettbewerb für Opergesang“ die Erinnerung an die große
Sängerin wachhalten.
Die höchst sehenswerte kleine Ausstellung des künstlerischen
Nachlasses von Erika Köth ist ab dem 15. September
zu sehen im
LBZ / Pfälzische Landesbibliothek
Otto-Mayer-Str. 9, 67346 Speyer
Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-12
Uhr
Foto: (Erika Köth) Horst Maack, (Schlüssel des Wissens) LBZ
Speyer, Presse
14.09.2015
In memoriam Clemens Jöckle
 Speyer und das LBZ erinnern an seinem 65. Geburtstag mit
einer Ausstellung an großen Inspirator seiner Kunst- und
Kulturszene
Speyer und das LBZ erinnern an seinem 65. Geburtstag mit
einer Ausstellung an großen Inspirator seiner Kunst- und
Kulturszene
Von Gerhard Cantzler
Speyer- Seine zahlreichen Freunde hätten
gestern den 65. Geburtstag von Clemens Jöckle
sicher nur allzu gerne mit ihm gemeinsam gefeiert. Doch ein
schwerer Hirnschlag, der den Speyerer Kunsthistoriker und
langjährigen Leiter der Städtischen Galerie im Herbst 2012 ereilte
und dessen Folgen er nach fast zweijährigem Wachkoma am 2. Juni
2014 erlag, verhinderte dies - wenige Tage nur, bevor er sein neues
Amt als Kurator der bedeutenden Ausstellung zum „Wittelsbacher
Jahr“ in der „Villa Ludwigshöhe“ antreten  konnte. Jetzt blieb ihnen allen nur noch, dem vielseitig
gebildeten Freund und hochgeschätzten Kenner der pfälzischen
Kunstszene und ihrer Vertreter im Rahmen der Eröffnung einer
dankenswerterweise von der Leiterin des Standortes Speyer des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz LBZ, Ute
Bahrs, initiierten Ausstellung zu gedenken, in der noch
bis zum 5. Juni eine Auswahl aus den 244 im Online-Katalog des
Hauses vermerkten Publikationen Jöckles sowie je ein Plakat pro
Jahr seiner mit fast 100 Ausstellungen höchst produktiven Amtszeit
als Leiter der Speyerer Städtischen Galerie gezeigt werden.
Emotionaler Höhepunkt der Schau ganz sicher aber der „leere
Arbeitsplatz“ Jöckles, den man praktischerweise aus dem Lesesaal –
fast so etwas wie der „zweiten Wohnung“ des Kunsthistorikers - in
die doch weitaus stärker frequentierte Ausleihe verlegt hat.
konnte. Jetzt blieb ihnen allen nur noch, dem vielseitig
gebildeten Freund und hochgeschätzten Kenner der pfälzischen
Kunstszene und ihrer Vertreter im Rahmen der Eröffnung einer
dankenswerterweise von der Leiterin des Standortes Speyer des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz LBZ, Ute
Bahrs, initiierten Ausstellung zu gedenken, in der noch
bis zum 5. Juni eine Auswahl aus den 244 im Online-Katalog des
Hauses vermerkten Publikationen Jöckles sowie je ein Plakat pro
Jahr seiner mit fast 100 Ausstellungen höchst produktiven Amtszeit
als Leiter der Speyerer Städtischen Galerie gezeigt werden.
Emotionaler Höhepunkt der Schau ganz sicher aber der „leere
Arbeitsplatz“ Jöckles, den man praktischerweise aus dem Lesesaal –
fast so etwas wie der „zweiten Wohnung“ des Kunsthistorikers - in
die doch weitaus stärker frequentierte Ausleihe verlegt hat.
 Wieviel Freundschaft der exzellente Kenner seiner Materie
in Speyer und weit darüber hinaus genoß, zeigte sich gestern abend
nicht zuletzt an der großen Zahl der Gäste, die der Einladung des
LBZ zu der Eröffnung gefolgt waren, an ihrer Spitze Speyers
Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Kulturbürgermeisterin
Monika Kabs und Domkapitular Peter Schappert. Wie Ute
Bahrs weiter unterstrich, habe sich die hohe Wertschätzung Jöckles
aber auch darin abgebildet, dass sich, wie bei kaum einer
vergleichbaren Gelegenheit zuvor, Menschen von der Einladung zu
dieser so ganz besonderen Geburtstagsfeier so sehr angerührt
fühlten, dass sie - soweit sie nicht selbst daran teilnehmen
konnten - sich doch zumindest ausdrücklich für ihr Fernbleiben
entschuldigt und ihr Bedauern über ihr Fehlen zum Ausdruck gebracht
hätten.
Wieviel Freundschaft der exzellente Kenner seiner Materie
in Speyer und weit darüber hinaus genoß, zeigte sich gestern abend
nicht zuletzt an der großen Zahl der Gäste, die der Einladung des
LBZ zu der Eröffnung gefolgt waren, an ihrer Spitze Speyers
Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Kulturbürgermeisterin
Monika Kabs und Domkapitular Peter Schappert. Wie Ute
Bahrs weiter unterstrich, habe sich die hohe Wertschätzung Jöckles
aber auch darin abgebildet, dass sich, wie bei kaum einer
vergleichbaren Gelegenheit zuvor, Menschen von der Einladung zu
dieser so ganz besonderen Geburtstagsfeier so sehr angerührt
fühlten, dass sie - soweit sie nicht selbst daran teilnehmen
konnten - sich doch zumindest ausdrücklich für ihr Fernbleiben
entschuldigt und ihr Bedauern über ihr Fehlen zum Ausdruck gebracht
hätten.
 „Uns 'Labi-anern' fehlt Clemens Jöckle“, stellte die
Standortleiterin in ihrer sehr persönlich gehaltenen Begrüßung
fest. Das würden alle MitarbeiterInnen des LBZ seit der
überraschenden Erkrankung Jöckles und noch mehr nach seinem allzu
frühen Tod fast tagtäglich konstatieren. „Denn er wusste zu allen
kunsthistorisch relevanten Fragen fast immer eine spontane
Antwort“, stellte Ute Bahrs fest - vor allem, wenn sich diese
Fragen um Pfälzer Künstler oder um allgemein sakrale Kunst drehten.
„Zumindest aber hatte er immer eine Idee, einen Rat bereit, wohin
man sich wenden oder wen man anrufen könnte“, stellte sie mit
Verweis auf das schon legendäre Netzwerk des Kunsthistorikers
fest.
„Uns 'Labi-anern' fehlt Clemens Jöckle“, stellte die
Standortleiterin in ihrer sehr persönlich gehaltenen Begrüßung
fest. Das würden alle MitarbeiterInnen des LBZ seit der
überraschenden Erkrankung Jöckles und noch mehr nach seinem allzu
frühen Tod fast tagtäglich konstatieren. „Denn er wusste zu allen
kunsthistorisch relevanten Fragen fast immer eine spontane
Antwort“, stellte Ute Bahrs fest - vor allem, wenn sich diese
Fragen um Pfälzer Künstler oder um allgemein sakrale Kunst drehten.
„Zumindest aber hatte er immer eine Idee, einen Rat bereit, wohin
man sich wenden oder wen man anrufen könnte“, stellte sie mit
Verweis auf das schon legendäre Netzwerk des Kunsthistorikers
fest.
Die Idee zu der jetzt eröffneten Ausstellung sei bereits am Tag
der Beerdigung Jöckles in die Welt gekommen, erinnerte Bahrs und
dankte all denen, die sich spontan dazu bereit erklärt hätten,
dieses Anliegen zu unterstützen – an ihrer Spitze Eva-Maria
Urban vom „Speyerer Kunstverein“ und dem Speyerer
Fotografen Peter Wilking. Zwei andere, die
Vorsitzende der „Arbeitsgemeinschaft Pfälzer Künstler“ apk,
Brigitte Sommer und der frühere Speyerer
Kulturdezernent Hanspeter Brohm, hatten sich sogar
bereit erklärt, Jöckle aus ihrer jeweiligen Perspektive noch einmal
lebendig werden zu lassen.
 Brigitte Sommer erinnerte sich in ihrer Würdigung
an die zahllosen „netten, humorvollen“ Begegnung mit Clemens
Jöckle. „Heute fehlt mir sehr, dass er mich morgens früh um halb
neun Uhr anruft, um mir seinen neuesten, geistreichen Witz zu
erzählen“, wies sie auf eine Facette im Charakter Jöckles hin. Der
in Wasserlos geborene Unterfranke sei schon früh durch seine Mutter
an die Künste, an Malerei, Architektur und Musik, herangeführt
worden, beschrieb Sommer Jöckle „als einen umfassend gebildeten
Menschen mit einem immensen Fach- und Allgemeinwissen“. Fast neun
Jahre lang habe er intensiv und inspirierend mit der apk
zusammengearbeitet. In dieser Zeit habe sie ihn als eine
Persönlichkeit kennengelernt, die, was ihre Kunst anging, zu
keinerlei Kompromissen bereit gewesen sei. „Sich seine Kunst
verwässern zu lassen, das war seine Sache nicht“, betonte die
Rednerin, die mit der bewegenden Feststellung schloß: „Clemens hat
in uns allen eine Spur hinterlassen, die im umfassenden Sinne
positiv in uns weiterleben wird“.
Brigitte Sommer erinnerte sich in ihrer Würdigung
an die zahllosen „netten, humorvollen“ Begegnung mit Clemens
Jöckle. „Heute fehlt mir sehr, dass er mich morgens früh um halb
neun Uhr anruft, um mir seinen neuesten, geistreichen Witz zu
erzählen“, wies sie auf eine Facette im Charakter Jöckles hin. Der
in Wasserlos geborene Unterfranke sei schon früh durch seine Mutter
an die Künste, an Malerei, Architektur und Musik, herangeführt
worden, beschrieb Sommer Jöckle „als einen umfassend gebildeten
Menschen mit einem immensen Fach- und Allgemeinwissen“. Fast neun
Jahre lang habe er intensiv und inspirierend mit der apk
zusammengearbeitet. In dieser Zeit habe sie ihn als eine
Persönlichkeit kennengelernt, die, was ihre Kunst anging, zu
keinerlei Kompromissen bereit gewesen sei. „Sich seine Kunst
verwässern zu lassen, das war seine Sache nicht“, betonte die
Rednerin, die mit der bewegenden Feststellung schloß: „Clemens hat
in uns allen eine Spur hinterlassen, die im umfassenden Sinne
positiv in uns weiterleben wird“.
 Auch der langjährige Speyerer Bürgermeister
Hanspeter Brohm kennzeichnete Jöckle als einen
„Privatgelehrten im besten klassischen Sinne“. Als „streitbarer
Mensch“ habe er nie einen Konflikt gescheut und nach dem „Aufbruch
in der Speyerer Kunst- und Kulturszene“ in den 1970er und 80er
Jahren unter Dr. Wolfgang Eger als Kulturdezernent
der Stadt, gemeinsam mit Rudolf Dister u.a. das Projekt einer
Städtischen Galerie vom ersten Tag an maßgeblich mit vorangebracht.
„Als ehrenamtlicher Leiter dieser neuen Galerie hat Jöckle diese
Aufgabe von Anfang an als seinen Hauptberuf verstanden und ihn wie
einen Hauptberuf ausgefüllt, ohne nach einer adäquaten Entlohnung
zu fragen“, stellte der ehemalige Kulturbürgermeister heraus. „Er
wollte einfach etwas bewegen in der Kunst unserer Stadt, die ihm
zur Heimat geworden war“. Seine zahllosen Reden und Referate zu
Ausstellungseröffnungen sowie zu speziellen, einzelnen
kunstgeschichtlichen Themen seien ebenso legendär gewesen, wie sein
spontan abrufbares Wissen über Kunstschaffende früherer wie
zeitgenössischer Epochen. „Nicht nur einmal mussten wir aufpassen,
dass er uns mit seiner tief in wissenschaftliche Details gehenden
Expertensprache nicht überforderte“, gestand Brohm, der auch daran
erinnerte, dass Jöckle bis zu seiner schweren Erkrankung der
„Motor“ des KV, des „Kartellverbandes Katholischer
Studentenverbindungen“ in der Pfalz gewesen sei, wo er gleichfalls
mit seinen Vorträgen glänzte und für den er unvergessene
Studienreisen organisiert und wissenschaftlich begleitet habe.
Auch der langjährige Speyerer Bürgermeister
Hanspeter Brohm kennzeichnete Jöckle als einen
„Privatgelehrten im besten klassischen Sinne“. Als „streitbarer
Mensch“ habe er nie einen Konflikt gescheut und nach dem „Aufbruch
in der Speyerer Kunst- und Kulturszene“ in den 1970er und 80er
Jahren unter Dr. Wolfgang Eger als Kulturdezernent
der Stadt, gemeinsam mit Rudolf Dister u.a. das Projekt einer
Städtischen Galerie vom ersten Tag an maßgeblich mit vorangebracht.
„Als ehrenamtlicher Leiter dieser neuen Galerie hat Jöckle diese
Aufgabe von Anfang an als seinen Hauptberuf verstanden und ihn wie
einen Hauptberuf ausgefüllt, ohne nach einer adäquaten Entlohnung
zu fragen“, stellte der ehemalige Kulturbürgermeister heraus. „Er
wollte einfach etwas bewegen in der Kunst unserer Stadt, die ihm
zur Heimat geworden war“. Seine zahllosen Reden und Referate zu
Ausstellungseröffnungen sowie zu speziellen, einzelnen
kunstgeschichtlichen Themen seien ebenso legendär gewesen, wie sein
spontan abrufbares Wissen über Kunstschaffende früherer wie
zeitgenössischer Epochen. „Nicht nur einmal mussten wir aufpassen,
dass er uns mit seiner tief in wissenschaftliche Details gehenden
Expertensprache nicht überforderte“, gestand Brohm, der auch daran
erinnerte, dass Jöckle bis zu seiner schweren Erkrankung der
„Motor“ des KV, des „Kartellverbandes Katholischer
Studentenverbindungen“ in der Pfalz gewesen sei, wo er gleichfalls
mit seinen Vorträgen glänzte und für den er unvergessene
Studienreisen organisiert und wissenschaftlich begleitet habe.
 „Ein Mensch wie Clemens Jöckle fehlt uns heute in der
Stadt – einen, den wir anrufen konnten, wenn wir eine
kunstgeschichtliche Frage hatten und der auf Anhieb eine kompetente
Antwort parat hatte“, so Brohm, der abschließend aber auch an eine
durchaus tragische Duplizität erinnern musste: Auch Jöckles Vater
sei nach einem schweren Hirnschlag und nach mehr als dreijährigem
Wachkoma verstorben. „Wir alle sind dankbar, dass Clemens zumindest
eine ganz so lange Leidenszeit erspart geblieben ist“, schloss
Brohm und wiederholte noch einmal seine Festellung: „Clemens Jöckle
hat die Kultur in Speyer wie kaum ein zweiter im besten Sinne
befruchtet – er wird deshalb in unseren Herzen weiterleben“.
„Ein Mensch wie Clemens Jöckle fehlt uns heute in der
Stadt – einen, den wir anrufen konnten, wenn wir eine
kunstgeschichtliche Frage hatten und der auf Anhieb eine kompetente
Antwort parat hatte“, so Brohm, der abschließend aber auch an eine
durchaus tragische Duplizität erinnern musste: Auch Jöckles Vater
sei nach einem schweren Hirnschlag und nach mehr als dreijährigem
Wachkoma verstorben. „Wir alle sind dankbar, dass Clemens zumindest
eine ganz so lange Leidenszeit erspart geblieben ist“, schloss
Brohm und wiederholte noch einmal seine Festellung: „Clemens Jöckle
hat die Kultur in Speyer wie kaum ein zweiter im besten Sinne
befruchtet – er wird deshalb in unseren Herzen weiterleben“.
Und noch eines wollte Hanspeter Brohm über den Mitchristen
Clemens Jöckle sagen: „Ich bin mir sicher, dass Clemens bei dieser
heutigen Feier mitten unter uns ist und dass er mit dem, was heute
zu seinen Ehren und zur Erinnerung an ihn gesprochen und
veranstaltet wurde, auch ihm mindestens so gut gefallen hätte wie
uns allen“. Und in dieser Gewissheit hätte Jöckle, der auch ein
begeisterter Freund der Musik von Bach bis Wagner war, das
musikalische Rahmenprogramm dieses so ganz besonderen
„Geburtstags-Gedenkens“ gefallen. 
Und da Arien von Wagner allein mit Klavierbegleitung nur sehr
schwer vorstellbar seien, so Ute Bahrs, hatten die Veranstalter die
heute in Leimersheim lebende griechisch-deutsche
Sopranistin Danai Amann gemeinsam mit ihrem
Begleiter Clemens Kuhn am Klavier eingeladen,
diesen Abend mit zwei Arien aus Mozarts Oper „Don Giovanni“ zu
umrahmen. Und mit bezaubernd schönem Timbre gestaltete die Sängerin
ihre höchst anspruchsvollen Parts mehr als überzeugend. Wir sind
gewiss: Auch der Mozart-Kenner und -Liebhaber Clemens Jöckle hätte
seine helle Freude daran gehabt. Danke deshalb, Ute Bahrs und danke
all jenen, die zum Gelingen dieses außergewöhnlichen Abends
beigetragen haben. Foto: gc
16.04.2015
LBZ digitalisiert historische Weinkarten aus Privatsammlung
 Das Landesbibliothekszentrum hat historische
gastronomische Weinkarten aus der Sammlung Manfred Rauscher
digitalisiert
Das Landesbibliothekszentrum hat historische
gastronomische Weinkarten aus der Sammlung Manfred Rauscher
digitalisiert
Speyer- Der Gesellschaft für Geschichte des
Weines e.V. ist es gelungen mit dem Besitzer einer großen Sammlung
historischer gastronomischer Weinkarten eine Vereinbarung über die
Digitalisierung abzuschließen: Der Sammler Manfred Rauscher stellt
die von ihm in jahrzehntelanger Arbeit zusammengetragene Sammlung
historischer Weinkarten, die über 200 Exemplare umfasst, jetzt dem
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) zur vollständigen
Digitalisierung und Präsentation im Internet zur Verfügung. Die
Sammlung beinhaltet Weinkarten aus bedeutenden Restaurants im
Zeitraum zwischen 1856 und 1966. Die Weinkarten sind im
Digitalisierungsportal Dilibri Rheinland-Pfalz unter www.dilibri.de, konkret unter http://www.dilibri.de/nav/classification/1363213
zugänglich.
Wie bei vielen Konsumgütern lässt sich auch beim Weingenuss
zurück blickend ein tiefgreifender Geschmackswandel beobachten. Er
kann sich auf den Ausbau der Weine beziehen (lieblich bis trocken),
die Farbe (Rotwein oder Weißwein), die Rebsorte oder das
Anbaugebiet mit seinen gebietstypischen Merkmalen. Beispielhaft ist
dieser Wandel seit der Mitte des 19. Jahrhunderts am
„Riesling-Boom“ an der Mosel zu beobachten, der den Winzern nach
Jahrzehnten der Not ein ordentliches Einkommen bescherte und der
Anbauregion Mosel eine internationale Wertschätzung.
Derartige Veränderungen lassen sich kaum besser nachvollziehen
als in den Weinkarten und -preislisten der gastronomischen
Einrichtungen und der Weinhändler. Es zeigt sich zum Beispiel, dass
die Weine der Mosel um die Wende zum 20. Jahrhundert Preise ähnlich
den teuersten Bordeaux-Weinen erzielten und im regionalen
Angebotsspektrum einen immer breiteren Raum einnahmen. Viele dieser
Karten sind künstlerisch sehr aufwendig gestaltet. Als ehemalige
Gebrauchsobjekte sind die Karten heute sehr selten und
wertvoll.
Bereits in der Volkskrone aus Weinblättern im Landeswappen
Rheinland-Pfalz wird zum Ausdruck gebracht, dass der Weinbau für
das Land einen besonderen Stellenwert hatte und immer noch hat:
Mehr als 65% des deutschen Weines werden heute in
rheinland-pfälzischen Weinbaugebieten hergestellt. Als Quelle
können die historischen gastronomischen Weinkarten sowohl bei
wirtschaftshistorischen, kulturwissenschaftlichen oder
kunsthistorischen Fragestellungen Zeugnis ablegen u.a. über die
Weinpreisentwicklung und den Weingeschmack der Zeit.
Im LBZ sind die historischen Weinkarten nun katalogisiert und
digitalisiert worden. Sie sind somit nachgewiesen im Online-Katalog
und stehen für jeden jederzeit einsehbar in dilibri zur Verfügung.
„Wir freuen uns, dass es, auch durch die Kooperation mit der
Gesellschaft für die Geschichte des Weines gelungen ist, diese
seltenen Weinkarten einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu
stellen“, erläutert die Leiterin des LBZ, Dr. Annette Gerlach.
Das rheinland-pfälzische Digitalisierungsportal dilibri ist die
digitalisierte Sammlung von landeskundlichen Werken zu
Rheinland-Pfalz sowie von Beständen aus rheinland-pfälzischen
Bibliotheken. Neben dem LBZ mit der Rheinischen Landesbibliothek
Koblenz, der Pfälzischen Landesbibliothek Speyer und der
Bibliotheca Bipontina Zweibrücken sind die Universitätsbibliothek
Trier und die Stadtbibliotheken Koblenz, Mainz, Trier und Worms
sowie die Bibliothek des Priesterseminars Trier an dilibri
beteiligt. Im März 2015 konnte die stolze Marke von 1 Million Scans
überschritten werden. Text und Foto: LBZ Speyer
11.04.2015
Onleihe Rheinland-Pfalz / Halbjahresbilanz im LBZ
 Seit
September 2014 nehmen die Bibliotheken des
Landesbibliothekszentrums am Onleihe-Verbund Rheinland-Pfalz teil.
Kunden der Landesbibliotheken in Koblenz und Speyer sowie der
Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken können rund um die Uhr auf ein
Angebot von über 30.000 E-Books, E-Zeitschriften und anderen
E-Medien zugreifen. Das Angebot ist unter der Adresse www.onleihe-rlp.de zu
finden.
Seit
September 2014 nehmen die Bibliotheken des
Landesbibliothekszentrums am Onleihe-Verbund Rheinland-Pfalz teil.
Kunden der Landesbibliotheken in Koblenz und Speyer sowie der
Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken können rund um die Uhr auf ein
Angebot von über 30.000 E-Books, E-Zeitschriften und anderen
E-Medien zugreifen. Das Angebot ist unter der Adresse www.onleihe-rlp.de zu
finden.
Speyer- Seit September 2014 beteiligen sich die
Bibliotheken des LBZ – Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken,
Pfälzische Landesbibliothek in Speyer, Rheinische Landesbibliothek
in Koblenz – aktiv an der Onleihe. Die Onleihe ermöglicht einen
24-Stunden-Service für die Benutzerinnen und Benutzer. Unter dem
Motto „Digitale Medien Ihrer Bibliothek – rund um die Uhr“ können
Sachbücher, Romane, Hörbücher, Sach- und Lernvideos sowie
Zeitschriften und Zeitungen von den Bibliothekskunden in
elektronischer Form ausgeliehen werden. Unter www.onleihe-rlp.de
sind sowohl Medien für Erwachsene als auch für Kinder und
Jugendliche zu finden.
„Zeit für eine Halbjahresbilanz“, stellt die Leiterin des LBZ,
Dr. Annette Gerlach fest. Bereits seit dem Start der Onleihe
Rheinland-Pfalz im Jahr 2010 ist das Landesbibliothekszentrum der
Koordinator für den gesamten Onleihe-Verbund im Bundesland
Rheinland-Pfalz, der zunächst mit acht öffentlichen Bibliotheken
gestartet ist. Mittlerweile beteiligen sich 43 Bibliotheken in
allen Regionen des Landes. „Als aktiver Teilnehmer bereichert das
LBZ nun auch das Onleihe-Angebot durch den Ankauf
wissenschaftlicher Titel“, erklärt Dr. Gerlach. „Dieses Konzept der
Beteiligung wissenschaftlicher Bibliotheken am Onleihe-Verbund und
damit der Erweiterung des Angebotes um wissenschaftliche Literatur
ist bisher einzigartig in Deutschland“, erläutert Dr. Gerlach
weiter.
Das wissen sowohl die Verbundbibliotheken zu schätzen als auch
die Kunden der LBZ-Bibliotheken. Besonders nachgefragt waren dabei
u.a. E-Paper wie „Der Spiegel“, E-Books über IT-Projektmanagement
oder auch der neueste Roman des britischen Schriftstellers Ken
Follett.
„Das Angebot der Onleihe mit seinen vielfältigen Möglichkeiten
schaue ich mir genauer an“, so ein Kunde im LBZ Koblenz begeistert,
als er auf die E-Medien aufmerksam gemacht wird. Als Kunde der
LBZ-Bibliotheken kann jeder die Onleihe nutzen, der für die
Zusatzleistung eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 Euro
jährlich entrichtet. Diese Gebühr ist in den Bibliotheken vor Ort
zu bezahlen. Die in der Onleihe angebotenen Titel sind auch im
LBZ-Katalog recherchierbar, von wo aus eine Verlinkung mit dem
Downloadbereich der Onleihe eingerichtet ist.
Die Jahresbilanz des Onleihe-Verbunds fällt ebenfalls sehr
erfreulich aus: Im Jahr 2014 wurden insgesamt rund 350.000
Entleihungen erzielt, eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahr von
mehr als 60%. 2013 waren es erst rund 217.000 Entleihungen. Auch
die Zahl der Nutzer hat sich im Vergleich zu 2013 um rund 40%
erhöht. Rund 14.000 Bibliothekskunden landesweit nutzen das
Angebot. Die ersten beiden Monate des Jahres 2015 mit
durchschnittlich 35.000 Entleihungen lassen erwarten, dass auch
2015 ein erfolgreiches Jahr für die Onleihe Rheinland-Pfalz wird.
Text und Bild: LBZ Speyer, Presse
01.03.2015
Neues Angebot des LBZ: Aufsichtscanner
 Speyer- Das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz (LBZ) bietet in den beiden Landesbibliotheken
in Speyer und Koblenz jeweils einen Aufsichtscanner an. So können
Besucher schnell und einfach Beiträge aus Büchern und Zeitschriften
bis zum Format DIN A2 kostenlos einscannen; dafür benötigen sie
lediglich einen USB-Stick. Die Aufsichtscanner ergänzen damit das
Angebot der kostenpflichtigen Kopierer im öffentlichen Bereich.
Speyer- Das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz (LBZ) bietet in den beiden Landesbibliotheken
in Speyer und Koblenz jeweils einen Aufsichtscanner an. So können
Besucher schnell und einfach Beiträge aus Büchern und Zeitschriften
bis zum Format DIN A2 kostenlos einscannen; dafür benötigen sie
lediglich einen USB-Stick. Die Aufsichtscanner ergänzen damit das
Angebot der kostenpflichtigen Kopierer im öffentlichen Bereich.
Die komfortable und intuitive Benutzerführung via Touchscreen
ermöglicht auch ungeübten Besuchern die Nutzung. Mit Blick auf den
Bestandsschutz der Vorlagen sind die Aufsichtscanner in jedem Fall
ein Gewinn. Eine Buchwippe sorgt für bestandsschonendes
Scannen, d.h. die Bindung wird geschont, die Wölbung der Seiten der
Vorlagen minimiert. Die Seiten können in verschiedenen Formaten
abgespeichert werden (pdf, jpg, tiff).
In Speyer finden die Besucher den Scanner vor dem Lesesaal im 2.
OG (s. Foto).
LBZ / Pfälzische Landesbibliothek
Otto-Mayer-Str. 9, 67346 Speyer
Tel.: 06232 9006-224, E-Mail: info.plb@lbz-rlp.de
www.lbz.rlp.de
Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr
15.02.2015
Schenkung an das LBZ Speyer im Rahmen des NS-Raubgut-Projektes
 Speyer- Im Rahmen des seit gut zwei Jahren
laufenden NS-Raubgut-Projektes im Landesbibliothekszentrum /
Pfälzische Landesbibliothek Speyer, erhielt die Landesbibliothek
vor kurzem eine außergewöhnliche Schenkung von Büchern und DVDs,
die sich mit dem Thema „Kindertransporte“ beschäftigen.
Speyer- Im Rahmen des seit gut zwei Jahren
laufenden NS-Raubgut-Projektes im Landesbibliothekszentrum /
Pfälzische Landesbibliothek Speyer, erhielt die Landesbibliothek
vor kurzem eine außergewöhnliche Schenkung von Büchern und DVDs,
die sich mit dem Thema „Kindertransporte“ beschäftigen.
Dieser Begriff bezeichnet ein Rettungsprogramm der britischen
Regierung, mit dessen Hilfe zwischen Dezember 1938 und September
1939 rund 10.000 jüdische Kinder vor der
nationalsozialistischen Verfolgung in Sicherheit gebracht werden
konnten. Die Kinder wurden von englischen Pflegefamilien
aufgenommen. Zu diesen geretteten Kindern gehörte auch Henry
(Heinz) Mayer, der später in Longwood, Florida lebte. Er traf am 5.
Januar 1939 elfjährig aus Speyer kommend in England ein. Seine
Eltern Anna und Friedrich Mayer mussten zu Hause auf ihre
Auswanderung warten, die sich aufgrund der Einwanderungsquoten in
den Aufnahmeländern verzögerte. Zu einer Emigration kam es
aber nicht mehr, weil das Ehepaar Mayer zusammen mit über 6.500
anderen badischen und pfälzischen Juden bereits am 22. Oktober 1940
nach Gurs verschleppt wurde. Von dort wurden sie im August 1942
nach Auschwitz deportiert, wo sie vermutlich kurz darauf ums Leben
kamen.
Im Zuge der Untersuchungen des Bestandes der Pfälzischen
Landesbibliothek auf NS-Raubgut wurden fünf Bücher mit dem
Autogramm von Anna Mayer gefunden. NS-Raubgut sind Kulturgüter, die
Verfolgten des Nazi-Regimes gehört haben und durch Enteignung oder
Zwangsverkauf in den Besitz öffentlicher Einrichtungen gelangt
sind. Das Landesbibliothekszentrum in Speyer ist die erste
Einrichtung in Rheinland-Pfalz, die ihre Bestände dahingehend
überprüft. Die als NS-Raubgut identifizierten Bücher sollen an die
Nachfahren der NS-Opfer zurückgegeben werden. Henry Mayer verstarb
bereits im Dezember 2012 im Alter von 85 Jahren, zwei Monate nach
Beginn des Projektes. Seine Witwe, Patricia Rahr Mayer, ist eine
der beiden Erbinnen von Anna und Friedrich Mayer, an die das
Landesbibliothekszentrum Anna Mayers Bücher restituieren wird. Mit
der Schenkung von sechs Büchern und zwei DVDs in englischer Sprache
an die Bibliothek verbindet Patricia Rahr Mayer zum einen die
Hoffnung, das Gedächtnis an die „Kindertransporte“ wach zu halten.
Sie und ihr Mann Henry hatten die meisten Autoren persönlich
gekannt. Zum anderen geschieht die Schenkung zur Erinnerung an ihre
Schwiegereltern Anna und Friedrich Mayer, worauf die Bibliothek mit
einem Geschenkexlibris* in den Publikationen hinweist.
Die geschenkten Medien sind ab dem 12. Februar für zwei Wochen
in einer Vitrine im Eingangsbereich ausgestellt und können
vorgemerkt werden.
* Geschenk von Henry und Patricia Mayer zur Erinnerung an die
Speyerer Bürger Anna und Friedrich Mayer † 1942 Auschwitz
LBZ / Pfälzische Landesbibliothek
Otto-Mayer-Str. 9, 67346 Speyer
Tel. 06232 9006-224, E-Mail: info.plb@lbz-rlp.de www.lbz.rlp.de
Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr
Das Foto von Anna und Friedrich Mayer, das Henry und
Patricia Mayer der Gedenkstätte Yad Vashem zur Verfügung gestellt
haben. Patricia Mayer hat uns die Verwendung des Fotos
genehmigt.
Text und Foto: LBZ, Speyer
12.02.2015
Neue URL und veränderter Webauftritt des LBZ
 Speyer- Der veränderte Webauftritt des
Landesbibliothekszentrums präsentiert sich mit verbesserten
Funktionalitäten und einer übersichtlicheren, auf seine
Dienstleistungen bezogenen Navigation, nach wie vor eingebettet in
das Corporate Design des Landes Rheinland-Pfalz.
Speyer- Der veränderte Webauftritt des
Landesbibliothekszentrums präsentiert sich mit verbesserten
Funktionalitäten und einer übersichtlicheren, auf seine
Dienstleistungen bezogenen Navigation, nach wie vor eingebettet in
das Corporate Design des Landes Rheinland-Pfalz.
Unter der neuen URL www.lbz.rlp.de stellt das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz seine Dienstleistungen in den Mittelpunkt. An
Stelle der einzelnen Standorte dominieren nun die wichtigsten
Angebote der Landesbibliotheken und der Landesbüchereistelle. „Wir
erhoffen uns von den vorgenommenen Veränderungen auf der Webseite
eine konsequentere Ausrichtung auf unsere Dienstleistungen und
Services“, erklärt die Leiterin des LBZ, Dr. Annette Gerlach.
Was ist neu? Auf der linken Seite der Navigationsleiste liegt
der Fokus klar auf den LBZ-Dienstleistungen. Die Rubrik "Über uns"
mit allgemeinen Informationen über das Landesbibliothekszentrum ist
in der Navigationsleiste weiter unten platziert. Der sogenannte
Content-Bereich in der Mitte der Webseite, besteht nicht länger
automatisch aus den LBZPressemitteilungen, sondern hier stehen
jetzt aktuelle Meldungen, sowohl zu LBZ-weiten wie auch zu
standortbezogenen Themen. Die Dauer der Information hängt somit nun
vom Inhalt ab, nicht davon, wie viele Pressemitteilungen von den
einzelnen Einrichtungen des LBZ veröffentlicht werden. Die
Pressemeldungen sind fortan als Unterpunkt von "Über uns" zu
finden.
Die sich auf der rechten Seite befindliche Highlightspalte
bietet einen Schnelleinstieg in die wichtigsten
Rechercheinstrumente wie die Digitale Bibliothek, die Onleihe, das
Digitalisierungsportal dilibri oder den Buchungskalender. Ansonsten
finden Sie hier vor allen Dingen allgemeine Kontaktadressen oder
konkrete Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner im LBZ. Auf der
Einstiegsseite finden Sie unter dem Punkt "Stellenbörse" ebenfalls
unsere aktuellen Stellenangebote.
Wichtig ist auch der Schnelleinstieg in die Katalogsuche. Daher
finden Kunden den Suchschlitz für den LBZ-Katalog zentral im
Content-Bereich. Der LBZ-Katalog verzeichnet Bücher und
Zeitschriften, aber auch elektronische Volltexte, Noten, Karten und
audiovisuelle Medien der wissenschaftlichen Bibliotheken im
Landesbibliothekszentrum. Für die Öffentlichen Bibliotheken als
Kunden der Landesbüchereistelle bietet sich der direkte Einstieg
über den Button „Öffentliche Bibliotheken“ oder „Leseförderung“ auf
der linken Seiten der Navigationsleiste an. Die
Landesbüchereistelle unterstützt mit ihren Angeboten Öffentliche
Bibliotheken und deren Träger durch Beratung in allen Fragen zur
Einrichtung, Ausstattung und Förderung; mit Medien aus den
Ergänzungsbüchereien; durch praktische Unterstützung bei der
fachlichen Medienerschließung und –bearbeitung; mit
Fortbildungsangeboten zur Qualifizierung des Bibliothekspersonals
sowie durch die Organisation landesweiter Projekte. Neue
Homepageadresse: www.lbz.rlp.de LBZ,
Presse
25.01.2015
Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2014 erneut ein großer Erfolg
 Zwei Preisrätsel ausgelost - Kinder im ganzen Land dürfen
sich in den nächsten Tagen auf gute Nachricht freuen
Zwei Preisrätsel ausgelost - Kinder im ganzen Land dürfen
sich in den nächsten Tagen auf gute Nachricht freuen
spk. Speyer- Mit der Auslosung der Gewinner der
beiden Preisrätsel im Foyer der „Pfälzischen Landesbibliothek“ fand
jetzt noch kurz vor dem Weihnachtsfest die letzte Aktion der
„Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2014“ statt. An der 7. Auflage
dieses landesweit größten Lesefestes hatten sich vom 24. Oktober –
13. November 150 Bibliotheken mit über 300 Veranstaltungen
beteiligt. Die Organisation und zentrale Koordinierung lag wie
gewohnt wieder in den Händen des rheinland-pfälzischen
Landesverbandes im Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) und des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz. Rund 16.000 Besucher
nahmen in dieser Zeit das vielseitige Angebot wahr. Im Mittelpunkt
der Veranstaltungen standen dabei die zentral organisierten
Lesereisen sowie die zahlreiche Buchkunst-Ausstellungen, die fast
die Hälfte der angebotenen Veranstaltungen ausmachten. Die
teilnehmenden Bibliotheken trugen zur Vielfalt des Angebots mit
eigenen Veranstaltungsideen bei.
 Die diesjährigen Bibliothekstage Rheinland-Pfalz boten
gleich doppelte Gewinnchancen, da neben dem etablierten
Kreuzworträtsel für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren erstmals auch
ein Bilderrätsel für Kinder bis 7 Jahre angeboten wurde.
Die diesjährigen Bibliothekstage Rheinland-Pfalz boten
gleich doppelte Gewinnchancen, da neben dem etablierten
Kreuzworträtsel für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren erstmals auch
ein Bilderrätsel für Kinder bis 7 Jahre angeboten wurde.
Rund 4.500 Kinder lösten das Kreuzworträtsel richtig, das Wissen
abverlangte. 30 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner werden nun in
den kommenden Tagen von „ihrer“ Bücherei darüber informiert.
Der 1. Preis, ein Tablet, geht nach
Limburgerhof (Rhein-Pfalz-Kreis). Über den
2. Preis, einen E-Book-Reader, kann sich eine
Benutzerin aus der Kreisbibliothek Daun (Landkreis
Vulkaneifel) freuen. Die Zentralbücherei
Waldfischbach-Burgalben (Landkreis Südwestpfalz)
wird den glücklichen Gewinner des 3. Preises, ein
Waveboard, informieren.
Das erstmals aufgelegte Bilderrätsel für Kinder bis 7 Jahre fand
großen Anklang in den Büchereien, die sich daran beteiligten. Unter
den rund 1.300 richtigen Einsendungen wurden ebenfalls 30
Gewinnerinnen und Gewinner ermittelt. Die Spielwarengutscheine im
Wert von 150 Euro und 100 Euro gehen an kleine Besucherinnen der
evangelischen Gemeindebücherei Bad Hönningen (Landkreis Neuwied)
und die katholische öffentliche Bücherei St. Agatha Wehlen in
Bernkastel-Kues (Landkreis Bernkastel-Wittlich). Über den 3. Preis,
einen Kickroller, kann sich ein Kind aus der Gemeindebücherei
Oberneisen freuen (Rhein-Lahn-Kreis).
 Die Auslosung fand am 12. Dezember 2014 im
Landesbibliothekszentrum Speyer statt. „Glücksfeen“ dabei waren die
Direktorin des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz, Dr. Annette Gerlach, der für die
Büchereien zuständige Referent im Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Anton
Neugebauer sowie Uwe Wöhlert, Vorstand
der Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz, die zugleich als Sponsor
der Preise auftrat.
Die Auslosung fand am 12. Dezember 2014 im
Landesbibliothekszentrum Speyer statt. „Glücksfeen“ dabei waren die
Direktorin des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz, Dr. Annette Gerlach, der für die
Büchereien zuständige Referent im Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Anton
Neugebauer sowie Uwe Wöhlert, Vorstand
der Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz, die zugleich als Sponsor
der Preise auftrat.
Wie Direktorin Dr. Gerlach bei der Auslosung der Preise noch
einmal betonte,bieten die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz eine gute
Gelegenheit, mit der Unterstützung der Stiftung Rheinland-Pfalz für
Kultur und anderen Förderern und Sponsoren die ausgezeichnete
Arbeit der Bibliotheken in Rheinland-Pfalz ins Licht der
Öffentlichkeit zu rücken. Foto: gc
18.12.2014
Bibliotheken in der Öffentlichkeit
 Begrüßung durch Christoph Kraus, zuständiger Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
Begrüßung durch Christoph Kraus, zuständiger Abteilungsleiter im Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur.
Workshop zum zehnjährigen Jubiläum des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz
Speyer- Am 13. November 2014 feierte das
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) in der Pfälzischen
Landesbibliothek in Speyer mit einem Workshop, an dem ca. 80 Gäste
aus dem politischen Bereich und aus rheinland-pfälzischen
Bibliotheken teilnahmen, sein zehnjähriges Bestehen.
In der am 1. September 2004 gegründeten Institution sind die
wissenschaftlichen Regionalbibliotheken Bibliotheca Bipontina in
Zweibrücken, Pfälzische Landesbibliothek in Speyer und Rheinische
Landesbibliothek in Koblenz mit der Landesbüchereistelle in Koblenz
und Neustadt/Weinstraße zusammengefasst. Das
Landesbibliothekszentrum versteht sich als Kompetenzzentrum des
Landes für alle Fragen im Bereich der Medien- und
Informationsvermittlung und als zentrale Entwicklungs- und
Beratungseinrichtung zu bibliotheksfachlichen Fragen. Eine Bilanz
nach zehn Jahren zeigt, dass die Gründung des LBZ zu einer
erheblichen Serviceverbesserung für die Kunden der Bibliotheken und
der Landesbüchereistelle im LBZ und zu Synergieeffekten u.a. bei
der Arbeitsorganisation und in den Bereichen der Verwaltung und der
Informationstechnik geführt hat.
In ihrem Grußwort ging Annette Gerlach, die Leiterin des
Landesbibliothekszentrums, auf die Kernaufgaben des
Landesbibliothekszentrums in der sich ändernden Medienwelt ein. Sie
betonte, dass Fusionen nie einfach seien, die Gründung des
Landesbibliothekszentrums aber durchaus eine Erfolgsgeschichte und
Grund zum Feiern sei. Christoph Kraus, Abteilungsleiter im
rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur überbrachte Grüße der Ministerinnen Doris
Ahnen und Vera Reiss. Für ihn habe die Feier des Jubiläums in der
Form einer „Arbeitssitzung“ einen starken symbolischen Charakter,
so Kraus. Er freute sich darüber, dass es gelungen sei, mit der
Gründung des Landesbibliothekszentrums vor zehn Jahren ein
landesweit zuständiges Kompetenzzentrum für den Bibliotheksbereich
zu schaffen. Das Landesbibliothekszentrum sei „die Lokomotive des
rheinland-pfälzischen Bibliothekszuges“.
Thematisch wollte das Landesbibliothekszentrum mit dem
Jubiläumsworkshop über den Tellerrand der näheren Umgebung
hinausschauen, daher standen Referenten aus den Partnerbibliotheken
in Tschechien und Polen und ein Referent aus Dänemark auf dem
Programm, die über die konkreten Modelle und Projekte im Bereich
„Bibliotheken und Öffentlichkeit“ in diesen Ländern berichteten.
Den Anfang machte Nis-Edwin List-Petersen vom Verband der deutschen
Büchereien in Nordschleswig (Dänemark), der in seinem lebendigen
Vortrag das Modell der „offenen Bibliothek“ in Nordschleswig
erläuterte. Durch die Einführung der “offenen Bibliothek“ mit stark
erweiterten Öffnungszeiten ohne Beratungsservice an Wochenenden und
in den Abendstunden, Selbstverbuchung und RFID gelang es, die
Ausleihzahlen um 15 – 20% zu steigern.
Olaf Eigenbrodt von der Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg beschäftigte sich in seinem Vortrag mit dem Thema
„Bibliotheken als Teil der urbanen Öffentlichkeit“. Aus den
Veränderungen, die die urbane Öffentlichkeit in den letzten Jahren
erfahren hat, erwachsen den Bibliotheken neue Aufgaben,
Anforderungen und auch neue Nutzertypen, so Eigenbrodt. Wichtig sei
es, Bibliotheken als gesellschaftliche Räume auszubauen, sich mit
städtischen Institutionen, Stadtteilbeiräten und Lobbygruppen zu
vernetzen und Möglichkeiten für Kreativität und Wissenstransfer zu
schaffen.
Der Beitrag des stellvertretenden Leiters des LBZ, Günter
Pflaum, ist im Hinblick auf Rheinland-Pfalz besonders
hervorzuheben, denn er beschäftigte sich mit dem Thema
„Bibliotheken als Bildungspartner in einem Flächenland“ und stellte
ausführlich die Leseförderprogramme für alle Altersgruppen, die das
Landesbibliothekszentrum in Kooperation mit unterschiedlichen
Partnern im Bildungsbereich wie Kindertagesstätten, Schulen u.a.
organisiert, vor.
Helmut Reichling, Professor an der Fachhochschule Kaiserlautern,
Studienort Zweibrücken beschäftigte sich mit eher theoretischen
Fragen des Marketings für Bibliotheken. Modernes Marketing
(Marketing 3.0) müsse gesellschaftliche Motive und deren
Befriedigung zugrunde legen. So sollten Förderung des
Leseverhaltens und Vermittlung von Medien- und
Informationskompetenz bei den Bibliotheken im Vordergrund stehen.
Um neue Benutzergruppen zu erreichen, sei es wichtig, die Wünsche
potentieller Besucher nach Daten- und Recherchesicherheit,
Teilnahme an einer Community und Unterhaltung zu beachten.
Ein Beispiel für eine professionelle Marketingkampagne
präsentierte anschließend Anna Jacobi, die Pressesprecherin der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Sie stellte sehr lebendig die
Pressekampagne der ZLB zum Neubau am Tempelhofer Feld in Print,
Film und Social Media dar.
Die Direktoren der beiden Partnerbibliotheken des
Landesbibliothekszentrums in Polen und Tschechien Tadeusz Chrobak (
Woiwodschaftsbibliothek Opole) und Jiri Mika (Mittelböhmische
Wissenschaftliche Bibliothek Kladno) stellten die verschiedenen
Projekte und Initiativen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit in ihren
Bibliotheken vor und illustrierten so mit kreativen Beispielen und
Ideen, welche Möglichkeiten der Serviceverbesserung und
-erweiterung sich durch die Vernetzung mit anderen Partnern für
Bibliotheken ergeben können.
Die Veranstaltung bildete gleichzeitig den offiziellen Abschluss
der diesjährigen rheinland-pfälzischen Bibliothekstage, die vom
24.10. bis 13.11.2014 stattfanden und vom rheinland-pfälzischen
Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) in
Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum organisiert werden.
Text und Foto: LBZ Rheinland-Pfalz
20.11.2014
Onleihe nun auch in den drei Bibliotheken des Landesbibliothekszentrums
 Attraktive
Erweiterung des digitalen Angebotes
Attraktive
Erweiterung des digitalen Angebotes
Speyer- Seit dem 1. September 2014
wird die Onleihe auch in den Bibliotheken des
Landesbibliothekszentrums (Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken,
Pfälzische Landesbibliothek in Speyer, Rheinische Landesbibliothek
in Koblenz) angeboten. So ist das Landesbibliothekszentrum nicht
nur wie bisher der Koordinator für den gesamten Onleihe-Verbund im
Bundesland Rheinland-Pfalz sondern auch aktiver Teilnehmer des
Verbundes und bereichert so das Angebot durch die Ergänzung
wissenschaftlicher Titel im Sortiment. Damit sind nun insgesamt 33
Bibliotheken im rheinland-pfälzischen Onleihe-Verbund
zusammengeschlossen; bis Jahresende werden es 42 Bibliotheken
sein.
Die Onleihe ermöglicht einen 24-Stunden-Service für
die Benutzerinnen und Benutzer der Bibliotheken. Unter dem Motto
„Digitale Medien Ihrer Bibliothek – rund um die Uhr“ können
Sachbücher, Romane, Hörbücher, Sach- und Lernvideos sowie einige
Zeitschriften und Zeitungen von den Bibliothekskunden ausgeliehen
werden. Unter www.onleihe-rlp.de werden nicht nur Medien für
Erwachsene sondern auch für Kinder- und Jugendliche angeboten. Das
Angebot wird ständig aktualisiert. Rund 23.000 E-Books und andere
E-Medien stehen zur Ausleihe bereit. Ausleihrenner sind die
Bestseller, die auch in den Bibliotheken vor Ort als gedrucktes
Buch oder als Hörbuch häufig ausgeliehen werden, u.a. die aktuellen
Thriller von Dan Brown oder John Grisham. Aber auch der „Spiegel“
und Computerzeitschriften werden stark nachgefragt.
Die enormen Steigerungsraten belegen die hohe
Attraktivität der Onleihe für die Bibliothekskunden. So gab es in
den Monaten Januar bis Juni 2014 156.843 Ausleihen; im Vorjahr
waren es im gleichen Zeitraum 96.996. Das entspricht einer
Steigerung von 162 %. Allein der Monat Juli brachte in diesem Jahr
eine Rekordausleihe von 30.000 E-Medien. Ähnlich sieht es bei den
aktiven Nutzern der Onleihe aus. Ende Juni 2013 nutzten 16.991
Kunden die Onleihe, Ende Juni 2014 sind es 27.814 (164%).
Die Kunden der LBZ-Bibliotheken haben nun neben den
gedruckten und elektronischen Beständen des LBZ zusätzlich Zugriff
auf die 23.000 elektronischen Medien im Onleihe-Verbund. Als
LBZ-Kunde kann jeder die Onleihe nutzen, der für die Zusatzleistung
eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 10 Euro jährlich entrichtet,
die vor Ort zu bezahlen ist.
Auch Neukunden sind herzlich willkommen. Die in der
ONLEIHE angebotenen Titel sind auch im LBZ-Katalog (www.lbz-rlp.de)
nachgewiesen und recherchierbar.
Doris Ahnen, Ministerin für Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur zur Onleihe: „Wir freuen uns über den
enormen Erfolg der „Onleihe“ und die Erweiterung und Bereicherung
des Angebotes in rheinland-pfälzischen Bibliotheken. Gerade auch
die Einbeziehung der Bibliotheken im Landesbibliothekszentrum
stärkt die notwendige Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und
wissenschaftlichen Bibliotheken. Gerade heute ist es wichtig,
unseren Bürgern einen leichten Zugang auch zu elektronischen Medien
verschaffen, was in gemeinsamer Anstrengung unserer Bibliotheken
immer besser gelingt.“
Dieses Konzept der Beteiligung wissenschaftlicher
Bibliotheken am Onleihe-Verbund und damit der Bereicherung und
Ergänzung des Angebotes der Onleihe um wissenschaftliche Literatur
ist bisher einzigartig in Deutschland. Wie die Onleihe
funktioniert, welche Medien ausgeliehen werden können und welche
Geräte und Programme für die Nutzung geeignet sind, erfahren
Interessierte in den beteiligten Bibliotheken sowie unter www.onleihe-rlp.de
LBZ Speyer, Presse
09.09.2014
Zwölfton- und serieller Musik Platz im Musikunterricht an Gymnasien verschafft
 Musikpädagoge Dr. Manfred Peters übergibt seinen Vorlass
der Musikabteilung des LBZ Speyer
Musikpädagoge Dr. Manfred Peters übergibt seinen Vorlass
der Musikabteilung des LBZ Speyer
cr. Speyer. „Schulmusik und Zwölfton- oder gar
serielle Musik als zeitgemäßer Ausprägung der klassischen Neuen
Musik im Unterricht – das passt doch so überhaupt nicht zusammen“.
Dieses Vorurteil prägte nach dem Zweiten Weltkrieg über Jahrzehnte
hinweg die Überzeugung von Schulmusikern an den Gymnasien und
folgerichtig auch in den entsprechenden Lehrplankonferenzen. „Die
Musik eines Karlheinz Stockhausen, eines Lugio Nono oder eines
Luciano Berio ist jungen Menschen ebenso unmöglich zu vermitteln,
wie es zuvor schon die Zwölftonreihen eines Arnold Schönberg waren
– Schluss und Basta“. Und damit endete Schulmusik zumeist mit der
Romantik, wenn's gut ging mit dem Impressionismus oder dem
Klassizismus.
Einer der ganz wenigen Pädagogen in Deutschland, die nie bereit
waren, sich diesem Vorurteil zu unterwerfen, ist der von 1965 bis
zu seiner Pensionierung im Jahr 1996 als
Musikpädagoge am Leininger-Gymnasium in Grünstadt
tätige Dr. Manfred Peters. Er begründete 1970 an
seiner Schule die „AG Neue Musik“, mit der er höchst erfolgreich
das pädagogische Ziel verfolgte, die Kreativität seiner Schüler zu
wecken und sie zum selbständigen musikalischen Denken und Handeln
anzuleiten. „Hierfür erwiesen sich die offenen Formen der Neuen
Musik, die dem eigenschöpferischen Anteil der Interpreten breiten
Raum lassen, als besonders geeignet“, so Dr. Peters, der jetzt,
wenige Wochen nach seinem 80 Geburtstag am 23. Juni, dem
Landesbibliothekszentrum in Speyer seinen 'Vorlass' übereignete und
so die bestehende Sammlung der Einrichtung zum Musikleben in der
Pfalz um wertvolle Dokumente bereicherte.
 .Dieser 'Vorlass' – so bezeichnen Experten die
Überlassung privat gesammelter wertvoller Dokumente und Archivalien
noch zu Lebzeiten des Gebers - belegt die drei wichtigsten
Lebensabschnitte von Manfred Peters, der 1934 in Landau geboren
wurde, und der seiner Pfälzer Heimat stets verbunden blieb. Neben
dem Studium der Musikwissenschaft, Geschichte und Schulmusik in
Mainz pflegte er auch die musikalische Praxis und perfektionierte
seine frühe Liebe zur Blockflöte und zur barocken Traversflöte. In
den 1960er Jahren galt er als einer der besten Blockflötisten des
Landes und unternahm mit renommierten Ensembles wie dem „Freiburger
Barock-Ensemble“ und „Musica atiqua“ Köln ausgedehnte
Konzertreisen, z.B. in die damalige Sowjetunion und nach
Südamerika. Davon zeugen im Vorlass Programme, Rezensionen und
Schallplattenaufnahmen.
.Dieser 'Vorlass' – so bezeichnen Experten die
Überlassung privat gesammelter wertvoller Dokumente und Archivalien
noch zu Lebzeiten des Gebers - belegt die drei wichtigsten
Lebensabschnitte von Manfred Peters, der 1934 in Landau geboren
wurde, und der seiner Pfälzer Heimat stets verbunden blieb. Neben
dem Studium der Musikwissenschaft, Geschichte und Schulmusik in
Mainz pflegte er auch die musikalische Praxis und perfektionierte
seine frühe Liebe zur Blockflöte und zur barocken Traversflöte. In
den 1960er Jahren galt er als einer der besten Blockflötisten des
Landes und unternahm mit renommierten Ensembles wie dem „Freiburger
Barock-Ensemble“ und „Musica atiqua“ Köln ausgedehnte
Konzertreisen, z.B. in die damalige Sowjetunion und nach
Südamerika. Davon zeugen im Vorlass Programme, Rezensionen und
Schallplattenaufnahmen.
Sein zweiter Lebensabschnitt begann 1965 mit seinem Eintritt in den
Schuldienst als Musikpädagoge am Leininger-Gymnasium in Grünstadt.
Um das für die Schüler geeignete Repertoire zu erweitern, gewann
Manfred Peters zahlreiche renommierte Komponisten dafür, Stücke
eigens für seine AG zu schreiben und diese zum Teil auch selbst mit
den Schülern zu erarbeiten. Dazu zählten u.a. Reiner Bredemeyer,
Johannes Fritsch, Hans-Joachim Hespos, Peter Hoch, Georg Katzer,
Dieter Schnebel, Mathias Spahlinger und Jakob Ullmann. Der
Schriftwechsel, den Manfred Peters mit Komponisten, aber auch mit
Literaten und Musikkritikern, führte, gehört zum wertvollsten Teil
des Vorlasses, Hier finden sich auch Schriftstücke von John Cage,
Karlheinz Stockhausen, Elfriede Jelinek und Ernst Schwitters, dem
Sohn von Kurt Schwitters.
 Dank der standhaften Beharrlichkeit von Manfred Peters
entwickelte sich die AG - trotz einer heftig umstrittenen
Anfangsphase - zu einem wagemutigen Vorreiter in der Erkundung
neuester musikalischer Entwicklungen durch aufgeschlossene
Jugendliche auch ohne spezielle Vorbildung. Sie wurde zu einem
Leuchtturm im Musikleben der Pfalz und zu einem Vorzeigeobjekt der
Musikpädagogik insgesamt. Einladungen zu Tagen und Festivals der
Neuen Musik erreichten die AG aus dem gesamten Inland und dem
benachbarten Ausland. Ihre Aufführungen wurden von Rundfunk und
Fernsehen aufgezeichnet und von der überregionalen Presse
wohlwollend begleitet.
Dank der standhaften Beharrlichkeit von Manfred Peters
entwickelte sich die AG - trotz einer heftig umstrittenen
Anfangsphase - zu einem wagemutigen Vorreiter in der Erkundung
neuester musikalischer Entwicklungen durch aufgeschlossene
Jugendliche auch ohne spezielle Vorbildung. Sie wurde zu einem
Leuchtturm im Musikleben der Pfalz und zu einem Vorzeigeobjekt der
Musikpädagogik insgesamt. Einladungen zu Tagen und Festivals der
Neuen Musik erreichten die AG aus dem gesamten Inland und dem
benachbarten Ausland. Ihre Aufführungen wurden von Rundfunk und
Fernsehen aufgezeichnet und von der überregionalen Presse
wohlwollend begleitet.
Eine Schallplatte und zwei CD-Produktionen machen diese
Pionierleistung Dr. Peters auch heute noch nachvollziehbar. Ihr
exemplarischer Rang wurde in einer CD-Edition des Deutschen
Musikrats zur „Musik in Deutschland 1950-2000“ dokumentiert. Der
Forschung zur jüngeren deutschen Musikpädagogik steht hiermit
reiches Material zur Verfügung.
In seiner dritten Lebensphase widmet sich Dr. Manfred Peters
heute vorrangig der wissenschaftlichen Erforschung von Musik. Dabei
steht – wie schon früher – Johann Sebastian Bach im Mittelpunkt
seines Interesses. Forschungen über die Bedeutung der musikalischen
Rhetorik für die Instrumentalwerke Bachs, speziell die Fugen,
führten zu Lehraufträgen am Lehrstuhl für  Musikwissenschaft der TU Dresden und zu seiner
Dissertation unter dem Titel „Die Dispositio der Oratorie als
Beitrag zum Formverständnis ausgewählter Instrumentalfugen von J.
S. Bach“, mit der er 2004 promoviert wurde. Seine neuen
Erkenntnisse hat er in mehreren Büchern und Zeitschriftenartikeln
publiziert, die in der Fachwelt hohe Anerkennung genießen.
Musikwissenschaft der TU Dresden und zu seiner
Dissertation unter dem Titel „Die Dispositio der Oratorie als
Beitrag zum Formverständnis ausgewählter Instrumentalfugen von J.
S. Bach“, mit der er 2004 promoviert wurde. Seine neuen
Erkenntnisse hat er in mehreren Büchern und Zeitschriftenartikeln
publiziert, die in der Fachwelt hohe Anerkennung genießen.
Nicht zuletzt erforscht Manfred Peters seine musikalischen Wurzeln
und engagiert sich dafür, die Erinnerung an seinen Großonkel, den
Komponisten Heinrich Kaminski (1886-1946),
lebendig zu erhalten.
LBZ-Standortleiterin Ute Bahrs und die Leiterin
der renommierten Musikabteilung der „LaBi“, Dr. Elisabeth
Diederichs, würdigten den Neuzugang als eine wesentliche
Bereicherung der bestehenden Sammlung, der jetzt dank der
Möglichkeiten des LBZ einer noch breiteren, interessierten
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden könne. Die Exponate der
„Sammlung Dr. Manfred Peters“ können ab sofort im LBZ genutzt bzw.
ausgeliehen werden.
Foto: gc
22.07.2014
„Erinnerung ist mehr als die Bewahrung der Asche – sie ist vielmehr Ausdruck unserer Verantwortung für die Zukunft“
 Eindrucksvoller Festakt zur Eröffnung der
Doppelausstellung zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges
Eindrucksvoller Festakt zur Eröffnung der
Doppelausstellung zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges
von Gerhard Cantzler
Speyer- Das Interesse an der
Eröffnungsveranstaltung zu der umfangreichen Doppelausstellung im
Gedenken an den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs
im Historischen Museum der Pfalz (lesen Sie dazu den Bericht im
SPEYER-KURIER vom 27.05. 2014) und im gemeinsamen
Foyer von Landesbibliothekszentrum und Landesarchiv in Speyer war
dem Ereignis angemessen riesig – das Foyer bis auf den letzten
Platz besetzt und selbst auf den Emporen drängten sich noch die
Besucher, als der Mainzer Kulturstaatssekretär Walter
Schumacher am Mittwoch abend an das Mikrophon trat, um die
zahlreichen, illustren Gäste aus Politik, Wirtschaft und
Wissenschaft zu begrüßen – an ihrer Spitze Brigitte Hayn
MdL, (Neustadt), den früheren Ministerpräsidenten
von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck sowie den langjährigen
Oberbürgermeister von Speyer und Vorsitzenden des Historischen
Vereins der Pfalz, Werner Schineller.
 Schumacher zeigte sich dabei tief beeindruckt
von der überaus großen Resonanz, auf die die zahlreichen
Veranstaltungen so vieler Einrichtungen im ganzen Lande zu diesem
Anlass stoßen. „In diesen Wochen zeigt sich, dass die Frage, wie
dieser Krieg die eigene Heimatregion betroffen hat, die Menschen in
Rheinland-Pfalz bis zum heutigen Tag tief bewegt“. Am Beispiel des
lange Zeit in der Südpfalz lebenden und wirkenden Impressionisten
Max Slevogt beschrieb er dessen Wandel vom Maler Harmonie
verströmender Landschafts- und Genrebilder zum Kriegsmaler und
Porträtist von Szenen voller Elend und Verzweiflung sowie das Los
des Speyerer Künstlerpaares Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller,
die unter dem Eindruck des Krieges ihren Aufenthalt in Paris
abbrechen und ihre Freundschaft zu Henri Matisse aussetzen mussten.
„Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war losgebrochen“, stellte
der aus Kaiserslautern stammende Staatssekretär fest, „als das in
Ludwigshafen bei der BASF entwickelte „Haber-Bosch-Verfahren“ nicht
mehr zur Herstellung von Düngemitteln, sondern zur Produktion von
Giftgas eingesetzt wurde“.
Schumacher zeigte sich dabei tief beeindruckt
von der überaus großen Resonanz, auf die die zahlreichen
Veranstaltungen so vieler Einrichtungen im ganzen Lande zu diesem
Anlass stoßen. „In diesen Wochen zeigt sich, dass die Frage, wie
dieser Krieg die eigene Heimatregion betroffen hat, die Menschen in
Rheinland-Pfalz bis zum heutigen Tag tief bewegt“. Am Beispiel des
lange Zeit in der Südpfalz lebenden und wirkenden Impressionisten
Max Slevogt beschrieb er dessen Wandel vom Maler Harmonie
verströmender Landschafts- und Genrebilder zum Kriegsmaler und
Porträtist von Szenen voller Elend und Verzweiflung sowie das Los
des Speyerer Künstlerpaares Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller,
die unter dem Eindruck des Krieges ihren Aufenthalt in Paris
abbrechen und ihre Freundschaft zu Henri Matisse aussetzen mussten.
„Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war losgebrochen“, stellte
der aus Kaiserslautern stammende Staatssekretär fest, „als das in
Ludwigshafen bei der BASF entwickelte „Haber-Bosch-Verfahren“ nicht
mehr zur Herstellung von Düngemitteln, sondern zur Produktion von
Giftgas eingesetzt wurde“.
 Dr. Walter Rummel, Standortleiter des
Landesarchivs Speyer, stellte in seinem Statement den
grenzüberschreitenden Charakter der Ausstellung in seinem Hause in
den Vordergrund, in der 35 wissenschaftliche Institutionen in der
Schweiz, dem Elsass sowie in Baden und der Pfalz eng
zusammengearbeitet hätten. Dadurch hätten Ausstellung und Katalog
in überaus kurzer Zeit realisiert werden können – das Ziel, mit
möglichst geringem Aufwand eine eindrucksvolle und zugleich
hochmobile Wanderausstellung zusammenzustellen, sei erreicht
worden. „Wir wollten keinen „Blockbuster“ - keine
'Kriegsausstellung' mit Exponaten wie dem zuvor von Staatssekretär
Schumacher angesprochenen, massenweise zum Einsatz gekommenen
Maschinengewehr O8/15 – später Inbegriff der Sinnlosigkeit jeden
Krieges – präsentieren“, betonte Dr. Rummel, „sondern den Besuchern
unserer Schauen die Auswirkungen des Krieges auf ihre nähere Heimat
– die Pfalz und Baden – die „Heimatfront“ eben - in all ihren
Auswirkungen vor Augen zu führen“.
Dr. Walter Rummel, Standortleiter des
Landesarchivs Speyer, stellte in seinem Statement den
grenzüberschreitenden Charakter der Ausstellung in seinem Hause in
den Vordergrund, in der 35 wissenschaftliche Institutionen in der
Schweiz, dem Elsass sowie in Baden und der Pfalz eng
zusammengearbeitet hätten. Dadurch hätten Ausstellung und Katalog
in überaus kurzer Zeit realisiert werden können – das Ziel, mit
möglichst geringem Aufwand eine eindrucksvolle und zugleich
hochmobile Wanderausstellung zusammenzustellen, sei erreicht
worden. „Wir wollten keinen „Blockbuster“ - keine
'Kriegsausstellung' mit Exponaten wie dem zuvor von Staatssekretär
Schumacher angesprochenen, massenweise zum Einsatz gekommenen
Maschinengewehr O8/15 – später Inbegriff der Sinnlosigkeit jeden
Krieges – präsentieren“, betonte Dr. Rummel, „sondern den Besuchern
unserer Schauen die Auswirkungen des Krieges auf ihre nähere Heimat
– die Pfalz und Baden – die „Heimatfront“ eben - in all ihren
Auswirkungen vor Augen zu führen“.
Gegliedert in sieben Abschnitte - vom Kriegseintritt im August
1914 bis zum Kriegesende 1918 und zu den Kriegsfolgen bis ins Jahr
1924 hinein - beleuchte die Ausstellung anhand von je zwei
Schautafeln zu jedem Abschnitt wichtige Aspekte dieses Krieges, -
in Speyer noch bis zum 28. Juni, ehe sie dann ins „Technoseum
Mannheim“ und danach an zahlreiche andere Orte in der Pfalz und in
Baden „weiter wandere“. Das besondere dabei sei, dass die Schau an
jedem Ort ihrer Präsentation durch Exponate aus den Beständen ihres
jeweiligen „gastgebenden Hauses“ ergänzt werde. „Damit stellt sich
die Ausstellung jenseits der großen Linien an jedem Ort anders
dar“, so Dr. Rummel, sicher Grund genug, sie an unterschiedlichen
Standorten auch mehrmals zu besuchen.
In Speyer seien die ergänzenden Exponate insbesondere solche,
die man aus heutiger Sicht durchaus als Propagandamedien bezeichnen
könnte. Auch die Kriegszeichnungen von Max Slevogt und die
Tagebuchaufzeichnungen von Ernst Jünger seien genauso bewegende
Zeugnisse einer sich rasch wandelnden Sicht auf den Krieg wie das
Schicksal der aus Weiher stammenden Winzerfamilie Jakob und Barbara
Ziegler, die drei ihrer sechs Söhne im Krieg verlor und das sich in
dem im Speyerer Landesarchiv verwahrten, bewegenden Briefwechsel
dokumentiert. „Diese Ausstellung ist deshalb keine Schau über Glanz
und Siege in einem sinnlosen Krieg, sondern ein Zeugnis für
Verblendung und Elend“, schloß Dr. Rummel seine nachdenkliche
Einführung.
 Sein Kollege Dr. Ludger Tekampe, Kurator
der Aussstellung „1914 – 1918. Die Pfalz im Ersten Weltkrieg“ im
Historischen Museum der Pfalz in Speyer, gab sodann einen Einblick
in die von ihm gestaltete Schau, über die der
SPEYER-KURIER in seiner Ausgabe vom 27.05.2014
bereits ausführlich berichtete. Dr. Tekampe betonte, dass beide
Ausstellungen versuchten, einen neuen Blick auf den Ersten
Weltkrieg zu eröffnen. „Dies ist heute ganz besonders nötig, damit
wir uns tagtäglich aufs neue der Kostbarkeit des Friedens bewußt
werden“.
Sein Kollege Dr. Ludger Tekampe, Kurator
der Aussstellung „1914 – 1918. Die Pfalz im Ersten Weltkrieg“ im
Historischen Museum der Pfalz in Speyer, gab sodann einen Einblick
in die von ihm gestaltete Schau, über die der
SPEYER-KURIER in seiner Ausgabe vom 27.05.2014
bereits ausführlich berichtete. Dr. Tekampe betonte, dass beide
Ausstellungen versuchten, einen neuen Blick auf den Ersten
Weltkrieg zu eröffnen. „Dies ist heute ganz besonders nötig, damit
wir uns tagtäglich aufs neue der Kostbarkeit des Friedens bewußt
werden“.
In seiner von persönlicher Betroffenheit geprägten, bewegenden
Ansprache stellte der frühere rheinland-pfälzische
Ministerpräsident Kurt Beck an den Beginn seiner
Ausführungen den aufrüttelnden Appell an alle Lehrer und sonstige
Lehrpersonen, die besonderen Daten dieses Jahres – den 100.
Jahrestag des Beginns des Ersten und den 75. Jahrestag des
Ausbruchs des Zweiten Weltkrieges sowie den 25. Jahrestag der
friedlichen Revolution in der DDR und des Mauerfalls als besondere
Verpflichtung zu verstehen, immer wieder an das Geschehene zu
erinnern. Die Deutschen müssten an jedem Tag neu darum bemüht sein,
mit den Menschen in anderen Ländern zusammenzuarbeiten, „damit wir
stets nur ein gutes Beispiel für weltkrieg die anderen abgeben“, so
Beck. Mit Blick auf die beiden aktuellen Speyerer Schauen gab der
Ministerpräsident a. D. seiner Freude darüber Ausdruck, dass sie
die Ereignisse des Ersten Weltkrieges nicht aus der „Perspektive
der 'großen' Politik“, sondern stets aus dem Blickwinkel der
eigentlich Betroffenen - der „ganz normalen Menschen“
darstellten.
 Kurt Beck erinnerte an das Los seines eigenen Großvaters –
ein typisches Soldaten-Schicksal – der im Ersten Weltkrieg eine
Giftgasvergiftung und bedingt dadurch eine schwere Lungenschädigung
erlitt und der dennoch auch im Zweiten Weltkrieg erneut als
„letztes Aufgebot“, als Volkssturmmann, zum Kriegsdienst eingezogen
wurde. In seiner Heimatgemeinde Steinweiler, so Beck, seien gleich
zu Kriegsbeginn 86 junge Männer eingezogen worden, von denen schon
kurz darauf bereits elf gefallen waren. „Was hätten diese Menschen
für Ihre Familien, für sich selbst und für unser ganzes Volk
leisten können, wenn man ihnen den Frieden erhalten hätte?“ so
Becks nachdenkliche Frage, die er sich dann gleich selbst mit dem
Hinweis auf die friedliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg
beantwortete:.„Zu welchen Leistungen für ihre Gesellschaft die
Opfer des Ersten Weltkrieges imstande gewesen wären, können wir
heute am Beispiel der Entwicklung unseres Landes in den vergangenen
69 Jahren des Friedens ermessen“. Beck führte auch vor Augen, wie
Bauern durch die Requirierung ihrer Fuhrwerke die Existenzgrundlage
genommen worden sei oder wie - grotesk genug - Eisenbahner erst
bewaffnet wurden, um Bahnhöfe und Bahnlinien gegen vermeintliche
Attentäter zu schützen, um kurz darauf ihre Waffen wieder
einzusammeln, um „eine ungewollte Massenbewaffnung“ zu verhindern.
„Groteske Situationen waren das“, so Beck, der daraus den Schluss
zog, dass sich die Menschen nie mehr durch indoktrinierende
„mainstream-Meinungen“ beeinflussen lassen dürften.
Kurt Beck erinnerte an das Los seines eigenen Großvaters –
ein typisches Soldaten-Schicksal – der im Ersten Weltkrieg eine
Giftgasvergiftung und bedingt dadurch eine schwere Lungenschädigung
erlitt und der dennoch auch im Zweiten Weltkrieg erneut als
„letztes Aufgebot“, als Volkssturmmann, zum Kriegsdienst eingezogen
wurde. In seiner Heimatgemeinde Steinweiler, so Beck, seien gleich
zu Kriegsbeginn 86 junge Männer eingezogen worden, von denen schon
kurz darauf bereits elf gefallen waren. „Was hätten diese Menschen
für Ihre Familien, für sich selbst und für unser ganzes Volk
leisten können, wenn man ihnen den Frieden erhalten hätte?“ so
Becks nachdenkliche Frage, die er sich dann gleich selbst mit dem
Hinweis auf die friedliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg
beantwortete:.„Zu welchen Leistungen für ihre Gesellschaft die
Opfer des Ersten Weltkrieges imstande gewesen wären, können wir
heute am Beispiel der Entwicklung unseres Landes in den vergangenen
69 Jahren des Friedens ermessen“. Beck führte auch vor Augen, wie
Bauern durch die Requirierung ihrer Fuhrwerke die Existenzgrundlage
genommen worden sei oder wie - grotesk genug - Eisenbahner erst
bewaffnet wurden, um Bahnhöfe und Bahnlinien gegen vermeintliche
Attentäter zu schützen, um kurz darauf ihre Waffen wieder
einzusammeln, um „eine ungewollte Massenbewaffnung“ zu verhindern.
„Groteske Situationen waren das“, so Beck, der daraus den Schluss
zog, dass sich die Menschen nie mehr durch indoktrinierende
„mainstream-Meinungen“ beeinflussen lassen dürften.
 Damit schlug er zugleich auch den Bogen von der
Propaganda des Ersten Weltkrieges auf allen kriegsbeteiligten
Seiten hin zu den Parolen, wie sie auch heute wieder in der
aktuellen Auseinandersetzung zwischen Rußland und der Ukraine zu
vernehmen seien. „Statt lauter Propaganda brauchen wir deshalb
immer wieder das direkte Gespräch zwischen den Staaten“, rief er
alle politisch Verantwortlichen zum Dialog auf. „Die Zeit vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat in beklemmender Weise gezeigt,
wie schnell Propaganda-Parolen verfangen können“, so Beck, der aber
gleichzeitig auch davor warnte, das gegenwärtig einvernehmliche
Miteinander über regionale und nationale Grenzen hinweg zu leicht
als Selbstverständlichkeit zu verstehen: „Nein“, rief Beck seinem
Auditorium zu, „darum müssen wir uns jeden Tag aufs neue bemühen –
daran müssen wir immer wieder auf allen Ebenen arbeiten“.
Damit schlug er zugleich auch den Bogen von der
Propaganda des Ersten Weltkrieges auf allen kriegsbeteiligten
Seiten hin zu den Parolen, wie sie auch heute wieder in der
aktuellen Auseinandersetzung zwischen Rußland und der Ukraine zu
vernehmen seien. „Statt lauter Propaganda brauchen wir deshalb
immer wieder das direkte Gespräch zwischen den Staaten“, rief er
alle politisch Verantwortlichen zum Dialog auf. „Die Zeit vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat in beklemmender Weise gezeigt,
wie schnell Propaganda-Parolen verfangen können“, so Beck, der aber
gleichzeitig auch davor warnte, das gegenwärtig einvernehmliche
Miteinander über regionale und nationale Grenzen hinweg zu leicht
als Selbstverständlichkeit zu verstehen: „Nein“, rief Beck seinem
Auditorium zu, „darum müssen wir uns jeden Tag aufs neue bemühen –
daran müssen wir immer wieder auf allen Ebenen arbeiten“.
Der grenzüberschreitende Zusammenschluß in der Metropolregion
Rhein-Neckar mit ihren Verzahnungen bis weit in die Schweiz und das
Elsaß hinein sei deshalb die einzig richtige Antwort auf die
furchtbaren Erfahrungen des Zweiten Weltkrieges gewesen, zeigte
sich Beck überzeugt, der auch seiner eigenen Partei den Vorhalt
nicht ersparen konnte, zu Beginn des Ersten Weltkrieges dem Rausch
der Kriegsrhetorik erlegen und den Kriegskrediten zu- und in die
euphorische patriotische Gesinnung mit eingestimmt zu haben.
„Erinnern ist deshalb mehr als nur das Bewahren der Asche – es
ist vielmehr der Ausdruck unser aller Verantwortung für die
Zukunft“, schloß Beck seine aufrüttelnde Ansprache.
 In seinem Einführungsvortrag umriß schließlich der Mainzer
Zeitgeschichtler Prof. Dr. Michael Kißener die
Situation während des Krieges „im Westen (des Deutschen Reiches)
und im „frontnahen Heimatgebiet“. Dabei richtete er sein besonderes
Augenmerk auf die allegemeine geostrategische Lage in der Pfalz zu
Beginn des Krieges sowie auf die Versorgung Verwundeter auf beiden
Seiten der Front sowie auf den Umgang mit den Kriegsgefangenen. Wie
Prof. Kißener konstatieren musste, sei das deutsche Militär mit
beidem schon sehr bald restlos überfordert gewesen.
In seinem Einführungsvortrag umriß schließlich der Mainzer
Zeitgeschichtler Prof. Dr. Michael Kißener die
Situation während des Krieges „im Westen (des Deutschen Reiches)
und im „frontnahen Heimatgebiet“. Dabei richtete er sein besonderes
Augenmerk auf die allegemeine geostrategische Lage in der Pfalz zu
Beginn des Krieges sowie auf die Versorgung Verwundeter auf beiden
Seiten der Front sowie auf den Umgang mit den Kriegsgefangenen. Wie
Prof. Kißener konstatieren musste, sei das deutsche Militär mit
beidem schon sehr bald restlos überfordert gewesen.
Mit der unvorstellbar großen Zahl Verwundeter und den
schrecklichen Verletzungen, die neuartige Waffensysteme bei den
verwundeten Kriegsgegnern hinterlassen hätten, seien die
Verantwortlichen schon bald ebenso an die Grenzen ihrer
Möglichkeiten gestoßen wie mit der riesigen Zahl von
Kriegsgefangenen. Allein bis Mai 1915 habe das deutsche Heer über
250.000 Gefangene gemacht, mit deren Verwahrung, Unterbringung und
Versorgung die zuständigen Stellen restlos überfordert gewesen
seien – Themen und Inhalte übrigens, die in den kommenden Monaten
sicher noch viele Bücher füllen und Gegenstand zahlreicher neuer
Fernsehproduktionen sein werden.
Was übrigblieb war eine zunehmend chaotische Situation an Front
und Heimatfront, die so garnicht zu dem auf Disziplin und Ordnung
ausgerichteten deutschen Militärwesen passen wollte. Einziger Trost
für die Kriegsgefangenen: Im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg habe
zumindest in der Pfalz keine Rede von einer „schlechten Behandlung
der Kriegsgegner“ die Rede sein können, so der Zeitgeschichtler.
Ganz im Gegenteil: Immer wieder sei es hier auch in der Presse zu
empörten Beschwerden darüber gekommen, dass die Zivilbevölkerung in
der Pfalz die Gefangenen in unangemessen freundlicher Weise
behandelen und sie mit „Liebesgaben“ bedenken würde.
Eine höchst ambivalente Situation also, die der Wissenschaftler
da skizzierte und die sich doch so ganz und gar von dem
„Hurra-Patriotismus“ unterscheidet, der - insbesondere in der
späteren, reflektierenden Darstellung der Ereignisse von
„Vierzehn-achtzehn“ in der den „Heldenmythos“ überhöhenden und
verherrlichenden Propaganda des Nationalsozialismus - zu einer über
viele Jahrzehnte aufrecht erhaltenen Verfälschung der wahren
Ereignisse jener Zeit führte.
Die beiden Speyerer Schauen sind dshalb bestens dazu angetan,
die tatsächliche Situation in diesem ersten, wirklichen „Weltkrieg
der Menschheitsgeschichte“ auf die Ebene der am meisten von ihm
Betroffenen, der an ihm leidenden Soldaten auf beiden Seiten sowie
der Zivilbevölkerung, zu rücken. Und deshalb lohnen beide, besucht
zu werden.
Zu dem höchst nachdenklichen Grundton dieser beiden
Ausstellungen und ihrer Eröffnung passte dann schließlich auch die
musikalische Umrahmung des Abends mit Musik eines Zeitzeugen dieses
Krieges, des ungarischen Komponisten Zoltán Koldály, mit dessen von
Zerrissenheit geprägten Duo für Violine und Violoncello op. 7 aus
dem Jahr 1914 (!) Beate Holder-Kirst (Violoncello) und
Wolfgang Brodbeck (Violine) in beeindruckender Weise zu
diesem „Ereignis der Erinnerung“ beitrugen. Foto: gc
30.05.2014
Schmerzhafte Zeugnisse einer unseligen Zeit
 Südwestrundfunk mit Vorpremiere seiner Dokumentation „Der
Erste Weltkrieg im Südwesten“
Südwestrundfunk mit Vorpremiere seiner Dokumentation „Der
Erste Weltkrieg im Südwesten“
von Gerhard Cantzler
Speyer- Wer durch die Informationskanäle der
öffentlich-rechtlichen wie der privaten Fernsehprogramme „zappt“,
der kann fast tagtäglich und zu jeder Tageszeit höchst informative
Dokumentationen zum Zweiten Weltkrieg, seiner Vorgeschichte und
seinen Folgen sehen. Ganz anders dagegen, wenn es um den Ersten
Weltkrieg geht. Er scheint - wohl bedingt durch die sich in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts rasch entwickelnden
Medientechnologien wie Fotografie, Film und Tonübertragung, vor
allem aber durch die stark ideologisch bestimmte Vorgeschichte des
Zweiten Weltkrieges, der die Erinnerungen an den ersten rasch
überlagerte – zu Unrecht weitgehend aus dem Blickfeld von
Historikern und Politikwissenschaftlern geraten zu sein.
 Erst jetzt, im Vorfeld des 100. Jahrestages des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges in der Folge des Attentats auf den
Österreich-Ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand am 28.
Juli 1914, werden Ausstellungen vorbereitet, Bücher veröffentlicht
und filmische Dokumentationen vorbereitet.
Erst jetzt, im Vorfeld des 100. Jahrestages des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges in der Folge des Attentats auf den
Österreich-Ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand am 28.
Juli 1914, werden Ausstellungen vorbereitet, Bücher veröffentlicht
und filmische Dokumentationen vorbereitet.
Zur Vorpremiere von Teil 1 einer der ersten davon, der
SWR-Dokumentation „Der Erste Weltkrieg im
Südwesten“, konnte gestern abend
LBZ-Standortleiterin Ute Bahrs in dem bis auf den
letzten Platz gefüllten gemeinsamen Foyer von Landesarchiv und
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz in Speyer zahlreiche Gäste
begrüßen, unter denen man u.a. auch den Standortältesten der
Speyerer Bundeswehrgarnison, Oberstleutnant Stefan
Jeck und den Speyerer Domdekan Dr. Christoph
Kohl sah.
Für den Autor der Dokumentation, Knut
Weinrich und die zuständige SWR-Redakteurin
Gabriele Trost war dieser Abend durchaus ein Experiment
mit ungewissem Ausgang, hatten sie doch bisher noch nie ein solches
Werk, das die Privatsphäre der in dem Film Porträtierten so tief
berührt, in einem solchen Rahmen vorgestellt.
Anhand der Lebensschicksale von vier Familien aus
Südwestdeutschland werden in der Dokumentation die sich wandelnden
Auswirkungen dieses ersten „industriell geführten Massenkrieges“ in
der Menschheitsgeschichte auf Individuen und Gesellschaft
dargestellt - eines Krieges, den Wissenschaftler bis heute als „die
Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ charakterisieren und von dem
manche sogar glauben, dass er angesichts der bürgerkriegsähnlichen
Ereignisse auf dem Balkan und zuletzt an der russisch-ukrainischen
Grenze eigentlich bis heute noch nicht wirklich beendet ist .
 In eindringlich-bewegender, höchst sensibler Weise ist es
dem Autor in dieser Dokumentation gelungen, über zeitgenössische
Sequenzen aus Wochenschauen und privat gedrehten, frühen Filmen
sowie durch private Fotografien eine Annäherung an die wahren
Gefühle und Verhältnisse der Menschen in dieser Zeit zu
ermöglichen. Insbesondere die szenische Umsetzung von Briefwechseln
zwischen „der Heimat und den Lieben an der Front“ lassen klar
erkennen: Da war nichts vorhanden von dem aus propagandistischen
Gründen so gerne vorgeführten „Hurra-Patriotismus“ offizieller
Verlautbarungen.
In eindringlich-bewegender, höchst sensibler Weise ist es
dem Autor in dieser Dokumentation gelungen, über zeitgenössische
Sequenzen aus Wochenschauen und privat gedrehten, frühen Filmen
sowie durch private Fotografien eine Annäherung an die wahren
Gefühle und Verhältnisse der Menschen in dieser Zeit zu
ermöglichen. Insbesondere die szenische Umsetzung von Briefwechseln
zwischen „der Heimat und den Lieben an der Front“ lassen klar
erkennen: Da war nichts vorhanden von dem aus propagandistischen
Gründen so gerne vorgeführten „Hurra-Patriotismus“ offizieller
Verlautbarungen.
In den vier Familiengeschichten spiegelt sich der Krieg in all
seinem sich steigernden Grauen. Mit drei dieser Geschichten rücken
Autor und Redakteurin durchaus prominente Zeitzeugen ins
Rampenlicht: Die Familie des großbürgerlichen
Filzfabrikanten Hähnle aus Giengen a.d. Brenz, der
bis zum Kriegsbeginn u.a. auch die Fabriken von Margarete Steiff
mit Filzprodukten belieferte, dann aber seine gesamte Produktion
auf Filzdecken, Ummantelungen von Feldflaschen u.ä.m. umstellen
musste. Seine Frau Lina Hähnle, die im Jahr 1899 in Stuttgart den
Bund für Vogelschutz - heute Naturschutzbund
Deutschland – gründete, richtete in dem Fabrikgebäude in Giengen
ein großes Lazarett ein.
Der zweite prominente Name in dem Film ist der des Freiburger
Verlegers Hermann Herder. „Mehr
als in anderen Gegenden des Deutschen Reichs sind die Menschen im
Südwesten mit dem Krieg konfrontiert“, beschreibt der SWR in einem
Begleittext zu der Dokumentation die damalige Situation in der
Münsterstadt. „Die Region ist Auf- und Durchmarschgebiet für die
Westfront. Kanonendonner und Kampflärm aus den Vogesen sind bis
Freiburg zu hören und schüren bei Kriegsbeginn massive Ängste. In
Freiburg gründet Charlotte Herder ein Lazarett in den Verlagsräumen
ihres Mannes. Obwohl sie zum wohlhabenden Freiburger Großbürgertum
gehört, spürt auch sie die zunehmende Not am eigenen Leib. Und sie
erlebt, wie bereits im Ersten Weltkrieg im Südwesten Zivilisten
Opfer des Bombenkrieges werden“.
Der dritte Name führt, zumindest in Ansätzen, auch in die Pfalz
und nach Speyer: Elly Heuss-Knapp, Ehefrau des
späteren ersten Bundespräsidenten der neuen Bundesrepublik
Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und Gründerin des
„Müttergenesungswerkes“ mit verwandtschaftlichen Beziehungen in die
Domstadt Speyer, wo sie auch später immer wieder gerne zu Gast
waren, organisiert in Heilbronn Arbeit und Versorgung für
Soldatenfrauen. Am Kriegsende bangt sie um das Leben ihres Vaters
im elsässischen Straßburg, das inzwischen wieder Frankreich
zugeschlagen worden war. Für ihr Engagement wird Elly Heuss-Knapp
im dritten Kriegsjahr mit einem vom württembergischen König Wilhelm
gestifteten und nach seiner Frau Charlotte benannten Orden geehrt,.
Spöttisch kommentiert Elly Heuss-Knapp diese Ehrung: „Schade nur,
dass der Orden die Initialen des Königspaares Wilhelm und Charlotte
trägt“...... Galgenhumor angesichts einer sich zunehmend
verschlechternden Gesamtsituation?
Siehe: SWR-Video „Verleihung des Charlottenordens“

Der vierte Name schließlich ist eigentlich mehr durch einen
glücklichen Zufall in den Film geraten. Auf der Suche nach Briefen
der Söhne der Pfälzer Heimatdichterin Lina Sommer kam die
SWR-Redakteurin mit Wiltrud Ziegler, Historikerin
aus Weyher an der Weinstrasse, ins Gespräch. Dabei erfuhr sie, dass
die „Spur Lina Sommer“ sie ins rechtsrheinische „Ausland“, nach
Baden führen würde und damit die Pfalz als wichtiger Region im
Drehbuch für ihre Dokumentation wieder ausfallen würde. Doch da
konnte ihr Wiltrud Ziegler helfen: Sie verwies auf einen im
Landesarchiv in Speyer verwahrten Briefwechsel aus weit über 1.000
Briefen, den ihre Großmutter in der Kriegszeit mit ihren sechs
Söhnen geführt hatte, die allesamt zum „Dienst für Kaiser und
Vaterland“ einrücken mussten. „Für mich war das der größte Treffer
meiner beruflichen Karriere“, erinnerte sich Gabriele Trost gestern
abend - innerlich noch immer spürbar aufgewühlt. Denn drei der
Söhne des Ehepaares Ziegler blieben in diesem Krieg auf den
Schlachtfeldern im Westen. Die Korrespondenz aber schildert
ungeschminkt und in bewegenden Worten die Zustände in den von
Dauerbeschuss aufgewühlten Schützengräben des Stellungskrieges –
auf der anderen Seiten aber auch die immer schwierigere Situation
zuhause, wo die Frauen allein den Weinbaubetrieb „über Wasser
halten“ mussten.
Siehe auch: SWR-Video „Todesmeldung Georg Ziegler“

 Norbert Ziegler, heute 85 und Sohn des den Krieg
überlebenden Jakob Ziegler sowie zahlreiche
Mitglieder seiner vielköpfigen Familie waren an diesem Abend nach
Speyer gekommen, um der Vorführung beizuwohnen. Sie zeigten sich im
Anschluss daran tief bewegt und dankbar dafür, diese dramatisierte
Fassung ihrer eigenen Familiengeschichte als erste miterleben zu
können.
Norbert Ziegler, heute 85 und Sohn des den Krieg
überlebenden Jakob Ziegler sowie zahlreiche
Mitglieder seiner vielköpfigen Familie waren an diesem Abend nach
Speyer gekommen, um der Vorführung beizuwohnen. Sie zeigten sich im
Anschluss daran tief bewegt und dankbar dafür, diese dramatisierte
Fassung ihrer eigenen Familiengeschichte als erste miterleben zu
können.
 Wie sehr die Menschen in der Region aber - entgegen allen
anderen Erwartungen - die Situation vor einhundert Jahren bewegt,
bewies die anschließende intensive Frage- und Diskussionsrunde, die
- angeregt und sachkundig moderiert vom Leiter des Speyerer
Landesarchivs, Dr. Walter Rummel - nach anfänglichem
Zögern in Gang kam. In sie schaltete sich dann auch der
frühere Landrat von Ludwigshafen und Regierungspräsident a.D. Dr.
Paul Schädler ein, der die Situation am Vorabend des
Ersten Weltkrieges mit der gegenwärtigen Lage in der Ukraine und
auf der Krim verglich. „Hoffen wir, dass die heute verantwortlichen
Politiker gemässigter und vernünftiger zu handeln in der Lage sind
als ihre Vorgänger im Jahr 1914“, so Dr. Schädler, der im 2.
Weltkrieg auch selbst drei Brüder seines Vaters verloren hat –
einen davon vor Stalingrad.
Wie sehr die Menschen in der Region aber - entgegen allen
anderen Erwartungen - die Situation vor einhundert Jahren bewegt,
bewies die anschließende intensive Frage- und Diskussionsrunde, die
- angeregt und sachkundig moderiert vom Leiter des Speyerer
Landesarchivs, Dr. Walter Rummel - nach anfänglichem
Zögern in Gang kam. In sie schaltete sich dann auch der
frühere Landrat von Ludwigshafen und Regierungspräsident a.D. Dr.
Paul Schädler ein, der die Situation am Vorabend des
Ersten Weltkrieges mit der gegenwärtigen Lage in der Ukraine und
auf der Krim verglich. „Hoffen wir, dass die heute verantwortlichen
Politiker gemässigter und vernünftiger zu handeln in der Lage sind
als ihre Vorgänger im Jahr 1914“, so Dr. Schädler, der im 2.
Weltkrieg auch selbst drei Brüder seines Vaters verloren hat –
einen davon vor Stalingrad.
Dass sich am Ende der Filmvorführung die Ergriffenheit über das
Gesehene erst langsam löste und sich dann in lang anhaltendem
Beifall entlud, kann als Zeichen dafür bewertet werden, dass die
„Macher“ mit diesem Film die Herzen ihrer Zuschauer getroffen
haben.
Die 90minütige Langfassung des Filmes zeigt der Südwestrundfunk
am Sonntag, dem 6. April 2014, um 2015 Uhr in seinem 3.
Fernsehprogramm. Man darf gespannt sein. Foto: gc
02.04.2014
Plakate und Maueranschläge aus der Zeit von 1914 bis 1919
-01.jpg) Eine außergewöhnliche Annäherung an den 100. Jahrestag des
Beginns des Ersten Weltkriegs
Eine außergewöhnliche Annäherung an den 100. Jahrestag des
Beginns des Ersten Weltkriegs
cr. Speyer- Ganz im Zeichen der
Erinnerung an den 100. Jahrestag des Ausbruchs des Ersten
Weltkrieges wird das Jahr 2014 auch für politisch und
zeitgeschichtlich interessierte Menschen in der Metropolregion
Rhein-Neckar stehen. An einem der kulturellen Zentren in der Pfalz,
dem Standort Speyer des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz
LBZ - der traditionsreichen „LaBi“ - wird wohl die „Ausstellung
über den Ersten Weltkrieg in der Metropolregion Rhein-Neckar“ zu
einem der herausragenden Höhepunkte werden, die am 28. Mai 2014 von
dem früheren rheinland-pfälzischen Ministerpräsidenten Kurt Beck im
LBZ in Speyer eröffnet werden wird.
-01.jpg) Dieses Gedenkjahr hat jetzt in der Speyerer 'LaBi' mit
einer ganz besonderen Annäherung an den Alltag in der Zeit des
Ersten Weltkrieges begonnen: Dr. Armin Schlechter, Leiter
der Abteilung „Handschriften und alte Drucke“ des LBZ,
hatte die gut 700 Exponate umfassende Sammlung von Plakaten und
Maueranschlägen des Hauses aus der Zeit von 1914 bis in die Zeit
der französischen Besetzung im Jahr 1919 bearbeitet und diese
damals entstandenen Medien nach ihren inhaltlichen Aussagen,
Zielsetzungen und Adressaten geordnet.
Dieses Gedenkjahr hat jetzt in der Speyerer 'LaBi' mit
einer ganz besonderen Annäherung an den Alltag in der Zeit des
Ersten Weltkrieges begonnen: Dr. Armin Schlechter, Leiter
der Abteilung „Handschriften und alte Drucke“ des LBZ,
hatte die gut 700 Exponate umfassende Sammlung von Plakaten und
Maueranschlägen des Hauses aus der Zeit von 1914 bis in die Zeit
der französischen Besetzung im Jahr 1919 bearbeitet und diese
damals entstandenen Medien nach ihren inhaltlichen Aussagen,
Zielsetzungen und Adressaten geordnet.
Dabei wies Dr. Schlechter gleich zu Beginn seines mit vielen
Abbildungen illustrierten Vortrages darauf hin, dass die
entsprechenden Drucke auf deutscher Seite fast ausschließlich zur
Bekanntmachung offizieller Verlautbarungen verwendet wurden,
während Plakate und Flugblätter der französischen und englischen
Kriegsgegner weitaus häufiger zur Verbreitung propagandistischer
Parolen genutzt worden seien. So wurden mit Hilfe eines
ausgeklügelten, technischen Systems über der deutsche Stellungen
aus Fesselballons Flugblätter abgeworfen, mit denen die Soldaten
zur Kapitulation oder zum Überlaufen aufgerufen wurden. „Die
Deutschen haben eine solche Propaganda abgelehnt und als Verstoss
gegen die 'Haager Landkriegsordnung' verstanden“, betonte der
Referent. Die deutschen Plakate und Maueranschläge hätten sich
deshalb auch ausschließlich an deutsche Bürger gerichtet, um sie
z.B. über aktuell gültige Höchstpreise für Lebensmittel und andere
Waren zu informieren.
-01.jpg) Aber auch andere, kriegsrelevante Verlautbarungen seien
auf diesem Wege verbreitet worden: Aufrufe an junge Männer zur
Gestellung für die Musterung, Verhaltensregeln bei
Fliegerangriffen, Aufrufe zu patriotischen Kriegsspenden („Gold gab
ich für Eisen“) und Kriegsanleihen, Appelle zur materiellen
Unterstützung Verwundeter oder von Hinterbliebenen gefallener
Soldaten.
Aber auch andere, kriegsrelevante Verlautbarungen seien
auf diesem Wege verbreitet worden: Aufrufe an junge Männer zur
Gestellung für die Musterung, Verhaltensregeln bei
Fliegerangriffen, Aufrufe zu patriotischen Kriegsspenden („Gold gab
ich für Eisen“) und Kriegsanleihen, Appelle zur materiellen
Unterstützung Verwundeter oder von Hinterbliebenen gefallener
Soldaten.
Daneben sollten die zum Teil höchst kunstvoll gestalteten
Plakate und Maueranschläge die Menschen in Zeiten zunehmender
kriegsbedingter Verknappung von Lebensmitteln und anderer,
„kriegswichtiger“ Güter zur Sparsamkeit aufrufen und ihnen
Alternativen zu den gewohnten Produkten nahe bringen. So wurden sie
zum Sammeln von Bucheckern, Kastanien, Brennesseln (Bester
Ersatz für Baumwolle) und Wildgemüse aufgefordert - Obstkerne
sollten als Grundlage für die Ölgewinnung die Ölfrüchte
ersetzen.
Auch Plakate als Werbung für kulturelle Ereignisse in
Kriegszeiten wurden vorgestellt: Theateraufführungen der „großer
Klassiker“ und Konzerte für Soldaten, Verwundete und Zivilisten
sollten die Stimmung an der Front und zuhause 'hoch' halten.
Und dann gab es auch zum Kriegsende wieder neue Verlautbarungen
– patriotische Durchhalteparolen bis zur Ankündigung der
Kapitulation - zunächst noch von der bayerischen Regierung und von
den militärischen Kommandostellen von München bis nach Landau und
Germersheim, ehe dann nach der Besetzung der Pfalz Ende 1918 auf
den Plakaten Befehle französischer Militärs in französischer
Sprache das Straßenbild bestimmten.
Lesen Sie den Vortrag von Dr. Armin Schlechter
im Wortlaut im SPEYER-KURIER 
-01.jpg) Plakate – sie waren, wie Dr. Schlechter es schilderte,
also auch ein Stück „psychologischer Kriegsführung“, die so wohl
zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte zum Einsatz kamen – zuhause
und an den Fronten des Weltkrieges.
Plakate – sie waren, wie Dr. Schlechter es schilderte,
also auch ein Stück „psychologischer Kriegsführung“, die so wohl
zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte zum Einsatz kamen – zuhause
und an den Fronten des Weltkrieges.
Zu Beginn dieses spannenden Vortragsabends hatte die
Standortleiterin des LBZ in Speyer, Ute Bahrs, ein
wiederum vielköpfiges Auditorium begrüßen können - an seiner Spitze
den Speyerer Oberbürgermeister Hansjörg Eger und
seinen Amtsvorgänger Werner Schineller. Unter den
Gästen sah man u.a. auch den früheren Neustadter
Regierungspräsidenten Rainer Rund sowie in
Vertretung des verhinderten Standortältesten der Speyerer
Bundeswehrgarnison, Oberstleutnant Stefan Jeck, an
der Spitze einer kleinen Abordnung von Offizieren aus der
Kurpfalzkaserne Oberstleutnant Jürgen Manthey.
Übrigens setzt das LBZ seine Veranstaltungsreihe zur Geschichte
des Ersten Weltkrieges bereits am Dienstag, dem 1. April
2014 um 19.00 Uhr am Standort Speyer fort. Dann zeigt der
Südwestrundfunk in einer
Vorpremiere seine Dokumentation „Der Erste
Weltkrieg im Südwesten“. Foto: gc; Plakate:
LBZ
26.03.2014
Vortrag von Dr. Armin Schlechter in der Pfälzischen Landesbibliothek
Die Pfalz im Ersten Weltkrieg im Spiegel der
Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek in
Speyer
-01.jpg) Die Pfälzische Landesbibliothek, seit 2004 Teil des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, wurde im Jahr 1921
begründet und zwei Jahre später eröffnet. Ihre den Ersten Weltkrieg
betreffenden Sammlungen sind mithin erst retrospektiv erworben
worden. Den zweifellos wichtigsten Fonds bilden etwa 700 Plakate
und Maueranschläge aus der Zeit von 1914 bis 1919 einschließlich
des ersten Jahres der Besetzung durch französische Truppen ab Ende
November 1918. Diese Plakate sind Teil einer größeren, zusammen
etwa 2.500 Einheiten umfassenden Sammlung, die vom Beginn des
Ersten Weltkriegs bis etwa 1950 reicht. Diese Plakatsammlung stammt
aus unterschiedlichen, heute nicht mehr in Gänze fassbaren Quellen,
die aber in der Pfalz zu vermuten sind. Teils handelt es sich um
druckfrische Exemplare, teils um tatsächlich öffentlich ausgehängte
Plakate oder Anschläge, wie beispielsweise typische
Verschmutzungen, Reißnagelspuren oder sogar Putzreste zeigen.
Die Pfälzische Landesbibliothek, seit 2004 Teil des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, wurde im Jahr 1921
begründet und zwei Jahre später eröffnet. Ihre den Ersten Weltkrieg
betreffenden Sammlungen sind mithin erst retrospektiv erworben
worden. Den zweifellos wichtigsten Fonds bilden etwa 700 Plakate
und Maueranschläge aus der Zeit von 1914 bis 1919 einschließlich
des ersten Jahres der Besetzung durch französische Truppen ab Ende
November 1918. Diese Plakate sind Teil einer größeren, zusammen
etwa 2.500 Einheiten umfassenden Sammlung, die vom Beginn des
Ersten Weltkriegs bis etwa 1950 reicht. Diese Plakatsammlung stammt
aus unterschiedlichen, heute nicht mehr in Gänze fassbaren Quellen,
die aber in der Pfalz zu vermuten sind. Teils handelt es sich um
druckfrische Exemplare, teils um tatsächlich öffentlich ausgehängte
Plakate oder Anschläge, wie beispielsweise typische
Verschmutzungen, Reißnagelspuren oder sogar Putzreste zeigen.
Die einzelnen Plakate der Sammlung sind bisher nicht
erschlossen, aber als Grundlage für die weitere Arbeit komplett
nach verschiedenen Gruppen sortiert. Begonnen wurde mit der
konservatorischen Sicherung der Sammlung. Ein Teil der Plakate
weist Risse und Verschmutzungen auf, bei anderen wurde zeitbedingt
sehr schlechtes und dünnes Papier verwendet, so daß manche Plakate
entsäuert und mit Japanpapier in der Fläche gesichert werden
müssen, was angesichts der Größe der Sammlung sehr zeitaufwendig
ist.
Zweifellos besteht ein Zusammenhang zwischen der Plakatsammlung
der Pfälzischen Landesbibliothek und den sogenannten
Kriegssammlungen der Zeit, die von öffentlichen Einrichtungen, aber
auch von Privatpersonen ab Kriegsbeginn zusammengetragen worden
sind, um dieses als überaus bedeutend empfundene Ereignis, diese
„große Zeit“, möglichst lückenlos zu dokumentieren. Neben Plakaten
gehörten dazu Feldzeitungen, Feldpostbriefe, Kriegstagebücher,
Kriegsandenken und vieles andere mehr. Bereits 1917 erschien ein
gedrucktes Verzeichnis, das die in Deutschland entstandenen
Sammlungen dieser Art dokumentierte. In Speyer begründete das
Historische Museum der Pfalz eine solche Kriegssammlung.
Wahrscheinlich schwand nach der Niederlage das öffentliche
Interesse an diesen Materialien, weshalb die Plakate letztlich ohne
nähere Bestimmungen an die Landesbibliothek abgegeben worden
sind.
Die Pfalz gehörte seit 1816, nach dem Fall Napoleons, wieder zum
Königreich Bayern, ohne allerdings über eine Landverbindung dorthin
zu verfügen. Nach der Annexion von Elsaß-Lothringen im Gefolge des
Krieges von 1870/71 hatte die Pfalz ihren jahrhundertelangen Status
als Grenzland verloren. Die ab 1871 vor allem in Landau und
Zweibrücken stationierten pfalzbayerischen Regimenter wurden im
Jahr 1900 zur 3. Infanterie-Division oder Pfälzer Division
zusammengefasst. Sie bildete mit der 4. Division das II. bayerische
Armeekorps, das seinen Sitz in Würzburg hatte. Mit königlicher
Verordnung vom 31. Juli 1914 gingen die Befugnisse vieler zivilen
Staatsbehörden auf die Militärbehörden über. Diese Aufgaben nahmen
neben dem stellvertretenden Generalkommando des II. Armeekorps in
Würzburg, bei dem die Oberhoheit lag, der Gouverneur der Festung
Germersheim sowie der Kommandeur der 6. Infanterie-Brigade in
Landau wahr.
Aufgrund ihrer grenznahen Lage spielte die Pfalz als
militärische Basis im Ersten Weltkrieg eine große Rolle. Hier waren
viele Ersatztruppenteile stationiert. Daneben gab es einige
Lazarette, und ebenso wurden viele Kriegsgefangene hier
untergebracht. Obwohl die Front vollständig auf französischem
Territorium verlief, blieb die Pfalz nicht von direkten
Kriegseinwirkungen verschont. Der erste französische Luftangriff
auf diese Region galt am 27. Mai 1915 der Pulverfabrik in
Ludwigshafen, wobei etliche Tote zu beklagen waren. Weitere
Angriffe unter anderem auf Friesenheim im März 1918 folgten. Wie in
allen anderen deutschen Territorien wurde die Versorgungslage auch
in der Pfalz im Verlauf des Krieges immer prekärer.
Das deutsche Waffenstillstandsersuchen Ende 1918 kam für die
pfälzische Bevölkerung völlig überraschend. Die der Zensur
unterworfenen Zeitungen hatten die sich immer weiter zuspitzende
militärische Lage an der Westfront nicht in ihrem gesamten Umfang
publik gemacht. Die zeitlich folgenden revolutionären Ereignisse,
in deren Zug der USPD-Politiker Kurt Eisner am 7. November 1918 in
München die Republik ausrief, spielten in der Pfalz eine deutlich
geringere Rolle. Gemäß dem Waffenstillstandsabkommen musste dieses
Territorium bis zum 26. November 1918 von deutschen Truppen geräumt
sein. In der Folge rückten bis zum 6. Dezember die französischen
Besatzungstruppen unter General Augustin Grégoire Arthur Gérard
(1857-1926) ein, der bis zu seiner Pensionierung zum 12. Oktober
1919 die Obergewalt in diesem Gebiet innehielt. Die französische
Besetzung der Pfalz endete erst am 30. Juni 1930.
-02.jpg) Die Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek zum
Ersten Weltkrieg ist vor dem Hintergrund der unterschiedlichen
Nutzung dieser Publikationsform durch die Entente und durch die
Mittelmächte zu sehen. Während die französischen, englischen und
amerikanischen Medien dieser Art unter Verweis auf die
rückständigen Regierungsformen in Deutschland und Österreich sowie
die gegen das Völkerrecht verstoßende Besetzung des neutralen
Belgiens mit drastischen Feindbildern im Innern Propaganda gegen
ihre Gegner machten, verzichtete insbesondere Deutschland auf ein
solches Vorgehen. Die propagandistische Bekämpfung des Feindes
in gehässiger Form wurde als Verstoß gegen die Haager
Landkriegsordnung und das Völkerrecht betrachtet. Erst Ende August
1918 gab die Oberste Heeresleitung ihre Zurückhaltung in diesem
Punkt auf. Deutsche Propagandaplakate des Ersten Weltkriegs
richteten sich in erster Linie an die eigene Bevölkerung und
wollten mit didaktischer Zielrichtung den von den Feinden erhobenen
Vorwurf des deutschen Militarismus und der Unkultur widerlegen.
Die Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek zum
Ersten Weltkrieg ist vor dem Hintergrund der unterschiedlichen
Nutzung dieser Publikationsform durch die Entente und durch die
Mittelmächte zu sehen. Während die französischen, englischen und
amerikanischen Medien dieser Art unter Verweis auf die
rückständigen Regierungsformen in Deutschland und Österreich sowie
die gegen das Völkerrecht verstoßende Besetzung des neutralen
Belgiens mit drastischen Feindbildern im Innern Propaganda gegen
ihre Gegner machten, verzichtete insbesondere Deutschland auf ein
solches Vorgehen. Die propagandistische Bekämpfung des Feindes
in gehässiger Form wurde als Verstoß gegen die Haager
Landkriegsordnung und das Völkerrecht betrachtet. Erst Ende August
1918 gab die Oberste Heeresleitung ihre Zurückhaltung in diesem
Punkt auf. Deutsche Propagandaplakate des Ersten Weltkriegs
richteten sich in erster Linie an die eigene Bevölkerung und
wollten mit didaktischer Zielrichtung den von den Feinden erhobenen
Vorwurf des deutschen Militarismus und der Unkultur widerlegen.
Bei den etwa 700 Plakaten und Maueranschlägen der Pfälzischen
Landesbibliothek handelt es sich sicherlich nicht um eine
vollständige Sammlung der von 1914 bis 1919 in der Pfalz
verwendeten Medien dieser Art, aber zweifellos um einen sehr
umfangreichen und repräsentativen Teilbestand. Neben für das ganze
Reich gültigen Plakaten, die zum großen Teil in Berlin gedruckt
worden sind, spielen Medien dieser Art bayerischen Ursprungs eine
große Rolle. Als Herstellungsort ist neben der Hauptstadt München
vor allem Würzburg zu nennen, der Sitz des Stellvertretenden
Generalkommandos des II. Armeekorps. In der Pfalz selbst ist nur
ein Bruchteil der Plakate aller dieser Gattungen hergestellt
worden. Die Plakate und Maueranschläge sind neben den
Tageszeitungen die Hauptträger der von der Regierung und der
Militärverwaltung gesteuerten Kommunikation mit der Bevölkerung im
öffentlichen Raum.
Formal zerfallen diese Plakate in einen deutlich größeren, rein
typographischen Teil von Maueranschlägen deutscher und später
französischer militärischer Institutionen ohne repräsentativen
Anspruch, die reine Verordnungen enthalten. Teils von renommierten
Graphikern der Zeit sind dagegen die Plakate gestaltet, die sich im
Sinne der Motivierung an die Bevölkerung richteten und zu Spenden,
zum Sammeln oder zur Zeichnung von Kriegsanleihen aufriefen. Gering
ist dagegen der Anteil von eigentlichen Propagandaplakaten, die
Vergleiche zwischen Deutschland und der Entente herstellen. Während
die offiziellen Maueranschläge regelmäßig eine Datierung aufweisen,
sind viele andere Plakate ohne eine Firmierung erschienen und
lassen sich deshalb zeitlich nicht immer mit Sicherheit
einordnen.
Den Beginn des Ersten Weltkrieges dokumentiert die vom
Regierungspräsidenten der Pfalz Adolf von Neuffer im Namen des
Königs verkündete ‚Bekanntmachung über die Verhängung des
Kriegszustandes’ unter anderem mit der Verkündung des Standrechts,
zugleich eine ‚Bekanntmachung über den Übergang der vollziehenden
Gewalt auf die Militärbefehlshaber’. Bemerkenswerterweise wurde das
Datum nicht eingedruckt, sondern musste von Hand nachgetragen
werden. Offensichtlich war die Anordnung schon vor der eigentlichen
Kriegserklärung vorbereitet worden. Erhalten haben sich weiter der
Aufruf ‚An das deutsche Volk’ von Kaiser Wilhelm II. vom 6. August
1914 sowie ein ‚Extra-Blatt zur „Pfälzer Zeitung“ und zum
„Rheinischen Volksblatt“’ vom 31. Juli 1914, in dem über den
drohenden Kriegszustand und besonders ausführlich über die
russische Mobilisierung berichtet wird. Mit der Einstellung des
Privatpaketverkehrs wurde hier schon über die erste die Bevölkerung
der Pfalz direkt betreffende Maßnahme berichtet.
Beim mit etwa 200 Einheiten größten Fonds innerhalb der 700
Plakate und Maueranschläge handelt es sich um offizielle
Bekanntmachungen, die entweder Höchstpreise von Waren festsetzten,
oder im Zuge der Rationierung über die Beschlagnahme,
Bestandserhebung, Enteignung und Ablieferung einer Fülle von
landwirtschaftlichen und forstwirtschaftlichen Produkten, Kleidung,
Metallen, Chemikalien und anderem mehr informierten. Vom 1. März
1917 datiert beispielsweise die ‚Bekanntmachung betreffend
Beschlagnahme, Bestandserhebung und Enteignung sowie freiwillige
Ablieferung von Glocken aus Bronze’, die die Kirchenglocken
betraf.. Diese Verordnungen, deren Schwerpunkt in die Jahre 1916
und 1917 fällt, waren weit überwiegend für ganz Bayern gültig und
wurden entsprechend von den stellvertretenden Generalkommandeuren
des I., II. und III. Armeekorps in München, Würzburg und Nürnberg
gezeichnet. Daneben existieren Verordnungen des II. Armeekorps nur
mit Gültigkeit für die Pfalz.
Etwa 35 Musterungsaufrufe für den Landsturm, aber auch für den
vaterländischen Hilfsdienst haben sich erhalten. Für die Musterung
der in der Region lebenden österreichisch-ungarischen
Landsturmpflichtigen war das entsprechende Konsulat im badischen
Mannheim zuständig. Zur militärischen Organisation der Pfalz gehört
ein Formular des stellvertretenden Generalkommandos des II.
Armeekorps, mit dem ein Betrieb zur Erhaltung der öffentlichen
Sicherheit unter militärische Leitung gestellt werden konnte.
Weitere Maueranschläge mit Bezug zum Krieg informierten die
Bevölkerung über den Versand von Feldpostsendungen oder über den
‚Postverkehr mit Kriegs- und Zivilgefangenen im Auslande’.
Auf anderen Einblattdrucken wurde vor der herrschenden
Spionengefahr gewarnt und zur Vorsicht bei Gesprächen
aufgerufen. Die Kommandeure der 6. Infanterie-Brigade in Landau und
der Festung Germersheim erließen am 29. Mai 1917 eine ‚Anordnung
betr. unwahrer Kriegsnachrichten’, deren Verbreitung sie unter
harte Strafen stellten. Im Namen des Kommandeurs des
Kriegsgefangenenlagers Germersheim wurde am 7. Oktober 1915 eine
Verordnung zum Umgang mit Kriegsgefangenen publik gemacht, und am
21. April 1917 warnte der bayerische Kriegsminister Philipp von
Hellingrath (1862-1939) vor der vom Ausland gesteuerten Sabotage
durch diesen Personenkreis.
Auch das in der Pfalz und in Nordbaden zunehmend drängender
werdende Problem der Fliegerabwehr wird auf einzelnen Plakaten
thematisiert. Ein in München gedrucktes Plakat informierte über das
‚Verhalten bei Luftangriffen’. Die Kommandeure der 6.
Infanterie-Brigade in Landau und der Festung Germersheim
verordneten am 16. März 1917 nächtliche
Beleuchtungseinschränkungen, und die Stadt Zweibrücken machte am
12. August 1918 die Modalitäten der Bekanntmachung des
Fliegeralarms publik.
Mit knapp 150 Einheiten bilden Aufrufe an die Bevölkerung um
Spenden und um Sammlungen landwirtschaftlicher Grundstoffe sowie um
die Zeichnung von Kriegsanleihen eine bemerkenswert große Gruppe.
Zeugnisse für die Mangelwirtschaft der Zeit sind
Umrechnungstabellen mit der Angabe, welche Mengen Fleisch, Knochen
etc. für Fleischmarken zu bekommen seien. Die Bevölkerung wurde auf
graphisch teils herausragend gestalteten Plakaten zum Sammeln von
Bucheckern, Kastanien, Obstkernen, Brennesseln (Bester Ersatz
für Baumwolle) und Wildgemüse aufgefordert. Auch Obstkerne
sollten als Grundlage für die Ölgewinnung abgeliefert werden. Die
prekäre Versorgungslage wird auch aus einem Plakat deutlich, das
die Eröffnung der Kriegsküche II in Zweibrücken im Dezember 1916
ankündigte. In dieselbe Richtung zielt ein auf Zeitungspapier
gedrucktes Flugblatt mit dem Titel ‚Steckrübengerichte für 4
Personen’. Gegen die grassierende Lebensmittelspekulation in dieser
Zeit richtete sich eine ‚Warnung vor unerlaubtem
Lebensmittel-Aufkauf’.
Andere Plakate wandten sich propagandistisch an die Landwirte.
Sie fühlten sich auch in der Pfalz einerseits von den
Rationierungsvorschriften gegängelt, andererseits wanderten Bauern
aufgrund des höheren Lohns auch in die Rüstungsindustrie der Städte
ab. Eine Quelle für diese Vorgänge ist ein auf den 4. Februar 1917
datiertes und vom Chef des Kriegsamtes General Wilhelm Groener
(1887-1939) gezeichnetes Plakat mit dem Titel ‚Landarbeit ist
vaterländischer Hilfsdienst’: Wer um wenige Groschen
Mehrverdienst vom Pfluge weg zur Stadt eilt, begeht
Fahnenflucht! Insgesamt lässt sich auf der Grundlage der
erhaltenen Plakate aber feststellen, daß die Regierung in
besonderem Masse versuchte, die Bauern zu umwerben und zu
motivieren.
Die gesamte Bevölkerung sprachen andere Aufrufe mit dem Ziel an,
Gold und Schmuck insbesondere zur Finanzierung des Krieges unter
dem Motto Gold gab ich zur Wehr/ Eisen nahm ich zur Ehr zu
spenden oder zu verkaufen. Plakate mit direkten Aufforderungen,
eine bestimmte Waffengattung zu unterstützen, lassen sich im
Zusammenhang mit der Marine und insbesondere mit Bezug auf U-Boote
nach dem Beginn des uneingeschränkten U-Boot-Krieges am 1. Februar
1917 nachweisen. Hierzu gehört auch ein Aufruf zu einer
U-Boot-Spende vom 14. April 1917 unter der Schirmherrschaft des
bayerischen Königs Ludwig III. von Bayern, den eine große Zahl von
Politikern und anderen Prominenten unterstützte.
Zu Spenden zur Linderung der Not von Verletzten, Kriegsinvaliden
und Hinterbliebenen riefen etliche Organisationen auf. Am
zeitlichen Anfang steht das Deutsche Rote Kreuz, das mit einigen
Plakaten vertreten ist. Schon unmittelbar vor Kriegsbeginn warb es
1914 für eine Sammlung zugunsten der freiwilligen Krankenpflege im
Kriege, da man ja nicht wisse, wann der nächste kriegerische
Konflikt folge. Der erste Jahrestag des Kriegsausbruchs wurde 1915
zum Anlass genommen, einen jährlichen ‚Opfertag’ zugunsten der
Kriegswohlfahrt auszurichten. Andere mit Aufrufen dieser Art
bezeugte Institutionen waren die ‚Nationalstiftung für die
Hinterbliebenen der im Krieg Gefallenen’ und der ‚Deutsche
Vaterlandsdank’.
-01.jpg) Ein weiteres, regionales Beispiel für einen
Sammlungsaufruf dieser Art ist ein Plakat der ‚Freiwilligen
Familien- und Kriegsfürsorge’, das mit der Darstellung des Speyerer
Altpörtels zu einer Spende bei zeitgleichem Einschlagen eines
Nagels in das eiserne Wappen der Stadt aufforderte. Diese aus
Holz gefertigten sogenannten Nagelungsfiguren wurden in vielen
deutschen Städten zu demselben Zweck errichtet. Das Speyerer, an
der Westseite des Altpörtels aufgehängte Exemplar wurde am 28. Juni
1916 eingeweiht und hat sich im Historischen Museum der Pfalz
erhalten. Erwähnenswert ist aus der Region weiter die Mainzer
Nagelungsfigur, die bis heute im Freien vor dem Dom aufgestellt
ist.
Ein weiteres, regionales Beispiel für einen
Sammlungsaufruf dieser Art ist ein Plakat der ‚Freiwilligen
Familien- und Kriegsfürsorge’, das mit der Darstellung des Speyerer
Altpörtels zu einer Spende bei zeitgleichem Einschlagen eines
Nagels in das eiserne Wappen der Stadt aufforderte. Diese aus
Holz gefertigten sogenannten Nagelungsfiguren wurden in vielen
deutschen Städten zu demselben Zweck errichtet. Das Speyerer, an
der Westseite des Altpörtels aufgehängte Exemplar wurde am 28. Juni
1916 eingeweiht und hat sich im Historischen Museum der Pfalz
erhalten. Erwähnenswert ist aus der Region weiter die Mainzer
Nagelungsfigur, die bis heute im Freien vor dem Dom aufgestellt
ist.
Die mengenmäßig meisten, rein typographischen oder aber
bebilderten Plakate in ganz unterschiedlichen Formaten, die zu
Spenden aufrufen, stehen in Zusammenhang mit der Ludendorff-Spende,
die der neben Paul von Hindenburg einflußreichste deutsche
militärische Führer Erich Ludendorff (1865-1937) im Februar 1918
zugunsten der Kriegsbeschädigten und Hinterbliebenen begründete.
Für diesen Zweck ist eine Vielzahl von Plakaten in ganz
unterschiedlichen Formaten aufgelegt worden. Diese Initiative wurde
von Offizieren und Politikern sowie aus Kreisen der deutschen
Wirtschaft breit unterstützt.
Plakate wurden in Pfalzbayern auch zum Zwecke des Totengedenkens
genutzt. Die Hinterbliebenen erhielten, wie dieses Beispiel eines
aus Neustadt an der Weinstraße stammenden Soldaten zeigt, zur
Erinnerung an den Gefallenen aus ihrer Familie eine Lithographie,
die ihn vor einem Grab mit Kreuz und Kranz zeigt. Links sind der
Name, der militärische Rang sowie der Todestag eingedruckt, rechts
die Ehrung des Toten durch den bayerischen König Ludwig III. Das
Plakat geht auf einen Entwurf des 1868 in Schlesien geborenen
Malers, Graphikers und Bühnenbildners Fritz Erler zurück, der 1940
in München starb. Am Anfang seines Schaffens stehen
kunstgewerbliche Arbeiten. Ab Beginn des Ersten Weltkriegs war er
einer der offiziellen deutschen Militärmaler.
Mit allein 50 Plakaten kommt der Aufforderung für die Zeichnung
der zusammen neun verschiedenen, ab September 1914 etwa
halbjährlich aufgelegten deutschen Kriegsanleihen eine
herausragende Bedeutung zu, wobei besonders die Propaganda für die
8. und die 9. Anleihe gut vertreten ist. Für die Anleihe warb
Hindenburg selbst mit den Aussagen Wer Kriegsanleihe zeichnet
macht mir die schönste Geburtstagsgabe sowie Die Zeit ist
hart, aber der Sieg ist sicher. Als Adressaten werden wiederum
die Landwirte besonders angesprochen. Sie würden, so die
Plakataussage, Geräte und Material nach Friedensschluss auf der
Grundlage der Kriegsanleihen erhalten.
Aus regionaler Perspektive ist ein typographischer Einblattdruck
mit dem Titel ‚Warum muß jeder Pfälzer in Stadt und Land zur 6.
Kriegsanleihe zeichnen?’ besonders bemerkenswert. Das undatierte
Blatt verweist auf die Verheerungen des Landes im Pfälzischen
Erbfolgekrieg im Frühjahr 1689 durch französische Truppen unter
General Melac und insbesondere auf den materiellen Schaden, den die
Besetzung der Pfalz um 1800 im Zuge der französischen
Revolutionskrieg mit sich gebracht hatte. Eine Wiederholung dieser
Vorgänge lasse sich nun durch finanzielle Opfer im Vorfeld
vermeiden, eben die Zeichnung der Kriegsanleihe, so die Aussage des
Plakats.
Vergleichsweise neue Wege der Werbung für die Kriegsanleihe
gehen von der Druckerei B. Heller in München hergestellte, farbige
Einblattdrucke, die in Form eines mit Versen unterlegten Comics zur
Zeichnung von Kriegsanleihen auffordern. Das ‚Der Weg des Geldes’
betitelte Blatt mit Versen des Schriftstellers und Journalisten
Gustav Hochstetter (1873-1944) und Bildern des renommierten
Graphikers Walter Trier (1890-1951) richtet sich an verschiedene
wirtschaftlich erfolgreiche Berufsgruppen, einen
Bauersmann, einen Handwerksmeister, einen Kaufmann und
einen Fabrikanten, denen die Kriegsanleihe als vorteilhafte
Anlageform und zugleich vaterländische Pflicht suggeriert wird:
Wir Alten/ Wir schaffen mit, das Land zu halten;/ Auch unser
Taler kann was zwingen/ und hilft – den Frieden zu
erringen!
Unter den zusammen 150 Aufrufen zu Spenden, zum Sammeln von
landwirtschaftlichen Rohstoffen und in der Werbung für die
Kriegsanleihe finden sich besonders viele Arbeiten bekannter
deutscher Graphiker und Künstler. Vertreten sind in der Sammlung
der Pfälzischen Landesbibliothek unter anderem Arbeiten des
Gebrauchsgraphikers, Typographen und Malers Lucian Bernhard
(1883-1972), des Gebrauchsmalers und Dekorationsmalers Julius
Gipkens (geb. 1883), des Graphikers, Malers und Illustrators Ludwig
Hohlwein (1874-1949; Abb. 34), des Malers und
Graphikers Louis Oppenheim (1879-1936) sowie des Marinemalers Willy
Stöwer (1864-1931).
Mit etwa 20 Einheiten ist die Zahl der Plakate, die im engeren
oder weiteren Sinn auf Propaganda abzielen, verhältnismäßig gering.
Zu diesem Genre gehören typographische Maueranschläge, mit denen
sich der bayerische König und der deutsche Kaiser im Anschluss an
ihre entsprechenden Proklamationen bei Kriegsbeginn an das Volk
wandten. Ludwig III. gedachte am 30. April 1916 unter dem Titel ‚An
meine lieben Pfälzer’ der hundertjährigen Wiederkehr des Übergangs
der Pfalz an Bayern nach Jahren der französischen Fremdherrschaft
(Hundert Jahre sind seit dem Tage vergangen, an dem die
pfälzischen Landes nach langer Fremdherrschaft und wechselvollem
Geschicke mit der Krone Bayerns vereint wurden). Am 31. Juli
1917 sprach Ludwig III. im Maueranschlag ‚An meine Bayern’ seinen
Dank für all die Kriegsarbeit der Heimat aus. Zum
Durchhalten rief am 12. Januar 1917 Kaiser Wilhelm II. angesichts
der Kriegsziele der Entente unter dem Titel ‚An das deutsche Volk’
auf. Das kleinere des in zwei Formaten vorliegenden Aufrufs zeigt
als Illustration eine von einem Adler begleitete Germania mit
gezogenem Schwert als Führerin des Volkes.
Besonders suggestiv ist ein fiktives Zwiegespräch in Versen
zwischen den Soldaten an der Front und den Rüstungsarbeitern in der
Heimat, das in die Ausrufe Schafft rastlos Granaten! und
Wir schaffen Granaten! mündet und von den Graphikern Bruno
Héroux (1868-1944)und Egon Tschirch (1889-1948) illustriert worden
ist. Die Texte gehen auf den nicht näher fassbaren Friedrich
Balzert und den Buchhändler, Journalisten und Schriftsteller Otto
Riebicke (1889-1961) zurück. An die Presse richtete sich ein in
Zusammenhang mit dem U-Boot-Krieg stehender ‚Anhalt zur Erläuterung
der täglichen Admiralstabsberichte über versenkten Schiffsraum’ von
der Presse-Abteilung des Admiralstabs der Marine, wie die kurzen
amtlichen Mitteilungen der Bevölkerung korrekt zu erläutern
seien.
Direkte Propaganda gegen die Entente findet sich nur auf fünf
Plakaten. Unter dem Titel ‚Wer ist Militarist?’ werden auf einem
wohl 1917 gedruckten Blatt von Louis Oppenheim die Zahl der von
Preußen, Frankreich und England im Zeitraum von 1700 bis 1914
geführten Kriege sowie die jeweiligen Militäretats der Entente und
der Mittelmächte bis zum Kriegsbeginn verglichen. Ein weiteres
Blatt wohl aus den Jahren 1917/18 stellt unter der Überschrift
‚Freiheit der Meere. England der Blutsauger der Welt’ England als
die ganze Welt mit seiner Flotte bedrohender Krake dar.
Besonders hervorzuheben ist ein sehr suggestives Plakat, das
sicherlich in der frontnahen Pfalz überaus wirksam war und die
‚Brennende Wunde Frankreichs’ thematisierte, die Kampfgebiete in
Frankreich und Belgien: Ein breiter Streifen zerstörten
Gebietes zieht sich wie eine riesige Wunde durch den Nordosten
Frankreichs. Weithin Trümmerstätten ehemals blühender Städte und
Dörfer, erstorbene Industriestätten, eisendurchsetzte Aecker, die
kein Pflug mehr durchfurchen kann! Größer und größer wird täglich
die Wunde, gierig frisst das Feuer weiter, geschürt von den
Kriegshetzern Clémenceau und Lloyd George. Deutsche, denkt an
unsere Feldgrauen, die Euch und die Heimat vor gleichem Schicksal
behüten. Tatsächlich trat die unbedingte Notwendigkeit,
Deutschland vor direkten Kriegsverwüstungen zu bewahren, wie sie
vor allem Frankreich erleiden musste, im Laufe des Jahres 1918 mehr
und mehr in den Vordergrund der deutschen Politik. Zum Bereich der
direkt an die pfälzischen Bevölkerung gerichteten Propaganda
gehören auch Ankündigungen von Vorträgen des ‚Hansa-Bundes’ und des
‚Volksvereins für das katholische Deutschland’ in Kaiserslautern
und Zweibrücken mit kriegsbejahender Tendenz.
Schon der Zeit der französischen Besetzung der Pfalz ab Ende
1918 gehört ein unfirmiertes Plakat an, das erneut eine
Entwicklungslinie vom französischen General Melac, dem
Mordbrenner der Pfalz, der Ende des 17. Jahrhunderts diese
Region zerstört hatte, zu General Gérard zog, dem Giftmischer
der Pfalz, und gegen die in beiden Jahrhunderten in Landau
stationierten Besatzungstruppen agitierte: Darum Achtung Ihr
deutschen Pfälzer, Frankreich hat immer seine Mittel der Zeit
angepasst – sein unentwegtes Ziel ist aber seit Jahrhunderten die
Knechtung der deutschen Pfalz – und deren endgültigen
Raub.
Der historische Hintergrund dieses Plakats war der Versuch der
Besatzungsmacht, separatistische Bestrebungen in der Pfalz zu
fördern und auf diesem Weg einen vom Deutschen Reich unabhängigen
Pufferstaat zu schaffen. Aus diesem Grund wurden unmittelbar nach
der Besetzung alle Verbindungen der Pfalz zur Regierung in München
und zum rechtsrheinischen Gebiet unterbrochen. Das Plakat weist
keinerlei Druckvermerk auf. In einen antifranzösischen Zusammenhang
gehört offensichtlich auch ein kleiner Maueranschlag mit dem Text
Deutsch sei Dein Gruß beim Kommen und beim Scheiden/ das Wort
„Adieu“ das sollst Du ganz vermeiden, der, wie Reißnagelspuren
zeigen, offensichtlich längere Zeit öffentlich aufgehängt war.
Außerhalb der Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek
hat sich im Bereich der Nachlässe ein bemerkenswerter Fonds
erhalten, der Zeugnisse gegnerischer Propaganda überliefert. Es
handelt sich um den Nachlass von Ludwig Eid (1865-1936), ab 1909
Leiter der katholischen Lehrerbildungsanstalt in Speyer und
pfälzischer Historiker. Aus seinem Besitz stammen etwa 20
Flugblätter französischen und vor allem englischen Ursprungs, die
sich an die deutschen Soldaten richteten. Teils wurden Medien
dieser Art mittels Flugzeugen über feindlichem Territorium
abgeworfen. Die Flugblätter aus dem Nachlass Eid wurden zumeist mit
Ballons über die Frontlinie transportiert, wenn Westwind herrschte.
Die einzelnen Blätter waren gelocht und auf eine Schnur gezogen,
die mit einer Zündschnur nach einer gewissen Zeit gelöst wurde.
Die englischen Flugblätter dieser Art gehören zur A.P.-Serie
(Aerial propaganda), von denen zusammen 95 Einheiten
hergestellt worden sind. Sie tragen die Aufschrift By balloon/
Durch Luftballon. Es handelt sich teils um rein typographische
Plakate. Thematisiert werden beispielsweise unter dem Titel ‚Der
deutsche Friedhof in Frankreich’ die Gräber der dort gefallenen
deutschen Soldaten. Andere Plakate richten sich an die Arbeiter
unter den Soldaten, die für die kapitalistischen Interessen der
Kriegsgewinnler und für das monarchistische System ihr Leben lassen
müssten. Seltener sind illustrierte Plakate. ‚Der Todesrachen’
thematisiert den Kriegsgewinn (Daimler Actien
Kriegsgewinn), während ‚Der Letzte’ die Einberufung des
jüngsten Sohnes zeigt, nachdem sowohl der Vater als auch die
älteren Brüder bereits gefallen sind. Es lässt sich nicht sagen,
welche Wirkung dieser Art von Feindpropaganda beschieden war; die
auch in der Pfalz mehr und mehr zunehmende Kriegsmüdigkeit dürfte
andere Ursachen gehabt haben..
Nur wenige Plakate der Pfälzischen Landesbibliothek gehören zu
den Genres Werbung und Kultur. Erhalten hat sich ein Angebot von
Kriegsversicherungen durch die ‚Lebensversicherungs-Gesellschaft
oesterreichischer Phönix’. Aus dem Bereich des Kulturlebens sind
verschiedene Ankündigungen von Theateraufführungen durch die
Volksbühne des stellvertretenden General-Kommandos des 21.
Armeekorps zugleich 16. Armeekorps in Zweibrücken zu nennen.
Gespielt wurden unter anderem Lessings ‚Minna von Barnhelm’ und
Goethes ‚Iphigenie auf Tauris’. Ziel dieser Aktion war es
sicherlich, auf diese Weise Propaganda für die Militärregierung zu
machen, die der Bevölkerung ansonsten herbe Einschränkungen
auferlegen mußte. Zu nennen wäre weiter eine Ankündigung einer
‚Ausstellung der bayerischen Kriegsinvalidenfürsorge im Pfälzischen
Gewerbemuseum Kaiserlautern’ im August und September 1916.
Nur etwa ein Dutzend Blätter stammen aus der Zeit des
Kriegsendes. Dazu gehören Verlautbarungen des bayerischen
Ministerpräsidenten Kurt Eisner, in denen die revolutionäre
Regierung in Programm vorstellte, aber auch die Aufrechterhaltung
der öffentlichen Ordnung thematisiert. Das Stellvertretender
Generalkommando und der Oberbefehlshaber des Arbeiter- und
Soldatenrates beim stellvertretenden Generalkommando riefen die
Pfälzer Ende November 1918 auf, trotz des unmittelbar
bevorstehenden Einmarsches der französischen Besatzungstruppen in
der Pfalz zu bleiben, da die Lebensmittelversorgung von
Flüchtlingen unmöglich wäre. Zudem würde man sein Eigentum am
besten schützen, wenn man es nicht verlassen würde. Andere Plakate
der neuen Regierung stellten den offensichtlich grassierenden
Diebstahl von Militärbesitz unter Strafe.
Schon Ende November setzten die zusammen etwa 140 Maueranschläge
der französischen Besatzungsmacht in der Plakatsammlung ein. Am
zeitlichen Anfang steht ein Aufruf von Maréchal Ferdinand Foch
(1851-1929), ab dem 14. April 1918 Oberbefehlshaber der alliierten
Streitkräfte, der die Übernahme des Oberbefehls im Land ankündigt.
Die sich anschließenden, teils einschneidenden und viele
Lebensbereiche betreffenden, meist zweisprachigen
Arrêtés/Verordnungen sind dann von General Gérard gezeichnet und
beginnen mit der Aufforderung zur Wohnsitzanmeldung der pfälzischen
Bevölkerung vom 30. November 1918. Eine gewisse Erleichterung der
Ausgangssperre wurde erst am 28. Juni 1919 von ihm erlassen,
nachdem die deutsche Regierung der Unterzeichnung des
Friedensvertrags zugestimmt hatte und zusätzlich das Verhalten der
Pfälzer gegenüber der Besatzungsmacht keinen Anlass zur Klage gebe
(Tenant à donner le plus tôt possible une certaine liberté aux
habitants du Palatinat qui n’ont pas cessé de se montrer déférents
vis-à-vis de l’autorité militaire française).
Den Schwerpunkt der Sammlung von Plakaten und Maueranschlägen
der Pfälzischen Landesbibliothek aus dem Ersten Weltkrieg liegt bei
offiziellen Plakaten. Die drei Zentren der Herstellung dieser
Medien sind vor dem Hintergrund der Zugehörigkeit der Pfalz zu
Bayern München und Würzburg sowie auf Reichsebene Berlin. Die Zahl
der nur die Pfalz betreffenden Plakate und Anschläge ist dagegen
deutlich geringer. In der Summe wären die in dieser Sammlung zu
findenden Medien dieser Art auch für andere Regionen Bayerns oder
Deutschlands repräsentativ. Thematisiert wird in erster Linie die
Mangelwirtschaft, gefolgt von direkten Auswirkungen des Kriegs auf
das Land. Einen großen Raum nehmen Aufrufe zu Spenden, Sammlungen
von Rohstoffen oder zur Zeichnung von Kriegsanleihen ein. Die
einzelnen Medien zeichnen das Bild eines Landes unter
Militärverwaltung mit vielen Vorschriften und einer Fülle von
Strafandrohungen, dessen Versorgungslage sich mehr und mehr
verschlechterte.
Direkte, gegen die Entente gerichtete Propagandaplakate sind
dagegen sehr selten. Ein spezifisch pfälzisches und in dieser Zeit
bewusst reaktiviertes Phänomen war das Misstrauen gegenüber
Frankreich aufgrund der Verwüstungen des Pfälzischen Erbfolgekriegs
Ende des 17. Jahrhunderts und der französischen Revolutionskriege
in den Jahren um 1800. Ein weiteres spezifisch pfälzisches Element
ist aufgrund der Nähe der Front insbesondere der Luftkrieg gewesen,
der diese Region zu einem potentiell besonders bedrohten
Territorium machte. Das wichtigste pfälzische Kriegsziel, dieses
Territorium von direkten Kriegseinwirkungen freizuhalten,
scheiterte nach dem Waffenstillstand mit der Besetzung durch
französische Truppen; allerdings blieb die Pfalz immerhin von
direkten Kampfhandlungen verschont.
Die Sammlung von Kriegsplakaten in der Pfälzischen
Landesbibliothek ist eine wichtige Quellengruppe zum Ersten
Weltkrieg in der Pfalz. Hohen Zeugniswert hat sie insbesondere für
die Kommunikation zwischen Regierung und Bevölkerung im
öffentlichen Raum, die grundsätzlich von den Herrschaftszentren
gesteuert und um vergleichsweise wenige regionale Erzeugnisse
ergänzt wurde. Der Alltag der Bevölkerung lässt sich auf dieser
Grundlage erschließen; sie selbst kommt bei dieser Quellengruppe
aber überhaupt nicht zu Wort.
Abschließend möchte ich auf eine Ausstellung zum Ersten
Weltkrieg in der Metropolregion Rhein-Neckar hinweisen, die am 28.
Mai 2014 von dem ehemaligen rheinland-pfälzischen
Ministerpräsidenten Kurt Beck hier im Haus eröffnet werden wird.
Sie wird zur Zeit erarbeitet konzipiert in Zusammenarbeit der
Archive der Metropolregion und der Pfälzischen Landesbibliothek und
ist als Wanderausstellung gedacht. Neben dem
Landesbibliothekszentrum haben verschiedene Archive der Region
Exponate beigesteuert, die den Alltag der Pfalz im Ersten Weltkrieg
mit ganz unterschiedlichen Zeugnissen illustrieren können.
26.03.2014
Säurehaltiges Papier gefährdet über 70.000 Regalmeter voller Bücher, Archivalien und Dokumente
-01.jpg) LBZ und Landesarchiv befürchten schleichende Zersetzung
großer Teile ihrer Bestände
LBZ und Landesarchiv befürchten schleichende Zersetzung
großer Teile ihrer Bestände
cr. Speyer- Auf die latent drohende Gefahr
einer „schleichenden, inneren Zersetzung und damit
Selbstzerstörung“ großer Teile ihrer Bestände mit Nachdruck
hinzuweisen – dazu sahen sich jetzt auch die Verantwortlichen von
Landesbibliothek und Staatsarchiv in Speyer aufgerufen. Fünf Jahre
nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs und zehn Jahre nach dem
verheerenden Brand in der „Herzogin Anna Amalia Bibliothek“ in
Weimar und damit dem Untergang unwiederbringlicher Kulturgüter
hatten deshalb die Leiterin des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz LBZ, Dr. Annette Gerlach und der
Standortleiter des Landesarchivs in Speyer, Dr. Walter
Rummel gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung
„Handschriften und Alte Drucke“ des LBZ, Dr. Armin
Schlechter, zu einer gemeinsamen Pressekonferenz
eingeladen, um die mit der dringend notwendigen Rettung und
Sicherung von Büchern und Archivalien einhergehende, schier
übergroße Herausforderung zu umreißen.
Zu diesem gemeinsamen Schritt in die Öffentlichkeit hätten sich
LBZ und Landesarchiv auch deshalb entschlossen, weil im Zuge der
gegenwärtig laufenden Sanierungs- und Ausbauarbeiten in ihrer
Einrichtung in einer Decke ein unter Druck stehendes Wasserrohr
angebohrt worden war und das ausströmende Wasser 17 laufende
Regalmeter voller Archivalien durchnässt hatte. „Ein 'kleiner
Ernstfall' nur für uns“, so Dr. Rummel - jedoch nur ein kleiner
Schaden im Vergleich zu dem, was sich in Köln, Weimar oder auch in
Dresden durch das Elbhochwasser ereignet hatte. In Speyer habe man
die durchnässten Blätter auf zufällig im Hause befindlichen
Gerüsten ausbreiten und sie innerhalb weniger Tage „gewellt und
muffig“ wieder trocknen können.
-01.jpg) Wenn in zwei Monaten das Dach des gemeinsamen Gebäudes in
der Speyerer Otto-Mayer-Straße 9 geöffnet werde, um Platz für ein
weiteres Stockwerk und damit für weitere Magazinflächen zu
schaffen, dann würden vorsorglich die dort gelagerten Bestände für
die Dauer der Bauzeit wasserdicht verpackt. „Für die Nutzer
bedeutet das allerdings, dass sie auch einmal etwas länger auf die
Ausgabe einer gewünschten Archivalie oder eines Buches warten
müssen oder dass eine Bereitstellung zeitweise überhaupt nicht
möglich sein wird“, bat Dr. Rummel dazu die Nutzer um
Verständnis.
Wenn in zwei Monaten das Dach des gemeinsamen Gebäudes in
der Speyerer Otto-Mayer-Straße 9 geöffnet werde, um Platz für ein
weiteres Stockwerk und damit für weitere Magazinflächen zu
schaffen, dann würden vorsorglich die dort gelagerten Bestände für
die Dauer der Bauzeit wasserdicht verpackt. „Für die Nutzer
bedeutet das allerdings, dass sie auch einmal etwas länger auf die
Ausgabe einer gewünschten Archivalie oder eines Buches warten
müssen oder dass eine Bereitstellung zeitweise überhaupt nicht
möglich sein wird“, bat Dr. Rummel dazu die Nutzer um
Verständnis.
Verarbeitung von Holzbestandteilen bei der
Papierproduktion gefährdet langfristig die Bestände
Das weitaus größere Problem aber stelle die dauerhafte Gefahr
dar, dass in den nächsten ein- bis zweihundert Jahren säurehaltige
Bücher, Dokumente und Archivalien von innen heraus zu zerfallen
drohten, erläuterte Dr. Annette Gerlach. Die Schuld an diesem
„Prozess der Selbstzerstörung“ trage der seit dem Ende des 19.
Jahrhunderts übliche Einsatz von Holzbestandteilen bei der
Papierherstellung.
-01.jpg) LBZ und Landesarchiv stünden deshalb heute vor sage und
schreibe 70.000 (!) Regalmetern voller Bücher, Archivalien und
anderen Drucksachen, die akut vom Säurefrass befallen seien – zwei
Drittel davon allein am Standort Speyer. „Am heftigsten drängt uns
der Zerfall von all dem, was zwischen den Jahren 1840 bis 1990
geschrieben und gedruckt wurde“, so die Bibliotheksleiterin, die
darauf verwies, dass mangels zureichender Finanzmittel, vor allem
aber spezialisierter Buchrestauratoren man dazu habe übergehen
müssen, für die Langzeitsicherung ein Priorisierungsverfahren
einzuführen. „Wir mussten uns entscheiden, was gerettet werden
sollte und was wir aufgeben müssen“.
LBZ und Landesarchiv stünden deshalb heute vor sage und
schreibe 70.000 (!) Regalmetern voller Bücher, Archivalien und
anderen Drucksachen, die akut vom Säurefrass befallen seien – zwei
Drittel davon allein am Standort Speyer. „Am heftigsten drängt uns
der Zerfall von all dem, was zwischen den Jahren 1840 bis 1990
geschrieben und gedruckt wurde“, so die Bibliotheksleiterin, die
darauf verwies, dass mangels zureichender Finanzmittel, vor allem
aber spezialisierter Buchrestauratoren man dazu habe übergehen
müssen, für die Langzeitsicherung ein Priorisierungsverfahren
einzuführen. „Wir mussten uns entscheiden, was gerettet werden
sollte und was wir aufgeben müssen“.
Jungen, an Büchern interessierten Menschen, die auf der Suche
nach einem „dauerhaft krisensicheren“ Arbeitsplatz seien, empfahl
sie deshalb, eine Ausbildung als BuchrestauratorIn in Erwägung zu
ziehen. „Denn allein für die Restaurierung der gegenwärtig zur
Langzeitsicherung noch überwiegend in tiefgefrorenem Zustand
aufbewahrten Bestände, die beim Einsturz des Kölner Stadtarchivs
durchnässt oder auf anderem Wege zu Schaden gekommen sind, werden
Restauratoren noch Arbeit für mehrere Jahrhunderte haben“,
prognostizierte Dr. Gerlach.
Warum das so ist, konnte Dr. Rummel in der kleinen, gemeinsam
von LBZ und Landesarchiv genutzten Restaurierungswerkstatt zeigen,
wo Beispiele beschädigter Bücher und Archivalien aufgelegt waren.
Dort können allerdings nur einzelne Blätter entsäuert, ausgebessert
und so dauerhaft gesichert werden – größere Bestände müssen in
spezialisierten Fachwerkstätten außerhalb bearbeitet werden.
-01.jpg) Am Beispiel eines Zeitungsbandes erläuterte.Dr.
Schlechter das höchst aufwändige Verfahren der Papierspaltung zur
Sicherung eines einzigen Zeitungsblattes. Dazu wird das von
Säurefrass bedrohte Blatt zunächst auf beiden Seiten mit einer
Spezialfolie beklebt. Zieht man diese beiden Folien dann
auseinander, verbleiben Vorder- und Rückseite des gedruckten
Blattes auf den beiden Trägerfolien. Dann werden beide Seiten auf
eine weitere Folie aufgebracht, die dann auf Dauer den Zeitungstext
auf beiden Seiten tragen kann. Danach können auch die Hilfsfolien
wieder abgelöst werden – die Zeitungsseite präsentiert sich im
originalen Zustand - eben halt mit einer Trägerfolie zwischen
Vorder- und Rückseite. Ein höchst aufwändiges und zeitintensives
Verfahren, bedenkt man, dass allein ein Jahrgang eines
Zeitungsbandes oft viele hundert Einzelblätter umfasst.
Am Beispiel eines Zeitungsbandes erläuterte.Dr.
Schlechter das höchst aufwändige Verfahren der Papierspaltung zur
Sicherung eines einzigen Zeitungsblattes. Dazu wird das von
Säurefrass bedrohte Blatt zunächst auf beiden Seiten mit einer
Spezialfolie beklebt. Zieht man diese beiden Folien dann
auseinander, verbleiben Vorder- und Rückseite des gedruckten
Blattes auf den beiden Trägerfolien. Dann werden beide Seiten auf
eine weitere Folie aufgebracht, die dann auf Dauer den Zeitungstext
auf beiden Seiten tragen kann. Danach können auch die Hilfsfolien
wieder abgelöst werden – die Zeitungsseite präsentiert sich im
originalen Zustand - eben halt mit einer Trägerfolie zwischen
Vorder- und Rückseite. Ein höchst aufwändiges und zeitintensives
Verfahren, bedenkt man, dass allein ein Jahrgang eines
Zeitungsbandes oft viele hundert Einzelblätter umfasst.
Doch dieses Verfahren müsste bei jeder Buchseite, bei jedem
einzelnen Archivblatt und bei jedem Dokument zur Anwendung kommen,
wollte man sämtliche Bestände vor dem drohenden Untergang retten –
eine wahre Sisyphosarbeit, die dazu geführt hat, dass immer größere
Teile der Bestände durch Mikroverfilmung und Digitalisierung
zumindest von ihrem Inhalt her bewahrt werden können. „Diese
modernen Medien aber können die ursprüngliche Wirkung des Originals
und seine Ausstrahlung nie ersetzen“, sind sich die Experten einig.
„Ein Buch z.B., in dem Goethe Anstreichungen vorgenommen hat, ist
ein einmaliges Kulturgut und durch absolut nichts zu ersetzen“, so
Dr. Gerlach. Und deshalb laute die Devise auch weiterhin:
„Restaurieren, restaurieren und noch einmal restaurieren - geht es
doch bei den bedrohten, auf Papier gedruckten oder geschriebenen
Medien um unser aller kulturelles Erbe“.
Dr. Gerlach und ihre Kollegen unterstützen deshalb auch
nachdrücklich die Bildung einer „Allianz zum Erhalt von Kulturgut“,
die sich in den kommenden Jahren den Erhalt dieser Medien zur
Aufgabe stellen will. Denn so wie in Speyer und Koblenz, dem Sitz
von LBZ und Landesarchiv, gibt es überall in der Bundesrepublik und
in Europa und der Welt Bibliotheken und Archive - Bücher, Dokumente
und Archivalien, die nach den gleichen Prinzipien bewahrt und
restauriert werden müssten. Foto: gc
Lesen Sie hierzu auch einen Einwurf von Gerhard
Cantzler 
24.03.2014
Einwurf
Grosse Vermögen zur Rettung unwiederbringlicher
Kulturgüter nutzen
Von Gerhard Cantzler
Wer begreift, welch gewaltige Aufwendungen notwendig wären, um
in der noch verbleibenden kurzen Zeit die von der Zersetzung
bedrohten gedruckten und geschriebenen, unwiederbringlichen
medialen Kulturgüter vor ihrem Untergang zu retten, der wird auch
einsehen, dass dies allein aus öffentlichen Mitteln wohl nicht
leistbar sein wird.
Doch wie wäre es, wenn der Gesetzgeber reichen Menschen in
unserer Gesellschaft, von denen wir immer wieder hören, sie würden
schon in den nächsten Jahren viele Billionen Euro „schwere“
Vermögen vererben, eine Möglichkeit anbieten würde, Teile ihrer
Vermögen steuerbegünstigt zu vererben, sofern sie diese zur Rettung
von solchen Kulturgütern einsetzen - Kulturgüter, die auch über
ihre und unsere eigene Lebenszeit hinaus nichts von ihrem Rang und
ihrer Bedeutung verlieren würden - als unser kollektives Gedächtnis
bei den Archivalien oder als jederzeit rezipierbarer Ausweis der
intellektuellen Leistungsfähigkeit von Generationen vor uns.
Doch könnten wir uns zu einem solchen Vorgehen verstehen, dann
müsste als einer der ersten Schritte die Ausweitung des Angebots an
Ausbildungsplätzen für die entsprechenden Fachleute sein.
Lohnen würde sich das sicher allemal.
Die Planungen für die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz 2014 laufen
 2014 finden zum
siebten Mal die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt
2014 finden zum
siebten Mal die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt
Speyer- Unter dem Motto
„Bibliotheken – einzigartig und vielfältig“ präsentieren sich vom
24. Oktober bis 13. November 2014 Öffentliche und
Wissenschaftliche Bibliotheken gemeinsam in der Öffentlichkeit als
Partner für Lesen, Informations- und Medienkompetenz, Weiterbildung
sowie als kultureller Veranstaltungsort und sozialer
Treffpunkt.
Die Bibliothekstage sind eine Gemeinschaftsveranstaltung, die 2001
ihre Premiere erlebten und seit der zweiten Veranstaltung 2004 alle
zwei Jahre stattfinden. Der Landesverband Rheinland-Pfalz im
Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) organisiert sie in
Kooperation mit dem Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
(LBZ), den Büchereifachstellen der Bistümer und der Landeskirchen,
dem Beirat für das öffentliche Bibliothekswesen im Mainzer
Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur
sowie den örtlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz. Die
Schirmherrschaft hatte von Beginn an Ministerpräsident Kurt Beck
übernommen; eine Tradition, die in diesem Jahr von
Ministerpräsidentin Malu Dreyer fortgeführt wird.
Derzeit laufen die Planungen für die zentral organisierten
Lesereisen, d.h. die Bibliotheken in Rheinland-Pfalz können sich
aus einem vorab erstellten Angebot Autoren oder andere
Kleinkünstler aussuchen und das LBZ stellt dann daraus eine
„Lesereise“ zusammen. Erneut wird es einen
Ausstellungsschwerpunkt „Buchkunst“ geben. Daneben planen
zahlreiche Bibliotheken eigenständige Veranstaltungen, die sie über
die Aktion „Bibliothekstage Rheinland-Pfalz“ landesweit bekannt
machen können. Wie in den Vorjahren erwarten die Veranstalter ein
reichhaltiges Angebot. 2012 waren es mehr als 400 Veranstaltungen
in über 160 Bibliotheken landesweit. Wir erwarten für 2014
ebenfalls ein breites Spektrum an Veranstaltungen: Lesungen von
Autorinnen und Autoren für alle Altersstufen, Vorträge, Workshops,
Ausstellungen, Konzerte, Mitmach-Aktionen, Bilderbuchkino,
Kindertheater, Musikkabarett und andere Kleinkunstveranstaltungen –
passend zum Motto „Bibliotheken – einzigartig und vielfältig“.
Von 2008-2012 fanden die Bibliothekstage zeitgleich
mit der dbv-Kampagne „Treffpunkt Bibliothek“ jeweils vom 24. – 31.
Oktober statt. Diese bundesweite dbv-Kampagne endete 2013. Die
Veranstaltungspartner in Rheinland-Pfalz haben sich darauf
verständigt, dass die Bibliothekstage auch in diesem Jahr am „Tag
der Bibliotheken“, dem 24. Oktober, starten sollen. Die
Auftaktveranstaltung findet in dem großartigen Neubau der
Stadtbibliothek Koblenz statt. Wegen der späten Herbstferien
erstrecken sich die Bibliothekstage in diesem Jahr erstmals über
drei Wochen. Zur Abschlussveranstaltung lädt am 13. November das
Landesbibliothekszentrum nach Speyer in die Pfälzische
Landesbibliothek zu einer internationalen Tagung zum Thema
Bibliotheken in der Öffentlichkeit – zwischen Event und
Alltagsroutine ein, die gleichzeitig auch
Jubiläumsveranstaltung zum zehnjährigen Bestehen des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz ist.
Info:
Im Deutschen Bibliotheksverband e.V. (dbv) sind ca.
2.100 Bibliotheken aller Sparten und Größenklassen Deutschlands
zusammengeschlossen. Der gemeinnützige Verein dient seit mehr als
60 Jahren der Förderung des Bibliothekswesens und der Kooperation
aller Bibliotheken. Sein Anliegen ist es, die Wirkung der
Bibliotheken in Kultur und Bildung sichtbar zu machen und ihre
Rolle in der Gesellschaft zu stärken. Zu den Aufgaben des dbv
gehören auch die Förderung des Buches und des Lesens als
unentbehrliche Grundlage für Wissenschaft und Information sowie die
Förderung des Einsatzes zeitgemäßer Informationstechnologien.
http://www.rp.bibliotheksverband.de
Deutscher Bibliotheksverband e.V. /
Landesverband Rheinland-Pfalz, Presse
31.01.2014
Elektronik erobert die Bibliotheksarbeit
 Rückblick auf zehn Jahre Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz – Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2014
Rückblick auf zehn Jahre Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz – Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2014
cr.Speyer- Am 1. September 2014 sind es
genau zehn Jahre,dass die „Pfälzische Landesbibliothek Speyer“ und
die „Bibliotheca Bipontina“ in Zweibrücken mit der „Rheinischen
Landesbibliothek Koblenz“ und den Büchereistellen in Koblenz und
Neustadt/Weinstraße zum Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz
LBZ zusammengeführt wurden. Jetzt stellte die Leiterin dieser
bedeutendsten öffentlichen Bibliothek des Landes, Dr.
Annette Gerlach in einem Pressegespräch gemeinsam mit dem
Leiter des Bereichs „Handschriften, Alte Drucke und Nachlässe“ des
LBZ, und den Standortleiterinnen der „Bibliotheca
Bipontina“, Dr. Sigrid Hubert-Reichling
und der LBZ in Speyer, Ute Bahrs, die Erfolge und
Fortschritte vor, die die Entwicklung des LBZ in den vergangenen
zehn Jahren begleiteten, in denen es sich zunehmend auch als
Kompetenzzentrum des Landes für alle Fragen im Bereich „Medien- und
Informationsvermittlung“ und als zentrale Entwicklungs- und
Beratungseinrichtung zu bibliotheksfachlichen Fragen
profilierte.
 Diese Bilanz nach zehn Jahren zeige, so Dr.
Gerlach, dass die Gründung des LBZ zu einer erheblichen
Serviceverbesserung für die Kunden der Bibliotheken und
Büchereistellen im LBZ und zu nennenswerten Synergieeffekten u.a.
bei der Arbeitsorganisation und in den Bereichen der Verwaltung und
der Informationstechnik geführt habe. Der im Jahr 2006 in Betrieb
genommene neue Online-Katalog des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz eröffne inzwischen den Zugang zu sämtlichen
Beständen der „Bibliotheca Bipontina“ Zweibrücken, der Pfälzischen
Landesbibliothek in Speyer und der Rheinischen Landesbibliothek
Koblenz als gleichberechtigte Zweigstellen in einer einheitlichen
Datenbank. Mit diesem neuen Katalog, so Dr. Gerlach, sei ein
EDV-System entstanden, das erstmals die Bestände der
Landesbibliotheken eines
Diese Bilanz nach zehn Jahren zeige, so Dr.
Gerlach, dass die Gründung des LBZ zu einer erheblichen
Serviceverbesserung für die Kunden der Bibliotheken und
Büchereistellen im LBZ und zu nennenswerten Synergieeffekten u.a.
bei der Arbeitsorganisation und in den Bereichen der Verwaltung und
der Informationstechnik geführt habe. Der im Jahr 2006 in Betrieb
genommene neue Online-Katalog des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz eröffne inzwischen den Zugang zu sämtlichen
Beständen der „Bibliotheca Bipontina“ Zweibrücken, der Pfälzischen
Landesbibliothek in Speyer und der Rheinischen Landesbibliothek
Koblenz als gleichberechtigte Zweigstellen in einer einheitlichen
Datenbank. Mit diesem neuen Katalog, so Dr. Gerlach, sei ein
EDV-System entstanden, das erstmals die Bestände der
Landesbibliotheken eines
Bundeslandes in einem gemeinsamen Katalog mit
Selbstbedienungsfunktion anbiete. Das habe zu einer deutlichen
Serviceverbesserung für die Kunden der Bibliotheken geführt, die
ausweislich der Bestellzahlen die damit verbundenen Vorteile längst
erkannt und angenommen hätten.So seien zuletzt im Jahr 2013
insgesamt 150.198 Medien als Direktbestellungen zwischen den
Standorten des LBZ als Zweigstellenbestellungen nachgefragt
worden,
Mit 29 Prozent sei mehr als ein Drittel aller
Bestellungen bei der Rheinischen Landesbibliothek Koblenz aus den
anderen Standorten des LBZ gekommen, bei der Pfälzischen
Landesbibliothek Speyer seien es 22% und bei der „Bibliotheca
Bipontina“ Zweibrücken mit 70 Prozent gar fast drei Viertel aller
Bestellungen gewesen. Auch der Service der Fernleihe werde von den
Kunden sehr gut genutzt.
Eine weitere wichtige Neuerung, so Dr. Gerlach, sei
das vom LBZ seit 2008 betriebene Internetportal „dilibri“ (www.dilibri.de). „dilibri“ sei die
digitalisierte Sammlung von landeskundlichen Werken über
Rheinland-Pfalz sowie von Beständen aus rheinland-pfälzischen
Bibliotheken. Zurzeit arbeiteten neben den Bibliotheken des LBZ die
Universitätsbibliothek Trier und die Stadtbibliotheken in Mainz und
Trier aktiv an dem Portal mit. Weitere Institutionen und Vereine
aus Rheinland-Pfalz stellten darüber hinaus ihre Bestände zur
Digitalisierung und zur Präsentation in „dilibri“ zur
Verfügung.
 Zur Zeit stehen dort 833.000 Scans in dilibri bereit, -
historische Bestände aus rheinland-pfälzischen Bibliotheken, die
die von interessierten Bürgerinnen und Bürgern direkt online
recherchiert und gelesen werden können.
Zur Zeit stehen dort 833.000 Scans in dilibri bereit, -
historische Bestände aus rheinland-pfälzischen Bibliotheken, die
die von interessierten Bürgerinnen und Bürgern direkt online
recherchiert und gelesen werden können.
Wie Dr. Gerlach weiter mitteilte, werde derzeit
federführend durch das LBZ die zusammen mit den drei anderen
rheinland-pfälzischen Bibliotheken mit regionalem Sammelauftrag –
den Stadtbibliotheken in Mainz und Trier – vorbereitete
Bibliographie landeskundlicher Werke aus Rheinland-Pfalz erstellt.
In dieser Datenbank, die seit 1996 über das Internet zugänglich ist
(www.rpb-rlp.de), seien
mittlerweile fast 400.000 Literaturhinweise recherchier- und zum
Großteil direkt bestellbar. Zusätzlich biete die
Rheinland-Pfälzische Personendatenbank mehr als 10.000
Kurzbiographien von bedeutenden Landeskindern (www.rppd-rlp.de).
Seit 2002 sammle und archiviere das LBZ auch
elektronische Publikationen und regionale Webseiten aus
Rheinland-Pfalz und stelle sie auf ihrem Archivserver edoweb -
www.edowebrlp.de dauerhaft zur
Verfügung.
Durch die Steigerung des Etats für die Beschaffung
von Büchern, Zeitschriften, elektronischen Medien und Datenbanken
im LBZ habe die Zahl der verfügbaren Medien inzwischen auf einen
Gesamtbestand von nunmehr 1. 864.467 Medieneinheiten ausgebaut
werden können. Dabei hätten in den letzten Jahren auch Ankäufe
wertvoller Antiquaria für das LBZ konnten getätigt werden. Hierzu
erinnerte die LBZ-Chefin insbesondere an die historischen
Rheinlaufkarten aus der Sammlung von Prof. Dr. Fritz Hellwig und an
den Ankauf von 67 Briefen aus dem Nachlass von Johann Georg August
Wirth und an das persönliche Exemplar der von ihm herausgegebenen
Zeitung 'Deutsche Tribüne'. Der überwiegende Teil der Kaufsumme
habe in beiden Fällen die „Stiftung Rheinland-Pfalz für Kultur“
übernommen, die gemeinsam mit der „Kulturstiftung der Länder“ auch
den Ankauf des schriftlichen Nachlasses von Max Slevogt durch das
LBZ im Jahr 2011 ermöglicht habe.
Büchereistellen im LBZ
Die Büchereistellen des Landesbibliothekszentrums
in Koblenz und Neustadt/ Weinstraße seien die Serviceinstitutionen
des Landes für die über 1.000 Öffentlichen Bibliotheken,
Schulbibliotheken und Leseecken, fuhr Dr. Gerlach in ihrem Bericht
fort. Sie stehen mit ihrem Fachpersonal den Städten, Gemeinden,
Landkreisen und anderen Bibliotheksträgern für Beratung und
Auskünfte in allen Büchereifragen zur Verfügung.
„Lese- und Medienkompetenz sind
Schlüsselqualifikationen in unserer Informationsgesellschaft“,
stellte der Bibliotheksleiterin weiter heraus. Deshalb unterstütze
das Landesbibliothekszentrum mit seinen Büchereistellen vielfältige
Angebote und Aktivitäten zur Leseförderung und zur Förderung der
Medienkompetenz. So würden zahlreiche landesweite Projekte und
Aktivitäten zur Leseförderung durchgeführt wie z. B. die Aktionen
"Schultüte", "Lesewelten entdecken", "Adventskalender",
"Lesesommer" oder "Bücherminis" und „Büchereipiraten“, die alle
innerhalb des Kooperationsprojektes „Lesespaß aus der Bücherei“ im
Rahmen der Initiative „Leselust in Rheinland-Pfalz“ geplant und
organisiert würden. Aber auch das Projekt „Leseecken in
Ganztagsschulen“ und die alle zwei Jahre in Kooperation mit dem
Landesverband Rheinland-Pfalz im Deutschen Bibliotheksverband (dbv)
stattfindenden „Bibliothekstage Rheinland-Pfalz“ seien hier zu
nennen. „E-Medien werden immer wichtiger, wenn es um die
Literaturversorgung geht“, unterstrich Dr. Gerlach. Daher
beteiligten sich immer mehr Öffentliche Bibliotheken in
Rheinland-Pfalz am Onleihe-Verbund „onleiherlp.de“, den das
Landesbibliothekszentrum mit seinen Büchereistellen koordiniert.
„Die 24-Stunden-Ausleihe kommt bei den Kunden der Öffentlichen
Bibliotheken gut an“, unterstrich sie und belegte dies anhand der
steigenden Zugriffszahlen, die von rund 40.000 Entleihungen im Jahr
2011 auf 117.000 im Jahr 2012 und fast 218.000 im letzten Jahr
angestiegen seien. Die Zahl der Nutzer habe sich von 2011 bis 2012
von 3.100 auf 6.100 nahezu verdoppelt und sei im Jahr 2013 auf
10.000 angestiegen..
Gut angenommen auch die seit 2005 erscheinenden
neuen Publikationen des LBZ: die Zeitschrift „Bibliotheken heute“
und der elektronische LBZ-Newsletter, die über bibliotheksfachliche
Entwicklungen im Land informieren. Die Schriftenreihe des LBZ und
der seit 2008 erscheinende Jahresbericht vervollständigten das
Publikationsprogramm.
Zweimal – in den Jahren 2006 und 2007 – hätten
zudem alle fünf Einrichtungen des LBZ an einem gemeinsamen„Tag der
offenen Tür“ ihre Pforten geöffnet, um dem interessierten Publikum
ihre Services näher zu bringen.
Auch das Veranstaltungsangebot in Form von
Autorenlesungen, Vorträgen mit landeskundlichem Inhalt, Konzerten,
Ausstellungen und VHS-Kursen sei in den letzten Jahren ständig
erweitert worden und erfreue sich großer Beliebtheit, wie die
Besucherzahlen zeigen.
Zusammenfassend stellte die LBZ-Leiterin fest, dass
sich die Einrichtung in den zehn Jahren ihres Bestehens als
Kompetenzzentrum und Beratungseinrichtung etabliert habe und eine
Reihe von innovativen Projekten anstoßen konnte. Mit der Gründung
des Landesbibliothekzentrums vor zehn Jahren habe Rheinland-Pfalz
vorausschauend eine Struktur geschaffen, um die Koordination und
Kooperation der Bibliotheken untereinander zu stärken. „Dies ist
die beste Voraussetzung, um die Forderung nach flächendeckenden
bibliothekarischen Angeboten trotz schwieriger finanzieller Lage
bei den Kommunen und dem Land auch in der Zukunft erfüllen zu
können.
Aus Anlass des Jubiläums „Zehn Jahre LBZ“ werden an
allen Standorten eine Vielzahl von begleitenden Veranstaltungen
durchgeführt, von denen die Ausstellung „Der Erste
Weltkrieg und seine Folgen in der Metropolregion Rhein-Neckar in
der Zeit von 1914 bis 1924“, die das LBZ
gemeinsam mit dem Landesarchiv in Speyer durchführt, sicher zu den
herausragenden gehören wird. Die Ausstellung wird vom 30.
Mai – 28. Juni 2014 im LBZ Speyer - Eröffnung Mi.,
28. Mai 2014, 18 Uhr Foto: gc
30.01.2014
Gemeinnützige Umwidmung von Bibliotheksmobiliar
 Die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer wird die
Bereiche mit sofort ausleihbaren, frei zugänglichen Medien
ausweiten
Die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer wird die
Bereiche mit sofort ausleihbaren, frei zugänglichen Medien
ausweiten
Speyer- In Vorbereitung der in den kommenden
Wochen und Monaten geplanten Umzugsaktivitäten wurden die nicht
mehr benötigten Katalogschränke abgebaut, die den sogenannten
"Systematischen Zettelkatalog" enthielten. Sie erfahren eine
Umnutzung an anderer Stelle: Das gemeinnützige Projekt "Street Doc"
in Ludwigshafen wird künftig darin Medikamente unterbringen -
ebenfalls nach einem systematischen Ordnungsprinzip.
Seit Ende Oktober 2013 haben Menschen, die über keinen Zugang
zum Gesundheitssystem verfügen, an drei Standorten in Ludwigshafen
einmal wöchentlich die Möglichkeit ehrenamtliche Sprechstunden für
Menschen wahrzunehmen. Es handelt sich um ein Angebot in
Trägerschaft der Ökumenischen Fördergemeinschaft, die hierfür mit
einem Dutzend niedergelassener Allgemeinmediziner kooperiert. Diese
praktizieren immer mittwochnachmittags stundenweise in sozialen
Brennpunkten in eigens hergerichteten Behandlungszimmern. Die
Finanzierung erfolgt ausschließlich über Spenden.
Pfälzische Landesbibliothek, Presse; Foto: Christoph Mayr
(LBZ),
29.01.2014
LBZ Speyer: Online-Zugang NAXOS Music Library (Classic und Jazz)
 NAXOS Music Library :
Zugang rund um die Uhr über das Landesbibliothekszentrum
NAXOS Music Library :
Zugang rund um die Uhr über das Landesbibliothekszentrum
Das Landesbibliothekszentrum bietet allen Interessierten ab sofort
das umfangreiche Musikangebot der NAXOS Music Library und der NAXOS
Musik Library Jazz an. Die Datenbanken sind via
Internet rund um die Uhr nutzbar. Einzige Voraussetzung ist ein
gültiger Benutzerausweis des LBZ, der kostenlos in den
LBZ-Bibliotheken in Koblenz, Speyer und Zweibrücken erhältlich ist.
Besucher der LBZ-Bibliotheken können das Angebot auch vor Ort ohne
Benutzerausweis nutzen.
Die NAXOS Music Library ist mit über 1,3 Mill. Titeln von
rund 90.000 CDs die weltweit größte klingende Enzyklopädie für
klassische Musik. Über 600 unabhängige Labels sind mit ihren
Einspielungen vertreten und sorgen für einen monatlichen Zuwachs
von rund 800 CDs. Über 10.000 Werke aus 1.000 Jahren
Musikgeschichte können nach Komponist, Titel, Interpret oder
Instrument gesucht und im Streaming-Verfahren angehört werden.
Darüber hinaus werden viele Zusatzinformationen angeboten, wie
digitale Booklets, Biographien, Werkanalysen oder Libretti.
Die NAXOS Music Library Jazz bietet in einem Mix von
Jazz-Legenden und aktuellen Musikern über 70.000 Titel von rund
7000 CDs. Über 180 Labels, wie Blue Note Records, Fantasy Records,
Altissimo oder Enja steuern Inhalte zu dem Angebot bei. Unter den
mehr als 32.000 Künstlern sind Jazzgrößen wie Herbie Hancock, John
Coltrane, Miles Davies und Charlie Parker vertreten.
Beide Datenbanken sind von jedem Internetarbeitsplatz über den
LBZ-Katalog nutzbar (http://www.lbz-rlp.de).
Es ist lediglich eine Authentifizierung als Benutzer des LBZ über
den Button „Anmeldung“ erforderlich.
LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM RHEINLAND-PFALZ, Presse
13.12.2013
Kostbarer Neuzugang an der „LaBi“ in Speyer
 Bibliotheksleitung
präsentiert wertvollen „Ottheinrich-Einband“ als Dauerleihgabe der
Ernst von Siemens Kunststiftung
Bibliotheksleitung
präsentiert wertvollen „Ottheinrich-Einband“ als Dauerleihgabe der
Ernst von Siemens Kunststiftung
spk. Speyer. Auch wenn es sich „nur“ um eine
Dauerleihgabe handelt – seit heute ist die Pfälzische
Landesbibliothek um eine kleine, aber feine Kostbarkeit reicher.
Finanziert von der Ernst von Siemens Kunststiftung
in München, die das Buch für 22.000 Euro aus einer deutschen
Privatsammlung erwarb, konnte die Bibliothek jetzt den kleinen Band
aus dem Besitz des Pfälzischen Kurfürsten Ottheinrich mit Speyerer
Provenienz in seine Bestände eingliedern. Zur Vorstellung dieser
Neuerwerbung war heute die neue Leiterin des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz LBZ, Dr. Annette
Gerlach, aus Koblenz in die Speyerer „LaBi“ gekommen, wo
sie, gemeinsam mit dem Leiter des Bereichs „Handschriften, Alte
Drucke und Nachlässe“ des LBZ, Dr. Armin
Schlechter, den neuen Band der Öffentlichkeit
präsentierte.
Mit großer Dankbarkeit würdigte die Leiterin des LBZ dabei das
bedeutsame Engagement der Ernst von Siemens Kunststiftung, ohne
deren Hilfe der kostbare Einband nicht in den faktischen Besitz der
Landesbibliothek hätte gelangen können.
 Dr.
Schlechter charakterisierte in seiner Vorstellung den zum
protestantischen Glauben übergetretenen Kurfürsten als einen der
großen Büchersammler seiner Zeit, in dessen Bibliothek
reformatorische Literatur einen breiten Raum eingenommen habe.
Darüber hinaus habe Ottheinrich aber auch viele Bücher zu anderen
Interessensgebiete gesammelt, unter anderem zu Astronomie und
Medizin. Nach seinen Vorgaben seien aber auch die kostbaren
Einbände seiner Bücher geschaffen worden, so wohl auch der jetzt
nach Speyer gelangte sogenannte „Ottheinricheinband“, erläuterte
Dr. Schlecher. Da aber der Kurfürst selbst wohl des Laterinischen
nicht mächtig gewesen sei, habe seine prachtvolle, vermutlich 600
bis 700 Bände umfassende Bibliothek wohl mehr der Repräsentation
gegenüber anderen Fürsten als dem eigenen Studium oder der Erbauung
gedient.
Dr.
Schlechter charakterisierte in seiner Vorstellung den zum
protestantischen Glauben übergetretenen Kurfürsten als einen der
großen Büchersammler seiner Zeit, in dessen Bibliothek
reformatorische Literatur einen breiten Raum eingenommen habe.
Darüber hinaus habe Ottheinrich aber auch viele Bücher zu anderen
Interessensgebiete gesammelt, unter anderem zu Astronomie und
Medizin. Nach seinen Vorgaben seien aber auch die kostbaren
Einbände seiner Bücher geschaffen worden, so wohl auch der jetzt
nach Speyer gelangte sogenannte „Ottheinricheinband“, erläuterte
Dr. Schlecher. Da aber der Kurfürst selbst wohl des Laterinischen
nicht mächtig gewesen sei, habe seine prachtvolle, vermutlich 600
bis 700 Bände umfassende Bibliothek wohl mehr der Repräsentation
gegenüber anderen Fürsten als dem eigenen Studium oder der Erbauung
gedient.
 In seiner
klassischen Form handele es sich bei dem jetzt erworbenen Band um
einen mit braunem Kalbleder überzogenen Holzdeckeleinband, der mit
blinden Rollen verziert ist. Im Zentrum steht auch hier ein
Supralibros-P aar in Gold, das auf der Vorderseite das Porträt
Ottheinrichs und auf der Rückseite sein Wappen zeigt. Heute
existieren nach Einschätzung von Dr, Schlechter wohl noch etwa 450
Ottheinrich-Einbände, die überwiegend in der „Bibliotheca
Apostolica Vaticana“ in Rom, in der Universitätsbibliothek
Heidelberg, in der Stadtbibliothek Mainz, in der Bayerischen
Staatsbibliothek München und im Landesbibliothekszentrum /
Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken aufbewahrt werden. Mit dem
heute vorgestellten Neuerwerb habe die LaBi in Speyer jetzt ihren
Besitz von bisher einem Ottheinrich-Einband – einem Werk zur
Astronomie eines Schülers von Nikolaus Kopernikus aus dem Bestand
der Bibliothek der früheren Domschule (heute Gymansium am
Kaiserdom) – nun „glatt um hundert Prozent erhöht“, so Dr.
Schlechter schmunzelnd.
In seiner
klassischen Form handele es sich bei dem jetzt erworbenen Band um
einen mit braunem Kalbleder überzogenen Holzdeckeleinband, der mit
blinden Rollen verziert ist. Im Zentrum steht auch hier ein
Supralibros-P aar in Gold, das auf der Vorderseite das Porträt
Ottheinrichs und auf der Rückseite sein Wappen zeigt. Heute
existieren nach Einschätzung von Dr, Schlechter wohl noch etwa 450
Ottheinrich-Einbände, die überwiegend in der „Bibliotheca
Apostolica Vaticana“ in Rom, in der Universitätsbibliothek
Heidelberg, in der Stadtbibliothek Mainz, in der Bayerischen
Staatsbibliothek München und im Landesbibliothekszentrum /
Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken aufbewahrt werden. Mit dem
heute vorgestellten Neuerwerb habe die LaBi in Speyer jetzt ihren
Besitz von bisher einem Ottheinrich-Einband – einem Werk zur
Astronomie eines Schülers von Nikolaus Kopernikus aus dem Bestand
der Bibliothek der früheren Domschule (heute Gymansium am
Kaiserdom) – nun „glatt um hundert Prozent erhöht“, so Dr.
Schlechter schmunzelnd.
Der 1502 in Amberg geborene Ottheinrich war ein Enkel des
pfälzischen Kurfürsten Philipp des Aufrichtigen. Nach dem Tode
seiner Eltern im für die Pfalz verheerenden Landshuter
Erbfolgekrieg übernahm er 1522 gemeinsam mit seinem Bruder die
Herrschaft im Fürstentum Pfalz-Neuburg. Dieses Territorium musste
er 1544 allerdings aufgrund völliger Überschuldung aufgeben. Von
1556 bis 1559 regierte Ottheinrich dann als Nachfolger von Kurfürst
Friedrich II. die Kurpfalz. In dieser Zeit modernisierte er die
Universität, führte sein Territorium zur Reformation und begründete
postum die „Bibliotheca Palatina“.
 Der neue
Speyerer Zugang wurde im Januar 2013 von dem Königsteiner
Antiquariat Reiss & Sohn angeboten und war gemäß dem
aufgeprägten Bindejahr als ein 1550 hergestellter
Ottheinrich-Einband identifiziert worden. Er zeigt vorne das zu
dieser Zeit gebräuchliche Supralibros des Kurfürsten mit der
Unterschrift OTTHAINRICH VON G.G./ PFALTZGRAVE BEY
RHEIN/ HERTZOG IN NIDERN VND OBERN BAIRN, hinten
korrespondierend eine nur bei den frühen Ottheinrich-Einbänden
verwendete Spes-Platte, eine Personifikation der Tugend Hoffnung.
Der Band zeigt weiter einen punzierten Goldschnitt, was bei dieser
Buchgattung eher selten vorkommt.
Der neue
Speyerer Zugang wurde im Januar 2013 von dem Königsteiner
Antiquariat Reiss & Sohn angeboten und war gemäß dem
aufgeprägten Bindejahr als ein 1550 hergestellter
Ottheinrich-Einband identifiziert worden. Er zeigt vorne das zu
dieser Zeit gebräuchliche Supralibros des Kurfürsten mit der
Unterschrift OTTHAINRICH VON G.G./ PFALTZGRAVE BEY
RHEIN/ HERTZOG IN NIDERN VND OBERN BAIRN, hinten
korrespondierend eine nur bei den frühen Ottheinrich-Einbänden
verwendete Spes-Platte, eine Personifikation der Tugend Hoffnung.
Der Band zeigt weiter einen punzierten Goldschnitt, was bei dieser
Buchgattung eher selten vorkommt.
In dem Band enthalten sind drei medizinische Drucke aus der
Feder von Antonio Musa Brasavola, dem im Jahr 1500 geborenen
Leibarzt von Kaiser Karl V. sowie von verschiedenen Päpsten, die
zwischen 1546 und 1549 in Lyon gedruckt worden waren.
Wahrscheinlich handelt es sich bei dem vorliegenden Objekt um
einen der Ottheinrich-Einbände, die bei der Wegführung der
Heidelberger „Bibliotheca Palatina“ nach Rom 1623 im
Dreißigjährigen Krieg als Dublette am Neckar zurückblieben.
Der Band befand sich, wie der Besitzvermerk Ex Bibliotheca
David Verbezii Carno-Lubeani Phil. et Med. Doct. Spirae 5. Julii
1637 zeigt, im Besitz des 1577 in Laibach geborenen David
Verbez, der 1600 in Basel in Medizin promovierte, dann als Arzt in
verschiedenen süddeutschen Städten wirkte und 1644 in Speyer
verstarb. Da die autochthonen Speyerer Buchbestände im Zuge des
Pfälzischen Erbfolgekrieges 1689 vollständig untergegangen sind,
haben solche zuvor in Speyer zuordenbaren Werke einen
außerordentlich hohen Überlieferungswert. Der fragliche Band befand
sich im späten 19. Jahrhundert wohl in Privatbesitz und scheint nie
Teil einer öffentlichen Bibliothek gewesen zu sein. Er zeigt, von
den altersbedingten Nutzungsspuren abgesehen, einen hervorragenden
Erhaltungszustand ohne jegliche restauratorische Eingriffe, was bei
Ottheinrich-Bänden heute sehr selten ist. Foto: gc;
LBZ
31.07.2013
Neueste Publikation der „Stiftung zur Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung“ vorgestellt
 Speyer- In einer
kleinen Feierstunde wurde am Dienstag, den 4.6.2013, im
Landesarchiv Speyer die neueste Publikation der „Stiftung zur
Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung“ vorgestellt. Die
Edition von Urkunden zu den Besitzungen, die das in der Eifel
gelegene Zisterzienserkloster Himmerod während im Raum Speyer
hatte, war schon immer ein Herzenswunsch, wie Laudator Prof. Dr.
Hans Ammerich, betonte, da die betreffenden Texte in Form der sehr
seltenen Urkundenrolle (rotulus) in dem von ihm geleiteten
Bistumsarchiv Speyer verwahrt werden. In seinem Einführungsvortrag
beschrieb Prof. Ammerich den Typus der Urkundenrolle – der eine
Rotulus misst ca. 3 Meter und umfasst 58 Urkundenabschriften aus
den Jahren 1194 bis 1262, der andere misst 2 Meter und beinhaltet
zwölf Urkunden von 1258 bis 1274 –, zeigte anhand einer Karte die
Lage der pfälzischen Besitzungen des Klosters auf und beleuchtete
die Frage, warum die Stücke bereits im Mittelalter als Abschriften
der Originale angefertigt wurden.
Speyer- In einer
kleinen Feierstunde wurde am Dienstag, den 4.6.2013, im
Landesarchiv Speyer die neueste Publikation der „Stiftung zur
Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung“ vorgestellt. Die
Edition von Urkunden zu den Besitzungen, die das in der Eifel
gelegene Zisterzienserkloster Himmerod während im Raum Speyer
hatte, war schon immer ein Herzenswunsch, wie Laudator Prof. Dr.
Hans Ammerich, betonte, da die betreffenden Texte in Form der sehr
seltenen Urkundenrolle (rotulus) in dem von ihm geleiteten
Bistumsarchiv Speyer verwahrt werden. In seinem Einführungsvortrag
beschrieb Prof. Ammerich den Typus der Urkundenrolle – der eine
Rotulus misst ca. 3 Meter und umfasst 58 Urkundenabschriften aus
den Jahren 1194 bis 1262, der andere misst 2 Meter und beinhaltet
zwölf Urkunden von 1258 bis 1274 –, zeigte anhand einer Karte die
Lage der pfälzischen Besitzungen des Klosters auf und beleuchtete
die Frage, warum die Stücke bereits im Mittelalter als Abschriften
der Originale angefertigt wurden.
Im Anschluss erläuterte der Bearbeiter Dr. Johannes Weingart die
aufwendige Vorgehensweise bei Herstellung der Edition. Auf die
Inhalte der Urkunden bezogen ließ er kurz den politischen und
gesellschaftlichen Stellenwert dieser Zeugnisse aufblitzen, denn in
einem Fall werden als Zeugen einer Beurkundung keine Geringeren als
die Bischöfe von Trier, Worms und Würzburg genannt. So sind diese
Texte in einem umfassenden Sinn von grundlegender Bedeutung für die
mittelalterliche Landesgeschichte der Pfalz und verbinden diese
zugleich mit der Geschichte des in der Eifel gelegenen
Zisterzienserklosters Himmerod, das heute noch von den Mönchen
betrieben wird und zu Erholung und Meditation einlädt.
Abschließend dankte Prof. Dr. Pirmin Spieß als Geschäftsführer
der Stiftung den Bearbeitern der Edition für ihre vorbildliche
Arbeit. Beim anschließenden Umtrunk wurde neben Pfälzer Rotwein
auch Wein aus Besitzungen des Klosters Himmerod an der Mosel
verkostet.
Erhältlich ist der Band im Buchhandel oder bei der
Vertriebsstelle der „Stiftung zur Förderung der pfälzischen
Geschichtsforschung“, Heinestrasse 3, 67433 Neustadt an der
Weinstraße zum Preis von 29.- €. LANDESARCHIV SPEYER,
Presse
05.06.2013
Landesarchiv Speyer präsentiert „Gesamtverzeichnis der Siegel im 'Gatterer-Apparat'“
 Dreißig Jahre
akribische Forschungsarbeit öffnen „berührungsfreien“ Zugang zu
1200 Jahren Kulturgeschichte
Dreißig Jahre
akribische Forschungsarbeit öffnen „berührungsfreien“ Zugang zu
1200 Jahren Kulturgeschichte
cr./spk. Speyer. 2571 detailliert und mit
größter Sorgfalt beschiebene, ganz unterschiedliche Siegel – 2260
davon in einem eigenen Band abgebildet - allein diese Zahlen lassen
schon erahnen, auf welch monumentale Herausforderung sich der
frühere Speyerer Archivdirektor Dr. Karl Heinz
Debus eingelassen hatte, als er vor nunmehr dreißig Jahren
mit der Erstellung eines „Gesamtverzeichnisses der Siegel
im 'Gatterer-Apparat'“ begann. Jetzt ist dieses opulente
Werk, das von der rastlosen und akribischenForschungs- und
Archivarbeit des längst pensionierten Wissenschaftlers Zeugnis
ablegt, fertiggestellt, gedruckt und kann seit diesem Wochenende
als „Band 116 der Veröffentlichungen des Landesarchivs
Rheinland-Pfalz“ erworben oder im Landesarchiv in Speyer
eingesehen werden.
 Groß war
deshalb auch die Zahl der interessierten Gäste, die jetzt zur
Präsentation dieses epochalen Werkes in das gemeinsame Foyer von
Landesbibliothk und Landesarchiv in Speyer gekommen waren. Die
Bedeutung des vorgestellten 'Opus magnus' machte nicht allein die
Anwesenheit des Speyerer Oberbürgermeisters Hansjörg
Eger, seines Vorgängers Werner Schineller
und des früheren Speyerer Kulturdezernenten Hanspeter
Brohm deutlich - auch zahlreiche Wissenschaftler,
Historiker und viele Speyerer Bürger waren gekommen.
Groß war
deshalb auch die Zahl der interessierten Gäste, die jetzt zur
Präsentation dieses epochalen Werkes in das gemeinsame Foyer von
Landesbibliothk und Landesarchiv in Speyer gekommen waren. Die
Bedeutung des vorgestellten 'Opus magnus' machte nicht allein die
Anwesenheit des Speyerer Oberbürgermeisters Hansjörg
Eger, seines Vorgängers Werner Schineller
und des früheren Speyerer Kulturdezernenten Hanspeter
Brohm deutlich - auch zahlreiche Wissenschaftler,
Historiker und viele Speyerer Bürger waren gekommen.
 Dr. Walter
Rummel, Leiter des Landesarchivs in Speyer, ließ schon in
seiner Begrüßung etwas von der großen Bedeutung aufscheinen, die
Siegel seit mehr als 5.000 Jahren und bis heute für die Menschen in
einer zivilisierten Gesellschaft haben. Daraus leite sich auch der
hohe Rang dieses Gesamtverzeichnisses ab, zu dessen Vorstellung an
diesem Tag auch die Direktorin des Landeshauptarchivs in
Koblenz, Dr. Elsbeth André nach Speyer gekommen war. Sie
erinnerte in ihrem Grußwort daran, dass der
„Gatterer-Apparat“ - eine herausragende Sammlung
von rund 4.500 historischen Urkunden, die nach dem von 1759 bis
1799 an der Universität in Göttingen lehrenden
Geschichtswissenschaftler und Begründer der Historischen
Hilfswisssenschaften, Professor Johann Christoph
Gatterer benannt ist, sich erst seit 1997 im Besitz und in
der Obhut des Speyerer Landesarchivs befindet.
Dr. Walter
Rummel, Leiter des Landesarchivs in Speyer, ließ schon in
seiner Begrüßung etwas von der großen Bedeutung aufscheinen, die
Siegel seit mehr als 5.000 Jahren und bis heute für die Menschen in
einer zivilisierten Gesellschaft haben. Daraus leite sich auch der
hohe Rang dieses Gesamtverzeichnisses ab, zu dessen Vorstellung an
diesem Tag auch die Direktorin des Landeshauptarchivs in
Koblenz, Dr. Elsbeth André nach Speyer gekommen war. Sie
erinnerte in ihrem Grußwort daran, dass der
„Gatterer-Apparat“ - eine herausragende Sammlung
von rund 4.500 historischen Urkunden, die nach dem von 1759 bis
1799 an der Universität in Göttingen lehrenden
Geschichtswissenschaftler und Begründer der Historischen
Hilfswisssenschaften, Professor Johann Christoph
Gatterer benannt ist, sich erst seit 1997 im Besitz und in
der Obhut des Speyerer Landesarchivs befindet.
Über die inhaltliche Bedeutung des „Gatterer-Apparates“ habe Dr.
Debus bereits im Jahr 1998 ein umfangreiches Werk vorgelegt, so Dr.
André, das jetzt mit dem neuen Gesamtverzeichnis eine
unentbehrliche Ergänzung erfahre. Der neue Siegelband erleichtere
künftig einschlägige Forschungsarbeiten, weil dadurch der Rückgriff
auf die empfindlichen Originale der Siegel nicht mehr notwendig
sei. Für diese Leistung sprach die Direktorin dem Autor des Werkes
Dank und Anerkennung aus und erinnerte zugleich auch daran, dass es
Dr. Debus gewesen sei, der schon früh – nach ersten Kontakten am
Rande einer wissenschaftlichen Tagung - die entscheidenden
Vorverhandlungen für den Erwerb dieser Sammlung aus dem Besitz des
Staatsarchiv des schweizerischen Kantons Luzern geführt habe.
 Auch sei es
Dr. Debus gewesen, der mit unermüdlicher Überzeugungskraft und
Hartnäckigkeit den auf einer „Mischkalkulation aus kollegialem
Freundschaftspreis und einem am Antiquitätenhandel orientierten
Marktpreis“ basierenden Kaufpreis für den „Gatterer-Apparat“ in
Höhe von 1 Million Schweizer Franken eingeworben habe. Wichtigste
Sponsoren seien dabei die „Kulturstifung der Länder“ und die
„Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz“ gerwesen. Auch zwei
namhafte Unternehmen habe Dr. Debus damals als Sponsoren gewinnen
können. Schließlich habe er noch rund 250.000 D-Mark von
verschiedenen Wirtschaftsverbänden, Kirchen, Kommunen und
Privatpersonen für diesen Erwerb einwerben können, so dass am 10.
Oktober 1986 der Kaufvertrag seitens der rheinland-pfälzischen
Landesregierung unterschrieben und am 18. Februar 1997 der
„Gatterer-Apparat“ ins Landesarchiv nach Speyer verbracht werden
konnte. Steuermittel, so betonte Dr. André, seien in diesem
Zusammenhang nicht geflossen.
Auch sei es
Dr. Debus gewesen, der mit unermüdlicher Überzeugungskraft und
Hartnäckigkeit den auf einer „Mischkalkulation aus kollegialem
Freundschaftspreis und einem am Antiquitätenhandel orientierten
Marktpreis“ basierenden Kaufpreis für den „Gatterer-Apparat“ in
Höhe von 1 Million Schweizer Franken eingeworben habe. Wichtigste
Sponsoren seien dabei die „Kulturstifung der Länder“ und die
„Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz“ gerwesen. Auch zwei
namhafte Unternehmen habe Dr. Debus damals als Sponsoren gewinnen
können. Schließlich habe er noch rund 250.000 D-Mark von
verschiedenen Wirtschaftsverbänden, Kirchen, Kommunen und
Privatpersonen für diesen Erwerb einwerben können, so dass am 10.
Oktober 1986 der Kaufvertrag seitens der rheinland-pfälzischen
Landesregierung unterschrieben und am 18. Februar 1997 der
„Gatterer-Apparat“ ins Landesarchiv nach Speyer verbracht werden
konnte. Steuermittel, so betonte Dr. André, seien in diesem
Zusammenhang nicht geflossen.
 Die Direktorin
des Landeshauptarchivs dankte dem pensionierten Archivdirektor für
dieses einmalige Engagement und bezog darin auch die Fotografin des
Speyerer Landesarchivs, Brigitte Roth, mit ein,
die in einem aufwändigen Prozeß im Fotostudio des Archivs die 2.260
Abbildungen hergestellt habe.
Die Direktorin
des Landeshauptarchivs dankte dem pensionierten Archivdirektor für
dieses einmalige Engagement und bezog darin auch die Fotografin des
Speyerer Landesarchivs, Brigitte Roth, mit ein,
die in einem aufwändigen Prozeß im Fotostudio des Archivs die 2.260
Abbildungen hergestellt habe.
Diegel gäben einen Einblick in die „Jahrtausende alte
Kulturgeschichte und in die menschlichen Tiefen“, gab sodann in
einem weiteren Redebeitrag der „Hausherr“ des Archivs, Dr.
Walter Rummel, zu bedenken. Er erinnerte
daran, dass bis heute alle offizielllen Dokumente und Urkunden
besiegelt würden – das „Be-Siegeln“ eines Versprechens – das
Markieren eines Herrschaftsanspruchs durch ein Siegel - „eigentlich
ist fast jede menschliche Existenz vom ersten bis zum letzten Tag
mit Siegeln dokumentiert“, so der Wissenschaftler - am Letzten Tag
im „Buch mit den sieben Siegeln“, der „Offenbarung des Johannes“,
wo das Siebte Siegel die Apokalypse, das Ende der Welt, markiere.
Schon vor mehr als 5.000 Jahren sei das „Besiegeln“ in
Mesopothamien, im Zweistrom-Land, eingeführt worden, so Dr. Rummel
in seiner „kompakten Siegel-Kunde“. Von dort aus habe es sich als
eine für die Menschheitsgeschichte bedeutsame offizielle Handlung
in der ganzen Welt verbreitet.
 In seiner
Vorstellung des umfangreichen „Gatterer-Apparates“ erinnerte
Dr. Debus zunächst daran, dass Prof. Gatterer auf
dem Weg zum Aufbau eines Lehrapparates für seine Studenten zunächst
den Nachlass seines Göttinger Vorgängers Johann David Köhler
übernommen hatte. Dieser habe aus einer umfangreichen Sammlung zu
Numismatik, Diplomatik, Heraldik und Geographie bestanden, mit der
Gatterer den Unterricht für seine Studenten anschaulich machen
wollte. Gatterer konnte dann die übernommene Sammlung durch
Zukäufe, durch Geschenke seiner Studenten sowie durch Widmungen
anderer Institutionen wesentlich erweitern. Die Sammlung umfasst
heute rund 4500 Originalurkunden, wobei etwa 1100 Dokumente aus der
Zeit vor dem Jahr 1400 stammen. Das älteste Pergament ist eine
Urkunde König Ludwigs des
Jüngeren aus dem Jahre 878. Zu den Archivalien gehören auch 50
Königsurkunden und 29 Papstbullen von vor 1400.
In seiner
Vorstellung des umfangreichen „Gatterer-Apparates“ erinnerte
Dr. Debus zunächst daran, dass Prof. Gatterer auf
dem Weg zum Aufbau eines Lehrapparates für seine Studenten zunächst
den Nachlass seines Göttinger Vorgängers Johann David Köhler
übernommen hatte. Dieser habe aus einer umfangreichen Sammlung zu
Numismatik, Diplomatik, Heraldik und Geographie bestanden, mit der
Gatterer den Unterricht für seine Studenten anschaulich machen
wollte. Gatterer konnte dann die übernommene Sammlung durch
Zukäufe, durch Geschenke seiner Studenten sowie durch Widmungen
anderer Institutionen wesentlich erweitern. Die Sammlung umfasst
heute rund 4500 Originalurkunden, wobei etwa 1100 Dokumente aus der
Zeit vor dem Jahr 1400 stammen. Das älteste Pergament ist eine
Urkunde König Ludwigs des
Jüngeren aus dem Jahre 878. Zu den Archivalien gehören auch 50
Königsurkunden und 29 Papstbullen von vor 1400.
Darüber hinaus gibt es aber auch bedeutende Schriftstücke aus
der Neuzeit , so Schreiben der Könige Friedrich Wilhelm I. und
Friedrich II. von Preußen. Neben diesen Originaldokumenten umfasse
die Sammlung aber auch Urkundenabschriften, alte
Schreibgerätschaften, alte Kupferstiche von Urkunden und Siegeln
sowie 275 Originalsiegel, 36 Siegelstempel, Siegelnachzeichnungen
und 40 Handschriften ab dem 13. Jahrhundert. Es gibt auch eine
vorlutherische Psalmenübersetzung aus dem Jahr 1470. Insgesamt
beinhalte der Bestand 8.600 einzelne Positionen.
 Neben
deutschen Ausstellern von Urkunden und Dokumenten finden sich auch
ausländische wie Christina von Schweden oder Ludwig XV. von
Frankreich. Außer Päpsten sind auch Kardinäle, Bischöfe und
päpstliche Legaten unter den Ausstellern. Empfänger der Urkunden
waren zumeist Domkapitel, Bistümer, Klöster, Städte, Gemeinden und
einzelne Adlige.
Neben
deutschen Ausstellern von Urkunden und Dokumenten finden sich auch
ausländische wie Christina von Schweden oder Ludwig XV. von
Frankreich. Außer Päpsten sind auch Kardinäle, Bischöfe und
päpstliche Legaten unter den Ausstellern. Empfänger der Urkunden
waren zumeist Domkapitel, Bistümer, Klöster, Städte, Gemeinden und
einzelne Adlige.
Durch den Erwerb des „Gatterer-Apparates“ konnte der bis dahin
vorhandene Bestand des Speyerer Landesarchivs von rund 20.000
Urkunden nicht nur um weitere 4.500 vergrößert werden - besonders
die Zahl der Dokumente aus dem Früh- und Hochmittelalter konnte so
verzwanzigfacht werden. Das ist umso bedeutsamer, als sich die
Mehrzahl der im „Gatterer-Apparat“ zusammengeführten Unterlagen auf
die Geschichte der Pfalz und Rheinhessens beziehen[
Zuvor hatte das Landesarchiv Speyer aufgrund der kriegerischen
Ereignisse in den letzten Jahrhunderten im Südwesten Deutschlands
wie auch wegen des Verlustes vieler Pfälzischer Archive durch ihre
Verlegung nach München, Darmstadt, Wiesbaden und Karlsruhe nur
verhältnismäßig wenige Dokumente zur reichen Geschichte des
Oberrheingebietes besessen, so Dr. Debus.
 All diese
Urkunden waren durch Siegel beglaubigt. Durch die Beschreibungen
und Abbildungen in dem neuen zweibändigen Werk von Dr. Karl Heinz
Debus werden diese Siegel nun interessierten Forschern
„berührungsfei“ zugänglich gemacht. Eine wissenschaftliche
Meisterleistung, für die dem früheren Speyerer Archivdirektor an
diesem Abend viel Lob und Dank zuteil wurde.
All diese
Urkunden waren durch Siegel beglaubigt. Durch die Beschreibungen
und Abbildungen in dem neuen zweibändigen Werk von Dr. Karl Heinz
Debus werden diese Siegel nun interessierten Forschern
„berührungsfei“ zugänglich gemacht. Eine wissenschaftliche
Meisterleistung, für die dem früheren Speyerer Archivdirektor an
diesem Abend viel Lob und Dank zuteil wurde.
Das erste Exemplar des Werkes überreichte Dr. Rummel symbolisch
dem Autor – für seine Ehefrau, die das Werk über drei Jahrzehnte
begleitet hat, gab es ebenso einen stattlichen Blumengruß wie für
die Fotografin der 2260 Abbildungen, Brigitte Roth.
Nach Speyerer Art, bei Wein und Brezeln, nahmen die Besucher der
Buchvorstellung im Anschluß daran Gelegenheit, sich auszutauschen
und die Exponate zu bewundern, die zu diesem Anlass in einer
kleinen Ausstellung präsentiert wurden – darunter eine
Original-Urkunde von Kaiser Heinrich III. Foto:
gc
29.04.2013
Sparkassenstiftung Speyer unterstützt den Ankauf von 24 Briefen von Anselm Feuerbach und aus seinem Umfeld
 Brief von Anselm Feuerbach an seine Stiefmutter Henriette Heydenreich vom Juni 1875.
Brief von Anselm Feuerbach an seine Stiefmutter Henriette Heydenreich vom Juni 1875.
Speyer- Die Sparkassenstiftung der Kreis- und
Stadtsparkasse Speyer unterstützte den Ankauf von 14 Briefen von
Anselm Feuerbach an seine Stiefmutter Henriette Feuerbach sowie
zehn Briefen von Henriette Feuerbach geb. Heydenreich an ihren
Bruder Christian Heydenreich bzw. Briefe von ihm an sie mit einer
Summe von 1.000 Euro. Die Briefe wurden dem
Landesbibliothekszentrum Speyer im vergangenen Jahr zum Kauf
angeboten und stammen wahrscheinlich aus dem Nachlass einer
Enkeltochter von Christian Heydenreich, die 1944 ohne Nachkommen
verstorben war. Nicht alle Schreiben sind vollständig, aber die
Briefe sind in einem angesichts ihres Alters hervorragenden
Zustand.
Anselm Feuerbach wurde 1829 in Speyer geboren. Sein Großvater
war der berühmte Strafrechtler Paul Johann Anselm von Feuerbach,
sein Vater der später in Freiburg wirkende Archäologe Anselm
Feuerbach. Zur wichtigsten Bezugsperson für den Maler wurde seine
aus Ansbach stammende Stiefmutter Henriette Heydenreich. Der junge
Anselm erhielt seine künstlerische Ausbildung in Düsseldorf,
München und Paris und reiste 1855 mit Victor von Scheffel nach
Italien, wo vor allem der Besuch Venedigs ein einschneidendes
Erlebnis für ihn wurde. Ein überaus wichtiger Lebensabschnitt
begann mit seiner Übersiedelung nach Rom im Oktober 1856, wo in der
Folge der Hauptteil seines Werkes entstand. 1872/73 erhielt er eine
Professur an der Akademie der Künste in Wien, musste diese Stelle
aus gesundheitlichen Gründen aber schon 1876 wieder aufgeben.
Anselm Feuerbach starb Anfang 1880 in Venedig und wurde in Nürnberg
begraben. Sein künstlerisches Werk ist in erster Linie antiken
Klassizismus und der Malerei der Hochrenaissance beeinflusst.
Henriette Feuerbach hatte 1886 den größten Teil der Briefe, die
Anselm Feuerbach an sie geschrieben hatte, der Nationalgalerie in
Berlin geschenkt, eine unbekannte Anzahl von Briefen aber
zurückgehalten, die deshalb auch nicht in der maßgeblichen Ausgabe
von Briefen des Künstlers an seine Stiefmutter enthalten sind
(Anselm Feuerbachs Briefe an seine Mutter. Aus dem Besitz der
Königlichen National-Galerie zu Berlin hrsg. von G. J. Kern u.
Hermann Uhde-Bernays, Bd. 1-2, Berlin 1911, hier Bd. 1, S.
XIIf.).
In teils gekürzter Form und ohne Angabe des Herausgebers
erschien 1911 in der Zeitschrift ‚Die neue Rundschau’ 2 (1911) die
Auswahlbriefedition ‚Henriette Feuerbach, Briefe an ihren Bruder
Christian Heydenreich’ (S. 956-976, 1110-1124, 1274-1282). Ein Teil
der vom Landesbibliothekszentrum erworbenen Briefe findet sich in
der Edition, die jedoch weitere Briefe enthält. Offensichtlich
handelt es sich bei der neuen Speyerer Erwerbung nur noch um
Anteile einer ursprünglich größeren Sammlung. Das
Landesbibliothekszentrum Speyer besitzt ausweislich des
Autographenportals Kalliope neben der Nationalgalerie Berlin die
meisten Briefe von Anselm Feuerbach und Henriette Feuerbach.
www.lbz-rlp.de
Pfälzische Landesbibliothek, Speyer, Presse
16.04.2013
Schenkung der Ike und Berthold Roland-Stiftung an das Landesbibliothekszentrum in Speyer
 Teilnachlass
der Nachkommen Christian IV., Herzog von Zweibrücken
Teilnachlass
der Nachkommen Christian IV., Herzog von Zweibrücken
Speyer- Die Pfälzische Landesbibliothek Speyer,
heute Teil des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, konnte
1993/94 bei einem Kölner Auktionshaus einen Teil des Nachlasses der
Nachkommen von Christian IV., Herzog von Zweibrücken (1722-1775),
erwerben, der seitdem unter der Signatur N 73 aufbewahrt wird.
Christian IV. schloss sich nach der Übernahme der Regentschaft im
Jahr 1740 politisch eng an Frankreich an, sorgte für ein Aufblühen
seines Landes in spätaufklärerischer Tradition und begründete 1755
das heutige Landgestüt Zweibrücken. 1751 ging er eine nicht
standesgemäße Ehe mit der am Mannheimer Theater wirkenden Tänzerin
Maria Johanna Franziska Camasse (1734-1807) ein, die er 1757
öffentlich machte. Aus dieser Verbindung gingen insgesamt acht
Kinder hervor. Unter ihnen kommt den Söhnen Christian (1752-1817)
und Philipp Wilhelm (1754-1807), Grafen von Forbach, die größte
Bedeutung zu. Da sie nicht erbberechtigt waren, schlugen beide eine
militärische Karriere in französischen und später in bayerischen
Diensten ein. Als Kommandeure des von ihrem Vater aufgestellten
Regiments Royal Deux-Ponts nahmen sie am amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg teil und zeichneten sich in der entscheidenden
Schlacht von Yorktown durch besondere Tapferkeit aus, wofür sie von
George Washington geehrt wurden. Der amerikanische
Unabhängigkeitskrieg ist in diesem Nachlassteil breit dokumentiert.
Daneben finden sich persönliche Briefe, militärische Unterlagen
späterer Zeit, Unterlagen zum Vermögen und weitere persönliche
Dokumente. Aus der sich anschließenden Generation haben sich
Unterlagen zu Christians Tochter Casimire Marie Louise (1787-1846)
überliefert, die 1808 Gustav Graf von Sayn-Wittgenstein
heiratete.
 Die Ike und
Berthold Roland Stiftung Mannheim für Kunst und soziales Engagement
hat 2012 dem Landesbibliothekszentrum einen weiteren Teil des
Nachlasses der Nachkommen von Christian IV. geschenkt, der einen
Umfang von etwa eineinhalb laufenden Metern hat. Er schließt sich
nahtlos an den 1993/94 angekauften Nachlassteil an, rundet diesen
einerseits ab und führt ihn andererseits bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts weiter, als der Lebensmittelpunkt der Nachkommen
endgültig in München lag, wo auch schon Christian und Philipp
Wilhelm von Forbach gestorben waren. Großen Raum nehmen in diesem
Material die Trennung von Christian von Forbach von seiner Frau
Adelaide François Lèontine de Béthune-Pologne (1761-1823) ein, die
er 1783 geheiratet hatte, weiter deren Testament und
Nachlassinventar. Die meisten Unterlagen finden sich zu ihrer
gemeinsamen Tochter Casimire, zur Familie ihres Mannes Gustav Graf
von Sayn-Wittgenstein sowie zu deren Enkelgeneration. Neben
handschriftlichen Briefen von Christian von Forbach, der Tochter
Casimire und des Schwiegersohns Gustav von Sayn-Wittgenstein sind
verschiedene Rechnungsbücher, Ausgabenverzeichnisse, Besitz- und
Palaisinventare bemerkenswert. Hinzu kommen Materialien zu
Vormundschaftsangelegenheiten sowie zu Rechtsstreitigkeiten in
Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung um die Ebenbürtigkeit
zweier sayn-wittgensteinischer Linien.
Die Ike und
Berthold Roland Stiftung Mannheim für Kunst und soziales Engagement
hat 2012 dem Landesbibliothekszentrum einen weiteren Teil des
Nachlasses der Nachkommen von Christian IV. geschenkt, der einen
Umfang von etwa eineinhalb laufenden Metern hat. Er schließt sich
nahtlos an den 1993/94 angekauften Nachlassteil an, rundet diesen
einerseits ab und führt ihn andererseits bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts weiter, als der Lebensmittelpunkt der Nachkommen
endgültig in München lag, wo auch schon Christian und Philipp
Wilhelm von Forbach gestorben waren. Großen Raum nehmen in diesem
Material die Trennung von Christian von Forbach von seiner Frau
Adelaide François Lèontine de Béthune-Pologne (1761-1823) ein, die
er 1783 geheiratet hatte, weiter deren Testament und
Nachlassinventar. Die meisten Unterlagen finden sich zu ihrer
gemeinsamen Tochter Casimire, zur Familie ihres Mannes Gustav Graf
von Sayn-Wittgenstein sowie zu deren Enkelgeneration. Neben
handschriftlichen Briefen von Christian von Forbach, der Tochter
Casimire und des Schwiegersohns Gustav von Sayn-Wittgenstein sind
verschiedene Rechnungsbücher, Ausgabenverzeichnisse, Besitz- und
Palaisinventare bemerkenswert. Hinzu kommen Materialien zu
Vormundschaftsangelegenheiten sowie zu Rechtsstreitigkeiten in
Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung um die Ebenbürtigkeit
zweier sayn-wittgensteinischer Linien.
Die Nachlassergänzung durch die Ike und Berthold Roland Stiftung
erweitert mit den Materialien zu Christian von Forbach und seiner
Nachkommen die Quellenlage zu einer bedeutenden pfälzischen adligen
Familie ganz erheblich. Sie bietet damit die Grundlage für weitere
personengeschichtliche Forschungen zu dieser Dynastie. Insbesondere
die Rechungen und Rechnungsbücher sind weiter eine wichtige
wirtschaftliche und sozialgeschichtliche Quelle für die adlige
Lebenswirklichkeit in Süddeutschland in der pfalzbayerischen Zeit.
Diese Materialien werden zukünftig auch unter der Signatur N 73
aufbewahrt, bleiben aber als separater Fonds und als Schenkung der
Stiftung kenntlich.
Im Anhang finden Sie eingescannte erste Seite des
handschriftlichen Testaments in französischer Sprache von Casimire
Marie Luise Gräfin von Forbach (1787-1846). Sie war die Tochter von
Christian Graf von Forbach und Freiherr von Zweybrücken und
heiratete 1808 Gustav Graf zu Sayn-Wittgenstein. www.lbz-rlp.de LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM
RHEINLAND-PFALZ, Presse
Lesen Sie hierzu auch einen EINWURF von Gerhard Cantzler

10.04.2013
Einwurf
In Zweibrücken verschmäht – in Speyer mit offenm Herzen
empfangen:
Speyerer Landesbibliothek Nutznießer eines
unbegreiflichen kunsthistorischen Affronts
Von Gerhard Cantzler
Er zählt sicher zu den herausragenden Persönlichkeiten in
Kunstgeschichte und Kulturmanagement der Gegenwart in der Kurpfalz
und weit darüber hinaus: Prof. Dr.
Berthold Roland, der jetzt einmal mehr namens der von
seiner Gattin und ihm gegründeten „Ike-und
Berthold-Roland-Stiftung“ wertvolle Teile des von ihm
gesammelten Nachlasses der Nachkommen des Herzogs aus der
Birkenfeld-Bischweiler Linie der Zweibrücker Wittelsbacher der
Handschriften-Sammlung der Speyerer Landesbibliothek
überreichte.
Und dabei hatte sich das der in Landau geborene und in der
Speyerer Prinz-Luitpold-Straße aufgewachsene Kunsthistorikers
einmal ganz anders vorgestellt: Die Zweibrücker Bibliothek sollte
eigentlich Empfänger dieser kunsthistorischen Pretiosen sein, die
Dr. Roland stets „ungesehen“, wie er bei der Übergabe betonte, im
Kusnthandel erworben hatte – zu nah war ihm stets das Zweibrücker
Herzogsgeschlecht, als dass er etwas ausgelassen hätte.
Auf dieses Geschlecht hatte ihn einst Prof. Dr.
Johann Buchheit, Kunsthistoriker und in den 1930er
Jahren Direktor des Bayerischen Nationalmuseums in München im
Rahmen seines Studiums an der Bayerischen
Ludwig-Maximilians-Universität „gebracht“. Prof. Dr. Buchheit,
selbst in Zweibrücken geboren und mit dem damaligen Direktor des
Historischen Museums der Pfalz in Speyer, Dr. Friedrich
Sprater, eng befreundet – bei letzterem ging Berthold
Roland in der Nachbarschaft seines Elternhauses schon als Kind ein
und aus, und er war es auch, der in ihm die Lust an und die
Leidenschaft für die Kunstgeschichte weckte – riet dem jungen
Studenten Berthold Roland, der damals auf der Suche nach einem
attraktiven Thema für seine Promotion war, sich doch einmal den
Zweibrücker Hofmaler Johann Christian von Mannlich
„anzuschauen“.
Eine lebenslange Liebe des jungen Speyerer Kunsthistorikers war
geweckt, die sich bis heute gehalten hat und die sich zuletzt erst
wieder in der Überlassung eines Porträts der „Gräfin von Forbach“
aus der Hand J. Chr. von Mannlichs als Dauerleihgabe an das
Historische Museum der Pfalz in Speyer manifestierte, in der sich
Herzog Christian IV. von Pfalz-Zweibrücken quasi „Bild in Bild“
widerspiegelt.
„Meine Frau Ike, die als Juristin 'einträgliche' Mandate hatte,
machte es mir möglich, vieles über diese Familie zu erwerben“,
bekennt Dr. Roland freimütig und so kam u.a. auch der jetzt
übergebene Nachlass in den Besitz der Famileinstiftung. Der
inzwischen 85jährige Dr. Berthold Roland selbst, der nach seiner
Zeit als Autor und Herausgeber zahlloser bedeutender Kunstkataloge
gut zehn Jahre lang Leiter der Kunstabteilung im
rheinland-pfälzischen Kultusministerium war und danach als Direktor
des Mittelrheinischen Landesmuseums in Mainz und – als
ausgewiesener Experte des Oeuvres des Bayerisch-Pfälzischen
Impressionisten Max Slevogt – das Museum Schloß „Villa Ludwigshöhe“
leitete und der als künstlerischer Berater für den Mainzer
Ministerpräsidenten und späteren Bundeskanzler Helmut Kohl ein
gefragter Ratgeber war, hätte sich, so gesteht er, seine
„Zweibrücker Leidenschaft“ „aus eigenem Geld“ nicht leisten können.
„Die öffentliche Hand war da nie so freigebig“.
Umso lieber hätte es natürlich das Stifterehepaar gesehen, wenn
ihre großherzige Gabe - der Nachlass des Zweibrücker Herzogs
Christian IV., der als Offizier im amerikanischen
Unabhängigkeitskrieg für seinen mutigen Einsatz durch ein Porträt
in der Rotunde des Washingtoner Capitols geehrte wurde, das ihn
gemeinsam mit dem ersten US-Präsidenten George Washington zeigt -
dort gelandet wäre, wo sie eigentlich hingehört: In der Bibilothek
von Zweibrücken.
Doch nachdem ein diesbezügliches, wiederholtes Angebot Dr.
Rolands an den Zweibrücker Oberbürgermeister ohne Resonanz blieb,
entschlossen sich Ike und Betrhold Roland – spürbar verärgert,
„Zweibrücken bekommt nichts!“
Und so kam dann die Speyerer Landebibliothek in den Besitz
dieses Konvoluts, das die bereits in den 1990er Jahren von einem
Kölner Kunsthändler erworbenen Nachlassteile in glückhafter Weise
ergänzt und komplettiert – und so kamen schließlich auch
die Speyerer Bibliotheks-“Leute“ , Ute Bahrs und Dr. Armin
Schlechter und die Journalisten in den Genuss, einmal mehr
diesem im besten Wortsinne „Mann der Kunst“ Dr. Berthold Roland zu
begegnen und für eine Stunde Anteil zu haben an seinem
Kunst-reichen Leben.
Und so wie sich zuvor schon das Speyerer Feuerbachhaus über ein
von Wolf Spitzer geschaffenes Porträt Anselm Feuerbachs -
gleichfalls eine Spende der „Ike-und-Berthold-Roland-Stiftung“ -
freuen durfte, so darf man sich jetzt auch in Bad Bergzabern auf
eine weitere Spende des großerhezigen Mannheimer Stifter-Ehepaares
freuen: Für die südpfälzische Kurstadt wird Berthold Roland den
Nachlass des Malers und Graphikers Werner vom Scheid und seiner
Frau, der Lyrikerin Martha Saalfeld, zu einer eindrucksvollen Schau
zusammenführen und in den nächsten Monaten der interssierten
Öffentlichkeit präsentieren.
„Kunst- und Bürgersinn vom Allerfeinsten“, kann man da
angesichts solcher Aktivitäten nur sagen.
Einblicke in die militärstrategischen „Schachzüge“ im Polnischen Thronfolgekrieg gewährt
 Speyerer LBZ
präsentiert deutsche Übersetzung eines außergewöhnlichen
Werkes
Speyerer LBZ
präsentiert deutsche Übersetzung eines außergewöhnlichen
Werkes
spk. Speyer. Es war ein durchaus ansehnlicher Kreis von
Interessierten, die jetzt zu der Präsentation der deutschen
Übersetzung der „Denkschrift von 1739“ nebst ausführlichem
Kartenteil des französischen Ingenieurs und Topographen Antoine
de Regemorte in das Landesbibiliothekszentrum in Speyer
gekommen waren. Unter ihnen konnte die Standortleiterin Speyer
des LBZ, Ute Bahrs, den früheren Oberbürgermeister von Speyer,
Dr. Christian Roßkopf sowie zwei ihrer Amtsvorgänger, Dr.
Hartmut Harthausen und Dr. Jürgen Vorderstemann, ganz
besonders begrüßen.
Prof. Dr. Heinz Musall, mehr als 20 Jahre lang Professor
für Kartographie und Geographie im Studiengang Kartographie und
Geomatik an der Technischen Hochschule Karlsruhe, hat die
Übersetzung und die wissenschaftliche Bearbeitung für dieses Werk
besorgt, dessen Original sich seit 1986 im Besitz der Pfälzischen
Landesbibliothek in Speyer befindet. Aus Anlaß dieser
Buchvorstellung war das kostbare Original für einen Abend lang
ausgestellt und konnte von den Besuchern auszugsweise in
Augenschein genommen werden.
Der aus einer Familie von Festungsbauunternehmern und
Militäringenieuren stammende Antoine de Regemorte beschrieb in
diesem Werk die militärischen Operationen im Polnischen
Thronfolgekrieg, die er als Begleiter der französischen Armee
während der Feldzüge der Jahre 1734 und 1735 im Raum zwischen der
Lauter im Süden und Mainz im Norden sowie in einigen Gebieten
rechts des Rheins erlebt hat.
 Der
wissenschaftliche Wert dieser Denkschrift, so Prof. Dr. Musall in
seinem Vortrag, liege insbesondere in den detaillierten
Beschreibungen des von den Truppen durchquerten Geländes und der
logistischen Probleme, die bei Truppenbewegungen größeren Umfangs
im 18. Jahrhundert zu lösen waren. Die Schilderungen in dem Werk
böten damit zusätzliche, weit über die üblichen Operationsjournale
hinausgehende Informationen zum Kriegsschauplatz, wo es ein
Hauptanliegen der Truppenführung sein musste, so gut wie möglich
für die Verpflegung der Truppen und ganz besonders auch für
Futtervorräte für die große Anzahl mitgeführter Pferde usw. in
feindlichem Gebiet zu sorgen.
Der
wissenschaftliche Wert dieser Denkschrift, so Prof. Dr. Musall in
seinem Vortrag, liege insbesondere in den detaillierten
Beschreibungen des von den Truppen durchquerten Geländes und der
logistischen Probleme, die bei Truppenbewegungen größeren Umfangs
im 18. Jahrhundert zu lösen waren. Die Schilderungen in dem Werk
böten damit zusätzliche, weit über die üblichen Operationsjournale
hinausgehende Informationen zum Kriegsschauplatz, wo es ein
Hauptanliegen der Truppenführung sein musste, so gut wie möglich
für die Verpflegung der Truppen und ganz besonders auch für
Futtervorräte für die große Anzahl mitgeführter Pferde usw. in
feindlichem Gebiet zu sorgen.
Dem Leser, so Prof. Dr. Musall, werden hier Einzelheiten zum
Ablauf des Kriegsgeschehens vor Augen geführt, wie er sie aus
anderen Quellen nicht oder nicht aus diesem militärischen
Blickwinkel erfahren kann. Zum anderen enthalte die Denkschrift
19 handgezeichnete Karten aus dem Operationsgebiet, die mit
ihren großen Maßstäben wichtige historisch-geographische Quellen
darstellten. Zudem würden sie eine Fülle an topographischen Details
aufweisen, wie sie in früheren militärkartographischen Aufnahmen
der französischen Ingenieure von diesem Raum nicht zu finden
seien..
 Im Teil I des
Werkes ssind der vollständige Text der Denkschrift einschließlich
der darin enthaltenen Karten enthalten. In Teil II werde zunächst
der Verlauf des Polnischen Thronfolgekrieges (1733–1737/38)
geschildert, um die in der Denkschrift erwähnten Ereignisse besser
einordnen zu können. Es folgen Ausführungen zur Praxis der
damaligen Kriegführung mit den sich dabei bei allen Heeren dieser
Zeit ergebenden Problemen und zu den speziellen Tätigkeiten der
Militäringenieure.
Im Teil I des
Werkes ssind der vollständige Text der Denkschrift einschließlich
der darin enthaltenen Karten enthalten. In Teil II werde zunächst
der Verlauf des Polnischen Thronfolgekrieges (1733–1737/38)
geschildert, um die in der Denkschrift erwähnten Ereignisse besser
einordnen zu können. Es folgen Ausführungen zur Praxis der
damaligen Kriegführung mit den sich dabei bei allen Heeren dieser
Zeit ergebenden Problemen und zu den speziellen Tätigkeiten der
Militäringenieure.
Um die Bedeutung der genauen topographischen Aufnahmen von
Regemorte als wichtigem Schritt zur modernen großmaßstäbigen
topographischen Karte herauszustellen, werden Beispiele früherer
von französischen Militärkartographen hergestellter Karten am
Oberrhein bis zum Anfang des 18. Jahrhunderts zum Vergleich
gezeigt.
Mit seinem mit vielen Kartensdarstellungen unterlegten Vortrag
hat der Autor, der seit 1969 mit zahlreichen Beiträgen zur
historischen Kulturlandschaft und zur Geschichte der Kartographie
der Oberrheinlande hervorgetreten ist und der auch selbst mehrere
Kartenausstellungen mitbetreute, hat Prof. Dr. Musall bei seinen
Zuhörern sicher Lust darauf geweckt, sich auch mit seiner 1999
entstandene Übersetzung und Kommentierung der französischen
Denkschrift des Chevalier de Clairac über die Reichsfestung
Philippsburg näher zu befassen.. Foto: gc
21.03.2013
Freier Zugang zu alten Drucken in dilibri Rheinland-Pfalz
 Abbildung des Titelblatts der "Chronica der freyen Reichs-Stadt Speier" von Christoph Lehmann in der Ausgabe von 1612
Abbildung des Titelblatts der "Chronica der freyen Reichs-Stadt Speier" von Christoph Lehmann in der Ausgabe von 1612
Die „Chronica der freyen Reichs-Stadt Speier“
des Juristen und Historikers Christoph Lehmann ist ein
grundlegendes Quellenwerk zur Speyerer Stadtgeschichte. Die
Ausgaben von 1612, 1662 und 1711 aus dem Bestand des
Landesbibliothekszentrums / Pfälzische Landesbibliothek sind nun
ohne Beschränkung einsehbar im rheinland-pfälzischen
Digitalisierungsportal dilibri www.dilibri.de .
Ermöglicht wurde dies durch ein von der Deutschen
Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördertes Digitalisierungsprojekt.
Unter Federführung der Universitätsbibliothek Trier stellten im
Sommer 2009 acht rheinland-pfälzische Bibliotheken bei der DFG
einen gemeinsamen Antrag auf finanzielle Beihilfe für die
Digitalisierung aller im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke
des 16. und 17. Jahrhunderts und ausgewählter Drucke des 18.
Jahrhunderts aus ihrem Bestand. Die für die Digitalisierung in
Frage kommenden Drucke sollten nicht bereits in anderen
Digitalisierungsvorhaben gescannt worden oder dort zur
Digitalisierung vorgesehen sein.
Nach positivem Bescheid seitens der DFG wurde zu Beginn des
Jahres 2010 mit der Abstimmungsphase zwischen den
Projektteilnehmern für dieses anspruchsvolle kooperative Vorhaben
begonnen. Projektteilnehmer waren neben der Universitätsbibliothek
Trier die Stadtbibliotheken in Koblenz, Trier und Worms, die
Bibliothek des Priesterseminars Trier und das
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) mit seinen drei
Bibliotheken Bibliotheca Bipontina Zweibrücken, Pfälzische
Landesbibliothek Speyer, Rheinische Landesbibliothek Koblenz.
Für die Durchführung des DFG-Digitalisierungsprojektes erwies
sich die bereits seit 2007 vom LBZ entwickelte und gepflegte
Digitalisierungsplattform dilibri als extrem hilfreich. Dilibri ist
die digitalisierte Sammlung von landeskundlichen Werken zu
Rheinland-Pfalz sowie von Beständen aus rheinland-pfälzischen
Bibliotheken. Eine Erweiterung der dilibri-Plattform für die
Umsetzung der DFG-Anforderungen war problemlos möglich.
Da nicht alle am Projekt teilnehmenden Bibliotheken über die
notwendige technische Infrastruktur verfügten, wurde das Scannen
und Bearbeiten der Dateien vornehmlich in der
Universitätsbibliothek Trier und in den beiden LBZ-Standorten
Speyer und Koblenz vorgenommen.
Das im August 2010 offiziell gestartete Projekt konnte zwei
Jahre später planungsgemäß und mit Erfolg abgeschlossen werden. In
diesem Zeitraum wurden knapp 2.300 Werke mit mehr als 400.000
Einzelscans in dilibri kostenfrei bereitgestellt. Auf das 16.
Jahrhundert entfallen davon ca. 750 Werke, auf das 17. Jahrhundert
1.000 Werke und 450 Werke stammen aus dem 18. Jahrhundert.
„Es war uns ein großes Anliegen, dass wir nun teilweise bislang
unerschlossene Werke des 16., 17. und 18. Jahrhunderts kostenfrei
und auf unkompliziertem Wege für die Wissenschaft und auch für eine
interessierte Öffentlichkeit zugänglich machen können“, führt der
Koordinator des DFG-Projektes Dr. Hans-Ulrich Seifert von der
Universitätsbibliothek Trier aus.
Als Beispiele seien hier genannt das farbenfrohe Turnierbuch von
Georg Rüxner, 1532 in Simmern in der Druckerei des Pfalzgrafen
gedruckt, schön ausgestattete Messbücher (z.B. das Missale
Trevirense) oder Ausgaben der „Chronica Der Freyen Reichs-Statt
Speyer“.
Nach dem Abschluss des DFG-Projektes bleibt das
Digitalisierungsportal dilibri weiterhin die digitalisierte
Sammlung von landeskundlichen Werken zu Rheinland-Pfalz. So sind in
dilibri aktuell mehr als 4.400 Objekte von der Einblatt-Karte bis
zur 17-bändigen Zeitschrift mit etwa 720.000 gescannten Seiten
einzusehen. Neben den beliebten Adressbüchern wird auf der
Plattform auch auf die digitalisierten Karten und die
Illustrationswerke sowie auf die landesgeschichtliche Literatur
gerne zugegriffen.
Für die Betreiber von dilibri ist die Kooperation mit weiteren
Bibliotheken, Archiven und auch historischen Vereinen wichtig, wie
der dilibri-Verantwortliche Elmar Schackmann (LBZ) betont. Denn
diese stellen häufig singuläre Objekte aus ihrem Besitz für die
Veröffentlichung in dilibri zur Verfügung. Der Fokus der
Digitalisierungsplattform wird in unmittelbarer Zukunft stark auf
der Digitalisierung von landeskundlichen Beständen aus
rheinland-pfälzischen Bibliotheken liegen.
LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM RHEINLAND-PFALZ, Speyer,
Presse
26.02.2013
Dr. Annette Gerlach neue Leiterin des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz
 v.l. Karl-Heinz Frickel, Personalratsvorsitzender, Christoph Kraus, Kulturabteilungsleiter im MBWWK, Dr. Annette Gerlach, Leiterin des LBZ, Günter Pflaum, Stellvertrender Leiter des LBZ
v.l. Karl-Heinz Frickel, Personalratsvorsitzender, Christoph Kraus, Kulturabteilungsleiter im MBWWK, Dr. Annette Gerlach, Leiterin des LBZ, Günter Pflaum, Stellvertrender Leiter des LBZ
Am 3. Dezember wurde die neue Leiterin des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz (LBZ), Dr. Annette
Gerlach, in Koblenz offiziell in ihr Amt eingeführt. Dr. Gerlach
war zuletzt Leiterin der Historischen Sammlungen der Zentral- und
Landesbibliothek Berlin und zuständig für die Bestandserhaltung,
darüber hinaus leitete sie seit fünf Jahren das „Kompetenzzentrum
Bestandserhaltung für Archive und Bibliotheken in Berlin und
Brandenburg". Vorher war sie stellvertretende Direktorin der
Anhaltischen Landesbücherei Dessau.
Im Landesbibliothekszentrum sind die Bibliotheca Bipontina in
Zweibrücken, die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer, die
Rheinische Landesbibliothek in Koblenz und die beiden
Büchereistellen in Koblenz und Neustadt zusammengefasst. Mit seinen
fünf Einrichtungen ist das LBZ ein leistungsstarkes
Kompetenzzentrum für alle Fragen der Medien- und
Informationsvermittlung.
Günter Pflaum, Stellvertretender Leiter des
Landesbibliothekszentrums, hieß Dr. Gerlach im LBZ herzlich
willkommen. Anschließend überbrachte Christoph Kraus, Leiter der
Kulturabteilung im Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur, Grüße von Ministerin Doris Ahnen und
Staatssekretär Walter Schumacher. Er betonte, dass mit Dr. Gerlach
eine Leiterin für das LBZ gewonnen werden konnte, die über
langjährige Erfahrungen sowohl im öffentlichen als auch im
wissenschaftlichen Bibliothekswesen verfüge. Der
Personalratsvorsitzende, Karl-Heinz Frickel, begrüßte die neue
Leiterin im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
Beschäftigten seien sich bewusst, dass das LBZ sich weiter
entwickeln müsse und freuten sich darauf, gemeinsam mit der neuen
Leitung diese Entwicklung zu gestalten.
In ihrer Antrittsrede stellte Dr. Annette Gerlach die Rolle des
LBZ im digitalen Zeitalter dar. Es sei sowohl
Kulturgedächtnisinstitution als auch Dienstleistungseinrichtung für
öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken im Land und darüber
hinaus für die aktuelle Informationsversorgung zuständig. In
einigen Bereichen, z. B. bei der Leseförderung und den digitalen
Angeboten wie dem rheinland-pfälzischen Digitalisierungsportal
dilibri, sei das LBZ Vorbild für andere Bundesländer. Um diese und
neue Aufgaben auch in Zukunft erfüllen zu können, müssten die
einzelnen Standorte stärker zu einer Einrichtung zusammen wachsen;
gleichzeitig sollten ihre regionalen Spezifika und Aufgaben
erkennbar bleiben. In der Bündelung von Kompetenzen und
Dienstleistungen und in einer stärkeren Vernetzung im Land, mit
Schulen, Bibliotheken, Museen, Archiven und anderen
Kultureinrichtungen, lägen die Chancen des LBZ.
Nach der Überzeugung von Dr. Gerlach werden Bibliotheken auch in
Zukunft für eine demokratische Gesellschaft unverzichtbar bleiben
und sollten ihre Rolle selbstbewusst artikulieren und sich stärker
in den gesellschaftlichen Prozess einmischen. www.lbz-rlp.de LANDESBIBLIOTHEKSZENTRUM
RHEINLAND-PFALZ, Presse; Foto: LBZ
04.12.2012
Deutsche und internationale Bucheinbände im Blickpunkt internationaler Experten
 Einbandforscher
zu Gast im Landesbibliothekszentrum Speyer
Einbandforscher
zu Gast im Landesbibliothekszentrum Speyer
von Ute Bahrs
Einbandforschung ist eine Hilfswissenschaft, die die Geschichte
des Bucheinbandes mit seiner technischen und künstlerischen
Entwicklung zum Gegenstand hat. Um ihr wieder neue Impulse zu
geben, gründete sich 1996 in Leipzig der „Arbeitskreis für die
Erfassung, Erschließung und Erhaltung historischer Bucheinbände“
(AEB). Der AEB sieht sich als Anlaufstelle für alle Fragen im
Zusammenhang mit der Erfassung und Bestimmung historischer und
moderner künstlerischer Bucheinbände. Berücksichtigt wird auch die
industrielle Buchproduktion bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts.
Institutionell ist der AEB an die Staatsbibliothek zu Berlin -
Preußischer Kulturbesitz angebunden, wo auch die Geschäftsstelle
geführt wird.
Seit 1996 treffen sich Einbandforscher aus dem In- und Ausland
einmal jährlich zu einer Tagung, die regelmäßig mit einer
Einbandausstellung eröffnet wird. 2012 fand die 17. AEB-Tagung
jetzt - mit freundlicher Unterstützung der Sparkassenstiftung der
Kreis- und Stadtsparkasse Speyer - im Landesbibliothekszentrum in
Speyer statt. Knapp 100 Einbandforscher/innen aus Deutschland und
neun weiteren europäischen Ländern waren dazu nach Speyer gekommen,
wo sie am Abend der Ausstellungseröffnung vom Mainzer
Staatssekretär Walter Schumacher und der Speyerer Bürgermeisterin
Monika Kabs in Speyer und im LBZ empfangen wurden. Dr. Armin
Schlechter vom LBZ führte sodann in das Thema der Ausstellung ein -
Einbände des 16. bis 18. Jahrhunderts aus den Beständen der
Bibliothek des Gymnasiums am Kaiserdom - und erklärte die
Geschichte, die hinter dieser Bibliothek steht. Zu der Ausstellung
ist als Band 8 der Schriftenreihe des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz auch ein Katalog erschienen: „Ex Bibliotheca
Lycei Spirensis“ (15 Euro).
 Für die
Vorträge an den beiden Veranstaltungstagen hatte die Deutsche
Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) ihre Aula zur
Verfügung gestellt - die DUV liegt gleich gegenüber der
Landesbibliothek. Im ersten Vortragsblock standen die Bestände der
Bibliotheca Bipontina im Mittelpunkt: Zum einen stellte die
Leiterin, Dr. Sigrid Hubert-Reichling, Supralibros und andere
Besitzeintragungen im Bestand der herzoglichen Zweibrücker
Bibliothek vor, zum anderen zeigte Restauratorin Petra Brickmann
(LBZ Speyer) kurioses Deckelmaterial, auf das sie bei
Restaurierungsarbeiten gestoßen war. Anschließend befasste sich
Annelen Ottermann (StB Mainz) mit ihren Entdeckungen an Einbänden
aus der ehemaligen Bibliothek der Mainzer Karmeliten. Im einem
weiteren Vortrag ging es um Silberbeschläge an armenischen
Prachteinbänden, auf die Margret Jaschke (Daisendorf) und Prof. Dr.
Robert Stähle (Aichwald) bei Restaurierungsarbeiten in Yerewan
gestoßen waren.
Für die
Vorträge an den beiden Veranstaltungstagen hatte die Deutsche
Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) ihre Aula zur
Verfügung gestellt - die DUV liegt gleich gegenüber der
Landesbibliothek. Im ersten Vortragsblock standen die Bestände der
Bibliotheca Bipontina im Mittelpunkt: Zum einen stellte die
Leiterin, Dr. Sigrid Hubert-Reichling, Supralibros und andere
Besitzeintragungen im Bestand der herzoglichen Zweibrücker
Bibliothek vor, zum anderen zeigte Restauratorin Petra Brickmann
(LBZ Speyer) kurioses Deckelmaterial, auf das sie bei
Restaurierungsarbeiten gestoßen war. Anschließend befasste sich
Annelen Ottermann (StB Mainz) mit ihren Entdeckungen an Einbänden
aus der ehemaligen Bibliothek der Mainzer Karmeliten. Im einem
weiteren Vortrag ging es um Silberbeschläge an armenischen
Prachteinbänden, auf die Margret Jaschke (Daisendorf) und Prof. Dr.
Robert Stähle (Aichwald) bei Restaurierungsarbeiten in Yerewan
gestoßen waren.
Der zweite Tagungstag stand ganz im Zeichen von Workshops, in
denen sich die Teilnehmer/innen aktiv einbringen konnten. Bei
Einbandspezialist Olaf Nie (Weßling) ging es um die Unterschiede
und Entwicklungen bei Papier- und Gewebeeinbänden des 19.
Jahrhunderts. Im Schulungsraum des LBZ Speyer führte Ulrike
Marburger (Staatsbibliothek Berlin) in Recherchestrategien in der
Einbanddatenbank ein; der Schwerpunkt lag bei den Einzelstempeln.
Dag-Ernst Petersen (Wolfenbüttel) vermittelte sein Wissen um
Einbandbeschreibung und Einbandbestimmung, d.h. was können
Einbandtechniken und –materialien aussagen. Dr. Franz Maier und
Restauratorin Elisabeth Schneider boten eine Führung durch das
Landesarchiv Speyer an, Dr. Armin Schlechter führte durch die
Einbandausstellung.
Alle Workshops waren ausgebucht, die Führungen sehr gut besucht.
Nach einer kleinen Atempause ging es weiter zum Empfang beim
Oberbürgermeister Hansjörg Eger im Historischen Ratssaal der
Stadt.
 Dort begrüßte
der Oberbürgermeister die Gäste und gab ihnen eine Einführung in
die Geschichte von Stadt und Rathaus. Die Stadt befinde sich in
einer ständigen Suche nach Spuren ihrer eigenen Geschichte, so Eger
– zuletzt bei Grabungen vor dem Kaiser- und Mariendom. Diese
Kathedrale bezeichnete er zugleich auch als den wohl bedeutendsten
„Einband“ in der Stadt, umrahme er doch das wichtigste Dokument in
der Stadtgeschichte – den „Freiheitsbrief“ von Kaiser Heinrich V.
aus dem Jahr 1111, der den Bürgern der Stadt Speyer besondere
Rechte eingeräumt habe.
Dort begrüßte
der Oberbürgermeister die Gäste und gab ihnen eine Einführung in
die Geschichte von Stadt und Rathaus. Die Stadt befinde sich in
einer ständigen Suche nach Spuren ihrer eigenen Geschichte, so Eger
– zuletzt bei Grabungen vor dem Kaiser- und Mariendom. Diese
Kathedrale bezeichnete er zugleich auch als den wohl bedeutendsten
„Einband“ in der Stadt, umrahme er doch das wichtigste Dokument in
der Stadtgeschichte – den „Freiheitsbrief“ von Kaiser Heinrich V.
aus dem Jahr 1111, der den Bürgern der Stadt Speyer besondere
Rechte eingeräumt habe.
In diesem Sinne sei auch der Historische Ratssaal sicher so
etwas wie ein Einband, seien doch in seinen Mauern über
Jahrhunderte hinweg bis ins Jahr 1990 für die Stadt bedeutsame
Entscheidungen getroffen worden. Heute lebe Speyer quasi von seiner
Geschichte, stellte der Oberbürgermeister mit Verweis auf die
jährlich mehr als zwei Millionen Touristen fest. „Wir fühlen uns
wohl im wohl schönsten Mittelzentrum der Welt“, betonte Eger und
erinnerte abschließend daran, dass in der Geschichte auch eine
bedeutende Stätte des Buchdrucks gewesen sei. „Diese Tradition
können wir glücklicherweise mit dem Landesbibliothekszentrum – der
„alten“ LaBi – und dem Staatsarchiv bis heute fortführen“, so der
OB stolz. Zudem gebe es in der Stadt durchaus auch überaus kreative
Einbandkünstler, so Eger und erinnerte in diesem Zusammenhang an
die jetzt in London wirkende Jeanette Koch, die noch vor kurzem
ihre Arbeiten in der „LaBi“ gezeigt hatte.
 Andreas
Wittenberg, verantwortlicher Bibliothekar für die Einbandforschung
an der Berliner Staatsbibliothek, bedankte sich namens seiner
Kolleginnen und Kollegen für den freundlichen Empfang an so
repräsentativer Stelle und bemerkte, dass Speyer bei den
Einband-Spezialisten nicht erst seit dieser Tagung einen guten
Namen habe. Als Erinnerungsgeschenk hatte Wittenberg ein Exemplar
des zum 350jährigen Jubiläum der Berliner Staatsbibliothek
veröffentlichten Kataloges mitgebracht.
Andreas
Wittenberg, verantwortlicher Bibliothekar für die Einbandforschung
an der Berliner Staatsbibliothek, bedankte sich namens seiner
Kolleginnen und Kollegen für den freundlichen Empfang an so
repräsentativer Stelle und bemerkte, dass Speyer bei den
Einband-Spezialisten nicht erst seit dieser Tagung einen guten
Namen habe. Als Erinnerungsgeschenk hatte Wittenberg ein Exemplar
des zum 350jährigen Jubiläum der Berliner Staatsbibliothek
veröffentlichten Kataloges mitgebracht.
Der zweite Tag der internationalen Fachtagung stand dann ganz im
Zeichen der europäischen Einbände: Prof. Mirjam Foot und Dr. Karen
Limper-Herz (London) stellten das Leben reisender
Buchbindergesellen im 17. und 18. Jahrhundert vor. Liia Rebane
(Tallinn) befasste sich mit niederländischen Einbänden in Tallinn.
Alte, handschriftliche Zeugnisse von meist deutschen Buchbindern
aus seiner eigenen Bibliothek standen im Mittelpunkt des Vortrags
von Geert van Daals (Dodewaard) . Um Weimarer Bibliothekseinbände
zwischen 1758 und 1918 ging es schließlich Matthias Hageböck
(Weimar).
Den krönenden Abschluss für die knapp 50 Teilnehmer/innen
bildete eine Exkursion nach Zweibrücken, wo Frau Dr.
Hubert-Reichling ihnen die prächtigsten Exemplare der an
eindrucksvollen Einbänden reichen Bibliotheca Bipontina vorstellte.
Um für die Führung genügend Platz zu haben, musste sich die Gruppe
teilen und erhielt zusätzlich eine kleine unterhaltsame
Stadtführung, für die Oberbürgermeister a.D. Prof. Helmut Reichling
sorgte.
Alle Teilnehmer/innen zeigten sich begeistert von der gelungenen
Organisation der Tagung, der herzlichen Gastfreundschaft in Speyer
sowie dem interessanten Programm an beiden Tagen. Sie wollen Speyer
– und Zweibrücken – in bester Erinnerung behalten und viele auch
gerne wiederkommen. Foto: gc; LBZ; Christoph Mayr
09.10.2012
LBZ Speyer durch Max Slevogts schriftlichen Nachlass weiter aufgewertet
 Rheinland-Pfalz
komplettiert seinen Besitz an Zeugnissen des bedeutenden
Impressionisten
Rheinland-Pfalz
komplettiert seinen Besitz an Zeugnissen des bedeutenden
Impressionisten
von Gerhard Cantzler
Er zählt zu den herausragenden Vertretern des
Impressionismus überhaupt und in der deutschen Kunstgeschichte
neben Max Liebermann und Lovis Corinth zu den “drei Großen” dieses
Genres - Max Slevogt, 1868 in Landshut in Bayern geboren und 1932
in Leinsweiler-Neukastel in der Pfalz auf dem später nach ihm
benannten Slevogthof gestorben - dem Ort, der ihm zum liebsten in
seinem Leben wurde.
 Im
Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Speyer wurde jetzt einer großen
Zahl von Kunstfreunden ein erster Blick auf den schriftlichen
Nachlass des Malers gewährt, den das Land Rheinland-Pfalz vor
kurzem aus Mitteln der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz und der
Kulturstiftung der Länder aus dem Besitz der Familie Slevogt
erwerben konnte. “Wir wollten mit dieser Präsentation nicht warten,
bis eine abschließende Aufarbeitung dieses Aufsehen erregenden
Konvoluts erfolgt ist”, erklärte mit launig-humorigen Worten der
zuständige Kultur-Staatssekretär Walter Schumacher
vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur, der eigens zu diesem Anlass aus Mainz
nach Speyer gekommen war.
Im
Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Speyer wurde jetzt einer großen
Zahl von Kunstfreunden ein erster Blick auf den schriftlichen
Nachlass des Malers gewährt, den das Land Rheinland-Pfalz vor
kurzem aus Mitteln der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz und der
Kulturstiftung der Länder aus dem Besitz der Familie Slevogt
erwerben konnte. “Wir wollten mit dieser Präsentation nicht warten,
bis eine abschließende Aufarbeitung dieses Aufsehen erregenden
Konvoluts erfolgt ist”, erklärte mit launig-humorigen Worten der
zuständige Kultur-Staatssekretär Walter Schumacher
vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur, der eigens zu diesem Anlass aus Mainz
nach Speyer gekommen war.
Er kündigte für das kommende Jahr eine große,
repräsentative Ausstellung der Werke Max Slevogts im Mainzer
Landesmuseum an - der ersten nach dann vierzig Jahren. Damals hatte
das Land zahlreiche Bilder und Plastiken des Künstlers erworben,
die auch bei der Schau im Jahr 2013 gezeigt werden.
Mit dem Erwerb des schriftlichen Nachlasses sei es
dem Land nun gelungen, neben den Bildern, Plastiken und graphischen
Arbeiten des Künstlers sowie dem Slevogthof mit seinem
einzigartigen Wandgemälde als Beispiel der architektonischen
Kreativität des Malers nun auch die Schriftwechsel mit so vielen
Künstlern und anderen bedeutenden Persönlichkeiten seiner Zeit in
Obhut zu nehmen, mit denen es nun erst wirklich möglich sei, das
Oeuvre dieses bedeutenden Künstlers umfänglich zu erschließen. “Zu
verdanken haben wir dies dem Umstand, dass sich das Land
Rheinland-Pfalz schon vor Jahren von seiner Landesbank getrennt
hat”, erläuterte Schumacher, “und den Erlös als Stiftungskapital in
die Kulturstiftung des Landes einbrachte”. Eine gute und - wie sich
angesichts der Probleme, die andere Länder mit ihren Landesbanken
bis heute haben - richtige Entscheidung.
 Zuvor schon
hatte LBZ-Direktor Dr. Helmut Frühauf unter den Gästen mit
besonderer Herzlichkeit Eva Emanuel-Slevogt, eine Nachfahrin des
großen Malers und den wohl bedeutensten lebenden Kenner des Werkes
von Max Slevogt, den Kunsthistoriker und Kultur-Manager Dr.
Berthold Roland, begrüßt.
Zuvor schon
hatte LBZ-Direktor Dr. Helmut Frühauf unter den Gästen mit
besonderer Herzlichkeit Eva Emanuel-Slevogt, eine Nachfahrin des
großen Malers und den wohl bedeutensten lebenden Kenner des Werkes
von Max Slevogt, den Kunsthistoriker und Kultur-Manager Dr.
Berthold Roland, begrüßt.
Ebenfalls zu diesem Anlass in die Speyerer
“LaBi”gekommen: Der Vorsitzende des Kulturpolitischen Ausschusses
im Mainzer Landtag, Manfred Geis MdL (SPD), Oberbürgermeister
Hansjörg Eger und sein Vorgänger Werner Schineller sowie zahlreiche
weitere Freunde der Bibliothek und des Schaffens Max Slevogts.
“Der Nachlass wurde von zwei unabhängigen
Gutachtern bewertet und von beiden Seiten - Käufer und der Familie
als Veräußerer in seinem festgestellten Wert akzeptiert”, konnte
Dr. Frühauf vermelden. Nun werde die umfangreiche Sammlung - unter
der Signatur “N 100" im Speyerer LBZ verwahrt - bearbeitet und dem
bisher schon vorhandenen, nennenswerten Slevogt-Bestand
beigeschlossen. Die Bibliothek habe bisher vor allem die von Max
Slevogt illustrierten Bücher gesammelt und sich - soweit auf
entsprechenden Auktionen angeboten - um den Erwerb von
Slevogt-Autographen bemüht. Mit dem jetzt hinzu gekommenen Nachlass
verfüge das Haus damit über die wohl bedeutendste Sammlung
eigenhändiger Briefe des Malers.
Das bestätigte auch der Leiter der Abteilung
Handschriften, Alte Drucke und Nachlässe bei der “LaBi”, Dr. Armin
Schlechter, der in einer kurzen Einführung das insgesamt 3.700
Blätter in 3.000 Objekten umfassende Konvolut vorstellte. Dabei
unterschied er Briefe, die Slevogt an seine Familie, insbesondere
an seine Frau, geschrieben hat - dazu zahlreiche Briefentwürfe
sowie 2.500 von Dritten an den Maler gerichtete Schreiben.
 Von den 1880er
Jahren bis zum Tod des Malers dokumentieren die Blätter den
Aufstieg Slevogts - eingebunden in ein vielfältiges
Beziehungsgeflecht, das ihn mit zahlreichen Künstlerfreunden und
Prominenten seiner Zeit verband. Vom Studentenausweis an der
Akademie der Künste in München bis hin zu dem Kondolenztelegramm,
das Reichspräsident von Hindenburg der Witwe des Malers zu dessen
Tod übermittelte, reichen die Lebenszeugnisse Slevogts, die jetzt
in Speyer ihre neue Heimat gefunden haben.
Von den 1880er
Jahren bis zum Tod des Malers dokumentieren die Blätter den
Aufstieg Slevogts - eingebunden in ein vielfältiges
Beziehungsgeflecht, das ihn mit zahlreichen Künstlerfreunden und
Prominenten seiner Zeit verband. Vom Studentenausweis an der
Akademie der Künste in München bis hin zu dem Kondolenztelegramm,
das Reichspräsident von Hindenburg der Witwe des Malers zu dessen
Tod übermittelte, reichen die Lebenszeugnisse Slevogts, die jetzt
in Speyer ihre neue Heimat gefunden haben.
Bedeutendes wie die Korrespondenz zum “Skandal” um
Slevogts Bild “Danae”, das er wegen der freizügigen Darstellung der
Heroenmutter im Jahr 1899 aus einer Ausstellung der “Münchner
Sezession” entfernen musste, bis hin zu durchaus Banalem - den
Speisekarten zu besonderen Anlässen zum Beispiel, zu deren
Illustrierung sich Künstler in jener Zeit immer wieder gerne
überreden ließen.
Autographen von Christian Morgenstern, Gerhard
Hauptmann, Käthe Kollwitz, Else Lasker-Schüler oder Winifred Wagner
finden sich ebenso in dem Nachlass wie Korrespondenzen mit
bedeutenden Pfälzern: Mit den Malerfreunden Adolf Keßler, Heinrich
Strieffler, Otto Dill und August Croissant, sowie mit dem Gründer
des Pfälzerwald Vereins, Heinrich Kohl, der als Bankier dem Maler
auch als Finanzberater ein wichtiger Gesprächspartner war.
Dazu die umfangreiche Korrespondenz mit Paul und
Bruno Cassirer in Berlin, die seine Bilder “vermarkteten” und die
von ihm illustrierten Bücher und Mappenwerke verlegten. Mit “Don
Giovanni” und “Ali Baba” zeigt die Ausstellung auch hierzu
herausragende Beispiele der Slevogt’schen
Buchillustrations-Kunst.
 Dr. Schlechter
gewährte schließlich auch Einblicke in die noch anstehenden und
notwendigen inhaltlich-historischen Recherche-Arbeiten sowie in die
Aufwendungen, die noch für die Sicherung der Blätter zu leisten
sind. Dabei wies er auf den insgesamt recht guten Zustand der
Briefe hin. Abgesehen von seltenen Fällen von Tintenfraß sowie von
Fraßspuren von Silberfischen an verschiedenen Blatträndern gehe es
deshalb vor allem um die Konservierung des Nachlasses für die
Nachwelt, sodass er auch für nachfolgende Generationen als
singuläre Quelle - zum Beispiel für die Erstellung künftiger
biographischer Arbeiten - bereit stehe.
Dr. Schlechter
gewährte schließlich auch Einblicke in die noch anstehenden und
notwendigen inhaltlich-historischen Recherche-Arbeiten sowie in die
Aufwendungen, die noch für die Sicherung der Blätter zu leisten
sind. Dabei wies er auf den insgesamt recht guten Zustand der
Briefe hin. Abgesehen von seltenen Fällen von Tintenfraß sowie von
Fraßspuren von Silberfischen an verschiedenen Blatträndern gehe es
deshalb vor allem um die Konservierung des Nachlasses für die
Nachwelt, sodass er auch für nachfolgende Generationen als
singuläre Quelle - zum Beispiel für die Erstellung künftiger
biographischer Arbeiten - bereit stehe.
Die Werkschau “Aus Max Slevogts Briefkasten” ist
noch bis zum 2. Juni 2012 während der Öffnungszeiten des
Landesbibliothekszentrums zu sehen.
Ein absolutes Muss für alle Freunde des deutschen
Impressionismus und des Malers Max Slevogt, der seit gestern noch
ein Stück mehr zum Pfälzer geworden ist. Foto: gc
22.05.2012
“Auf irren Pfaden durch die Hungerzeit”
.jpg) Liedermacher
Oskar “Oss” Kröher zu Gast im Speyerer
Landesbibiothekszentrum
Liedermacher
Oskar “Oss” Kröher zu Gast im Speyerer
Landesbibiothekszentrum
von Gerhard Cantzler
Sie bestimmten mit ihren Liedern - wie wohl nur
wenige in ihrer Zeit - das Lebensgefühl einer ganzen Generation:
Die Kröher-Zwilllinge Hein und Oss, die, von den Parolen des
Nationalsozialismus indoktriniert, die Gräuel des Krieges mit
seinem ganzen Schrecken durchleiden mußten, um dann heimzukehren in
ihre völlig zerstörte Heimat - nach Pirmasens. Dort - in einer
Atmosphäre absoluter Hoffnungslosigkeit - gelang es ihnen, sich und
andere mit ihrer Musik dazu anzustiften, aus der drohenden
Resignation heraus Wege zu suchen, um sicherzustellen, dass
Rassenhass und Antisemitismus, dass Herrenmenschentum und Gewalt
gegen andere Völker in Deutschland nie mehr eine Chance haben
dürften.
Viele derer, die all das durch eigene Erfahrungen
oder durch die Erzählungen ihrer Vätergeneration mit erfahren und
erlitten haben, sind Hein und Oss Kröher bis heute dankbar dafür,
dass sie ihnen in Zeiten der Hoffnungslosigkeit Wege der Ermutigung
aufgetan haben - dass sie ihnen die Augen geöffnet haben für die
einzige - dem Menschen gerechte Gesellschaftsform - die
Demokratie.
.jpg) Das konnte
man jetzt bei dem Leseabend im Speyerer Landesbibliothekszentrum,
der “alten LaBi” erleben, als Oskar “Oss” Kröher zutiefst
berührende Auszüge aus seinem neuesten Buch “Auf irren Pfaden durch
die Hungerzeit” las. Das Foyer der LaBi war schon lange vor Beginn
des Abends bis auf den letzten Platz gefüllt, so dass noch
zusätzliche Stühle aus dem ganzen Haus herbeigeschafft werden
mußten. Ute Bahrs, Leiterin der LaBi in Speyer, zeigte sich in
ihrer Begrüßung von diesem Ansturm völlig überwältigt und bekannte,
als geborene Norddeutsche im Jahr 2004 beim letzten Besuch von Oss
Kröher in ihrem Hause, noch nichts von der ungemeinen Faszination
geahnt zu haben, die von dem Liedermacher, Sänger und Literat in
der Pfalz und weit darüber hinaus ausgehe. Dass er an diesem Tag
wieder zu Gast sei, dafür dankte sie an erster Stelle dem Initiator
der Lesung, Buchhändler Patrick Boucher aus der Speyerer
Buchhandlung Fröhlich.
Das konnte
man jetzt bei dem Leseabend im Speyerer Landesbibliothekszentrum,
der “alten LaBi” erleben, als Oskar “Oss” Kröher zutiefst
berührende Auszüge aus seinem neuesten Buch “Auf irren Pfaden durch
die Hungerzeit” las. Das Foyer der LaBi war schon lange vor Beginn
des Abends bis auf den letzten Platz gefüllt, so dass noch
zusätzliche Stühle aus dem ganzen Haus herbeigeschafft werden
mußten. Ute Bahrs, Leiterin der LaBi in Speyer, zeigte sich in
ihrer Begrüßung von diesem Ansturm völlig überwältigt und bekannte,
als geborene Norddeutsche im Jahr 2004 beim letzten Besuch von Oss
Kröher in ihrem Hause, noch nichts von der ungemeinen Faszination
geahnt zu haben, die von dem Liedermacher, Sänger und Literat in
der Pfalz und weit darüber hinaus ausgehe. Dass er an diesem Tag
wieder zu Gast sei, dafür dankte sie an erster Stelle dem Initiator
der Lesung, Buchhändler Patrick Boucher aus der Speyerer
Buchhandlung Fröhlich.
Für den aktuellen Leseabend, zu dem auch
Oberbürgermeister Hansjörg Eger und sein Vorgänger Werner
Schineller gekommen waren, hatte sich Oss Kröher Episoden aus vier
Kapiteln seines neuesten Buches ausgesucht. Darin beschreibt er in
eindringlicher Weise die erste Zeit nach seiner Rückkehr aus dem
Kriege - in dem er wie seine gesamte Generation seine Jugend
verloren hatte - und seine Versuche, im Kreise seiner Familie
“wieder Boden unter die Füße” zu bekommen. Er schildert, wie er -
der zu der Ideologie des Nationalsozialismus verführte
Fähnlein-Führer in der “Hitler-Jugend” - seinen Weg zurück in den
Schulalltag fand, wie ihm dort Klassenkameraden und Lehrer
begegneten und wie er den Einmarsch der französischen
Besatzungstruppen in seine Heimatstadt erlebte. Ein Lächeln huschte
über das Gesicht so manchen älteren Zuhörers, als Oss Kröher vom
dem Widder erzählte, den zwei französische Spahi-Soldaten als
Regimentsmaskottchen vor der militärischen Formation vorneweg
führten. Und natürlich konnte es sich da der alte Musikus nicht
versagen, den französischen Parademarsch gesungen und mit den
Knöcheln getrommelt anklingen zu lassen.
.jpg) Und als er
dann in einer weiteren Episode schilderte, welches Unrecht
Jugendliche - Kinder eigentlich noch, die bei Kriegsende gerade
einmal 15 Jahre alt waren - als Gefangene in den provisorischen
Gefängnissen der Surété, des französischen Sicherheitsdienstes,
erleiden mußten, da wischte sich so manch einer der Zuhörer
verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Oss Kröher erinnerte an
das Schicksal von Günther Klein, der mit ansehen mußte, wie ein
Häftling im Gefängnis von dem Surété-Chef einfach mit den Fäusten
erschlagen wurde. “Da gab es keine Beschuldigung, keine Anklage,
keinen Prozess und kein Urteil”. Als jüngster der durch
Denunziation ins Gefängnis geratenen Jugendlichen mußte Klein am
längsten ausharren, bis er durch einen Zufall beim Einüben von
Fahrtenliedern mit seinen Mitgefangenen einem Lehrer auffiel und
durch ihn aus seiner durch nichts gerechtfertigten Haft erlöst
werden konnte.
Und als er
dann in einer weiteren Episode schilderte, welches Unrecht
Jugendliche - Kinder eigentlich noch, die bei Kriegsende gerade
einmal 15 Jahre alt waren - als Gefangene in den provisorischen
Gefängnissen der Surété, des französischen Sicherheitsdienstes,
erleiden mußten, da wischte sich so manch einer der Zuhörer
verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Oss Kröher erinnerte an
das Schicksal von Günther Klein, der mit ansehen mußte, wie ein
Häftling im Gefängnis von dem Surété-Chef einfach mit den Fäusten
erschlagen wurde. “Da gab es keine Beschuldigung, keine Anklage,
keinen Prozess und kein Urteil”. Als jüngster der durch
Denunziation ins Gefängnis geratenen Jugendlichen mußte Klein am
längsten ausharren, bis er durch einen Zufall beim Einüben von
Fahrtenliedern mit seinen Mitgefangenen einem Lehrer auffiel und
durch ihn aus seiner durch nichts gerechtfertigten Haft erlöst
werden konnte.
Ja, das Singen - die Musik - sie waren und sind das
Elixier der inzwischen fast 85jährigen Brüder, das sie bis heute
jung hält. Und so griff Oss Kröher auch an diesem Abend immer mal
wieder zur “Klampfe”, um das eine oder andere Lied aus seiner
“jugendbewegten” Zeit zum besten zu geben - passend stets zu den
rezitierten Texten.
So auch, als er über den ehemaligen Rittmeister
Gerhard L. berichtete, der ihm und seinem Zwillingsbruder den
Zugang zu einem Liedgut eröffnete, das weit entfernt war von dem
nationalen Pathos der Hitlerzeit und das auf andere menschliche
Gemütsebenen abzielte - Lieder, mit denen Hein und Oss über viele
Jahrzehnte in der ganzen Welt unterwegs waren als “Botschafter
eines anderen, eines besseren Deutschlands”.
Fast schon zum Ende dieses Leseabends schilderte
Oss Kröher dann noch eine Reise nach Speyer, wo er mit Freunden
eine Aufführung des Märchens “Rumpelstilzchen” im Alten Stadtsaal
besuchen wollte - in den ersten Jahren der Nachkriegszeit noch eine
Odysee, die an einem Tag nicht zu bewältigen war. Dort traf er mit
Siegfried und Roland Schmidt zusammen - vielen Speyerern
unvergessene Protagonisten der Speyerer “Tatgemeinschaft”, einer
Organisation der Bündischen Jugend, die über viele Jahrzehnte
hinweg ihren Sitz im alten Drachenturm hinter der Zeppelinschule
hatte. In den Schmidts fanden Hein und Oss Kröher Gleichgesinnte,
mit denen sie über ihre gemeinsamen Jahre bei den Festivals auf
Burg Waldeck im Hunsrück in den frühen sechziger Jahren eng
verbunden blieben. Kein Wunder, dass sich an diesem Abend auch
“Tatgemeinschaftler” und “alte Waldecker” in großer Zahl
eingefunden hatten - irgendwie auch so etwas wie ein
Familientreffen also...
.jpg) Und noch
eine nach dem Krieg entstandene oder - besser gesagt - wieder
entstandene Freundschaft kam zur Sprache, als Oss Kröher sich an
seinen Einstieg ins Berufsleben erinnerte: Mangels anderer
Möglichkeiten - Studieren war aus wirtschaftlichen Gründen nicht
drin und er wurde erst in späteren Jahren Lehrer - absolvierte er
nämlich zunächst eine Ausbildung zum Kaufmännischen Angestellten
und Kalkulator in einer Pirmasenser Schuhfabrik - war “der
Seniorstift mit Abitur” - ein Zustand, der so gar nichts mit seinen
eigentlichen Neigungen zu Literatur, Musik und Reisen gemein hatte.
Als dann sein alter Schulfreund Gustav Pfirrmann bei ihm auftauchte
- selbst bereits Student der Volkswirtschaftslehre mit
Auslandserfahrung - und ihm eine gemeinsame Reise nach Indien
vorschlug, da war’s bald vorbei mit der kaufmännischen “Karriere”.
Nach seiner Gehilfenprüfung brachen die beiden im Motorrad auf zu
einer abenteuerlichen Reise auf dem Motorrad von Pirmasens nach
Kalkutta. Doch das ist dann schon wieder eine andere, eine
phantastische Geschichte...
Und noch
eine nach dem Krieg entstandene oder - besser gesagt - wieder
entstandene Freundschaft kam zur Sprache, als Oss Kröher sich an
seinen Einstieg ins Berufsleben erinnerte: Mangels anderer
Möglichkeiten - Studieren war aus wirtschaftlichen Gründen nicht
drin und er wurde erst in späteren Jahren Lehrer - absolvierte er
nämlich zunächst eine Ausbildung zum Kaufmännischen Angestellten
und Kalkulator in einer Pirmasenser Schuhfabrik - war “der
Seniorstift mit Abitur” - ein Zustand, der so gar nichts mit seinen
eigentlichen Neigungen zu Literatur, Musik und Reisen gemein hatte.
Als dann sein alter Schulfreund Gustav Pfirrmann bei ihm auftauchte
- selbst bereits Student der Volkswirtschaftslehre mit
Auslandserfahrung - und ihm eine gemeinsame Reise nach Indien
vorschlug, da war’s bald vorbei mit der kaufmännischen “Karriere”.
Nach seiner Gehilfenprüfung brachen die beiden im Motorrad auf zu
einer abenteuerlichen Reise auf dem Motorrad von Pirmasens nach
Kalkutta. Doch das ist dann schon wieder eine andere, eine
phantastische Geschichte...
Ein großartiger Abend für all die Zuhörer, die sich
von Erinnerungen an gute wie an weniger gute Zeiten im Laufe der
Geschichte gefangen nehmen lassen und die um die göttliche Wirkung
der Musik und des Gesanges auf die menschliche Seele wissen - auch
wenn sich an diesem Abend so recht niemand traute, in die von Oss
Kröher mit noch immer profunder und ausdrucksstarker Stimme
vorgetragenen Lieder einzufallen. Aber vielleicht tun sich die
Menschen heute einfach nur schwerer, sich öffentlich zum Singen zu
bekennen, denn heimlich summte der eine oder andere schon mit oder
schlug zumindest mit dem Fuß den Takt.
Ein großartiger Abend, der in den Besuchern sicher
noch lange nachklingen wird. Danke, Oss Kröher, für den Besuch in
unserer Stadt, danke, dass Sie uns Ihr Herz geöffnet und uns einen
Blick in Ihr Innerstes gewährt haben. Danke, Oss Kröher! Foto:
miwa
15.02.2012
Anita Büscher - Phantastische Bilder und Bücher
 Ein für die Ausstellung entstandenes Werk "Bücher sind Türen zu Orten voller Magie"
Ein für die Ausstellung entstandenes Werk "Bücher sind Türen zu Orten voller Magie"
Die Ausstellung wird am Dienstag, den 29. November 2011 um 19
Uhr im Foyer des Landesbibliothekszentrums in Speyer
eröffnet.
Die Kunsthistorikerin Monika Portenlänger führt in die
Ausstellung und das Werk von Anita Büscher ein.
Die Kunst von Anita Büscher: Ihre Welt ist die Welt der
Bilder, der Phantasie, der Träume und Sehnsüchte, des
Geheimnisvollen, der leisen Töne, der feinen Pinselstriche. Dem
entsprechen ihre Motive: Pflanzen, Bäume, Tiere, Sonne, Mond,
Sterne – und immer wieder ihre Heimat, die Pfalz, die ihr Empfinden
stark geprägt hat. Ein schönes Gedicht, ein wunderbares Buch, sei
es von Rilke, Hesse, Kaschnitz, Eichendorff oder Mascha Kaléko,
wecken in ihr das starke Verlangen, das Gelesene und Empfundene in
ein Bild umzusetzen. Ihre Illustrationen zieren neben Büchern auch
die Cover von Schallplatten und CDs, Kunstdrucke, Geschirr,
Geschenkpapier, Künstlerpuppen, Schmuck, kleine Objekte sowie
Jahrbücher und Kalender.
Seit 1974 sind ihre Werke in fast 80 Einzelausstellungen in
Deutschland, Österreich, Holland, Frankreich und der Schweiz zu
sehen gewesen.
Anita Büscher, geboren 1940 in Ludwigshafen, aufgewachsen in
der Westpfalz und Oggersheim. Die Welt der Großeltern hat sie stark
geprägt: Naturnähe, künstlerisches Handwerk, Literatur. Von früh
auf malt sie, denkt sich Geschichten aus. Das Stipendienangebot für
ein Kunststudium der Stadt Ludwigshafen nimmt sie auf Druck der
Eltern nicht an. Stattdessen arbeitet sie in der BASF, anschließend
in Werbeabteilungen einer Kosmetikfirma sowie bei Grünzweig und
Hartmann. Sie malt aber immer weiter, verschenkt die Bilder im
Freundeskreis. 1974 erregt eines ihrer Bilder das Interesse der
Galerie Marcushof im Künstlerdorf Worpswede bei Bremen; ein Freund
hatte das ihm geschenkte Bild dorthin mitgenommen. Anita Büscher
kann dort ihre erste Ausstellung zeigen. Der Durchbruch erfolgt
1976, als sie bei der Ausstellung „Mannheim von Künstlern gesehen“
zehn ihrer Bilder zeigen darf - insgesamt sind 83 Bilder von 33
Künstlern zu sehen. Bei dieser Ausstellung lernt sie auch ihren
Mann, Klaus Büscher, kennen, der ihre künstlerische Arbeit
unterstützt und fördert. In der Folgezeit hat Anita Büscher viel
Erfolg mit Plakaten (z.B. für die Weihnachtsmärkte in Mannheim,
Heidelberg, Heilbronn) und sammelt erste Auszeichnungen für ihre
Plakatserien; u.a. „100 Jahre Automobil“ für Daimler-Benz 1986.
Ihre Werke werden auch verlegt.
1987 schreibt Anita Büscher ihr erstes Kinderbuch: „Die süßen
Geschichten“. Aufgrund der vielen Änderungswünsche des Verlags
gründen Anita und Klaus Büscher ihren eigenen Verlag „B&B“. Das
Kinderbuch wird mit 40.000 verkauften Exemplaren ein Erfolg.
Weitere Eigenproduktionen folgen, seit 2004 auch die
„Phantastischen Jahrbücher“ und „Phantastischen Kalender“. 2010
erscheint ihr erster Roman „Die Blausilberkugel“.
Für andere Verlage illustriert bzw. schreibt und illustriert Anita
Büscher ebenfalls Kinderbücher. Pressestelle
Landesbibliothekszentrum / Pfälzische Landesbibliothek,
Speyer
25.11.2011
Marianne und Germania - von der Erbfeindschaft zur unverbrüchlichen Freundschaft
 Eine
historische Reise in Karikaturen durch vier Jahrhunderte
Eine
historische Reise in Karikaturen durch vier Jahrhunderte
von Gerhard Cantzler
Wenn es richtig wäre, was das Sprichwort sagt,
nämlich dass sich neckt, was sich liebt, dann gäbe es sicher eine
ganz einfache Erklärung für die zahllosen Karikaturen, die in den
vergangenen drei, vier Jahrhunderten in Frankreich ebenso wie in
Deutschland über die Schwächen der eigenen Nation oder über den
jeweiligen Nachbarn erschienen sind: Es wäre die pure Liebe. Da
dies aber nicht uneingeschränkt für eine Beziehung gelten kann, in
der immer wieder auch von “Erbfeindschaft” die Rede war, bedarf
dies einer sorgfältigen Untersuchung, wie sie jetzt das
Landesbibliothekszentrum in Speyer aufgegriffen hat, indem es 85
ausgewählte Karikaturen zu den Jahrhunderte alten weiblichen
Symbolfiguren beider Länder, der Germania auf der deutschen und der
Marianne auf der französischen Seite in einer inhaltlich wie
künstlerisch hochrangigen Ausstellung präsentiert.
 Prof. Dr.
Ursula E. Koch, langjährige Professorin für Germanistik und
Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München und ausgewiesene Kennerin dieses ganz besonderen Genres
künstlerischer Beleuchtung aktuellen Zeitgeschehens hat diese
Ausstellung in vorzüglicher Weise kuratiert. Aus einem fast
unüberschaubaren Konvolut bedeutender Blätter aus beiden Ländern
hat sie 85 der qualitätvollsten ausgewählt und sie auf eine
“Tournee” geschickt, auf der sie zwischenzeitlich schon an 40 Orten
in Frankreich und Deutschland gezeigt wurden, auf der sie aber auch
nach Serbien und Montenegro gelangten und jetzt nach einem
“Abstecher” in die Türkei in Speyer einkehrten.
Prof. Dr.
Ursula E. Koch, langjährige Professorin für Germanistik und
Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München und ausgewiesene Kennerin dieses ganz besonderen Genres
künstlerischer Beleuchtung aktuellen Zeitgeschehens hat diese
Ausstellung in vorzüglicher Weise kuratiert. Aus einem fast
unüberschaubaren Konvolut bedeutender Blätter aus beiden Ländern
hat sie 85 der qualitätvollsten ausgewählt und sie auf eine
“Tournee” geschickt, auf der sie zwischenzeitlich schon an 40 Orten
in Frankreich und Deutschland gezeigt wurden, auf der sie aber auch
nach Serbien und Montenegro gelangten und jetzt nach einem
“Abstecher” in die Türkei in Speyer einkehrten.
Große Namen der Zeichenkunst wie Honoré Daumier,
André Gil, Albert Uderzo oder der große Elsässer Tomi Ungerer auf
der französischen, Olaf Gulbransson, Werner Hahmann oder Ernst
Maria Lang auf der deutschen Seite sind nur einige der bedeutenden
Autoren, in deren Karikaturen die großen nationalen Symbolfiguren
immer wieder eine Rolle spielten. Mehr aber fast noch gilt dies für
die vielen namenlosen Verfasser von herausragenden Blättern in
dieser Ausstellung - namenlos deshalb, weil die Karikatur stets als
journalistisches Stilmittel galt, als Überhöhung eines gut
geschriebenen Textes.
In ihrer Einführung in die Ausstellung ließ Prof.
Dr. Koch Entstehungsgeschichte der Symbolfiguren Germania und
Marianne Revue passieren, die im Fall der Germania bis in die Zeit
der römischen Kaiserzeit zurückreicht. Mit ihren Attributen Krone,
Reichsapfel, Szepter, aber auch Schild und Schwert und - seit
Richard Wagner - auch noch mit dem Wikingerhelm, wirkt sie eher
erstarrt und unbeweglich, vielleicht bewusst auch majestätisch,
während die dem südfranzösischen Kulturkreis in der Zeit der
Französischen Revolution entstammende Marianne mit Freiheitsmütze
und aufspringendem Rock - zuletzt durch Brigitte Bardot dargestellt
- eher den Typus des lebenslustigen “Vollweibs” verkörperte.
Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges waren diese
Gegensätze auch in den Karikaturen präsent, mal freundlicher, mal
grimmiger. Erst nach diesem verheerenden Ereignis, in dem die
Nazi-Diktatur auch der Kunst der stets systemkritischen Karikatur
nahezu in ganz Europa ein Ende machte, setzte sich auch in den
Karikaturen die Idee der Freundschaft zwischen Deutschen und
Franzosen durch und löste so die von Generation zu Generation
wechselseitig weitergegebene Verblendung über die Erbfeindschaft
ab.
 Eine
sehenswerte Ausstellung, in der einem so vieles auf höchstem Niveau
begegnet: Feinste zeichnerische Kunstfertigkeit, köstlicher Humor,
ätzende Satire, Schlagfertigkeit und durchaus auch freche Antworten
auf zu ihrer Zeit aktuelle Fragen.
Eine
sehenswerte Ausstellung, in der einem so vieles auf höchstem Niveau
begegnet: Feinste zeichnerische Kunstfertigkeit, köstlicher Humor,
ätzende Satire, Schlagfertigkeit und durchaus auch freche Antworten
auf zu ihrer Zeit aktuelle Fragen.
Zu der Ausstellung in der Speyerer Bibliothek ist
ein hervorragend gemachter kleiner Katalog erschienen, der die
Geschichte der Karikatur zwischen Deutschen und Franzosen
vorzüglich erhellt und dabei dem Betrachter die Mühe abnimmt, unter
der Masse der noch immer in Archiven und Bibliotheken ruhenden
Blättern die für die jeweilige Epoche kennzeichnenden selbst
auszusuchen. Das hat für ihn in dankenswerter Weise die Kuratorin
Ursula E. Koch besorgt.
Vor der Einführung in die Ausstellung hatten Prof.
Dr. Helmut Frühauf, Direktor des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz, Oberbürgermeister Hansjörg Eger und der Direktor
der Landeszentrale für Politische Bildung, Dr. Dieter Schiffmann,
aus ihrem jeweiligen Blickwinkel die Bedeutung dieser Ausstellung
gewürdigt, die gerade in Speyer, im Grenzgebiet zu Frankreich,
einen historisch ganz besonderen Stellenwert einnehme.
Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnungsfeier vom
Duo Mariance, zwei jungen Musikerinnen der Staatsphilharmonie
Rheinland-Pfalz - Cristelle Maria Hofmann, Flöte und Beate Maria
Anton, Harfe - die dem spitzen und hintergründigen Stift der
Karikaturisten die einfühlsam-feine Sprache der Musik kongenial zur
Seite stellten.
Ein Abend, der den erfreulich vielen Gästen der
Soirée sicher noch lange in bester Erinnerung bleiben wird und
schon jetzt Vorfreude keimen läßt auf Ähnliches zu anderen Themen.
Foto: sim
07.09.2011
"Allianz Schriftliches Kulturgut Erhalten"
fördert Buchrestaurierungen im Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz
Im Jahr 2001 begründeten elf deutsche Archive und Bibliotheken
mit umfangreichen historischen Beständen die ‚Allianz Schriftliches
Kulturgut Erhalten’. Die Allianz will „die in ihrer Existenz
gefährdeten Originale der reichen kulturellen und
wissenschaftlichen Überlieferung in Deutschland sichern und diese
Überlieferung als nationale Aufgabe im öffentlichen Bewusstsein
verankern“. In Erinnerung an den Brand der Herzogin Anna Amalia
Bibliothek Weimar am 2. September 2004 veranstaltet die Allianz an
wechselnden Ausrichtungsorten nationale Aktionstage, die für diese
Aufgabe werben.
2010 wurde eine Koordinierungsstelle bei der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz eingerichtet, die Modellprojekte
initiiert, betreut und evaluiert sowie ein nationales
Bestandserhaltungskonzept erarbeitet. In einem ersten Schritt
wurden aus Bundesmitteln 500.000 Euro und zusätzlich aus
Landesmitteln 100.000 Euro zur Verfügung gestellt, die in erster
Linie kleineren Einrichtungen zugute kommen sollten. Das
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz bewarb sich um eine
Förderung und erhielt die Zusage über zusammen 17.200 Euro für die
Restaurierung gefährdeter Buchbestände.
Aus dem Besitz der Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken konnten
fünf Foliobände des 16. Jahrhunderts restauriert werden. Angesichts
der vielen wertvollen Einbände dieses Hauses wurden weiter für
3.000 Euro maßgefertigte Kassetten aus säurefreier Spezialpappe für
besonders wertvolle Exemplare in Auftrag gegeben. Die Rheinische
Landesbibliothek in Koblenz konnte vier Bände des 16. und 17.
Jahrhunderts restaurieren lassen, darunter die 1562 bei Bellerus
erschienene Ausgabe der „Historia de gentibus septentrionalibus“
des schwedischen Geistlichen, Geographen und Kartographen Olaus
Magnus mit kolorierten Holzschnitten. Mit der Schedelschen
Weltchronik wurde ein herausragendes Objekt der Pfälzischen
Landesbibliothek wiederhergestellt. Die restaurierten Bände dieser
drei Standorte des Landesbibliothekszentrums wiesen vorher zum
großen Teil massive Einbandschäden, in geringerem Maße Mängel am
Buchblock auf. Teilweise waren einzelne Bände aus konservatorischen
Gründen seit längerem für die Benutzung gesperrt. Ohne die Mittel
der Allianz wäre eine Restaurierung dieser wertvollen Bestände auf
absehbare Zeit nicht möglich gewesen. Das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz wird sich auch künftig um die Einwerbung von
Bundes- und Ländermitteln für die Sicherung seiner wertvollen
Altbestände bemühen.
Bei der auf den Nürnberger Stadtarzt Hartmann Schedel
zurückgehenden Weltchronik, die 1493 in einer deutschen und in
einer lateinischen Fassung bei dem renommierten Drucker Anton
Koberger erschien, handelt es sich um das ambitionierteste
Buchprojekt der Inkunabelzeit. Das heilsgeschichtlich ausgerichtete
Werk beginnt mit der Schöpfung und endet mit dem jüngsten Gericht.
In der Tradition mittelalterlicher Weltchronistik gliedert sich das
Werk in sieben Weltalter. Historische Nachrichten finden sich im
sechsten Weltalter, das zwei Drittel des Buches ausmacht. Über
1.800 Holzschnitte illustrieren die Weltchronik. In der Werkstatt,
die die Holzschnitte hergestellt hat, wurde Albrecht Dürer
ausgebildet. Das Exemplar der Schedelschen Weltchronik im
Landesbibliothekszentrum stammt aus der Bibliothek der Franziskaner
im badischen Heitersheim und wurde dann vom Historischen Verein der
Pfalz erworben. Der Band zeigte deutliche Benutzungsspuren mit
vielen Rissen und Knickfalten, die im Zuge der Restaurierung neben
einer Trockenreinigung geschlossen beziehungsweise geglättet
wurden. Ute Bahrs, Standortleitung, Pfälzische
Landesbibliothek
07.06.2011
 Ansicht aus der Schedelschen Weltchronik, die die Stadt Straßburg um 1490 zeigt (Foto: Ralf Niemeyer).
Ansicht aus der Schedelschen Weltchronik, die die Stadt Straßburg um 1490 zeigt (Foto: Ralf Niemeyer).
Die Reichskanzler der Weimarer Republik. Zwölf Lebensläufe in Bildern - Ausstellung vom 9. Juni - 27. August 2011
Die Ausstellung wird am Mittwoch, dem 8. Juni 2011 um 19 Uhr
im Foyer des Landesbibliothekszentrums eröffnet. In Zusammenarbeit
mit der Hambach-Gesellschaft für historische Forschung und
politische Bildung e.V. präsentiert das Landesbibliothekszentrum
eine Wanderausstellung der Stiftung
Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte, Heidelberg.
Zwischen der Eröffnung der Nationalversammlung in Weimar am 6.
Februar 1919 und der Machtergreifung Hitlers am 30. Januar 1933
haben zwölf Reichskanzler die Weimarer Republik regiert. Aufgrund
ihrer kurzen Kanzlerschaften sind sie heute weitgehend in
Vergessenheit geraten. Dabei sagt die Kürze oder Länge einer
Amtszeit grundsätzlich nichts über die Qualität des Amtsinhabers
aus. Die vielen Kanzlerwechsel der ersten deutschen Demokratie
resultierten aus der äußerst schwierigen außen- und
innenpolitischen Lage Deutschlands nach 1918. Die erdrückenden
wirtschaftlichen, sozialen und mentalen Folgelasten des verlorenen
Ersten Weltkrieges machten letztlich den Aufbau einer stabilen
Demokratie unmöglich. Kein Kanzler konnte deshalb erwarten, sich im
Buch der Geschichte mit einem Ruhmesblatt verewigen zu
können.
Ziel der Ausstellung soll es sein, diese zwölf Männer wieder im
kollektiven Gedächtnis der Nation zu verankern. Sie will den
vergessenen Kanzlern Gesicht und Stimme zurückgeben. Sie erhebt
bewusst nicht den Anspruch, eine umfassende Darstellung der
Geschichte der Weimarer Republik zu liefern. Sie konzentriert sich
auch nicht auf die jeweils sehr kurzen Kanzlerschaften, sondern
präsentiert die Gesamtbiographien von Philipp Scheidemann, Gustav
Bauer, Hermann Müller, Constantin Fehrenbach, Joseph Wirth, Wilhelm
Cuno, Gustav Stresemann, Wilhelm Marx, Hans Luther, Heinrich
Brüning, Franz von Papen und Kurt von Schleicher. Da Erinnerung und
Erinnerungskultur in unserem visuellen Zeitalter hauptsächlich mit
optischen Eindrücken verbunden sind, wirkt die Ausstellung in
erster Linie über die Fotografien. Dabei wurde besonders auf die
Qualität der historischen Vorlagen und deren Wiedergabe geachtet.
Zahlreiche Fotos, die aus dem Besitz von Kindern und Nachfahren der
Reichskanzler stammen, sind zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu
sehen. Über 750 Fotos von rund 65 Leihgebern aus Deutschland,
Österreich, Dänemark, Schweden, der Schweiz und den Niederlanden
zeigen die Gemeinsamkeiten, aber auch die gravierenden Unterschiede
in den Lebensläufen dieser zwölf Kanzler auf. Sie spiegeln Höhen
und Tiefen der deutschen Geschichte vom Kaiserreich bis in die
Bundesrepublik Deutschland wider.
Dr. Bernd Braun, Jg. 1963, Studium der Mittleren und
Neueren Geschichte, der Germanistik und Politikwissenschaft, seit
1990 Museumspädagoge, seit 1999 Wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Stiftung Reichspräsident-Friedrich-Ebert-Gedenkstätte in
Heidelberg, Lehrbeauftragter an der Universität Heidelberg, Kurator
der Reichskanzler-Ausstellung.
Die Hambach-Gesellschaft für historische Forschung und
politische Bildung e.V. wurde vor 25 Jahren von engagierten und
interessierten Unterstützern der 150-Jahr-Feier des Hambacher
Festes von 1832 gegründet – Privatpersonen wie auch Institutionen.
Ihr Ziel ist es, an das Hambacher Fest und seine Ziele zu erinnern:
Die europäische Einigung, eine dauerhafte Friedenssicherung und
eine gerechte Sozialordnung sind nicht die Ergebnisse eines
abgeschlossenen historischen Prozesses, sondern müssen erinnert,
gelebt und immer wieder von Neuem erkämpft werden. Am 8. Juni 1986
fand das erste Treffen statt, am 2. November im selben Jahr wurde
die Gründungsurkunde der Hambach-Gesellschaft unterzeichnet.
Ute Bahrs, Pfälzische Landesbibliothek
27.05.2011
 Fotocollage der zwölf Reichskanzler (von links nach rechts: Scheidemann, Bauer, Müller, Fehrenbach, Wirth, Cuno, Stresemann,Marx, Luther, Brüning, von Papen, von Schleicher)
Fotocollage der zwölf Reichskanzler (von links nach rechts: Scheidemann, Bauer, Müller, Fehrenbach, Wirth, Cuno, Stresemann,Marx, Luther, Brüning, von Papen, von Schleicher)
"Vom Ziegenleder zur Krötenhaut - Die unbegrenzten Möglichkeiten des Buchbinders"
Zur aktuellen Ausstellung im Landesbibliothekszentrum in Speyer
ist eine Broschüre erschienen, in deren Mittelpunkt die wichtigsten
Exponate stehen: 22 meisterhafte Einbände der britischen
Buchbinderin Jeanette Koch sind dort in Farbe abgebildet und
beschrieben. Die Broschüre kostet 5 Euro und ist an der
Ausleihtheke der Landesbibliothek erhältlich. Die Drucklegung war
dank der freundlichen Unterstützung der Stiftung der Kreis- und
Stadtsparkasse Speyer möglich.
Die Ausstellung ist - entgegen der ursprünglichen Ankündigung -
noch bis zum 17. Juni 2011 zu sehen. Als offizielles
Ausstellungsende wird Jeanette Koch am Freitag, dem 17. Juni noch
einmal von 15-17 Uhr durch ihre Ausstellung führen.
Landesbibliothekszentrum / Pfälzische Landesbibliothek
Otto-Mayer-Str. 9, 67346 Speyer
Tel.: 06232 9006 - 224, E-Mail: info.plb@lbz-rlp.de
Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr
23.05.2011
LBZ Speyer präsentiert Albert-Schweitzer-Autographen
 Mit berechtigtem Stolz konnte
jetzt die Leitung des Landesbibliothekszentrums eine neue
Kostbarkeit ihrer Autographen-Sammlung präsentieren: Es handelt
sich dabei um 29 eigenhändige Briefe des legendären
Friedensnobelpreisträgers und Universalgelehrten Dr. Albert
Schweitzer, die das LBZ mit Unterstützung der Kulturstiftung
Speyer und der Sparkassenstiftung Speyer, des Rotary-Clubs Speyer
sowie zweier spontaner Privatspender bei einer Auktion in Berlin
ersteigern konnte. (Der SPEYER-KURIER berichtete)
Mit berechtigtem Stolz konnte
jetzt die Leitung des Landesbibliothekszentrums eine neue
Kostbarkeit ihrer Autographen-Sammlung präsentieren: Es handelt
sich dabei um 29 eigenhändige Briefe des legendären
Friedensnobelpreisträgers und Universalgelehrten Dr. Albert
Schweitzer, die das LBZ mit Unterstützung der Kulturstiftung
Speyer und der Sparkassenstiftung Speyer, des Rotary-Clubs Speyer
sowie zweier spontaner Privatspender bei einer Auktion in Berlin
ersteigern konnte. (Der SPEYER-KURIER berichtete)
Die besondere Bedeutung dieses Konvoluts liegt in dem
unmittelbaren Bezug der Briefe zu Speyer, sind sie doch allesamt an
den früheren Stadtpfarrer Dr. Emil Lind gerichtet, der zunächst in
Straßburg Schüler und danach lebenslanger Freund des Urwaldarztes
war.
Und nachdem ein großer Teil der Briefe von Emil Lind, an den
sich noch so manch wirklich älterer Speyerer mit Respekt erinnert,
ebenfalls im LBZ verwahrt wird, kann nun gemeinsam mit den
Albert-Schweitzer-Briefen die tiefe geistige Freundschaft des
Urwalddoktors aus Lambarene mit dem Speyerer Theologen erschlossen
werden.
Beim einem Pressegespräch würdigte Leitender Bibliotheksdirektor
Dr. Helmut Frühauf die außergewöhnliche Sammlung, die aus Briefen
Schweitzers aus den Jahren 1928 bis 1936 und 1946 bis 1965, dem
Todesjahr des Friedensaktivisten besteht und zu der
auch Fotografien von Ausflügen der von Pfarrer Dr. Lind zur
Unterstützung der Arbeit von Schweitzer gegründeten
Albert-Schweitzer-Kameradschaft in die elsässische Heimat des
großen Humanisten gehören.
Dr. Frühauf skizzierte das reiche Leben Schweizers, der nach dem
Studium der Theologie in Straßburg ein paralleles Orgelstudium in
Paris absolvierte und dort zu einer Neubewertung des Orgelwerks von
Johann Sebastian Bach beitrug.Seine großen Fähigkeiten als Organist
und insbesondere als Bach-Interpret führten ihn auch auf viele
Orgeln in der Pfalz, unter anderem auch bis kurz vor seinem Tod
nach Speyer, wo er - unerkannt - auf der Orgel der
Heiliggeistkirche musizierte.
Nach seiner Rückkehr nach Straßburg, wohin er als Dozent für
Theologie berufen worden war, begann er mit dem Studium der
Medizin, um als Missionsarzt tätig werden zu können. In dieser Zeit
lernet er Emil Lind kennen, der seinerseits zum Studium der
Theologie in der Münsterstadt an der Ill gekommen war.
Dr. Frühaufs Dank galt den Vertretern der Sponsoren, Uwe Wöhlert
für die Kulturstiftung und Kirchenpräsident i.R. Eberhard Cherdron
für den Rotary-Club. Er dankte aber auch Oberkirchenrat a.D. Klaus
Bümlein, der im Rahmen seiner Forschungsarbeiten auf das Konvolut
aufmerksam geworden und das LBZ auf die Spur dieser Sammlung
gesetzt hätte.
In seiner Präsentation wies der Leiter der
Handschriftenabteilung der Bibliothek, Dr. Armin Schlechter, auf
das überaus enge Verhältnis Schweitzers zu dem Speyerer Theologen
hin. So nannte er als Beispiel die Reaktion Schweitzers auf die
Absicht Dr. Linds, eine Biographie über den über eine lange Epoche
hinweg als Vorbild ganzer Generationen gültigen Humanisten zu
verfassen. In einem der Briefe untersagte er Lind, sich in
Superlativen über ihn zu ergehen und drohte ihm - freundschaftlich
- für jeden Superlativ “einen guten Humpen Pfälzer Bier” von ihm
abzuverlangen. An gleicher Stelle forderte er den Freund - nun
wieder ganz ernsthaft - auf, “ja das Wort ‘Hitler’ nicht vorkommen
zu
lassen”.
In den Briefen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg gibt sich
Albert Schweitzer als Gegner einer atomaren Bewaffnung zu
erkennen und berichtet über seine entsprechenden Korrespondenzen
unter anderem mit Albert Einstein. Die Briefe aus dieser Zeit
müssen allerdings noch weitergehend erschlossen werden, da sie auf
Luftpostpapier geschrieben waren und von den Vorbesitzern gelocht
verwahrt wurden.
Dr. Bümlein gab zunächst seiner großen Freude Ausdruck, dass es
gelungen sei, die Briefe für die Speyerer Sammlung zu sichern: “Es
w ar dies im besten Sinne ein konzertierte Aktion zwischen
öffentlichen Geldgebern und privaten Spendern”.
Dass es dabei gelungen ist, das Konvolut auch noch für einen
mehr als akzeptablen Preis zu erstehen, war sicher mehr als nur ein
glücklicher Zufall. Denn nachdem kurz zuvor eine andere Sammlung
mit 1400 Briefen Schweitzers, die in keinem Zusammenhang mit Speyer
standen, für 75.00 EURO zugeschlagen wurden - angesetzt waren diese
mit 80.000 EURO, hatte das Marktinteresse an
Albert-Schweitzer-Autographen nachgelassen, so dass die 29
“Speyerer” Briefe für überaus akzeptable 4.000 EURO (netto) an den
Rhein kamen.
Durchaus ein Schnäppchen, das nach einer gründlichen Revision
und konservatorischer Bearbeitung in einigen Monaten der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden wird. Gerhard
Cantzler, Alle Fotos: sim
18.05.2011
Vom Ziegenleder zur Krötenhaut - die unbegrenzten Möglichkeiten des Buchbinders
Vom 5. Mai - 11. Juni 2011 stehen Einbandexponate der
britischen Buchbinderin Jeanette Koch im Mittelpunkt dieser
Ausstellung.
Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, wie der Untertitel
verrät. Die Einbände orientieren sich in der thematischen
Ausführung am Inhalt des jeweiligen Buches. Wertvolle Materialien
wie Samt, Perlen, Gold und Seide kommen neben verschiedensten
eingefärbten Lederarten – z.B. Ziege, Kalb und Straußenvogel – wie
auch Pergament und Leinen zum Einsatz. Eher ungewöhnliche
Einbandmaterialien wie Hühnerkrallen-, Lachs- und Krötenhaut,
Eichenblätter, Baumrinde, Holz(stangen) werden von Jeanette Koch
ebenso verwendet. Sie versieht buchhandelsübliche Exemplare mit
ausgefallenen Einbänden, stellt aber auch ganz eigene Bücher her,
wie z.B. sternförmige Exponate in der Ausstellung beweisen. Mit
Auszügen aus alten Londoner Stadtplänen, Collagen, Kontaktabzügen,
Blindprägung oder Lederstaub vollendet Jeanette Koch die weitere
Einbandgestaltung.
Die Ausstellung gewährt außerdem Einblick in die Arbeitswelt der
Buchbinder: ihre Werkzeuge, ihre Materialien, die Arbeitsschritte.
Einige Vitrinen befassen sich mit dem literarischen Werk von Arno
Reinfrank, dem verstorbenen Ehemann von Jeanette Koch.
Die Ausstellung wird am 4. Mai 2011 um 19 Uhr im Foyer des
Landesbibliothekszentrums in Speyer eröffnet.
Jeanette Koch studierte Französisch und Kunst an der Nottingham
University (1965-1969) und schloss ihr Bachelorstudium mit
Auszeichnung ab. Sie arbeitete zehn Jahre im administrativen
Bereich bei verschiedenen Kunsteinrichtungen und Galerien.
Anschließend war sie bis 1992 Mitbetreiberin einer Fotosatz- und
Theaterprogramm-Druckerei in Covent Garden.
Seit 1992 widmet sich Jeanette Koch der Buchbinderei. Sie gehört
zum Vorstand von ‚Designer Bookbinders’ und ist Mitherausgeberin
der jährlich erscheinenden Zeitschrift ‚The New Bookbinder’. Sie
war oft unter den Preisträgern der jährlich stattfindenden
Wettbewerbe von ‚Designer Bookbinders’ vertreten; u.a. erhielt
Jeanette Koch 1997 die Silbermedaille. Z. Zt. bereitet sie sich auf
die ‚Fellowship’ Prüfung bei ‚Designer Bookbinders’ vor; ihre
Mentoren sind Flora Ginn und Glenn Bartley.
Kochs Arbeiten befinden sich in Privatsammlungen in England,
Amerika und Deutschland sowie in der ‘Alec Taylor Collection’ in
der British Library, London.
Jeanette Koch lebte über 10 Jahre mit dem deutschen Autor und
Dichter Arno Reinfrank zusammen. Nach seinem frühen Krebstod 2001
verschrieb sie sich drei Jahre lang der Aufarbeitung und Erfassung
des literarischen Nachlasses ihres Mannes. Sie übergab den Nachlass
2003 der Pfälzischen Landesbibliothek in Speyer. Ihm zu Ehren
stiftete Jeanette Koch zwei Preise: 2006 den
‘Arno-Reinfrank-Literatur-Preis’ der zusammen mit der Stadt Speyer
ausgeschrieben und alle drei Jahre vergeben wird. Der
‘Arno-Reinfrank-Jugend-Preis’ wird seit 2007 alle zwei Jahre in
Ludwigshafen verliehen, der Stadt, in der Arno Reinfrank
aufwuchs.
Zur Ausstellung erscheint auch eine kleine Broschüre, die dank der
freundlichen Unterstützung der Sparkassenstiftung der Kreis- und
Stadtsparkasse Speyer aufgelegt werden kann. Sie wird zu
Ausstellungsbeginn zum Preis von 5 Euro im Landesbibliothekszentrum
erhältlich sein.
Das Foto zeigt einen Einband, den Jeanette Koch für eine
Ausgabe von "Cyrano de Bergerac" (Autor: Edmond Rostand) gestaltet
hat. Der Einband besteht aus rot gefärbtem Ziegenleder und wurde
mit grauer Hühnerkrallenhaut bezogen (Foto: Sussie
Ahlburg).
Landesbibliothekszentrum / Pfälzische Landesbibliothek
Otto-Mayer-Str. 9, 67346 Speyer
Tel.: 06232 9006 - 224, E-Mail: info.plb@lbz-rlp.de
Montag bis Freitag 9-18 Uhr, Samstag 9-12 Uhr
27.04.2011
LBZ ersteigert Briefe Albert Schweitzers
 Fotorechte: Dick de Haas
Fotorechte: Dick de Haas
Am 19. April versteigerte das renommierte, auf
Autographen spezialisierte Berliner Auktionshaus Stargardt in
Berlin ein Konvolut von Albert-Schweitzer-Briefen an seinen
Biographen, den in Speyer wirkenden Theologen Emil Lind, einer
seiner "ältesten und liebsten Freunde" (Albert Schweitzer in einem
Brief an Lind vom 17. Februar 1964). Das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz erhielt dafür den Zuschlag, worüber sich der
Direktor des Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, Dr. Helmut
Frühauf, hocherfreut zeigt.
Lind hatte von 1909 bis 1913 Theologie studiert, u.a. bei
Schweitzer in Straßburg. Die Briefe geben einen Einblick in
Schweitzers Tätigkeit als Arzt in Afrika und lassen die Entstehung
von Linds biographischen Werken über Schweitzer miterleben.
Das Konvolut umfasst 29 eigenhändige Briefe Schweitzers aus
Königsfeld, Günsbach und Lambaréné (Gabun). Sie entstanden in der
Zeit vom 9.9.1928 bis 9.2.1936 und vom 27.5.1946 bis 19.7.1965.
Albert Schweitzer starb am 4. September 1965 in Lambaréné. Weiter
wurden zahlreiche Beilagen mit erworben, darunter Schreiben von
Personen aus dem Umkreis Schweitzers sowie Fotografien.
Über Albert Schweitzer und Emil Lind:
Der spätere Friedensnobelpreisträger Albert Schweitzer war
evangelischer Theologe, Philosoph, Organist und Arzt. Er wurde am
14. Januar 1875 im Oberelsass, in der Nähe von Colmar, geboren und
starb am 4. September 1965 in dem von ihm begründeten
Urwaldkrankenhaus in Lambaréné in Gabun. Nach seinem Abitur
studierte Schweitzer ab 1893 an der Universität Straßburg Theologie
und Philosophie sowie bei Charles Marie Widor in Paris Orgel. 1899
promovierte er im Fach Philosophie, 1901 im Fach Theologie. 1902
habilitierte er sich an der Universität Straßburg in Evangelischer
Theologie. Neben seiner Tätigkeit als Dozent an der Universität
Straßburg studierte er von 1905 bis 1913 Medizin mit dem Ziel in
Afrika Missionsarzt zu werden. Seine Approbation als Arzt erhielt
er 1912 und heiratete die Krankenschwester Helene Bresslau
(1879-1957), die Tochter des renommierten Historikers Harry
Bresslau. Im selben Jahr wurde ihm aufgrund seiner
anerkennenswerten wissenschaftlichen Leistungen der
Professorentitel verliehen. Ehrfurcht vor dem Leben prägte sein
Denken, Schreiben und Handeln. Für sein humanitäres und
pazifistisches Engagement wurde Albert Schweitzer mehrfach
ausgezeichnet. 1953 wurde ihm rückwirkend für 1952 der
Friedensnobelpreis verliehen.
Emil Lind wurde am 22. Mai 1890 im pfälzischen Schwegenheim
geboren und starb am 15. Dezember 1966 in Speyer. Er studierte von
1909 bis 1913 Theologie und Philosophie in Heidelberg, Halle,
Straßburg und Utrecht. Nach seelsorgerischen Tätigkeiten in
Lambrecht, Lauterecken und Neustadt übernahm er 1925 eine Pfarrei
in Speyer. Von 1930 bis 1936 gab Emil Lind die Zeitschrift „Der
Speyerer Protestant“ heraus. Im Zentrum seiner wissenschaftlichen
Arbeiten standen Theologie, Philosophie, Kirchen- und
Zeitgeschichte. Er befasste sich auch mit der pfälzischen Volks-
und Heimatkunde. 1946 ging er in den Ruhestand und gab zwischen
1948 und 1964 mehrere biographische Arbeiten über seinen Lehrer und
Freund Albert Schweitzer heraus: u.a. „Albert Schweitzer. Aus
seinem Leben und Werk“ (Bern 1948; Neue Textfassung Wiesbaden 1955)
und „Die Universalmenschen Goethe und Schweitzer“ (1964). Der
Nachlass mit den historischen und kulturgeschichtlichen Arbeiten
von Emil Lind befindet sich in der Pfälzischen Landesbibliothek in
Speyer. Er enthält auch Korrespondenzen, darunter bereits Briefe
von Albert Schweitzer. Der kirchliche Teil seines Nachlasses
befindet sich im Besitz des Zentralarchivs der Evangelischen Kirche
der Pfalz in Speyer. Emil Lind gilt als einer der profiliertesten
Pfarrer in der Pfalz im 20. Jahrhundert, und sein Nachlass erfreut
sich reger Nutzung.
An der Finanzierung beteiligen sich neben dem
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz die Stiftung der Kreis-
und Stadtsparkasse Speyer, die Kulturstiftung der Stadt Speyer und
der Rotary Club Speyer. Spenden von privater Seite sind ebenfalls
in Aussicht gestellt.
Besonderen Dank gebührt Dr. Klaus Bümlein, Oberkirchenrat
im Ruhestand, der auf die Versteigerung des Konvoluts
aufmerksam machte und sich darum bemühte, die Sammlung nach Speyer
zu holen. Auf sein Engagement sind die Spendenangebote des Rotary
Clubs und von privater Seite zurück zu führen. Zu danken ist auch
der Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz, die das
Landesbibliothekszentrum bei der Stargardt-Auktion vertreten
hat.
Mitte Mai 2011 wird das erworbene Konvolut in Speyer
vorgestellt. Der SPEYER-Kurier wird auch hierüber berichten.
Textquelle: LBZ Rheinland-Pfalz
21.04.2011






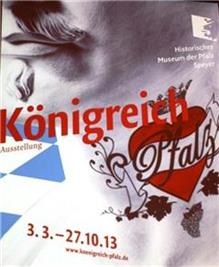



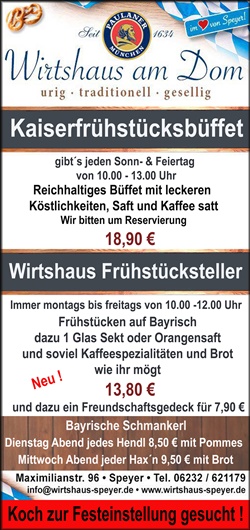
.jpg)



.png)



 Mitgliederversammlung
des dbv-LV am 12.10.2015 in Schifferstadt - Mitglieder heißen
Flüchtlinge in Bibliotheken willkommen
Mitgliederversammlung
des dbv-LV am 12.10.2015 in Schifferstadt - Mitglieder heißen
Flüchtlinge in Bibliotheken willkommen Gute
Nachricht zum 90. Geburtstag von Erika Köth - Ihr künstlerischer
Nachlass bleibt dauerhaft im LBZ Speyer.
Gute
Nachricht zum 90. Geburtstag von Erika Köth - Ihr künstlerischer
Nachlass bleibt dauerhaft im LBZ Speyer. Anlässlich des runden Geburtstages von Erika Köth
präsentiert das LBZ / Pfälzische Landesbibliothek in Speyer deshalb
jetzt eine kleine Vitrinenausstellung im 1. OG im Bereich des
Zeitschriften-Lesesaals.
Anlässlich des runden Geburtstages von Erika Köth
präsentiert das LBZ / Pfälzische Landesbibliothek in Speyer deshalb
jetzt eine kleine Vitrinenausstellung im 1. OG im Bereich des
Zeitschriften-Lesesaals. Speyer und das LBZ erinnern an seinem 65. Geburtstag mit
einer Ausstellung an großen Inspirator seiner Kunst- und
Kulturszene
Speyer und das LBZ erinnern an seinem 65. Geburtstag mit
einer Ausstellung an großen Inspirator seiner Kunst- und
Kulturszene konnte. Jetzt blieb ihnen allen nur noch, dem vielseitig
gebildeten Freund und hochgeschätzten Kenner der pfälzischen
Kunstszene und ihrer Vertreter im Rahmen der Eröffnung einer
dankenswerterweise von der Leiterin des Standortes Speyer des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz LBZ, Ute
Bahrs, initiierten Ausstellung zu gedenken, in der noch
bis zum 5. Juni eine Auswahl aus den 244 im Online-Katalog des
Hauses vermerkten Publikationen Jöckles sowie je ein Plakat pro
Jahr seiner mit fast 100 Ausstellungen höchst produktiven Amtszeit
als Leiter der Speyerer Städtischen Galerie gezeigt werden.
Emotionaler Höhepunkt der Schau ganz sicher aber der „leere
Arbeitsplatz“ Jöckles, den man praktischerweise aus dem Lesesaal –
fast so etwas wie der „zweiten Wohnung“ des Kunsthistorikers - in
die doch weitaus stärker frequentierte Ausleihe verlegt hat.
konnte. Jetzt blieb ihnen allen nur noch, dem vielseitig
gebildeten Freund und hochgeschätzten Kenner der pfälzischen
Kunstszene und ihrer Vertreter im Rahmen der Eröffnung einer
dankenswerterweise von der Leiterin des Standortes Speyer des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz LBZ, Ute
Bahrs, initiierten Ausstellung zu gedenken, in der noch
bis zum 5. Juni eine Auswahl aus den 244 im Online-Katalog des
Hauses vermerkten Publikationen Jöckles sowie je ein Plakat pro
Jahr seiner mit fast 100 Ausstellungen höchst produktiven Amtszeit
als Leiter der Speyerer Städtischen Galerie gezeigt werden.
Emotionaler Höhepunkt der Schau ganz sicher aber der „leere
Arbeitsplatz“ Jöckles, den man praktischerweise aus dem Lesesaal –
fast so etwas wie der „zweiten Wohnung“ des Kunsthistorikers - in
die doch weitaus stärker frequentierte Ausleihe verlegt hat. Wieviel Freundschaft der exzellente Kenner seiner Materie
in Speyer und weit darüber hinaus genoß, zeigte sich gestern abend
nicht zuletzt an der großen Zahl der Gäste, die der Einladung des
LBZ zu der Eröffnung gefolgt waren, an ihrer Spitze Speyers
Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Kulturbürgermeisterin
Monika Kabs und Domkapitular Peter Schappert. Wie Ute
Bahrs weiter unterstrich, habe sich die hohe Wertschätzung Jöckles
aber auch darin abgebildet, dass sich, wie bei kaum einer
vergleichbaren Gelegenheit zuvor, Menschen von der Einladung zu
dieser so ganz besonderen Geburtstagsfeier so sehr angerührt
fühlten, dass sie - soweit sie nicht selbst daran teilnehmen
konnten - sich doch zumindest ausdrücklich für ihr Fernbleiben
entschuldigt und ihr Bedauern über ihr Fehlen zum Ausdruck gebracht
hätten.
Wieviel Freundschaft der exzellente Kenner seiner Materie
in Speyer und weit darüber hinaus genoß, zeigte sich gestern abend
nicht zuletzt an der großen Zahl der Gäste, die der Einladung des
LBZ zu der Eröffnung gefolgt waren, an ihrer Spitze Speyers
Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Kulturbürgermeisterin
Monika Kabs und Domkapitular Peter Schappert. Wie Ute
Bahrs weiter unterstrich, habe sich die hohe Wertschätzung Jöckles
aber auch darin abgebildet, dass sich, wie bei kaum einer
vergleichbaren Gelegenheit zuvor, Menschen von der Einladung zu
dieser so ganz besonderen Geburtstagsfeier so sehr angerührt
fühlten, dass sie - soweit sie nicht selbst daran teilnehmen
konnten - sich doch zumindest ausdrücklich für ihr Fernbleiben
entschuldigt und ihr Bedauern über ihr Fehlen zum Ausdruck gebracht
hätten. „Uns 'Labi-anern' fehlt Clemens Jöckle“, stellte die
Standortleiterin in ihrer sehr persönlich gehaltenen Begrüßung
fest. Das würden alle MitarbeiterInnen des LBZ seit der
überraschenden Erkrankung Jöckles und noch mehr nach seinem allzu
frühen Tod fast tagtäglich konstatieren. „Denn er wusste zu allen
kunsthistorisch relevanten Fragen fast immer eine spontane
Antwort“, stellte Ute Bahrs fest - vor allem, wenn sich diese
Fragen um Pfälzer Künstler oder um allgemein sakrale Kunst drehten.
„Zumindest aber hatte er immer eine Idee, einen Rat bereit, wohin
man sich wenden oder wen man anrufen könnte“, stellte sie mit
Verweis auf das schon legendäre Netzwerk des Kunsthistorikers
fest.
„Uns 'Labi-anern' fehlt Clemens Jöckle“, stellte die
Standortleiterin in ihrer sehr persönlich gehaltenen Begrüßung
fest. Das würden alle MitarbeiterInnen des LBZ seit der
überraschenden Erkrankung Jöckles und noch mehr nach seinem allzu
frühen Tod fast tagtäglich konstatieren. „Denn er wusste zu allen
kunsthistorisch relevanten Fragen fast immer eine spontane
Antwort“, stellte Ute Bahrs fest - vor allem, wenn sich diese
Fragen um Pfälzer Künstler oder um allgemein sakrale Kunst drehten.
„Zumindest aber hatte er immer eine Idee, einen Rat bereit, wohin
man sich wenden oder wen man anrufen könnte“, stellte sie mit
Verweis auf das schon legendäre Netzwerk des Kunsthistorikers
fest. Brigitte Sommer erinnerte sich in ihrer Würdigung
an die zahllosen „netten, humorvollen“ Begegnung mit Clemens
Jöckle. „Heute fehlt mir sehr, dass er mich morgens früh um halb
neun Uhr anruft, um mir seinen neuesten, geistreichen Witz zu
erzählen“, wies sie auf eine Facette im Charakter Jöckles hin. Der
in Wasserlos geborene Unterfranke sei schon früh durch seine Mutter
an die Künste, an Malerei, Architektur und Musik, herangeführt
worden, beschrieb Sommer Jöckle „als einen umfassend gebildeten
Menschen mit einem immensen Fach- und Allgemeinwissen“. Fast neun
Jahre lang habe er intensiv und inspirierend mit der apk
zusammengearbeitet. In dieser Zeit habe sie ihn als eine
Persönlichkeit kennengelernt, die, was ihre Kunst anging, zu
keinerlei Kompromissen bereit gewesen sei. „Sich seine Kunst
verwässern zu lassen, das war seine Sache nicht“, betonte die
Rednerin, die mit der bewegenden Feststellung schloß: „Clemens hat
in uns allen eine Spur hinterlassen, die im umfassenden Sinne
positiv in uns weiterleben wird“.
Brigitte Sommer erinnerte sich in ihrer Würdigung
an die zahllosen „netten, humorvollen“ Begegnung mit Clemens
Jöckle. „Heute fehlt mir sehr, dass er mich morgens früh um halb
neun Uhr anruft, um mir seinen neuesten, geistreichen Witz zu
erzählen“, wies sie auf eine Facette im Charakter Jöckles hin. Der
in Wasserlos geborene Unterfranke sei schon früh durch seine Mutter
an die Künste, an Malerei, Architektur und Musik, herangeführt
worden, beschrieb Sommer Jöckle „als einen umfassend gebildeten
Menschen mit einem immensen Fach- und Allgemeinwissen“. Fast neun
Jahre lang habe er intensiv und inspirierend mit der apk
zusammengearbeitet. In dieser Zeit habe sie ihn als eine
Persönlichkeit kennengelernt, die, was ihre Kunst anging, zu
keinerlei Kompromissen bereit gewesen sei. „Sich seine Kunst
verwässern zu lassen, das war seine Sache nicht“, betonte die
Rednerin, die mit der bewegenden Feststellung schloß: „Clemens hat
in uns allen eine Spur hinterlassen, die im umfassenden Sinne
positiv in uns weiterleben wird“. Auch der langjährige Speyerer Bürgermeister
Hanspeter Brohm kennzeichnete Jöckle als einen
„Privatgelehrten im besten klassischen Sinne“. Als „streitbarer
Mensch“ habe er nie einen Konflikt gescheut und nach dem „Aufbruch
in der Speyerer Kunst- und Kulturszene“ in den 1970er und 80er
Jahren unter Dr. Wolfgang Eger als Kulturdezernent
der Stadt, gemeinsam mit Rudolf Dister u.a. das Projekt einer
Städtischen Galerie vom ersten Tag an maßgeblich mit vorangebracht.
„Als ehrenamtlicher Leiter dieser neuen Galerie hat Jöckle diese
Aufgabe von Anfang an als seinen Hauptberuf verstanden und ihn wie
einen Hauptberuf ausgefüllt, ohne nach einer adäquaten Entlohnung
zu fragen“, stellte der ehemalige Kulturbürgermeister heraus. „Er
wollte einfach etwas bewegen in der Kunst unserer Stadt, die ihm
zur Heimat geworden war“. Seine zahllosen Reden und Referate zu
Ausstellungseröffnungen sowie zu speziellen, einzelnen
kunstgeschichtlichen Themen seien ebenso legendär gewesen, wie sein
spontan abrufbares Wissen über Kunstschaffende früherer wie
zeitgenössischer Epochen. „Nicht nur einmal mussten wir aufpassen,
dass er uns mit seiner tief in wissenschaftliche Details gehenden
Expertensprache nicht überforderte“, gestand Brohm, der auch daran
erinnerte, dass Jöckle bis zu seiner schweren Erkrankung der
„Motor“ des KV, des „Kartellverbandes Katholischer
Studentenverbindungen“ in der Pfalz gewesen sei, wo er gleichfalls
mit seinen Vorträgen glänzte und für den er unvergessene
Studienreisen organisiert und wissenschaftlich begleitet habe.
Auch der langjährige Speyerer Bürgermeister
Hanspeter Brohm kennzeichnete Jöckle als einen
„Privatgelehrten im besten klassischen Sinne“. Als „streitbarer
Mensch“ habe er nie einen Konflikt gescheut und nach dem „Aufbruch
in der Speyerer Kunst- und Kulturszene“ in den 1970er und 80er
Jahren unter Dr. Wolfgang Eger als Kulturdezernent
der Stadt, gemeinsam mit Rudolf Dister u.a. das Projekt einer
Städtischen Galerie vom ersten Tag an maßgeblich mit vorangebracht.
„Als ehrenamtlicher Leiter dieser neuen Galerie hat Jöckle diese
Aufgabe von Anfang an als seinen Hauptberuf verstanden und ihn wie
einen Hauptberuf ausgefüllt, ohne nach einer adäquaten Entlohnung
zu fragen“, stellte der ehemalige Kulturbürgermeister heraus. „Er
wollte einfach etwas bewegen in der Kunst unserer Stadt, die ihm
zur Heimat geworden war“. Seine zahllosen Reden und Referate zu
Ausstellungseröffnungen sowie zu speziellen, einzelnen
kunstgeschichtlichen Themen seien ebenso legendär gewesen, wie sein
spontan abrufbares Wissen über Kunstschaffende früherer wie
zeitgenössischer Epochen. „Nicht nur einmal mussten wir aufpassen,
dass er uns mit seiner tief in wissenschaftliche Details gehenden
Expertensprache nicht überforderte“, gestand Brohm, der auch daran
erinnerte, dass Jöckle bis zu seiner schweren Erkrankung der
„Motor“ des KV, des „Kartellverbandes Katholischer
Studentenverbindungen“ in der Pfalz gewesen sei, wo er gleichfalls
mit seinen Vorträgen glänzte und für den er unvergessene
Studienreisen organisiert und wissenschaftlich begleitet habe. „Ein Mensch wie Clemens Jöckle fehlt uns heute in der
Stadt – einen, den wir anrufen konnten, wenn wir eine
kunstgeschichtliche Frage hatten und der auf Anhieb eine kompetente
Antwort parat hatte“, so Brohm, der abschließend aber auch an eine
durchaus tragische Duplizität erinnern musste: Auch Jöckles Vater
sei nach einem schweren Hirnschlag und nach mehr als dreijährigem
Wachkoma verstorben. „Wir alle sind dankbar, dass Clemens zumindest
eine ganz so lange Leidenszeit erspart geblieben ist“, schloss
Brohm und wiederholte noch einmal seine Festellung: „Clemens Jöckle
hat die Kultur in Speyer wie kaum ein zweiter im besten Sinne
befruchtet – er wird deshalb in unseren Herzen weiterleben“.
„Ein Mensch wie Clemens Jöckle fehlt uns heute in der
Stadt – einen, den wir anrufen konnten, wenn wir eine
kunstgeschichtliche Frage hatten und der auf Anhieb eine kompetente
Antwort parat hatte“, so Brohm, der abschließend aber auch an eine
durchaus tragische Duplizität erinnern musste: Auch Jöckles Vater
sei nach einem schweren Hirnschlag und nach mehr als dreijährigem
Wachkoma verstorben. „Wir alle sind dankbar, dass Clemens zumindest
eine ganz so lange Leidenszeit erspart geblieben ist“, schloss
Brohm und wiederholte noch einmal seine Festellung: „Clemens Jöckle
hat die Kultur in Speyer wie kaum ein zweiter im besten Sinne
befruchtet – er wird deshalb in unseren Herzen weiterleben“.
 Das Landesbibliothekszentrum hat historische
gastronomische Weinkarten aus der Sammlung Manfred Rauscher
digitalisiert
Das Landesbibliothekszentrum hat historische
gastronomische Weinkarten aus der Sammlung Manfred Rauscher
digitalisiert
 Speyer- Das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz (LBZ) bietet in den beiden Landesbibliotheken
in Speyer und Koblenz jeweils einen Aufsichtscanner an. So können
Besucher schnell und einfach Beiträge aus Büchern und Zeitschriften
bis zum Format DIN A2 kostenlos einscannen; dafür benötigen sie
lediglich einen USB-Stick. Die Aufsichtscanner ergänzen damit das
Angebot der kostenpflichtigen Kopierer im öffentlichen Bereich.
Speyer- Das Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz (LBZ) bietet in den beiden Landesbibliotheken
in Speyer und Koblenz jeweils einen Aufsichtscanner an. So können
Besucher schnell und einfach Beiträge aus Büchern und Zeitschriften
bis zum Format DIN A2 kostenlos einscannen; dafür benötigen sie
lediglich einen USB-Stick. Die Aufsichtscanner ergänzen damit das
Angebot der kostenpflichtigen Kopierer im öffentlichen Bereich. Speyer- Im Rahmen des seit gut zwei Jahren
laufenden NS-Raubgut-Projektes im Landesbibliothekszentrum /
Pfälzische Landesbibliothek Speyer, erhielt die Landesbibliothek
vor kurzem eine außergewöhnliche Schenkung von Büchern und DVDs,
die sich mit dem Thema „Kindertransporte“ beschäftigen.
Speyer- Im Rahmen des seit gut zwei Jahren
laufenden NS-Raubgut-Projektes im Landesbibliothekszentrum /
Pfälzische Landesbibliothek Speyer, erhielt die Landesbibliothek
vor kurzem eine außergewöhnliche Schenkung von Büchern und DVDs,
die sich mit dem Thema „Kindertransporte“ beschäftigen. Speyer- Der veränderte Webauftritt des
Landesbibliothekszentrums präsentiert sich mit verbesserten
Funktionalitäten und einer übersichtlicheren, auf seine
Dienstleistungen bezogenen Navigation, nach wie vor eingebettet in
das Corporate Design des Landes Rheinland-Pfalz.
Speyer- Der veränderte Webauftritt des
Landesbibliothekszentrums präsentiert sich mit verbesserten
Funktionalitäten und einer übersichtlicheren, auf seine
Dienstleistungen bezogenen Navigation, nach wie vor eingebettet in
das Corporate Design des Landes Rheinland-Pfalz. Zwei Preisrätsel ausgelost - Kinder im ganzen Land dürfen
sich in den nächsten Tagen auf gute Nachricht freuen
Zwei Preisrätsel ausgelost - Kinder im ganzen Land dürfen
sich in den nächsten Tagen auf gute Nachricht freuen Die diesjährigen Bibliothekstage Rheinland-Pfalz boten
gleich doppelte Gewinnchancen, da neben dem etablierten
Kreuzworträtsel für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren erstmals auch
ein Bilderrätsel für Kinder bis 7 Jahre angeboten wurde.
Die diesjährigen Bibliothekstage Rheinland-Pfalz boten
gleich doppelte Gewinnchancen, da neben dem etablierten
Kreuzworträtsel für Kinder im Alter von 6 - 12 Jahren erstmals auch
ein Bilderrätsel für Kinder bis 7 Jahre angeboten wurde. Die Auslosung fand am 12. Dezember 2014 im
Landesbibliothekszentrum Speyer statt. „Glücksfeen“ dabei waren die
Direktorin des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz, Dr. Annette Gerlach, der für die
Büchereien zuständige Referent im Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Anton
Neugebauer sowie Uwe Wöhlert, Vorstand
der Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz, die zugleich als Sponsor
der Preise auftrat.
Die Auslosung fand am 12. Dezember 2014 im
Landesbibliothekszentrum Speyer statt. „Glücksfeen“ dabei waren die
Direktorin des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz, Dr. Annette Gerlach, der für die
Büchereien zuständige Referent im Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Weiterbildung und Kultur, Anton
Neugebauer sowie Uwe Wöhlert, Vorstand
der Landesbausparkasse Rheinland-Pfalz, die zugleich als Sponsor
der Preise auftrat.
 Attraktive
Erweiterung des digitalen Angebotes
Attraktive
Erweiterung des digitalen Angebotes Musikpädagoge Dr. Manfred Peters übergibt seinen Vorlass
der Musikabteilung des LBZ Speyer
Musikpädagoge Dr. Manfred Peters übergibt seinen Vorlass
der Musikabteilung des LBZ Speyer .Dieser 'Vorlass' – so bezeichnen Experten die
Überlassung privat gesammelter wertvoller Dokumente und Archivalien
noch zu Lebzeiten des Gebers - belegt die drei wichtigsten
Lebensabschnitte von Manfred Peters, der 1934 in Landau geboren
wurde, und der seiner Pfälzer Heimat stets verbunden blieb. Neben
dem Studium der Musikwissenschaft, Geschichte und Schulmusik in
Mainz pflegte er auch die musikalische Praxis und perfektionierte
seine frühe Liebe zur Blockflöte und zur barocken Traversflöte. In
den 1960er Jahren galt er als einer der besten Blockflötisten des
Landes und unternahm mit renommierten Ensembles wie dem „Freiburger
Barock-Ensemble“ und „Musica atiqua“ Köln ausgedehnte
Konzertreisen, z.B. in die damalige Sowjetunion und nach
Südamerika. Davon zeugen im Vorlass Programme, Rezensionen und
Schallplattenaufnahmen.
.Dieser 'Vorlass' – so bezeichnen Experten die
Überlassung privat gesammelter wertvoller Dokumente und Archivalien
noch zu Lebzeiten des Gebers - belegt die drei wichtigsten
Lebensabschnitte von Manfred Peters, der 1934 in Landau geboren
wurde, und der seiner Pfälzer Heimat stets verbunden blieb. Neben
dem Studium der Musikwissenschaft, Geschichte und Schulmusik in
Mainz pflegte er auch die musikalische Praxis und perfektionierte
seine frühe Liebe zur Blockflöte und zur barocken Traversflöte. In
den 1960er Jahren galt er als einer der besten Blockflötisten des
Landes und unternahm mit renommierten Ensembles wie dem „Freiburger
Barock-Ensemble“ und „Musica atiqua“ Köln ausgedehnte
Konzertreisen, z.B. in die damalige Sowjetunion und nach
Südamerika. Davon zeugen im Vorlass Programme, Rezensionen und
Schallplattenaufnahmen. Dank der standhaften Beharrlichkeit von Manfred Peters
entwickelte sich die AG - trotz einer heftig umstrittenen
Anfangsphase - zu einem wagemutigen Vorreiter in der Erkundung
neuester musikalischer Entwicklungen durch aufgeschlossene
Jugendliche auch ohne spezielle Vorbildung. Sie wurde zu einem
Leuchtturm im Musikleben der Pfalz und zu einem Vorzeigeobjekt der
Musikpädagogik insgesamt. Einladungen zu Tagen und Festivals der
Neuen Musik erreichten die AG aus dem gesamten Inland und dem
benachbarten Ausland. Ihre Aufführungen wurden von Rundfunk und
Fernsehen aufgezeichnet und von der überregionalen Presse
wohlwollend begleitet.
Dank der standhaften Beharrlichkeit von Manfred Peters
entwickelte sich die AG - trotz einer heftig umstrittenen
Anfangsphase - zu einem wagemutigen Vorreiter in der Erkundung
neuester musikalischer Entwicklungen durch aufgeschlossene
Jugendliche auch ohne spezielle Vorbildung. Sie wurde zu einem
Leuchtturm im Musikleben der Pfalz und zu einem Vorzeigeobjekt der
Musikpädagogik insgesamt. Einladungen zu Tagen und Festivals der
Neuen Musik erreichten die AG aus dem gesamten Inland und dem
benachbarten Ausland. Ihre Aufführungen wurden von Rundfunk und
Fernsehen aufgezeichnet und von der überregionalen Presse
wohlwollend begleitet. Musikwissenschaft der TU Dresden und zu seiner
Dissertation unter dem Titel „Die Dispositio der Oratorie als
Beitrag zum Formverständnis ausgewählter Instrumentalfugen von J.
S. Bach“, mit der er 2004 promoviert wurde. Seine neuen
Erkenntnisse hat er in mehreren Büchern und Zeitschriftenartikeln
publiziert, die in der Fachwelt hohe Anerkennung genießen.
Musikwissenschaft der TU Dresden und zu seiner
Dissertation unter dem Titel „Die Dispositio der Oratorie als
Beitrag zum Formverständnis ausgewählter Instrumentalfugen von J.
S. Bach“, mit der er 2004 promoviert wurde. Seine neuen
Erkenntnisse hat er in mehreren Büchern und Zeitschriftenartikeln
publiziert, die in der Fachwelt hohe Anerkennung genießen. Eindrucksvoller Festakt zur Eröffnung der
Doppelausstellung zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges
Eindrucksvoller Festakt zur Eröffnung der
Doppelausstellung zum Gedenken an den 100. Jahrestag des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges Schumacher zeigte sich dabei tief beeindruckt
von der überaus großen Resonanz, auf die die zahlreichen
Veranstaltungen so vieler Einrichtungen im ganzen Lande zu diesem
Anlass stoßen. „In diesen Wochen zeigt sich, dass die Frage, wie
dieser Krieg die eigene Heimatregion betroffen hat, die Menschen in
Rheinland-Pfalz bis zum heutigen Tag tief bewegt“. Am Beispiel des
lange Zeit in der Südpfalz lebenden und wirkenden Impressionisten
Max Slevogt beschrieb er dessen Wandel vom Maler Harmonie
verströmender Landschafts- und Genrebilder zum Kriegsmaler und
Porträtist von Szenen voller Elend und Verzweiflung sowie das Los
des Speyerer Künstlerpaares Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller,
die unter dem Eindruck des Krieges ihren Aufenthalt in Paris
abbrechen und ihre Freundschaft zu Henri Matisse aussetzen mussten.
„Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war losgebrochen“, stellte
der aus Kaiserslautern stammende Staatssekretär fest, „als das in
Ludwigshafen bei der BASF entwickelte „Haber-Bosch-Verfahren“ nicht
mehr zur Herstellung von Düngemitteln, sondern zur Produktion von
Giftgas eingesetzt wurde“.
Schumacher zeigte sich dabei tief beeindruckt
von der überaus großen Resonanz, auf die die zahlreichen
Veranstaltungen so vieler Einrichtungen im ganzen Lande zu diesem
Anlass stoßen. „In diesen Wochen zeigt sich, dass die Frage, wie
dieser Krieg die eigene Heimatregion betroffen hat, die Menschen in
Rheinland-Pfalz bis zum heutigen Tag tief bewegt“. Am Beispiel des
lange Zeit in der Südpfalz lebenden und wirkenden Impressionisten
Max Slevogt beschrieb er dessen Wandel vom Maler Harmonie
verströmender Landschafts- und Genrebilder zum Kriegsmaler und
Porträtist von Szenen voller Elend und Verzweiflung sowie das Los
des Speyerer Künstlerpaares Hans Purrmann und Mathilde Vollmoeller,
die unter dem Eindruck des Krieges ihren Aufenthalt in Paris
abbrechen und ihre Freundschaft zu Henri Matisse aussetzen mussten.
„Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts war losgebrochen“, stellte
der aus Kaiserslautern stammende Staatssekretär fest, „als das in
Ludwigshafen bei der BASF entwickelte „Haber-Bosch-Verfahren“ nicht
mehr zur Herstellung von Düngemitteln, sondern zur Produktion von
Giftgas eingesetzt wurde“. Dr. Walter Rummel, Standortleiter des
Landesarchivs Speyer, stellte in seinem Statement den
grenzüberschreitenden Charakter der Ausstellung in seinem Hause in
den Vordergrund, in der 35 wissenschaftliche Institutionen in der
Schweiz, dem Elsass sowie in Baden und der Pfalz eng
zusammengearbeitet hätten. Dadurch hätten Ausstellung und Katalog
in überaus kurzer Zeit realisiert werden können – das Ziel, mit
möglichst geringem Aufwand eine eindrucksvolle und zugleich
hochmobile Wanderausstellung zusammenzustellen, sei erreicht
worden. „Wir wollten keinen „Blockbuster“ - keine
'Kriegsausstellung' mit Exponaten wie dem zuvor von Staatssekretär
Schumacher angesprochenen, massenweise zum Einsatz gekommenen
Maschinengewehr O8/15 – später Inbegriff der Sinnlosigkeit jeden
Krieges – präsentieren“, betonte Dr. Rummel, „sondern den Besuchern
unserer Schauen die Auswirkungen des Krieges auf ihre nähere Heimat
– die Pfalz und Baden – die „Heimatfront“ eben - in all ihren
Auswirkungen vor Augen zu führen“.
Dr. Walter Rummel, Standortleiter des
Landesarchivs Speyer, stellte in seinem Statement den
grenzüberschreitenden Charakter der Ausstellung in seinem Hause in
den Vordergrund, in der 35 wissenschaftliche Institutionen in der
Schweiz, dem Elsass sowie in Baden und der Pfalz eng
zusammengearbeitet hätten. Dadurch hätten Ausstellung und Katalog
in überaus kurzer Zeit realisiert werden können – das Ziel, mit
möglichst geringem Aufwand eine eindrucksvolle und zugleich
hochmobile Wanderausstellung zusammenzustellen, sei erreicht
worden. „Wir wollten keinen „Blockbuster“ - keine
'Kriegsausstellung' mit Exponaten wie dem zuvor von Staatssekretär
Schumacher angesprochenen, massenweise zum Einsatz gekommenen
Maschinengewehr O8/15 – später Inbegriff der Sinnlosigkeit jeden
Krieges – präsentieren“, betonte Dr. Rummel, „sondern den Besuchern
unserer Schauen die Auswirkungen des Krieges auf ihre nähere Heimat
– die Pfalz und Baden – die „Heimatfront“ eben - in all ihren
Auswirkungen vor Augen zu führen“. Sein Kollege Dr. Ludger Tekampe, Kurator
der Aussstellung „1914 – 1918. Die Pfalz im Ersten Weltkrieg“ im
Historischen Museum der Pfalz in Speyer, gab sodann einen Einblick
in die von ihm gestaltete Schau, über die der
SPEYER-KURIER in seiner Ausgabe vom 27.05.2014
bereits ausführlich berichtete. Dr. Tekampe betonte, dass beide
Ausstellungen versuchten, einen neuen Blick auf den Ersten
Weltkrieg zu eröffnen. „Dies ist heute ganz besonders nötig, damit
wir uns tagtäglich aufs neue der Kostbarkeit des Friedens bewußt
werden“.
Sein Kollege Dr. Ludger Tekampe, Kurator
der Aussstellung „1914 – 1918. Die Pfalz im Ersten Weltkrieg“ im
Historischen Museum der Pfalz in Speyer, gab sodann einen Einblick
in die von ihm gestaltete Schau, über die der
SPEYER-KURIER in seiner Ausgabe vom 27.05.2014
bereits ausführlich berichtete. Dr. Tekampe betonte, dass beide
Ausstellungen versuchten, einen neuen Blick auf den Ersten
Weltkrieg zu eröffnen. „Dies ist heute ganz besonders nötig, damit
wir uns tagtäglich aufs neue der Kostbarkeit des Friedens bewußt
werden“. Kurt Beck erinnerte an das Los seines eigenen Großvaters –
ein typisches Soldaten-Schicksal – der im Ersten Weltkrieg eine
Giftgasvergiftung und bedingt dadurch eine schwere Lungenschädigung
erlitt und der dennoch auch im Zweiten Weltkrieg erneut als
„letztes Aufgebot“, als Volkssturmmann, zum Kriegsdienst eingezogen
wurde. In seiner Heimatgemeinde Steinweiler, so Beck, seien gleich
zu Kriegsbeginn 86 junge Männer eingezogen worden, von denen schon
kurz darauf bereits elf gefallen waren. „Was hätten diese Menschen
für Ihre Familien, für sich selbst und für unser ganzes Volk
leisten können, wenn man ihnen den Frieden erhalten hätte?“ so
Becks nachdenkliche Frage, die er sich dann gleich selbst mit dem
Hinweis auf die friedliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg
beantwortete:.„Zu welchen Leistungen für ihre Gesellschaft die
Opfer des Ersten Weltkrieges imstande gewesen wären, können wir
heute am Beispiel der Entwicklung unseres Landes in den vergangenen
69 Jahren des Friedens ermessen“. Beck führte auch vor Augen, wie
Bauern durch die Requirierung ihrer Fuhrwerke die Existenzgrundlage
genommen worden sei oder wie - grotesk genug - Eisenbahner erst
bewaffnet wurden, um Bahnhöfe und Bahnlinien gegen vermeintliche
Attentäter zu schützen, um kurz darauf ihre Waffen wieder
einzusammeln, um „eine ungewollte Massenbewaffnung“ zu verhindern.
„Groteske Situationen waren das“, so Beck, der daraus den Schluss
zog, dass sich die Menschen nie mehr durch indoktrinierende
„mainstream-Meinungen“ beeinflussen lassen dürften.
Kurt Beck erinnerte an das Los seines eigenen Großvaters –
ein typisches Soldaten-Schicksal – der im Ersten Weltkrieg eine
Giftgasvergiftung und bedingt dadurch eine schwere Lungenschädigung
erlitt und der dennoch auch im Zweiten Weltkrieg erneut als
„letztes Aufgebot“, als Volkssturmmann, zum Kriegsdienst eingezogen
wurde. In seiner Heimatgemeinde Steinweiler, so Beck, seien gleich
zu Kriegsbeginn 86 junge Männer eingezogen worden, von denen schon
kurz darauf bereits elf gefallen waren. „Was hätten diese Menschen
für Ihre Familien, für sich selbst und für unser ganzes Volk
leisten können, wenn man ihnen den Frieden erhalten hätte?“ so
Becks nachdenkliche Frage, die er sich dann gleich selbst mit dem
Hinweis auf die friedliche Entwicklung nach dem Zweiten Weltkrieg
beantwortete:.„Zu welchen Leistungen für ihre Gesellschaft die
Opfer des Ersten Weltkrieges imstande gewesen wären, können wir
heute am Beispiel der Entwicklung unseres Landes in den vergangenen
69 Jahren des Friedens ermessen“. Beck führte auch vor Augen, wie
Bauern durch die Requirierung ihrer Fuhrwerke die Existenzgrundlage
genommen worden sei oder wie - grotesk genug - Eisenbahner erst
bewaffnet wurden, um Bahnhöfe und Bahnlinien gegen vermeintliche
Attentäter zu schützen, um kurz darauf ihre Waffen wieder
einzusammeln, um „eine ungewollte Massenbewaffnung“ zu verhindern.
„Groteske Situationen waren das“, so Beck, der daraus den Schluss
zog, dass sich die Menschen nie mehr durch indoktrinierende
„mainstream-Meinungen“ beeinflussen lassen dürften. Damit schlug er zugleich auch den Bogen von der
Propaganda des Ersten Weltkrieges auf allen kriegsbeteiligten
Seiten hin zu den Parolen, wie sie auch heute wieder in der
aktuellen Auseinandersetzung zwischen Rußland und der Ukraine zu
vernehmen seien. „Statt lauter Propaganda brauchen wir deshalb
immer wieder das direkte Gespräch zwischen den Staaten“, rief er
alle politisch Verantwortlichen zum Dialog auf. „Die Zeit vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat in beklemmender Weise gezeigt,
wie schnell Propaganda-Parolen verfangen können“, so Beck, der aber
gleichzeitig auch davor warnte, das gegenwärtig einvernehmliche
Miteinander über regionale und nationale Grenzen hinweg zu leicht
als Selbstverständlichkeit zu verstehen: „Nein“, rief Beck seinem
Auditorium zu, „darum müssen wir uns jeden Tag aufs neue bemühen –
daran müssen wir immer wieder auf allen Ebenen arbeiten“.
Damit schlug er zugleich auch den Bogen von der
Propaganda des Ersten Weltkrieges auf allen kriegsbeteiligten
Seiten hin zu den Parolen, wie sie auch heute wieder in der
aktuellen Auseinandersetzung zwischen Rußland und der Ukraine zu
vernehmen seien. „Statt lauter Propaganda brauchen wir deshalb
immer wieder das direkte Gespräch zwischen den Staaten“, rief er
alle politisch Verantwortlichen zum Dialog auf. „Die Zeit vor dem
Ausbruch des Ersten Weltkrieges hat in beklemmender Weise gezeigt,
wie schnell Propaganda-Parolen verfangen können“, so Beck, der aber
gleichzeitig auch davor warnte, das gegenwärtig einvernehmliche
Miteinander über regionale und nationale Grenzen hinweg zu leicht
als Selbstverständlichkeit zu verstehen: „Nein“, rief Beck seinem
Auditorium zu, „darum müssen wir uns jeden Tag aufs neue bemühen –
daran müssen wir immer wieder auf allen Ebenen arbeiten“. In seinem Einführungsvortrag umriß schließlich der Mainzer
Zeitgeschichtler Prof. Dr. Michael Kißener die
Situation während des Krieges „im Westen (des Deutschen Reiches)
und im „frontnahen Heimatgebiet“. Dabei richtete er sein besonderes
Augenmerk auf die allegemeine geostrategische Lage in der Pfalz zu
Beginn des Krieges sowie auf die Versorgung Verwundeter auf beiden
Seiten der Front sowie auf den Umgang mit den Kriegsgefangenen. Wie
Prof. Kißener konstatieren musste, sei das deutsche Militär mit
beidem schon sehr bald restlos überfordert gewesen.
In seinem Einführungsvortrag umriß schließlich der Mainzer
Zeitgeschichtler Prof. Dr. Michael Kißener die
Situation während des Krieges „im Westen (des Deutschen Reiches)
und im „frontnahen Heimatgebiet“. Dabei richtete er sein besonderes
Augenmerk auf die allegemeine geostrategische Lage in der Pfalz zu
Beginn des Krieges sowie auf die Versorgung Verwundeter auf beiden
Seiten der Front sowie auf den Umgang mit den Kriegsgefangenen. Wie
Prof. Kißener konstatieren musste, sei das deutsche Militär mit
beidem schon sehr bald restlos überfordert gewesen.
 Südwestrundfunk mit Vorpremiere seiner Dokumentation „Der
Erste Weltkrieg im Südwesten“
Südwestrundfunk mit Vorpremiere seiner Dokumentation „Der
Erste Weltkrieg im Südwesten“ Erst jetzt, im Vorfeld des 100. Jahrestages des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges in der Folge des Attentats auf den
Österreich-Ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand am 28.
Juli 1914, werden Ausstellungen vorbereitet, Bücher veröffentlicht
und filmische Dokumentationen vorbereitet.
Erst jetzt, im Vorfeld des 100. Jahrestages des Ausbruchs
des Ersten Weltkrieges in der Folge des Attentats auf den
Österreich-Ungarischen Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand am 28.
Juli 1914, werden Ausstellungen vorbereitet, Bücher veröffentlicht
und filmische Dokumentationen vorbereitet. In eindringlich-bewegender, höchst sensibler Weise ist es
dem Autor in dieser Dokumentation gelungen, über zeitgenössische
Sequenzen aus Wochenschauen und privat gedrehten, frühen Filmen
sowie durch private Fotografien eine Annäherung an die wahren
Gefühle und Verhältnisse der Menschen in dieser Zeit zu
ermöglichen. Insbesondere die szenische Umsetzung von Briefwechseln
zwischen „der Heimat und den Lieben an der Front“ lassen klar
erkennen: Da war nichts vorhanden von dem aus propagandistischen
Gründen so gerne vorgeführten „Hurra-Patriotismus“ offizieller
Verlautbarungen.
In eindringlich-bewegender, höchst sensibler Weise ist es
dem Autor in dieser Dokumentation gelungen, über zeitgenössische
Sequenzen aus Wochenschauen und privat gedrehten, frühen Filmen
sowie durch private Fotografien eine Annäherung an die wahren
Gefühle und Verhältnisse der Menschen in dieser Zeit zu
ermöglichen. Insbesondere die szenische Umsetzung von Briefwechseln
zwischen „der Heimat und den Lieben an der Front“ lassen klar
erkennen: Da war nichts vorhanden von dem aus propagandistischen
Gründen so gerne vorgeführten „Hurra-Patriotismus“ offizieller
Verlautbarungen.
 Norbert Ziegler, heute 85 und Sohn des den Krieg
überlebenden Jakob Ziegler sowie zahlreiche
Mitglieder seiner vielköpfigen Familie waren an diesem Abend nach
Speyer gekommen, um der Vorführung beizuwohnen. Sie zeigten sich im
Anschluss daran tief bewegt und dankbar dafür, diese dramatisierte
Fassung ihrer eigenen Familiengeschichte als erste miterleben zu
können.
Norbert Ziegler, heute 85 und Sohn des den Krieg
überlebenden Jakob Ziegler sowie zahlreiche
Mitglieder seiner vielköpfigen Familie waren an diesem Abend nach
Speyer gekommen, um der Vorführung beizuwohnen. Sie zeigten sich im
Anschluss daran tief bewegt und dankbar dafür, diese dramatisierte
Fassung ihrer eigenen Familiengeschichte als erste miterleben zu
können. Wie sehr die Menschen in der Region aber - entgegen allen
anderen Erwartungen - die Situation vor einhundert Jahren bewegt,
bewies die anschließende intensive Frage- und Diskussionsrunde, die
- angeregt und sachkundig moderiert vom Leiter des Speyerer
Landesarchivs, Dr. Walter Rummel - nach anfänglichem
Zögern in Gang kam. In sie schaltete sich dann auch der
frühere Landrat von Ludwigshafen und Regierungspräsident a.D. Dr.
Paul Schädler ein, der die Situation am Vorabend des
Ersten Weltkrieges mit der gegenwärtigen Lage in der Ukraine und
auf der Krim verglich. „Hoffen wir, dass die heute verantwortlichen
Politiker gemässigter und vernünftiger zu handeln in der Lage sind
als ihre Vorgänger im Jahr 1914“, so Dr. Schädler, der im 2.
Weltkrieg auch selbst drei Brüder seines Vaters verloren hat –
einen davon vor Stalingrad.
Wie sehr die Menschen in der Region aber - entgegen allen
anderen Erwartungen - die Situation vor einhundert Jahren bewegt,
bewies die anschließende intensive Frage- und Diskussionsrunde, die
- angeregt und sachkundig moderiert vom Leiter des Speyerer
Landesarchivs, Dr. Walter Rummel - nach anfänglichem
Zögern in Gang kam. In sie schaltete sich dann auch der
frühere Landrat von Ludwigshafen und Regierungspräsident a.D. Dr.
Paul Schädler ein, der die Situation am Vorabend des
Ersten Weltkrieges mit der gegenwärtigen Lage in der Ukraine und
auf der Krim verglich. „Hoffen wir, dass die heute verantwortlichen
Politiker gemässigter und vernünftiger zu handeln in der Lage sind
als ihre Vorgänger im Jahr 1914“, so Dr. Schädler, der im 2.
Weltkrieg auch selbst drei Brüder seines Vaters verloren hat –
einen davon vor Stalingrad.-01.jpg) Eine außergewöhnliche Annäherung an den 100. Jahrestag des
Beginns des Ersten Weltkriegs
Eine außergewöhnliche Annäherung an den 100. Jahrestag des
Beginns des Ersten Weltkriegs-01.jpg) Dieses Gedenkjahr hat jetzt in der Speyerer 'LaBi' mit
einer ganz besonderen Annäherung an den Alltag in der Zeit des
Ersten Weltkrieges begonnen: Dr. Armin Schlechter, Leiter
der Abteilung „Handschriften und alte Drucke“ des LBZ,
hatte die gut 700 Exponate umfassende Sammlung von Plakaten und
Maueranschlägen des Hauses aus der Zeit von 1914 bis in die Zeit
der französischen Besetzung im Jahr 1919 bearbeitet und diese
damals entstandenen Medien nach ihren inhaltlichen Aussagen,
Zielsetzungen und Adressaten geordnet.
Dieses Gedenkjahr hat jetzt in der Speyerer 'LaBi' mit
einer ganz besonderen Annäherung an den Alltag in der Zeit des
Ersten Weltkrieges begonnen: Dr. Armin Schlechter, Leiter
der Abteilung „Handschriften und alte Drucke“ des LBZ,
hatte die gut 700 Exponate umfassende Sammlung von Plakaten und
Maueranschlägen des Hauses aus der Zeit von 1914 bis in die Zeit
der französischen Besetzung im Jahr 1919 bearbeitet und diese
damals entstandenen Medien nach ihren inhaltlichen Aussagen,
Zielsetzungen und Adressaten geordnet.-01.jpg) Aber auch andere, kriegsrelevante Verlautbarungen seien
auf diesem Wege verbreitet worden: Aufrufe an junge Männer zur
Gestellung für die Musterung, Verhaltensregeln bei
Fliegerangriffen, Aufrufe zu patriotischen Kriegsspenden („Gold gab
ich für Eisen“) und Kriegsanleihen, Appelle zur materiellen
Unterstützung Verwundeter oder von Hinterbliebenen gefallener
Soldaten.
Aber auch andere, kriegsrelevante Verlautbarungen seien
auf diesem Wege verbreitet worden: Aufrufe an junge Männer zur
Gestellung für die Musterung, Verhaltensregeln bei
Fliegerangriffen, Aufrufe zu patriotischen Kriegsspenden („Gold gab
ich für Eisen“) und Kriegsanleihen, Appelle zur materiellen
Unterstützung Verwundeter oder von Hinterbliebenen gefallener
Soldaten.-01.jpg) Plakate – sie waren, wie Dr. Schlechter es schilderte,
also auch ein Stück „psychologischer Kriegsführung“, die so wohl
zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte zum Einsatz kamen – zuhause
und an den Fronten des Weltkrieges.
Plakate – sie waren, wie Dr. Schlechter es schilderte,
also auch ein Stück „psychologischer Kriegsführung“, die so wohl
zum ersten Mal in der Kriegsgeschichte zum Einsatz kamen – zuhause
und an den Fronten des Weltkrieges.-01.jpg) Die Pfälzische Landesbibliothek, seit 2004 Teil des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, wurde im Jahr 1921
begründet und zwei Jahre später eröffnet. Ihre den Ersten Weltkrieg
betreffenden Sammlungen sind mithin erst retrospektiv erworben
worden. Den zweifellos wichtigsten Fonds bilden etwa 700 Plakate
und Maueranschläge aus der Zeit von 1914 bis 1919 einschließlich
des ersten Jahres der Besetzung durch französische Truppen ab Ende
November 1918. Diese Plakate sind Teil einer größeren, zusammen
etwa 2.500 Einheiten umfassenden Sammlung, die vom Beginn des
Ersten Weltkriegs bis etwa 1950 reicht. Diese Plakatsammlung stammt
aus unterschiedlichen, heute nicht mehr in Gänze fassbaren Quellen,
die aber in der Pfalz zu vermuten sind. Teils handelt es sich um
druckfrische Exemplare, teils um tatsächlich öffentlich ausgehängte
Plakate oder Anschläge, wie beispielsweise typische
Verschmutzungen, Reißnagelspuren oder sogar Putzreste zeigen.
Die Pfälzische Landesbibliothek, seit 2004 Teil des
Landesbibliothekszentrums Rheinland-Pfalz, wurde im Jahr 1921
begründet und zwei Jahre später eröffnet. Ihre den Ersten Weltkrieg
betreffenden Sammlungen sind mithin erst retrospektiv erworben
worden. Den zweifellos wichtigsten Fonds bilden etwa 700 Plakate
und Maueranschläge aus der Zeit von 1914 bis 1919 einschließlich
des ersten Jahres der Besetzung durch französische Truppen ab Ende
November 1918. Diese Plakate sind Teil einer größeren, zusammen
etwa 2.500 Einheiten umfassenden Sammlung, die vom Beginn des
Ersten Weltkriegs bis etwa 1950 reicht. Diese Plakatsammlung stammt
aus unterschiedlichen, heute nicht mehr in Gänze fassbaren Quellen,
die aber in der Pfalz zu vermuten sind. Teils handelt es sich um
druckfrische Exemplare, teils um tatsächlich öffentlich ausgehängte
Plakate oder Anschläge, wie beispielsweise typische
Verschmutzungen, Reißnagelspuren oder sogar Putzreste zeigen.-02.jpg) Die Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek zum
Ersten Weltkrieg ist vor dem Hintergrund der unterschiedlichen
Nutzung dieser Publikationsform durch die Entente und durch die
Mittelmächte zu sehen. Während die französischen, englischen und
amerikanischen Medien dieser Art unter Verweis auf die
rückständigen Regierungsformen in Deutschland und Österreich sowie
die gegen das Völkerrecht verstoßende Besetzung des neutralen
Belgiens mit drastischen Feindbildern im Innern Propaganda gegen
ihre Gegner machten, verzichtete insbesondere Deutschland auf ein
solches Vorgehen. Die propagandistische Bekämpfung des Feindes
in gehässiger Form wurde als Verstoß gegen die Haager
Landkriegsordnung und das Völkerrecht betrachtet. Erst Ende August
1918 gab die Oberste Heeresleitung ihre Zurückhaltung in diesem
Punkt auf. Deutsche Propagandaplakate des Ersten Weltkriegs
richteten sich in erster Linie an die eigene Bevölkerung und
wollten mit didaktischer Zielrichtung den von den Feinden erhobenen
Vorwurf des deutschen Militarismus und der Unkultur widerlegen.
Die Plakatsammlung der Pfälzischen Landesbibliothek zum
Ersten Weltkrieg ist vor dem Hintergrund der unterschiedlichen
Nutzung dieser Publikationsform durch die Entente und durch die
Mittelmächte zu sehen. Während die französischen, englischen und
amerikanischen Medien dieser Art unter Verweis auf die
rückständigen Regierungsformen in Deutschland und Österreich sowie
die gegen das Völkerrecht verstoßende Besetzung des neutralen
Belgiens mit drastischen Feindbildern im Innern Propaganda gegen
ihre Gegner machten, verzichtete insbesondere Deutschland auf ein
solches Vorgehen. Die propagandistische Bekämpfung des Feindes
in gehässiger Form wurde als Verstoß gegen die Haager
Landkriegsordnung und das Völkerrecht betrachtet. Erst Ende August
1918 gab die Oberste Heeresleitung ihre Zurückhaltung in diesem
Punkt auf. Deutsche Propagandaplakate des Ersten Weltkriegs
richteten sich in erster Linie an die eigene Bevölkerung und
wollten mit didaktischer Zielrichtung den von den Feinden erhobenen
Vorwurf des deutschen Militarismus und der Unkultur widerlegen.-01.jpg) Ein weiteres, regionales Beispiel für einen
Sammlungsaufruf dieser Art ist ein Plakat der ‚Freiwilligen
Familien- und Kriegsfürsorge’, das mit der Darstellung des Speyerer
Altpörtels zu einer Spende bei zeitgleichem Einschlagen eines
Nagels in das eiserne Wappen der Stadt aufforderte. Diese aus
Holz gefertigten sogenannten Nagelungsfiguren wurden in vielen
deutschen Städten zu demselben Zweck errichtet. Das Speyerer, an
der Westseite des Altpörtels aufgehängte Exemplar wurde am 28. Juni
1916 eingeweiht und hat sich im Historischen Museum der Pfalz
erhalten. Erwähnenswert ist aus der Region weiter die Mainzer
Nagelungsfigur, die bis heute im Freien vor dem Dom aufgestellt
ist.
Ein weiteres, regionales Beispiel für einen
Sammlungsaufruf dieser Art ist ein Plakat der ‚Freiwilligen
Familien- und Kriegsfürsorge’, das mit der Darstellung des Speyerer
Altpörtels zu einer Spende bei zeitgleichem Einschlagen eines
Nagels in das eiserne Wappen der Stadt aufforderte. Diese aus
Holz gefertigten sogenannten Nagelungsfiguren wurden in vielen
deutschen Städten zu demselben Zweck errichtet. Das Speyerer, an
der Westseite des Altpörtels aufgehängte Exemplar wurde am 28. Juni
1916 eingeweiht und hat sich im Historischen Museum der Pfalz
erhalten. Erwähnenswert ist aus der Region weiter die Mainzer
Nagelungsfigur, die bis heute im Freien vor dem Dom aufgestellt
ist.-01.jpg) LBZ und Landesarchiv befürchten schleichende Zersetzung
großer Teile ihrer Bestände
LBZ und Landesarchiv befürchten schleichende Zersetzung
großer Teile ihrer Bestände-01.jpg) Wenn in zwei Monaten das Dach des gemeinsamen Gebäudes in
der Speyerer Otto-Mayer-Straße 9 geöffnet werde, um Platz für ein
weiteres Stockwerk und damit für weitere Magazinflächen zu
schaffen, dann würden vorsorglich die dort gelagerten Bestände für
die Dauer der Bauzeit wasserdicht verpackt. „Für die Nutzer
bedeutet das allerdings, dass sie auch einmal etwas länger auf die
Ausgabe einer gewünschten Archivalie oder eines Buches warten
müssen oder dass eine Bereitstellung zeitweise überhaupt nicht
möglich sein wird“, bat Dr. Rummel dazu die Nutzer um
Verständnis.
Wenn in zwei Monaten das Dach des gemeinsamen Gebäudes in
der Speyerer Otto-Mayer-Straße 9 geöffnet werde, um Platz für ein
weiteres Stockwerk und damit für weitere Magazinflächen zu
schaffen, dann würden vorsorglich die dort gelagerten Bestände für
die Dauer der Bauzeit wasserdicht verpackt. „Für die Nutzer
bedeutet das allerdings, dass sie auch einmal etwas länger auf die
Ausgabe einer gewünschten Archivalie oder eines Buches warten
müssen oder dass eine Bereitstellung zeitweise überhaupt nicht
möglich sein wird“, bat Dr. Rummel dazu die Nutzer um
Verständnis.-01.jpg) LBZ und Landesarchiv stünden deshalb heute vor sage und
schreibe 70.000 (!) Regalmetern voller Bücher, Archivalien und
anderen Drucksachen, die akut vom Säurefrass befallen seien – zwei
Drittel davon allein am Standort Speyer. „Am heftigsten drängt uns
der Zerfall von all dem, was zwischen den Jahren 1840 bis 1990
geschrieben und gedruckt wurde“, so die Bibliotheksleiterin, die
darauf verwies, dass mangels zureichender Finanzmittel, vor allem
aber spezialisierter Buchrestauratoren man dazu habe übergehen
müssen, für die Langzeitsicherung ein Priorisierungsverfahren
einzuführen. „Wir mussten uns entscheiden, was gerettet werden
sollte und was wir aufgeben müssen“.
LBZ und Landesarchiv stünden deshalb heute vor sage und
schreibe 70.000 (!) Regalmetern voller Bücher, Archivalien und
anderen Drucksachen, die akut vom Säurefrass befallen seien – zwei
Drittel davon allein am Standort Speyer. „Am heftigsten drängt uns
der Zerfall von all dem, was zwischen den Jahren 1840 bis 1990
geschrieben und gedruckt wurde“, so die Bibliotheksleiterin, die
darauf verwies, dass mangels zureichender Finanzmittel, vor allem
aber spezialisierter Buchrestauratoren man dazu habe übergehen
müssen, für die Langzeitsicherung ein Priorisierungsverfahren
einzuführen. „Wir mussten uns entscheiden, was gerettet werden
sollte und was wir aufgeben müssen“.-01.jpg) Am Beispiel eines Zeitungsbandes erläuterte.Dr.
Schlechter das höchst aufwändige Verfahren der Papierspaltung zur
Sicherung eines einzigen Zeitungsblattes. Dazu wird das von
Säurefrass bedrohte Blatt zunächst auf beiden Seiten mit einer
Spezialfolie beklebt. Zieht man diese beiden Folien dann
auseinander, verbleiben Vorder- und Rückseite des gedruckten
Blattes auf den beiden Trägerfolien. Dann werden beide Seiten auf
eine weitere Folie aufgebracht, die dann auf Dauer den Zeitungstext
auf beiden Seiten tragen kann. Danach können auch die Hilfsfolien
wieder abgelöst werden – die Zeitungsseite präsentiert sich im
originalen Zustand - eben halt mit einer Trägerfolie zwischen
Vorder- und Rückseite. Ein höchst aufwändiges und zeitintensives
Verfahren, bedenkt man, dass allein ein Jahrgang eines
Zeitungsbandes oft viele hundert Einzelblätter umfasst.
Am Beispiel eines Zeitungsbandes erläuterte.Dr.
Schlechter das höchst aufwändige Verfahren der Papierspaltung zur
Sicherung eines einzigen Zeitungsblattes. Dazu wird das von
Säurefrass bedrohte Blatt zunächst auf beiden Seiten mit einer
Spezialfolie beklebt. Zieht man diese beiden Folien dann
auseinander, verbleiben Vorder- und Rückseite des gedruckten
Blattes auf den beiden Trägerfolien. Dann werden beide Seiten auf
eine weitere Folie aufgebracht, die dann auf Dauer den Zeitungstext
auf beiden Seiten tragen kann. Danach können auch die Hilfsfolien
wieder abgelöst werden – die Zeitungsseite präsentiert sich im
originalen Zustand - eben halt mit einer Trägerfolie zwischen
Vorder- und Rückseite. Ein höchst aufwändiges und zeitintensives
Verfahren, bedenkt man, dass allein ein Jahrgang eines
Zeitungsbandes oft viele hundert Einzelblätter umfasst. 2014 finden zum
siebten Mal die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt
2014 finden zum
siebten Mal die Bibliothekstage Rheinland-Pfalz statt Rückblick auf zehn Jahre Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz – Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2014
Rückblick auf zehn Jahre Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz – Ausblick auf das Jubiläumsjahr 2014 Diese Bilanz nach zehn Jahren zeige, so Dr.
Gerlach, dass die Gründung des LBZ zu einer erheblichen
Serviceverbesserung für die Kunden der Bibliotheken und
Büchereistellen im LBZ und zu nennenswerten Synergieeffekten u.a.
bei der Arbeitsorganisation und in den Bereichen der Verwaltung und
der Informationstechnik geführt habe. Der im Jahr 2006 in Betrieb
genommene neue Online-Katalog des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz eröffne inzwischen den Zugang zu sämtlichen
Beständen der „Bibliotheca Bipontina“ Zweibrücken, der Pfälzischen
Landesbibliothek in Speyer und der Rheinischen Landesbibliothek
Koblenz als gleichberechtigte Zweigstellen in einer einheitlichen
Datenbank. Mit diesem neuen Katalog, so Dr. Gerlach, sei ein
EDV-System entstanden, das erstmals die Bestände der
Landesbibliotheken eines
Diese Bilanz nach zehn Jahren zeige, so Dr.
Gerlach, dass die Gründung des LBZ zu einer erheblichen
Serviceverbesserung für die Kunden der Bibliotheken und
Büchereistellen im LBZ und zu nennenswerten Synergieeffekten u.a.
bei der Arbeitsorganisation und in den Bereichen der Verwaltung und
der Informationstechnik geführt habe. Der im Jahr 2006 in Betrieb
genommene neue Online-Katalog des Landesbibliothekszentrums
Rheinland-Pfalz eröffne inzwischen den Zugang zu sämtlichen
Beständen der „Bibliotheca Bipontina“ Zweibrücken, der Pfälzischen
Landesbibliothek in Speyer und der Rheinischen Landesbibliothek
Koblenz als gleichberechtigte Zweigstellen in einer einheitlichen
Datenbank. Mit diesem neuen Katalog, so Dr. Gerlach, sei ein
EDV-System entstanden, das erstmals die Bestände der
Landesbibliotheken eines Zur Zeit stehen dort 833.000 Scans in dilibri bereit, -
historische Bestände aus rheinland-pfälzischen Bibliotheken, die
die von interessierten Bürgerinnen und Bürgern direkt online
recherchiert und gelesen werden können.
Zur Zeit stehen dort 833.000 Scans in dilibri bereit, -
historische Bestände aus rheinland-pfälzischen Bibliotheken, die
die von interessierten Bürgerinnen und Bürgern direkt online
recherchiert und gelesen werden können. Die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer wird die
Bereiche mit sofort ausleihbaren, frei zugänglichen Medien
ausweiten
Die Pfälzische Landesbibliothek in Speyer wird die
Bereiche mit sofort ausleihbaren, frei zugänglichen Medien
ausweiten NAXOS Music Library :
Zugang rund um die Uhr über das Landesbibliothekszentrum
NAXOS Music Library :
Zugang rund um die Uhr über das Landesbibliothekszentrum Bibliotheksleitung
präsentiert wertvollen „Ottheinrich-Einband“ als Dauerleihgabe der
Ernst von Siemens Kunststiftung
Bibliotheksleitung
präsentiert wertvollen „Ottheinrich-Einband“ als Dauerleihgabe der
Ernst von Siemens Kunststiftung Dr.
Schlechter charakterisierte in seiner Vorstellung den zum
protestantischen Glauben übergetretenen Kurfürsten als einen der
großen Büchersammler seiner Zeit, in dessen Bibliothek
reformatorische Literatur einen breiten Raum eingenommen habe.
Darüber hinaus habe Ottheinrich aber auch viele Bücher zu anderen
Interessensgebiete gesammelt, unter anderem zu Astronomie und
Medizin. Nach seinen Vorgaben seien aber auch die kostbaren
Einbände seiner Bücher geschaffen worden, so wohl auch der jetzt
nach Speyer gelangte sogenannte „Ottheinricheinband“, erläuterte
Dr. Schlecher. Da aber der Kurfürst selbst wohl des Laterinischen
nicht mächtig gewesen sei, habe seine prachtvolle, vermutlich 600
bis 700 Bände umfassende Bibliothek wohl mehr der Repräsentation
gegenüber anderen Fürsten als dem eigenen Studium oder der Erbauung
gedient.
Dr.
Schlechter charakterisierte in seiner Vorstellung den zum
protestantischen Glauben übergetretenen Kurfürsten als einen der
großen Büchersammler seiner Zeit, in dessen Bibliothek
reformatorische Literatur einen breiten Raum eingenommen habe.
Darüber hinaus habe Ottheinrich aber auch viele Bücher zu anderen
Interessensgebiete gesammelt, unter anderem zu Astronomie und
Medizin. Nach seinen Vorgaben seien aber auch die kostbaren
Einbände seiner Bücher geschaffen worden, so wohl auch der jetzt
nach Speyer gelangte sogenannte „Ottheinricheinband“, erläuterte
Dr. Schlecher. Da aber der Kurfürst selbst wohl des Laterinischen
nicht mächtig gewesen sei, habe seine prachtvolle, vermutlich 600
bis 700 Bände umfassende Bibliothek wohl mehr der Repräsentation
gegenüber anderen Fürsten als dem eigenen Studium oder der Erbauung
gedient. In seiner
klassischen Form handele es sich bei dem jetzt erworbenen Band um
einen mit braunem Kalbleder überzogenen Holzdeckeleinband, der mit
blinden Rollen verziert ist. Im Zentrum steht auch hier ein
Supralibros-P aar in Gold, das auf der Vorderseite das Porträt
Ottheinrichs und auf der Rückseite sein Wappen zeigt. Heute
existieren nach Einschätzung von Dr, Schlechter wohl noch etwa 450
Ottheinrich-Einbände, die überwiegend in der „Bibliotheca
Apostolica Vaticana“ in Rom, in der Universitätsbibliothek
Heidelberg, in der Stadtbibliothek Mainz, in der Bayerischen
Staatsbibliothek München und im Landesbibliothekszentrum /
Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken aufbewahrt werden. Mit dem
heute vorgestellten Neuerwerb habe die LaBi in Speyer jetzt ihren
Besitz von bisher einem Ottheinrich-Einband – einem Werk zur
Astronomie eines Schülers von Nikolaus Kopernikus aus dem Bestand
der Bibliothek der früheren Domschule (heute Gymansium am
Kaiserdom) – nun „glatt um hundert Prozent erhöht“, so Dr.
Schlechter schmunzelnd.
In seiner
klassischen Form handele es sich bei dem jetzt erworbenen Band um
einen mit braunem Kalbleder überzogenen Holzdeckeleinband, der mit
blinden Rollen verziert ist. Im Zentrum steht auch hier ein
Supralibros-P aar in Gold, das auf der Vorderseite das Porträt
Ottheinrichs und auf der Rückseite sein Wappen zeigt. Heute
existieren nach Einschätzung von Dr, Schlechter wohl noch etwa 450
Ottheinrich-Einbände, die überwiegend in der „Bibliotheca
Apostolica Vaticana“ in Rom, in der Universitätsbibliothek
Heidelberg, in der Stadtbibliothek Mainz, in der Bayerischen
Staatsbibliothek München und im Landesbibliothekszentrum /
Bibliotheca Bipontina in Zweibrücken aufbewahrt werden. Mit dem
heute vorgestellten Neuerwerb habe die LaBi in Speyer jetzt ihren
Besitz von bisher einem Ottheinrich-Einband – einem Werk zur
Astronomie eines Schülers von Nikolaus Kopernikus aus dem Bestand
der Bibliothek der früheren Domschule (heute Gymansium am
Kaiserdom) – nun „glatt um hundert Prozent erhöht“, so Dr.
Schlechter schmunzelnd. Der neue
Speyerer Zugang wurde im Januar 2013 von dem Königsteiner
Antiquariat Reiss & Sohn angeboten und war gemäß dem
aufgeprägten Bindejahr als ein 1550 hergestellter
Ottheinrich-Einband identifiziert worden. Er zeigt vorne das zu
dieser Zeit gebräuchliche Supralibros des Kurfürsten mit der
Unterschrift OTTHAINRICH VON G.G./ PFALTZGRAVE BEY
RHEIN/ HERTZOG IN NIDERN VND OBERN BAIRN, hinten
korrespondierend eine nur bei den frühen Ottheinrich-Einbänden
verwendete Spes-Platte, eine Personifikation der Tugend Hoffnung.
Der Band zeigt weiter einen punzierten Goldschnitt, was bei dieser
Buchgattung eher selten vorkommt.
Der neue
Speyerer Zugang wurde im Januar 2013 von dem Königsteiner
Antiquariat Reiss & Sohn angeboten und war gemäß dem
aufgeprägten Bindejahr als ein 1550 hergestellter
Ottheinrich-Einband identifiziert worden. Er zeigt vorne das zu
dieser Zeit gebräuchliche Supralibros des Kurfürsten mit der
Unterschrift OTTHAINRICH VON G.G./ PFALTZGRAVE BEY
RHEIN/ HERTZOG IN NIDERN VND OBERN BAIRN, hinten
korrespondierend eine nur bei den frühen Ottheinrich-Einbänden
verwendete Spes-Platte, eine Personifikation der Tugend Hoffnung.
Der Band zeigt weiter einen punzierten Goldschnitt, was bei dieser
Buchgattung eher selten vorkommt. Speyer- In einer
kleinen Feierstunde wurde am Dienstag, den 4.6.2013, im
Landesarchiv Speyer die neueste Publikation der „Stiftung zur
Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung“ vorgestellt. Die
Edition von Urkunden zu den Besitzungen, die das in der Eifel
gelegene Zisterzienserkloster Himmerod während im Raum Speyer
hatte, war schon immer ein Herzenswunsch, wie Laudator Prof. Dr.
Hans Ammerich, betonte, da die betreffenden Texte in Form der sehr
seltenen Urkundenrolle (rotulus) in dem von ihm geleiteten
Bistumsarchiv Speyer verwahrt werden. In seinem Einführungsvortrag
beschrieb Prof. Ammerich den Typus der Urkundenrolle – der eine
Rotulus misst ca. 3 Meter und umfasst 58 Urkundenabschriften aus
den Jahren 1194 bis 1262, der andere misst 2 Meter und beinhaltet
zwölf Urkunden von 1258 bis 1274 –, zeigte anhand einer Karte die
Lage der pfälzischen Besitzungen des Klosters auf und beleuchtete
die Frage, warum die Stücke bereits im Mittelalter als Abschriften
der Originale angefertigt wurden.
Speyer- In einer
kleinen Feierstunde wurde am Dienstag, den 4.6.2013, im
Landesarchiv Speyer die neueste Publikation der „Stiftung zur
Förderung der pfälzischen Geschichtsforschung“ vorgestellt. Die
Edition von Urkunden zu den Besitzungen, die das in der Eifel
gelegene Zisterzienserkloster Himmerod während im Raum Speyer
hatte, war schon immer ein Herzenswunsch, wie Laudator Prof. Dr.
Hans Ammerich, betonte, da die betreffenden Texte in Form der sehr
seltenen Urkundenrolle (rotulus) in dem von ihm geleiteten
Bistumsarchiv Speyer verwahrt werden. In seinem Einführungsvortrag
beschrieb Prof. Ammerich den Typus der Urkundenrolle – der eine
Rotulus misst ca. 3 Meter und umfasst 58 Urkundenabschriften aus
den Jahren 1194 bis 1262, der andere misst 2 Meter und beinhaltet
zwölf Urkunden von 1258 bis 1274 –, zeigte anhand einer Karte die
Lage der pfälzischen Besitzungen des Klosters auf und beleuchtete
die Frage, warum die Stücke bereits im Mittelalter als Abschriften
der Originale angefertigt wurden. Dreißig Jahre
akribische Forschungsarbeit öffnen „berührungsfreien“ Zugang zu
1200 Jahren Kulturgeschichte
Dreißig Jahre
akribische Forschungsarbeit öffnen „berührungsfreien“ Zugang zu
1200 Jahren Kulturgeschichte Groß war
deshalb auch die Zahl der interessierten Gäste, die jetzt zur
Präsentation dieses epochalen Werkes in das gemeinsame Foyer von
Landesbibliothk und Landesarchiv in Speyer gekommen waren. Die
Bedeutung des vorgestellten 'Opus magnus' machte nicht allein die
Anwesenheit des Speyerer Oberbürgermeisters Hansjörg
Eger, seines Vorgängers Werner Schineller
und des früheren Speyerer Kulturdezernenten Hanspeter
Brohm deutlich - auch zahlreiche Wissenschaftler,
Historiker und viele Speyerer Bürger waren gekommen.
Groß war
deshalb auch die Zahl der interessierten Gäste, die jetzt zur
Präsentation dieses epochalen Werkes in das gemeinsame Foyer von
Landesbibliothk und Landesarchiv in Speyer gekommen waren. Die
Bedeutung des vorgestellten 'Opus magnus' machte nicht allein die
Anwesenheit des Speyerer Oberbürgermeisters Hansjörg
Eger, seines Vorgängers Werner Schineller
und des früheren Speyerer Kulturdezernenten Hanspeter
Brohm deutlich - auch zahlreiche Wissenschaftler,
Historiker und viele Speyerer Bürger waren gekommen. Dr. Walter
Rummel, Leiter des Landesarchivs in Speyer, ließ schon in
seiner Begrüßung etwas von der großen Bedeutung aufscheinen, die
Siegel seit mehr als 5.000 Jahren und bis heute für die Menschen in
einer zivilisierten Gesellschaft haben. Daraus leite sich auch der
hohe Rang dieses Gesamtverzeichnisses ab, zu dessen Vorstellung an
diesem Tag auch die Direktorin des Landeshauptarchivs in
Koblenz, Dr. Elsbeth André nach Speyer gekommen war. Sie
erinnerte in ihrem Grußwort daran, dass der
„Gatterer-Apparat“ - eine herausragende Sammlung
von rund 4.500 historischen Urkunden, die nach dem von 1759 bis
1799 an der Universität in Göttingen lehrenden
Geschichtswissenschaftler und Begründer der Historischen
Hilfswisssenschaften, Professor Johann Christoph
Gatterer benannt ist, sich erst seit 1997 im Besitz und in
der Obhut des Speyerer Landesarchivs befindet.
Dr. Walter
Rummel, Leiter des Landesarchivs in Speyer, ließ schon in
seiner Begrüßung etwas von der großen Bedeutung aufscheinen, die
Siegel seit mehr als 5.000 Jahren und bis heute für die Menschen in
einer zivilisierten Gesellschaft haben. Daraus leite sich auch der
hohe Rang dieses Gesamtverzeichnisses ab, zu dessen Vorstellung an
diesem Tag auch die Direktorin des Landeshauptarchivs in
Koblenz, Dr. Elsbeth André nach Speyer gekommen war. Sie
erinnerte in ihrem Grußwort daran, dass der
„Gatterer-Apparat“ - eine herausragende Sammlung
von rund 4.500 historischen Urkunden, die nach dem von 1759 bis
1799 an der Universität in Göttingen lehrenden
Geschichtswissenschaftler und Begründer der Historischen
Hilfswisssenschaften, Professor Johann Christoph
Gatterer benannt ist, sich erst seit 1997 im Besitz und in
der Obhut des Speyerer Landesarchivs befindet. Auch sei es
Dr. Debus gewesen, der mit unermüdlicher Überzeugungskraft und
Hartnäckigkeit den auf einer „Mischkalkulation aus kollegialem
Freundschaftspreis und einem am Antiquitätenhandel orientierten
Marktpreis“ basierenden Kaufpreis für den „Gatterer-Apparat“ in
Höhe von 1 Million Schweizer Franken eingeworben habe. Wichtigste
Sponsoren seien dabei die „Kulturstifung der Länder“ und die
„Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz“ gerwesen. Auch zwei
namhafte Unternehmen habe Dr. Debus damals als Sponsoren gewinnen
können. Schließlich habe er noch rund 250.000 D-Mark von
verschiedenen Wirtschaftsverbänden, Kirchen, Kommunen und
Privatpersonen für diesen Erwerb einwerben können, so dass am 10.
Oktober 1986 der Kaufvertrag seitens der rheinland-pfälzischen
Landesregierung unterschrieben und am 18. Februar 1997 der
„Gatterer-Apparat“ ins Landesarchiv nach Speyer verbracht werden
konnte. Steuermittel, so betonte Dr. André, seien in diesem
Zusammenhang nicht geflossen.
Auch sei es
Dr. Debus gewesen, der mit unermüdlicher Überzeugungskraft und
Hartnäckigkeit den auf einer „Mischkalkulation aus kollegialem
Freundschaftspreis und einem am Antiquitätenhandel orientierten
Marktpreis“ basierenden Kaufpreis für den „Gatterer-Apparat“ in
Höhe von 1 Million Schweizer Franken eingeworben habe. Wichtigste
Sponsoren seien dabei die „Kulturstifung der Länder“ und die
„Kulturstiftung des Landes Rheinland-Pfalz“ gerwesen. Auch zwei
namhafte Unternehmen habe Dr. Debus damals als Sponsoren gewinnen
können. Schließlich habe er noch rund 250.000 D-Mark von
verschiedenen Wirtschaftsverbänden, Kirchen, Kommunen und
Privatpersonen für diesen Erwerb einwerben können, so dass am 10.
Oktober 1986 der Kaufvertrag seitens der rheinland-pfälzischen
Landesregierung unterschrieben und am 18. Februar 1997 der
„Gatterer-Apparat“ ins Landesarchiv nach Speyer verbracht werden
konnte. Steuermittel, so betonte Dr. André, seien in diesem
Zusammenhang nicht geflossen. Die Direktorin
des Landeshauptarchivs dankte dem pensionierten Archivdirektor für
dieses einmalige Engagement und bezog darin auch die Fotografin des
Speyerer Landesarchivs, Brigitte Roth, mit ein,
die in einem aufwändigen Prozeß im Fotostudio des Archivs die 2.260
Abbildungen hergestellt habe.
Die Direktorin
des Landeshauptarchivs dankte dem pensionierten Archivdirektor für
dieses einmalige Engagement und bezog darin auch die Fotografin des
Speyerer Landesarchivs, Brigitte Roth, mit ein,
die in einem aufwändigen Prozeß im Fotostudio des Archivs die 2.260
Abbildungen hergestellt habe. In seiner
Vorstellung des umfangreichen „Gatterer-Apparates“ erinnerte
Dr. Debus zunächst daran, dass Prof. Gatterer auf
dem Weg zum Aufbau eines Lehrapparates für seine Studenten zunächst
den Nachlass seines Göttinger Vorgängers Johann David Köhler
übernommen hatte. Dieser habe aus einer umfangreichen Sammlung zu
Numismatik, Diplomatik, Heraldik und Geographie bestanden, mit der
Gatterer den Unterricht für seine Studenten anschaulich machen
wollte. Gatterer konnte dann die übernommene Sammlung durch
Zukäufe, durch Geschenke seiner Studenten sowie durch Widmungen
anderer Institutionen wesentlich erweitern. Die Sammlung umfasst
heute rund 4500 Originalurkunden, wobei etwa 1100 Dokumente aus der
Zeit vor dem Jahr 1400 stammen. Das älteste Pergament ist eine
Urkunde König
In seiner
Vorstellung des umfangreichen „Gatterer-Apparates“ erinnerte
Dr. Debus zunächst daran, dass Prof. Gatterer auf
dem Weg zum Aufbau eines Lehrapparates für seine Studenten zunächst
den Nachlass seines Göttinger Vorgängers Johann David Köhler
übernommen hatte. Dieser habe aus einer umfangreichen Sammlung zu
Numismatik, Diplomatik, Heraldik und Geographie bestanden, mit der
Gatterer den Unterricht für seine Studenten anschaulich machen
wollte. Gatterer konnte dann die übernommene Sammlung durch
Zukäufe, durch Geschenke seiner Studenten sowie durch Widmungen
anderer Institutionen wesentlich erweitern. Die Sammlung umfasst
heute rund 4500 Originalurkunden, wobei etwa 1100 Dokumente aus der
Zeit vor dem Jahr 1400 stammen. Das älteste Pergament ist eine
Urkunde König  Neben
deutschen Ausstellern von Urkunden und Dokumenten finden sich auch
ausländische wie Christina von Schweden oder Ludwig XV. von
Frankreich. Außer Päpsten sind auch Kardinäle, Bischöfe und
päpstliche Legaten unter den Ausstellern. Empfänger der Urkunden
waren zumeist Domkapitel, Bistümer, Klöster, Städte, Gemeinden und
einzelne Adlige.
Neben
deutschen Ausstellern von Urkunden und Dokumenten finden sich auch
ausländische wie Christina von Schweden oder Ludwig XV. von
Frankreich. Außer Päpsten sind auch Kardinäle, Bischöfe und
päpstliche Legaten unter den Ausstellern. Empfänger der Urkunden
waren zumeist Domkapitel, Bistümer, Klöster, Städte, Gemeinden und
einzelne Adlige. All diese
Urkunden waren durch Siegel beglaubigt. Durch die Beschreibungen
und Abbildungen in dem neuen zweibändigen Werk von Dr. Karl Heinz
Debus werden diese Siegel nun interessierten Forschern
„berührungsfei“ zugänglich gemacht. Eine wissenschaftliche
Meisterleistung, für die dem früheren Speyerer Archivdirektor an
diesem Abend viel Lob und Dank zuteil wurde.
All diese
Urkunden waren durch Siegel beglaubigt. Durch die Beschreibungen
und Abbildungen in dem neuen zweibändigen Werk von Dr. Karl Heinz
Debus werden diese Siegel nun interessierten Forschern
„berührungsfei“ zugänglich gemacht. Eine wissenschaftliche
Meisterleistung, für die dem früheren Speyerer Archivdirektor an
diesem Abend viel Lob und Dank zuteil wurde.
 Teilnachlass
der Nachkommen Christian IV., Herzog von Zweibrücken
Teilnachlass
der Nachkommen Christian IV., Herzog von Zweibrücken Die Ike und
Berthold Roland Stiftung Mannheim für Kunst und soziales Engagement
hat 2012 dem Landesbibliothekszentrum einen weiteren Teil des
Nachlasses der Nachkommen von Christian IV. geschenkt, der einen
Umfang von etwa eineinhalb laufenden Metern hat. Er schließt sich
nahtlos an den 1993/94 angekauften Nachlassteil an, rundet diesen
einerseits ab und führt ihn andererseits bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts weiter, als der Lebensmittelpunkt der Nachkommen
endgültig in München lag, wo auch schon Christian und Philipp
Wilhelm von Forbach gestorben waren. Großen Raum nehmen in diesem
Material die Trennung von Christian von Forbach von seiner Frau
Adelaide François Lèontine de Béthune-Pologne (1761-1823) ein, die
er 1783 geheiratet hatte, weiter deren Testament und
Nachlassinventar. Die meisten Unterlagen finden sich zu ihrer
gemeinsamen Tochter Casimire, zur Familie ihres Mannes Gustav Graf
von Sayn-Wittgenstein sowie zu deren Enkelgeneration. Neben
handschriftlichen Briefen von Christian von Forbach, der Tochter
Casimire und des Schwiegersohns Gustav von Sayn-Wittgenstein sind
verschiedene Rechnungsbücher, Ausgabenverzeichnisse, Besitz- und
Palaisinventare bemerkenswert. Hinzu kommen Materialien zu
Vormundschaftsangelegenheiten sowie zu Rechtsstreitigkeiten in
Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung um die Ebenbürtigkeit
zweier sayn-wittgensteinischer Linien.
Die Ike und
Berthold Roland Stiftung Mannheim für Kunst und soziales Engagement
hat 2012 dem Landesbibliothekszentrum einen weiteren Teil des
Nachlasses der Nachkommen von Christian IV. geschenkt, der einen
Umfang von etwa eineinhalb laufenden Metern hat. Er schließt sich
nahtlos an den 1993/94 angekauften Nachlassteil an, rundet diesen
einerseits ab und führt ihn andererseits bis zum Ende des 19.
Jahrhunderts weiter, als der Lebensmittelpunkt der Nachkommen
endgültig in München lag, wo auch schon Christian und Philipp
Wilhelm von Forbach gestorben waren. Großen Raum nehmen in diesem
Material die Trennung von Christian von Forbach von seiner Frau
Adelaide François Lèontine de Béthune-Pologne (1761-1823) ein, die
er 1783 geheiratet hatte, weiter deren Testament und
Nachlassinventar. Die meisten Unterlagen finden sich zu ihrer
gemeinsamen Tochter Casimire, zur Familie ihres Mannes Gustav Graf
von Sayn-Wittgenstein sowie zu deren Enkelgeneration. Neben
handschriftlichen Briefen von Christian von Forbach, der Tochter
Casimire und des Schwiegersohns Gustav von Sayn-Wittgenstein sind
verschiedene Rechnungsbücher, Ausgabenverzeichnisse, Besitz- und
Palaisinventare bemerkenswert. Hinzu kommen Materialien zu
Vormundschaftsangelegenheiten sowie zu Rechtsstreitigkeiten in
Zusammenhang mit einer Auseinandersetzung um die Ebenbürtigkeit
zweier sayn-wittgensteinischer Linien. Speyerer LBZ
präsentiert deutsche Übersetzung eines außergewöhnlichen
Werkes
Speyerer LBZ
präsentiert deutsche Übersetzung eines außergewöhnlichen
Werkes Der
wissenschaftliche Wert dieser Denkschrift, so Prof. Dr. Musall in
seinem Vortrag, liege insbesondere in den detaillierten
Beschreibungen des von den Truppen durchquerten Geländes und der
logistischen Probleme, die bei Truppenbewegungen größeren Umfangs
im 18. Jahrhundert zu lösen waren. Die Schilderungen in dem Werk
böten damit zusätzliche, weit über die üblichen Operationsjournale
hinausgehende Informationen zum Kriegsschauplatz, wo es ein
Hauptanliegen der Truppenführung sein musste, so gut wie möglich
für die Verpflegung der Truppen und ganz besonders auch für
Futtervorräte für die große Anzahl mitgeführter Pferde usw. in
feindlichem Gebiet zu sorgen.
Der
wissenschaftliche Wert dieser Denkschrift, so Prof. Dr. Musall in
seinem Vortrag, liege insbesondere in den detaillierten
Beschreibungen des von den Truppen durchquerten Geländes und der
logistischen Probleme, die bei Truppenbewegungen größeren Umfangs
im 18. Jahrhundert zu lösen waren. Die Schilderungen in dem Werk
böten damit zusätzliche, weit über die üblichen Operationsjournale
hinausgehende Informationen zum Kriegsschauplatz, wo es ein
Hauptanliegen der Truppenführung sein musste, so gut wie möglich
für die Verpflegung der Truppen und ganz besonders auch für
Futtervorräte für die große Anzahl mitgeführter Pferde usw. in
feindlichem Gebiet zu sorgen. Im Teil I des
Werkes ssind der vollständige Text der Denkschrift einschließlich
der darin enthaltenen Karten enthalten. In Teil II werde zunächst
der Verlauf des Polnischen Thronfolgekrieges (1733–1737/38)
geschildert, um die in der Denkschrift erwähnten Ereignisse besser
einordnen zu können. Es folgen Ausführungen zur Praxis der
damaligen Kriegführung mit den sich dabei bei allen Heeren dieser
Zeit ergebenden Problemen und zu den speziellen Tätigkeiten der
Militäringenieure.
Im Teil I des
Werkes ssind der vollständige Text der Denkschrift einschließlich
der darin enthaltenen Karten enthalten. In Teil II werde zunächst
der Verlauf des Polnischen Thronfolgekrieges (1733–1737/38)
geschildert, um die in der Denkschrift erwähnten Ereignisse besser
einordnen zu können. Es folgen Ausführungen zur Praxis der
damaligen Kriegführung mit den sich dabei bei allen Heeren dieser
Zeit ergebenden Problemen und zu den speziellen Tätigkeiten der
Militäringenieure.

 Einbandforscher
zu Gast im Landesbibliothekszentrum Speyer
Einbandforscher
zu Gast im Landesbibliothekszentrum Speyer Für die
Vorträge an den beiden Veranstaltungstagen hatte die Deutsche
Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) ihre Aula zur
Verfügung gestellt - die DUV liegt gleich gegenüber der
Landesbibliothek. Im ersten Vortragsblock standen die Bestände der
Bibliotheca Bipontina im Mittelpunkt: Zum einen stellte die
Leiterin, Dr. Sigrid Hubert-Reichling, Supralibros und andere
Besitzeintragungen im Bestand der herzoglichen Zweibrücker
Bibliothek vor, zum anderen zeigte Restauratorin Petra Brickmann
(LBZ Speyer) kurioses Deckelmaterial, auf das sie bei
Restaurierungsarbeiten gestoßen war. Anschließend befasste sich
Annelen Ottermann (StB Mainz) mit ihren Entdeckungen an Einbänden
aus der ehemaligen Bibliothek der Mainzer Karmeliten. Im einem
weiteren Vortrag ging es um Silberbeschläge an armenischen
Prachteinbänden, auf die Margret Jaschke (Daisendorf) und Prof. Dr.
Robert Stähle (Aichwald) bei Restaurierungsarbeiten in Yerewan
gestoßen waren.
Für die
Vorträge an den beiden Veranstaltungstagen hatte die Deutsche
Universität für Verwaltungswissenschaften (DUV) ihre Aula zur
Verfügung gestellt - die DUV liegt gleich gegenüber der
Landesbibliothek. Im ersten Vortragsblock standen die Bestände der
Bibliotheca Bipontina im Mittelpunkt: Zum einen stellte die
Leiterin, Dr. Sigrid Hubert-Reichling, Supralibros und andere
Besitzeintragungen im Bestand der herzoglichen Zweibrücker
Bibliothek vor, zum anderen zeigte Restauratorin Petra Brickmann
(LBZ Speyer) kurioses Deckelmaterial, auf das sie bei
Restaurierungsarbeiten gestoßen war. Anschließend befasste sich
Annelen Ottermann (StB Mainz) mit ihren Entdeckungen an Einbänden
aus der ehemaligen Bibliothek der Mainzer Karmeliten. Im einem
weiteren Vortrag ging es um Silberbeschläge an armenischen
Prachteinbänden, auf die Margret Jaschke (Daisendorf) und Prof. Dr.
Robert Stähle (Aichwald) bei Restaurierungsarbeiten in Yerewan
gestoßen waren. Dort begrüßte
der Oberbürgermeister die Gäste und gab ihnen eine Einführung in
die Geschichte von Stadt und Rathaus. Die Stadt befinde sich in
einer ständigen Suche nach Spuren ihrer eigenen Geschichte, so Eger
– zuletzt bei Grabungen vor dem Kaiser- und Mariendom. Diese
Kathedrale bezeichnete er zugleich auch als den wohl bedeutendsten
„Einband“ in der Stadt, umrahme er doch das wichtigste Dokument in
der Stadtgeschichte – den „Freiheitsbrief“ von Kaiser Heinrich V.
aus dem Jahr 1111, der den Bürgern der Stadt Speyer besondere
Rechte eingeräumt habe.
Dort begrüßte
der Oberbürgermeister die Gäste und gab ihnen eine Einführung in
die Geschichte von Stadt und Rathaus. Die Stadt befinde sich in
einer ständigen Suche nach Spuren ihrer eigenen Geschichte, so Eger
– zuletzt bei Grabungen vor dem Kaiser- und Mariendom. Diese
Kathedrale bezeichnete er zugleich auch als den wohl bedeutendsten
„Einband“ in der Stadt, umrahme er doch das wichtigste Dokument in
der Stadtgeschichte – den „Freiheitsbrief“ von Kaiser Heinrich V.
aus dem Jahr 1111, der den Bürgern der Stadt Speyer besondere
Rechte eingeräumt habe. Andreas
Wittenberg, verantwortlicher Bibliothekar für die Einbandforschung
an der Berliner Staatsbibliothek, bedankte sich namens seiner
Kolleginnen und Kollegen für den freundlichen Empfang an so
repräsentativer Stelle und bemerkte, dass Speyer bei den
Einband-Spezialisten nicht erst seit dieser Tagung einen guten
Namen habe. Als Erinnerungsgeschenk hatte Wittenberg ein Exemplar
des zum 350jährigen Jubiläum der Berliner Staatsbibliothek
veröffentlichten Kataloges mitgebracht.
Andreas
Wittenberg, verantwortlicher Bibliothekar für die Einbandforschung
an der Berliner Staatsbibliothek, bedankte sich namens seiner
Kolleginnen und Kollegen für den freundlichen Empfang an so
repräsentativer Stelle und bemerkte, dass Speyer bei den
Einband-Spezialisten nicht erst seit dieser Tagung einen guten
Namen habe. Als Erinnerungsgeschenk hatte Wittenberg ein Exemplar
des zum 350jährigen Jubiläum der Berliner Staatsbibliothek
veröffentlichten Kataloges mitgebracht. Rheinland-Pfalz
komplettiert seinen Besitz an Zeugnissen des bedeutenden
Impressionisten
Rheinland-Pfalz
komplettiert seinen Besitz an Zeugnissen des bedeutenden
Impressionisten Im
Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Speyer wurde jetzt einer großen
Zahl von Kunstfreunden ein erster Blick auf den schriftlichen
Nachlass des Malers gewährt, den das Land Rheinland-Pfalz vor
kurzem aus Mitteln der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz und der
Kulturstiftung der Länder aus dem Besitz der Familie Slevogt
erwerben konnte. “Wir wollten mit dieser Präsentation nicht warten,
bis eine abschließende Aufarbeitung dieses Aufsehen erregenden
Konvoluts erfolgt ist”, erklärte mit launig-humorigen Worten der
zuständige Kultur-Staatssekretär Walter Schumacher
vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur, der eigens zu diesem Anlass aus Mainz
nach Speyer gekommen war.
Im
Landesbibliothekszentrum (LBZ) in Speyer wurde jetzt einer großen
Zahl von Kunstfreunden ein erster Blick auf den schriftlichen
Nachlass des Malers gewährt, den das Land Rheinland-Pfalz vor
kurzem aus Mitteln der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz und der
Kulturstiftung der Länder aus dem Besitz der Familie Slevogt
erwerben konnte. “Wir wollten mit dieser Präsentation nicht warten,
bis eine abschließende Aufarbeitung dieses Aufsehen erregenden
Konvoluts erfolgt ist”, erklärte mit launig-humorigen Worten der
zuständige Kultur-Staatssekretär Walter Schumacher
vom rheinland-pfälzischen Ministerium für Bildung, Wissenschaft,
Weiterbildung und Kultur, der eigens zu diesem Anlass aus Mainz
nach Speyer gekommen war. Zuvor schon
hatte LBZ-Direktor Dr. Helmut Frühauf unter den Gästen mit
besonderer Herzlichkeit Eva Emanuel-Slevogt, eine Nachfahrin des
großen Malers und den wohl bedeutensten lebenden Kenner des Werkes
von Max Slevogt, den Kunsthistoriker und Kultur-Manager Dr.
Berthold Roland, begrüßt.
Zuvor schon
hatte LBZ-Direktor Dr. Helmut Frühauf unter den Gästen mit
besonderer Herzlichkeit Eva Emanuel-Slevogt, eine Nachfahrin des
großen Malers und den wohl bedeutensten lebenden Kenner des Werkes
von Max Slevogt, den Kunsthistoriker und Kultur-Manager Dr.
Berthold Roland, begrüßt. Von den 1880er
Jahren bis zum Tod des Malers dokumentieren die Blätter den
Aufstieg Slevogts - eingebunden in ein vielfältiges
Beziehungsgeflecht, das ihn mit zahlreichen Künstlerfreunden und
Prominenten seiner Zeit verband. Vom Studentenausweis an der
Akademie der Künste in München bis hin zu dem Kondolenztelegramm,
das Reichspräsident von Hindenburg der Witwe des Malers zu dessen
Tod übermittelte, reichen die Lebenszeugnisse Slevogts, die jetzt
in Speyer ihre neue Heimat gefunden haben.
Von den 1880er
Jahren bis zum Tod des Malers dokumentieren die Blätter den
Aufstieg Slevogts - eingebunden in ein vielfältiges
Beziehungsgeflecht, das ihn mit zahlreichen Künstlerfreunden und
Prominenten seiner Zeit verband. Vom Studentenausweis an der
Akademie der Künste in München bis hin zu dem Kondolenztelegramm,
das Reichspräsident von Hindenburg der Witwe des Malers zu dessen
Tod übermittelte, reichen die Lebenszeugnisse Slevogts, die jetzt
in Speyer ihre neue Heimat gefunden haben. Dr. Schlechter
gewährte schließlich auch Einblicke in die noch anstehenden und
notwendigen inhaltlich-historischen Recherche-Arbeiten sowie in die
Aufwendungen, die noch für die Sicherung der Blätter zu leisten
sind. Dabei wies er auf den insgesamt recht guten Zustand der
Briefe hin. Abgesehen von seltenen Fällen von Tintenfraß sowie von
Fraßspuren von Silberfischen an verschiedenen Blatträndern gehe es
deshalb vor allem um die Konservierung des Nachlasses für die
Nachwelt, sodass er auch für nachfolgende Generationen als
singuläre Quelle - zum Beispiel für die Erstellung künftiger
biographischer Arbeiten - bereit stehe.
Dr. Schlechter
gewährte schließlich auch Einblicke in die noch anstehenden und
notwendigen inhaltlich-historischen Recherche-Arbeiten sowie in die
Aufwendungen, die noch für die Sicherung der Blätter zu leisten
sind. Dabei wies er auf den insgesamt recht guten Zustand der
Briefe hin. Abgesehen von seltenen Fällen von Tintenfraß sowie von
Fraßspuren von Silberfischen an verschiedenen Blatträndern gehe es
deshalb vor allem um die Konservierung des Nachlasses für die
Nachwelt, sodass er auch für nachfolgende Generationen als
singuläre Quelle - zum Beispiel für die Erstellung künftiger
biographischer Arbeiten - bereit stehe..jpg) Liedermacher
Oskar “Oss” Kröher zu Gast im Speyerer
Landesbibiothekszentrum
Liedermacher
Oskar “Oss” Kröher zu Gast im Speyerer
Landesbibiothekszentrum.jpg) Das konnte
man jetzt bei dem Leseabend im Speyerer Landesbibliothekszentrum,
der “alten LaBi” erleben, als Oskar “Oss” Kröher zutiefst
berührende Auszüge aus seinem neuesten Buch “Auf irren Pfaden durch
die Hungerzeit” las. Das Foyer der LaBi war schon lange vor Beginn
des Abends bis auf den letzten Platz gefüllt, so dass noch
zusätzliche Stühle aus dem ganzen Haus herbeigeschafft werden
mußten. Ute Bahrs, Leiterin der LaBi in Speyer, zeigte sich in
ihrer Begrüßung von diesem Ansturm völlig überwältigt und bekannte,
als geborene Norddeutsche im Jahr 2004 beim letzten Besuch von Oss
Kröher in ihrem Hause, noch nichts von der ungemeinen Faszination
geahnt zu haben, die von dem Liedermacher, Sänger und Literat in
der Pfalz und weit darüber hinaus ausgehe. Dass er an diesem Tag
wieder zu Gast sei, dafür dankte sie an erster Stelle dem Initiator
der Lesung, Buchhändler Patrick Boucher aus der Speyerer
Buchhandlung Fröhlich.
Das konnte
man jetzt bei dem Leseabend im Speyerer Landesbibliothekszentrum,
der “alten LaBi” erleben, als Oskar “Oss” Kröher zutiefst
berührende Auszüge aus seinem neuesten Buch “Auf irren Pfaden durch
die Hungerzeit” las. Das Foyer der LaBi war schon lange vor Beginn
des Abends bis auf den letzten Platz gefüllt, so dass noch
zusätzliche Stühle aus dem ganzen Haus herbeigeschafft werden
mußten. Ute Bahrs, Leiterin der LaBi in Speyer, zeigte sich in
ihrer Begrüßung von diesem Ansturm völlig überwältigt und bekannte,
als geborene Norddeutsche im Jahr 2004 beim letzten Besuch von Oss
Kröher in ihrem Hause, noch nichts von der ungemeinen Faszination
geahnt zu haben, die von dem Liedermacher, Sänger und Literat in
der Pfalz und weit darüber hinaus ausgehe. Dass er an diesem Tag
wieder zu Gast sei, dafür dankte sie an erster Stelle dem Initiator
der Lesung, Buchhändler Patrick Boucher aus der Speyerer
Buchhandlung Fröhlich..jpg) Und als er
dann in einer weiteren Episode schilderte, welches Unrecht
Jugendliche - Kinder eigentlich noch, die bei Kriegsende gerade
einmal 15 Jahre alt waren - als Gefangene in den provisorischen
Gefängnissen der Surété, des französischen Sicherheitsdienstes,
erleiden mußten, da wischte sich so manch einer der Zuhörer
verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Oss Kröher erinnerte an
das Schicksal von Günther Klein, der mit ansehen mußte, wie ein
Häftling im Gefängnis von dem Surété-Chef einfach mit den Fäusten
erschlagen wurde. “Da gab es keine Beschuldigung, keine Anklage,
keinen Prozess und kein Urteil”. Als jüngster der durch
Denunziation ins Gefängnis geratenen Jugendlichen mußte Klein am
längsten ausharren, bis er durch einen Zufall beim Einüben von
Fahrtenliedern mit seinen Mitgefangenen einem Lehrer auffiel und
durch ihn aus seiner durch nichts gerechtfertigten Haft erlöst
werden konnte.
Und als er
dann in einer weiteren Episode schilderte, welches Unrecht
Jugendliche - Kinder eigentlich noch, die bei Kriegsende gerade
einmal 15 Jahre alt waren - als Gefangene in den provisorischen
Gefängnissen der Surété, des französischen Sicherheitsdienstes,
erleiden mußten, da wischte sich so manch einer der Zuhörer
verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel. Oss Kröher erinnerte an
das Schicksal von Günther Klein, der mit ansehen mußte, wie ein
Häftling im Gefängnis von dem Surété-Chef einfach mit den Fäusten
erschlagen wurde. “Da gab es keine Beschuldigung, keine Anklage,
keinen Prozess und kein Urteil”. Als jüngster der durch
Denunziation ins Gefängnis geratenen Jugendlichen mußte Klein am
längsten ausharren, bis er durch einen Zufall beim Einüben von
Fahrtenliedern mit seinen Mitgefangenen einem Lehrer auffiel und
durch ihn aus seiner durch nichts gerechtfertigten Haft erlöst
werden konnte..jpg) Und noch
eine nach dem Krieg entstandene oder - besser gesagt - wieder
entstandene Freundschaft kam zur Sprache, als Oss Kröher sich an
seinen Einstieg ins Berufsleben erinnerte: Mangels anderer
Möglichkeiten - Studieren war aus wirtschaftlichen Gründen nicht
drin und er wurde erst in späteren Jahren Lehrer - absolvierte er
nämlich zunächst eine Ausbildung zum Kaufmännischen Angestellten
und Kalkulator in einer Pirmasenser Schuhfabrik - war “der
Seniorstift mit Abitur” - ein Zustand, der so gar nichts mit seinen
eigentlichen Neigungen zu Literatur, Musik und Reisen gemein hatte.
Als dann sein alter Schulfreund Gustav Pfirrmann bei ihm auftauchte
- selbst bereits Student der Volkswirtschaftslehre mit
Auslandserfahrung - und ihm eine gemeinsame Reise nach Indien
vorschlug, da war’s bald vorbei mit der kaufmännischen “Karriere”.
Nach seiner Gehilfenprüfung brachen die beiden im Motorrad auf zu
einer abenteuerlichen Reise auf dem Motorrad von Pirmasens nach
Kalkutta. Doch das ist dann schon wieder eine andere, eine
phantastische Geschichte...
Und noch
eine nach dem Krieg entstandene oder - besser gesagt - wieder
entstandene Freundschaft kam zur Sprache, als Oss Kröher sich an
seinen Einstieg ins Berufsleben erinnerte: Mangels anderer
Möglichkeiten - Studieren war aus wirtschaftlichen Gründen nicht
drin und er wurde erst in späteren Jahren Lehrer - absolvierte er
nämlich zunächst eine Ausbildung zum Kaufmännischen Angestellten
und Kalkulator in einer Pirmasenser Schuhfabrik - war “der
Seniorstift mit Abitur” - ein Zustand, der so gar nichts mit seinen
eigentlichen Neigungen zu Literatur, Musik und Reisen gemein hatte.
Als dann sein alter Schulfreund Gustav Pfirrmann bei ihm auftauchte
- selbst bereits Student der Volkswirtschaftslehre mit
Auslandserfahrung - und ihm eine gemeinsame Reise nach Indien
vorschlug, da war’s bald vorbei mit der kaufmännischen “Karriere”.
Nach seiner Gehilfenprüfung brachen die beiden im Motorrad auf zu
einer abenteuerlichen Reise auf dem Motorrad von Pirmasens nach
Kalkutta. Doch das ist dann schon wieder eine andere, eine
phantastische Geschichte...
 Eine
historische Reise in Karikaturen durch vier Jahrhunderte
Eine
historische Reise in Karikaturen durch vier Jahrhunderte Prof. Dr.
Ursula E. Koch, langjährige Professorin für Germanistik und
Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München und ausgewiesene Kennerin dieses ganz besonderen Genres
künstlerischer Beleuchtung aktuellen Zeitgeschehens hat diese
Ausstellung in vorzüglicher Weise kuratiert. Aus einem fast
unüberschaubaren Konvolut bedeutender Blätter aus beiden Ländern
hat sie 85 der qualitätvollsten ausgewählt und sie auf eine
“Tournee” geschickt, auf der sie zwischenzeitlich schon an 40 Orten
in Frankreich und Deutschland gezeigt wurden, auf der sie aber auch
nach Serbien und Montenegro gelangten und jetzt nach einem
“Abstecher” in die Türkei in Speyer einkehrten.
Prof. Dr.
Ursula E. Koch, langjährige Professorin für Germanistik und
Kommunikationswissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität in
München und ausgewiesene Kennerin dieses ganz besonderen Genres
künstlerischer Beleuchtung aktuellen Zeitgeschehens hat diese
Ausstellung in vorzüglicher Weise kuratiert. Aus einem fast
unüberschaubaren Konvolut bedeutender Blätter aus beiden Ländern
hat sie 85 der qualitätvollsten ausgewählt und sie auf eine
“Tournee” geschickt, auf der sie zwischenzeitlich schon an 40 Orten
in Frankreich und Deutschland gezeigt wurden, auf der sie aber auch
nach Serbien und Montenegro gelangten und jetzt nach einem
“Abstecher” in die Türkei in Speyer einkehrten. Eine
sehenswerte Ausstellung, in der einem so vieles auf höchstem Niveau
begegnet: Feinste zeichnerische Kunstfertigkeit, köstlicher Humor,
ätzende Satire, Schlagfertigkeit und durchaus auch freche Antworten
auf zu ihrer Zeit aktuelle Fragen.
Eine
sehenswerte Ausstellung, in der einem so vieles auf höchstem Niveau
begegnet: Feinste zeichnerische Kunstfertigkeit, köstlicher Humor,
ätzende Satire, Schlagfertigkeit und durchaus auch freche Antworten
auf zu ihrer Zeit aktuelle Fragen.

 Mit berechtigtem Stolz konnte
jetzt die Leitung des Landesbibliothekszentrums eine neue
Kostbarkeit ihrer Autographen-Sammlung präsentieren: Es handelt
sich dabei um 29 eigenhändige Briefe des legendären
Friedensnobelpreisträgers und Universalgelehrten Dr. Albert
Schweitzer, die das LBZ mit Unterstützung der Kulturstiftung
Speyer und der Sparkassenstiftung Speyer, des Rotary-Clubs Speyer
sowie zweier spontaner Privatspender bei einer Auktion in Berlin
ersteigern konnte. (Der SPEYER-KURIER berichtete)
Mit berechtigtem Stolz konnte
jetzt die Leitung des Landesbibliothekszentrums eine neue
Kostbarkeit ihrer Autographen-Sammlung präsentieren: Es handelt
sich dabei um 29 eigenhändige Briefe des legendären
Friedensnobelpreisträgers und Universalgelehrten Dr. Albert
Schweitzer, die das LBZ mit Unterstützung der Kulturstiftung
Speyer und der Sparkassenstiftung Speyer, des Rotary-Clubs Speyer
sowie zweier spontaner Privatspender bei einer Auktion in Berlin
ersteigern konnte. (Der SPEYER-KURIER berichtete)
