Konzert am Nachmittag - Programm 2. Halbjahr
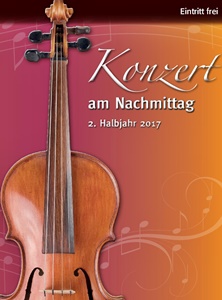 Speyer- Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ des
Seniorenbüros Speyer besteht 2017 zehn Jahre. In dieser Zeit sind
diese Veranstaltungen zu einem festen Bestandteil der Speyerer
Kultur geworden. Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf
alle gesellschaftlichen Bereiche. Wenn es also abends mehr und mehr
Menschen gibt, die nicht mehr gerne aus dem Haus gehen, dann muss
es auch tagsüber ein interessantes und qualitatives gutes Programm
geben.
Speyer- Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ des
Seniorenbüros Speyer besteht 2017 zehn Jahre. In dieser Zeit sind
diese Veranstaltungen zu einem festen Bestandteil der Speyerer
Kultur geworden. Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf
alle gesellschaftlichen Bereiche. Wenn es also abends mehr und mehr
Menschen gibt, die nicht mehr gerne aus dem Haus gehen, dann muss
es auch tagsüber ein interessantes und qualitatives gutes Programm
geben.
In den zehn Jahren hat sich bewährt, dass ein Bedarf an solchen
Konzerten am Nachmittag ist. Die Besucher kommen gerne. Es ist dem
Seniorenbüro bis jetzt auch immer gelungen ein interessantes
Programm zusammenzustellen, immer mit einer anderen Besetzung.
Erstmals steht die Reihe 2017 unter einem Motto und zwar
Weltmusik.
Auch im zweiten Halbjahr ist es dem Seniorenbüro gelungen
entsprechende Konzerte zu organisieren.
Programm
Donnerstag, 24. August
2017
Zeitreise - Musik aus verschiedenen Kulturen
Rolf Verres, Konzertflügel und Percussion
Peter Hess, Gong, Indische Tabla, Digeridoo, Obertongesang
Jochen Sattler, Querflöte, Bambusflöte, Mundorgel, Digeridoo,
Trommeln
Historischer Ratssaal, 15 Uhr
Montag, 18. September
2017
The good life
Mit der Gruppe Jazz à la flute
Isabelle Bodenseh, Querflöten
Lorenzo Petrocca, Gitarre
Historischer Ratssaal, 15 Uhr
Mittwoch, 4. Oktober
2017
Die Winde des Mittelmeers und Ihre Geschichte
Tambur Duo
Hozan Tamburwan, Baglama und Gesang
Santino Scavelli, Perkussion
Historischer Ratssaal, 15 Uhr
Mittwoch, 8. November
2017
Neue Flamencos – Klassische Musik
Mit dem Spanischen Quintett , CONCUERDA Y MÁS
Daniel Yagüe, Flamencogitarre
José Carlos Martín, Geige
José Manuel Jiménez, Geige
Amparo Mas, Cello
José Antonio García, Kontrabass
Historischer Ratssaal, 15 Uhr
Dieses Konzert findet im Rahmen der Demografiewoche
Rheinland-Pfalz statt.
Donnerstag, 14. Dezember
2017
Wo Musik erklingt, da lass dich nieder
-Es ist ein Ros´entsprungen-
Kleine Wunder in der kalten Jahreszeit
Duo Marmor
Theresa Braisch, Klarinette
Maximilian Braisch, Fagott
Historischer Ratssaal, 15 Uhr
Dieses Konzert ist für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.
Es ist aber offen für alle, die Musik lieben
Der Eintritt zu allen Konzerten ist kostenfrei.
Seniorenbüro der Stadt Speyer
13.07.2017
Hilfe für Senioren bei Problemen mit dem eigenen Computer
Speyer- Das Seniorenbüro der Stadt Speyer bietet jeden
Dienstag eine Computersprechstunde an.
Bei Geräte- Störungen, Fehlermeldungen, Installationen,
Anwendungen oder Hochrüstungen von Programmen oder Apps stehen
ihnen erfahrene Tutoren zur Seite. Wenn möglich Problemgeräte bitte
mitbringen.
10:00 bis 11:30 Uhr in den Räumen des F@irnet-
Cafés, Ludwigsstr. 15b
Text: Stadt Speyer, Seniorenbüro
22.09.2016
Abenteuer Kultur wagen
 Kulturelle
Teilhabe für Menschen mit Demenz
Kulturelle
Teilhabe für Menschen mit Demenz
Speyer- Erneut war das Purrmann-Haus Besuchsort
für Menschen mit Demenz. Die Lokale Allianz für Menschen mit
Demenz, koordiniert und moderiert über das Seniorenbüro,
organisierte diese besondere Veranstaltung. Acht Betroffene und
ihre Begleitpersonen aus vier Speyerer stationären Einrichtungen
waren eingeladen, gemeinsam Kunstwerke des Museums zu entdecken.
Aber zunächst wurden die Gäste in dem einladenden Innenhof von Frau
Maria Leitmeyer, der Kustodin des Purrmann-Hauses, empfangen.
Leonard Holler (Violine) und Jannik Geiß (Gitarre) von der
Musikschule der Stadt Speyer sorgten mit ihrem Spiel für eine
angenehme Atmosphäre. Die beiden Schüler hatten eine Musikauswahl
getroffen, die Ruhe ausstrahlte und anfänglich bestehende Ängste
bei den Menschen mit Demenz, löste. Livemusik im Freien zu erleben,
mit frischen Melonenstückchen und Getränken verwöhnt zu werden,
waren erste positive Erfahrungen. Maria Leitmeyer erklärte kurz das
Haus und berichtete auf humorvolle Weise aus dem Leben von
Hans Purrmann. Das Zusammenspiel von Musik,
Umgebung und dem herzlichen Zugehen auf Menschen mit Demenz sorgten
dafür, dass eine sehr angenehme Atmosphäre entstehen konnte. Die
ist gerade bei Menschen mit Demenz sehr wichtig.
Nach der Begrüßungsrunde im Freien wurde das Abenteuer Kultur im
Purrmann-Haus fortgesetzt. Wieder spielte die Musik, die die
Besucher nun zum Mitsingen anregte. Passend zu einem
Blumenstillleben wurden kleine Rosen verteilt. Erinnerungen wurden
geweckt. „Am Geburtstag verschenk ich immer Blumen“, erzählte eine
Besucherin. „Den Tisch hab ich immer mit Blumen geschmückt“,
erinnerte sich eine andere Frau. Den leuchtenden Augen war
anzusehen, mit wieviel Freude sich die Gäste auf die gemeinsame
Entdeckungsreise einlassen konnten. Maria Leitmeyer ging gefühlvoll
und immer wieder wertschätzend auf die Äußerungen der Menschen mit
Demenz ein.
Passend zum zweiten Gemälde, das gemeinsam mit Menschen mit
Demenz entdeckt werden sollte, war auf einem Tischlein ein
Stillleben nachgebildet. Dieses sahen sich die Besucherinnen und
Besucher neugierig an. Aber sie konnten die Dinge, die darauf
standen auch anfassen, daran riechen. Ein Kürbis weckte bei einem
Teilnehmer Erinnerungen an vergangene Zeiten. „Das waren
riesengroße Kürbisse, die wir hatten. Und schwer waren die auch. So
einfach wegtragen konnte man die nicht, da hat man Handkarren
gebraucht“, erzählte ein Mann ganz eifrig. Der von Maria Leitmeyer
rumgereichte Pfirsich löste wahre Freude aus. „Die habe ich immer
eingekocht. Wie gut die riechen“, war von den Besuchern zu hören.
Spürbar und sichtbar war die Freude, mit der die Menschen mit
Demenz sich auf das erneute Abenteuer Kultur einlassen konnten.
Dank der großzügigen Blumenspende von Alexandra Remus von Blume
und Gestaltung, konnte sich jeder Besucher, in einer abschließenden
Runde im Innenhof, ein Blumensträußchen zusammenstellen und mit
nach Hause nehmen. „Ich kann nur danke sagen“, bemerkte eine Frau
begeistert. Und eine andere fragte: „Ist das nur einmal im
Jahr“?
Nein, das Angebot „Abenteuer Kultur wagen“ soll öfter
stattfinden. In einem gemeinsamen Erfahrungsaustausch mit Jochen
Schmauck-Langer von dementia + art Köln wurde Anfang August
konzeptionell weitergearbeitet. Ende August 2016 läuft das
Modellprojekt „Lokale Allianz für Menschen mit Demenz“ aus. Danach
wird es weitergehen. Das steht für alle Beteiligten fest. Die
Verbindung zwischen Kultureinrichtungen, Kulturschaffenden und dem
Pflegebereich ist eine Bereicherung für beide Seiten und ermöglicht
eine neue Teilhabe für Menschen mit Demenz.
Text: Ria Krampitz; Foto: spk Archiv
12.08.2016
Großmutter wird mit der Sense rasiert
 Erdbeerfest mit Musik, Gedichte, Kuchen und Bowle bereichert den Nachmittag von demenzkranken Senioren.
Erdbeerfest mit Musik, Gedichte, Kuchen und Bowle bereichert den Nachmittag von demenzkranken Senioren.
Erdbeerfest im Altenzentrum holt Menschen aus
der Demenz
Schifferstadt- Die Stimmung im
Garten des Caritas-Altenzentrums St. Matthias in Schifferstadt ist
gut, fast schon ausgelassen, es wird ja auch Erdbeerfest gefeiert.
Mit allem Drum und Dran, mit Musik, Erdbeerkuchen und Erdbeerbowle.
Dennoch ist dieses Fest kein ganz alltägliches Sommerfest, denn die
Bewohner, die im hübsch geschmückten Pavillon an der Kaffeetafel
Platz genommen haben, kommen von der Demenzstation.
Dietmar Schöffel greift zur Gitarre und stimmt das erste Lied
an: „Im Märzen der Bauer“. Schon fallen die ersten Bewohner mit
ein. Einige singen leise vor sich hin, andere aus vollem Hals.
Simone Joder, Mitarbeiterin der Sozialbetreuung, schmunzelt und
erklärt: „Manche singen leidenschaftlich gern, leidenschaftlich
laut und leidenschaftlich falsch.“ Das macht gar nichts, im
Gegenteil, die gute Laune steckt an. Einige fangen an, im Takt mit
zu klatschen und nach dem Lied gibt es Bravo-Rufe. Simone Joder
nutzt eine Pause, möchte ein Erdbeergedicht vorlesen, beginnt mit
den Worten: „Darf ich ein paar Worte sagen?“ „Ja was soll ich da
schon sagen“, antwortet spontan ein Bewohner. „Mir tun die Füße
weh“, murmelt eine andere. „Hallo!“ sagt die nächste zum x-ten Mal.
Die ganze Situation mutet vielleicht ein bisschen schrullig an,
aber was vor allem hängen bleibt, ist das Gefühl, dass es den
Bewohnern jetzt im Augenblick gut geht.
Nach ein paar weiteren Liedern sagt eine Bewohnerin: „Jetzt wär
ein Kaffee recht“. Also wird der Erdbeerkuchen aufgetragen. „Ist er
schön? Ah ja, mit einem Schuss Sahne“, murmelt sie anerkennend.
„Meine Tante liebt das Essen hier im Heim und das, obwohl sie
früher ganz schön schnäkisch war“, sagt die Nichte der Bewohnerin,
die zum Fest gekommen ist. Heute schmeckt es allen. Simone Joder,
Iris Müller und Martina Heil haben alle im Blick, füllen
Kaffeetassen ein zweites Mal, bringen Kuchen für die, die gerne ein
zweites Stück hätten, reichen den Bewohnern, die nicht mehr allein
essen können, geduldig den Kuchen an, erinnern andere, die
vergessen haben, dass da ein Kuchen vor ihnen steht und drücken
ihnen die Gabel in die Hand. Später gibt es noch ein oder zwei
Gläser Erdbeerbowle. Einige Bewohner haben mitgeholfen die Früchte
zu schneiden. „Es ist alkoholfreier Sekt“, verrät Simon Joder
leise.
Dietmar Schöffel hat die Gitarre zur Seite gestellt und macht
eine kurze Pause, essen und singen gleichzeitig geht schließlich
nicht. Er kommt jede Woche ehrenamtlich ins Altenzentrum und singt
mit den Senioren. In der Regel hat er da auch seinen Hund Buddy mit
dabei. Die Bewohner lieben das, singen mit ihm und stellen schon
Leckerlis für Buddy bereit. Der Hund ist heute zu Hause geblieben.
„Es ist so schön, wenn man alte Volkslieder singen kann und die
Texte sind den Bewohnern wohl bekannt. Manche kennen wirklich jedes
Lied“, sagt Schöffel.
 Bald ist er wieder gefragt. Weiter geht’s mit Liedern.
Manchmal entwickeln die Bewohner eine Eigendynamik. Bei „Freut Euch
des Lebens“, stimmt erst eine die „Großmutter wird mit der Sense
rasiert“-Version an. Das kennen auch die Herren, fallen mit ein und
schon hat der stattliche Chor Dietmar Schöffel übertönt. Simone
Joder und ihre Kolleginnen sind mittendrin im Geschehen, nehmen
immer wieder mal einen der Bewohner herzlich in den Arm, schunkeln
zum Takt der Lieder oder halten ihnen eine Zeit lang die Hand.
Bald ist er wieder gefragt. Weiter geht’s mit Liedern.
Manchmal entwickeln die Bewohner eine Eigendynamik. Bei „Freut Euch
des Lebens“, stimmt erst eine die „Großmutter wird mit der Sense
rasiert“-Version an. Das kennen auch die Herren, fallen mit ein und
schon hat der stattliche Chor Dietmar Schöffel übertönt. Simone
Joder und ihre Kolleginnen sind mittendrin im Geschehen, nehmen
immer wieder mal einen der Bewohner herzlich in den Arm, schunkeln
zum Takt der Lieder oder halten ihnen eine Zeit lang die Hand.
Nach eineinhalb Stunden Singen und Feiern fangen die ersten
Bewohner langsam an zu gähnen, bekommen einen verschleierten Blick.
Sie haben lange durchgehalten. „Viele sind nachmittags müde, dösen
vor sich hin, aber heute war davon nichts zu merken“, sagt Simon
Joder. Es sind eben oft die Dinge, die Außenstehenden gerade nicht
auffallen, die Aktionen, wie das Erdbeerfest, in den Bewohnern
bewirken. Da ist zum Beispiel der Mann, der sonst teilnahmslos mit
leerem Blick vor sich hindämmert und eine halbe Ewigkeit zum Essen
braucht. Heute blinzelt er viel. „Ich sehe, dass da was in seinem
Kopf abläuft“, sagt Simone Joder. Und die zwei großen Stücke
Erdbeerkuchen und die Bowle, die sie ihm reicht, sind im Nu
aufgegessen. Oder der Mann, der sonst ständig wissen möchte, wie
spät es ist. Heute interessiert ihn das nicht. Oder sein
Sitznachbar der nie mitsingt, wenn im Wohnbereich gesungen wird.
Heute fällt er leise mit in den Chor ein. Text und Bild:
Christine Kraus
06.07.2016
Begeisterung fürs Federvieh kennt kein Alter
 Die Hühner bringen den Kindern und den Senioren viel Freude.
Die Hühner bringen den Kindern und den Senioren viel Freude.
Schifferstadt- Dem Charme eines Huhnes kann sich kaum
jemand entziehen. Alle zwei Wochen besuchen die Kinder des
Waldkindergartens die Senioren im Caritas-Altenzentrum St. Matthias
in Schifferstadt. Dieses Mal haben sie einen besonderen Anlass für
ihren Besuch: Im Garten des Altenzentrums sind für zwei Wochen fünf
Hühner eingezogen und da zeigt sich, dass selbst 80 Jahre
Altersunterschied die Begeisterung fürs Federvieh nicht mindern
können.
Die Aktion „Rent a Huhn“, des Hühnerhof-Besitzers Michael Lüft
aus Seligenstadt macht es möglich.
Lüft vermietet seit drei Jahren Hühner mit allem, was man dafür
braucht, auf Zeit. Im vergangenen Jahr hat das Federvieh schon
einmal im Garten des Seniorenzentrums gescharrt und Eier gelegt.
Damals war gleich klar, dass es eine Wiederholung geben soll. Nun
ist es also wieder so weit.
Die Senioren haben im Schatten Platz genommen. Die Kinder können
es kaum noch erwarten, endlich ins Gehege zu dürfen. Die Hühner
offensichtlich auch nicht, denn sie ahnen schon, dass Arletta Groß,
die Leiterin der Sozialbetreuung von St. Matthias, einen
Leckerbissen für sie in der Tüte hat. Eine vorwitzige Henne springt
sogar schon in die Luft. Vorsichtig gehen die Kinder zu den
Hühnern, die sich sogar von ihnen streicheln lassen. Doch die
Salatblätter aus der Tüte sind erst mal wichtiger als Kuscheln,
dafür ist später noch Zeit, finden die Hühner und auch die Kinder.
Die haben große Freude daran, die Tiere zu Füttern.
Den Bewohnern, die zuschauen, macht das Treiben auch sichtlich
Spaß. Während die Hühner mit den Salatblättern beschäftigt sind,
dürfen die Kinder das Dach des Hühnerstalls aufklappen und sehen,
ob vielleicht eine Henne schon ein Ei gelegt hat. Tatsächlich, da
liegt eins. Die kleine Helena darf es vorsichtig herausholen, es
ist noch ganz warm. Die Kinder staunen, als ihnen Arletta Groß dann
zum Vergleich ein winziges Wachtelei zeigt. Das Hühnerei kommt in
einen Korb mit den anderen Eiern, die die Hennen in den letzten
Tagen gelegt haben. „Vergangenes Jahr waren es mehr, da war das
Wetter besser“, erklärt Arletta Groß den Kindern. Sie dürfen es mit
in den Kindergarten nehmen, denn aus hygienischen Gründen dürfen
frische Eier in einem Seniorenheim nicht verwendet werden. Danach
liest die Erzieherin Verginiya Ottendörfer noch die Geschichte von
einem Huhn, das gerne Urlaub machen möchte, vor.
Die Bewohner sitzen inzwischen bei einem Gläschen Eierlikör und
auch für die Kinder gibt es eine Stärkung, bevor sie weiter ziehen.
Da bugsiert Alltagsbegleiterin Ewa Nordt ein Huhn in einen Korb,
legt eine Decke drüber und macht sich auf in die Wohnbereiche. Sie
besucht Bewohner, die ans Bett gefesselt sind oder zu schwach sind,
um in den Garten zu kommen und zeigt ihnen das Huhn, erzählt ihnen,
was draußen los war, lässt sie das Huhn streicheln. Später kommt
sie zurück und berichtet, dass sich die Bewohner sehr gefreut
hätten über „das Hinkel“. „Sie haben richtig gestrahlt. Eine
Bewohnerin hat mich gleich in die Küche geschickt, damit das Hinkel
was zu trinken bekommt“, sagt sie und strahlt dabei selbst nicht
weniger. Arletta Groß freut sich: „Es ist ein Segen für mich, mit
so einem Team zu arbeiten“. Sie und ihr Team haben sich auch
allerhand einfallen lassen für die Zeit, in der die Hühner zu Gast
sind. So trafen sich die Senioren zum Hühnercafé im Garten bei
einem Stück „Spiegeleikuchen“, es gab ein Hühnerquiz und Eierwerfen
war auch schon angesagt. Allerdings mit Styroporeiern, die die
Senioren in einen Korb werfen sollten.
Man merkt, dass die Senioren sich über die Hühner freuen, und
jede Gelegenheit für einen Spaziergang in den Garten nutzen.
Arletta Groß erzählt von einem Bewohner, der sich sonst außerhalb
seiner unmittelbaren Umgebung nicht mehr orientieren kann, jetzt
aber plötzlich zum Aufzug wollte, weil es da ja zu den Hühnern
geht. Das Federvieh bringt frischen Wind ins Seniorenheim. Die
Besuche der Kinder auch. Es waren auch schon Gruppen aus anderen
Kindergärten zum Hühner-Gucken da. Alt und Jung gehören zusammen,
das sollte eigentlich ganz selbstverständlich sein, findet Arletta
Groß. Deswegen kommen neben den Kindergartenkindern auch immer
wieder mal andere junge Menschen zu Besuch. „Wir hatten kürzlich
Rollstuhltraining für eine Handballmannschaft und demnächst kommt
eine Gruppe Firmlinge vorbei“, erzählt sie. Auch wenn die Hühner
dann schon wieder weggezogen sind. Text und Foto: Christine
Kraus
26.06.2016
Bester Arbeitgeber "Vitanas unter den Top 10"
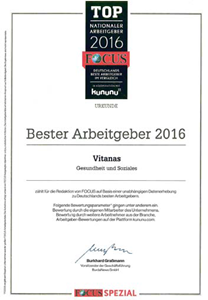 Top
Arbeitsumfeld im Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer
Top
Arbeitsumfeld im Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer
Ludwigshafen- Was muss ein Arbeitgeber bieten,
damit seine Beschäftigten jeden Morgen gern zur Arbeit gehen, sich
wertgeschätzt fühlen und ihre Tätigkeit mit viel Engagement
ausüben? Von Aufstiegschancen übers Betriebsklima bis zum Gehalt -
das große Arbeitgeber- Ranking des Wirtschaftsmagazins Focus zeigt,
welche Unternehmen in Deutschland ihren Mitarbeitern herausragende
Job-Bedingungen bieten. Und nicht nur das Team des Vitanas Senioren
Centrums in Ludwigshafen ist stolz, auch die ganze
Unternehmensgruppe freut sich: Vitanas erreichte in der Branche
‚Gesundheit und Soziales‘ den hervorragenden 10. Platz und gehört
damit zu den besten Arbeitgebern Deutschlands.
In der größten deutschen Befragung dieser Art ermittelte der
Focus in Zusammenarbeit mit dem Karrierenetzwerk ‚Xing‘ und der
Bewertungsplattform ‚kununu‘ die besten Arbeitgeber aus 22
Branchen. Insgesamt liegen den Ergebnissen über 70.000 Bewertungen
von Arbeitnehmern aller Hierarchie- und Altersstufen zugrunde. Die
Befragten beurteilten unter anderem das Führungsverhalten ihres
Vorgesetzten, ihre beruflichen Perspektiven, das Gehalt sowie das
Image ihres Arbeitgebers. Besonders wichtig für das Gesamturteil
war die Weiterempfehlungsbereitschaft: Würden die Befragten ihren
Arbeitgeber auch an Freunde und Verwandte weiterempfehlen? Denn
dazu ist nur bereit, wer wirklich von seinem Unternehmen überzeugt
ist.
Kontakt und Informationen:
Ansprechpartnerin: Mareen Thielemann,
Centrumsleiterin
Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer
Rheinallee 16 | 67061 Ludwigshafen
Telefon: (0621) 669 44 - 0 | E-Mail: m.thielemann@vitanas.de |
www.vitanas.de/amrheinufer
Text und Foto: Vitanas GmbH & Co. KGaA, Presse
20.02.2016
Menschen mit Demenz zu Gast im Kloster St. Magdalena
Abenteuer Kultur wagen!
Speyer- Vergangenen Freitag waren sechs
Menschen mit Demenz gemeinsam mit ihren Begleitpersonen auf
Einladung der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Speyer im
Kloster St. Magdalena zu Gast. Im Rahmen des Projekts „Abenteuer
Kultur wagen“ war dies bereits das dritte, speziell ausgerichtete
Angebot für Menschen mit Demenz.
Die Schwestern des Magdalenenklosters Speyer waren auf Anfrage
sofort bereit, dieses Vorhaben aktiv zu unterstützen. Um für die
Betroffenen eine behagliche Atmosphäre zu schaffen, stellten die
Schwestern einen ansprechenden Raum innerhalb der Klosteranlage zur
Verfügung.
Der mit Tannenzweigen und Kerzen geschmückte Tisch sowie Punsch
und Lebkuchen bereitenden sobald eine heimelige, vertraute
Atmosphäre.
Durch die wohl gewählten Begrüßungsworte von Schwester Raphaela
und der weihnachtlichen Klavierbegleitung seitens Schwester
Ambrosia fühlten sich die Betroffenen auf das herzlichste
willkommen.
Denn nur wer sich wohl und angenommen fühlt, hat auch den Mut
etwas zu sagen. Und genau das soll mit dem Projekt „Abenteuer
Kultur wagen“, der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz erreicht
werden.
Mit dem Gedicht „Stern“, stellte Eva-Maria Urban einen ersten
Bezug zum Höhepunkt dieses Morgens, dem Besuch der prachtvollen
Krippe in der Klosterkirche, her.
Die Bewunderung für die Figuren war groß. Vor allem die edlen
Gewänder der heiligen drei Könige hatten es den Besuchern angetan.
Es war zu spüren, wie berührt diese Menschen mit Demenz beim
Anblick der Krippe waren. Immer wieder entdeckten Sie Neues und
ihre große Freude an der Krippe wurde sichtlich spürbar. Schwester
Ambrosia an der Orgel stimmte Weihnachtslieder an und die Gäste
sangen mit großer Freude mit. Die Intimität und Ruhe in der
Klosterkirche erzeugten bei den Betroffenen Geborgenheit und
Wohlbefinden:
„Wie schön! Das hab ich noch nie gesehen! Hier war ich noch nie!
Da komm ich wieder her!“ Diese Sätze wiederholte eine Frau
mit Demenz immer wieder. Sie verabschiedete sich mit der Aussage:
„Das werd ich nie vergessen!“
Eine andere Dame wurde neugierig und wollte noch mehr von der
Klosterkirche sehen. Beim Abschied vom Kloster St. Magdalena
erhielten alle Gäste das vorgetragene Gedicht sowie eine Vorlage
zum Sternebasteln.
Die Krippe im Kloster St. Magdalena war nach dem Besuch im
Purrmann Haus und im Archäologischen Schaufenster das dritte
Angebot für Menschen mit Demenz im Rahmen des Projektes „Abenteuer
Kultur wagen“.
Weitere kulturelle Angebote sollen folgen. Ziel des Projektes
ist es: Menschen mit Demenz in einer geschützten Umgebung
Aufmerksamkeit, Wertschätzung und Freude zu schenken. Gerade der
kulturelle Bereich ist für dieses Vorhaben außerordentlich
geeignet, da er auf vielfältige Weise die Sinne belebt und positive
Gefühle erzeugen kann.
Diese Angebote erhöhen die Lebensqualität von Menschen mit
Demenz sichtbar. Um dieses „Abenteuer Kultur wagen“
langfristig zu fördern und zu stärken, braucht es noch mehr aktive
kulturelle Einrichtungen und Kunstschaffende.
Wer sich bei diesem Projekt engagieren möchte, kann sich im
Seniorenbüro Speyer:
Ria Krampitz, Tel. 06232/14-2661 gerne melden.
Eva-Maria Urban und Ria Krampitz
20.01.2016
Abenteuer Kultur wagen
 Menschen mit Demenz
besuchen Archäologisches Schaufenster
Menschen mit Demenz
besuchen Archäologisches Schaufenster
Speyer- Das in diesem Jahr gestartete Projekt
„Abenteuer Kultur wagen“, initiiert von der Lokalen Allianz für
Menschen mit Demenz geht weiter. Fünf Menschen mit Demenz und ihre
Begleitpersonen waren im Archäologischen Schaufenster zu Gast.
Keiner der Teilnehmenden hatte bisher diese Einrichtung besucht. So
war es für alle Beteiligte eine erste Kontaktaufnahme. Ludger
Schulte vom Archäologischen Schaufenster hatte alles liebevoll für
die Gäste richtet. Aus Tonbechern konnte ein Begrüßungstrunk
genossen werden. An diesem Vormittag stand das Leben der Römer, wie
sie früher gelebt haben, im Mittelpunkt. Aus welchem Geschirr haben
sie gegessen und getrunken.
Allein durch das Ansehen und fühlen der Tonschalen wurden schon
Erinnerungen wachgerufen. Eine Betroffene erzählte von ihrem Vater,
der getöpfert hat. „Schöne Schüsseln hat er gemacht. Wunderschön“.
Und darum geht es bei dem Projekt „Abenteuer Kultur wagen“.
Erinnerungen sollen bei den Betroffenen geweckt werden. Diese
aufgreifen und Wertschätzen, das ist Ziel dieser Veranstaltungen.
Es geht um eine andere Art der Kulturvermittlung. Nicht Wissen
abfragen, denn da kommt es meist zu Frustrationserlebnissen.
Menschen mit Demenz werden in ihrem Alltag sowieso ständig damit
konfrontiert, was sie nicht mehr können. Bei „Abenteuer Kultur
wagen“ geht es gerade darum, das, was sie noch können und wissen,
wachzurufen und Wert zu schätzen.
 Nachdem so viel über
das Essen und das Geschirr gesprochen worden war, konnten die Gäste
selbst Kräuter schneiden und einen Kräuterquark anrühren, den sie
dann mit frischem Fladenbrot genießen konnten. Strahlend, mit einem
Button vom Archäologischen Schaufenster als Geschenk,
verabschiedeten sich die Gäste. Ihren Gesichtern war anzusehen,
dass das Erlebte gefallen hat. Mit dem Projekt „Abenteuer Kultur
wagen“, soll Menschen mit Demenz Lebensfreude vermittelt werden und
die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.
Nachdem so viel über
das Essen und das Geschirr gesprochen worden war, konnten die Gäste
selbst Kräuter schneiden und einen Kräuterquark anrühren, den sie
dann mit frischem Fladenbrot genießen konnten. Strahlend, mit einem
Button vom Archäologischen Schaufenster als Geschenk,
verabschiedeten sich die Gäste. Ihren Gesichtern war anzusehen,
dass das Erlebte gefallen hat. Mit dem Projekt „Abenteuer Kultur
wagen“, soll Menschen mit Demenz Lebensfreude vermittelt werden und
die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ermöglicht werden.
Die nächste Veranstaltung findet im Kloster Sankt Magdalena
statt. Die Gäste werden hier im Januar 2016 die ausgestellte Krippe
besuchen.
Weitere Informationen zu dem Projekt „Abenteuer Kultur wagen“
sind im Seniorenbüro Speyer erhältlich. Ansprechpartnerin Ria
Krampitz, Tel. 06232/142661, E-Mail: Ria.Krampitz@stadt-speyer.de
Seniorenbüro der Stadt Speyer, Presse
04.12.2015
Teilhabe wird erfahrbar
 Meike Leupold (2. v. r.) übergab eine Spende an Vorsteher Dr. Günter Geisthardt (3. v. r.), Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang (l.) und Bewohner der inklusiven WG.
Meike Leupold (2. v. r.) übergab eine Spende an Vorsteher Dr. Günter Geisthardt (3. v. r.), Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang (l.) und Bewohner der inklusiven WG.
Landau- „Hier wird Teilhabe wirklich und
erfahrbar gemacht.“ Damit brachte Dr. Günter Geisthardt, Vorsteher
der Diakonissen Speyer-Mannheim, die Bedeutung zweier inklusiver
Wohnprojekte von Diakonissen Bethesda Landau bei deren offizieller
Einweihung am 16. Oktober auf den Punkt.
Zehn Personen haben im Sommer im neuen Wohnquartier „Am
Ebenberg“ Wohngruppen für behinderte Menschen bezogen, in einer
inklusiven Wohngemeinschaft nur wenige Straßen entfernt leben vier
Menschen mit Beeinträchtigung in einer Wohngemeinschaft mit
Studierenden der Universität Koblenz-Landau zusammen. Das neue
Wohnquartier am Rande des Landesgartenschaugeländes habe
Vorbildcharakter, betonte Matthias Rösch, Landesbeauftragter für
die Belange behinderter Menschen des Landes Rheinland-Pfalz, das
dezentrale Wohnprojekte für Menschen mit Behinderung unterstützt,
um deren Integration in die Gesellschaft zu fördern: „Das Quartier
wurde von Anfang an mit Blick auf Inklusion entwickelt“, sagte
Rösch: „Hier wird Vielfalt sichtbar.“
Dass die Vielfalt gut ankommt, habe sich in den ersten Wochen in
der Nachbarschaft gezeigt, freute sich Bethesda-Geschäftsführer
Dieter Lang: „Vorurteile fallen in der Begegnung – und hier sorgen
wir für Begegnung.“ Die Wohnprojekte entstanden im Rahmen der
Dezentralisierungs-Aktivitäten von Diakonissen Bethesda Landau.
Ziel sei es, in den nächsten Jahren ähnliche Wohnangebote für
insgesamt 72 Menschen mit Einschränkungen in Landau und Umgebung zu
schaffen, damit behinderte Menschen selbstbestimmt leben und am
gesellschaftlichen Leben teilhaben können, so Lang. Er betonte
allerdings auch, dass die Bewohner Bethesdas selbst darüber
entscheiden, ob und wie sie ihr Leben außerhalb des Geländes in der
Bodelschwinghstraße gestalten möchten. Einblick in den schwierigen
Entscheidungsprozess gab bei der Einweihungsfeier Erika
Happersberger, Vorsitzende des Bewohnerbeirats in Bethesda, die
nach 38 Jahren in der Einrichtung in eine der neuen Wohnungen
gezogen ist.
Im Anschluss an die Feierlichkeiten hatten die Gäste die
Möglichkeit, die Wohnungen zu besichtigen. In der Wohngemeinschaft
gab es bei der Gelegenheit ein besonderes Geschenk: Meike Leupold
übergab eine Spende der Dietmar Hopp-Stiftung in Höhe von 4.000
Euro zur Finanzierung der Küche. Der Stiftung sei es ein Anliegen,
Menschen, die im Leben stehen zu unterstützen, sagte sie: „Dazu
gehört das Miteinander von Generationen und von Menschen mit und
ohne Beeinträchtigung.“ Text und Foto: Diakonissen
Speyer-Mannheim
19.10.2015
Generation 60+ aktiv im Internet
Verbraucherzentrale und MedienKompetenzNetzwerk unterstützen
beim Gebrauch smarter Technologien
In keiner Generation wächst der Gebrauch von Internet und
smarten Technologien so stark wie bei den 60- bis 69-Jährigen.
Damit sich Seniorinnen und Senioren sicher im World Wide Web
bewegen können, legen die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz und
die Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz das
aktualisierte Lehrbuch „Silver Surfer – Sicher online im Alter“
schon in der dritten Auflage vor, dieses Mal mit dem Schwerpunkt
auf mobilen Anwendungen. Das Buch dient als Schulungsmaterial in
den zahlreichen Kursen, die von den Volkshochschulen, der
Verbraucherzentrale und den MedienKompetenzNetzwerken ab September
wieder landesweit angeboten werden.
Die Generation 60+ ist nicht mit digitalen Technologien groß
geworden, zeigt aber ein großes Interesse am Umgang mit Internet,
Smartphone und Co. Sind die ersten Berührungsängste überwunden,
stellen sich neben Neugier auch Unsicherheit und reichlich viele
Fragen ein. Das umfangreiche Buch „Silver Surfer – Sicher online im
Alter“ macht ältere Onlinerinnen und Onliner behutsam mit den
Nutzungsmöglichkeiten des Internets vertraut und führt sie sicher
durch die weite Welt des Internets. Im ersten Teil des gut
gegliederten und mit vielen Beispielen versehenen Buches erhalten
ältere Nutzerinnen und Nutzer wichtige Einblicke in die Grundlagen
von E-Mails, Suchmaschinen, Unterhaltungsmöglichkeiten,
Online-Einkauf und Datenschutz. Der zweite Teil befasst sich mit
Handy, Smartphone und Co. Auch die Themen Apps, Cloud Computing und
mobile Bezahlmethoden sowie damit verbundene Stolperfallen kommen
nicht zu kurz. Alle Inhalte des Buches wurden von Expertinnen und
Experten der beteiligten Institutionen erarbeitet und auf den
neusten Stand gebracht. Der Landesbeauftragte für den Datenschutz
und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz hat am Kapitel
Datenschutz mitgewirkt.
Verbraucherschutzminister Prof. Dr. Gerhard Robbers erklärte
hierzu: „Die Digitalisierung unseres Alltags macht auch vor dem
demographischen Wandel nicht halt. Für junge Menschen, die in eine
digitalisierte Welt hineinwachsen, wie für ältere ist das Internet
zunehmend unverzichtbar. Ein bewusster, aber vor allem auch
sicherer Umgang damit ist deshalb wichtig. Dank gut verständlicher
Informationen leistet die Broschüre „Silver Surfer – Sicher online
im Alter“ einen wichtigen Baustein zum Verbraucherschutz.“
„Silver Surfer ist eine Erfolgsgeschichte exklusiv aus
Rheinland-Pfalz“, so die Ministerin für
Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie Sabine
Bätzing-Lichtenthäler. „Viele ältere Menschen beschäftigen sich mit
den neuen digitalen Technologien und integrieren sie in ihren
Alltag. Dabei werden die Vorteile, die die Technologien nicht nur
für die Kommunikation bieten, deutlich: Apps zur Gesundheit oder
Hinweise auf Pünktlichkeit von öffentlichen Verkehrsmitteln sind
hier nur zwei von vielen Beispielen“, so die Ministerin.
Gefördert wurde das Buch durch das Ministerium der Justiz und
für Verbraucherschutz sowie das Ministerium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demografie Rheinland-Pfalz. Die Volkshochschulen
werden in landesweit angebotenen Kursen dafür sorgen, dass die
Generation 60+ zu all diesen Fragen praxisnah geschult wird.
Das Buch kann kostenlos donnerstags zwischen 10 und 15 Uhr im
Beratungsstützpunkt Germersheim, Kreisverwaltung Germersheim,
Luitpoldplatz 1, 76726 Germersheim abgeholt werden. Postversand
erfolgt gegen Einsendung von 2,40 Euro in Briefmarken durch
die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz, Postfach 41 07 in 55031
Mainz. Die Kurstermine und weitere Informationen sind auf der
Internetseite www.silversurfer-rlp.de zu
finden.
Text: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz e.V. Stützpunkt
Germersheim, Presse
25.09.2015
Computersprechstunde ab 29.09.2015 wöchentlich
Computersprechstunde
Speyer- Die bewährte individuelle Computerhilfe
des Internet-Treffs des Seniorenbüros wird ausgebaut. Ab
Dienstag, 29. September 2015 findet nun
wöchentlich eine Beratung zur Lösung von
speziellen PC-Fragen statt.
Dazu kann der eigene Laptop mitgebracht werden.
Dieses erweitere Angebot nennt sich nun Computersprechstunde und
findet jeden Dienstag von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, im Internet-Treff,
Ludwigstraße 15b statt.
Text: Seniorenbüros der Stadt Speyer, Presse
23.09.2015
Erfolgreiche Saison für „Immer wieder sonntags“
 Stefan Mross
feiert letzte Live-Sendung
Stefan Mross
feiert letzte Live-Sendung
Rust- Zum letzten Mal in diesem Jahr hat der Moderator und
Entertainer Stefan Mross am Sonntag, 06. September 2015 seine Fans
live vom Festivalgelände des Europa-Park begrüßt. Dabei blickte er
einmal mehr auf eine erfolgreiche Saison zurück. Bei der 14.
Sendung sorgten u. a. Andreas Gabalier, die Ehrlich Brothers und
Comedian Marco Rima für gute Laune.
Auf die Fans der beliebten SWR-Musik- und Unterhaltungsshow
„Immer wieder sonntags“ wartet am 13. September um 10 Uhr das große
„Best-of“. Die Zuschauer erleben nochmals die schönsten Auftritte
der Schlagerstars, Comedians und Nachwuchskünstler im Europa-Park.
Text und Foto: Europa-Park GmbH & Co Mack KG,
Presse
12.09.2015
500 Notfallmappen: Seniorenbeirat schnürt erstmals großes Hilfspaket
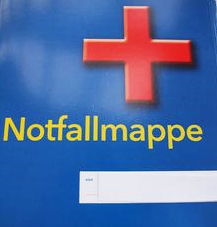 Wichtige
Daten auf einen Blick
Wichtige
Daten auf einen Blick
Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Wichtige Telefonnummern,
Medikamentenliste, persönliche Angaben, Infos zu behandelnden
Ärzten, Rentenunterlagen, Daten zu Versicherungen und Angaben zu
Familienangehörigen in einem Schnellhefter stets griffbereit:
„Meine Notfallmappe“ ist gedacht als Gedankenstütze und möglichst
optimale Hilfeleistung bei Notfällen und wurde vom
Seniorenbeirat erarbeitet. Die mit Unterstützung durch
Bürgermeisterin Monika Kabs nun zusammengestellten ersten 500
Mappen sollen als Starterset funktionieren und sind über die
Mitglieder des Seniorenbeirats sowie im Seniorenbüro
erhältlich.
Für Seniorenbeiratsvorsitzenden Ludwig Schultheis und seine
beiden Stellvertreter Klaus Bohn und Daoud Hattab ist besonders
wichtig, dass die Sammlung lose Blätter enthält und jedes Blatt bei
Bedarf ausgetauscht und aktualisiert werden kann. Auch
Ergänzungen sind denkbar, so sind Formblätter für
Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung in die Mappe
integriert. Schultheis erläutert: „Broschüren mit Notrufnummern
gibt es genug, aber alle persönlichen Daten in einem
Schnellhefter, das kann eine echte Hilfe sein.“ Angegeben
ist, in welchem Fall Kopien für die Unterlagen genügen .
Da Betroffene in einer Notsituation oftmals zunächst „kopflos“
sind und nicht alles Erforderliche bedenken, hat der
Seniorenbeirat auch den Standard-Inhalt eines
Notfallkoffers aufgelistet, lobt die Bürgermeisterin das Engagement
des Seniorengremiums. Im Notfall können hier Angehörige eines
plötzlich Erkrankten oder Gestürzten, etwa bei einer
Krankenhauseinweisung, hilfreiche Informationen beziehen. So
auch über Betreuungsangebote und Pflegedienste. Wenn die Mappe
sorgfältig ausgefüllt ist, finden Ärzte und Pflegepersonal
alle wichtigen Daten, die zu einer schnellen und sicheren
Soforthilfe beitragen. Angesichts der jährlich steigenden Zahl
älterer Mitbürger ist Monika Kabs dem Seniorenbeirat dankbar
für diesen hilfreichen Wegweiser, von dem je nach Nachfrage weitere
Exemplare erstellt werden sollen. Denn die Notfallmappe ist zwar
von Senioren, aber nicht nur für die Generation 65 plus
gedacht. Auch Jüngere können sich des
Schnellhefters mit dem roten Kreuz auf der Umschlagseite
bedienen. „Mitten im Leben sind wir mit dem Tod umfangen“,
zitiert der Seniorenbeirat-Vorstand in seinem Vorwort
aus einem Kirchenlied und erklärt: „Es muss aber nicht immer ein
tödliches Ereignis sein, was uns plötzlich trifft. Es können
jederzeit Notsituationen eintreten, bei denen wir schnell auf
wichtige Informationen zurückgreifen können.“
Als nächstes plant der Seniorenbeirat einen „Wegeplan“. Für
diesen richtungsweisenden Seniorenhelfer, der als großräumiger
Stadtplan die Fuß- und Radwege zu alle Hilfseinrichtungen aufzeigen
soll, sucht das Gremium zurzeit Sponsoren. Denn dieser
Senioren-Wegeplan soll als Broschüre gedruckt werden,
informierte Klaus Bohn.
Foto: spk-Archiv
23.08.2015
Versorgungssicher, sauber, komfortabel
 Auch Speyerer „Salierstift“ setzt jetzt auf Wärme- und
Warmwasserversorgung aus Fernwärme der Stadtwerke
Speyer
Auch Speyerer „Salierstift“ setzt jetzt auf Wärme- und
Warmwasserversorgung aus Fernwärme der Stadtwerke
Speyer
cr. Speyer- Es war fast schon so etwas wie
ein glücklicher Zufall, dass die alte Heizungsanlage im Speyerer
„Salierstift“ in der Oberen Langgasse 5a ausgerechnet zu einem
Zeitpunkt „schlapp“ zu machen drohte, als überall in der Stadt die
Straßen aufgegraben und Leitungen zur Fernwärmeversorgung verlegt
wurden. Kein Wunder also, dass da Gerd
Flaschenträger, neben Bernhard Mückain
und Rudolf Lang Mitglied im Stiftungsbeirat der
Seniorenresidenz und selbst langjähriger „Stadtwerker“, damit
begann, Informationen einzuholen, wie, wo und vor allem zu welchen
finanziellen Bedingungen das im Besitz von 130 Eigentümern
befindliche und von 150 Senioren bewohnte Stift an das städtische
Fernwärmenetz angeschlossen werden könnte.
 Und das Ergebnis, so erläuterte Flaschenträger jetzt bei
der offiziellen Übergabe der neuen Anlage, war selbst für ihn als
Experten durchaus überraschend: Denn hätte man für die Installation
einer neuen, der alten Anlage entsprechenden und die durchgehende
Versorgung des Objektes mit Heizenergie und Warmwasser sichernden
stationären Heizungsanlage mit zwei Heizkesseln vor Ort im Keller
des „Salierstifts“ oder für ein entsprechend leistungsfähiges
Blockheizkraftwerk rund 210.000 Euro aufwenden müssen, so boten die
Stadtwerke Speyer den Anschluss an das Fernwärmenetz und damit die
zukünftige versorgungssichere Belieferung mit Heizenergie und
Warmwasser mit nur 89.000 Euro deutlich günstiger an.
Und das Ergebnis, so erläuterte Flaschenträger jetzt bei
der offiziellen Übergabe der neuen Anlage, war selbst für ihn als
Experten durchaus überraschend: Denn hätte man für die Installation
einer neuen, der alten Anlage entsprechenden und die durchgehende
Versorgung des Objektes mit Heizenergie und Warmwasser sichernden
stationären Heizungsanlage mit zwei Heizkesseln vor Ort im Keller
des „Salierstifts“ oder für ein entsprechend leistungsfähiges
Blockheizkraftwerk rund 210.000 Euro aufwenden müssen, so boten die
Stadtwerke Speyer den Anschluss an das Fernwärmenetz und damit die
zukünftige versorgungssichere Belieferung mit Heizenergie und
Warmwasser mit nur 89.000 Euro deutlich günstiger an.
In einer Eigentümerversammlung, so Flaschenträger schließlich,
hatten dann alle Mitbesitzer des Objektes dieser zukunftsträchtigen
und auch ökologisch sinnvollen Lösung zugestimmt, handele es sich
doch bei der zum Einsatz kommenden Fernwärme quasi um ein
„Abfallprodukt“ aus der Stromerzeugung des Großkraftwerkes
Mannheim.
Ein weiteres Argument für diese Lösung sei schließlich auch die
durch den Einsatz eines „Hotmobils“ während der gesamten Umbauzeit
durchgängig gewährleistete Versorgungssicherheit mit Warmwasser
gewesen, „denn ein Ausfall der Warmwasserversorgung in einem Haus
wie dem unseren, das geht überhaupt nicht“, so der sachkundige
Heimleiter Stephen Husk.
 „Ganz toll - die gesamte Umbaumaßnahme hat störungsfrei
und wunderbar geklappt“. lobte auch der
Geschäftsführer des „Salierstifts“, Ulrich
Heberger, der darauf verwies, dass durch den
fachlich-kompetenten Einsatz der Stadtwerke-Mitarbeiter um
Norbert Pelgen und Markus Sohn
sein Haus keinen Moment auf Wärme und Warmwasser verzichten
musste.
„Ganz toll - die gesamte Umbaumaßnahme hat störungsfrei
und wunderbar geklappt“. lobte auch der
Geschäftsführer des „Salierstifts“, Ulrich
Heberger, der darauf verwies, dass durch den
fachlich-kompetenten Einsatz der Stadtwerke-Mitarbeiter um
Norbert Pelgen und Markus Sohn
sein Haus keinen Moment auf Wärme und Warmwasser verzichten
musste.
Und so kam es denn, dass Anfang Juni 2015 die beiden alten und
maroden, mit Gas befeuerten Heizkessel abgebaut und die neue
Heizungs- und Warmwasserversorgung des Hauses, die mit einer
Anschlussleistung von 450 kW stattliche 660.000 kWh jährlich zu
leisten imstande ist, innerhalb weniger Wochen auf die komfortable
Fernwärmeversorgung umgerüstet werden konnte. Dazu wurden u.a. auch
ein Frischwassermodul sowie ein 1000-Liter-Wärme-Pufferspeicher
eingebaut. Bereits sechs Wochen nach Beginn der Umbauarbeiten
konnte dann am 15. Juli die Umschaltung der Warmwasserbereitung auf
Fernwärme erfolgen – in diesen Tagen nun die offizielle Übergabe an
den Nutzer, das „Salierstift“.
 Dieser Tag – übrigens auch draußen einer der „heißesten“
des Jahres - gab auch Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang
Bühring Gelegenheit, auf die Vorzüge der Fernwärme zu
verweisen, die sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit und
Versorgungssicherheit auszeichne. „Doch auch der Umstand, dass
Fernwärmenutzer keinen zusätzlichen, großen Warmwasserspeicher
benötigen, weil warmes Wasser bei ihnen stets bedarfsgerecht und
kontinuierlich in den Haushalt gelangt, macht dieses Produkt so
konkurrenzlos und komfortabel“, unterstrich Bühring, der daran
erinnerte, dass die „grüne Fernwärme“ auch bei der Stromerzeugung
eine zunehmend größere Bedeutung erlange. Und deshalb setze sich
Fernwärme auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Speyer immer
mehr durch – würden sich immer mehr Hausbesitzer dafür entscheiden,
ihre Immobilie an diese modernste und „sauberste“ Form der
Wärmeversorgung anzuschließen.
Dieser Tag – übrigens auch draußen einer der „heißesten“
des Jahres - gab auch Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang
Bühring Gelegenheit, auf die Vorzüge der Fernwärme zu
verweisen, die sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit und
Versorgungssicherheit auszeichne. „Doch auch der Umstand, dass
Fernwärmenutzer keinen zusätzlichen, großen Warmwasserspeicher
benötigen, weil warmes Wasser bei ihnen stets bedarfsgerecht und
kontinuierlich in den Haushalt gelangt, macht dieses Produkt so
konkurrenzlos und komfortabel“, unterstrich Bühring, der daran
erinnerte, dass die „grüne Fernwärme“ auch bei der Stromerzeugung
eine zunehmend größere Bedeutung erlange. Und deshalb setze sich
Fernwärme auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Speyer immer
mehr durch – würden sich immer mehr Hausbesitzer dafür entscheiden,
ihre Immobilie an diese modernste und „sauberste“ Form der
Wärmeversorgung anzuschließen.
Und noch eins zum Schluß: Dort, wo im Keller des „Salierstifts“
bislang die beiden gewaltigen Heizungskessel ihren Platz hatten,
sind jetzt nur noch die Armaturen und Verbindungsteile zwischen der
Haus-Verteileranlage und dem öffentlichen Fernwärmenetz zu sehen.
Die größere, frei gewordene Fläche im Keller steht jetzt für andere
Zwecke zur Verfügung. Foto: gc
15.08.2015
Projekt „Abenteuer Kultur wagen“
 Menschen mit Demenz
besuchen das Purrmann-Haus
Menschen mit Demenz
besuchen das Purrmann-Haus
Speyer- Es war eine Premiere. Erstmals
besuchten Menschen mit Demenz, mit ihren Begleitpersonen das
Purrmann-Haus. Gemeinsam mit den Veranstaltern, der Lokalen Allianz
für Menschen mit Demenz und dem Purrmann-Haus, wagten sie das
Abenteuer Kultur.
Mit vorsichtigen Schritten, aber neugierigen Blicken trafen nach
und nach die Besucherinnen und Besucher ein. Sie kamen aus fünf
stationären Speyerer Einrichtungen. Die angenehme Atmosphäre im
Innenhof des Purrmann-Hauses, die mit Kräutern dekorierten Tische,
die herzliche Begrüßung, Getränke und Kekse sorgten dafür, dass
sich die ersten Unsicherheiten schnell legten. Maria Leitmeyer,
Kustodin des Purrmann-Hauses, erzählte kleine Anekdoten aus dem
Leben von Hans Purrmann. „Die Gäste waren intensiv dabei, das
konnte man an den Gesichtern ablesen“, sagte sie danach.
Im Purrmann-Haus selbst, war alles vorbereitet. Ein
Blumenstrauß mit Rosen und Hortensien war ein Blickfang und sorgte
für Bewunderung. „Ist das schön“, diese Bemerkung einer
Teilnehmerin drückte aus, was alle empfanden. Maria Leitmeyer hatte
zwei Blumen-Stillleben von Mathilde Vollmoeller-Purrmann für eine
nähere Betrachtung ausgewählt.
 Zur Einstimmung
bekamen alle eine Rose in die Hand. Als das Lied „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“ erklang, stimmten alle Gäste mit ein. Es war
bewegend zuhören und zu sehen, mit welcher Intensität sie dabei
waren und alle Strophen auswendig singen konnten. Auch hier sorgte
die Atmosphäre, die der Raum ausstrahlte, für eine angenehme
Stimmung. Menschen mit Demenz sind empfindsam, sie spüren, ob sie
willkommen sind. Im Purrmann Haus waren sie das. „Es herrschten
eine unglaubliche Aufmerksamkeit und Offenheit“, bestätigt auch
Anke Nader von der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz. Maria
Leitmeyer fesselte mit Erzählungen aus dem Leben der Künstlerin
Mathilde VollmoellerPurrmann und weckte damit auch Erinnerungen der
Besucherinnen und Besucher. Immer wieder gab es Äußerungen, die
deutlich machten, dass die Gäste interessiert bei der Sache
waren.
Zur Einstimmung
bekamen alle eine Rose in die Hand. Als das Lied „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“ erklang, stimmten alle Gäste mit ein. Es war
bewegend zuhören und zu sehen, mit welcher Intensität sie dabei
waren und alle Strophen auswendig singen konnten. Auch hier sorgte
die Atmosphäre, die der Raum ausstrahlte, für eine angenehme
Stimmung. Menschen mit Demenz sind empfindsam, sie spüren, ob sie
willkommen sind. Im Purrmann Haus waren sie das. „Es herrschten
eine unglaubliche Aufmerksamkeit und Offenheit“, bestätigt auch
Anke Nader von der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz. Maria
Leitmeyer fesselte mit Erzählungen aus dem Leben der Künstlerin
Mathilde VollmoellerPurrmann und weckte damit auch Erinnerungen der
Besucherinnen und Besucher. Immer wieder gab es Äußerungen, die
deutlich machten, dass die Gäste interessiert bei der Sache
waren.
Die Abschlussrunde fand wieder im Hof statt. Dort lag auf den
Tischen eine bunte Blumenvielfalt bereit. Dank der großzügigen
Spenden, von Alexandra Remus ortsansässigem Blumengeschäft in der
Wormser Straße und Mobile Pflege A. Holusa, war eine schöne Auswahl
vorhanden. Jeder Gast konnte sich sein eigenes Blumensträußchen
binden und voller Stolz mit nach Hause nehmen. Das Lächeln in den
Gesichtern drückte die Freude über das Tun und das Gelingen aus.
„Das war eine gute Idee“, bemerkte am Schluss eine Teilnehmerin.
Und diese Idee will die Lokale Allianz für Menschen mit Demenz
weiter verfolgen und weiter ausbauen. Kulturelle Veranstaltungen
helfen die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und die ihrer
Angehörigen zu fördern.
Das Ziel ist, eine feste Projektgruppe in Speyer aufzubauen, die
hilft, solche Veranstaltungen vorzubereiten, durchzuführen und zu
finanzieren. Aus diesem Grund findet dazu am Freitag, 18. September
2015, von 10 bis 12 Uhr, eine Fortbildungsveranstaltung im
Seniorenbüro statt. Wer das „Abenteuer Kultur wagen“ mit aufbauen
und entwickeln möchte, ist herzlich dazu eingeladen. Anmeldung im
Seniorenbüro, Ansprechpartnerin Ria Krampitz, Tel.
06232/142661.
Text und Foto: Seniorenbüro der Stadt Speyer
05.08.2015
15 Jahre Haus am Germansberg
 Erinnerte an die Anfänge des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am Germansberg: Heimleiter Klaus-Dieter Schneider
Erinnerte an die Anfänge des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am Germansberg: Heimleiter Klaus-Dieter Schneider
Speyer- Mit einem ökumenischen Gottesdienst und
einem kleinen Fest feierten haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende,
Bewohnerinnen und Bewohner sowie ihre Angehörigen am 19. Juni das
15jährige Bestehen des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am
Germansberg.
Das Seniorenzentrum sei „ein gutes Zeichen ökumenischer
Zusammenarbeit“, betonte Heimleiter Klaus-Dieter Schneider bei
seinem Rückblick auf die Zusammenlegung eines evangelischen und
eines katholischen Altenheims im Juni 2000. Am 18. Juni seien
Bewohnerinnen und Mitarbeitende des Diakonissen Altenheims aus dem
heutigen Ärztehaus 1 in den Neubau auf dem Gelände der ehemaligen
Normand-Kaserne gezogen, nur einen Tag später folgten die Bewohner
und Betreuer aus dem katholischen Altenheim in der Engelsgasse. Das
große Engagement sowohl der hauptamtlich als auch der ehrenamtlich
Mitarbeitenden und ihre gute Kooperation miteinander seien Garant
für die gelungenen Umzüge gewesen, betonte Schneider.
Einige der Ehrenamtlichen erinnerten in der Feierstunde an
Unsicherheiten und Erwartungen der Bewohnerinnen und Bewohner vor
15 Jahren. „Einen alten Baum verpflanzt man nicht“ hätte man vor
den Umzügen oft gehört, aber mit dem Einzug in die neuen Räume
seien alle Zweifel sofort verflogen. Sowohl die Bewohnerinnen und
Bewohner als auch die Mitarbeitenden hätten viel bessere räumliche
Rahmenbedingungen vorgefunden als in ihren vorherigen Domizilen. In
seinem Grußwort für den Vorstand bestätigte Pfarrer Dr. Werner
Schwartz, dass das Ziel, das sich die Verantwortlichen im Jahr 2000
gesetzt hatten, von Anfang an erfüllt wurde und bis heute wird: Das
Haus am Germansberg sollte „Geborgenheit im Alter“ geben. Text
und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
23.06.2015
Arbeitsbedingungen in der Altenpflege verbessern
Rege Diskussionen im Rahmen des ersten kreisübergreifenden
Workshops am 04. Februar 2015
Speyer- Die Arbeitsbedingungen in der
Altenpflege standen im Mittelpunkt eines Workshops, zu dem die
Sozialplanerinnen und Sozialplaner der Städte Speyer, Frankenthal,
Ludwigshafen und des Rhein-Pfalz-Kreises eingeladen hatten. Mehr
als 50 Teilnehmer, vor allem Führungskräfte aus
Altenpflegeeinrichtungen, diskutierten die Ursachen, warum
Pflegekräfte oftmals unzufrieden mit den Arbeitsbedingungen sind.
Der Workshop fand in den Räumlichkeiten der Universität für
Verwaltungswissenschaften in Speyer statt. Es war der erste
gemeinsame Workshop der drei Städte und des Rhein-Pfalz-Kreis.
Bürgermeisterin Monika Kabs, betonte in ihrem Begrüßungsvortrag,
wie wichtig ein gemeinsames Vorgehen von benachbarten Kreisen und
Städten ist. Von daher sei dieser erste kreisübergreifende Workshop
zukunftsweisend. „Die Arbeitsbedingungen in der Altenpflege sind
ein wichtiges Thema vor dem Hintergrund der demografischen
Entwicklung“, führte Prof. Dr. Joachim Wieland, Rektor der
Universität für Verwaltungswissenschaften, in seiner Begrüßung aus.
„Das Berufsfeld muss attraktiv gestaltet werden. Ansonsten wird es
schwierig, ausreichend Nachwuchs zu gewinnen“.
Prognosen des Instituts für Wirtschaft, Arbeit und Kultur
(IWAK), das den Workshop gemeinsam mit dem Deutschen Institut für
angewandte Pflegeforschung (dip) durchgeführt hat, deuten darauf
hin, dass bis zum Jahr 2020 fast 2.900 Altenpflegefachkräfte in
Rheinland-Pfalz fehlen könnten, wenn nicht geeignete Maßnahmen zur
Fachkräftesicherung ergriffen werden. „Unattraktive und belastende
Arbeitsbedingungen können dazu führen, dass Pflegekräfte die
Einrichtung wechseln oder ganz aus dem Beruf ausscheiden“, so
Oliver Lauxen vom IWAK. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass
dafür vor allem die Rahmenbedingungen verantwortlich sind, unter
denen Pflegeheime und ambulante Pflegedienste arbeiten. Die
finanziellen Mittel, über die die Einrichtungen verfügen, wurden
als nicht ausreichend beschrieben. Die Altenpflege erfahre in der
Gesellschaft nicht genügend Wertschätzung. Hinzu kommen ein hoher
bürokratischer Aufwand, häufige Kontrollen und
Schnittstellenprobleme mit Hausärzten und Krankenhäusern.
Wie der Workshops zeigte, verfügen die Altenpflegeeinrichtungen
über zahlreiche Strategien zum Umgang mit diesen schwierigen
Rahmenbedingungen. Eine wirkliche Verbesserung der
Arbeitsbedingungen kann aus Sicht der Teilnehmenden allerdings nur
erreicht werden, wenn Gesellschaft und Politik für die Problemlagen
der Altenpflegeeinrichtungen sensibilisiert werden. Die regionalen
Pflegekonferenzen werden sich diesem Thema weiterhin widmen.
Seniorenbüro der Stadt Speyer, Presse
05.02.2015
Mit Musik und Museumsbesuchen eigene Identität wiedergewinnen
 Speyerer
Seniorenbüro präsentiert Modellprojekte zur Betreuung von Menschen
mit Demenz – Ehrenamtliche Helfer gesucht
Speyerer
Seniorenbüro präsentiert Modellprojekte zur Betreuung von Menschen
mit Demenz – Ehrenamtliche Helfer gesucht
cr. Speyer- Die „Lokale Allianz für
Menschen mit Demenz“, ein vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend gefördertes Modellprojekt des
Seniorenbüros der Stadt Speyer, sucht ehrenamtliche Mitarbeiter und
Helfer Mittwoch, 11. März 2015, 10:00 bis 16:00 Uhr, Speyer zur
Betreuung von Patienten mit Demenz. Im Rahmen eines Pressegesprächs
stellte jetzt die zuständige Speyerer Sozialdezernentin,
Bürgermeisterin Monika Kabs, gemeinsam der
Leiterin des Seniorenbüros. Ria Krampitz, der
Öffentlichkeit die beiden Säulen dieses Projektes vor, mit denen
versucht werden soll, Demenzpatienten durch den Kontakt mit Musik
bzw. mit Kunstwerken in Museen oder Galerien zu aktivieren und
positiv zu beeinflussen.
 „Mit
Musik geht vieles leichter – Menschen mit Demenz musikalisch
einfühlsam begleiten“ ist das eine Projekt überschrieben -
„Abenteuer Kultur wagen – Menschen mit Demenz im
Museum“ das andere. Für beide Projekte können sich
Interessenten für eine ehrenamtliche Mitwirkung beim Seniorenbüro
Speyer, Frau Ria Krampitz, Maulbronner Hof 1 A, 67346 Speyer,
e-mail: Ria.Krampitz@stadt-speyer.de
anmelden.
„Mit
Musik geht vieles leichter – Menschen mit Demenz musikalisch
einfühlsam begleiten“ ist das eine Projekt überschrieben -
„Abenteuer Kultur wagen – Menschen mit Demenz im
Museum“ das andere. Für beide Projekte können sich
Interessenten für eine ehrenamtliche Mitwirkung beim Seniorenbüro
Speyer, Frau Ria Krampitz, Maulbronner Hof 1 A, 67346 Speyer,
e-mail: Ria.Krampitz@stadt-speyer.de
anmelden.
Für beide Projekte bietet das Seniorenbüro einführende Seminare
an, in denen sich Interessenten über Art und Umfang ihrer Aufgaben
informieren können. Dazu treffen sich die „Musiker“ am Mittwoch,
11. März 2015, 10:00 bis 16:00 Uhr, im AWO Seniorenhaus Burgfeld,
Burgfeldstraße 34-36 Speyer
 In diesem
Seminar vermittelt die Musiktherapeutin Simone
Willig Hintergründe und praktische Tipps für den gezielten
und sinnstiftenden Einsatz von Musik in der Begleitung von Menschen
mit Demenz. Wann ist der
In diesem
Seminar vermittelt die Musiktherapeutin Simone
Willig Hintergründe und praktische Tipps für den gezielten
und sinnstiftenden Einsatz von Musik in der Begleitung von Menschen
mit Demenz. Wann ist der
Einsatz von Musik sinnvoll? Wann ist er völlig fehl am Platze
für die Erhaltung von Lebensqualität? Wie kann ich mit Musik
Alltagsituationen wie z.B. das Essen und Trinken unterstützen?
Musik ist ein Stück Identität. Wie ein roter Faden begleitet sie
uns unser Leben lang und ist untrennbar an Emotionen geknüpft.
Babys erkennen die Stimme der Mutter an deren Klangfarbe. Singen
wir gemeinsam mit anderen Menschen, so passt sich unser Herzschlag
dem Rhythmus der Musik an und schlägt gemeinsam mit den
MitsängerInnen im Takt. Wir werden uns zeitlebens an die Musik
erinnern, zu der wir gemeinsam mit unserer ersten großen Liebe
getanzt haben. Musik entwickelt und erhält Identität, insofern
spielt sie eine wichtige Rolle in der Begleitung von Menschen mit
Demenz.Zielgruppe für dieses Seminar sind ehrenamtliche
Demenzbegleiterinnen und -begleiter, sowie Angehörige und haupt-
und nebenberufliche Pflegekräfte.
 Auch für die
Interessenten an einer ehrenamtlichen Begleitung von
Demenz-Patienten im zweiten Projekt „Abenteuer Kultur wagen
– Menschen mit Demenz im Museum“ wird es ein einführendes
Seminar geben, das - in zwei Abschnitte gegliedert – gemeinsam von
der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Uschi
Baetz und MitarbeiterInnen der beiden ersten, in das
Projekt einbezogene Speyerer „Kunsttempeln“ abgehalten wird. Um
seinen Ablauf im Detail zu erläutern, waren zu dem Pressegespräch
als Vertreter dieser beiden Einrichtungen der Direktor des
Historischen Museums der Pfalz, Dr. Alexander Schubert und
die Kustodin des „Purrmann-Hauses“ in Speyer, Maria Leitmeyer M.A,
hinzugekommen.
Auch für die
Interessenten an einer ehrenamtlichen Begleitung von
Demenz-Patienten im zweiten Projekt „Abenteuer Kultur wagen
– Menschen mit Demenz im Museum“ wird es ein einführendes
Seminar geben, das - in zwei Abschnitte gegliedert – gemeinsam von
der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Uschi
Baetz und MitarbeiterInnen der beiden ersten, in das
Projekt einbezogene Speyerer „Kunsttempeln“ abgehalten wird. Um
seinen Ablauf im Detail zu erläutern, waren zu dem Pressegespräch
als Vertreter dieser beiden Einrichtungen der Direktor des
Historischen Museums der Pfalz, Dr. Alexander Schubert und
die Kustodin des „Purrmann-Hauses“ in Speyer, Maria Leitmeyer M.A,
hinzugekommen.
Das Seminar findet nämlich am Montag, dem 8. Juni 2015,
ab 10.00 Uhr im „Purrmann-Haus“ Speyer,
Kleine Greifengasse 14, 67346 Speyer statt und wird am Nachmittag
im Historischen Museum der Pfalz, Domplatz 4, 67346 Speyer
fortgesetzt. Ende: ca. 17.00 Uhr.
Im Rahmen dies Seminars sollen Fragen wie „Können Kunstwerke
Fenster in die Erinnerung öffnen?“ - „Bieten historische Originale
biografische Anknüpfungspunkte?“ - „Weckt die besondere Atmosphäre
eines Museums
Emotionen?“ - „Macht es Sinn, mit Menschen mit Demenz geschützte
Räume zu verlassen, um mit ihnen das 'Abenteuer Kultur' zu
wagen?“
 Dieses Seminar,
organisiert von der „Arbeitsgruppe Demenz Speyer“, stellt
Möglichkeiten, Barrieren und Erfolge der Arbeit mit Menschen mit
Demenz im Museum vor und möchte Ansätze für örtliche Projekte
aufzeigen. Zielgruppen sind hier MitarbeiterInnen von Museen,
Angehörige, Ehrenamtliche und alle, die sich in diesem Bereich
engagieren möchten
Dieses Seminar,
organisiert von der „Arbeitsgruppe Demenz Speyer“, stellt
Möglichkeiten, Barrieren und Erfolge der Arbeit mit Menschen mit
Demenz im Museum vor und möchte Ansätze für örtliche Projekte
aufzeigen. Zielgruppen sind hier MitarbeiterInnen von Museen,
Angehörige, Ehrenamtliche und alle, die sich in diesem Bereich
engagieren möchten
Die Seminare sind kostenfrei.
Die VertreterInnen von Stadt, Seniorenbüro, aber auch von Museum
und Purrmann-Haus zeigten sich in dem Gespräch durchweg sehr
gespannt auf dieses neue Projekt, mit dem sich insbesondere die
Museen und Galerien Zugang zu einer neuen, bislang nicht
vertretenen Besucherklientel versprechen. Ihre bei dem Projekt
gesammelten Erkenntnisse wollen sie auch an alle anderen Museen,
Galerien und anderen Kultureinrichtungen weitergeben, um so den
Kreis der besuchbaren Einrichtungen schon recht bald ausweiten zu
können. Foto: gc
25.01.2015
„Schade um jede Veranstaltung, die man versäumt hat“ - Erzählcafé sagt tschüss
 Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Dipl.-Pädagoge Karl-Heinz Jung
als Motor, Pfarrer i.R. Bernhard Linvers und Arzt Dr.Thomas Neubert
sagen leise servus. Mit rund 200 Erzählcafés haben sie in sechs
Jahren den Speyerer Senioren Lokalgeschichte nähergebracht und dank
vieler kompetenter Zeitzeugen und Referenten mit Erzählungen
Kultur, Politik, Wirtschaft und Sport die eigenen Erinnerungen der
insgesamt über 4000 Besucher an das Leben in ihrer Stadt
erweckt und so zur Bereicherung der Erzählnachmittage beigetragen.
Das Moderatoren-Trio landete zum Abschluss ihres Engagements für
das Seniorenbüro im Historischen Ratssaal noch einmal einen
Volltreffer: Die 1849 von Melchior Hess gegründete „Filzfabrik“ hat
mit der Produktion von Munitionszubehör Weltruhm erlangt und wurde
erst 1996 geschlossen.
Die geniale Erfindung eines Büchsenmachers bildete vor 166
Jahren den Grundstein für ein Industrieunternehmen, das in seinen
Glanzzeiten weit über 200 Mitarbeiter zählte. Dorothee
Fetzer, Urenkelin von Melchior Hess, und ihr Ehemann Gerhard
Krause, erläuterten, welcher „Filz“ dem Familienunternehmen
seinen Namen gab. Das umständliche und langwierige Stopfen
eines Vorderladers brachte Melchior Hess auf die Idee, für
die Jäger und Sportschützen einen viel leichter und schneller
zu handhabenden Hinterlader zu entwickeln. Zur Abdichtung der
Ladung in Aluminium-Schrotpatronen gegenüber den nachfolgenden
Pulvergasen fertigte die Speyerer „Munitions-Fabrik“ als
Zwischenmittel einen elastischen Filzpropfen, der beidseitig
mit Teerplättchen beklebt wurde. Ein Vorteil war zusätzlich, dass
die Hülsen wiederverwendbar waren. Die Hesspropfen wurden
weltbekannt. Das Fabrikationsprogramm umfasste später auch alle
Grundstoffe, Filz (aus Fell von Kühen und Pferden), Eisenfilz
Filzit, Lackpapier und Joghurtdeckel sowie starke
Pappen.
Dass die „Filzfabrik“ als familienfreundliches Unternehmen und
wichtiger Arbeitgeber in Speyer einen guten Ruf hatte, bestätigten
einige Erzählcafé-Besucher. Otto Hess, Enkel des
Firmengründers, war zur Auflage gemacht worden ein
Löschbecken auf dem großen Firmengelände vorzuhalten und hatte
beschlossen, dieses als „Gartenschwimmbad“ für die
Fremdarbeiter zu gestalten. Auf der 25 Meter-Bahn hat auch Dorothee
Fetzer Schwimmen gelernt. Liesel Jester erinnert sich gerne
an die stets sehr gut besuchten Weihnachtsfeiern des von Ernst und
August Hess angeführten Pioniervereins im kleinen Saal des
Wittelsbacher Hofs mit dem von den Hess-Brüdern gefüllten
Grabbelsack. Peter Schmidt, der frühere Tagespost-Chefredakteur,
ist als Nachbar in der Germanstraße aufgewachsen, zeigte sich
noch jetzt dankbar dafür, dass die Munitionsfabrik und damit auch
sein Elternhaus im Zweiten Weltkrieg nicht bombardiert wurden.
Die humoristische Seite des kulturell stark engagierten Otto
Hess beleuchtete SKG-Ehrenpräsident Werner Hill. Ein Treffen mit
ihm 1958 habe im Hess‘schen Weinkeller geendet. An
diesem Abend sei die Herrensitzung geboren worden. Und bei
der Premiere 1963 im Weinmuseum habe Hess selbst eine
bemerkenswerte Büttenrede gehalten mit dem Thema „Der
Furz“.
 Auf Teilen des vor ein paar Jahren an einen Investor
verkauften Fabrikgeländes entstanden inzwischen ein
Supermarkt, ein Drogeriemarkt, Therapie- und Arztpraxen und ein
großer Wohnkomplex. Noch ungewiss ist die Zukunft eines unter
Denkmalschutz stehenden Gartenhäuschens. Das um 1716
erbaute barocke Schlösschen diente einstmals Geistlichen und
später wohl dem Verwalter als Unterkunft.
Auf Teilen des vor ein paar Jahren an einen Investor
verkauften Fabrikgeländes entstanden inzwischen ein
Supermarkt, ein Drogeriemarkt, Therapie- und Arztpraxen und ein
großer Wohnkomplex. Noch ungewiss ist die Zukunft eines unter
Denkmalschutz stehenden Gartenhäuschens. Das um 1716
erbaute barocke Schlösschen diente einstmals Geistlichen und
später wohl dem Verwalter als Unterkunft.
Zum Abschluss des letzten Erzählcafés in dieser Form blickte
Karl-Heinz Jung im Beisein zahlreicher Referenten in Wort und Bild
zurück auf die monatlichen Erzählnachmittage mit Themen
aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Sport. „Schade um jede
Veranstaltung, die man versäumt hat“, kommentierte Bürgermeisterin
Monika Kabs und dankt dem Führungstrio für die engagierte und stets
mit großer Vorarbeit verbundene Organisation der Erzählcafés. Die
Kulturdezernentin stellte die Planung des Seniorenbüro vor: Ab
4.März soll eine Veranstaltungsreihe „Lebendige Erinnerungen“
starten. Für die Quartalstreffen suchen sie und
Seniorenbüro-Leiterin Ria Krampitz nun Ehrenamtliche, denen
die Stadtgeschichte weiterhin am Herzen liegt. Kabs verwies
überdies auf die Erzählcafés, welche seit einigen Jahren der
Nachbarschaftsverein der Baugenossenschaft
durchführt.
08.01.2015
Dr. Bernhard Vogel - erlebte Geschichte des 20.Jahrunderts im Erzählcafé
 Speyer- Die Geschichte des 20.Jahrhunderts
aus seiner Sicht machte Dr.Bernhard Vogel, von 1976 bis 1988
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003
Regierungschef von Thüringen, beim Dezember-Erzählcafé des
Seniorenbüros im Historischen Rathaus an drei markanten Punkten „im
Jahr des Gedenkens“ fest: Am Beginn des ersten Weltkriegs vor
100 Jahren, am Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren
und am 9.November 1989, dem Tag des Mauerfalls. Hierzu
erklärte der 81-jährige Speyerer Ehrenbürger: „Das hab ich nie
gedacht, dass ich den erleben darf.“
Speyer- Die Geschichte des 20.Jahrhunderts
aus seiner Sicht machte Dr.Bernhard Vogel, von 1976 bis 1988
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003
Regierungschef von Thüringen, beim Dezember-Erzählcafé des
Seniorenbüros im Historischen Rathaus an drei markanten Punkten „im
Jahr des Gedenkens“ fest: Am Beginn des ersten Weltkriegs vor
100 Jahren, am Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren
und am 9.November 1989, dem Tag des Mauerfalls. Hierzu
erklärte der 81-jährige Speyerer Ehrenbürger: „Das hab ich nie
gedacht, dass ich den erleben darf.“
Der erste Weltkrieg, den viele als
„Naturkatastrophe bezeichnet“ hätten, habe die Karte Europas völlig
verändert. Dankbar ist der am 19.Dezember 1932 in Göttingen
geborene Politiker dem in Großbritannien lebenden
australischen Historiker Christopher Clark, der in seinem 1000
Seiten starken Bestseller „Schlafwandler“ Deutschland nicht die
Alleinschuld am Kriegsausbruch gegeben habe. Ohne Frage habe
dagegen Adolf Hitler 25 Jahre später „den Zweiten Weltkrieg
mutwillig vom Zaun gebrochen“. Es gab „leider nicht genug
Demokraten, die die Weimarer Verfassung verteidigt haben“, weshalb
Hitler „legal an die Macht gekommen“ sei. Bernhard Vogel: „Am
Anfang hätte die Gefahr gebannt werden müssen.“ Höchst bedauerlich
für Vogel, dass das Attentat auf Hitler am 20.Juli 1944
schiefgegangen sei. Zum Kriegsende am 8.Mai 1945 waren 50 Millionen
Tote zu beklagen, war Deutschland am Boden zerstört. Dankbar zeigt
sich der der einzige Landesvater zweier Bundesländer dafür, dass
der für ihn damals unvorstellbare Wiederaufbau mit vereinten
Kräften und Konrad Adenauer als Motor so gut gelang und er selbst
später am Aufbauen der Demokratie mitwirken durfte. Besonders
bemerkenswert für ihn, wie gut dabei noch rund 14 Millionen
Vertriebene integriert wurden und in Deutschland eine zweite
Heimat fanden.
 „Nach 25 Jahren besteht kein Zweifel daran, dass die
Wiedervereinigung alles in allem gelungen ist“, stört Dr.Bernhard
Vogel beispielsweise der Unterschied, dass in den
West-Bundesländern die Einkommens- und Besitzverhältnisse fast
doppelt so hoch sind wie in Ostdeutschland. „Es ist in der
Tat ein Wunder, dass kein Schuss gefallen und kein Tropfen Blut
geflossen ist.“ Vogel zum nicht immer reibungslosen Zusammenwachsen
von neuen und alten Bundesländern: „Wenn wir uns freuen, dass die
Revolution unblutig verlaufen ist, dürfen wir uns auf der anderen
Seite“ nicht wundern, dass hinterher alle noch da sind!“ Die drei
großen Wegbereiter der deutschen Einheit waren für ihn Michail
Gorbatschow. George Bush sen. und Helmut Kohl, „der Vater der
Wiedervereinigung“. 1989 seien in der DDR noch 80 000 russische
Soldaten stationiert gewesen. Dass der ehemalige sowjetische
Staatschef nicht intervenierte, war für Vogel nicht nur ein Zeichen
von Stärke, sondern auch von Schwäche – angesichts des sich
abzeichnenden Zusammenbruchs der UDSSR. Nicht alle europäischen
Staatschefs hätten die Wiedervereinigung begrüßt, erzählte Vogel.
So habe Giulio Andreotti gesagt: „Ich liebe Deutschland so sehr,
dass ich zwei davon will.“ Und Margret Thatcher habe geäußert.
„Zweimal haben wir sie besiegt, jetzt sind sie schon wieder
da.“
„Nach 25 Jahren besteht kein Zweifel daran, dass die
Wiedervereinigung alles in allem gelungen ist“, stört Dr.Bernhard
Vogel beispielsweise der Unterschied, dass in den
West-Bundesländern die Einkommens- und Besitzverhältnisse fast
doppelt so hoch sind wie in Ostdeutschland. „Es ist in der
Tat ein Wunder, dass kein Schuss gefallen und kein Tropfen Blut
geflossen ist.“ Vogel zum nicht immer reibungslosen Zusammenwachsen
von neuen und alten Bundesländern: „Wenn wir uns freuen, dass die
Revolution unblutig verlaufen ist, dürfen wir uns auf der anderen
Seite“ nicht wundern, dass hinterher alle noch da sind!“ Die drei
großen Wegbereiter der deutschen Einheit waren für ihn Michail
Gorbatschow. George Bush sen. und Helmut Kohl, „der Vater der
Wiedervereinigung“. 1989 seien in der DDR noch 80 000 russische
Soldaten stationiert gewesen. Dass der ehemalige sowjetische
Staatschef nicht intervenierte, war für Vogel nicht nur ein Zeichen
von Stärke, sondern auch von Schwäche – angesichts des sich
abzeichnenden Zusammenbruchs der UDSSR. Nicht alle europäischen
Staatschefs hätten die Wiedervereinigung begrüßt, erzählte Vogel.
So habe Giulio Andreotti gesagt: „Ich liebe Deutschland so sehr,
dass ich zwei davon will.“ Und Margret Thatcher habe geäußert.
„Zweimal haben wir sie besiegt, jetzt sind sie schon wieder
da.“
 Ihm war klar, dass den Gipfelsturm-Freuden eine trockene
Ebene folgen würde, der Übergang aus sozialer Planwirtschaft in
eine kapitalistische Marktwirtschaft nicht problemlos
vonstattengehe. „Die Wiedervereinigung kam über Nacht!“ So gab es
kein Ministerium zum Planen der Privatisierung volkseigener
Betriebe und keine Zeit zum Gründen einer Kommission, erinnerte
Vogel an die Schwierigkeiten beim Aneinanderfügen der beiden so
lange getrennten Teile. Einen für ihn erfreulichen Aspekt
sprach Bernhard Vogel noch an. In der DDR hatte es keine frei
gewählten Gemeinderäte gegeben, und es war „für mich erstaunlich“,
wieviele Bürger sich bei der ersten demokratischen Wahl in
Ostdeutschland für Stadt-und Gemeinderat haben aufstellen
lassen.
Ihm war klar, dass den Gipfelsturm-Freuden eine trockene
Ebene folgen würde, der Übergang aus sozialer Planwirtschaft in
eine kapitalistische Marktwirtschaft nicht problemlos
vonstattengehe. „Die Wiedervereinigung kam über Nacht!“ So gab es
kein Ministerium zum Planen der Privatisierung volkseigener
Betriebe und keine Zeit zum Gründen einer Kommission, erinnerte
Vogel an die Schwierigkeiten beim Aneinanderfügen der beiden so
lange getrennten Teile. Einen für ihn erfreulichen Aspekt
sprach Bernhard Vogel noch an. In der DDR hatte es keine frei
gewählten Gemeinderäte gegeben, und es war „für mich erstaunlich“,
wieviele Bürger sich bei der ersten demokratischen Wahl in
Ostdeutschland für Stadt-und Gemeinderat haben aufstellen
lassen.
Befragt zum Unterschied seiner beiden Amtszeiten
als Ministerpräsident, meinte Vogel, dass er dank seiner Autorität
in Thüringen besser zurechtgekommen sei. Außerdem hätten die vom
Sozialismus geprägten Ostdeutschen „weniger widersprochen“.
Wenn er in Mainz jemanden zum Rechnungshof versetzen musste, wurde
er für diesen „zum Feind für immer“.
Moderator Bernhard Linvers erinnerte daran, dass
Dr.Bernhard Vogel schon immer sehr aktiv am Speyerer Leben
teilgenommen und einst für den Pfarrgemeinderat von St.Joseph
kandidiert habe. In seinem Dankeswort meinte der Pfarrer i.R.:„Dr.
Vogel war ein Segen für Thüringen!“ Text: Werner Schilling,
Foto: khj
Nächstes Erzählcafé am 6.Januar, 15 Uhr, im
Historischen Ratssaal mit dem Thema: Filzfabrik Melchior
Hess.
03.12.2014
Eindrucksvolle Schilderungen der 77jährigen Ordensfrau Schwester Miguela im Erzählcafé
 Speyer- Über das Institut St.Dominikus in
Speyer und seinen Einsatz in Ghana berichtete Schwester Miguela
0.P.beim Erzählcafé des Speyerer Seniorenbüros. Dass die gelernte
Hebamme und Krankenschwester ihre Hilfe mit Herz und Seele
leistete, war ihren eindrucksvollen Schilderungen deutlich
anzumerken. Bestens nachvollziehbar war für die knapp 50 Besucher
im Historischen Rathaus und für Moderator Bernhard Linvers, warum
die aus dem südpfälzischen Leimersheim stammende Ordensschwester
für ihr Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
wurde. Vor drei Jahren erhielt Schwester Miguela Keller die fast 50
Jahre in Ghana wirkte, den "Millenium Excellenz Preis", eine der
höchsten Ehrungen des afrikanischen Staates. Mit dem Preis werden
Gruppen oder einzelne Persönlichkeiten ausgezeichnet, die
„unermüdlich für Gesundheit, Menschenrechte und Seuchenkontrolle in
Afrika kämpfen“.
Speyer- Über das Institut St.Dominikus in
Speyer und seinen Einsatz in Ghana berichtete Schwester Miguela
0.P.beim Erzählcafé des Speyerer Seniorenbüros. Dass die gelernte
Hebamme und Krankenschwester ihre Hilfe mit Herz und Seele
leistete, war ihren eindrucksvollen Schilderungen deutlich
anzumerken. Bestens nachvollziehbar war für die knapp 50 Besucher
im Historischen Rathaus und für Moderator Bernhard Linvers, warum
die aus dem südpfälzischen Leimersheim stammende Ordensschwester
für ihr Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
wurde. Vor drei Jahren erhielt Schwester Miguela Keller die fast 50
Jahre in Ghana wirkte, den "Millenium Excellenz Preis", eine der
höchsten Ehrungen des afrikanischen Staates. Mit dem Preis werden
Gruppen oder einzelne Persönlichkeiten ausgezeichnet, die
„unermüdlich für Gesundheit, Menschenrechte und Seuchenkontrolle in
Afrika kämpfen“.
Die für ihre 77 Jahre noch sehr rüstige und vitale Ordensfrau
engagierte sich bis 2012 in Ghana als Regionalpriorin ihrer
Ordensgemeinschaft besonders im Gesundheitswesen. Das Institut St.
Dominikus unterhält in dem westafrikanischen Land zwei große
Krankenhäuser - in Akwatia im Landesinnern sowie in Battor am
Voltafluss. Beide Einrichtungen sind für die medizinische
Versorgung der Bevölkerung im Süden Ghanas von großer Bedeutung.
Nicht zuletzt weil sie auch den Aufbau von Basisgesundheitsdiensten
in entlegenen Dörfern fördern. Zu den Arbeitsschwerpunkten der
Krankenhäuser zählen die Aids-Prävention und die Behandlung von
Aids-Kranken. Sie arbeiten eng mit der Universitätsklinik in Accra
zusammen und haben ein hoch wirksames, preiswertes Aids-Medikament
auf der Basis von Naturheilmitteln entwickelt. Heute leistet das
Institut in einem großen HIV/AIDS-Zentrum mit einem Flügel für
Tuberkulose-Kranke wertvolle Hilfe. Der Gesundheitsdienst
kocht dreimal am Tag eine Mahlzeit für die Patienten, die nicht von
Angehörigen versorgt werden oder sehr arm sind.
 1957, im Jahr der
Unabhängigkeit Ghanas, waren die ersten vier Schwestern vom
Institut St.Dominikus ausgesandt worden Sie sollten eine
Wochenstation übernehmen und eine kleine Klinik. Eine deutsche
Gynäkologin hatte eine Praxis in ihrem Bungalow eröffnet.
Eindrucksvoll berichtete die engagierte Entwicklungshelferin
von den schwierigen Anfängen - „kein Strom, Wasser aus einem
Tank, kein Telefon“ - und dem mühsamen Ausbau der Geburtenstation
zum Allgemeinen Krankenhaus. Schwester Miguela erinnerte an
Verständigungsschwierigkeiten und an Einzelschicksale, wie das
einer jungen Frau: Ihr erstes Kind war an Malaria
gestorben. Aus Angst davor, das zweite Kind auf die gleiche Weise
zu verlieren, kam sie trotz Verbot des Vaters in die Klinik
gelaufen. Die Kenntnis der Sitten und Gebräuche sowie
das Erlernen der schwierigen Sprache der Einheimischen waren für
die Arbeit der Schwestern enorm wichtig, betonte die
Referentin.
1957, im Jahr der
Unabhängigkeit Ghanas, waren die ersten vier Schwestern vom
Institut St.Dominikus ausgesandt worden Sie sollten eine
Wochenstation übernehmen und eine kleine Klinik. Eine deutsche
Gynäkologin hatte eine Praxis in ihrem Bungalow eröffnet.
Eindrucksvoll berichtete die engagierte Entwicklungshelferin
von den schwierigen Anfängen - „kein Strom, Wasser aus einem
Tank, kein Telefon“ - und dem mühsamen Ausbau der Geburtenstation
zum Allgemeinen Krankenhaus. Schwester Miguela erinnerte an
Verständigungsschwierigkeiten und an Einzelschicksale, wie das
einer jungen Frau: Ihr erstes Kind war an Malaria
gestorben. Aus Angst davor, das zweite Kind auf die gleiche Weise
zu verlieren, kam sie trotz Verbot des Vaters in die Klinik
gelaufen. Die Kenntnis der Sitten und Gebräuche sowie
das Erlernen der schwierigen Sprache der Einheimischen waren für
die Arbeit der Schwestern enorm wichtig, betonte die
Referentin.
Am Herzen lag der Generalpriorin ab 1978 der Aufbau des
Basisgesundheitsdienstes. Da es nicht genügend Krankenhäuser gab,
keine befahrbaren Straßen und keine Transportmöglichkeiten,
schlossen sich die Missionshospitäler aller Religionen
zusammen zur „Christian Health Association of Ghana“.
Die Bischöfe bestimmten, „wenn die Leute nicht zu uns kommen
können, müssen wir zu ihnen gehen“. Bei den Besuchen in kleineren
Dörfern ging es um die Aufklärung, die Verhütung von
Krankheiten, Schwangerenberatung und die Behandlung einfacher
Krankheiten. Für die Impfung gegen Kinderkrankheiten sowie
Wundstarrkrampf wurden Dorfhelfer ausgebildet. Doch oft fehlte es
an Kühltaschen, Spritzen und Nadeln sowie an Impfstoffen.
Dank Unterstützung durch Misereor wurde ein Geländewagen
angeschafft, mit dem die bis zu 60 Helfer starken Schwesternteams
in 24 Dörfern ihres Kreises einmal im Monat helfen
konnten.
 Neben ihrem Einsatz
im Gesundheitswesen kümmerte sich Schwester Miguela nahezu 30 Jahre
lang zudem um die medizinische und soziale Betreuung der
Häftlinge im größten Gefängnis Ghanas. Als sie das erste Mal
dorthin kam, erschrak sie: „Ich sah lebende Skelette hinter
Gittern.“ Da war ihr schnell klar, dass diese armen Menschen, -
überwiegend politische Häftlinge - bisweilen Zuspruch und
regelmäßig von den Mitschwestern gebackenes Brot benötigten.
Neben ihrem Einsatz
im Gesundheitswesen kümmerte sich Schwester Miguela nahezu 30 Jahre
lang zudem um die medizinische und soziale Betreuung der
Häftlinge im größten Gefängnis Ghanas. Als sie das erste Mal
dorthin kam, erschrak sie: „Ich sah lebende Skelette hinter
Gittern.“ Da war ihr schnell klar, dass diese armen Menschen, -
überwiegend politische Häftlinge - bisweilen Zuspruch und
regelmäßig von den Mitschwestern gebackenes Brot benötigten.
Als beratendes Mitglied in der „Amazing Grace Helpline“, einer
Agentur für Nächstenliebe und Entwicklung, beriet sie Witwen und
Waisen in finanziellen und beruflichen Fragen. Auch der Bau von
hunderten von Brunnen sowie Toiletten geht auf den Einsatz von
Schwester Miguela und ihrer Mitschwestern zurück. Hierfür wurden
junge Männer im Steinemachen ausgebildet. Die Versorgung mit Wasser
stand neben Hygiene-Geboten ganz oben auf der Hilfsliste von
Schwester Miguela. Sie freut sich, dass die Projekte des Instituts
St. Dominikus unter anderem durch Hungermärsche, Spendenaktionen
von Schulen wie dem Nikolaus-von-Weis-Gymnasium Speyer, Rotary
International sowie vielen
Einzelspendern besonders aus dem Bistum Speyer
gefördert werden.ws; Foto: khj
05.11.2014
Erstes Filmfestival in Speyer ein Erfolg
Speyer- „Prima, dass das
Filmfestival der Generationen, der Metropolregion, jetzt auch in
Speyer ist“. Diese Aussage einer 67jährigen Dame spiegelt die
Meinung der Besucherinnen und Besucher. Der Zuspruch war groß. Rund
500 Interessierte kamen, um sich einen oder mehrere Filme
anzusehen. Der Eintritt war kostenfrei. Die Organisation hatte das
Seniorenbüro Speyer übernommen.
Schon gleich bei der Eröffnung in St. Hedwig,
musste von einem Veranstaltungsraum in die Kirche umgezogen werden,
weil der Platz nicht reichte. „Und wenn wir alle zusammenziehen“
gab Anstoß über neue Wohnformen nachzudenken.
Das Besondere an dem Filmfestival in Speyer war,
dass für jeden Film neue Kooperationspartner gefunden werden
konnten. Die Zusammenarbeit kam schnell zustande, weil alle die
Idee Filmfestival in Speyer zu Themen des Älterwerdens gut fanden.
Die Inhalte der sechs Filme, wie Wohnen im Alter, Soziale
Beziehungen, Dialog der Generationen, Sexualität im Alter, Demenz,
Musik und Kreativität im Alter, Biografiearbeit in stationären
Einrichtungen, Sport und Bewegung im Alter, Altersbilder,
Entwicklungsgewinne im Alter, Umgang mit Krebs, Neuanfang, Liebe im
Alter, Pflege und Sterbehilfe boten Stoff zum anschließenden
Austausch und zur Diskussion. Nach jedem Film wurde dieser
moderierte Austausch angeboten. Es meldeten sich vor allem
Angehörige zu Wort. Das zeigt, dass sie sich wohl gefühlt haben,
denn nur mit einem Gefühl der Sicherheit und des sich Wohlfühlens,
spricht man über Privates vor vielen Menschen.
„Das Lied des Lebens“ berührte alle Anwesenden.
Immer wieder gab es spontanen Applaus, wenn gezeigt wurde, was
Musik bei Menschen bewegen kann. Bernhard König der Musiker und
Komponist, stand anschließend für Gespräche zur Verfügung.
„Wünsche mir, dass mir Ähnliches begegnet, wenn ich
möglicherweise uralt werde“, so eine Äußerung eines Besuchers.
Der Film „Sein letztes Rennen“ wurde in der
Pflegerischen Schule der Diakonissenanstalt gezeigt. Hier ist es
wirklich gelungen Jung und Alt zusammenzuführen. Es waren zur
Hälfte Schüler und zur Hälfte ältere Menschen, die gemeinsam den
Film erlebt haben. Die Botschaft des Filmes lautete, niemals still
stehen. Die Schüler hatten mit selbstgebackenem Kuchen, für die
kulinarische Seite gesorgt. Die Altersspanne ging hier von 17 bis
95 Jahren.
Der Film „Die Frau, die sich traut“ wurde im
Diakonissen Mutterhaus gezeigt. Die Filmauswahl sollte
unterschiedliche Inhalte ansprechen. Deshalb war dieser Film so
wichtig, da er den Umgang mit der Diagnose Krebs zeigte. Auch hier
die zentrale Botschaft „Lebe Deinen
Traum“.
Sehr bewegend war auch der Film „Anfang 80“. Die
letzte Zeit des Lebens, so zu gestalten, wie man es selbst wünscht,
intensiv das zu tun, was gut tut. Vor allem sein Leben
selbstbestimmt gestalten bis zum Lebensende. „Gespräche nach dem
Film hilfreich für die Verarbeitung der diversen Themen“ gab eine
ältere Dame als Rückmeldung.
Der letzte Film „Vergiss mein nicht“ war ein
Dokumentarfilm oder besser ein Liebesfilm. David Sieveking, der
Regisseur nimmt in diesem Film die Zuschauer mit auf seine ganz
persönliche Reise seiner Familie, seiner, Mutter, die an Demenz
gestorben ist. Im Anschluss stand David Sieveking für Fragen zur
Verfügung und konnte noch mehr Informationen zur Entstehung des
Filmes geben.
Insgesamt eine gelungene Reihe, mit guter Stimmung
und Atmosphäre. „Nächstes Jahr bitte wieder!“ lauteten Aussagen von
Besuchern.
Seniorenbüro der Stadt Speyer, Presse
15.10.2014
Werner Schineller im Erzählcafé über Speyer und „Die scheene alte Zeit“
 Speyer. Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich
Schiller, Friedrich Hölderlin, Ludwig Uhland, Joseph von
Eichendorff, Victor Hugo, Eugen Roth und Günter Grass -um nur
einige zu nennen – haben eines gemeinsam: Sie alle haben irgendwann
einmal in einem Gedicht, Geschichten oder Erinnerungen etwas über
die Stadt Speyer geschrieben. Manchmal waren es nur ein paar
Zeilen, aber bisweilen sind es auch größere Abhandlungen. Und alle
Lobeshymnen und die wenigen negativen Erlebnisberichte haben der
damalige Bürgermeister und spätere Oberbürgermeister Werner
Schineller und Verleger Hermann G.Klein gesammelt und 1986 in einem
Lesebuch herausgegeben. Nun erinnerte Schineller im Erzählcafé des
Seniorenbüros auszugsweise an die unter dem Buchtitel „Macht euch
auf nach Speyer“ zu Papier gebrachten Gedanken der Schriftsteller,
Dichter oder Künstler und ergänzte den bemerkenswerten
Literatur-Spiegel durch Äußerungen von Politikern, Kirchenleuten
und Kulturschaffenden. Viele Zitate nutzte Schineller zum Aufbau
seiner „einigen tausend Grußworte“.
Speyer. Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich
Schiller, Friedrich Hölderlin, Ludwig Uhland, Joseph von
Eichendorff, Victor Hugo, Eugen Roth und Günter Grass -um nur
einige zu nennen – haben eines gemeinsam: Sie alle haben irgendwann
einmal in einem Gedicht, Geschichten oder Erinnerungen etwas über
die Stadt Speyer geschrieben. Manchmal waren es nur ein paar
Zeilen, aber bisweilen sind es auch größere Abhandlungen. Und alle
Lobeshymnen und die wenigen negativen Erlebnisberichte haben der
damalige Bürgermeister und spätere Oberbürgermeister Werner
Schineller und Verleger Hermann G.Klein gesammelt und 1986 in einem
Lesebuch herausgegeben. Nun erinnerte Schineller im Erzählcafé des
Seniorenbüros auszugsweise an die unter dem Buchtitel „Macht euch
auf nach Speyer“ zu Papier gebrachten Gedanken der Schriftsteller,
Dichter oder Künstler und ergänzte den bemerkenswerten
Literatur-Spiegel durch Äußerungen von Politikern, Kirchenleuten
und Kulturschaffenden. Viele Zitate nutzte Schineller zum Aufbau
seiner „einigen tausend Grußworte“.
„Durch manch wechselnden Gau, an blühenden Städten
vorüber, strömt goldhaltige Flut, wälzend der herrliche Rhein. Aber
so viel er bespült die Städte, der Länder, ich altes Speyer, ich
werde noch stets unter die ersten gezählt. So dichtete Theodor
Reysmann im Jahr 1531. In diesem Jahrhundert fanden in den Mauern
der Stadt bedeutende Reichstage statt, so der von 1526 und der von
1529, der die Teilung der deutschen Nation in konfessioneller
Hinsicht herbeiführte. Während die Versammlungen der Städte und
Stände jeweils einige Wochen Leben in die Stadt brachten, sorgte
die Anwesenheit des Reichskammergerichtes von 1527 bis 1688 für
vielfältige Belebung und trug maßgeblich zum Ruhm der Stadt bei.
Aus Speyer, der alten Metropole Germaniens, war der juristische
Mittelpunkt des Reiches geworden. So lässt Johann Wolfgang von
Goethe am Ende des zweiten Aufzugs seinen Götz von Berlichingen
sagen: Macht euch auf nach Speyer, es ist Visitationszeit, zeigt’s
an, sie müssen’s untersuchen und euch zu dem Eurigen helfen.“ Der
ehemalige Speyerer OB, der über eine beachtliche Privat-Bibliothek
verfügt, zitierte aus dieser Zeit auch den englischen
Schriftsteller Thomas Coryate aus dessen Aufzeichnungen über eine
Venedig- und Rheinfahrt im Jahre 1608: „Speyers Lage ist lieblich,
es steht in einer fruchtbaren Ebene, durch die das Flüßchen Spira
fließt, nicht weit vom Rhein, obgleich dieser seine Mauern nicht
bespült. Es ist von starken Mauern umgeben mit Türmen, die so hoch
sind wie unsere Kirchtürme, die höchsten Türme in einer Mauer, die
ich auf meiner Reise sah. Manche derselben sind dazu noch mit
sonderbaren Torbauten versehen, welche der Stadt ein stolzes
Aussehen verleihen und sie weithin sichtbar machen. Viele Straßen
sind bemerkenswert wegen ihrer Länge und Breite, die große Straße,
die zum Dom führt, ist an beiden Enden fünfunddreißig schritte
breit, ich habe dies eigens mit meinen Schritten gemessen.“
 Bei dem von Karl-Heinz Jung moderierten und mit
Powerpoint-Fotos unterlegten Vortrag im gut besuchten Historischen
Rathaus räumte Schineller freilich den Speyerern breiten Raum ein.
So zitierte er aus dem „Vermächtnis“ des in der Domstadt geborenen
Malers Anselm Feuerbach (1829 bis 1880) eine passage, in der die
Domstadt nicht ganz so gut wegkommt. Bildhaft umschreibt der 1839
in Speyer zur Welt gekommene Lyriker Martin
Greif im Gedicht „Nähe der alten Stadt“ seinen Geburtsort: Ich
zieh‘ auf stillem Wege entlang des Stromes Lauf, die alte Stadt im
Nebel steigt nahe vor mir auf. Tief dringt mir in die Seele ihr
wohlbekanntes Bild, scheint sie doch wie verkläret, so winkt sie
friedensmild. Auch ist’s als ob die Bürde der Zeit sie abgelegt, so
stolz mit ihren Türmen das Haupt empor sie trägt.“
Bei dem von Karl-Heinz Jung moderierten und mit
Powerpoint-Fotos unterlegten Vortrag im gut besuchten Historischen
Rathaus räumte Schineller freilich den Speyerern breiten Raum ein.
So zitierte er aus dem „Vermächtnis“ des in der Domstadt geborenen
Malers Anselm Feuerbach (1829 bis 1880) eine passage, in der die
Domstadt nicht ganz so gut wegkommt. Bildhaft umschreibt der 1839
in Speyer zur Welt gekommene Lyriker Martin
Greif im Gedicht „Nähe der alten Stadt“ seinen Geburtsort: Ich
zieh‘ auf stillem Wege entlang des Stromes Lauf, die alte Stadt im
Nebel steigt nahe vor mir auf. Tief dringt mir in die Seele ihr
wohlbekanntes Bild, scheint sie doch wie verkläret, so winkt sie
friedensmild. Auch ist’s als ob die Bürde der Zeit sie abgelegt, so
stolz mit ihren Türmen das Haupt empor sie trägt.“
Breiten Raum nahm in Schinellers Zitatenschatz die
Dichterin Sophie de La Roche ein, die von 1780 bis 1786 in Speyer
lebte und in deren Wohnhaus in der Hauptstraße gegenüber dem
Rathaus auf Anregung des damaligen Oberbürgermeisters Schineller
eine Gedenkstätte eingerichtet wurde. Sie schildert in ihrer
Erzählung „Die Linde im Hof“ eindrucksvoll die Schwierigkeiten, in
Nähe des Domes zur Ruhe zu kommen: „Anfangs erwachte ich auch oft
bey dem Zusammenläuten der Glocken des Doms, welche um fünf Uhr die
Herren Geistliche in den Chor rufen.“ Zu Sophie de la Roche ist
zweimal Friedrich Schiller aus Mannheim zu Besuch gekommen. Dieser
schwärmt in einem Brief an Henriette von Wolzogen vom 13.November
1783 von der Speyererin mit einer köstlichen Formulierung: …
„die sanfte und geistvolle Frau , die zwischen fünfzig und sechszig
alt ist und das Herz eines neunzehnjährigen Mädchens hat.“ Die
Besucher zum Schmunzeln brachte Schineller mit den überaus
ehrlichen „Speyerer Jugenderinnerungen“ der Heimatdichterin Lina
Sommer (1862 bis 1932). Diese schreibt darin ausführlich vom
Friedensfest 1871 und der bis auf den Rand mit Wein gefüllten
„Dummschüssel“, die unter Missachtung (heute geltender)
Hygienevorschriften mit eigenen Bechern und Kaffeetassen
feuchtfröhlich geleert wurde. Den Speyerer Reigen schließt der 1975
in der Domstadt geborene und in Berlin lebende Schriftsteller
Thomas Lehr, dessen Roman „Fata Morgana“ 2010 beste Kritiken
erhielt.
Nach seinem Exkurs in die Politik – mit Zitaten der
Kanzler Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard
Schröder sowie Kreml-Chef Michail Gorbatschow, US-Präsident George
Bush und weiterer Besucher der Domstadt schloss der Ex-OB mit einem
Mundartgedicht von Ludwig Hartmann über „Die scheene alte Zeit“,
welche die Senioren sehr gut nachempfinden konnten. ws
Nächstes Erzählcafé am Dienstag,
4.November, 15 Uhr, Historischer Ratssaal; Schwester Miguela
O.P. spricht über Institut St.Dominikus und 55 Jahre
medizinische Versorgung in Afrika. Text: ws; Foto:
khj
06.10.2014
Erzählcafé informiert über Spezialschiffe auf dem Rhein …
-01.jpg) Speyer- Neben den Passagier- und
Transportschiffen stellte der langjährige Vorsitzende des
Schiffervereins, Günter Kuhn, Klapp-, Mess-, Hebe-, Bergungs- u.
Fährschiffe sowie Feuerlösch- und Polizeiboote vor.
Speyer- Neben den Passagier- und
Transportschiffen stellte der langjährige Vorsitzende des
Schiffervereins, Günter Kuhn, Klapp-, Mess-, Hebe-, Bergungs- u.
Fährschiffe sowie Feuerlösch- und Polizeiboote vor.
Als interessante Variante wurde mit einem
Ozeanriesen auf dem Werbeplakat eingeladen. „Diese großartigen
Passagierschiffe werden auf dem Rhein nicht fahren; ungenügende
Wassertiefe, niedrige Brücken, zu wenige Passagiere“, so der
ehemalige Berufsschiffer. Doch die Flusskreuzfahrten auf dem Rhein,
der Donau und anderen europäischen Strömen nehmen zu. Wie die
Mitglieder des Speyerer Schiffer-Vereins sehen, legen die KD
(Köln-Düsseldorfer) und die VIKING Schiffe an mindestens drei Tagen
pro Woche hier an. Die Gäste besuchen den Dom, bummeln in der
Stadt, werden nach Heidelberg oder an die Weinstraße gefahren.
Keine profitable Lösung für
Speyer
-01.jpg) Günter Kuhn beobachtet die Versorgung der Schiffe mit
Kühlwagen und Containern voll Lebensmittel, die aus Holland
angeliefert werden( Vollverpflegung an Bord). Auch Busse mit
osteuropäischen Kennzeichen werden eingesetzt. Selbst die
Liegegebühren versuchen die Kapitäne zu umgehen, indem die
Wartezeit durch „Ankern“ auf der „badischen Seite“ versucht wird.
Hier erfolgt das Verbot durch die Wasserschutzpolizei jedoch
umgehend.
Günter Kuhn beobachtet die Versorgung der Schiffe mit
Kühlwagen und Containern voll Lebensmittel, die aus Holland
angeliefert werden( Vollverpflegung an Bord). Auch Busse mit
osteuropäischen Kennzeichen werden eingesetzt. Selbst die
Liegegebühren versuchen die Kapitäne zu umgehen, indem die
Wartezeit durch „Ankern“ auf der „badischen Seite“ versucht wird.
Hier erfolgt das Verbot durch die Wasserschutzpolizei jedoch
umgehend.
„Die beiden Anlegestellen mit Zugang zu
den Schiffen am Speyerer Ufer liegen auf der
„Prallseite“(starker Strömungsdruck durch Flusskrümmung) und
bereiten besonders beim Ablegen ein kompliziertes Manöver, trotz
Bug- und Seiten-Strahl-Triebwerken. Lange Zeit war die
„Schleifspur“ solch eines missglückten Manövers an der
Uferbefestigung zu erkennen“, so Kuhn. Die kommunale
Wahlkampfforderung nach einer weiteren
Anlegestelle sollte unbedingt mit Fachleuten erörtert werden,
denn die nahe gelegene Salierbrücke verbietet dort eine
Anbringung.
Sicherheit durch Doppel-Hüllen-Schiffe und
ständige Fahrrinnenkontrolle
Die neuen Passagier- u. Transportschiffe auf
dem Rhein sind „doppelwandig“, haben Satellitensteuerung, Laser-u.
Radarhilfen und können so Tag und Nacht fahren.
-01.jpg) Lasten wie Schüttgut (Sand, Kies, Steine, Kohlen) sind in
Stauräumen durch Längs- u. Querschotten (Stahlwände) gesichert.
Container, in den Maschinen, Autos, Möbel usw. transportiert
werden, sind mit besonderen Sicherheitssystemen befestigt. Trotzdem
musste Günter Kuhn mit seinem „Hebebock“ mehrmals verlorene
Container im Rhein suchen und bergen. Die Strömung verschiebt diese
Container sehr schnell „zu Tal“ und sie gefährden dadurch weitere
Schiffe. Taucher und Froschmänner sind bei der Suche behilflich und
erledigen dabei einen lebensbedrohlichen Job.
Lasten wie Schüttgut (Sand, Kies, Steine, Kohlen) sind in
Stauräumen durch Längs- u. Querschotten (Stahlwände) gesichert.
Container, in den Maschinen, Autos, Möbel usw. transportiert
werden, sind mit besonderen Sicherheitssystemen befestigt. Trotzdem
musste Günter Kuhn mit seinem „Hebebock“ mehrmals verlorene
Container im Rhein suchen und bergen. Die Strömung verschiebt diese
Container sehr schnell „zu Tal“ und sie gefährden dadurch weitere
Schiffe. Taucher und Froschmänner sind bei der Suche behilflich und
erledigen dabei einen lebensbedrohlichen Job.
Die Messschiffe, erkennbar an den beiden
Seitenarmen mit Messpropellern, stellen mit Echograph die Breite,
die Hindernisfreiheit der Fahrrinne sicher und messen die
Fließgeschwindigkeit. Wie Kuhn ausführte, setzen Kies und
Uferbefestigung dem Wasser Reibung entgegen. In der mittleren
und oberen Flusszone gibt es keine Reibung, deshalb ist hier die
Abflussgeschwindigkeit höher. Bei Niedrig-, Mittel- und
Hochwasser entstehen gewaltige Unterschiede, welche der Kapitän bei
der Fahrt und Navigation berücksichtigen muss. Bei Niedrigwasser
sind 364m³/Sek., bei Mittlerem Hochwasser 617m³/Sek. und bei
Hochwasser steigt der Wert auf 4.440m³/Sek. Die Gefahr, die dabei
für den Schiffs-und Bootsverkehr entsteht, verlangt ein sofortige
Einstellung der Fahrt. Die Schiffsführer sind verpflichtet,
mehrmals täglich die Wasserstandsmeldungen und die damit
verbundenen Werte abzufragen und die Fahrt danach auszurichten.
Günter Kuhn und die Vereinsmitglieder zeigten Fotos vom Hochwasser
1955, wobei der Hochwasserpegel bei 8,76 m lag, die Altstadt „
unter Wasser setzte“ und Häuser nur über Notstiege oder mit
Booten zu erreichen waren. Im Jahre 1882 blieb der Pegel bei 8,86 m
lange Zeit stehen.
Erhaltung der 92 m Fahrrinne,
Kiesbeseitigung, Feuerbekämpfung
-01.jpg) Der rege Schiffsverkehr auf dem Rhein verlangt eine
Sicherung der Fahrrinne durch Bojen, welche auch auf
„Gefahrenquellen“ hinweisen. Das „ Kies- u. Sandgeschiebe“ schafft
aber oft Hindernisse, die markiert und mit Hilfe der „Eimerbagger“
beseitigt werden. Vor den Staustufen wird der Kies aufgehalten,
hinter dem Bauwerk nagt das strömende Wasser an den Fundamenten der
Bauwerke. Hier hilft der Einsatz der „Klappschiffe“. Mit Kies
beladen kann so ein Ausgleich auf der Flusssohle hergestellt
werden, indem Kies über die Bodenklappe in den Fluss geschüttet
wird. Obwohl genügend Wasser vorhanden ist, kann ein Feuer auf dem
Schiff nur von Feuerlöschbooten bekämpft werden. Mit dem
„Stäubesystem“ (Feuer berieseln) wird dem Feuer der Sauerstoff
entzogen und somit erstickt. Die Löschboote verfügen über
eine Innen-Überdruckkabine, die vor schädlichen Gasen
schützt. Der „Schottelantrieb“ befähigt das zu Boot zu
umfangreicher, schneller Positionierung.
Der rege Schiffsverkehr auf dem Rhein verlangt eine
Sicherung der Fahrrinne durch Bojen, welche auch auf
„Gefahrenquellen“ hinweisen. Das „ Kies- u. Sandgeschiebe“ schafft
aber oft Hindernisse, die markiert und mit Hilfe der „Eimerbagger“
beseitigt werden. Vor den Staustufen wird der Kies aufgehalten,
hinter dem Bauwerk nagt das strömende Wasser an den Fundamenten der
Bauwerke. Hier hilft der Einsatz der „Klappschiffe“. Mit Kies
beladen kann so ein Ausgleich auf der Flusssohle hergestellt
werden, indem Kies über die Bodenklappe in den Fluss geschüttet
wird. Obwohl genügend Wasser vorhanden ist, kann ein Feuer auf dem
Schiff nur von Feuerlöschbooten bekämpft werden. Mit dem
„Stäubesystem“ (Feuer berieseln) wird dem Feuer der Sauerstoff
entzogen und somit erstickt. Die Löschboote verfügen über
eine Innen-Überdruckkabine, die vor schädlichen Gasen
schützt. Der „Schottelantrieb“ befähigt das zu Boot zu
umfangreicher, schneller Positionierung.
Fragen der Zuhörer zu Schub- und
Koppelungsverbänden, RoRo-(Roll ab und fahre weiter; hierbei wird
der Ladeteil eines Lkw´s auf das Schiff gebracht, während der
Motorwagen neue Last herbeischafft) sowie zu Selbstfahrversuchen
und Unfällen auf dem wichtigsten Strom Deutschlands.
Die Anwesenden dankten mit herzlichem Beifall für
die Informationen bei Kaffee und Kuchen.
Text und Foto: Karl-Heinz Jung
06.09.2014
Erzählcafé vom 01.07.14 - Historische Rheinübergänge bei Speyer mit Rudi Höhl
 Historische
Rheinübergänge bei Speyer mit Rudi Höhl
Historische
Rheinübergänge bei Speyer mit Rudi Höhl
Speyer- Aus der Geschichte zeigt sich die
enge Verbundenheit der Stadt Speyer und des Umlandes mit den
rechtsrheinischen Städten und Gemeinden. Die Bewohner an beiden
Ufern haben sich trotz mancher Allüren von „Vater Rhein“ nie aus
den Augen verloren. Beweise hierfür lieferte Hobbyhistoriker Rudi
Höhl mit seinem fundierten Vortrag über die Entwicklung der
Rheinübergänge bei Speyer im gut besuchten Juli-Erzählcafé des
Seniorenbüros, das Moderator Karl-Heinz Jung mit einem Hinweis auf
die Zeunerschen Bronzeplastiken im Domgarten und einem lauten „Fährmann, hol über!“ eröffnete.
Als der damalige Fluss sehr breit und träge in vielen
Bogenschlingen und um die je nach Wasserhöhe gebildeten
Inseln dahinfloss, nutzten die Menschen mit Floßen und
Einbäumen geschickt die verschiedenen Strömungen und ruhigere
Fahrwässer um die andere Landseite zu erreichen, ging Höhl anfangs
bis in die Römerzeit zurück. Um die befestigten Handelsplätze und
militärischen Kastelle zu verbinden, entstanden bereits erste feste
Verbindungen und Landestellen. Eine Schenkung von König Karl eines
Fischer- und Bauerngehöfts nebst kleiner Kirche an den Abt
Gundeland vom Kloster Lorsch um 776 lieferte unter der Bezeichnung
Kezo Marca die ersten Hinweise auf das spätere Ketsch.
Stromaufwärts entstand der Weiler Luzheim. Als weitere wichtige
Ansiedlung stromaufwärts ist das Dorf Husen an der Furt
(Rheinhausen) urkundlich erst 1526 als im Besitz des Bischofs von
Speyer bekannt.
Für Spira ergab sich eine An- und Abfahrtsstelle, eine so
genannte Helle oder Lände am Gestade der Vorstadt Altspeyer über
mäanderartige Schlingen des Flusses hinüber nach Ketsch (ab 1228).
Das Ende dieser dem Domstift gehörenden Ablegestelle kam durch die
Abtrennung des Altrheinarmes und Aufschüttung des Eselsdamms im
Zuge der zweiten Dombauphase. Mit der Aufschüttung wollte Heinrich
IV. den starken Strom unterhalb des Ostteils des Doms abbremsen,
berichtete Rudi Höhl. Die Abfahrtsstelle für die meist von
Pferden getreidelte Fähre nach Ketsch musste zum Gehöft Spitzrhein
verlegt werden. Dort blieb sie auch, bis die Tullasche
Rheinregulierung 1835 dieser Verbindung das Aus bescherte.
.jpg) Die
zweite Fähre querte im Süden der Stadt, etwa ab 1290, nach
Lußheim, auch in die Besitzungen des Speyerer Bischofs, der in
Bruchsal Stadtherr war. Urkundlich erwähnt sind ferner Fähren bei
Rheinsheim (1191), Rheinhausen (1296) und Udenheim -Philippsburg
(1297). Nach nur wenigen Jahren wurde ein Fährbetrieb von
Mechtersheim nach Philippsburg wegen Gebiets- und Erbstreitigkeiten
aufgegeben.
Die
zweite Fähre querte im Süden der Stadt, etwa ab 1290, nach
Lußheim, auch in die Besitzungen des Speyerer Bischofs, der in
Bruchsal Stadtherr war. Urkundlich erwähnt sind ferner Fähren bei
Rheinsheim (1191), Rheinhausen (1296) und Udenheim -Philippsburg
(1297). Nach nur wenigen Jahren wurde ein Fährbetrieb von
Mechtersheim nach Philippsburg wegen Gebiets- und Erbstreitigkeiten
aufgegeben.
Für die freie Reichsstadt Speyer waren nach der Rheinbegradigung
die Lusheimer Fahr (heute Altlußheim), die husemer
(Rheinhäuser) und noch die kleiner Fähre bei Oberhausen die
herausragenden Verbindungen in die rechsrheinischen Gebiete. Höhl
erinnerte an regen Handel und zeigte colorierte Postkarten mit
Pferdekutschen und ersten Automobilen. Bewegt wurden die
Fähren meist von vier Ruderknechten, den Fergen. Du der
Fergenmeister trieb Gebühren und anfallenden Zoll ein, mal im
Dienst des Klerus oder der Stadt Speyer. Streitigkeiten über
Besitzrechte, kriegerische Auseinandersetzungen und
Beschlagnahmungen füllen laut Historiker Höhl „ein umfangreiches
Aktenmaterial“.
Eine besondere Bedeutung bekam die Rheinhäuser Fähre, als Kaiser
Maximilian I. 1490 eine schnelle Postverbindung einrichtete
zu seinem Sohn Philip ins belgische Mechelen. Regen
Fährverkehr brachten die Reichstage von 1526 und 1570. Die
aufstrebenden Städte wie Mannheim und Karlsruhe bewirkten ab 1669
eine Abschwächung des Fährbetriebs bei Speyer. Der kam nach
dem Pfälzischen Erbfolgekrieg 1688 bis 1697 ganz zum Erliegen.
Nachdem sich die Lage im 18. Jahrhundert normalisierte, kamen im
Rhein verstärkt so genannte „fliegende Brücken“, also Gierfähren
zum Einsatz.
Als 1720 Kurfürst Philip seine Residenz von Heidelberg nach
Mannheim verlegte, was Mannheim wirtschaftlichen Auftrieb gab,
wurde die „fliegende Brücke“ um 1835 durch eine Schiffsbrücke
ersetzt. Sie brachte eine schnellere Verbindung hinüber zur
Rheinschanze, dem späteren Ludwighafen. Große Veränderungen brachte
der Wiener Kongreß für die Pfalz. Die überregionalen Entscheidungen
wurden von München aus gesteuert und Speyer wurde
Kreishauptstadt des Bayerischen Rheinkreises. Der Rhein war
zur Ländergrenze geworden. Da die Schiffsbrücken für den
zunehmenden Gütertransport zum Bau von Eisenbahnen und
Fabrikgebäuden zu schwach waren, wurden feste Brücken mit
Bahngleisen gebaut, 1867 die Brücke von Ludwigshafen nach Mannheim.
Der Speyerer Plan, bei Rheinhausen eine Eisenbahnlinie in Richtung
Bruchsal zu bauen, wurde verworfen und nur eine Schiffsbrücke
errichtet und 1866 eingweiht. Dafür verlegte man die
Lussheimer Gierfähre nach Rheinhausen. Schon sechs Jahre später
verkaufte die Stadt Speyer die Schiffsbrücke an die Pfälzische
Ludwigsbahn Gesellschaft, die eine Gleisspur einrichtete. Eine in
Heidelberg gegründete Gesellschaft verfolgte den Bau einer
Eisenbahnlinie über Schwetzingen zum Rhein und den Anschluss an die
Speyerer Schiffsbrücke. Der Traum einer direkten Verbindung von
Neustadt bis nach Würzburg war indes nicht zu verwirklichen,
lediglich eine Abzweigung vom Speyerer Bahnhof
zum Rhein und eine Schmalspurbahn Neustadt-Speyer wurden
genehmigt.
.jpg) Wegen des
ständig steigenden Schiffsverkehrs musste die Schiffsbrücke bis zu
30 Mal am Tag geöffnet werden. Der Wunsch des Speyerer
Stadtrates nach einer festen Rheinbrücke wurde mehrfach
negativ beschieden. Erst Jahre 1929 und 1930 stellte die Regierung
die Mittel bereit. Der Spatenstich für die Speyerer Rheinbrücke
erfolgte am 23.September 1938, die Einweihung 1938. Nur ganze
sieben Jahre hielt die tolle Verbindung „von hiwwe nach driwwe“. Am
23.März 1945 wurde sie beim Rückzug von der Wehrmacht gesprengt,
die Fähren in Rheinhausen und Oberhausen wurden am badischen Ufer
gesprengt und versenkt. Schon am 31.März erbaute die
französische Armee an der Stelle der alten Speyerer
Schiffsbrücke eine Pontonbrücke und erweiterte ihre militärischen
Aktionen ins Badische.
Wegen des
ständig steigenden Schiffsverkehrs musste die Schiffsbrücke bis zu
30 Mal am Tag geöffnet werden. Der Wunsch des Speyerer
Stadtrates nach einer festen Rheinbrücke wurde mehrfach
negativ beschieden. Erst Jahre 1929 und 1930 stellte die Regierung
die Mittel bereit. Der Spatenstich für die Speyerer Rheinbrücke
erfolgte am 23.September 1938, die Einweihung 1938. Nur ganze
sieben Jahre hielt die tolle Verbindung „von hiwwe nach driwwe“. Am
23.März 1945 wurde sie beim Rückzug von der Wehrmacht gesprengt,
die Fähren in Rheinhausen und Oberhausen wurden am badischen Ufer
gesprengt und versenkt. Schon am 31.März erbaute die
französische Armee an der Stelle der alten Speyerer
Schiffsbrücke eine Pontonbrücke und erweiterte ihre militärischen
Aktionen ins Badische.
Nachdem die Westalliierten di Trizone im März 1948 schufen, war
eine Verbindung ohne Passierschein von beiden Rheinseiten wieder
möglich. Die Stadt Speyer nahm am 27.Oktober 1948 das Fährboot
„Katharina (im Volksmund die „Zonenkattel“) und im Dezember ein
zweites Boot, die „Karl Theodor“ in Dienst. So konnten Personen und
Fahrräder schnell übergesetzt werden. Im Februar 1950 erwarb Speyer
eine 40-Tonnen Schnellfähre „Pfalz“. Sie war dank
des revolutionären Voith-Schneider Antriebs sehr wendig und
schnell. In den sieben Jahren ihres Einsatzes beförderte sie
Millionen von Fußgängern und Radfahrern sowie rund zwei Millionen
Kraftfahrzeuge und Fuhrwerke. Mit der ab 1954 erbauten und am
3.November 1956 eingeweihten Salierbrücke und der 1974 in
Betrieb genommenen Pylon-Autobahnbrücke wurden die Pfalz und
Nordbaden ganz fest verbunden. Aber noch einmal kam alter Glanz zur
Anlegestelle der Rheinhäuser Fähre: Die Salierbrücke wurde wegen
Fahrbahnerneuerung ab 1.August 1977 für sechs Wochen komplett
gesperrt. Das schwere Schwimmbrückenbataillon 880 aus Bensheim
stellte für die Sanierungszeit eine 100 Tonnen schwere Flussfähre
vom Typ Bodan mit großer Ladekapazität. Schon bei der ersten
Überfahrt beförderte die Fähre elf Motorfahrzeuge. Erst zur
700-Jahr-Feier der historischen Fährverbindung zwischen Rheinhausen
und Speyer am 11.April 1995 wurde wieder ein kleines Fährboot,
zuerst die „Eberhard“, dann ab 1998 die „Neptun“ in Betrieb
genommen. Sie befördert im Sommer an Wochenenden Fußgänger und
Radfahrer. Im Einsatz ist auch noch die Kollerfähre über den Rhein.
Sie verbindet von Frühjahr bis in den Herbst, bei Stromkilometer
410, von mittwochs bis sonntags die Gemeinde Brühl mit der
linksrheinischen Kollerinsel.
Text: Schilling Foto: Karl-Heinz Jung
03.07.2014
RHEIN-PFALZ-STIFT unter neuer Leitung
 Engagiertes Team: Pflegedienstleitung Rebecca Zimmermann (l.) und Heim- und Verwaltungsleiter Thorsten Fitz (2.v.r.) übernehmen die Leitungsfunktion des RHEIN-PFALZSTIFT in Waldsee. Qualitätsmanagement-Beauftragte Beata Schumann (2.v.l.) und avendi- Regionaldirektor Thomas Gilow (r.) stehen ihnen weiterhin zur Seite.
Engagiertes Team: Pflegedienstleitung Rebecca Zimmermann (l.) und Heim- und Verwaltungsleiter Thorsten Fitz (2.v.r.) übernehmen die Leitungsfunktion des RHEIN-PFALZSTIFT in Waldsee. Qualitätsmanagement-Beauftragte Beata Schumann (2.v.l.) und avendi- Regionaldirektor Thomas Gilow (r.) stehen ihnen weiterhin zur Seite.
Waldsee- Zeit der Veränderung in Waldsee: Seit
kurzem steht die Pflegeeinrichtung RHEIN-PFALZSTIFT unter der
Leitung von Thorsten Fitz, dem neuen Heim- und Verwaltungsleiter.
Als Pflegedienstleitung komplettiert Rebecca Zimmermann das
erfahrene Führungsteam. Sie ist für Beata Schumann gekommen, die in
ihrer eigentlichen Aufgabe als Qualitätsmanagement- Beauftragte bei
avendi das RHEIN-PFALZ-STIFT weiterhin begleitet.
Heim- und Verwaltungsleiter Thorsten Fitz absolvierte zunächst
eine Ausbildung zum Krankenpfleger und arbeitete einige Jahre in
diesem Beruf, bevor er leitende Aufgaben übernahm. Die Arbeit mit
den ihm anvertrauten Menschen, das Leben und der Alltag in einer
Pflegeeinrichtung liegen ihm sehr am Herzen. Als gebürtiger
Mannheimer kennt er die Kurpfalzmetropole und die Umgebung
natürlich bestens. Thorsten Fitz freut sich, das Rhein- Pfalz-Stift
als Heim- und Verwaltungsleiter im bisherigen Stil weiterzuführen
und den Bewohnern hier ein Zuhause zum Wohlfühlen zu bieten.
Rebecca Zimmermann ist seit 2004 examinierte Altenpflegerin,
Leitungserfahrung hat sie seit 2007 gesammelt. Für die gebürtige
Schwetzingerin, deren Schwester als Heim- und Verwaltungsleitung in
der Einrichtung Service-Wohnen & Pflege PARKSTRASSE in Ketsch
arbeitet, stehen das Wohlergehen der Bewohner und die
Zusammenarbeit im Team an erster Stelle.
Ein derart gut aufgestelltes Führungsteam im Rhein-Pfalz-Stift
erlaubt es nun auch avendi- Regionaldirektor Thomas Gilow, sich
wieder seinen eigentlichen Aufgaben zu widmen. Das Haus, seine
Bewohner und Waldsee seien ihm in den vergangenen Monaten, in denen
er die Einrichtung interimsmäßig geleitet hat, sehr ans Herz
gewachsen, resümiert er. Thomas Gilow freut sich umso mehr über das
neue fachlich wie menschlich überzeugende Führungsteam
Fitz/Zimmermann. Im Rahmen seiner Arbeit als Regionaldirektor wird
er auch künftig regelmäßig in seinem Büro im RHEIN-PFALZ-STIFT
anzutreffen sein.
Das rund 3400 Quadratmeter große Areal des RHEIN-PFALZ-STIFT
erstreckt sich im Herzen von Waldsee. Die avendi Senioren Service
GmbH bietet hier nicht nur eine kompetente stationäre Pflege,
sondern auch eine sehr schöne Atmosphäre in einem übersichtlich
strukturierten und modernst ausgestatteten Haus mit 85 komfortablen
Einzelzimmern. Bewohner aller Pflegestufen werden hier liebevoll
versorgt, davon können sich Interessierte beim kostenlosen
Probewohnen überzeugen. Die kleinteiligen Wohngruppen und das
avendi-Konzept eröffnen den Bewohnern viel Raum für die persönliche
Entfaltung, das gemeinsame Erleben und die Pflege sozialer
Kontakte. Bewohner aller Pflegestufen werden hier versorgt. Ergänzt
wird das Angebot des Hauses um den PALLIATIV STÜTZPUNKT VORDERPFALZ
und das Pflegehotel.
Die avendi Senioren Service GmbH betreibt aktuell 17
Einrichtungen und vier mobile Pflegedienste mit Schwerpunkten in
der Metropolregion Rhein-Neckar, im Ortenaukreis sowie in den
Regionen Rhein-Main und Dessau-Roßlau / Weißenfels. Text und
Foto: avendi Senioren Service GmbH
05.06.2014
Speyer hätte Paris mehr als einen Monat mit Wein versorgen können
 Speyer- Einige Senioren hatten auf ein
Probier-Gläschen gehofft, wenn es schon eine gute Stunde lang rund
um den Ruländerwein ging. Aber die Kehlen blieben trocken beim
Vortrag von Stadtarchiv-Leiter Dr.Joachim Kemper, der sein Thema
„Speyer, der Ruländer und die Weinstadt am Rhein“ mit historischen
Bildern beleuchtete . Anhand einer Karte von 1821 zeigte Moderator
Karl-Heinz Jung einleitend auf, wie viele Rebstöcke in dieser Zeit
im Stadtgebiet standen – die meisten an Klöstern, wie dem St.
Magdalena-Kloster im Hasenpfuhl. Seine Erklärung hierfür: „Der Wein
war sauber, das Wasser nicht immer.“
Speyer- Einige Senioren hatten auf ein
Probier-Gläschen gehofft, wenn es schon eine gute Stunde lang rund
um den Ruländerwein ging. Aber die Kehlen blieben trocken beim
Vortrag von Stadtarchiv-Leiter Dr.Joachim Kemper, der sein Thema
„Speyer, der Ruländer und die Weinstadt am Rhein“ mit historischen
Bildern beleuchtete . Anhand einer Karte von 1821 zeigte Moderator
Karl-Heinz Jung einleitend auf, wie viele Rebstöcke in dieser Zeit
im Stadtgebiet standen – die meisten an Klöstern, wie dem St.
Magdalena-Kloster im Hasenpfuhl. Seine Erklärung hierfür: „Der Wein
war sauber, das Wasser nicht immer.“
In München, wo Kemper lange arbeitete, sind die
bayerisch-pfälzischen Verbindungen im Zeichen des Weines noch
lebendig, wies Kemper auf die Pfälzer Residenz–Weinstube am
Odeonsplatz hin. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet –
als Versuch, die Pfalz wieder an das rechtsrheinische Bayern
anzuschließen - und gehört noch heute dem Landesverband der
Pfälzer in Bayern. Die bayerische Wein-Propaganda war indes
vergebens. Im Jahr 1956 erhielt das Volksbegehren zur
„Wiedervereinigung“ in der Pfalz eine klare Absage.
Über 200 Jahre zurück liegt für die Weingeschichte der Stadt
wichtige „Entdeckung“ einer bis heute weit verbreiteten
Weißwein-Rebsorte zurück. 1711 erkannte der Speyerer Kaufmann
Johann Seger Ruland in einem von ihm erworbenen
Gartengrundstück den Wert und die Besonderheit zweier
Rebstöcke. Heute erinnert eine 1999 in der Marienstraße 2
angebrachte Hinweistafel in der Marienstraße 2 an den
Ruländer-Entdeckungsort. Wie der Speyerer Gymnasialkonrektor Georg
Litzel berichtet, soll Ruland den Traubenmost der beiden Rebstöcke
separat in ein kleines Fass abgefüllt und beim Verkosten des süßen
Rebensaftes im Sommer die Wirkung des Weines im Kopf verspürt
haben. Um die Mitte des 18.Jahrhunderts hatte in Speyer der
Ruländer, auch „vinum bonum“ (guter Wein) genannt, den Gänsfüßer
als beliebteste Rebsorte verdrängt. Im Versuchsanbau im
Staatsweingut in Neustadt-Mußbach wird der Gänsfüßer heute wieder
gepflegt und kann dort auch gekauft werden, informierte der
Stadtarchiv-Leiter.
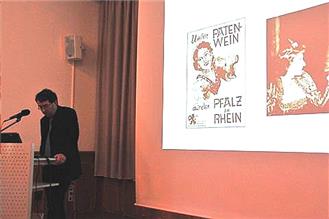 Der von vielen
Landesherren geförderte Ruländeranbau sorgte für eine
zunehmende Verbreitung dieser Rebsorte. Die rötlich-rot
gefärbte Ruländerrebe ist im deutschen Sprachraum unter der
Bezeichnung Grauburgunder bekannt und zu der Zeit von Rulands
„Entdeckung“ auch schon weit verbreitet gewesen. Man versteht
darunter die eher trockene Variante des Weines, während die
Bezeichnung „Ruländer“ in de Regel den lieblichen Ausbau der
Rebsorte aus reifen und zum Teil edelfaulen Trauben meint. In
Frankreich, Australien und Luxemburg, dominiert die Bezeichnung
Pinot gris, in Italien heißt der Grauburgunder Pinot grigio. Die im
Elsass lange gebräuchliche Sortenbezeichnung „Tokayer“ darf seit
kurzem aufgrund einer Klage aus Ungarn (Weinanbaugebiet Tokajer)
nicht mehr verwendet werden, erklärte Kemper.
Der von vielen
Landesherren geförderte Ruländeranbau sorgte für eine
zunehmende Verbreitung dieser Rebsorte. Die rötlich-rot
gefärbte Ruländerrebe ist im deutschen Sprachraum unter der
Bezeichnung Grauburgunder bekannt und zu der Zeit von Rulands
„Entdeckung“ auch schon weit verbreitet gewesen. Man versteht
darunter die eher trockene Variante des Weines, während die
Bezeichnung „Ruländer“ in de Regel den lieblichen Ausbau der
Rebsorte aus reifen und zum Teil edelfaulen Trauben meint. In
Frankreich, Australien und Luxemburg, dominiert die Bezeichnung
Pinot gris, in Italien heißt der Grauburgunder Pinot grigio. Die im
Elsass lange gebräuchliche Sortenbezeichnung „Tokayer“ darf seit
kurzem aufgrund einer Klage aus Ungarn (Weinanbaugebiet Tokajer)
nicht mehr verwendet werden, erklärte Kemper.
Im 19.Jahrhundert in der Pfalz zeitweise fast gänzlich vom
Silvaner verdrängt, kam es nach dem ersten Weltkrieg zum
Wiederaufschwung der leistungsfähigen Ruländerrebe, die erheblich
auf Klimaschwankungen reagiert und anfällig ist für
Rebkrankheiten und Schädlinge. Haupanbaugebiete des Ruländers sind
heute die Pfalz, Rheinhessen und Baden. In Deutschland wird
Grauburgunder auf 45000 Hektar angebaut, was etwa vier Prozent der
Rebfläche entspricht. Die in Speyer 1982 gegründete
Ruländer-Akademie hat sich der Dokumentierung der Herkunft
und Verbreitung des Ruländers verschrieben. Jährlich schreibt
die Akademie einen Ruländer-Wettbewerb aus und prämiert je einen
trocken und einen lieblich ausgebauten Pfälzer Wein dieser
 Rebsorte. Seit 32
Jahren darf sich Speyer laut Joachim Kemper ganz offiziell
wieder Weinbaugemeinde nennen. Der damals neu angelegte Wingert am
Tafelsbrunnen (Richtung Römerberg) umfasst elf Rebzeilen mit rund
660 Rebstöcken. Die Erntemenge liegt bei durchschnittlich 1000
Litern. Immerhin zweimal erhielt der Ruländerwein der Stadt die
„Bronzene Kammerpreismünze“, ein Mal gar die Silberne. Die Trauben
werden in Neustadt gekeltert und für die Stadtverwaltung in
0,7-Liter-Flaschen abgefüllt. Der Ruländer wird als
regelrechter Repräsentationswein gerne verschenkt, aber auch gerne
bei feierlichen Anlässen getrunken.
Rebsorte. Seit 32
Jahren darf sich Speyer laut Joachim Kemper ganz offiziell
wieder Weinbaugemeinde nennen. Der damals neu angelegte Wingert am
Tafelsbrunnen (Richtung Römerberg) umfasst elf Rebzeilen mit rund
660 Rebstöcken. Die Erntemenge liegt bei durchschnittlich 1000
Litern. Immerhin zweimal erhielt der Ruländerwein der Stadt die
„Bronzene Kammerpreismünze“, ein Mal gar die Silberne. Die Trauben
werden in Neustadt gekeltert und für die Stadtverwaltung in
0,7-Liter-Flaschen abgefüllt. Der Ruländer wird als
regelrechter Repräsentationswein gerne verschenkt, aber auch gerne
bei feierlichen Anlässen getrunken.
Dass Wein in de Domstadt stets große Bedeutung hatte und
ein großer Umschlagsplatz war, belegte Kemper mit einem Bericht aus
Frankreich nach der Stadtzerstörung 1689, in welchem beiläufig
erwähnt werde, dass man mit der Menge des in Speyer lagernden
Weines eine Großstadt wie Paris mehr als einen Monat hätte
versorgen können. Ws; Foto: khj
Zur Information:
Beim nächsten Erzählcafé am Dienstag, 1.Juli, 15 Uhr, im Seniorenbüro-Veranstaltungsraum im Maulbronner
Hof 1 A, erinnert Hobbyhistoriker Rudi Höhl an „Historische
Rheinübergänge bei Speyer“.
05.06.2014
Tag der Pflege: Diakonissen Seniorenzentren danken Mitarbeitenden
 Freundlicher Empfang zur Frühschicht im Diakonissen Seniorenstift Bürgerhospital
Freundlicher Empfang zur Frühschicht im Diakonissen Seniorenstift Bürgerhospital
Speyer- Den internationalen Tag der Pflege und
bundesweiten Aktionstag der Diakonie Deutschland am 12. Mai nahmen
die Diakonissen Seniorenzentren zum Anlass, sich bei den
Mitarbeitenden für ihr Engagement zu bedanken.
Pünktlich zu Beginn der ersten Schicht um 6 Uhr begrüßten das
Leitungsteam und Mitarbeitervertreter im Speyerer Seniorenstift
Bürgerhospital Mitarbeitende persönlich mit Blumen und einem
Frühstück to go. Ein kleines Dankeschön bekamen die überraschten
Mitarbeitenden auch mit auf den Weg: „Wir danken damit für die
tägliche Arbeit, die Freundlichkeit, die Professionalität und die
Zeit, die unsere Mitarbeitenden in der Pflege, der Hauswirtschaft,
Technik und Verwaltung zum Wohl unserer Bewohner einbringen“, sagt
Pflegedienstleiterin Sabine Seifert, die die Idee hatte, den
bundesweiten Aktionstag den Mitarbeitenden zu widmen.
Die tolle Idee haben auch andere Seniorenzentren der Diakonissen
Speyer-Mannheim aufgegriffen, so begrüßten Heimleiter Klaus-Dieter
Schneider und sein Führungsteam im Haus am Germansberg die
Mitarbeitenden der Früh- und Spätschicht mit einem kleinen
Dankeschön und einem Gutschein für ein Büffet, an dem sie sich im
Laufe des Tages mit allerlei Köstlichkeiten versorgen konnten. „Es
war gar nicht so einfach, die Aktion geheim zu halten, umso
schöner, dass die Mitarbeitenden so positiv überrascht von dieser
Form der Wertschätzung waren“, so Schneider.
 Ebenso erfreut waren die Mitarbeitenden, die
Heimleiterin Sabine Rumpf-Alles und Pflegedienstleiter Dado Plavsic
im Diakonissen Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden
jeweils zu Schichtbeginn persönlich mit einem kleinen Dankeschön in
Empfang nahmen.
Ebenso erfreut waren die Mitarbeitenden, die
Heimleiterin Sabine Rumpf-Alles und Pflegedienstleiter Dado Plavsic
im Diakonissen Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden
jeweils zu Schichtbeginn persönlich mit einem kleinen Dankeschön in
Empfang nahmen.
Neben den eigenen Aktivitäten für ihre Mitarbeitenden
beteiligten sich die Diakonissen Seniorenzentren an einer
bundesweiten Aktion von Diakonie Deutschland, in deren Zuge am 12.
Mai in allen 3.500 Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten der
Diakonie symbolisch Rettungspakete gepackt wurden. „Die Situation
der Altenpflege ist kritisch, da die Zahl der pflegebedürftigen
Menschen steigt, während die Arbeit der Pflegekräfte zu wenig
wertgeschätzt wird und die Finanzierung von Pflege nicht
ausreichend gesichert ist“, erklärt Pfarrer Dr. Werner Schwartz,
Vorsteher der Diakonissen Speyer-Mannheim. Daher freue er sich,
dass haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende, Bewohnerinnen und
Bewohner sowie Angehörige die Gelegenheit nutzten, ihre Wünsche auf
Postkarten zu formulieren, mit denen Diakonie Deutschland ihre
Forderung an die Bundesregierung untermauert, ein Rettungspaket für
die Altenpflege zu schnüren. Die Wünsche, die in den Diakonissen
Seniorenzentren gesammelt wurden, unterscheiden sich dabei kaum von
denen der Diakonie Deutschland, so geht es vor allem um mehr
Anerkennung für den Berufsstand, eine gerechtere Bezahlung und eine
Kürzung der bürokratischen Anforderungen im Alltag, um sich
intensiver um die Pflegebedürftigen kümmern zu können.
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
13.05.2014
55 Jahre Städtepartnerschaft Speyer-Chartres mit Dr. Christian Roßkopf (OB i.R.) im Erzählcafé
 Speyer- Am
25. Mai 1959 wurde die Urkunde von Oberbürgermeister Paulus Skopp
und seinem französischen Kollegen Joseph Pichard in Chartres
unterschrieben und somit die Partnerschaft zwischen beiden Städten
feierlich besiegelt. „Die Urkunde beruft sich auf eine gemeinsame
Tradition und beide Städte verpflichten sich mit dem
Dokument, beständige Verbindung zu pflegen, den Austausch der
Bürger zu fördern und damit die europäische Bruderschaft zu
stärken“(siehe Goldenes Buch der Partnerschaften).
Speyer- Am
25. Mai 1959 wurde die Urkunde von Oberbürgermeister Paulus Skopp
und seinem französischen Kollegen Joseph Pichard in Chartres
unterschrieben und somit die Partnerschaft zwischen beiden Städten
feierlich besiegelt. „Die Urkunde beruft sich auf eine gemeinsame
Tradition und beide Städte verpflichten sich mit dem
Dokument, beständige Verbindung zu pflegen, den Austausch der
Bürger zu fördern und damit die europäische Bruderschaft zu
stärken“(siehe Goldenes Buch der Partnerschaften).
Dr. Roßkopf, der die französische Partnerstadt oft
besucht und selbst den Weg dorthin mit dem Fahrrad schon
„erstrammelte“, erinnerte zu Beginn an die wichtigen
Entscheidungen des Europarates, der am gleich Tag in Wien
zusammenkam, um über drohende Kriegsgefahren in der
Ost-Ukraine zu beraten.
Weiter würdigte er die Gründung des Europarates vor
nun 65 Jahren, den EWG-Vertrag zur Vergemeinschaftung von Kohle und
Stahl durch Robert Schumann, Jean Monet und Konrad Adenauer,
die Väter Europas.
Speyer erhielt von den französischen Bischöfen beim
Bau der Bernhardus-Kirche eine großzügige Spende, die der Bischof
von Metz damals in bar überbrachte. Auch die Einweihung mit
Robert Schumann, Francois Poncet und Konrad Adenauer stellte einen
Höhepunkt der Beziehungen dar.
Gechichtliche Verbindungen beider Städte
 Dr. Roßkopf stellte
Speyer und Chartres als Schwesterstädte im besten Sinn des Begriffs
vor. Dies bezieht sich nicht nur auf den majestätischen romanischen
Dom und die weltberühmte gotische Kathedrale mit herrlichen
Glasfenstern sondern auch auf die Funde keltischen Ursprungs,
die bei Grabungen in beiden Städten immer wieder auftauchen.
Beide Bischofsstädte hatten einflussreiche Domschulen; in Chartres
wurde der französische Heinrich IV. gekrönt, Speyer war Stadt des
Reichskammergerichts bis 1688 und erlangte große Bedeutung durch
die Reichstage von 1526 und 1529. Besondere Erwähnung fand
auch Bernhard von Clairveaux , der an Weihnachten 1146 den
deutschen König Konrad III. im Speyerer Dom zum Kreuzzug
aufforderte.
Dr. Roßkopf stellte
Speyer und Chartres als Schwesterstädte im besten Sinn des Begriffs
vor. Dies bezieht sich nicht nur auf den majestätischen romanischen
Dom und die weltberühmte gotische Kathedrale mit herrlichen
Glasfenstern sondern auch auf die Funde keltischen Ursprungs,
die bei Grabungen in beiden Städten immer wieder auftauchen.
Beide Bischofsstädte hatten einflussreiche Domschulen; in Chartres
wurde der französische Heinrich IV. gekrönt, Speyer war Stadt des
Reichskammergerichts bis 1688 und erlangte große Bedeutung durch
die Reichstage von 1526 und 1529. Besondere Erwähnung fand
auch Bernhard von Clairveaux , der an Weihnachten 1146 den
deutschen König Konrad III. im Speyerer Dom zum Kreuzzug
aufforderte.
Der ehemalige Oberbürgermeister vergaß
ebenfalls nicht die Entstehung der Erbfeindschaft durch den
1689er Erbfolgekrieg von Ludwig XIV, die Revolutionskriege von 1700
bis 1814, den 1870/71er Krieg und die „Ehrverletzung“ der Franzosen
durch die dt. Reichsgründung in Versailles. Auch der vor 100 Jahren
begonnene 1. Weltkrieg und der II. Weltkrieg von
1939-1945 mit Millionen Toten, „schlugen Wunden beim
Gegner“.
Neue Epoche nach Kriegsende 1945
 „Nirgendwo hat
sich die Aussöhnung spontaner und überzeugender erwiesen als in der
Städtepartnerschaft, die als Freundschaft wahrgenommen wurde“, so
Dr. Roßkopf. Über 1000 Bürger aus Speyer und dem Umland fuhren in
einem Sonderzug 1972 nach Chartres, wo bereits weitere
„Chartresfreunde“ mit Pkw eingetroffen waren; 1969 waren 700
Besucher aus Chartres nach Speyer gekommen. Die
Pfingsttreffen „bewegten“ die Speyerer und die Chartrainer
wechselseitig in West- und Ostrichtung zur „Jumelage“.
„Nirgendwo hat
sich die Aussöhnung spontaner und überzeugender erwiesen als in der
Städtepartnerschaft, die als Freundschaft wahrgenommen wurde“, so
Dr. Roßkopf. Über 1000 Bürger aus Speyer und dem Umland fuhren in
einem Sonderzug 1972 nach Chartres, wo bereits weitere
„Chartresfreunde“ mit Pkw eingetroffen waren; 1969 waren 700
Besucher aus Chartres nach Speyer gekommen. Die
Pfingsttreffen „bewegten“ die Speyerer und die Chartrainer
wechselseitig in West- und Ostrichtung zur „Jumelage“.
Mit Hilfe der PowerPoint-Fotos konnte der
ehemalige Oberbürgermeister von vielen neuen
freundschaftlichen Verbindungen berichten:
Kriegsveteranen trafen sich, es gab
Schüleraustausch; Firmen, Verwaltungen, Baugenossenschaften, Banken
und Trachtengruppen organisierten Treffen. Besonders Künstler,
Sportvereine, die Feuerwehr und die Stadtgärtnereien erfanden
Freundschaftstreffen.
„Ein umfassender Geist gegenseitiger Sympathie,
Freundschaft und Verständigung hatte die Bürgerschaft von Chartres
und Speyer erfasst“, wie Dr. Roßkopf anhand von Fotos beweisen
konnte. Jubiläen wurden zu Volksfesten mit vielen Attraktionen in
Sälen und auf Plätzen. In den folgenden Jahren erwählte die
SKG ihre Faschingsprinzessin in Chartres. Ehen wurden über Grenzen
hinweg geschlossen, die Glaswerkstatt Loire baute Glasfenster in
Mannheim, Berlin, im Gebets- und Andachtsraum des Altenheims
der Bürgerhospitalstiftung ein, wo noch ein Segment im
Eingangsbereich des Neubaus zu bewundern ist.
Perspektiven der Städtepartnerschaft
 Die besondere
Bedeutung von Giscard d`Estaing, ehemaliger Präsident Frankreichs
und Helmut Schmidt, früherer deutscher Bundeskanzler,
erhalten den Deutsch-Französischen Medienpreis, für den neuen
Elan, den beide den deutsch-französischen Beziehungen verliehen
haben. Darin wird nach Dr. Roßkopf auch die Rolle der Nachbarländer
für die Einheit Europas gewürdigt. So könnten auch die
Städtepartnerschaften nach 55 Jahren sich weitere Situationen
suchen, um hilfreich das Rückgrat Europas zu stärken. „Das
Bewusstsein bleibender Zusammengehörigkeit und gleichzeitig
aufgeschlossen und neugierig für weiterführende Gemeinsamkeiten
sein, woraus weiterführende ASPEKTE und Anregungen zu erwarten
sind; im Bereich der Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr
und der politischen Praxis“, so der Wunsch von Herrn Dr.
Roßkopf.
Die besondere
Bedeutung von Giscard d`Estaing, ehemaliger Präsident Frankreichs
und Helmut Schmidt, früherer deutscher Bundeskanzler,
erhalten den Deutsch-Französischen Medienpreis, für den neuen
Elan, den beide den deutsch-französischen Beziehungen verliehen
haben. Darin wird nach Dr. Roßkopf auch die Rolle der Nachbarländer
für die Einheit Europas gewürdigt. So könnten auch die
Städtepartnerschaften nach 55 Jahren sich weitere Situationen
suchen, um hilfreich das Rückgrat Europas zu stärken. „Das
Bewusstsein bleibender Zusammengehörigkeit und gleichzeitig
aufgeschlossen und neugierig für weiterführende Gemeinsamkeiten
sein, woraus weiterführende ASPEKTE und Anregungen zu erwarten
sind; im Bereich der Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr
und der politischen Praxis“, so der Wunsch von Herrn Dr.
Roßkopf.
Der angemahnte neue Elan führte zu vielen
Wortmeldungen. Für den seit 1995 bestehenden Freundeskreis lud Herr
Ott die Anwesenden zu Gesprächen, Monatstreffen in die französische
Bibliothek, aber besonders zu den Aktivitäten im Rahmen der
55-Jahr-Feier ein.
Vom Theologiestudium im Kriegsgefangenlager
Chartres konnte Pfr. Bernhard Linvers berichten. Damals hatte Abbe
Stock unter der „schützenden Hand“ des damaligen
vatikanischen Nuntius, Angelo Roncali, dem späteren Papst Johannes
XXIII., theologische Vorlesungen und Prüfungen durchgeführt, die
später auch in Deutschland anerkannt wurden. So konnte auch der
spätere Domkapitular Johann Maria Dörr in der Kriegsgefangenschaft
sein Theologiestudium ausbauen.
Auch der Frankfurter Gemeinde- und Rundfunkpfarrer
Lothar Zenetti studierte während dieser Zeit im Lager
Chartres. Stefan Dreeßen, verantwortlich für die
Behindertenseelsorge der Diözese Speyer, berichtete von der
Unterschutzstellung der ehemaligen Lagerschuppen bei Chartres und
von der eingeleiteten Seligsprechung von Abbe Stock. Alles sind
positive Zeichen und muntern zum ergänzenden Erforschen von
Gemeinsamkeiten beider Städte auf.
Auch weiterführende Aspekte der
Stadtentwicklung im Bereich von Innenstadt-Parkdecks, der
Fußgängerzone und einer unkonventionellen Verkehrsführung mit Hilfe
mächtiger „Kalksteinpoller“, konnte Architekt Carl-Dieter
Schmitt, aufzeigen.
Für die detaillierten, umfangreichen, mit
Fotos ausgestalteten Ausführungen, gewürzt mit persönlichen
Erlebnissen von Dr. Christian Roßkopf, spendeten die etwa 80
Zuhörer reichlich Beifall und man war sicher, dass „Freundschaften
über Grenzen hinweg Gemeinsamkeiten schaffen können, auch
über Sprachbarrieren hinweg“. Text und Foto: Karl-Heinz
Jung
08.05.2014
Vom Kirchenfürst zum Kirchenführer
 Der
ehemalige Kirchenpräsident Eberhard Cherdron im
Erzählcafé
Der
ehemalige Kirchenpräsident Eberhard Cherdron im
Erzählcafé
Speyer- Gerne erinnert sich Eberhard Cherdron
an seine Zeit als Kirchenpräsident, ist aber jetzt auch froh und
glücklich, wenn er den Menschen, welche in die
Dreifaltigkeitskirche kommen, dieses Gotteshaus mit den
vielen Bildern näher bringen darf. So organisiert er seit seiner
Pensionierung den „Öffnungsdienst“ dieser Kirche.
Musikliebhaber Cherdron, der in der Freizeit die kleine Gamba
spielt, im Chor singt und bei vielen Aufführungen in Altenheimen
mitwirkt, ist gleich in seinem Element.
 „ Das
Deckengemälde der Barockkirche zeigt König David beim Harfenspiel.
Erin großes Orchester von Engeln mit verschiedenen Instrumenten
umschweben die Orgel, bis die heilige Cäcilia den Musikkreis
ergänzt“, so Eberhard Cherdron. „ Der umfangreiche Bilderschmuck an
den Emporen, meist eine Verbindung zwischen dem Alten und Neuen
Testament, stellt einen reichen Schatz dieses Gotteshauses dar, dem
man einen ganzen Erzählnachmittag widmen könnte. Die vorgesehene
Restaurierung der Bilder wird viele Monate in Anspruch nehmen,
damit bei der 300-Jahrfeier 2017 eine strahlende Bilderwelt zu
bestaunen sein wird“, so der Kirchenpräsident in Ruhe.
„ Das
Deckengemälde der Barockkirche zeigt König David beim Harfenspiel.
Erin großes Orchester von Engeln mit verschiedenen Instrumenten
umschweben die Orgel, bis die heilige Cäcilia den Musikkreis
ergänzt“, so Eberhard Cherdron. „ Der umfangreiche Bilderschmuck an
den Emporen, meist eine Verbindung zwischen dem Alten und Neuen
Testament, stellt einen reichen Schatz dieses Gotteshauses dar, dem
man einen ganzen Erzählnachmittag widmen könnte. Die vorgesehene
Restaurierung der Bilder wird viele Monate in Anspruch nehmen,
damit bei der 300-Jahrfeier 2017 eine strahlende Bilderwelt zu
bestaunen sein wird“, so der Kirchenpräsident in Ruhe.
Fragen der Zuhörer nach den Kosten, den Veränderungen bei der
Renovierung im Kirchenraum, ergänzten die Ausführungen.
Begleitet vom schönsten Wetter, ging die Wanderung in den
Maulbronner Hof los, wo auch alle Besucher, offensichtlich von der
Aussicht auf eine Tasse Kaffee gelockt, alsbald eintrafen.
 Dort
berichtete der ehemalige Kirchenpräsidenten erstmals einiges
über seine Bilderbuchkarriere. Nach dem Staatsexamen und einer
einjährigen Ausbildung im Predigerseminar Landau trat er seine
Vikariatsstelle an. Damit war es erstmals genug mit der
Theologie, es schloss sich das Studium der Volkswirtschaft in
Mannheim an, das er unter anderem damit finanzierte, dass er in der
Edith-Stein-Schule Religionsunterricht gab. Doch nach diesem
Studium trat er seine erste Pfarrstelle für drei Jahre in Neuhofen
an. Von dort berief man ihn als Landesjugendpfarrer nach
Kaiserslautern, wo er sich mit Freuden für sieben Jahre mit
Leib und Seele einbrachte.
Dort
berichtete der ehemalige Kirchenpräsidenten erstmals einiges
über seine Bilderbuchkarriere. Nach dem Staatsexamen und einer
einjährigen Ausbildung im Predigerseminar Landau trat er seine
Vikariatsstelle an. Damit war es erstmals genug mit der
Theologie, es schloss sich das Studium der Volkswirtschaft in
Mannheim an, das er unter anderem damit finanzierte, dass er in der
Edith-Stein-Schule Religionsunterricht gab. Doch nach diesem
Studium trat er seine erste Pfarrstelle für drei Jahre in Neuhofen
an. Von dort berief man ihn als Landesjugendpfarrer nach
Kaiserslautern, wo er sich mit Freuden für sieben Jahre mit
Leib und Seele einbrachte.
Nach weiteren sieben Jahren übernahm er die Leitung des
Diakonischen Werkes in Speyer und kehrte so zurück in seine
Heimatstadt. Vom Diakonischen Werk aus erfolgte die Wahl zum
Oberkirchenrat in der Landeskirche und zwar arbeitete er hier
zehn Jahre als Personaldezernent. 1998 erfolgte dann die Wahl zum
Kirchenpräsidenten.
Die Leitung einer Kirche geschehe allein durch das Wort, es
bestehe auch keine Richtlinienkompetenz, der Präsident ist im
Landeskirchenrat einer unter Gleichen. Die Dezernenten seien
selbstständig, ein Präsident kann nicht hineindirigieren. Beide
sind der Landessynode verantwortlich, von der sie auch gewählt
worden waren. Die einzige Möglichkeit des Hineindirigierens
wäre, den Dezernenten mit Zustimmung der Landessynode seine
Zuständigkeiten zu verändern. Im Ganzen handele es sich um eine
repräsentative Funktion, so Eberhard Cherdron.
 Während
des Dienstes ergeben sich viele Kontaktgespräche mit Politikern des
Landes, auch mit Repräsentanten der Kirchen anderer Länder und auch
Völker. Zusammen mit Pfarrer Linvers wies er auch auf die seit
Jahrzehnten gute Zusammenarbeit mit den Katholiken hin, ein
Verhältnis, das durch die Nähe der Sitze beider und die
Übereinstimmung der Grenzen profitiere.
Während
des Dienstes ergeben sich viele Kontaktgespräche mit Politikern des
Landes, auch mit Repräsentanten der Kirchen anderer Länder und auch
Völker. Zusammen mit Pfarrer Linvers wies er auch auf die seit
Jahrzehnten gute Zusammenarbeit mit den Katholiken hin, ein
Verhältnis, das durch die Nähe der Sitze beider und die
Übereinstimmung der Grenzen profitiere.
Auch das relativ gute Verhältnis zu den Pietisten wurde
erwähnt.
Gefragt nach dem, was in seiner Amtszeit als sehr gelungen zu
sehen sei, wies er auf die Restaurierung der Gedächtniskirche hin.
Negativ schien ihm die Tatsache, dass es in dieser Richtung mit der
Dreifaltigkeitskirche nicht richtig klappe.
Als Wunsch für seinen Nachfolger formulierte er die Hoffnung,
dass ihm die bisher so positiv aufgefallene freundliche Zuwendung
zu den Menschen erhalten bleibe.
Mit herzlichen Worten dankte Moderator Dr. Thomas Neubert für
die umfangreichen Ausführungen in der Dreifaltigkeitskirche und im
Seniorenbüro.
Text und Foto:khj
10.04.2014
Lieber von Glaser karikiert, als vom Leben gezeichnet
 Speyer- Eine Gruppe Senioren, die im Rahmen
der Reihe „Hören und Sehen“ des Seniorenbüros Speyer einer
Einladung von Hans Günther Glaser gefolgt waren sah dies genauso
und mancher Besucher lies sich karikieren.
Speyer- Eine Gruppe Senioren, die im Rahmen
der Reihe „Hören und Sehen“ des Seniorenbüros Speyer einer
Einladung von Hans Günther Glaser gefolgt waren sah dies genauso
und mancher Besucher lies sich karikieren.
Der stadtbekannte und beliebte Künstler porträtierte die
Besucher gegen einen kleinen Obolus und zeigte sein
Karikatur-Archiv, das zur allgemeinen Erheiterung der Gäste
beitrug. Hierin waren viele Speyerer Persönlichkeiten und bekannte
Politiker, nicht nur aus unserer Stadt, von ihm karikiert
worden.
„Das ist doch die Inge, das ist der Bernd“ wurden die
Gezeichneten erkannt. Auch Details wurden genau unter die Lupe
genommen, wie das Dekolleté und der Teil des Busens einer Dame. Es
wurde diskutiert, ob die dargestellte Größe den
damaligen Tatsachen entsprochen hätte.
Nach zwei Stunden mit netter Unterhaltung bedankte sich Karen
Plewa bei Glaser für die Einladung und benannte den nächsten Besuch
bei der Künstlerin Karin Germeyer-Kiem.
Text und Foto: Pressestelle Stadt Speyer
10.04.2014
Wolfgang German, ein Künstler mit Hand und Fuß
Speyer- Anlässlich der Reihe „Hören und Sehen“ des Seniorenbüros
hatte der Speyerer Künstler Wolfgang German zu einer Führung durch
die außergewöhnliche Welt seines Anwesens in der Großen
Pfaffengasse Nr. 7 eingeladen. Noch vor dem Betreten seines Hauses
stießen die 19 Gäste auf der Eingangstreppe auf einen angeketteten
Damenfuß aus Sandstein. Einen Blick auf die Hausfassade werfend,
entdeckten sie noch eine Hand, ebenfalls aus rotem
Sandstein.
Der Künstler empfing die Senioren und führte selbst durch seine
außergewöhnliche Wohnwelt, in der er Galerie, Atelier und Wohnung
faszinierend und reizvoll miteinander verbindet. Gemälde,
Kunstobjekte und Dinge des alltäglichen Lebens werden zur
Installation im Kunstraum. Die Betrachter wurden in Staunen,
Bewunderung und Überraschung versetzt. Im Rahmen einer gemütlichen
Kaffeetafel – von der Dame des Hauses liebevoll vorbereitet -
fand abschließend noch eine Gesprächsrunde statt. Ein besonders
beeindruckender Nachmittag blieb damit allen Beteiligten in
Erinnerung.
Pressestelle Stadt Speyer
10.04.2014
1,7 für avendi-Einrichtung Rhein-Pfalz-Stift
 Ein sehr gutes
Ergebnis für die Waldseer Pflegeeinrichtung der Mannheimer avendi
Senioren Service GmbH
Ein sehr gutes
Ergebnis für die Waldseer Pflegeeinrichtung der Mannheimer avendi
Senioren Service GmbH
Waldsee- Der Medizinische Dienst
der Krankenversicherungen (MDK) bewertete das Rhein-Pfalz-Stift mit
der Note 1,7. „Das ist für uns ein Zeichen, dass wir auf dem
richtigen Weg sind“, freut sich Thomas Gilow, Heimleiter und
avendi-Regionaldirektor, über dieses Ergebnis. Die Prüfer erkannten
die hohe Qualität und die guten Urteile der Bewohner an. „Es ist
unser Bestreben, ein sinnenfrohes, anregendes Umfeld zu gestalten,
in dem die Freude am Leben im Vordergrund steht“, so Thomas Gilow.
Dennoch sei das gute Abschneiden bei der MDK-Bewertung kein Grund
zum Stillstand, sondern vielmehr Ansporn: „Wir werden auch
weiterhin alles daran setzen, dass sich unsere Bewohner rundum
wohlfühlen und bestens versorgt sind. Bei uns steht immer der
Mensch im Mittelpunkt.“ Das spiegelt sich in der Einzelnote der
Befragung der Bewohner wider, die die Einrichtung mit der
Spitzennote 1,1 bewerteten.
Seit 2009 prüft der MDK deutschlandweit
unangekündigt Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste. Die
Ergebnisse müssen bundesweit veröffentlicht werden, sind also für
Pflegebedürftige, Angehörige und Interessierte ein wertvolles
Instrument der Vergleichbarkeit auf dem Weg zur Entscheidung für
ein Haus. Seit 1. Februar 2014 gelten für die Bewertung neue
Richtlinien. Ausgelöst worden war die Überarbeitung durch
Änderungen in den Pflegetransparenzvereinbarungen für die
stationäre Pflege und die Überarbeitung des
Pflege-Neuausrichtungsgesetz (PNG). Die Regelprüfung bezieht sich
auf die Qualität der Pflege und medizinischen Betreuung, des
Umgangs mit demenzkranken Bewohnern, der sozialen Betreuung und
Alltagsgestaltung sowie des Wohnens, der Verpflegung und der
Hauswirtschaft. Die Zufriedenheit der Bewohner einer Einrichtung
wird separat ermittelt und als eigene Note dargestellt.
Das Rhein-Pfalz-Stift verfügt über 85 Pflegeplätze
in Einzelzimmern. Beliebte Treffpunkte für die Bewohner und ihre
Gäste sind die großzügigen Wohnküchen sowie die Cafeteria im
Erdgeschoss. „In Waldsee bieten wir Pflegebedürftigen aller
Pflegestufen nicht nur ein Zuhause zum Wohlfühlen“, erläutert
Thomas Gilow. „Hier können Menschen, die auf Unterstützung
angewiesen sind, zudem allein oder gemeinsam mit ihren Angehörigen
Urlaub machen. Im Pflegehotel sind wir darauf bestens vorbereitet.
Gäste mit und ohne Pflegestufe können sich hier rundum verwöhnen
lassen und so erholen.“ Darüber hinaus ist das Rhein-Pfalz-Stift
durch die Kooperation mit dem Mannheimer Schmerztherapeut Dr.
Stefan Schramm seit März 2014 PALLIATIV STÜTZPUNKT VORDERPFALZ. Das
PALLIATIV CARE-Team steht mit spezialisierten Fachpflegekräften und
Ärzten Menschen mit fortgeschrittenen und unheilbaren Krankheiten
am Ende der Lebensphase zur Seite.“
Die avendi Senioren Service GmbH betreibt neben dem
Rhein-Pfalz-Stift in Waldsee weitere 16 Einrichtungen mit
regionalen Schwerpunkten in Baden-Württemberg und Sachsen-Anhalt.
Eine weitere Einrichtung in Bad Dürkheim ist derzeit in Planung.
Das Unternehmen ging 2001 aus der Entwicklung des Geschäftsbereichs
Senioren-Immobilien innerhalb der eigentümergeführten DIRINGER
& SCHEIDEL Unternehmensgruppe hervor.
avendi Senioren Service GmbH, Presse
08.04.2014
Ratgeber: Wohnen im Alter - Komfort ohne Barrieren
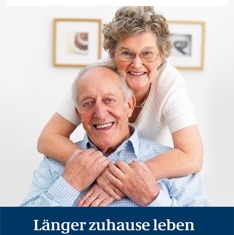 Die Ansprüche an die eigene Wohnumgebung verändern sich im
Laufe des Lebens. Ein Zuhause für die ganze Familie muss andere
Anforderungen erfüllen, als für ein Leben zu zweit nach dem Auszug
der Kinder. Der klassische Grundriss für Einfamilienhäuser der
1960er bis 1980er sah neben dem Keller einen abgetrennten Ess- und
Küchenbereich, Garderobe, Wohnzimmer, Schlafzimmer und
Gästetoilette im Erdgeschoss vor sowie Kinderzimmer, Bad und
Gästezimmer im Obergeschoss und einen geräumigen Dachboden, zu dem
nicht selten eine Holzleiter oder schmale Wendeltreppe
führte.
Die Ansprüche an die eigene Wohnumgebung verändern sich im
Laufe des Lebens. Ein Zuhause für die ganze Familie muss andere
Anforderungen erfüllen, als für ein Leben zu zweit nach dem Auszug
der Kinder. Der klassische Grundriss für Einfamilienhäuser der
1960er bis 1980er sah neben dem Keller einen abgetrennten Ess- und
Küchenbereich, Garderobe, Wohnzimmer, Schlafzimmer und
Gästetoilette im Erdgeschoss vor sowie Kinderzimmer, Bad und
Gästezimmer im Obergeschoss und einen geräumigen Dachboden, zu dem
nicht selten eine Holzleiter oder schmale Wendeltreppe
führte.
Nach dem Auszug der Kinder wird diese Raumaufteilung häufig für
viele Jahre beibehalten. Kinder und Enkelkinder sollen weiter zu
Besuch kommen oder es fehlen Ideen, wie der „verwaiste“ Wohnraum
auf die veränderte Lebenssituation angepasst werden kann. Erst wenn
das ständige Treppensteigen zu beschwerlich wird, der Rollstuhl
nicht durch die Zimmertüren passt oder sich Haustür- und
Balkonschwellen zu gefährlichen Stolperfallen entwickeln, wird die
seniorengerechte Wohnraum-Anpassung in Angriff genommen. Viele
Barrieren lassen sich mit relativ wenig Aufwand beseitigen. Wenn
Sie jedoch aufgrund wachsender Beeinträchtigungen den gesamten
Grundriss verändern oder umfassende Modernisierungsmaßnahmen
durchführen möchten, können die Kosten schnell die eigenen
Möglichkeiten übersteigen. Das gilt insbesondere, wenn Sie nicht
mehr berufstätig sind und eine vergleichsweise niedrige Rente
beziehen.
Auch der Zeitfaktor kann zu einem Problem werden. Wer nach einem
Unfall vorübergehend oder dauerhaft auf einen Rollstuhl angewiesen
ist, hat kaum Zeit für einen umfassenden behindertengerechten
Umbau. Auch wenn der Partner plötzlich pflegebedürftig wird, bleibt
für die sorgfältige Planung einer seniorengerechten Wohnung keine
Zeit. Experten raten daher, schon in jüngeren Jahren bei der
Renovierung oder Modernisierung von Eigenheim und Mietwohnung auf
Barrierefreiheit zu achten. Das spart nicht nur Zeit und Geld,
sondern garantiert, dass Komfort, Ästhetik und individuelle
Wohnwünsche angemessen berücksichtigt werden können.
Zum Ratgeber: 
09.03.2014
Ursula und Werner Thiele berichten im Erzählcafé
 Tanzschule Thiele vor der 90-Jahr-Feier voll in
Schwung…….
Tanzschule Thiele vor der 90-Jahr-Feier voll in
Schwung…….
Speyer- Albert Krüger(1903-1975)
ließ sich in der Frankfurter Ballettschule zum Lehrer für
Gesellschaftstanz ausbilden und eröffnete 1925 im angemieteten
Harmoniesaal des Wittelsbacher Hofes in Speyer eine Tanzschule.
Während er in Krieg und Kriegsgefangenschaft ist führte
seine Frau Hermine , geb. Bantz, die Tanzschule weiter. Mit
dem Fahrrad, dem Plattenspieler im Rucksack ging es nach
Ketsch, Berghausen, Schifferstadt, Otterstadt, Dudenhofen,
Harthausen, Geinsheim bis Gommersheim. Bezahlt wurden die Tanzkurse
mit Naturalien wie Kartoffeln, Gemüse, Brot, Wurst oder Brennholz.
Ehemann Albert munterte derweilen Kriegsgefangene mit Tanzschritten
auf. „Hungerjahre“ sind noch in Erinnerung, so Ursula
Thiele, 1937 geborene Tochter des Gründerehepaares Krüger, da sie
schon als junges Mädchen zu Tanzkränzchen mit durfte, „damit
sich das Kind mal satt essen konnte“, so die Erzählerin.
Hauptinhalt bleibt die Tanzschule in Speyer
und im Umkreis…
 Als Vater Albert als entlassener Kriegsgefangener wieder
in Speyer eintraf, ging das Tanzstundentraining umgehend in
gemieteten Räumen weiter.- So ist die Tanzstundenzeit in den
Cafés Hilzinger und Ebert, der Schwarz´schen Brauerei, dem
Domnapf, Sternemoos, Gambrinus, Wittelsbacher Hof, Goldener Adler,
im Katholischen Vereinshaus, bei der Rudergesellschaft, dem
Wassersportverein und im Pfarrzentrum St. Otto, vielen anwesenden-
Junggebliebenen in bester Erinnerung, wie in Redebeiträgen bekundet
wurde. Interessant ist auch Frau Thieles Aussage zu werten, „
dass Privatunterricht für Speyerer Prominenz im ausgeräumten
Wohnzimmer der Krügers arrangiert wurde“. Sie erzählte ganz
begeistert von ihrem Vater, der nach weiteren Prüfungen 1929
zum Mitglied der Fachprüfungskommission ernannt, mit 27 Jahren
seine erste Goldmedaille für Leistungen als Fachlehrer erhielt und
anerkannter Wertungsrichter mit zahlreichen Einsätzen bei
repräsentativen Turnieren wurde. „Er lehrte stets das Neueste,
vergaß aber nie die Vermittlung des Traditionellen. War dezenter
Regisseur bei der Polonaise, lenkte mit Charme und Witz schwierige
Tanzpassagen und wurde von Tanzschülern, wie bei mitbegründeten
Tischtennisclub, bei Billard und Schachfreunden liebevoll - Papa
Krüger - genannt“, so Ursula Thiele. Weiter berichtete sie,
dass ihr Vater mit seinen Neugründungen stets Glück hatte, so auch
mit dem „ Hobbykreis Grün-Gold“, aus dem sich später der
erfolgreiche Tanzsportclub entwickelte.
Als Vater Albert als entlassener Kriegsgefangener wieder
in Speyer eintraf, ging das Tanzstundentraining umgehend in
gemieteten Räumen weiter.- So ist die Tanzstundenzeit in den
Cafés Hilzinger und Ebert, der Schwarz´schen Brauerei, dem
Domnapf, Sternemoos, Gambrinus, Wittelsbacher Hof, Goldener Adler,
im Katholischen Vereinshaus, bei der Rudergesellschaft, dem
Wassersportverein und im Pfarrzentrum St. Otto, vielen anwesenden-
Junggebliebenen in bester Erinnerung, wie in Redebeiträgen bekundet
wurde. Interessant ist auch Frau Thieles Aussage zu werten, „
dass Privatunterricht für Speyerer Prominenz im ausgeräumten
Wohnzimmer der Krügers arrangiert wurde“. Sie erzählte ganz
begeistert von ihrem Vater, der nach weiteren Prüfungen 1929
zum Mitglied der Fachprüfungskommission ernannt, mit 27 Jahren
seine erste Goldmedaille für Leistungen als Fachlehrer erhielt und
anerkannter Wertungsrichter mit zahlreichen Einsätzen bei
repräsentativen Turnieren wurde. „Er lehrte stets das Neueste,
vergaß aber nie die Vermittlung des Traditionellen. War dezenter
Regisseur bei der Polonaise, lenkte mit Charme und Witz schwierige
Tanzpassagen und wurde von Tanzschülern, wie bei mitbegründeten
Tischtennisclub, bei Billard und Schachfreunden liebevoll - Papa
Krüger - genannt“, so Ursula Thiele. Weiter berichtete sie,
dass ihr Vater mit seinen Neugründungen stets Glück hatte, so auch
mit dem „ Hobbykreis Grün-Gold“, aus dem sich später der
erfolgreiche Tanzsportclub entwickelte.
Ursula Krüger und Werner
Thiele…..
Ursula und Werner lernten sich 1953 in der
Tanzstunde in Speyer kennen. Werner Thiele, damals wohnhaft in
Ludwigshafen, hatte von seinem Opa 20 DM zur Anzahlung erbettelt
und so den Weg zu seinem Lebensglück geebnet. Später raste er
jedes Wochenende mit dem Motorrad von Esslingen zu seiner
Freundin. Die Hochzeit wurde 1957 gefeiert, in
den nächsten Jahren kamen die Kinder Ulla, Peter und Monika zur
Welt. Während dieser Zeit absolvierten Ursula und Werner Thiele die
Tanzlehrer- und Tanzsporttrainer-Ausbildung. Bereits 1968 übertrug
„ Seniorchef Albert“ die Leitung der Tanzschule an Tochter und
Schwiegersohn.
Endlich eigene Räume mit neuem
Kursangebot…….
 Nach einigen Schwierigkeiten konnte 1973 der Neubau in der
Raiffeisenstraße in herrlicher Umgebung, mit großem
Parkplatz, viel Tageslicht, vom Stadtzentrum gut erreichbar,
bezogen werden. Ballett, Gymnastik, Yoga, Jazztanz wurden von den
engagierten Gisèle Santoro ( Brasilien) und Anneliese Theobald
angeboten. Weitere Tanzkreise entstanden. Werner und Ursula Thiele
hielten sich jahrelang bei erfolgreichen Profiturnieren (Slowfox/
Samba) für ihren Club fit. Schmunzelnd erzählte Herr Thiele vom
verlorenen Unterkleid seiner Partnerin und den Problemen mit seiner
„ verjüngenden“ Perücke. Als Landestrainer,
Fachbeiratsmitglieder, Übungsleiter, Wertungsrichter wurden Ehepaar
Thiele verpflichtet. Ursula Thiele berichtete, dass alle drei
Kinder schon früh die Liebe zum Tanzen entdeckten. Peter für Boogie
und Rock`n Roll, Monika tanzt Turnier in der
lateinamerikanischen Sektion, wurde Landesmeister in der D-und
C-Klasse. Ulla begeisterte sich nach der klassischen
Ballettausbildung auch für Jazz-, Step-Tanz, Rock`n Roll und
gewann mehrere Landesmeisterschaften im Standard und Latein.
Nach einigen Schwierigkeiten konnte 1973 der Neubau in der
Raiffeisenstraße in herrlicher Umgebung, mit großem
Parkplatz, viel Tageslicht, vom Stadtzentrum gut erreichbar,
bezogen werden. Ballett, Gymnastik, Yoga, Jazztanz wurden von den
engagierten Gisèle Santoro ( Brasilien) und Anneliese Theobald
angeboten. Weitere Tanzkreise entstanden. Werner und Ursula Thiele
hielten sich jahrelang bei erfolgreichen Profiturnieren (Slowfox/
Samba) für ihren Club fit. Schmunzelnd erzählte Herr Thiele vom
verlorenen Unterkleid seiner Partnerin und den Problemen mit seiner
„ verjüngenden“ Perücke. Als Landestrainer,
Fachbeiratsmitglieder, Übungsleiter, Wertungsrichter wurden Ehepaar
Thiele verpflichtet. Ursula Thiele berichtete, dass alle drei
Kinder schon früh die Liebe zum Tanzen entdeckten. Peter für Boogie
und Rock`n Roll, Monika tanzt Turnier in der
lateinamerikanischen Sektion, wurde Landesmeister in der D-und
C-Klasse. Ulla begeisterte sich nach der klassischen
Ballettausbildung auch für Jazz-, Step-Tanz, Rock`n Roll und
gewann mehrere Landesmeisterschaften im Standard und Latein.
Europameister zu Gast in
Speyer…..
René Sagarra- Rock ´n Roll Europameister und
Fred Traguth kamen zur Tanzschule Thiele. Für die Lateinschulung
fand World-Cup-Siegerin Ute Streicher den Weg in die Domstadt.
Pierre Dulaine und Yvonne Marceau aus New York tanzten auf
zwei Sonntagsparties hier ihre berühmte
Weltmeisterschaftsshow. Die 13-fachen Weltmeister Bill
und Bolbie Irvine sowie die Weltmeister Markus und Karen Hilton
kamen zu Festbällen nach Speyer, wie Werner Thiele erzählte.
Seit 1997 gibt die dritte Generation die
Tanzschritte vor…..
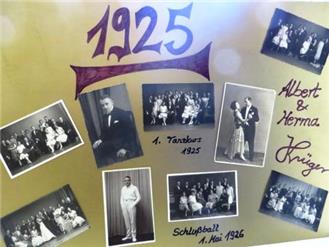 Nach der Ausbildung zu Tanzlehrern bei Weltmeister
Trautz und Opitz-Hädrich stiegen Ulla und Peter verstärkt an der
Raiffeisenstraße ein. Ulla gründete die „ Pink Panther“, Peter
organisierte eine quirlige Booggieformation, woraus Marc Stegmann
und Sabine Zillmann 1993 hervorgingen, welche vor 3000
Zuschauern den 1. Platz ertanzten und Deutschland in New York
vertreten durften. Mike Appelmann und Petra Fedlmeier ergänzen den
Tanzlehrerkreis. „Mit Wehmut im Herzen“, so Ursula und Werner
Thiehle, „ denken wir an schöne Jahre als Tanzlehrer zurück“. In
besonderer Erinnerung blieben die Verleihung der Ehrennadel in Gold
vom Landessportverband, die Silbermedaille des Deutschen
Tanzsportverbandes und die Sportmedaille der Stadt Speyer, so die
Erzähler.
Nach der Ausbildung zu Tanzlehrern bei Weltmeister
Trautz und Opitz-Hädrich stiegen Ulla und Peter verstärkt an der
Raiffeisenstraße ein. Ulla gründete die „ Pink Panther“, Peter
organisierte eine quirlige Booggieformation, woraus Marc Stegmann
und Sabine Zillmann 1993 hervorgingen, welche vor 3000
Zuschauern den 1. Platz ertanzten und Deutschland in New York
vertreten durften. Mike Appelmann und Petra Fedlmeier ergänzen den
Tanzlehrerkreis. „Mit Wehmut im Herzen“, so Ursula und Werner
Thiehle, „ denken wir an schöne Jahre als Tanzlehrer zurück“. In
besonderer Erinnerung blieben die Verleihung der Ehrennadel in Gold
vom Landessportverband, die Silbermedaille des Deutschen
Tanzsportverbandes und die Sportmedaille der Stadt Speyer, so die
Erzähler.
Weiter Sprung in der Zeit von 1925-
2014…….
Vom Charleston zum Video-Clip-Dancing, vom Tanzkurs
in gemieteten Räumen zum Tanzzentrum mit vier Sälen und einer
Tanzfläche von 450 qm, wo mehr als tausend Menschen wöchentlich
ihre Freizeit verbringen. Vom Ein-Mann-Unternehmen zu sieben
Tanzlehrern und 20 Angestellten. Von Kleiderpflicht, Tanz und
Handschuhe zu Jeans und Turnschuhen. Die Tanzschüler werden jünger,
die Nervosität ist wie früher und trotzdem macht es Spaß zu tanzen,
so der Tenor von Ehepaar Thiele und den Anwesenden. Die
Gesundheitsförderung für Herz und Kreislauf hob Moderator
Dr.Thomas Neubert noch hervor und wünschte allen „frohes
Tanzen“. Text und Foto: khj
08.03.2014
Speyerer Wirtschaftsgeschichten im Erzählcafé
 Biertresen wurden durch Einkaufstheken
ersetzt
Biertresen wurden durch Einkaufstheken
ersetzt
Speyer- Unmöglich, in
eineinhalb Stunden die enorme Lokalgeschichte der alten Speyerer
Gaststätten erschöpfend und damit lückenlos in Wort und Bild
darzustellen. Dipl.-Archivarin Katrin Hopstock, beim Stadtarchiv
für das Kulturelle Erbe verantwortlich, hatte für das
Februar-Erzählcafé des Seniorenbüros über 50 historische Fotos
ausgewählt und eine Powerpoint-Präsentation für die
Wirtschaftsgeschichte zusammengestellt. In dieser
„Lokalrunde“ wurde den rund einhundert Gästen klar, warum
Speyer sich rühmt, in Relation zur Einwohnerzahl die Stadt mit der
größten Kneipendichte in Deutschland zu sein. Vor dem Mauerfall
soll den Spitzenplatz West-Berlin innegehabt, Speyer auf Platz zwei
gelegen haben.
Wer heute durch die Innenstadt läuft, kann es kaum
glauben, dass die Domstadt so viel „Wirtschaftskraft“ vorweisen
kann. Denn inzwischen sind die meisten der einst in der
Maximilianstraße angesiedelten Wirtshäuser wirklich nur noch
Lokal-Geschichte und machte eine ganze Reihe von Biertresen Platz
für Einkaufstheken.
 Am heutigen Postplatz residierte einstmals eine der
vielen Speyerer Brauereien. Die Brauerei Zum Storchen
gab ums Jahr 1900 dem Areal seinen Namen „Storchenplatz“ (mit
großräumiger Pferdetränke), ehe die Brauerei in ihre
Neubauten in der Oberen Langgasse umzog. Das
Abbruchmaterial verwendete die Stadt zur Jahrhundertwende zum Bau
des Festplatzes. Geschichte ist auch die Spanische Weinhalle
„Zur Stadt Barcelona“, in der bereits 1862 Wein ausgeschenkt worden
sein soll. Roberto Serra hat in dem früher als Gilgenstraße 3
geführten Anwesen neben dem direkt benachbarten Bayerischen
Hof (heute Schuhgeschäft) von 1914 bis Sommer 1917 eine
Weinwirtschaft betrieben, dann ging das Gebäude in den Besitz von
Fritz Detzner über, der es als „Weinstube Detzner“ führte. Die
Gaststätte, von 1952 in „Zum Falken“ umbenannt, war noch 1996 in
Familienbesitz, zuletzt nach umfangreicher Renovierung als „Bistro
am Altpörtel“. Auch eine Bürgerinitiative konnte 1958 nicht den
Abriss der beliebten Weinwirtschaft „Zum Rössel“ in der
Gilgenstraße 7/8, Geburtshaus des Pfälzer Heimatdichters Fridrich
Blaul und ein 200 Jahre altes Fachwerkhaus, verhindern. Nach Fritz
Wirth stillte in den
Am heutigen Postplatz residierte einstmals eine der
vielen Speyerer Brauereien. Die Brauerei Zum Storchen
gab ums Jahr 1900 dem Areal seinen Namen „Storchenplatz“ (mit
großräumiger Pferdetränke), ehe die Brauerei in ihre
Neubauten in der Oberen Langgasse umzog. Das
Abbruchmaterial verwendete die Stadt zur Jahrhundertwende zum Bau
des Festplatzes. Geschichte ist auch die Spanische Weinhalle
„Zur Stadt Barcelona“, in der bereits 1862 Wein ausgeschenkt worden
sein soll. Roberto Serra hat in dem früher als Gilgenstraße 3
geführten Anwesen neben dem direkt benachbarten Bayerischen
Hof (heute Schuhgeschäft) von 1914 bis Sommer 1917 eine
Weinwirtschaft betrieben, dann ging das Gebäude in den Besitz von
Fritz Detzner über, der es als „Weinstube Detzner“ führte. Die
Gaststätte, von 1952 in „Zum Falken“ umbenannt, war noch 1996 in
Familienbesitz, zuletzt nach umfangreicher Renovierung als „Bistro
am Altpörtel“. Auch eine Bürgerinitiative konnte 1958 nicht den
Abriss der beliebten Weinwirtschaft „Zum Rössel“ in der
Gilgenstraße 7/8, Geburtshaus des Pfälzer Heimatdichters Fridrich
Blaul und ein 200 Jahre altes Fachwerkhaus, verhindern. Nach Fritz
Wirth stillte in den  Zwanziger Jahren Karl Durst den Durst der Gäste, was
ab 1939 „Schorsch“ Hornbach übernahm. Dieser war Mitbegründer der
Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) und im Vorstand des
Verkehrsvereins aktiv. Während „Landauer Tor“ und „Goldene Rose“ in
der Gilgenstraße von der Bildfläche verschwanden, haben sich
der „Goldene Engel“ dort gehalten. Das Gasthaus und somit der
Grundstein des heutigen Hotelkomplexes entstand ums
Jahr 1700 und zählt nach Hopstocks Recherche zu den ältesten
Speyerer Gaststätten. Das Gelände erwarb um 1870 der Bäcker Michael
Schäfer. Dessen Sohn Josef nutzte 1899 bei der Neugestaltung
des „Storchenplatzes“ die Gunst der Stunde und errichtete
neben dem Goldenen Engel eine weitere Gaststätte, der er den
freigewordenen Namen „Zum Storchen“ gab. Als das Wirtshaus
1932 in den Besitz der Bellheimer Brauerei Silbernagel
überging, wurde es in „Zum Pfalzgrafen“ umbenannt.
Zwanziger Jahren Karl Durst den Durst der Gäste, was
ab 1939 „Schorsch“ Hornbach übernahm. Dieser war Mitbegründer der
Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) und im Vorstand des
Verkehrsvereins aktiv. Während „Landauer Tor“ und „Goldene Rose“ in
der Gilgenstraße von der Bildfläche verschwanden, haben sich
der „Goldene Engel“ dort gehalten. Das Gasthaus und somit der
Grundstein des heutigen Hotelkomplexes entstand ums
Jahr 1700 und zählt nach Hopstocks Recherche zu den ältesten
Speyerer Gaststätten. Das Gelände erwarb um 1870 der Bäcker Michael
Schäfer. Dessen Sohn Josef nutzte 1899 bei der Neugestaltung
des „Storchenplatzes“ die Gunst der Stunde und errichtete
neben dem Goldenen Engel eine weitere Gaststätte, der er den
freigewordenen Namen „Zum Storchen“ gab. Als das Wirtshaus
1932 in den Besitz der Bellheimer Brauerei Silbernagel
überging, wurde es in „Zum Pfalzgrafen“ umbenannt.
 Auf mehr als 220 Jahre bewegte Lokalgeschichte kann auch
die Weinstube „Schwarzamsel“ verweisen. Nachdem bis 1814
zunächst eine Metzgerei in dem Anwesen beheimatet war,
errichtetete Heinrich Brinkmann um 1850 die „Restauration zum
Hahnen“ ein. Um 1914 nannte Karl Schirmer die Wirtschaft in
„Schwarzamsel“ um. Viel gab’s auch zu erzählen über das
„Stermemoos“ in der Karlsgasse. In dem 1714 erbauten
Haus gründete Bierbrauer Wilhelm Hahn 1834 das Gasthaus
„Zum Stern“. Um 1870 erwarb es Heinrich Moos. Da es um diese Zeit
viele Familien mit Namen Moos in Speyer gab, erhielt es den
Beinamen und schließlich die Gaststättenbezeichnung „Zum
Sternemoos“. Im Frühjahr 1960 kam das aus für das
Wirtshaus.
Auf mehr als 220 Jahre bewegte Lokalgeschichte kann auch
die Weinstube „Schwarzamsel“ verweisen. Nachdem bis 1814
zunächst eine Metzgerei in dem Anwesen beheimatet war,
errichtetete Heinrich Brinkmann um 1850 die „Restauration zum
Hahnen“ ein. Um 1914 nannte Karl Schirmer die Wirtschaft in
„Schwarzamsel“ um. Viel gab’s auch zu erzählen über das
„Stermemoos“ in der Karlsgasse. In dem 1714 erbauten
Haus gründete Bierbrauer Wilhelm Hahn 1834 das Gasthaus
„Zum Stern“. Um 1870 erwarb es Heinrich Moos. Da es um diese Zeit
viele Familien mit Namen Moos in Speyer gab, erhielt es den
Beinamen und schließlich die Gaststättenbezeichnung „Zum
Sternemoos“. Im Frühjahr 1960 kam das aus für das
Wirtshaus.
 An das sehr beliebte „Café Ihm“ neben dem Altpörtel
und das Café-Restaurant Schwesinger“ (heute im Besitz der Deutschen
Bank) am Postplatz erinnerten sich noch viele
Erzählcafe-Besucher. Auch an „Pfälzer Hof“, „Rodensteiner“,
„Domschänke“ und Pfennig-Liesel Jesters
guten alten „Weidenberg“ am St.Guido-Stiftsplatz wurde erinnert.
Fehlen durfte auch nicht der „Halbmond“, das beliebte
Fachwerk-Fotomotiv an der Sonnenbrücke.
An das sehr beliebte „Café Ihm“ neben dem Altpörtel
und das Café-Restaurant Schwesinger“ (heute im Besitz der Deutschen
Bank) am Postplatz erinnerten sich noch viele
Erzählcafe-Besucher. Auch an „Pfälzer Hof“, „Rodensteiner“,
„Domschänke“ und Pfennig-Liesel Jesters
guten alten „Weidenberg“ am St.Guido-Stiftsplatz wurde erinnert.
Fehlen durfte auch nicht der „Halbmond“, das beliebte
Fachwerk-Fotomotiv an der Sonnenbrücke.
Pfarrer i.R. Bernhard Linvers übernahm für die
kurzfristig verhinderte Archivarin Hopstock die Präsentation der
Wirtschaften-Geschichte, unterstützt von „Schwanen“-Gastwirtssohn
Erich Cordes. Er plauderte etwas aus dem Nähkästchen und erzählte
davon, wie er ab 1956 nach dem Tod des Großvaters im zarten
Alter von neun Jahren im Lokal in der Johannesstraße (am
„Schwanebuckel“) im Lokal mit anpacken und einmal die
Woche die schweren Löwenbräu-Holzfässer vom Güterbahnhof
abholen musste. Ständiger Biergeruch und die starken Rauchschwaden
im „Schwanen“ hätten ihm später an der Übernahme des Lokals
gehindert, verriet Cordes. ws; Foto: Stadtarchiv
Speyer
05.02.2014
95 Jahre GBS und ihre Entwicklung, spannende Geschichten im Erzählcafé
 ws.Speyer- Die
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist noch heute größer als das
Angebot, das die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS)
seinen Mitgliedern machen kann. An die Anfänge vor 95 Jahren und
die Entwicklung der GBS erinnerten Aufsichtsratsvorsitzende Elke
Jäckle und der frühere kaufmännische Vorstand Bernhard Mückain im
Januar-Erzählcafé des Seniorenbüros. „Ich kenne keine andere
gesellschaftsrechtliche Form, die dem Wohle seiner Mitglieder in
ähnlicher Weise Rechnung trägt“, stellte Mückain die Speyerer
Baugenossenschaft als „etwas Besonderes“ heraus. Zuvor hatte es nur
in Pirmasens und Ludwigshafen Wohnungsbaugesellschaften
gegeben.
ws.Speyer- Die
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist noch heute größer als das
Angebot, das die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS)
seinen Mitgliedern machen kann. An die Anfänge vor 95 Jahren und
die Entwicklung der GBS erinnerten Aufsichtsratsvorsitzende Elke
Jäckle und der frühere kaufmännische Vorstand Bernhard Mückain im
Januar-Erzählcafé des Seniorenbüros. „Ich kenne keine andere
gesellschaftsrechtliche Form, die dem Wohle seiner Mitglieder in
ähnlicher Weise Rechnung trägt“, stellte Mückain die Speyerer
Baugenossenschaft als „etwas Besonderes“ heraus. Zuvor hatte es nur
in Pirmasens und Ludwigshafen Wohnungsbaugesellschaften
gegeben.
„Hilfe zur Selbsthilfe" - unter diesem Motto stand die Gründung
des Unternehmens im Februar 1919, als die Wohnungsnot nach dem
Ersten Weltkrieg enorm groß war und dringend preiswerter Wohnraum
benötigt wurde. Die Initiative zur Gründung ging vom damaligen
Bürgermeister Dr. Otto Moericke aus. Als erste Maßnahme wurden 39
Wohnungen in 24 Einfamilien-Reihenhäusern und drei
Fünffamilienhäusern in der Peter-Drach-Straße und der Blaulstraße,
der GBS-Keimzelle, gebaut. Die Baugenossenschaft hat von der Stadt
das Acker- und Wiesengelände im Burgfeld in Erbbaurecht erhalten,
würdigte das langjährige SPD-Ratsmitglied diese Starthilfe. Für den
Quadratmeter waren damals 9 Mark zu zahlen, „im Jahr“, betonte
Mückain.
Die ersten Baugenossinnen und Baugenossen haben selbst mit Hand
angelegt beim Bau ihrer Häuser und Wohnungen. Es folgten
Baumaßnahmen in der Schützenstraße, in der Eugen-Jäger- und der
Lina-Sommer-Straße sowie in den Gartenwegen. Der Wohnungsbestand
belief sich vor Beginn des Zweiten Weltkrieges auf rund 300
Wohnungen.
Während des Zweiten Weltkrieges ruhte die Bautätigkeit ganz. Sie
nahm anschließend aber einen stürmischen Verlauf, an dessen
vorläufigem Ende, im Jahre 1964, das Unternehmen einen Bestand von
1.094 Wohnungen mit 14 Läden und 72 Garagen aufwies. Die Zahl der
Mitglieder war auf 2.543 angewachsen. Die Bilanzsumme überschritt
damals erstmals die 5 Millionen-Euro-Grenze.
Neben dem Mietwohnungsbau kam nun noch der Bau von
Eigentumswohnungen hinzu. Heute verfügt die GBS über einen Bestand
von rund 6000 Mitgliedern mit 5,4 Millionen Euro Geschäftsanteilen
und hat im eigenen Besitz 1.411 Wohnungen beziehungsweise
gewerbliche Einheiten, 153 Reihenhäuser sowie ein Seniorenhaus. In
diesem betreut die Arbeiterwohlfahrt (Awo) zurzeit 114 Bewohner.
Daneben verwaltet die Baugenossenschaft rund 470 Wohnungs- und
Gewerbeeinheiten. Die Bilanzsumme beläuft sich heute auf 53,6
Millionen Euro.
Dem GBS-Verwaltungsgebäude in der Burgstraße wurde vor zehn
Jahren das Seniorenheim zur Seite gestellt. Mit Stolz sprach Elke
Jäckle über die Aktivitäten des Nachbarschaftsvereins, der nicht
nur Feste und Veranstaltungen koordiniert und Begegnungen aller
Generationen und Kulturkreise ermöglicht. „Er ist für alle da,
nicht nur die Baugenossen“, wies die Aufsichtsratschefin auf
Aktionen zur Wohnumfeld-Verbesserung, die Vermittlung
nachbarschaftlicher und professioneller Hilfeleistungen hin sowie
auf Beratung bei persönlichen und sozialen Anliegen. Jäckle und
Mückain nannten im Verlauf ihrer Erzählungen viele stadtbekannte
Namen, die eng mit den Führungsgremien der Baugenossenschaft
(Vorstand und Aufsichtsrat) verbunden sind: Ob Heinrich Ober, Franz
Bögler, Josef Schmitt, Felix Rieser, August Fehn, Otto Lehr, Franz
Stützel, Johannes Kirchhoch, Anton Schültke, Gustav Rindchen, Peter
Kosian, Josef Sack, Heiner Brech, Jakob Weber, Hans Bachmann oder
Reiner Wieland, alle haben sich über lange Zeiten für die GBS-Ziele eingesetzt.
Und viele der knapp 50 Senioren erinnerten sich gerne an die
guten alten Zeiten, als sich im Gartenweg, in der Kolbstraße oder
den anderen GBS-Domizilen noch viele Nachbarn auf der Straße und in
Gärten zur Unterhaltung trafen, wozu Gänse im Vorbeimarsch
schnatterten, Hühner gackerten, Ziegen meckerten und die Stallhasen
sich über eine frische „Geelerrieb“ freuten. „Heute sind leider
einige Gärten verwahrlost“, beklagte sich ein im Burgfeld
aufgewachsener Erzählcafe-Besucher.
Moderator Karl-Heinz Jung macht schon Appetit auf den
Februar-Termin des Erzählcafés: Am 4.Februar, ermöglicht
Dipl.-Archivarin Katrin Hopstock ab 15 Uhr im Veranstaltungsraum
des Seniorenbüros ein Wiedersehen mit alten Speyerer Gaststätten,
wobei es ganz gewiss so manche Wirtschaftsgeschichte zu erzählen
gibt.
Foto: khj10.01.2014
Erzählcafé: DreiCant-Chor stimmt im Rathaus auf Adventzeit ein
.jpg) Senioren Herz
erwärmt
Senioren Herz
erwärmt
Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Etwas Herzerwärmendes tut
in der Adventszeit allen gut. Bei einem Erzählcafé der besonderen
Art kredenzte der DreiCant-Chor der Dreifaltigkeitskirchengemeinde
den rund 50 Besuchern im Historischen Ratssaal eine wohlklingende
Mischung aus vorweihnachtlichen Liedern. Mit nachdenklich
stimmenden und heiteren Weihnachtsgeschichten und Gedichten trugen
abwechselnd Erzählcafé-Moderator Dr. Thomas Neubert und
Chormitglied Hildegard Bohlender zum Gelingen des
unterhaltsamen Seniorenbüro-Nachmittags bei.
.jpg) Der Chor, der
mittwochs mit Dirigentin Susanne May-Rohde im Haus Trinitatis
probt, bereichert drei bis vier Gottesdienste im Jahr mit
musikalischer Umrahmung, singt auch mal bei Hochzeiten und
Geburtstagen sowie bei ökumenischen Gemeindefesten zusammen mit
anderen Chören, wie etwa dem Chor der benachbarten Dompfarrei. Bei
Landeskirchen- und Dekanatsmusiktagen und bei der Speyerer
Kult(o)urnacht ist „DreiCant“ stets gerne mit von der Partie.
Der Chor, der
mittwochs mit Dirigentin Susanne May-Rohde im Haus Trinitatis
probt, bereichert drei bis vier Gottesdienste im Jahr mit
musikalischer Umrahmung, singt auch mal bei Hochzeiten und
Geburtstagen sowie bei ökumenischen Gemeindefesten zusammen mit
anderen Chören, wie etwa dem Chor der benachbarten Dompfarrei. Bei
Landeskirchen- und Dekanatsmusiktagen und bei der Speyerer
Kult(o)urnacht ist „DreiCant“ stets gerne mit von der Partie.
.jpg) Für die
Chorleiterin, die 1990 in die Pfalz kam, war der Beginn an der
Dreifaltigkeitskirche zunächst ein „Kinderspiel“. May-Rohde übte
anfangs Kindersingspiele für Kindergottesdienste ein. Daraus
entwickelte sich ein Kinderchor, der mit über 20 Kindern- vom
Vorschulalter bis hin zu Sechstklässlern, seitdem jedes Jahr im
Herbst mit den Proben beginnt für den Auftritt in der
Vorweihnachtszeit. Und 1999 war dann die Geburtsstunde von
DreiCant, kam May-Rohde dem Wunsch nach Gründung des
Erwachsenenchors nach. Geselligkeit und Gemeinschaftssinn sind bei
DreiCant ebenso hoch angesiedelt wie die Freude am Singen, betrieb
die Chorleiterin Werbung in eigener Sache. Besonders Männerstimmen
sind sehr begehrt.
Für die
Chorleiterin, die 1990 in die Pfalz kam, war der Beginn an der
Dreifaltigkeitskirche zunächst ein „Kinderspiel“. May-Rohde übte
anfangs Kindersingspiele für Kindergottesdienste ein. Daraus
entwickelte sich ein Kinderchor, der mit über 20 Kindern- vom
Vorschulalter bis hin zu Sechstklässlern, seitdem jedes Jahr im
Herbst mit den Proben beginnt für den Auftritt in der
Vorweihnachtszeit. Und 1999 war dann die Geburtsstunde von
DreiCant, kam May-Rohde dem Wunsch nach Gründung des
Erwachsenenchors nach. Geselligkeit und Gemeinschaftssinn sind bei
DreiCant ebenso hoch angesiedelt wie die Freude am Singen, betrieb
die Chorleiterin Werbung in eigener Sache. Besonders Männerstimmen
sind sehr begehrt.
.jpg) Bei der Auswahl
der Chorliteratur – die Notenwerke werden ohnehin meist aus der
Chorkasse finanziert – für die Gottesdienste lassen die Pfarrer der
Dreifaltigkeitskirchengemeinde der Dirigentin freie Hand, freut
sich Susanne May-Rohde über die künstlerische Freiheit und
schneidet Lieder speziell auf den Chor zu und arrangiert sie neu.
Sie sei zwar „von Haus aus Kirchenmusikerin“, doch sucht sie für
ihren „DreiCant“-Chor gerne moderne, zeitgenössische Stücke aus und
unternimmt auch mal Ausflüge in die folkloristische Musik. Für die
Sänger besonders anspruchsvoll wird es, wenn die Chorleiterin
Lieder in Fremdsprachen einstudiert, wobei es nicht immer nur
englisch ist, sondern auch mal rumänisch oder griechisch sein kann.
Am ersten Adventsonntag hatte der DreiCant-Chor zwei Tage vorher
mit Christmas Carols beim Konzert in der Gedächtniskirche für
Aufhorchen gesorgt. Fürs Erzählcafé wählte Chorleiterin May-Rohde
deutschsprachiges Liedgut und nur einen Konzertbeitrag, das
Glockenlang nachahmende „God rest ye, merry gentlemen“ aus.
Nach „Hört der Engel große Freud“, „Es ist ein Ros entsprungen“,
„Vom Himmel hoch“ und den „Königen vom Morgenland“ lud die
Chorleitern zum Abschluss alle Zuhörer ein zum Mitsingen von „O du
Fröhliche“. Dieser Einladung kamen die Senioren gerne nach, und
Allgemeinmediziner Dr. Thomas Neubert lachte das Herz und gab zu
wissen: „Es gibt nichts Gesünderes als Singen!“
Bei der Auswahl
der Chorliteratur – die Notenwerke werden ohnehin meist aus der
Chorkasse finanziert – für die Gottesdienste lassen die Pfarrer der
Dreifaltigkeitskirchengemeinde der Dirigentin freie Hand, freut
sich Susanne May-Rohde über die künstlerische Freiheit und
schneidet Lieder speziell auf den Chor zu und arrangiert sie neu.
Sie sei zwar „von Haus aus Kirchenmusikerin“, doch sucht sie für
ihren „DreiCant“-Chor gerne moderne, zeitgenössische Stücke aus und
unternimmt auch mal Ausflüge in die folkloristische Musik. Für die
Sänger besonders anspruchsvoll wird es, wenn die Chorleiterin
Lieder in Fremdsprachen einstudiert, wobei es nicht immer nur
englisch ist, sondern auch mal rumänisch oder griechisch sein kann.
Am ersten Adventsonntag hatte der DreiCant-Chor zwei Tage vorher
mit Christmas Carols beim Konzert in der Gedächtniskirche für
Aufhorchen gesorgt. Fürs Erzählcafé wählte Chorleiterin May-Rohde
deutschsprachiges Liedgut und nur einen Konzertbeitrag, das
Glockenlang nachahmende „God rest ye, merry gentlemen“ aus.
Nach „Hört der Engel große Freud“, „Es ist ein Ros entsprungen“,
„Vom Himmel hoch“ und den „Königen vom Morgenland“ lud die
Chorleitern zum Abschluss alle Zuhörer ein zum Mitsingen von „O du
Fröhliche“. Dieser Einladung kamen die Senioren gerne nach, und
Allgemeinmediziner Dr. Thomas Neubert lachte das Herz und gab zu
wissen: „Es gibt nichts Gesünderes als Singen!“
Beim ersten Erzählcafé 2014 plaudern Elke Jäckle und Brernhard
Mückain am Dienstag, 7.Januar, ab 15 Uhr, im Seniorenbüro-Saal im
Maulbronner Hof 1a über die Geschichte der Gemeinnützigen
Baugenossenschaft Speyer(GBS). Foto:
khj
05.12.2013
Lions-Club spendet Seniorenbüro 4000 Euro
 v.l.: Seniorenbüroleiterin Ria Krampitz, Reinhard Oelbermann und Bürgermeisterin Monika Kabs
v.l.: Seniorenbüroleiterin Ria Krampitz, Reinhard Oelbermann und Bürgermeisterin Monika Kabs
Mit Musik Lebensqualität in stationären
Einrichtungen steigern
Speyer- Der Lions-Club Speyer
sorgte dieser Tage für strahlende Gesichter im Stadthaus. Dank
einer Spende in Höhe von 4000 Euro ist die Finanzierung der
beliebten Veranstaltungsreihe des Seniorenbüros „Konzert am
Nachmittag“ für das Jahr 2014 gesichert. Erwirtschaftet wurde das
Geld durch das ehrenamtliche Engagement der Serviceclubmitglieder
beim Altstadtfest, informiert Reinhard Oelbermann bei der
Scheckübergabe an Bürgermeisterin Monika Kabs und
Seniorenbüroleiterin Ria Krampitz.
Verwendet wird das Geld zur Weiterentwicklung der
Reihe, die bisher vier Konzertnachmittage pro Halbjahr im
Historischen Ratssaal bietet. Dieses kulturelle Angebot soll
zukünftig auch Menschen erreichen, die nicht mehr mobil sind. „Wir
möchten mit Musik im stationären Hospiz, der Palliativstation und
in Wohnbereichen der stationären Einrichtungen erfreuen, entspannen
und ablenken“, erläutert Krampitz die Pläne, die den Lions-Club auf
Anhieb überzeugten. Während bei den Konzerten im Historischen
Ratssaal die eingesammelten Spenden der Besucher an die jungen
Talente der Musikhochschulen Mannheim, Saarbrücken und Mainz
weitergereicht werden können, ermöglicht die Lions-Spende die
Honorierung der Musiker für diese stationären Auftritte, freut sich
Bürgermeisterin Kabs über die Finanzierungsmöglichkeit dieser
freiwilligen Leistung der Kommune.
Text und Foto: Pressestelle Stadt Speyer
11.11.2013
Speyerer Spion Johann Georg Dasch im Erzählcafé
 Peter Schmidt im Gespräch mit Besucher Dieter Bahr über den Spion und sein Leben
Peter Schmidt im Gespräch mit Besucher Dieter Bahr über den Spion und sein Leben
Speyer- Wie der Speyerer Johann
Georg Dasch durch seinen Verrat ans FBI im August 1942 sechs
Kameraden auf den elektrischen Stuhl brachte, behandelte der Speyer
Journalist und Buchautor Peter Schmidt im von Karl-Heinz Jung
moderierten November-Erzählcafé des Seniorenbüros. Während zurzeit
deutsche und amerikanische Geheimdienstchefs rund um Edward
Snowdens Abhör-Enthüllungen über die Möglichkeiten verhandeln,
politisch ihr Gesicht zu wahren, auf der anderen Seite aber auch
alle gefährlichen Angriffe, etwa von weltweit operierenden
Terrornetzwerken wie Al Qaida, abzuwehren, war Spionage im Dritten
Reich ein schlichtes, hartes Handwerk, allerdings oft ein
sehr blutiges, wie Peter Schmidt bildhaft darlegte.
Auf der Basis dieser wahren Spionagegeschichte
entwickelte Schmidt, bis 1995 Chefredakteur der „Speyerer
Tagespost“, eine Kriminal- und eine Liebesgeschichte. In dem 345
Seiten starken Taschenbuch „Lili unterm Regenbogen“ erzählt
der Journalist unter dem Pseudonym Peter
Biron (Familienname der Mutter) die spannende Geschichte einer
jungen Frau, die 1967 auf den Spuren ihres Vaters in Amerika dessen
Tod auf dem elektrischen Stuhl nachgeht. Das Buch beginnt in der so
genannten „Neuen Welt“, den USA, und führt den Leser auch ein
bisschen nach Kanada. Dabei zeichnet Schmidt anschaulich ihm
bei seinem sechswöchigen USA-Besuch 1967 eingeprägte
Landschaftsbilder und breitet amerikanische Lebenswelten aus. Und
zwischendurch richtet der heute 75-jährige Autor immer wieder
seinen Blick auf historische Ereignisse Ende der sechziger Jahre in
den USA, erinnert an die damals herrschende Rassendiskriminierung
oder lässt die Parolen der Hippi-Bewegung blumenreich
aufblühen.
Seine Romanfigur Lili findet in Amerika nicht nur
ihre große Liebe, sondern beinahe auch den Tod. Dem entgeht
Dasch, nach Schmidts Auffassung „irgendwie schizophren“, ganz
gezielt: Bereits zwei Tage nach der Landung der U-Boote verrät der
als „eleganter Mann mit guten Manieren“ beschriebene Speyerer dem
FBI das deutsche Vorhaben. Seine Aussage umfasste nach Schmidts
Recherche 251 Schreibmaschinenseiten. Die meisten der Agenten waren
amerikanische Staatsangehörige geworden und auf abenteuerliche
Weise zu Beginn des Zweiten Weltkrieges nach Deutschland
zurückgekehrt, der NSDAP beigetreten. In den Zeiten der großen
Arbeitslosigkeit war der Pfälzer 1922 ausgewandert und hatte unter
dem Namen „George John Dasch“ als Kellner in New York und San
Francisco seinen Lebensunterhalt verdient. Alle Saboteure wurden
nach Daschs Verrat gefasst. Präsident Roosevelt hat ein
Sondergericht ernannt. Sechs Mitstreiter starben einen qualvollen
Tod auf dem elektrischen Stuhl. Dasch, am 7.Februar 1903 als Kind
geachteter Eheleute in der Domstadt geboren, wurde zu 30 Jahren
Zuchthaus verurteilt, 1948 von Präsident Truman begnadigt und nach
Deutschland abgeschoben. Er blieb unverheiratet und verstarb 1991
in Ludwigshafen. Dorthin war Dasch offenbar „geflüchtet“, nachdem
er im März 1951 in der Mannheimer Straße (heutige Spaldinger
Straße) einen Mann namens Karl Staiger angefahren und diesem dabei
tödliche Verletzungen zugefügt hatte. Über die Familie des Getöten
und einen Zeitungsartikel von dem Verkehrsunfall kam Peter Schmidt
dem berüchtigten Spion auf die Spur. ws;
Foto:khj
Peter Biron
„Lili unterm Regenbogen“,
354 Seiten,
erhältlich in allen Speyerer Buchhandlungen,
Preis: 14.99 Euro.
Als Download (E-Book) bei Amazon (Kindle-Edition)
9.99 Euro.
07.11.2013
Ehrenamtliche im Mittelpunkt
 Die
ehrenamtlich Mitarbeitenden standen Ende vergangener Woche im
Mittelpunkt einer Feier im Diakonissen Seniorenstift
Bürgerhospital.
Die
ehrenamtlich Mitarbeitenden standen Ende vergangener Woche im
Mittelpunkt einer Feier im Diakonissen Seniorenstift
Bürgerhospital.
Bei einem Empfang zu ihren Ehren bedankte sich Dr. Werner
Schwartz, Vorsteher der Diakonissen Speyer-Mannheim, für ihr
Engagement. Ehrenamtliche könnten die hauptamtliche Arbeit nicht
ersetzen, seien aber eine wertvolle Ergänzung und „unverzichtbares
Element in der Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner“, so
Schwartz. Die ehrenamtlich Mitarbeitenden stünden damit auch in der
Tradition der Diakonissen, die sich weit über die körperliche
Pflege hinaus um die ihnen anvertrauten Menschen gekümmert
hätten.
Auch Heimleiter Klaus-Dieter Schneider wies auf die große
Bedeutung des Ehrenamtes in der Seniorenarbeit hin und freute sich,
dass die ehrenamtlich Mitarbeitenden ihre ganz persönlichen
Fähigkeiten und Talente einbrächten, „und damit wesentlich zum
Wohlergehen unserer Bewohnerinnen und Bewohner beitragen.“ Auf das
breite Spektrum der Tätigkeiten, die das Ehrenamt im Diakonissen
Seniorenstift Bürgerhospital bietet, wies Wolfgang
Fischer-Oberhauser vom Sozialkulturellen Dienst hin: Die
Möglichkeiten reichten vom Pfortendienst über die Rollstuhlgruppe
oder Einzelbetreuung und Gedächtnistraining bis zum Kirchendienst.
So sei für fast jeden, der sich einbringen wolle, eine passende
Tätigkeit dabei, sagte Fischer-Oberhauser, der sich freute, beim
diesjährigen Fest für die Ehrenamtlichen auch zahlreiche neue
Gesichter zu sehen.
Interessenten an einem Ehrenamt im Diakonissen Seniorenstift
Bürgerhospital können sich bei Wolfgang Fischer-Oberhauser unter
Tel. 06232 648-131 informieren. Diakonissen Speyer-Mannheim,
Presse
22.10.2013
„Güte, Gefasstheit und Abgeklärtheit als Zeichen für die Öffnung einer Persönlichkei für immer wieder Neues“
 Prof. Dr.
Andreas Kruse beim 20jährigen Jubiläum von Seniorenbeirat und
Seniorenbüro in Speyer
Prof. Dr.
Andreas Kruse beim 20jährigen Jubiläum von Seniorenbeirat und
Seniorenbüro in Speyer
Von Gerhard Cantzler
Speyer- Es hatte durchaus etwas von einem
höchst gelungenen „Gesamtkunstwerk“, mit dem jetzt der renommierte
Heidelberger Altersforscher Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas
Kruse die Ergebnisse seiner eigenen,
langjährigen Untersuchungen und die der gerontologischen Forschung
insgesamt im Kleinen Saal der Speyerer Stadthalle präsentierte.
Anlass dieses feslichen Zusammentreffens: Das zwanzigjährige
Jubiläum von Seniorenbeirat und Seniorenbüro in der Stadt.
 Eingebettet in
frei rezitierte, beziehungsreiche Gedichte aus Barock und Romantik
sowie – quasi als Unterstützung der Vertiefungsphasen zu dem
Gehörten – durch den Referenten gekonnt am Flügel dargebotene
Kompositionen des großen Johann Sebastian Bach, ermutigte der
studierte Philosoph, Psychologe und Musiker Prof. Dr. Kruse nämlich
die zahlreichen Zuhörer dazu, bis ans Ende ihres Lebensweges offen
zu bleiben für Neues. Dazu zitierte der Referent gleich zu Beginn
seiner Ausführungen aus einer erst kürzlich abgeschlossenen Studie
unter 85 bis 101jährigen Menschen, die es darin als „ihr zentrales
Thema im Alter“ bezeichnet hatten, „etwas für die Gemeinschaft zu
tun“ . Dadurch -so hätten sie in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl
erklärt – sei für sie „auch in hohem und höchsten Alter noch ein
erfülltes Leben möglich“.
Eingebettet in
frei rezitierte, beziehungsreiche Gedichte aus Barock und Romantik
sowie – quasi als Unterstützung der Vertiefungsphasen zu dem
Gehörten – durch den Referenten gekonnt am Flügel dargebotene
Kompositionen des großen Johann Sebastian Bach, ermutigte der
studierte Philosoph, Psychologe und Musiker Prof. Dr. Kruse nämlich
die zahlreichen Zuhörer dazu, bis ans Ende ihres Lebensweges offen
zu bleiben für Neues. Dazu zitierte der Referent gleich zu Beginn
seiner Ausführungen aus einer erst kürzlich abgeschlossenen Studie
unter 85 bis 101jährigen Menschen, die es darin als „ihr zentrales
Thema im Alter“ bezeichnet hatten, „etwas für die Gemeinschaft zu
tun“ . Dadurch -so hätten sie in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl
erklärt – sei für sie „auch in hohem und höchsten Alter noch ein
erfülltes Leben möglich“.
Prof. Dr. Kruse warnte deshalb auch davor, im Zusammenhang mit
der Diskussion um das Altern immer nur die Aspekte von Krankheit,
Pflege und Versorgung in den Vordergrund zu stellen. „Natürlich
dürfen wir das Auftreten von Krankheiten und altersbedingten
Einschränkungen nicht leugnen“, betonte der Professsor. A llerdings
sollte sich die Gesellschaft darüber bewusst werden, was Menschen
auch noch in hohem und höchstem Alter für sich und andere leisten
könnten. Dazu aber müssten vor allem ihre noch immer vorhandenen
schöpferischen Fähigkeiten und Kräfte in den Vordergrund gerückt
werden.
„Das Lernvermögen der Menschen bleibt bis ins hohe Lebensalter
bestehen“, stellte der Wissenschaftler fest und zitierte dazu den
athenischen Staatsmann und Gelehrten Solon, der schon vor über
2.600 Jahren von sich selbst gesagt hatte: „Ich werde alt und lerne
jeden Tag dazu...“ Deshalb – so Prof. Dr. Kruse – müssten die
Menschen auch heute stets offen bleiben.
 Nach
gesicherten wissenschaftlichen Beobachtungen gehe der
Alterungsprozess des Menschen mit zunehmender Selbstreflexion
einher - „Menschen erlangen meist erst im Alter Klarheit darüber,
was und wer sie sind“. Die besten Gespräche könnten deshalb – oft
mit viel Witz und Selbstirone gewürzt - mit hochbetagten Menschen
geführt werden, weil sie dann zu ihren eigenen Ursprüngen
zurückkehrten. Dabei gehe es ihnen in aller Regel nicht um eine
verklärte Sichtweise auf Vergangenes, sondern um die Erkenntnis,
dass „in einer Sorgekultur für andere der tiefere Sinn des Lebens
liegt“. Dieser „Selbstgestaltung“, wie sie der Wissenschaftler
definiert, stellt Prof. Dr. Kruse die „Weltgestaltung“ gegenüber,
für deren Wirkungskraft er anhand eines Gedichtes des
Barock-Dichters Andreas Gryphius die ungeheuren schöpferischen
Kräfte aufführte, die gealterte und durch den 30jährigen Krieg
scheinbar zermürbte Menschen noch in hohem Alter entwickelt hätten.
Ihnen gehe es dabei im wesentlichen darum, im Gespräch mit der
nachfolgenden Generation eigene Erfahrungen an jüngere
weiterzugeben. „Dabei sollten sich beide Generationen – junge und
alte – immer „zugleich als Lehrende wie als Lernende“ verstehen, so
Prof. Dr. Kruse.
Nach
gesicherten wissenschaftlichen Beobachtungen gehe der
Alterungsprozess des Menschen mit zunehmender Selbstreflexion
einher - „Menschen erlangen meist erst im Alter Klarheit darüber,
was und wer sie sind“. Die besten Gespräche könnten deshalb – oft
mit viel Witz und Selbstirone gewürzt - mit hochbetagten Menschen
geführt werden, weil sie dann zu ihren eigenen Ursprüngen
zurückkehrten. Dabei gehe es ihnen in aller Regel nicht um eine
verklärte Sichtweise auf Vergangenes, sondern um die Erkenntnis,
dass „in einer Sorgekultur für andere der tiefere Sinn des Lebens
liegt“. Dieser „Selbstgestaltung“, wie sie der Wissenschaftler
definiert, stellt Prof. Dr. Kruse die „Weltgestaltung“ gegenüber,
für deren Wirkungskraft er anhand eines Gedichtes des
Barock-Dichters Andreas Gryphius die ungeheuren schöpferischen
Kräfte aufführte, die gealterte und durch den 30jährigen Krieg
scheinbar zermürbte Menschen noch in hohem Alter entwickelt hätten.
Ihnen gehe es dabei im wesentlichen darum, im Gespräch mit der
nachfolgenden Generation eigene Erfahrungen an jüngere
weiterzugeben. „Dabei sollten sich beide Generationen – junge und
alte – immer „zugleich als Lehrende wie als Lernende“ verstehen, so
Prof. Dr. Kruse.
Welche Konsequenzen eine solche generationsübergreifende
Zusammenarbeit haben könne, machte der Referent auch am Beispiel
generationsgemischter Teams in Unternehmen deutlich, die in aller
Regel deutlich erfolgreicher arbeiteten als solche aus der gleichen
Generation.
 Weltgestaltung
sei der Wissenschaft aber auich zum „großen Thema“ geworden, als
sie sich mit den Auswirkungen des Schicksals jüdischer Menschen
nach dem Ende der NS-Zeit auseinandersetzte. Bei diesen Menschen
seien die Erinnerungen an diese für sie so schwere Zeit oft erst
wieder im hohen Alter stärker geworden und habe sie ermutigt, damit
in die Schulen zu gehen und der nachwachsenden Generation deutlich
zu machen, was eine funktionierende Demokratie bedeute. Dabei
hätten sie immer wieder erfahren können, dass dadurch auch das
Interesse der jungen Generation an diesen Zusammenhängen deutlich
gewachsen sei.
Weltgestaltung
sei der Wissenschaft aber auich zum „großen Thema“ geworden, als
sie sich mit den Auswirkungen des Schicksals jüdischer Menschen
nach dem Ende der NS-Zeit auseinandersetzte. Bei diesen Menschen
seien die Erinnerungen an diese für sie so schwere Zeit oft erst
wieder im hohen Alter stärker geworden und habe sie ermutigt, damit
in die Schulen zu gehen und der nachwachsenden Generation deutlich
zu machen, was eine funktionierende Demokratie bedeute. Dabei
hätten sie immer wieder erfahren können, dass dadurch auch das
Interesse der jungen Generation an diesen Zusammenhängen deutlich
gewachsen sei.
Als ein weiteres Beispiel der schöpferischen Kraft von Menschen
gerade auch in hohem Alter führte er den musikalischen Genius
Johann Sebastian Bach an, der nach einem von vielen
Schicksalsschlägen gepägten Leben – schon mit neun Jahre war Bach
Vollwaise, verlor als 35jähriger die geliebte Ehefrau und litt in
hohem Alter an einer Vielzahl schwerer Erkrankungen und war
schließlich sogar erblindet – dennoch kurz vor dem Ende seines
Lebens seine bedeutensten Kompositionen schuf - unter anderem das
großartige „Credo“ aus seiner h-moll-Messe oder die Endfassung
seiner Kunst der Fuge. „Damit ist Johann Sebastian Bach ein
Beispiel dafür, dass ein Mensch trotz eines schwerwiegenden
körperlichen Alterungsprozesses auch weiterhin in der Lage sein
kann, kraft seiner seelischen Verfassung Großartiges zu schaffen.
Dies habe auch für den berühmten niedeländischen Maler Rembrandt
van Rijn gegolten, der am Ende seines Lebens – bereits stark
eingeschränkt -seine eindringlichsten Gemälde geschaffen habe.
In diesem Zusammenhang sprach der Referent auch von der
„Gerotranszendentalen Phänomenologie“ - der Fähigkeit eines
Menschen, in seiner nachfolgenden Generation weiterzuleben – getreu
dem Lehrsatz: „Ich komme in eine Welt, in der vor mir schon viele
Generationen lebten und gehe aus einer Welt, in der auch nach mir
viele Generationen leben werden“.
 Die dieser
Erkenntnis innewohende Endlichkeitserfahrung könne aber bei manchen
Menschen auch dazu führen, dass sie sich erst in höherem Alter –
also nicht schon unmittelbar nach dem „Ausstieg“ aus dem Arbeits-
und Berufsleben – dazu entschließen würden, „noch etwas für die
Allgemeinheit zu leisten“.
Die dieser
Erkenntnis innewohende Endlichkeitserfahrung könne aber bei manchen
Menschen auch dazu führen, dass sie sich erst in höherem Alter –
also nicht schon unmittelbar nach dem „Ausstieg“ aus dem Arbeits-
und Berufsleben – dazu entschließen würden, „noch etwas für die
Allgemeinheit zu leisten“.
Deshalb sei „Offenheit für Neues“ die zentrale Voraussetzung für
ein „gutes Alter“, führte der Referent aus, „denn Offenheit
beflügelt uns zu dem lebenslang notwendigen
generationsübergreifenden Diskurs und gibt uns die Möglichkeit, uns
bis ans Ende unseres Leben weiterzuentwickeln“. Diese
Entwicklungsmöglichkeit gelte sogar für schwerstkranke
Palliativ-Patienten, sofern für sie eine gute schmerzmedizinische
Versorgung gewährleistet sei. „Dabei sind Güte, Gefasstheit und
Abgeklärtheit auch immer Anzeichen dafür, in welchem Maße sich eine
Persönlichkeit geöffnet zegt“, unterstrich Prof. Dr. Kruse.
Mit dem Gedicht „Mondnacht“ von Joseph von Eichendorff, in dem
es u.a. heißt „....und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus,
flog durch die stillen Lande, als flöge sie nach Haus....“.machte
der Altersforscher deutlich, dass selbst bei Demenzkranken und
Palliativ-Patienten am Ende ihres Lebens die Seele noch ienmal ganz
weit in den Vordergrund trete.
 Eine so
angelegte Gerontologie brauche öffentliche Räume, in denen sich
Menschen über die Grenzen der eigenen Generation hinweg begegnen
könnten. „Nur im Kontakt mit anderen Menschen werden wir kreativ“,
unterstrich der Wissenschaftler zum Abschluss seines Referates,,
als er Speyer zu dem entsprechenden öffentlichen Raum für diese
Arbeit in Seniorenbeirat und Seniorenbüro gratulierte und allen
Speyerern zu einer Stadt, die auch für ihn selbst zu einer seiner
Lieblingsstädte zähle, in der er gemeinsam mit seiner Frau immer
wieder gerne zu Gast sei.
Eine so
angelegte Gerontologie brauche öffentliche Räume, in denen sich
Menschen über die Grenzen der eigenen Generation hinweg begegnen
könnten. „Nur im Kontakt mit anderen Menschen werden wir kreativ“,
unterstrich der Wissenschaftler zum Abschluss seines Referates,,
als er Speyer zu dem entsprechenden öffentlichen Raum für diese
Arbeit in Seniorenbeirat und Seniorenbüro gratulierte und allen
Speyerern zu einer Stadt, die auch für ihn selbst zu einer seiner
Lieblingsstädte zähle, in der er gemeinsam mit seiner Frau immer
wieder gerne zu Gast sei.
Zu Beginn der Veranstaltung hatte Oberbürgermeister
Hansjörg Eger die Gäste mit launischen Worten begrüßt und
an die verschiedenen Initiativen erinnert, die in Sachen
„generationenübergreifende Arbeit“ von Speyer ausgegangen seien und
die an diesem Tag in das Doppeljubiläums „Zwanzig Jahre
Seniorenbeirat und Seniorenbüro Speyer“ einmünden würden. Dazu
nannte er im einzelnen das aus Anlass der 2000-Jahr-Feier der Stadt
1993 gegründete Europäische Netzwerk der Mittelstädte „MECINE“ und
verwies auf die frühen diesbezüglichen Forschungsarbeiten von
Prof. Dr. Carl Böhret und Götz
Konzendorf. Foto: gc
10.10.2013
Die Mauern der Freien Reichsstadt Speyer im Erzählcafé…
-01.jpg) Speyer-
„Speyer- ist von starken Mauern umgeben mit Türmen, die so
hoch wie unsere Kirchtürme sind, die höchsten Türme in einer
Mauer, die ich auf meiner Reise sah“, so der Engländer Thomas
Coryate in - Die Venedig- und Rheinfahrt 1608.
Speyer-
„Speyer- ist von starken Mauern umgeben mit Türmen, die so
hoch wie unsere Kirchtürme sind, die höchsten Türme in einer
Mauer, die ich auf meiner Reise sah“, so der Engländer Thomas
Coryate in - Die Venedig- und Rheinfahrt 1608.
Im allgemeinen denken wir bei dieser Aussage von Coryate an die
Stadtbefestigung in Speyer, wie sie Sebastian Münster oder Matthäus
Merian um 1550 im Holzschnitt darstellen ließen, hierbei sind aber
die Innenstadt und die vier Vorstädte zu unterscheiden. Wann sind
diese Mauern entstanden, wer hat sie erbauen lassen, wann wurden
sie zerstört? Fragen auf Fragen, so leitete der Moderator das
Thema ein und stellte den 90-jährigen Dr. Karl Rudolf Müller
vor, der im 75. Lebensjahr seine langjährigen Forschungsarbeiten in
seiner Promotion verarbeitete. Müller war auch sofort in
seinem Metier und erklärte den 85 interessierten Zuhörern mit
Hilfe einer Power Show die “ römische-, ottonische-,
salische- und mittelalterliche
Stadtmauer“.
Spätrömische Stadtmauer um 375, Ottonische um 950
erbaut
Aus starken Sandsteinquadern mit einer Mauerstärke
von ca 2,5 m und einer geringen Höhe ohne Türme wurde um 375,
als Schutz vor den angreifenden Germanenvölkern, die spätrömische
Stadtmauer erbaut. Sie begrenzte „Nemetes“, ist im
Archivgarten der Landeskirche zu sehen, verlief südwärts bis zur
Webergasse, im Westen zur Schrannengasse und der Nordverlauf ging
etwa 20 m neben der Afrakapelle vorbei nach Osten, Nähe
Heidenturm, konnte aber den Germanenansturm um 400 nicht aufhalten.
Kaiser Otto I. bestätigte Bischof Otger 969 die
Herrschaft über Speyer, wobei die 950 gebaute Stadtmauer erwähnt
wurde.
-01.jpg) Sie begrenzte
die Bischofspfalz im Bereich des Heidenturms, zog nach Süden zum
Stephanspförtchen, der Großen Pfaffen- und Webergasse, „Alter
Marktplatz“ und „Läutturm“, zog im Norden zur Torgasse am
Hasenpfuhl, streifte die Margaretengasse und führte zum
Archivgarten. Die Einfälle der Normannen im 9.-u. der Ungarn im 10.
Jh. zeigten, dass nur befestigte Städte widerstanden.
Früh- und spätsalische Erweiterung. Um 1050 ließ
Bischof Sigibodos die frühsalische Stadtmauer bis zur Ludwigstraße,
dem Altpörtel (Westpforte mit zwei Stockwerken), über die
Greifengasse zur bestehenden Mauer weiterführen. Die spätsalische
rechteckige Norderweiterung umschloss das Johannes-/ St.
Guidostift, wurde durch Bischof Johannes I.-Neffe Kaiser
Heinrich IV. -(1090-1100) erbaut und ließ die Belagerung durch
Erzbischof Adalbert von Mainz 1116 scheitern. Der rote Turm
an der Nordflanke und das Weidentor waren Ergänzungen.
Sie begrenzte
die Bischofspfalz im Bereich des Heidenturms, zog nach Süden zum
Stephanspförtchen, der Großen Pfaffen- und Webergasse, „Alter
Marktplatz“ und „Läutturm“, zog im Norden zur Torgasse am
Hasenpfuhl, streifte die Margaretengasse und führte zum
Archivgarten. Die Einfälle der Normannen im 9.-u. der Ungarn im 10.
Jh. zeigten, dass nur befestigte Städte widerstanden.
Früh- und spätsalische Erweiterung. Um 1050 ließ
Bischof Sigibodos die frühsalische Stadtmauer bis zur Ludwigstraße,
dem Altpörtel (Westpforte mit zwei Stockwerken), über die
Greifengasse zur bestehenden Mauer weiterführen. Die spätsalische
rechteckige Norderweiterung umschloss das Johannes-/ St.
Guidostift, wurde durch Bischof Johannes I.-Neffe Kaiser
Heinrich IV. -(1090-1100) erbaut und ließ die Belagerung durch
Erzbischof Adalbert von Mainz 1116 scheitern. Der rote Turm
an der Nordflanke und das Weidentor waren Ergänzungen.
Rundgang um die innere Stadtmauer
-01.jpg) Dr. Müller
erläuterte mit Hilfe der Fotoshow die noch sichtbaren
Teile der Stadtmauer mit Ausgangspunkt
Altpörtel. Am höchsten Torturm Deutschlands (1197
erstmals erwähnt, 1230 erneuert, 1512/1514 aufgestockt) sind
Mauervertiefungen (Holzgatter), Auflagen der Wehrbrüstung,
Gefängniszelle im Tordurchgang und „Musterelle“ zu erkennen. Hinter
der „Postgalerie“ steht am Klipfelstor ein Mauerzeugnis aus
roten Kleinsandsteinquadern. Im Café daneben ist ein
Rundbogenscheitel als Wasserpforte der spätsalischen
Erweiterungsmauer versteckt. Mit Sträuchern ist der
„Postgraben“(ehemals Tiergraben) zugewachsen. Zur Bahnhofstraße hin
sieht man das einzige erhaltene Grabenprofil mit der
besonderen Bauweise der „Kontereskarpe“- und
„Bermenmauer“(Vorschutzmauern), wie Dr. Müller anhand einer
Skizze erklärte. Ein Foto zeigt den Windmühlturm(Runder
Turm), der an der Rützhaubstraße stand und weiter nördlich
den Roten Turm . Am ehemals 10 m tiefen
Hirschgraben mit der Außenfuttermauer am Alten
Friedhof(Adenauerpark), sind die spätsalische Mauer,
das stauferzeitliche Haus mit rotem
Kleinquadermauerwerk, Zinnen, Wurfscharten, Schießscharten
und zwei gotische Zierfenster(1200) am Wehrgang zu erkennen.
Die Stadtmauer ist hier 1,2 m dick und 8m hoch, war oft umkämpft,
diente als Zugang zum Eiskeller, später zum Luftschutzbunker und
hält heute noch stand. Durch Straßenbegradigung um 1810
entstand der St.-Guido-Stifts-Platz, wo sich das Weidentor
als einziges Nordtor befand. Am N
eubau der Petschengasse 1 steht eine Infotafel mit
Detailplan der Stadtmauern, direkt daneben die
erhaltene spät salische Hauptmauer.
Dr. Müller
erläuterte mit Hilfe der Fotoshow die noch sichtbaren
Teile der Stadtmauer mit Ausgangspunkt
Altpörtel. Am höchsten Torturm Deutschlands (1197
erstmals erwähnt, 1230 erneuert, 1512/1514 aufgestockt) sind
Mauervertiefungen (Holzgatter), Auflagen der Wehrbrüstung,
Gefängniszelle im Tordurchgang und „Musterelle“ zu erkennen. Hinter
der „Postgalerie“ steht am Klipfelstor ein Mauerzeugnis aus
roten Kleinsandsteinquadern. Im Café daneben ist ein
Rundbogenscheitel als Wasserpforte der spätsalischen
Erweiterungsmauer versteckt. Mit Sträuchern ist der
„Postgraben“(ehemals Tiergraben) zugewachsen. Zur Bahnhofstraße hin
sieht man das einzige erhaltene Grabenprofil mit der
besonderen Bauweise der „Kontereskarpe“- und
„Bermenmauer“(Vorschutzmauern), wie Dr. Müller anhand einer
Skizze erklärte. Ein Foto zeigt den Windmühlturm(Runder
Turm), der an der Rützhaubstraße stand und weiter nördlich
den Roten Turm . Am ehemals 10 m tiefen
Hirschgraben mit der Außenfuttermauer am Alten
Friedhof(Adenauerpark), sind die spätsalische Mauer,
das stauferzeitliche Haus mit rotem
Kleinquadermauerwerk, Zinnen, Wurfscharten, Schießscharten
und zwei gotische Zierfenster(1200) am Wehrgang zu erkennen.
Die Stadtmauer ist hier 1,2 m dick und 8m hoch, war oft umkämpft,
diente als Zugang zum Eiskeller, später zum Luftschutzbunker und
hält heute noch stand. Durch Straßenbegradigung um 1810
entstand der St.-Guido-Stifts-Platz, wo sich das Weidentor
als einziges Nordtor befand. Am N
eubau der Petschengasse 1 steht eine Infotafel mit
Detailplan der Stadtmauern, direkt daneben die
erhaltene spät salische Hauptmauer.
Dr. Müller führte die Zuhörer zum Maulbronner
Hof, wo ein 170 m langes Mauerstück aus roten
Kleinquadern mit romanischen Wurfscharten(1100)
als Hauswände der Lauergassenhäuser mit einmaligem
Erhaltungsgrad zu sehen ist. Romanische Zinnen stehen
in 1,5 m Höhe, Schartenbänke sind durch Aufmauerung
zugesetzt. Nördlich stand der Pulverturm, ein um 1330
erstellter Backsteinbau. Zum Fischmarkt hin ist die
Mauerkrone in 6 m Höhe noch erhalten, während Zwischenteile
im „Mörsch“ abgesackt sind. Weiter wurde vom Erzähler
die Stapelplatzmauer an der Häuserrückfront der
Pistoreigasse (zwischen Mittelsteg und Stuhlbrudergasse)
erklärt, wobei das Backsteinwerk auf einem Sockel
von kleinen roten Sandsteinquadern mit 12 Zinnen ruht. Vorbei
an der Nikolaustreppe gingen die Erklärungen, zum
ehemaligen „Uten-oder Pfalzturm“, dem
Heidenturm, wo drei Mauern parallel
laufen. Die Hochmauerreste mit den fünf
Wehrgangsbögen sind die einzige Stelle, die
ungefähr zeigen kann, wie seit 1260 die Stadtmauer
rings um die Innenstadt aussah. Vom Salierdenkmal führt der
ottonisch-römische Mauerzug zum Archivgarten.
Vom Armbrusterturm( südöstl. Museumsturm) z. Karmelitergraben
Entlang der Steingasse , ab Gymnasium, sieht man die Mauer
als Häuserrückseite der Großen Pfaffengasse. Der Neubau kurz vor
dem „Weißen Tor“ lässt im Hofbereich noch eine schmale
Furt den Blick auf die frühsalische- und
ottonische Mauerlinie von 1050 zu. Hinter der Tankstelle
zwischen Linden- u. Zeppelinstraße stand einst der mächtige
gotische Schmied/Heiligenturm, dessen gelbe
Quader seiner Nordostecke zu sehen sind; seitlich
versetzt seit dem 20. Jh. als Sonnenburg
umfunktioniert. Der frühsalische Mauerdurchbruch an der
Feuerbachstraße verlief auf der Außenfuttermauer
des Alexgrabens ( St. Alexius-Kapelle). Der Mauerrücksprung verrät
die Auflage des frühromanischen hölzernen Wehrgangs. Zwischen
dem Neupörtel(Ludwigstraße) und dem Altpörtel
war die frühsalische Mauer durch gotische Wehrgangsbögen
verstärkt. Die Hausbreite von 6,7 m entspricht
dem Maß eines Bogens. In der Karmeliterstraße( 37/29) ist die
Brüstung der äußeren Grabenfuttermauer (15.Jh.) mit alten
Abdecksteinen (bespickt mit Glasscherben) zu sehen, die den
tiefen Graben zur Stadtmauer hin verdeckt. Die
Stadtmauer dahinter besteht bis zur Stockwerkshöhe aus
1 m starkem Quaderwerk. .An der frühgotischen
Ziegelsteinaufmauerung der Wehrgangsbrüstung sind noch
drei große Steinkugeln in der Wand zu erkennen „. Die
vierte gibt in einer Kellerbar ihre
Erinnerungen an weinfröhliche Zecher weiter“, so Dr.
Müller.
Die vier Vorstadtmauern von Speyer
-01.jpg) In einem
Kurz-Durchgang stellte der Buchautor Müller noch die Vorstadtmauern
vor, welche im 14. Jh. entstanden sind. Die im Jahre 1111 von
Kaiser Heinrich V . an Speyerer Bürger verliehenen
Privilegien, die 1198 von Herzog Philipp von Schwaben
übergebene Selbstverwaltung und der 1294 übertragene
Status einer Freien Reichsstadt, boten persönliche
Freiheit im Stadtgebiet und förderten die wirtschaftliche
Entwicklung, so dass Vorstädte immer größer und nun auch
durch Schutzmauern Sicherung erhielten. Um 1325 wurde
in der Ägidien Vorstadt entlang des
Gilgengrabens eine Mauer mit 19 Rundtürmen in Ziegelwerk
aufgebaut. Vom Drachenturm ist nur das offene
Untergeschoß vorhanden, den Taubenturm in
50 m Abstand ziert noch ein Kegeldach, der Turm zum Bock
besteht noch als Mauerstumpf und hat als einziger Turm dieser
Stadtmauer keinen Vogelnamen. Die Vorstadt über dem
Hasenpfuhl wurde 1335 durch eine Mauer geschützt und
hatte vier Türme . Beim Oberen Bachriegel mit
zwei Rundbögen auf schweren Quaderpfeilern und einer
Wehrgangsbrüstung mit einer Zinne war die Vorstadtmauer an
den innerstädtischen Lauerzwinger angeschlossen.
Einige Meter südlich des Riegelbogens sieht man untere
Gewändeteile der Allmendpforte, die für
Töpfer offen blieb, damit sie zu ihren Tonlagern gelangen
konnten. Vom Bärenturm ragt noch die äußere
Hälfte als Stumpf in den Graben; am Klostergarten zu St.
Magdalena steht der Löwenturm, vom Widderturm
sind noch Mauerreste zu finden. .Der Farrenturm
stand auf der Stadtmauerecke, wurde einem Garten-
später einem Bauernhaus einverleibt, das im
Kindergartenbereich zu erkennen ist. Das Küh-, später
Rheintor, verschwand um 1860 im Durchbruch der
Hasenpfuhlstraße . Am Brauhaus des Gasthofs zum Anker ist
noch ein Teil der Vorstadtmauer zu erkennen, daneben stand
der Gackturm mit schwerem Gatter als Unterer
Mauerriegel. Die Markus-Vorstadt wurde
1360 durch eine Mauer geschützt, die ab dem
Dreißigjährigen Krieg verschwunden war. Der Graben nach Osten war
vom Fischertor ab durch den Marxendamm vom
Altrheingelände(Festplatz) abgetrennt. Seit Mitte des 20.Jh. füllt
ihn die Karl-Leiling-Allee aus. Mauerreste sind noch am
Rot-Kreuz-Haus zu sehen. Das St. Marxentor war
eines der drei wichtigsten Stadttore und führte zur Rheinhäuser
Fähre, wie Dr. Müller mit Fotos beweisen konnte. Die
Vorstadt Altspeyer erhielt erst um 1380
eine Stadtmauer, obwohl das Dorf „ Spira“ dort
seit dem 6. Jahrhundert neben einem Judenviertel
bestand. Nur die Westmauer ( 1502 ) am Alten Friedhof
(Bahnhofstraße) blieb übrig. Bis zur Villa Velten( vor der
Araltankstelle) zogen sich bis 1830 die Stadtmauerflucht und
der schmale“ Judensand“(Friedhof) zum
Birkenturm(Siechenturm) hin. Der Speyerbach-Woog
vor der Dietbrücke, der Diebsturm und das
Heiliggrabtor standen im Bereich des Rauschenden Wassers an
der jetzigen Wormser Straßenbrücke.
In einem
Kurz-Durchgang stellte der Buchautor Müller noch die Vorstadtmauern
vor, welche im 14. Jh. entstanden sind. Die im Jahre 1111 von
Kaiser Heinrich V . an Speyerer Bürger verliehenen
Privilegien, die 1198 von Herzog Philipp von Schwaben
übergebene Selbstverwaltung und der 1294 übertragene
Status einer Freien Reichsstadt, boten persönliche
Freiheit im Stadtgebiet und förderten die wirtschaftliche
Entwicklung, so dass Vorstädte immer größer und nun auch
durch Schutzmauern Sicherung erhielten. Um 1325 wurde
in der Ägidien Vorstadt entlang des
Gilgengrabens eine Mauer mit 19 Rundtürmen in Ziegelwerk
aufgebaut. Vom Drachenturm ist nur das offene
Untergeschoß vorhanden, den Taubenturm in
50 m Abstand ziert noch ein Kegeldach, der Turm zum Bock
besteht noch als Mauerstumpf und hat als einziger Turm dieser
Stadtmauer keinen Vogelnamen. Die Vorstadt über dem
Hasenpfuhl wurde 1335 durch eine Mauer geschützt und
hatte vier Türme . Beim Oberen Bachriegel mit
zwei Rundbögen auf schweren Quaderpfeilern und einer
Wehrgangsbrüstung mit einer Zinne war die Vorstadtmauer an
den innerstädtischen Lauerzwinger angeschlossen.
Einige Meter südlich des Riegelbogens sieht man untere
Gewändeteile der Allmendpforte, die für
Töpfer offen blieb, damit sie zu ihren Tonlagern gelangen
konnten. Vom Bärenturm ragt noch die äußere
Hälfte als Stumpf in den Graben; am Klostergarten zu St.
Magdalena steht der Löwenturm, vom Widderturm
sind noch Mauerreste zu finden. .Der Farrenturm
stand auf der Stadtmauerecke, wurde einem Garten-
später einem Bauernhaus einverleibt, das im
Kindergartenbereich zu erkennen ist. Das Küh-, später
Rheintor, verschwand um 1860 im Durchbruch der
Hasenpfuhlstraße . Am Brauhaus des Gasthofs zum Anker ist
noch ein Teil der Vorstadtmauer zu erkennen, daneben stand
der Gackturm mit schwerem Gatter als Unterer
Mauerriegel. Die Markus-Vorstadt wurde
1360 durch eine Mauer geschützt, die ab dem
Dreißigjährigen Krieg verschwunden war. Der Graben nach Osten war
vom Fischertor ab durch den Marxendamm vom
Altrheingelände(Festplatz) abgetrennt. Seit Mitte des 20.Jh. füllt
ihn die Karl-Leiling-Allee aus. Mauerreste sind noch am
Rot-Kreuz-Haus zu sehen. Das St. Marxentor war
eines der drei wichtigsten Stadttore und führte zur Rheinhäuser
Fähre, wie Dr. Müller mit Fotos beweisen konnte. Die
Vorstadt Altspeyer erhielt erst um 1380
eine Stadtmauer, obwohl das Dorf „ Spira“ dort
seit dem 6. Jahrhundert neben einem Judenviertel
bestand. Nur die Westmauer ( 1502 ) am Alten Friedhof
(Bahnhofstraße) blieb übrig. Bis zur Villa Velten( vor der
Araltankstelle) zogen sich bis 1830 die Stadtmauerflucht und
der schmale“ Judensand“(Friedhof) zum
Birkenturm(Siechenturm) hin. Der Speyerbach-Woog
vor der Dietbrücke, der Diebsturm und das
Heiliggrabtor standen im Bereich des Rauschenden Wassers an
der jetzigen Wormser Straßenbrücke.
Viele spezielle Fragen der Zuhörer zur Stadtmauer,
der Zerstörung durch verschiedene Belagerungen und
Kriege, erklärte der bald 91-jährige
Buchautor bevor er mit bewunderungswürdigem
Beifall verabschiedet wurde. Er erklärte sich für
weitere Erzähltermine bereit. Alle Achtung.!!
Text und Foto: Karl-Heinz Jung
08.10.2013
Emma Ott feiert 100. Geburtstag
 (v. r.): Oberbürgermeister Hansjörg Eger und Vorsteher Pfarrer Dr. Werner Schwartz gratulieren Emma Ott zum 100. Geburtstag
(v. r.): Oberbürgermeister Hansjörg Eger und Vorsteher Pfarrer Dr. Werner Schwartz gratulieren Emma Ott zum 100. Geburtstag
Ihren 100. Geburtstag feierte Emma Ott am 17. Juli im
Diakonissen Seniorenstift Haus am Germansberg.
Ihrem Hobby, dem Tanzen, kann die Jubilarin nicht mehr
nachgehen, zahlreiche Fotos zeugen aber davon, dass sie ihre
Leidenschaft ihrer Enkelin vererbt hat. Die Tochter des einzigen
Sohnes ist im Turniertanzsport aktiv und besucht die Oma
regelmäßig, zum 100. Geburtstag gemeinsam mit Urenkel Kevin und
zahlreichen weiteren Verwandten.
Beim Tanzen lernte Emma Ott, die acht Jahre die Speyerer
Klosterschule besucht hat, ihren Ehemann Franz kennen, den sie 1936
in der Josephskirche heiratete und später bei Büroarbeiten in
seiner Schreinerei unterstützte.
Seit 2007 lebt die Jubilarin im Diakonissen Seniorenzentrum Haus
am Germansberg, wo sie an ihrem Ehrentag die Glückwünsche von
Vorsteher Pfarrer Dr. Werner Schwartz und Oberbürgermeister
Hansjörg Eger entgegennahm, der auch Grüße von Ministerpräsidentin
Malu Dreyer überbrachte. Sie habe keine Laster und ihr Leben lang
viel Bewegung gehabt, verriet die Seniorin ihr Erfolgsrezept für
ihr hohes Alter. Davon, dass auch eine gehörige Portion Humor
dazugehört, konnten sich Oberbürgermeister Eger und Dr. Werner
Schwartz überzeugen, bevor Emma Ott mit Verwandten, Bekannten und
Mitbewohnern bei Kaffee, Kuchen und einem Glas Sekt den runden
Geburtstag feierte. Diakonissen Speyer-Mannheim,
Presse
17.07.2013
Mit 86 Jahren sportlich aktiv
 Team alla
hopp!: Erstes Mitglied Laci Legenstein ermutigt zu mehr
Bewegung
Team alla
hopp!: Erstes Mitglied Laci Legenstein ermutigt zu mehr
Bewegung
Metropolregion Rhein-Neckar- Ladislav
Legenstein, 86 Jahre alt, lächelt verschmitzt, wenn er wieder
einmal gefragt wird, was das Geheimrezept für seine Fitness ist.
„Ich habe keines“, antwortet Legenstein, den alle beim Spitznamen
„Laci“ nennen. Nur dieses: Er habe sein ganzes Leben lang Sport
getrieben. Und noch immer trifft sich Legenstein jeden Montag mit
seiner Seniorengruppe zum Tennisspielen und ist auch regelmäßig auf
dem Golfplatz anzutreffen. Als erstes Mitglied im Team alla hopp!
ermutigt Legenstein andere dazu, Sport und Bewegung für sich zu
entdecken.
Legensteins eigener Weg zum Sport war quasi vorgezeichnet. Er
wuchs in Cakovec (Tschakathurn) im heutigen Kroatien auf. Beide
Eltern waren erfolgreiche Tischtennisspieler. „In Cakovec, damals
ein 3.000-Einwohner-Örtchen, war der Sport die einzige Möglichkeit
der Freizeitgestaltung.“ Legenstein spielte wie seine Eltern
zunächst Tischtennis, bald war er auch im Fußball und Volleyball
erfolgreich. Schließlich entdeckte er Tennis für sich: „Es gab
einen Platz in der Nähe meiner Schule, da durften meine Freunde und
ich die Bälle einsammeln. Und wenn die Herrschaften eine Pause
machten, durften wir ein paar Bälle übers Netz schlagen.“
 Beim
Golfspielen so gut wie im Tennis
Beim
Golfspielen so gut wie im Tennis
Als Legenstein zum Studium nach Zagreb ging, konzentrierte er
sich fortan ganz aufs Tennis. 1955 kehrte er seinem Heimatland den
Rücken und nahm die österreichische Staatsbürgerschaft an, die ihm
die Alpenrepublik aufgrund der Herkunft seines Vaters anbot. Später
ging der junge Sportler für Österreich im Davis Cup an den Start.
Mit Anfang 30 startete Legenstein durch: 1959 besiegte er bei den
French Open in Paris den Australier Rod Laver, der später vier Mal
in Wimbledon gewinnen sollte. Ein Jahr später triumphierte er bei
den Canadian Open in Toronto.
In die Rhein-Neckar-Region kam Legenstein Mitte der 1960er
Jahre. Er nahm einen Trainerjob beim Heidelberger TC an, für den er
auch aktiv spielte. Auf der Anlage des HTC lieferte er sich
packende Trainingspartien mit der jungen Steffi Graf. Anfang der
1970er Jahre begann er, nebenbei auf dem Golfplatz an seinem
Handicap zu arbeiten, das zwischenzeitlich bei 9 lag. Bis 2007, da
war er 80 Jahre alt, sammelte er 16 Welt- sowie 85
Europameistertitel in der Senioren-Altersklasse. Seitdem tritt er
nicht mehr bei Turnieren an, jagt aber weiterhin Filzkugeln über
das Netz und schlägt Bälle auf dem Golfplatz.
Gerne mal ein Glas Wein
Was tut er sonst noch für seine Fitness? Beim Essen eher wenig,
gesteht Laci Legenstein mit einem Augenzwinkern: „Ich habe immer
das gegessen, worauf ich Lust hatte, kein Gemüse, kein Fisch, dazu
gerne mal ein Glas Wein.“ Beim Rauchen hingegen bleibt er strikt:
„Keine Zigaretten!“, betont der 86-Jährige.
 Fitness ist nach
seiner Erfahrung nicht vom Alter abhängig und es braucht dazu auch
keine Profilaufbahn. Wichtig sei nur eins: dass es Spaß macht.
Deshalb sieht Laci Legenstein in alla hopp! ein hervorragendes
Angebot für alle Generationen. Auf seine Jugendtage blickt er
gerne, wenn auch mit etwas Wehmut zurück. „Es war eine schöne Zeit,
aber wir hatten viel geringere Entfaltungsmöglichkeiten. So etwas
wie einen kostenlosen Bewegungsparcours gab es damals nicht. Ich
freue mich darauf, bald einen solchen Parcours in der
Rhein-Neckar-Region zu testen“, sagt Legenstein.
Fitness ist nach
seiner Erfahrung nicht vom Alter abhängig und es braucht dazu auch
keine Profilaufbahn. Wichtig sei nur eins: dass es Spaß macht.
Deshalb sieht Laci Legenstein in alla hopp! ein hervorragendes
Angebot für alle Generationen. Auf seine Jugendtage blickt er
gerne, wenn auch mit etwas Wehmut zurück. „Es war eine schöne Zeit,
aber wir hatten viel geringere Entfaltungsmöglichkeiten. So etwas
wie einen kostenlosen Bewegungsparcours gab es damals nicht. Ich
freue mich darauf, bald einen solchen Parcours in der
Rhein-Neckar-Region zu testen“, sagt Legenstein.
Steckbrief Laci Legenstein
Name: Ladislav („Laci“) Legenstein
Geburtsort: Cakovec (Jugoslawien, heute Kroatien)
Geburtsdatum: 19. November 1926
Sportarten: Tennis, Golf
Meine Motivation: „Von meiner Fitness profitiere ich
körperlich und geistig.“
Kurzprofil Team alla hopp!
Bewegung und Begegnung der Generationen ist die Devise der
Aktion alla hopp! der Dietmar Hopp Stiftung. Das Team alla hopp!
steht stellvertretend für alle aktiven Bürger der Metropolregion
Rhein-Neckar. Bewegung befördert die körperliche und geistige
Fitness. Gemeinsames Sporttreiben macht Spaß und stärkt den
sozialen Zusammenhalt. Zum Team alla hopp!, das nach und nach
vorgestellt wird, gehören Menschen aller Generationen. Die
Team-Mitglieder haben Vorbildcharakter und spornen zur Bewegung an.
Sie berichten, welche Bedeutung Sport für ihr eigenes Leben hat und
woraus sie ihre Motivation für Bewegung schöpfen. Mehr
Informationen über die Teammitglieder: www.alla-hopp.de
Kurzprofil alla hopp!
Die Aktion alla hopp! ist ein Angebot für alle und verbindet
Jung und Alt durch die Freude an der Bewegung. Die Dietmar Hopp
Stiftung errichtet dazu 18 generationsübergreifende Bewegungs- und
Begegnungsräume. Das ganzheitliche Konzept zur Bewegungsförderung
wurde gemeinsam mit Experten erarbeitet. Die 290 Kommunen der
Metropolregion Rhein-Neckar können sich bis 30. September 2013
bewerben. Die alla hopp!-Anlagen bestehen aus drei bis vier
Modulen. Empfohlen wird eine Grundstücksgröße von rund 5.000
Quadratmetern. Im Bewegungsparcours bieten sich für alle
Generationen verschiedenste Möglichkeiten, Kraft, Ausdauer,
Gleichgewicht, Beweglichkeit und Koordination in unterschiedlichen
Anforderungsgraden zu trainieren. Ein Kinderspielplatz hält
Spielmöglichkeiten bereit, die die Motorik und die Kognition der
Kleinsten ansprechen. Der Spiel- und Bewegungsplatz für Kinder im
Schulalter lädt zum Mitgestalten und Austoben ein. Bei ausreichend
großer und geeigneter Fläche, kann optional ein Parcours für
jugendliche Sportler angeschlossen werden. Die Anlagen bieten
Nutzungsmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer und Menschen mit
Gehhilfe. Mit der Aktion alla hopp! schlägt die Dietmar Hopp
Stiftung eine Brücke zwischen ihren vier Förderbereichen Sport,
Medizin, Soziales und Bildung. Für die auf mehrere Jahre angelegte
Aktion alla hopp! plant die Dietmar Hopp Stiftung einen Betrag in
Höhe von 40 Millionen Euro ein.
Weitere Informationen unter www.alla-hopp.de. Text und Foto:
Dietmar Hopp Stiftung
12.07.2013
Sommerfest im Seniorenstift
 Sommerfest im Diakonissen Seniorenstift Bürgerhospital: auch ein Fest der Generationen
Sommerfest im Diakonissen Seniorenstift Bürgerhospital: auch ein Fest der Generationen
Zahlreiche Gäste kamen am 6. Juli bei herrlichem
Sommerwetter zum Sommerfest im Diakonissen Seniorenstift
Bürgerhospital
Nach einem ökumenischen Gottesdienst, gestaltet von Pfarrerin
Christine Gölzer von der Dreifaltigkeitskirche und Sigrid Sandmeier
von der Dom-Pfarrei, genossen Bewohner, Angehörige und Gäste das
vielfältige Programm, das mit einem Mittagessen begann, das von den
Rhythmen der Stadtjugendkapelle Speyer begleitet wurde. „Die
Kapelle hat sich trotz ihres eigenen Sommerfestes Zeit für uns
genommen“, freute sich Wolfgang Fischer-Oberhauser vom
sozialkulturellen Dienst des Seniorenstifts.
Begeistert verfolgten die Besucher anschließend die Auftritte
der Speyerer Squaredance-Gruppe Tupsy Turtles und von
Kindertanzgruppen des TSV Speyer, die bereits Tradition beim
Sommerfest am Mausbergweg haben. Bereits seit Jahrzehnten begleitet
die Ottersheimer Blaskapelle die jährliche Feier und sorgte auch in
diesem Jahr für Stimmung.
Publikumsmagneten waren außerdem das von Speyerer Gärtnereien
prachtvoll bestückte Blumenrad oder die Tombola mit 1000 Preisen,
darunter ein hochwertiger Gasgrill und ein Damenfahrrad, sowie das
Angebot des Bistro-Cafés am Mausbergweg.
„Mit einer Mischung aus traditionellen und modernen Angeboten
war wieder für jeden Geschmack etwas dabei und wir freuen uns schon
aufs Sommerfest im nächsten Jahr“, so Fischer-Oberhauser.
Diakonissen Speyer-Mannheim, Presse
09.07.2013
Robbe Anna zieht am Germansberg ein
 Tobias Bachmann, der die Robben in Deutschland vertreibt und Mitarbeiter coacht, begleitete Annas ersten Besuch im Haus am Germansberg.
Tobias Bachmann, der die Robben in Deutschland vertreibt und Mitarbeiter coacht, begleitete Annas ersten Besuch im Haus am Germansberg.
„Ist die süß“ und „Wie heißt sie“ schallte es aus allen
Richtungen, als Robbe Anna letzte Woche im Diakonissen
Seniorenzentrum Haus am Germansberg einzog.
Anna kommt allerdings nicht aus der Nordsee, sondern ist eine
japanische Erfindung, die in rund 50 Seniorenzentren in Deutschland
zu therapeutischen Zwecken eingesetzt wird. Der plüschige Roboter
PARO ist dem Baby einer Sattelrobbe nachempfunden und wird in der
Seniorenarbeit eingesetzt, da sie die soziale Interaktion fördert
und eine positive Wirkung auf die Stimmung der Menschen hat.
Dass Anna, die auf Berührungen und Geräusche reagiert, darüber
hinaus als zur Kommunikation anregt, konnten Heimleiter
Klaus-Dieter Schneider und sein Team beobachten, als sie das erste
Mal im Haus am Germansberg zum Einsatz kam. Nicht nur die
Betreuungsassistenten, die die Bewohnerinnen und Bewohner mit der
Robbe besuchen, kamen schnell ins Gespräch, Anna sorgte auch unter
den Senioren für reichlich Gelächter und Gesprächsstoff.
Untersuchungen belegen, dass der Kontakt zu Tieren aktivierende
und fördernde Effekte auf Menschen haben. „Die Roboter-Robbe hat
Studien zufolge einen ähnlich positiven Einfluss, ist aber
flexibler und kurzfristiger einsetzbar“, freut sich Katharina
Kieselhorst vom Sozialkulturellen Dienst darüber, dass die
Anschaffung durch eine Spende der Thor Stiftung möglich war.
Diakonissen Speyer-Mannheim, Presse
08.07.2013
Wiederaufbau der Rheinschifffahrt spannend interessierten Senioren erzählt
 Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling
Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Bei Kriegsende im
März 1945 war wegen der zerstörten Rheinbrücken Maxau, Germersheim,
Speyer und Ludwigshafen sowie der Schiffsbrücke bei
Germersheim kein Schiffsverkehr auf dem Rhein mehr möglich.
Zudem lagen in der pfälzisch-badischen Rheinstrecke in der Zeit 375
Schiffseinheiten gesprengt oder durch Luftangriffe versenkt im
Strom. Dem Wiederaufbau der Rheinschifffahrt in der
Nachkriegszeit widmete sich Günter Kuhn im Erzählcafé des
Seniorenbüros Speyer, zu dem rund 50 interessierte Senioren
ins Zelt des Schiffbauer-, Schiffer- und Fischervereins (SSFV)
gekommen waren. Kuhn, seit 2010 SSFV-Ehrenvorsitzender, führte den
Verein 24 Jahre lang und war maßgeblich beteiligt am Aufbau des
Museums in der Klipfelsau wenige Meter vorm Flaggenmast an der
Rheinpromenade. In den 46 Jahren seiner Arbeit beim Wasser- und
Schifffahrtsamt Mannheim bestimmte das Leben auf dem Rhein
Kuhns Tagewerk. Bei seinen Erzählungen spüren die Besucher, dass der Schifffahrtexperte seinen Beruf mit
Leidenschaft und Herz ausübte und mit dem Rhein auch im Ruhestand
noch fest verankert ist.
 Sofort im
April 1945 begannen die amerikanischen und französischen Truppen
mit der Errichtung behelfsmäßiger Übersetzstellen, um den
Armeenachschub nach der rechten Rheinseite sicherzustellen. Bis
Juli dauerte der Bau der amerikanischen Noteisenbahnbrücke 50
Meter unterhalb der zerstörten Rheinbrücke Mannheim-Ludwigshafen.
Außerdem stellten die Truppen ab April Pontonbrücken mit
wechselnden Standorten bei Speyer, Rheinhausen, Germersheim und
Maximiliansau auf, berichtete Kuhn von den Schwierigkeiten, an die
andere Uferseite zu kommen. Im Juli begannen die
Amerikaner damit, in den zerstörten Brücken
Schifffahrtsöffnungen herzustellen.
Sofort im
April 1945 begannen die amerikanischen und französischen Truppen
mit der Errichtung behelfsmäßiger Übersetzstellen, um den
Armeenachschub nach der rechten Rheinseite sicherzustellen. Bis
Juli dauerte der Bau der amerikanischen Noteisenbahnbrücke 50
Meter unterhalb der zerstörten Rheinbrücke Mannheim-Ludwigshafen.
Außerdem stellten die Truppen ab April Pontonbrücken mit
wechselnden Standorten bei Speyer, Rheinhausen, Germersheim und
Maximiliansau auf, berichtete Kuhn von den Schwierigkeiten, an die
andere Uferseite zu kommen. Im Juli begannen die
Amerikaner damit, in den zerstörten Brücken
Schifffahrtsöffnungen herzustellen.  Die
gesprengten oder zertrümmerten Konstruktionsteile sind aber nicht
gehoben, sondern im Flussbett belassen worden, wo sie sich in die
Sohle verlagerten und teilweise rasch einkiesten. Diese
Arbeitsweise erschwerte die späteren Räumungsarbeiten durch
deutsche Stellen erheblich. Die von den Besatzungsmächten
geschaffenen Durchfahrtsöffnungen waren für den im September 1945
freigegebenen Schiffsverkehr „sehr ungünstig und gefahrvoll“,
erinnerte der SSFV-Ehrenvorsitzende. Die Brückenstellen waren nur
äußerst schwer zu passieren. Die Speyerer Stelle war
besonders schwierig zu befahren, da hier in der starken
Rheinbiegung laut Kuhn nur eine 48 Meter breite Schifahrtsöffnung
zur Verfügung stand. In den folgenden Jahren seien alle für den
Rhein zuständigen Stellen damit beschäftigt gewesen, die im
Strom liegenden Fahrzeugwracks und restlichen Brückenteile zu heben
und aus der Fahrrinne zu räumen.
Die
gesprengten oder zertrümmerten Konstruktionsteile sind aber nicht
gehoben, sondern im Flussbett belassen worden, wo sie sich in die
Sohle verlagerten und teilweise rasch einkiesten. Diese
Arbeitsweise erschwerte die späteren Räumungsarbeiten durch
deutsche Stellen erheblich. Die von den Besatzungsmächten
geschaffenen Durchfahrtsöffnungen waren für den im September 1945
freigegebenen Schiffsverkehr „sehr ungünstig und gefahrvoll“,
erinnerte der SSFV-Ehrenvorsitzende. Die Brückenstellen waren nur
äußerst schwer zu passieren. Die Speyerer Stelle war
besonders schwierig zu befahren, da hier in der starken
Rheinbiegung laut Kuhn nur eine 48 Meter breite Schifahrtsöffnung
zur Verfügung stand. In den folgenden Jahren seien alle für den
Rhein zuständigen Stellen damit beschäftigt gewesen, die im
Strom liegenden Fahrzeugwracks und restlichen Brückenteile zu heben
und aus der Fahrrinne zu räumen.
Breiten Raum widmete der Rheinfachmann der in
dieser Zeit üblichen Schleppschifffahrt. Meist mehr als einen
Kilometer lang war ein Schleppzug auf der Oberrheinstrecke bis
Sondernheim. Ein Seitenradschlepper hatte bei einer Bergfahrt sechs
bis acht Anhänge (mit einer Gesamttonnage bis zu 10 000 Tonnen, die
wegen der Manövrierfähigkeit und des „Losschmeißens“ in den
Zielhafen jeweils mindestens 80 Meter Abstand voneinander haben
mussten. Die großen Motorschlepper stammten meist von Schweizer
Schiffbauern (Uri, Unterwalden) und hatten die gleiche Anzahl von
Schiffen im Schlepp wie die Räderboote.
Nun kam die große Zeit der Werften. Dort wurden
nicht nur neue Schiffe mit erheblich größerer Tragfähigkeit (bis zu
1200 Tonnen) und Tanker gebaut. Da die Schleppschifffahrt
(zwölf Mann pro Schleppschiff) auch wegen der meist langen
Liegezeiten und hohen Schleppkosten zu teuer geworden war, kam für
sie in den 60er Jahren das Aus. Nahezu die gesamte
Schlepp-Rheinflotte wurde in Werften zu Selbstfahrern umgebaut. Die
letzten Radschlepper gingen für immer vor Anker, um verschrottet zu
werden oder wurden umgebaut zu Kabinenschiffen. Dadurch wurde
der nach dem Krieg fast ausgestorbene Schiffsverkehr zu neuem Leben
erweckt Mit der Einführung des Radars waren nun auch
Nachttransporte möglich geworden. Die gelben Bojen 70 Meter vor und
hinter der Speyerer Salierbrücke weisen die Schiffigen des Nachts
auf die vom Radar sonst nicht erkannten Brückenpfeiler hin,
rechtzeitig zum Umschiffen, erklärte Kuhn auf Nachfrage eines
Erzählcafé-Gastes. Durch umfangreiche wasserbauliche Maßnahmen
wurden Verbesserungen in der Fahrwassertiefe erreicht, die jetzt ab
der Neckarmündung stromaufwärts bei 2,10 Metern liegt. Dort, wo die
Fahrwasserbreite weniger als 92 Meter beträgt, sind rote oder grüne
Fahrwassertonnen ausgelegt.
Inzwischen hat sich das frühere Schleppen häufig in
ein Schieben umgewandelt. Schon 1957 hatte die erste
Schubeinheit „Wasserbüffel“ die Fahrt auf dem Rhein
aufgenommen. Aus diesen frühen Versuchen haben sich dann
Schubeinheiten herausgebildet. Die rasante Entwicklung dieser aus
den USA übernommenen und für den Rheinverkehr angepassten
Schifffahrt hat „selbst Förderer und Befürworter überrascht“,
kommentiert Kuhn. In der badisch-pfälzischen Rheinstrecke
können in jüngster Zeit immer mehr leistungsstarke Schubboote
mit vier Schubleichtern (Gesamttonnage bis zu 12000 Tonnen)
beobachtet werden. Foto: khj
04.07.2013
„100 Jahre Flugplatz Speyer“ Thema des Erzählcafés
Speyer- Es begann 1912 mit
einer Wiese, auf der die ersten Flugzeuge starten und landen
durften. Ein Jahr später wurde gleich nebenan der Grundstein gelegt
für den Flugzeugbau, die heutige Pfalz-Flugzeugwerke GmbH. Die
100-jährige Flug-Geschichte war Anlass für ein
Seniorenbüro-Erzählcafe. Der Geschäftsführer der Flugplatz
Speyer-Ludwigshafen GmbH (FSL), Roland Kern, erzählte den knapp 50
Besuchern im neuen Flugtower locker vom Hocker alles rund um den
Speyerer Flugplatz, die Erweiterung und seine Zukunftsgedanken.
Pfarrer i.R. Bernhard Linvers, der sich viele Jahre im mit Erfolg
für den Erhalt der einst 2500 Arbeitsplätze und das Speyerer
Werk eingesetzt hatte, konnte als Moderator einiges zur
wechselvollen Geschichte des Unternehmens (von Heinkel
über VFW Fokker, MBB und DASA bis zur 1997 erfolgten Umwandlung in
die PFW Aerospace AG) beisteuern.
Die Gründung der Pfalz-Flugzeugwerke GmbH wurde am
3. Juni 1913 in Neustadt/W. beurkundet und am 12. Juli 1913 in das
Handelsregister beim Amtsgericht Ludwigshafen eingetragen. Im
Handelsregister stand: „Gegenstand des Unternehmens ist der Bau von
Flugzeugen und die Ausbildung von Flugzeugführern sowie die
Betätigung aller Geschäfte, die geeignet sind, das Unternehmen zu
fördern." Als Geschäftsführer wurden Alfred Eversbusch und Richard
Kahn eingesetzt. Das Kapital betrug 50.000 Mark, davon waren 20.000
Mark reine Sacheinlagen. Die Sacheinlagen bestanden aus einer
Flugmaschine, einem Flugzeugschuppen, einem Opel-Flugmotor sowie
verschiedenen Werkzeugen und Zeichnungen. Die Flugmaschine brachten
die Gebrüder Eversbusch mit, vermutlich eine Eigenkonstruktion, die
1912/13 in Neustadt entstand. Flugversuche führten mindestens
Anfang 1913 zu einem leichten Flugunfall von Alfred Eversbusch, der
sich demnach anfangs auch als Pilot versuchte.
Kaum jemandem sei bewusst, dass der Speyerer Platz
eines der ältesten Fluggelände in Deutschland ist, betonte Kern. Um
diese Zeit seien in Deutschland bis zu 20 Flugplätze gegründet
worden. Der Speyerer sei mit der erste gewesen. Bereits 1912
landete eine Rumpler-Taube auf den Wiesen am Rhein. Die Taube war
vor dem Ersten Weltkrieg einer der erfolgreichsten
Motorflugzeugtypen.
Schon früh - noch vor der Gründung der
Pfalz-Flugzeugwerke - bemühte sich Eversbusch um die Pachtung eines
Geländes an dem neu geschaffenen Speyerer Flugplatz. Bereits im
März 1913 erhielt er einen Vertragsentwurf für die Verpachtung.
Denn die Stadt Speyer war damals sehr an dem neuen Wirtschaftszweig
„Flugzeugbau" interessiert. Schließlich konnten 2000 Quadratmeter
zu 10 Pfennigen pro m² erworben werden. Zudem wurde der Schuppen
des Flugvereins für 50 Pf. pro Tag verpachtet, und die in der Nähe
stehende Festhalle konnte sogar kostenlos genutzt werden. Im
gemieteten Schuppen auf dem Flugplatz wurden hauptsächlich
technisch klare bzw. flugbereite Flugzeuge der PFW abgestellt.
In den beiden Weltkriegen wurde Kriegsflugzeug in
Speyer gebaut und repariert. 1914 landete und startete unter
anderem der „Rote Baron“ Manfred von Richthofen seinen Jagdflieger
in der Domstadt.
Seit den späten achtziger Jahren dient der Speyerer
Platz mehr als zwanzig Unternehmen als Basis für ihren
Geschäftsreiseverkehr. Eine grundlegend neue Situation brachte die
Ankündigung der DASA, dass sie den Platz künftig nicht mehr braucht
und damit den Flugbetrieb in Speyer einstellen möchte. Die
Regierung des Landes Rheinland-Pfalz und der Speyerer Stadtrat
stimmten 1994 den Plänen zum Kauf des Verkehrslandeplatzes zu. Noch
im selben Jahr wurden die Grundstücksgesellschaft FSG, die
Betreibergesellschaft FSL gegründet und der Kaufvertrag
abgeschlossen. Damals habe es geheißen, „das Werk kann nur gerettet
werden, wenn jedes Jahr ein Airbus gebaut wird“, erinnerte Linvers
an die Arbeitskämpfe. Heute werden jährlich rund 300
Airbus-Maschinen produziert, berichtete Kern, der als früherer
Wirtschaftsförderer und Beigeordneter der Stadt bereits in den 90er
Jahren mit der Weiterentwicklung des Verkehrslandeplatzes im Zuge
der Umstrukturierung des früheren DASA-Konzerns befasst und
vorübergehend auch als Geschäftsführer für die FSL GmbH tätig war
und nun seit 2012 wieder FSL-Geschäftsführer ist.
„Wir hatten nie vorgehabt einen Verkehrsflughafen
zu bauen“, erinnerte Kern an die Proteste der Bündnisgrünen und von
Anwohnern in Speyer-Süd gegen die Erweiterung der Landebahn für den
Speyerer Flugplatz, der heute ein 17 Hektar großes Gelände umfasst.
„Schauen sie, der Auwald ist immer noch da“, verteidigte Kern stets
die Erweiterung der Landebahn auf 1400 Meter, womit eine
Pistenlänge von 1667 Metern erreicht wurde. Hierfür
hatten auf rund 200 Meter breiter Front Baumspitzen gekappt werden
müssen. Den Flugplatzgegnern hielt der FSL-Geschäftsführer
eindrucksvolle Argumente vor: Die Gemeinde Heßheim bringe mit ihrer
Sonderabfalldeponie ihren Beitrag ein für die Metropolregion
Rhein-Neckar, die Stadt Ludwigshafen betreibe die
Müllverbrennungsanlage. Mit der Bereitstellung eines den
EU-Normen gerecht werdenden Flugplatzes leiste die Stadt Speyer
ihren Teil für die Infrastruktur der Wirtschaftsregion. Von den im
Jahr rund 30000 Flugbewegungen (im Schnitt 50 Starts oder Landungen
am Tag) seien der überwiegende Teil für private Flüge
(Ultraleichtflugzeuge, Segelflieger, Heißluftballons) und lediglich
3000 für Geschäftsflüge. Aber nur so könnten globale Unternehmen,
wie BASF, Heberger, Südzucker oder SAP und Verantwortliche
kleinerer Firmen ihre Geschäfte vor Ort machen und ihren Standort
in der Region halten. Hierfür können in der Domstadt auch bei
zwei Gesellschaften einer von sechs Jets angemietet werden. Den
Zeitvorteil lassen sich die Geschäftsleute dann 1500 Euro pro
Stunde kosten. Kern machte deutlich. „Wenn wir starke Unternehmen
im Rhein-Neckar-Raum haben wollen, müssen wir dafür sorgen, dass
die Entscheider ihren Standort in der Metropolregion halten und
auch dort erreicht werden können.“
06.06.2013
Einwurf
Gemeinsam für eine seniorengerechtere Umwelt – Plädoyer
fürs Aufspüren und Beseitigen von Mängeln, die älteren Menschen
„das Leben schwer machen“.
Von Gerhard Cantzler
Es sind die vielen Kleinigkeiten, die älteren Menschen das Leben
im Alltag oft schwer machen, oder die – stellt man sie ab – ihnen
das Leben bedeutend erleichtern können. Jede für sich vielleicht
nur eine Kleinigkeit, eine Bagatelle, die abzustellen nur wenige
hundert Euro und manchmal vielleicht sogar noch weniger kosten
würde. Eine fehlende Hausnummer anzubringen, ein Hinweisschild
umzustellen, die Phase einer Fußgängerampel so zu verlängern, dass
Senioren nicht gleich in Stress geraten müssen, wenn sie es während
einer Grünphase nicht „packen“, rechtzeitig über die Strasse zu
kommen - alles Dinge, die ohne übermäßigen Aufwand umzusetzen
wären. Die prominente Altersforscherin Prof. Dr. Ursula Lehr hat
bei ihrem Auftritt in Speyer unzählige Beispiele dafür aufgezeigt,
wo Verbesserungen ohne übermäßig großen Aufwand zu erzielen
wären.
Was an vielen Stellen auch in Speyer aber halt immer noch fehlt,
ist das Bewußtsein für solche Mängel - ist am Ende aber vielleicht
dann auch doch wieder das Geld, denn wenn auch jede Einzelmaßnahme
für sich genommen kaum ins Gewicht fallen würde, so addiert sich
doch das Umsetzen all der von der früheren Familienministerin
aufgeführten Veränderungen zu einem „stattlichen Sümmchen“.
Speyer hat derzeit gerade zwei zweifelsohne bedeutsame
Massnahmen in der „Mache“: Die Neugestaltung des Berliner Platzes,
dessen Fertigstellung am vergangenen Sonntag gerade zu Recht
gefeiert wurde und die Renaturierung des Woogbachtales, die derzeit
in ihre Endphase eintritt. 1,8 Mio. Euro für den Berliner Platz ,
1,3 Mio. für das Woogbachtal, Massnahmen, die sich Bund und Land
gemeinsam 75% der Aufwendungen kosten lassen. Da bleibt halt, so
scheint's, für das viele, nicht weniger notwendige „Kleinzeug“, wie
es jetzt die Forscherin beispielhaft aufgezeigt hat, kein Geld mehr
übrig.
Wie wäre es da, wenn Bund und Länder ein Finanzierungsprogramm
auf den Weg bringen würden, das es den Kommunen erlaubt, all die
Kleinigkeiten abzustellen, die Senioren – und dazu wird, wie wir
spätestens seit dem Auftritt von Prof. Dr. Lehr in Speyer wissen -
zukünftig ein immer größerer Teil unsrerer Bevölkerung zählen – bei
ihren alltäglichen Bewegungen im öffentlichen Verkehrsraum
behindern? Natürlich gibt es da noch immer das sogenannte
„Kooperationsverbot“, das es dem Bund verbietet, an den Ländern
vorbei die Kommunen direkt mit Finanzmitteln zu bedenken. Doch auch
dieses „Kooperationsverbot“ ist irgendwannd einmal von Menschen
erfunden und von Parlamenten verabschiedet worden. Und deshalb
sollte es für einen solchen Zweck auch wieder von Parlamenten
geändert werden können.
Aber auch den privaten Betreibern von Geschäften in unseren
Städten möchte man zurufen: Richtet Euch auf die neuen Zeiten ein,
wenn immer mehr „Alte“ in Eure Geschäfte kommen. Seniorengerecht
eingerichtet zu sein, seine Waren den Bedürfnissen der älteren
Generation entsprechend zu präsentieren zu können, das wird
zukünftig für den Handel ein absoluter Wettbewerbsvorteil sein.
Die Altersforschein Prof. Ursula Lehr hat dazu Beispiele „en
masse“ aufgezeigt und der SPEYER-KURIER hat in den
letzten Tagen versucht, einen Teil davon in seiner dreiteiligen
Artikelserie widerzugeben.
Jetzt ist es vor allem aber auch an den Sernioren selbst, mit
Selbstbewußtsein auf all das hinzuweisen, was sie im Alltag
behindert. Der Seniorenbeirat sollte eine gute Adresse dafür sein,
um solche Hinweise zu sammeln und zu kanalisieren - die politischen
Repräsentanten auf allen Ebenen aber sollten schleunigst nach Wegen
suchen, wie die Beseitigung der in einem solchen Prozess zu Tage
tretenden Mängel in unserem unmittelbaren Umfeld finanziert werden
kann.
Gegen die „kleinen“ Probleme des Alltags, die älteren Menschen oft das Leben erschweren
.jpg) Prof.
Dr. Ursula Lehr ruft Senioren zur aktiven Mitwirkung an einer
„präventiven Umweltgestaltung“ auf. (Teil 3/3)
Prof.
Dr. Ursula Lehr ruft Senioren zur aktiven Mitwirkung an einer
„präventiven Umweltgestaltung“ auf. (Teil 3/3)
cr. Speyer. Mit offenen Augen durch die Stadt
gehen – Stolpersteine und Barrieren erkennen und ausräumen – das
möchte die Altersforschein Prof.Dr. Ursula Lehr
und ruft deshalb Senioren auch in Speyer dazu auf, zu einer
„präventiven Umweltgestaltung“ beizutragen, indem sie alltägliche
Missstände aufdecken, sie ihrem Seniorenbeirat zur Kenntnis
bringen, damit dieser dann für Abhilfe sorgen kann.
Es sind zahllose, zum Teil kleine, oft scheint's banale Probleme
– unbedacht zumeist in eine Baumassnahme eingebracht - die Senioren
das Bewegen in einer nicht „seniorengerechten“ Stadt erschweren.
Sind die Straßenübergänge an der richtigen Stelle? Gibt es
visiuelle und akustische Signale, die die Übergänge sicherer
machen? Sind die Querungszeiten an Ampeln ausreichend lang? Alles
Fragen, die am besten im Selbstversuch von Senioren für Senioren
beantwortet werden können.
Kopfsteinpflaster – in historischen Altstädten oft ein
schmückendes Muss - für Senioren aber oft ein „gefährliches
Pflaster“, wenn ein bewegungseingeschränkter Mensch auf einem allzu
unebenen Untergrund zu Fall kommt. Ein mindestens 1,20 Meter
breiter, geglätteter Weg mit aufgerauter Oberfläche, so Prof. Dr.
Lehr, gibt Sicherheit und hilft, Stürze zu vermeiden.
.jpg) Straßenbeleuchtungen –
sind sie hell genug?
Straßenbeleuchtungen –
sind sie hell genug?
Treppen – verfügen sie über Handläufe auf beiden Seiten und sind
die Stufen deutlich genug markiert?
Wie ist es um die Erreichbarkeit von Arztpraxen bestellt –
insbesondere in Fußgängerzonen?
Straßenschilder – ist ihre Beschriftung groß genug und sind die
Kontraste ausreichend?
Hausnummern – sind überhaupt welche vorhanden - sind sie groß
genug und gut lesbar?
Sitzbänke – haben sie die richtige Höhe und verfügen sie über
Armlehnen?
Gibt es ausreichend Hinweisschilder auf öffentliche
Toiletten?
Fahradwege – gerade auch in Speyer derzeit in der Diskussion –
sind sie ausreichend gesichert? Fragen über Fragen, die mit wenigen
Blicken beantwortet werden können.
Und noch eine dringende Bitte der Professorin an die
entsrpechenden Akteure: Verzichten Sie auf die heute so gerne
benutzten „denglischen“ Begriffe: Shoppping Center, Meeting Point,
Ticket Shop, Business Lounge und Event Center sind für viele
Senioren „Böhmische Dörfer“ und dienen mehr der Irritation als der
Information – von den Fahrkartenautomaten auf den Bahnhöfen ganz zu
schweigen, die nicht nur für viele ältere Menschen ein „Buch mit
sieben Siegeln“ sind.
Gläserne und deshalb transparente Übergänge sind architektonisch
sicher attraktiv – im Alltag vieler, insbesondere älterer Menschen
aber lösen sie Verunsicherung und sogar Ängste aus. Gleiches gilt
auch für breite Freitreppenanlagen, wenn keine Handläufe in sie
integriert sind.
.jpg) Dann kam
Prof. Dr.Lehr auch auf die Gestaltung von kulturellen Einrichtungen
zu sprechen: Theater und Kinos, wo zu breite Sitzreihen das
Erreichen des Sitzplatzes in der Mitte der Reihe erschweren.Hier
könnten Zwischengänge in angemessenen Abständen Abhilfe
schaffen.
Dann kam
Prof. Dr.Lehr auch auf die Gestaltung von kulturellen Einrichtungen
zu sprechen: Theater und Kinos, wo zu breite Sitzreihen das
Erreichen des Sitzplatzes in der Mitte der Reihe erschweren.Hier
könnten Zwischengänge in angemessenen Abständen Abhilfe
schaffen.
Beschriftungen und Legenden an Exponaten in Museen und
Ausstellungen, die zu hoch oder zu tief angebracht, die zu klein –
um nicht zu sagen zu winzig – geschrieben sind und wo eine graue
Schrift auf grauem Untergrund zwar ein chices Design erkennen
lässt, die aber ganz klar zu Lasten der Lesbarkeit gehen.
Bei den Bahnhöfen beklagt Prof. Dr. Lehr, dass Bahnsteige immer
noch viel zu oft nur über Treppen erreichbar sind, weil Aufzüge
fehlen. Züge müssen oft über viel zu hohe Stufen bestiegen werden,
in Regionalbahnen ist der Zwang zur Benutzung von Stufen
bauarttypisch. Auch hier seien die Reservierungen meist
unleserlich, weil zu klein geschrieben, ebenso wie die Fahrpläne,
die zudem auch noch oft zu hoch aufgehängt sind.
Im Straßenverkehr benötigen ältere Autofahrer klare und
eindeutige Informationen. Dazu müssen Straßenschilder groß und
Verkehrszeichen gut leserlich und richtig platziert sein. Klare
Schriften in Kontrastfarben tragen ebenso zur richtigen
Orientierung bei wie rechtzeitige Hinweise aufs Abbiegen oder
Einordnen. Alles Hilfen, die wie eine helle Beleuchtung für viele
ältere Autofahrer unabdingbar sind zu einer sicheren Teilnahme am
Straßenverkehr, die aber auch jüngeren das Fahren erleichtern.
.jpg) Der
demografische Wandel, so ist sich Prof. Dr. Lehr sicher, werde auch
dazu führen, dass Tankstellen wieder verstärkt einen Bedienservice
anbieten müssten, um älteren Kunden das beschwerliche Aussteigen zu
ersparen.
Der
demografische Wandel, so ist sich Prof. Dr. Lehr sicher, werde auch
dazu führen, dass Tankstellen wieder verstärkt einen Bedienservice
anbieten müssten, um älteren Kunden das beschwerliche Aussteigen zu
ersparen.
Um die sich aus einer solchen Mängelaufnahme ableitenden
Probleme für die Zukunft wenn schon nicht ganz zu vermeiden, so
doch wenigstens zu reduzieren, müssten neue Konzepte der
Stadtplanung und der Stadtentwicklung erarbeitet werden. Dies gelte
insbesondere auch für öffentliche Gebäude, für Sportanlagen und
Veranstaltungszentren, die für den Freizeitwert einer Stadt und
damit auch für Senioren von Bedeutung seien. Hier müsste der
Zunahme von Rollstuhlfahrern und Benutzern von Rollatoren im
Straßenverkehr durch die Einbeziehung entsprechender baulicher
Pinzipien entsprochen werden, die auch die schwindende Seh- und
Hörfähigkeit sowie den Verlust der Sensibilität in den
Fingerkuppen, der Gelenkigkeit und der Fingerfertigkeit
berücksichtige.
Um Menschen im fortgeschrittenen Alter den Alltag zu
erleichtern, spricht sich die Professorin auch nachdrücklich für
den Ausbau einer wohnortnahnen Versorgung aus:
Lebensmittelgeschäft, Post, Sparkasse, Apotheke und medizinische
Versorgung müssten wohnungsnah erreichbar sein. Hol- und
Bringdienste müssten den Menschen auch zum Besuch von sportlichen,
kulturellen und sozialen Veranstaltungen zur Verfügung stehen.
.jpg) Auch an
die Gestaltung von Ladengeschäften stellt Prof. Dr. Lehr geänderte
Anforderungen: Sie sollten leicht erreicchbar sein und über gute
Parkmöglcihkeiten mit breiten Parkplätzen verfügen, die es auch
Menschen z.B. mit Knieproblemen überhaupt erst möglich machten, ihr
Fahrzeug schmerzfrei zu verlassen. Bei den Zugängen sollte auf die
Beschaffenheit von Stufen, auf eventuell fehlende Handläufe oder zu
schwere Türen geachtet werden, die einen zu hohen Kraftaufwand
erforderten. Auf glatte Fussböden und auch hier sollte auf
Glasböden ganz verzichtet werden. Treppen sollten generell nicht
offen und dadurch durchsichtig sein, weil dies Unsicherheit
auslöst, Handläufe sollten rund und gut zu umgreifen und auch an
Rolltreppen sollten gut zu greifende Handläufe montiert sein. Die
Gänge in den Ladengeschäften sollten zudem so breit sein, dass auch
mit dem Rollator bequem zu befahren sind.
Auch an
die Gestaltung von Ladengeschäften stellt Prof. Dr. Lehr geänderte
Anforderungen: Sie sollten leicht erreicchbar sein und über gute
Parkmöglcihkeiten mit breiten Parkplätzen verfügen, die es auch
Menschen z.B. mit Knieproblemen überhaupt erst möglich machten, ihr
Fahrzeug schmerzfrei zu verlassen. Bei den Zugängen sollte auf die
Beschaffenheit von Stufen, auf eventuell fehlende Handläufe oder zu
schwere Türen geachtet werden, die einen zu hohen Kraftaufwand
erforderten. Auf glatte Fussböden und auch hier sollte auf
Glasböden ganz verzichtet werden. Treppen sollten generell nicht
offen und dadurch durchsichtig sein, weil dies Unsicherheit
auslöst, Handläufe sollten rund und gut zu umgreifen und auch an
Rolltreppen sollten gut zu greifende Handläufe montiert sein. Die
Gänge in den Ladengeschäften sollten zudem so breit sein, dass auch
mit dem Rollator bequem zu befahren sind.
Praktische Tipps der Professorin, die nicht nur „Älteren“ zugute
kommen: Einkaufswagen sollten auch als Gehstütze nutzbar sein und
mit Ablagen für Taschen und Gehstock sowie mit einer
Klemmvorrichtung für den Einkaufszettel ausgerüstet sein.
Für Senioren oft unerreichbar: Waren, die zu hoch oder zu
niedrig in den Regalen einsortiert sind und die deshalb nur schwer
oder überhaupt nicht „gegriffen“ werden können. Informationen
darüber, wo was zu finden ist, sollten in großen und gut lesbaren
Buchstaben angebracht sein - für das Lesen von Preisettiketten und
Inhaltsangaben empfiehlt die Expertin das Anbringen fixierter Lupen
an den Regalen oder am besten gleich an den Einkaufswagen. Die
sollten auch an den riesigen Tiefkühltruhen verfügbar sein, die für
viele Senioren oft viel zu breit und vor allem viel zu tief sind,
als dass sie die darin befindlichen Waren problemlos „greifen“
könnten. Überhaupt kritisiert Prof. Dr. Lehr, dass noch immer viel
zu wenige Lebensmittel in Gebindegrössen angeboten werden, die für
Ein-Personen-Haushalte geeignet sind.
Schließlich die Werbung für die unteschiedlichen Waren: Sie
sollte nicht mit Laufschriften oder in anderen bewegten Formen auf
die Kunden „losgelassen“ werden, weil dies nach einschlägigen
Untersuchungen nicht nur für viele Senioren irritierend und
verwirrend sei.
.jpg) Am Ende
eine Einkaufstour durch den Grooßmarkt schließlich empfiehlt die
Altersforscherin auch an den Kassen dringend Verbesserungen:
Ablagemöglichkeiten für Handtaschen und eventuell eine
Klemmvorrichtung für den Gehstock sollten angebracht werden, um zu
vermeiden, dass der Stock zu Boden fällt und unter großen Mühen
wieder aufgehoben werden muss. An den Kassen sollten große und
deshalb gut ablesbare Zahlen die Rechnungssumme anzeigen, um auch
Sehbehinderten gerecht zu werden, leicht geschwungene Schalen
helfen zudem, das Aufnehmen von Münzgeld zu erleichtern.
Am Ende
eine Einkaufstour durch den Grooßmarkt schließlich empfiehlt die
Altersforscherin auch an den Kassen dringend Verbesserungen:
Ablagemöglichkeiten für Handtaschen und eventuell eine
Klemmvorrichtung für den Gehstock sollten angebracht werden, um zu
vermeiden, dass der Stock zu Boden fällt und unter großen Mühen
wieder aufgehoben werden muss. An den Kassen sollten große und
deshalb gut ablesbare Zahlen die Rechnungssumme anzeigen, um auch
Sehbehinderten gerecht zu werden, leicht geschwungene Schalen
helfen zudem, das Aufnehmen von Münzgeld zu erleichtern.
Gerade Lebensmittelgeschäfte sollten sich darauf einstellen,
zukünftig verstärkt mit Senioren zu tun zu bekommen. Ihnen den
Einkauf zu erleichtern, führt zu Kundenzufriedenheit und zu
Kundenbindung.
Auch in der häuslichen Umgebung könnte eine „dritte“ Hand
Senioren oft helfen, ihren Alltag leichter zu bewältigen, wenn ihr
schwindendes Sensorium das Greifvermögen einschränkt. Dann fällt es
älteren Menschen oft schwer, ein Marmeladenglas zu öffnen, einen
Korken aus einer Flasche zu ziehen, vakuumverpackte Wurst, Schinken
oder Käse aus der Folie zu holen oder einfach nur eine defekte
Glühbirne auszutauschen.
Um hier Abhilfe zu schaffen und um Senioren vor einer
ungewollten Abhängigkeit von Dritten zu bewahren, empfiehlt die
Wissenschaftlerin in diesem Zusammenhang dringend eine generelle
Überprüfung aller Verpackungen von Alltagsprodukten. So könnten
auch Verschlüsse von Dosen und anderen Behältnissen leichter zu
öffnen sein – die komplizierten Verschlüsse von Putzmitteln, aber
auch von manchen Medikamenten-Packungen gehören dazu. Dann aber
auch die Minaeralwasserflaschen mit Plastikverschluss, Laschen an
Vakuumverpackungen, die von älteren Händen oft nicht mehr „zu
fassen“ sind – alles kleine Hürden im Alltag, die leicht zu
beseitigen wären.
Und nicht zuletzt sind da auch die heute unvermeidlichen
Fernbedienungen für Fernsehgeräte, Radios und viele andere
Gerätschaften mehr, die zwar das oft beschwerliche Aufstehen vom
Sessel ersparen, die aber oft so winzig klein beschriftet oder mit
so kleinen Tasten ausgestattet sind, dass „Senior“ sie eigentlich
nicht gebrauchen kann.
.jpg) Dem
Grunde nach eigentlich alles „Kleinigkeiten“, lappalien, die ohne
großen Aufwand und Mühe zu verändern wären, würden sich Designer
und Marketing-Verantwortliche für einen Moment in die
Lebenssituation von Senioren versetzen. Wenn sie sich
vergegenwärtigen würden, dass heute bereits nur noch ein Prozent
aller über 70jährigen über seine uneingeschränkte Sehkraft verfügt,
dann würden sie vielleicht darauf achten, dass Beipackzettel von
Medikamenten oder Bedienungsanleitungen von Geräten ausreichend
groß gedruckt sind, dass darauf verzichtet wird, aus Design-Gründen
graue Schriften auf einen grauen Untergrund zu drucken oder dass
verschnörkelte und deshalb kaum leserliche Schriftarten verwendet
werden.
Dem
Grunde nach eigentlich alles „Kleinigkeiten“, lappalien, die ohne
großen Aufwand und Mühe zu verändern wären, würden sich Designer
und Marketing-Verantwortliche für einen Moment in die
Lebenssituation von Senioren versetzen. Wenn sie sich
vergegenwärtigen würden, dass heute bereits nur noch ein Prozent
aller über 70jährigen über seine uneingeschränkte Sehkraft verfügt,
dann würden sie vielleicht darauf achten, dass Beipackzettel von
Medikamenten oder Bedienungsanleitungen von Geräten ausreichend
groß gedruckt sind, dass darauf verzichtet wird, aus Design-Gründen
graue Schriften auf einen grauen Untergrund zu drucken oder dass
verschnörkelte und deshalb kaum leserliche Schriftarten verwendet
werden.
„Sieht vielleicht schön aus – ist aber extrem
Senioren-unfreundlich“, kritisiert die Altersforscherrin viele
Produkte und rät Herstellern, die auch ältere Menschen erreichen
wollen, sich der in der Wissenschaft heute schon längst zum
Standard gehörenden „Age Explorer“ zu bedienen, eines
Versuchsanzuges, der künstlich die Bewegungsfähigkeit seines
Trägers einschränkt. „Dann werden sie rasch am eigenen Leib
erfahren, was zu ändern ist“,
Abschließend rief die Wissenschaftlerin nicht nur die Senioren
dazu auf, all solche Misstände ihrem Seniorenbeirat zu melden,
damit dieser für Abhilfe sorgen kann, aber auch direkt – durch
Interventionen bei Verbraucherzentralen und letztlich auch bei den
Herstellern selbst – auf Abhilfe zu drängen.
Nur durch eigenes Engagement könnten Fehler in der eigenen
Umweltgetaltung aufgedeckt und letztlich auch abgestellt werden.
Die Senioren seien eine zunehemd große „Macht“ in unserer
Gesllschaft, die vieles bewegen könnten, wenn sie es nur wollten
und wenn sie nicht vor jedem Problem sofort kapitulierten,
ermunterte die Professorin ihr Auditorium. Denn wie schloss die
Expertin ihr höchst instruktives Referat? „Der Optimist macht aus
jedem Problem eine Aufgabe, die es zu lösen hilt! Der Pessimist
macht aus jeder Aufgabe ein Problem, dem er sich hilflos
ausgeliefert sieht - Lassen Sie uns deshalb Optimisten sein“, rief
sie ihren dankbat-begeisteten Zuhörern zu. Foto: Aus dem
Vortrag von Prof. Dr. Ursula Lehr, mit freundlicher
Genehmigung
29.05.2013
Prof. Dr. Lehr fordert Förderung des freiwilligen Engagements der Senioren:
 „Es darf aber
kein 'soziales Pflichtjahr für Ältere' daraus werden“ - Tipps für
Möglichkeiten, sich für andere einzubringen. (Teil
2/3)
„Es darf aber
kein 'soziales Pflichtjahr für Ältere' daraus werden“ - Tipps für
Möglichkeiten, sich für andere einzubringen. (Teil
2/3)
cr. Speyer. Auf zahlreiche
Möglichkeiten für Senioren, sich mit ihren Erfahrungen und ihrem
Engagement zugunsten der Gesellschaft und einzelner ihrer
Mitglieder einzubringen, ging die Altersforscherin und frühere
Bundesministerin Prof. Dr. Ursula Lehr im zweiten
Teil ihres Referates beim Treffen des Landes-Seniorenrates
Rheinland-Pfalz ein (der SPEYER-KURIER berichtete
in seiner Ausgabe am 27. Mai 2013). Zugleich ermutigte sie die
Zuhörer im Historischen Ratssaal der Stadt Speyer, mit offenen
Augen durch ihre Stadt zu gehen und dabei auf gerade für ältere
Menschen behindernde Umstände zu achten. Auch hierzu gab sie
zahlreiche praktische Hinweise - worauf zu achten sei und was zu
tun ist. Dazu mehr im 3. Teil unserer Berichterstattung über den
Vortrag der Altersforscherin, der morgen im
SPEYER-KURIER erscheint.
„Weiß ich doch längst“ mag der eine oder andere gedacht haben,
als die Professorin auf die vielfältigen Möglichkeiten zu sprechen
kam, wie Senioren ihren weniger mobilen Altersgenossen behilflich
sein könnte. Denn gerade auch hier gilt der Satz von Erich Ksätner,
„Es gibt nichts Gutes außer man tut es“. Und deshalb war es sicher
mehr als nur hilfreich, an diesem Nachmittag komprimiert über
mögliche Aktivitäten informiert zu werden.
Die reichten von der ehrenamtlichen Mitarbeit in Sportvereinen –
gerade für lebenslang sportlich aktiven Senioren meist jetzt schon
ein „Muss“. Die Möglichkeit jedoch, durch den stundenweisen
ehrenamtlichen Einsatz von Senioren die Öffnungszeiten z.B. in
(Pfarr)biliotheken oder in Schwimmbädern zu verlängern, wie es
Prof. Dr. Lehr vorschlägt, scheint jedoch innovativ und
erwägenswert.
Für junge Eltern wäre es oft eine unschätzbar wertvolle Hilfe,
wenn ein älterer Mensch – aus vielerlei Gründen kann dies oft genug
nicht die eigene Oma oder der Opa sein – ein Kind aus der
Nachbarschaft, einen Schulanfänger vielleicht, frühmorgens zum
Unterricht begleiten und es zum Schulschluss dort wieder abholen
würde.
 „Großelterndienste“
hält die Wissenschaftlerin aber auch in anderer Form für hilfreich:
Senioren, die mit ihrem Erfahrungshorizont und ihren wertvollen
Kontakten in der Gesellschaft in Schulen in einer Form von
ergänzendem Unterricht über „ihren“ früheren Beruf berichten und
die Schulabgänger als „Paten“ bei der Berufswahl und der
Ausbildungsplatzsuche unterstützen können – besonders wichtig
gerade auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund, denen
Senioren auch bei der Optimierung ihrer Lese-, Sprach- und
Schreibkompetenzen helfen könnten – andere aber auch, die als
„neutrale Dritte“ helfen können, Konflikte in den Schulen zu
entschärfen.
„Großelterndienste“
hält die Wissenschaftlerin aber auch in anderer Form für hilfreich:
Senioren, die mit ihrem Erfahrungshorizont und ihren wertvollen
Kontakten in der Gesellschaft in Schulen in einer Form von
ergänzendem Unterricht über „ihren“ früheren Beruf berichten und
die Schulabgänger als „Paten“ bei der Berufswahl und der
Ausbildungsplatzsuche unterstützen können – besonders wichtig
gerade auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund, denen
Senioren auch bei der Optimierung ihrer Lese-, Sprach- und
Schreibkompetenzen helfen könnten – andere aber auch, die als
„neutrale Dritte“ helfen können, Konflikte in den Schulen zu
entschärfen.
Besuchsdienste im Krankenhaus – z.B. in Form der bewährten
„grünen Damen“ - tragen dazu bei, die Kommunikation der Patienten
nach außen aufrecht zu erhalten und kleine Besorgungen für die
Patienten zu erledigen. Besuchs- und Begleitdienste in Altenheimen
ermöglichen es aber auch unsicheren und immobilen Menschen, ohne
Angst vor Stürzen oder anderen Problemen auf dem Weg einen Arzt
aufzusuchen oder auch einmal ein Museum oder eine
Theatervorstellung zu besuchen.
Senioren leisten „Hilfe den Helfenden“ - lösen pflegende
Angehörige stundenweise in ihrem oft überaus belastenden Dienst ab
oder nehmen sich – mit besonderer Ausbildung – der Unterstützung in
der Hospizarbeit an. Hier wünscht sich Prof. Dr. Lehr allerdings
eine Verbesserung der Zusammenarbeit mit der Ärzteschaft und den
Kirchen.
Für viele Senioren mit Sehstörungen oder mit altersbedingten
motorischen Störungen sicher auch eine gute Idee der Ex-Ministerin,
wenn sie Altersgenossen dazu aufruft, in der Bank, der Sparkasse
oder der Postbank in der Nachbarschaft wöchtenlich für ein paar
Stunden bereit zu stehen, um beim Ausfüllen von Formularen
behilflichzu sein, was bei dem zunehmenden Umfang von
IBAN-Zahlen-Buchstaben-Verbindungen selbst für Menschen mit „guten
Augen“ immer schwieriger wird.
Senioren seien heute schon im Rahmen des SES, des „Senior Expert
Serrvices“ begehrte Berater in den Entwicklungsländern, so Prof.
Dr. Lehr – zuhause aber könnten sie Gleichaltrige z.B. in die
„Geheimnisse“ von PC, Internet und vielen anderen technischen
Geräten einführen.
 Dabei, so die
Professorin, brauche auch das Ehrenamt quasi eine
„berufsbegleitende“ Weiterbildung durch gegenseitige Aussprache,
Erfahrungsaustausch, aber auch durch gegenseitige Ermutigung. „Wir
wollen das freiwillige Engagement der Senioren fördern, es darf
aber kein „soziales Pflichtjahr für Ältere“ daraus werden“, stellte
die Wissenschaftlerin klar. Auch die Stärkung der Motivation und
das Ergründen und Beseitigen von Barrieren gehöre zu den
Herausforderungen an die Seniorenbeiräte. Dazu gehöre die Schaffung
und die Verbesserung geeigneter Rahmenbedingungen für diese Arbeit,
z.B. durch die Einrichtung von Seniorenbüros und
Mehrgenerationenhäuser – soweit nicht schon vorhanden – sowie durch
den Ausbau einer ihr Engagement fördernden Infrastruktur.
Dabei, so die
Professorin, brauche auch das Ehrenamt quasi eine
„berufsbegleitende“ Weiterbildung durch gegenseitige Aussprache,
Erfahrungsaustausch, aber auch durch gegenseitige Ermutigung. „Wir
wollen das freiwillige Engagement der Senioren fördern, es darf
aber kein „soziales Pflichtjahr für Ältere“ daraus werden“, stellte
die Wissenschaftlerin klar. Auch die Stärkung der Motivation und
das Ergründen und Beseitigen von Barrieren gehöre zu den
Herausforderungen an die Seniorenbeiräte. Dazu gehöre die Schaffung
und die Verbesserung geeigneter Rahmenbedingungen für diese Arbeit,
z.B. durch die Einrichtung von Seniorenbüros und
Mehrgenerationenhäuser – soweit nicht schon vorhanden – sowie durch
den Ausbau einer ihr Engagement fördernden Infrastruktur.
Für die Senioren, die sich in solche Dienste einbrächten, gelte
es aber auch, Versicherungsleistungen in Un-fällen zu klären und
die Erstattung von Unkosten bzw. den Ersatz von Auslagen
sicherzustellen.
Und was Prof. Dr. Ursula Lehr unter
„präventiver Umweltgestaltung“ versteht, und was jeder einzelne
Bürger dazu beitragen kann, eine solche Umwelt zu erreichen, das
wird der SPEYER-KURIER morgen im 3. Teil seiner
Berichterstattung über den interssanten Vortrag der Alterforscherin
darstellen – denn wir alle werden – hoffentlich – Senioren – der
eine früher, der andere später. Foto: gc
28.05.2013
Geistig und körperlich aktiv bleiben für ein selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter
 BAGSO-Vorsitzende
und Altersforscherin Prof. Dr. Lehr zu Gast bei der
LandesSeniorenVertretung Rheinland-Pfalz
BAGSO-Vorsitzende
und Altersforscherin Prof. Dr. Lehr zu Gast bei der
LandesSeniorenVertretung Rheinland-Pfalz
cr. Speyer. Es waren durchaus beeindruckende,
in mancherlei Hinsicht vielleicht sogar Besorgnis erregende
Perspektiven, die heute die frühere
Bundesministerin für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit
und Leiterin des Instituts für Gereontologie an der Universität
Heidelberg, Prof. Dr. Ursula Lehr, beim
Treffen des Landes-Seniorenrates im Historischen Ratssaal der Stadt
Speyer aufzeigte. Sicher, das von ihr aufbereitete Zahlenmaterial
über die demographische Entwicklung in den kommenden Jahren – über
Bevölkerungszu- und abnahmen in den unterschiedlichen Erdteilen und
Regionen der Welt – war nicht unbedingt neu. In dieser Dichte aber
und heruntergebrochen auf die Ebenen der Bundesrepublik
Deutschland, des Landes Rheinland-Pfalz und letztlich auch der
Stadt Speyer machte es doch augenfällig: Unsere Gesellschaft wird
„weniger, bunter und vor allem älter“, wie es die Professorin auf
einen kurzen Nenner brachte.
Lebten im Jahr 2000 in Europa noch insgesamt ca. 727,3 Millionen
Menschen mit einem Durchschnittsalter von 37,7 Jahren, so werden
dies nach den Prognosen der UN im Jahr 2050 nur noch 603,3
Millionen sein – dann allerdings mit einem Durchschnittsalter von
49,5 Jahren. In Deutschland werde sich diese Zahl von 81,7
Millionen Einwohner im Jahr 2000 mit einem Durchschnittsalter von
42,4 Jahren auf 70,8 Millionen Einwohner im Jahr 2050 mit einem
durchschnittlichen Alter von 51,4 Jahren reduzieren.
 Interessant
dabei: Während die Einwohnerzahlen in Europa bis zur Mitte des 21.
Jahrhunderts kontinuierlich absinken, werden sie auf allen anderen
Kontinenten der Welt ansteigen: Bis ins Jahr 2050 in Afrika von 793
Mio. im Jahr 2000 um fast das dreifache auf 2 Milliarden in 2050 -
in Lateinamerika von 518 auf 805 Millionen - in Nordamerika von 314
auf 438 Mio und in Asien gar von 3,672 Milliarden Einwohner auf
5.428 Milliarden im Jahr 2050. Europa und damit auch Deutschland
werden schrumpfen, werden verlieren – zumindest nach der Zahl
seiner Einwohner – und an Bedeutung in der Welt.
Interessant
dabei: Während die Einwohnerzahlen in Europa bis zur Mitte des 21.
Jahrhunderts kontinuierlich absinken, werden sie auf allen anderen
Kontinenten der Welt ansteigen: Bis ins Jahr 2050 in Afrika von 793
Mio. im Jahr 2000 um fast das dreifache auf 2 Milliarden in 2050 -
in Lateinamerika von 518 auf 805 Millionen - in Nordamerika von 314
auf 438 Mio und in Asien gar von 3,672 Milliarden Einwohner auf
5.428 Milliarden im Jahr 2050. Europa und damit auch Deutschland
werden schrumpfen, werden verlieren – zumindest nach der Zahl
seiner Einwohner – und an Bedeutung in der Welt.
Auch für Rheinland-Pfalz und für Speyer hatte Prof. Dr. Lehr
Zahlen mitgebracht: Während das Land von 2009 bis 2030 4,5% seiner
Einwohner verlieren soll, sagt der Bertelsmann Demografie-Atlas von
2010 der Stadt Speyer in diesem Zeitraum noch ein zumindest
leichtes Wachstum von 0,1% seiner Bevölkerung voraus. Nur einige
wenige weitere kommunale Gebietskörperschaften, zumeist entlang der
Rheinschiene - Mainz, Worms, Neustadt/Weinstraße und Landau - und
dazu Trier, wohl wegen seiner Lage im Zentrum des
Saar-Lorr-Lux-Raumes, können sich gleichfalls auf weiteren Zuwachs
freuen.
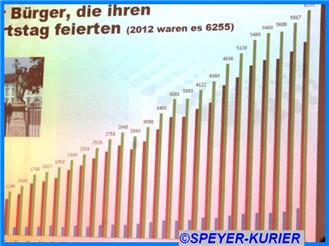 Noch
dramatischer die Verschiebungen im Altersaufbau in der sich derart
verändernden Bevölkerungsstruktur: Wird sich der Anteil der über
60jährigen in Deutschland vom Jahr 2000 bis 2025 von 23,2% auf
33,2% und 25 Jahre weiter auf 38.1% erhöhen, so wird der Anteil der
über 80jährigen von 3,6% im Jahr 2000 bis 2050 gar auf 13,2% und
die Zahl der über 90jährigen von 10.000 noch im Jahr 2000 auf
44.000 im Jahr 2020 und bis 2050 auf 114.700 klettern. Dann wird
sich auch die Zahl der Höchstbetagten, die statistisch gesehen 105
Jahre und älter sind, und deren Zahl von 1970 bis 2009 von 7 auf
447 Fälle gestiegen ist, sich entscheidend weiter nach oben
entwickeln.
Noch
dramatischer die Verschiebungen im Altersaufbau in der sich derart
verändernden Bevölkerungsstruktur: Wird sich der Anteil der über
60jährigen in Deutschland vom Jahr 2000 bis 2025 von 23,2% auf
33,2% und 25 Jahre weiter auf 38.1% erhöhen, so wird der Anteil der
über 80jährigen von 3,6% im Jahr 2000 bis 2050 gar auf 13,2% und
die Zahl der über 90jährigen von 10.000 noch im Jahr 2000 auf
44.000 im Jahr 2020 und bis 2050 auf 114.700 klettern. Dann wird
sich auch die Zahl der Höchstbetagten, die statistisch gesehen 105
Jahre und älter sind, und deren Zahl von 1970 bis 2009 von 7 auf
447 Fälle gestiegen ist, sich entscheidend weiter nach oben
entwickeln.
Familien, in denen gleich drei Generationen eine Altersrente
beziehen, werden dann keine Seltenheit mehr sein, Fälle, in denen -
so Prof. Dr. Lehr schmunzelnd - eine 100jährige Bewohnerin eines
Seniorenheimes mit dem Bemerken „Für diesen Laden bin ich noch ncht
reif“ dort wieder auszieht und in die eigene Wohnung zurückkehrt,
werden dann kaum noch Schlagzeilen machen – das Bild von dem
„kompetenten, weisen und älteren Menschen, der noch im hohen Alter
alleine seinen Alltag meistert“, werde dann wohl zum Alltag
gehören.
Denn Alter, so betonte die Referentin, die selbst in wenigen
Tagen ihren 83. Geburtstag feiert, dürfe schon längst nicht mehr
mit 'Pflegebedürftigkeit' gleichgesetzt werden. Lediglich die
steigende Zahl der demenziell Erkrankten werfe einen Schatten auf
diese ansonsten eher positive Entwicklung, lasse sich doch durch
entsprechende körperliche und geistige Aktivitäten der
Alterungsprozess doch entscheidend verzögern.
Dass aber parallel zur Steigerung der Lebenserwartung der
Menschen die Zahl der Geburten immer weiter zurückgeht, verschärft
diese Entwicklung noch zusätzlich. Für Rheinland-Pfalz rechnet die
Bertelmann-Stiftung für die Zeit von 2009 bis 2030 mit 10,6%
weniger Geburten, für Speyer mit 7,8%. Doch auch hierzu gibt es
weitaus bedenklichere Zahlen aus anderen Ländern und Regionen: Für
Sachsen-Anhalt erwartet die Statistik ein Minus von 36,3%, für
Thüringen eines von 33,9% und für Mecklenburg-Vorpommern von 32,7%
- in Städten in Rheinland-Pfalz soll die Geburtenrate z.B. in
Pirmasens um 28,4%, in Bad Ems um 18,5%, in Neuwied um 18,9% und
auch in Germersheim um 20,0% zurückgehen.
 Habe ein
klasssiches Familienbild früher ein Großelternpaar porträtiert,
umgeben von mehreren Kindern und einer Schar von Enkeln, so zeige
es immer öfter den „Einzelenkel“, umgeben von vier Großeltern, 2
Urgroßeltern und zusätzlich oft genug auch noch von einigen
„Stiefgroßeltern“. Die Tendenz vom 3-Generationen-Haushalt zum
1-Personen-Haushalt verstärke sich immer mehr, so die
Altersforscherin, die erst kürzlich in ihrem Amt als Vorsitzende
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO
bestätigt wurde.
Habe ein
klasssiches Familienbild früher ein Großelternpaar porträtiert,
umgeben von mehreren Kindern und einer Schar von Enkeln, so zeige
es immer öfter den „Einzelenkel“, umgeben von vier Großeltern, 2
Urgroßeltern und zusätzlich oft genug auch noch von einigen
„Stiefgroßeltern“. Die Tendenz vom 3-Generationen-Haushalt zum
1-Personen-Haushalt verstärke sich immer mehr, so die
Altersforscherin, die erst kürzlich in ihrem Amt als Vorsitzende
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO
bestätigt wurde.
Drei- und Mehrpersonenhaushalte würden immer mehr abnehmen,
berichtete Prof. Dr. Lehr, die Zahl der Ein- und
Zwei-Personenhaushalte dagegen nehme immer mehr zu. In Städten mit
über 500.000 Einwohnern seinen heute bereits mehr als die Hälfte
der Haushalte Single-Haushalte. Und da bei den über 80 jährigen
Frauen bereits 87,4% Singles seien – bei den Männern sind es
immerhin noch 34,9% - werde rasch klar, dass eine Familienpflege im
Pflegefall rasch an ihre Grenzen stosse. Und da eine
Pflegebedürftigkeit in immer höherem Alter auftrete -
dementsprechend sei auch das Alter der potentiell pflegenden
Angehörigen höher – da viele Ältere überhaupt keine Kinder hätten
und – wenn Kinder da seien – ihre Zahl so gering sei, dass die
früher übliche Aufteilung der Pflege kaum mehr möglich sei und da
die Kinder immer seltener in der Nähe des Wohnorts ihrer Eltern
lebten, würde in der Zukunft mehr professionelle Hilfe durch den
Ausbau der Pflege- und Versogungsdienste gebraucht, so Prof. Lehr.
„Solidarität zwischen den Generationen und innerhalb der eigenen
Generation ist deshalb das Gebot der Stunde“, rief deshalb die
Expertin auf.
 Um die aus
diesem demografischen Wandel notwendigen richtigen Konsequenzen
ziehen zu können, blickte Prof. Dr. Lehr noch einmal auf die
Entwicklung des Sozialsystems in Deutschland zurück. Als Bismarck
im Jahr 1889 die gesetzliche Alters- und Krankenversicherung
einführte, habe die mittlere Lebenserwartung noch bei 45 Jahren
gelegen. Der Berufsanfang erfolgte damals mit 15 Jahren, die
Altersrente wurde mit 70 Jahrn gewährt. Im Jahr 2000 habe die
Lebenswerwartung bereits etwa 80 Jahre betragen und sei inzwischen
weiter gestiegen, der Beufseinstieg erfolgt heute mit 25 Jahren,
das Berufsende mit 60, seit kurzem mit durchschnittlich 63 Jahren.
„Wer heute in Rente geht, der hat noch mehr als ein Viertel seines
Lebens vor sich“, unterstrich die Altersforscherin. Noch vor 50
Jahren sei die Pensionierung mit 65 Jahren von den Menschen als
„Anfang vom Ende“ erlebt und von den meisten auch befürchtet worden
– heute werde er als Beginn einer neuen aktiven Lebensphase gesehen
und von vielen geradezu „herbeigesehnt“.
Um die aus
diesem demografischen Wandel notwendigen richtigen Konsequenzen
ziehen zu können, blickte Prof. Dr. Lehr noch einmal auf die
Entwicklung des Sozialsystems in Deutschland zurück. Als Bismarck
im Jahr 1889 die gesetzliche Alters- und Krankenversicherung
einführte, habe die mittlere Lebenserwartung noch bei 45 Jahren
gelegen. Der Berufsanfang erfolgte damals mit 15 Jahren, die
Altersrente wurde mit 70 Jahrn gewährt. Im Jahr 2000 habe die
Lebenswerwartung bereits etwa 80 Jahre betragen und sei inzwischen
weiter gestiegen, der Beufseinstieg erfolgt heute mit 25 Jahren,
das Berufsende mit 60, seit kurzem mit durchschnittlich 63 Jahren.
„Wer heute in Rente geht, der hat noch mehr als ein Viertel seines
Lebens vor sich“, unterstrich die Altersforscherin. Noch vor 50
Jahren sei die Pensionierung mit 65 Jahren von den Menschen als
„Anfang vom Ende“ erlebt und von den meisten auch befürchtet worden
– heute werde er als Beginn einer neuen aktiven Lebensphase gesehen
und von vielen geradezu „herbeigesehnt“.
Die Herausforderungen an eine immer älter werdende Gesellschaft
lauteten deshalb, „gesund und kompetent alt zu werden“ –
Selbstständigkeit und Unabhägigkeit möglichst lange zu erhalten und
dadurch eine möglichst hohe Lebensqualität auch in der letzten
Lebensphase zu sichern – kurz: ein würdevolles Alter zu
gestalten.
Gerade ältere Menschen müssten deshalb konsquent daran arbeiten,
durch eine selbstverantwortliche und selbstständige Lebensführung
ihre Gesundheit zu bewahren. „Die meisten Krankheiten im Alter sind
keine Alterskrankheiten, sonder 'alternde Krankheiten', die ihre
Ursachen bereits in früheren Lebensjahren hätten“, ermahnte die
Wissenschaftlerin die jüngere Generation. Körperliche, geistige und
soziale Aktivität sowie eine gesunde Ernährung seien die
wesentlichen Voraussetzungen für ein gesundes und kompetentes
Älterwerden. „Was rastet, das rostet“, rief sie aus - Funktionen,
die nicht gebraucht würden, verkümmerten. Prof. Dr. Lehr empfahl
deshalb Senioren ein konsequentes „Muskelkraftaufbau-Training“, das
unter dem Motto „Fit für 100“ auch Hochaltrige beweglich halte und
so ihre Lebensqualität erhöhe.
 Gleiches gelte
auch für die geistigen Aktivitäten. „Wir müssen ein Leben lang mehr
lernen und „anders“ lernen als unsere Vorfahren“, betonte die
Referentin. Dies würden die Veränderungen unserer Umwelt mit immer
größerer Beschleunigung ebenso erzwingen wie die technischen
Entwicklungen, die zu einer Erleichterung der Kommunikation und
einer Stärkung der Sozialkontakte geführt habe.
Gleiches gelte
auch für die geistigen Aktivitäten. „Wir müssen ein Leben lang mehr
lernen und „anders“ lernen als unsere Vorfahren“, betonte die
Referentin. Dies würden die Veränderungen unserer Umwelt mit immer
größerer Beschleunigung ebenso erzwingen wie die technischen
Entwicklungen, die zu einer Erleichterung der Kommunikation und
einer Stärkung der Sozialkontakte geführt habe.
Prof. Dr. Lehr rief die Senioren dazu auf, sich durch soziale
Aktivitäten den Herausforderungen in dieser „Gesellschaft des
Wandels und des langen Lebens“ zu stellen. „Machen Sie die
gewonnenen Jahre zu erfüllten Jahren – übernehmen Sie
Verantwortung“, appellierte sie. Das gelte für jeden einzelnen, der
etwas für sich selbst tun müsse, das gelte aber auch für andere,
die etwas für andere tun und die Mitverantwortung für die
Gesellschaft übernehmen müssten.Ende der 50er Jahre habe die
Seniorenarbeit mit der Frage begonnen „Was kann die Gesellschaft
für die Senioren tun? - Heute habe sich diese Frage gedreht und
laute: „Was können die Senioren für die Gesellschaft tun?“.
 Heute seien
60% der über 65jährigen ehrenamtlich tätig. Für die meisten der
zahlreichen Gäste, die zu dieser ungewöhnlichen Zeit in den alten
Ratssal gekommen waren, eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Vertreter unterschiedlichster Senioreninitiativen in der Stadt
waren gekommen – dazu die Sozialdezernentin,
Bürgermeisterin Monika Kabs, die die prominante
Wissenschaftlerin eingangs begrüßte, sodann der u.a. für das
Ehrenamt zuständige Städtische Beigeordnete Dr. Wolf
Böhm und die Leiterin des Seniorenbüros, Ria
Krampitz. Eröffnet hatte den hochinteressanten Nachmittag
als Sprecher der LandesSeniorenVertretung deren
Vorstandmitglied Horst Weller, der der Referentin für ihre
Bereitschaft dankte, mit diesem Referat nun schon zum zweiten Male
nach Rheinland-Pfalz gekommen zu sein.
Heute seien
60% der über 65jährigen ehrenamtlich tätig. Für die meisten der
zahlreichen Gäste, die zu dieser ungewöhnlichen Zeit in den alten
Ratssal gekommen waren, eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Vertreter unterschiedlichster Senioreninitiativen in der Stadt
waren gekommen – dazu die Sozialdezernentin,
Bürgermeisterin Monika Kabs, die die prominante
Wissenschaftlerin eingangs begrüßte, sodann der u.a. für das
Ehrenamt zuständige Städtische Beigeordnete Dr. Wolf
Böhm und die Leiterin des Seniorenbüros, Ria
Krampitz. Eröffnet hatte den hochinteressanten Nachmittag
als Sprecher der LandesSeniorenVertretung deren
Vorstandmitglied Horst Weller, der der Referentin für ihre
Bereitschaft dankte, mit diesem Referat nun schon zum zweiten Male
nach Rheinland-Pfalz gekommen zu sein.
 Am Ende gab es
noch Geschenke für die lebhaft und höchst humorvoll agierende
Wissenschaftlerin – den neuen Bildband über die Stadt Speyer und
dazu – aus der Hand von Monika Kabs - etwas, was man nirgends
kaufen kann: Zwei Flaschen Ruländer-Wein aus dem Städtischen
Weinberg am Tafelsbrunnen.
Am Ende gab es
noch Geschenke für die lebhaft und höchst humorvoll agierende
Wissenschaftlerin – den neuen Bildband über die Stadt Speyer und
dazu – aus der Hand von Monika Kabs - etwas, was man nirgends
kaufen kann: Zwei Flaschen Ruländer-Wein aus dem Städtischen
Weinberg am Tafelsbrunnen.
Zuvor hatte Prof. Dr. Lehr die Arbeit der Seniorenbeiräte
landauf, landab gewürdigt und ihrem AuditoriumTipps und Hinweise
auf Hilfs- und Verbesserungsmöglichkeiten gegeben.
„Gehen Sie mit offenen Augen durch Ihre Stadt“, rief sie den
Zuhörern zu, „und melden Sie Ihrem Speyerer Seniorenbeirat, wenn
Ihnen etwas auffällt, damit es abgestellt werden kann“.
Worauf die Senioren dabei achten sollten, darüber berichtet der
SPEYER-KURIER in seiner morgigen Ausgabe.
Foto: gc
27.05.2013
Bunte Kunststoffboote und außergewöhnlich schöne Holzboote mit Eskimopaddel
-01.jpg) Erzählcafé
beim Kanuclub…
Erzählcafé
beim Kanuclub…
Etwa 450 Mitglieder, gute Jugendausbildung, Segelabteilung,
größter und aktivster Verein im Pfälzischen Kanu Verband.
Hans Spies und Hans-Peter Schäfer stellten den Verein im
schmucken Clubhaus am Leinpfad vor.
Versteckt hinter Sträuchern und Bäumen, direkt am Rhein bei
Stromkilometer 399,7 , unmittelbar vor der Rheinbrücke am linken
Rheinufer, liegt das Clubgelände. Für Wasserwanderer somit eine
ideale Anlaufstelle zum Zelten und Übernachten für „ eine Nacht“,
so die Vereinsnachrichten. Vereinsmitglieder haben dort ihre Boote
gelagert, treffen sich zum Training, planen Wander- und
Wildwasserfahrten, finden sich aber auch am Sonntag bei „selbst
gebackenem Kuchen“ zur Kaffeezeit dort ein.
Gründung des Vereins 1925
-01.jpg) Wie Hans Spies
ausführte, trafen sich vor genau 88 Jahren sieben Anhänger des
Faltbootsports in einem kleinen Musikpavillon einer
Rheinwirtschaft, wo die Boote untergebracht waren. Bereits vier
Jahre später wurde das erste Bootshaus in der Nähe der heutigen
Hafeneinfahrt mit eigenen Mitteln errichtet. Beim Bau der
Eisenbahnbrücke stand es im Weg, so dass ein Neubau im Nahbereich
der Schiffswerft Braun am Westufer des Ölhafens erstellt wurde. Bei
der „Überführung in den Verein für Leibeserziehung“ 1938 blieb die
Abteilung Kanusport erhalten.
Wie Hans Spies
ausführte, trafen sich vor genau 88 Jahren sieben Anhänger des
Faltbootsports in einem kleinen Musikpavillon einer
Rheinwirtschaft, wo die Boote untergebracht waren. Bereits vier
Jahre später wurde das erste Bootshaus in der Nähe der heutigen
Hafeneinfahrt mit eigenen Mitteln errichtet. Beim Bau der
Eisenbahnbrücke stand es im Weg, so dass ein Neubau im Nahbereich
der Schiffswerft Braun am Westufer des Ölhafens erstellt wurde. Bei
der „Überführung in den Verein für Leibeserziehung“ 1938 blieb die
Abteilung Kanusport erhalten.
Nach dem 2. Weltkrieg waren die meisten Boote zerstört, das
Bootshaus beschlagnahmt. Doch schon 1950 wurde der Verein mit 20
Mitgliedern „ wiedererweckt“. Unter dem rührigen Vorsitzenden Karl
Jung entstand um 1955 das heutige Bootshaus, wurde erweitert und
ergänzt. Das Clubhaus mit Wirtschaftsbetrieb kostete 75000 DM,
wurde unter Mithilfe der Mitglieder errichtet und 1965 eingeweiht..
Damals waren viele Austritte zu verzeichnen, „weil die Haftung der
Schulden von den Mitgliedern erwartet wurde“, so Hans Spies.
Ende der Faltboote u. Beginn der Kunststoffboote,
Rennkajaks, Transportprobleme
-01.jpg) Mit einem
kurzen Rundgang in der Bootshalle erklärte Hans-Peter Schäfer die
verschiedenen Bootstypen, den Aufbau, die Handhabung beim Rennen,
Wartung und Pflege. So wurden Wander-, Zweier-, Wildwasserkajaks,
Faltboote, Kanu Kanadier, Familien-, Rennboote und die großen
Vereinskanadier bestaunt und erklärt. Wie Schäfer ausführte, waren
die 50er/60er Jahre die Erfolgsjahre des KC Speyer mit Erfolgen bei
Regatten und Meisterschaften in Süddeutschland. Hans Spies,
Hans-Peter Schäfer, Peter Schubert, Peter Fleischbein führten die
Vereinsfarben zu Siegen und brachten Pokale heim. Probleme gab es
beim Transport der Boote. Oft half der „ Opel-Blitz vom
„Kohlen-Seidel“, der Fahrschulwagen von Emil Oppinger oder die
„Doppelkabine“ von Waldi Löser, versehen mit Dachträgern oder
Anhängern die Boote ans Ziel zu bringen.
Mit einem
kurzen Rundgang in der Bootshalle erklärte Hans-Peter Schäfer die
verschiedenen Bootstypen, den Aufbau, die Handhabung beim Rennen,
Wartung und Pflege. So wurden Wander-, Zweier-, Wildwasserkajaks,
Faltboote, Kanu Kanadier, Familien-, Rennboote und die großen
Vereinskanadier bestaunt und erklärt. Wie Schäfer ausführte, waren
die 50er/60er Jahre die Erfolgsjahre des KC Speyer mit Erfolgen bei
Regatten und Meisterschaften in Süddeutschland. Hans Spies,
Hans-Peter Schäfer, Peter Schubert, Peter Fleischbein führten die
Vereinsfarben zu Siegen und brachten Pokale heim. Probleme gab es
beim Transport der Boote. Oft half der „ Opel-Blitz vom
„Kohlen-Seidel“, der Fahrschulwagen von Emil Oppinger oder die
„Doppelkabine“ von Waldi Löser, versehen mit Dachträgern oder
Anhängern die Boote ans Ziel zu bringen.
Noch in guter Erinnerung waren Spies und Schäfer die
Deutsche Meisterschaft am Chiemsee
Schon die Anfahrt mit den Freunden aus Frankenthal, deren
Bootsanhänger defekt wurde, so dass eine Nachtfahrt erforderlich
war. Am Chiemsee, frühmorgens angelangt, musste zuerst im
überschwemmten Gelände ein Zeltplatz gefunden werden. Die 10.000 m
Regatta selbst führte bei der ersten Wende zu einer
„Bolzsituation“, wobei viele Bootsspitzen zerbrachen.
-01.jpg) Beim Rundgang
warf Norbert Schwarz einen wehmütigen Blick hinauf zu seinem „69er
Pfalzzweier in Langversion“, den er gerne wieder einmal auf seine
Schnelligkeit testen möchte. In Gedanken waren auch die
„Altkanuten“ beim früheren Vorsitzenden Pfr. Herbert Slach, Leiter
des St. Josef- Konfikts = „Seppelskaschde“, der bei einer
Wildwasserfahrt im Zillertal tödlich verunglückte.
Beim Rundgang
warf Norbert Schwarz einen wehmütigen Blick hinauf zu seinem „69er
Pfalzzweier in Langversion“, den er gerne wieder einmal auf seine
Schnelligkeit testen möchte. In Gedanken waren auch die
„Altkanuten“ beim früheren Vorsitzenden Pfr. Herbert Slach, Leiter
des St. Josef- Konfikts = „Seppelskaschde“, der bei einer
Wildwasserfahrt im Zillertal tödlich verunglückte.
Segelabteilung, Zeltlager, Freizeiten in Huttenheim mit
Jakob und Liesel Schäfer
In der Zeit von 1972 bis 1993 war Jakob Schäfer Vorsitzender des
Vereins. Der heute 95jährige hatte sich eigentlich vorgenommen,
sein Lebensweg und die Aktivitäten des Vereins vorzustellen. Durch
Krankheit bedingt war dies leider nicht möglich.
In seiner „Amtszeit“ entstand die „Segelabteilung“ am
Otterstadter Altrhein. Ein urwüchsiges Stück Auwald wurde in
Eigenarbeit für die Ausübung des Segelsports hergerichtet. An
einer einfachen Steganlage und an Land wurde 1973 Platz für 30
Boote geschaffen. Nach einer Erweiterung 1975 bietet die Steganlage
mit 58 m Länge neun Liegeplätze für Segelyachten. Auf einer
Pachtfläche von 20x40 m können Jollen abgestellt werden.
Die Begeisterung Jugendlicher für den Wassersport und
das Erleben der Gemeinschaft
Besonders Liesel Schäfer, die Frau des Vorsitzenden, sah dies
als wichtige Aufgabe an. So waren die „Sommerlager“ in Huttenheim
für viele Jugendliche aus Speyer sehr erlebnisreich am Wasser,
erfüllt von Gemeinschaftserlebnissen, Lieder- und Grillabenden, die
noch heute Gesprächsabende füllen. Die folgenden Vorsitzenden Klaus
Bohn, Manfred Kauer und Rainer Spies verwendeten auch viel Energie
zum Erhalt und Ausbau der Kanu-Gemeinschaft.
Ausbildung in Wasserkunde, Rheinschifffahrtsordnung und
Bootsbeherrschung, Naturschutz
Die Ausbildung der Jugendlichen nimmt im Club eine bedeutende
Stelle ein, wie H.-P. Schäfer erklärte. Die Anfängerschulung ist
für Kinder und Erwachsene vorgesehen. Jeder Teilnehmer muss
schwimmen können, entsprechende Kleidung, Schuhwerk, Regenjacke,
warme Wechselkleidung mitbringen und die Kursgebühr von 30,00 Euro
( für Jugendliche) bezahlt haben. Frankreich verlangt, dass die
Schwimmweste immer getragen wird. Ausgebildet wird in stehendem
Gewässer, wobei das Boot, seine Bewegungsabläufe, der Einfluss von
Paddel u. Wellen, erklärt und die Beherrschung trainiert wird. Viel
Geschick und Übung verlangt die „Eskimorolle“ „.Die
Berufsschifffahrt hat immer Vorfahrt“, so Schäfer, denn die
heutigen Steuerleute schauen von erhöhtem Standort und können die
kleinen Boote im „toten Winkel“ nicht erkennen. „Immer deutlichen
Kurs fahren und kein Risiko eingehen“, empfiehlt Spies.
Der Kanusportler muss Landschaftsschützer sein, damit sich auch
andere Zeitgenossen an der einzigartigen Natur erfreuen können, so
lautet die Vorgabe des Vereinsvorsitzen Andreas Heilmann seines
Vorstandes und der 450 Vereinsmitglieder. Text und Foto:
Karl-Heinz Jung
15.05.2013
Vom Lindemann´schen Wasserwerk um 1883 zur heutigen und zukünftigen Wasserversorgung von Speyer im Erzählcafé…
 -Die Vereinten
Nationen erklären Wasser zum Menschenrecht-
-Die Vereinten
Nationen erklären Wasser zum Menschenrecht-
-884 Mio Menschen haben nicht genügend
sauberes Wasser-
-täglich sterben 5000 Kinder an
Durchfallerkrankungen aufgrund verseuchten
Wassers-
-So sterben mehr Menschen als durch
Malaria, Masern u. HIV-
-1855 und 1873 wüteten in Speyer
Typhus- bzw. Cholera-Epidemien-
-etwa 63 Pumpbrunnen versorgten Speyer
mit Trinkwasser-
Königliche Anweisung aus München fordert
den Stadtrat von Speyer auf „umgehend für sauberes Wasser Sorge zu
tragen“.
 Gerd
Flaschenträger, ehemaliger Fachbereichsleiter der SWS, berichtete
vom ersten Wasserwerk im Waldgebiet „ Jägerrast“ an der Iggelheimer
Straße.
Gerd
Flaschenträger, ehemaliger Fachbereichsleiter der SWS, berichtete
vom ersten Wasserwerk im Waldgebiet „ Jägerrast“ an der Iggelheimer
Straße.
Nachdem Regierungspräsident Paul von Braun und
Hygieniker Dr. Max von Pettenkofer den Speyerer Stadtrat zu einer
„sauberen Wasserversorgung“ geradezu bedrängt hatten, wurde die
Offerte des Ingenieurs Adolf Friedrich Lindemann angenommen. Er
wollte die Stadt auf eigene Rechnung und Gefahr mit gutem
Trinkwasser versorgen. Am 2. August 1881 erteilte der Stadtrat
Lindemann die Konzession zur „Herstellung und zum Betrieb eines
Wasserwerkes in Speyer“. Der Stadt blieb das Recht ihre Pumpbrunnen
zu erhalten. Um 1882 begannen rings um das Stadtgebiet
Versuchsbohrungen, diese hatten in der Gewanne „Jägerrast“(
Iggelheimer Straße) Erfolg.
Rohrverlegungsarbeiten wurden ab Juli 1882 von der
Ludwigstraße, Himmelsgasse, Dom, Richtung St. Guidostiftsplatz
begonnen. Im Oktober wurde an der 2,5 km entfernten „Jägerrast“ der
Brunnenschacht ( 5,00x 5,00 m) und einer Tiefe von 4,00 m
ausgehoben. Weiter mussten zwei Brunnenrohre von 80 cm Durchmesser
18,30 m tief eingebracht, das Maschinenund Kesselhaus errichtet
werden. Heute wohnt in diesem stabil erbauten Haus Familie Werner,
zwischenzeitlich waren dort eine Schützen- und Kegel-Gesellschaft
untergebracht. Die Gaststätte „Waldeslust“ steht heute im Bereich
des Maschinistenhauses.
 Wasserturm zum
Festpreis von 52.000 Mark von Bauunternehmer Fritz Felder aus
Hilden in vier Monaten erbaut…
Wasserturm zum
Festpreis von 52.000 Mark von Bauunternehmer Fritz Felder aus
Hilden in vier Monaten erbaut…
Nach Flaschenträger, lieferten Fa. Steiger aus
Harthausen die Ziegelsteine und Holzmann aus Frankfurt die
Verbundsteine. Das Bauwasser pumpte Jakob Steiner (Sägemüller) aus
dem Speyerbach zur Baustelle. Frost behinderte im Dezember 1882 die
Bauarbeiten.
Mit Hilfe von verbundenen Holzbottichen war am
31.3.1883 die Aufnahme des Betriebs möglich. Anschließend wurde das
Reservoir mit sechs zusammen genieteten Ringen aus acht- bis zehn
Millimeter starkem Stahlblech der Firma Kühnle aus Frankenthal
eingesetzt. Der Durchmesser des Behälters beträgt 10,00 m und hat
eine Höhe von 6,00 m. Er fasst 460 cbm, wiegt 24 Tonnen und steht
im 5. OG, 25 m über dem Terrain. Der denkmalgeschützte Wasserturm
hat eine Gesamthöhe von 36,86 m ist noch voll funktionsfähig, wird
aber in Zukunft nur noch als Messstelle benutzt.
Umwandlung der Wasserwerksgesellschaft in
„The Speyer Waterworks Company, Limited“ am 31.Januar
1883
Lindemanns Eigentum an der Gesellschaft wurde mit
440 000 Mark, Eastons Anteil auf 350.000 Mark bewertet. Die
Umwandlung hatte Bankier J.F. Haid aus Speyer vorgenommen. Er
offerierte dem Stadtrat Speyer ein Aktienpaket im Wert von 50 000
Mark, was jedoch abgelehnt wurde.
Im Juni 1883 war das Wasserwerk vollendet, das
Rohrnetz war 18,4 km lang, 135 Hydranten; 150 Häuser und 22
Großkonsumenten( überwiegend Brauereien) waren angeschlossen.
Eine großartige Eröffnungsfeier mit Staatsrat,
Exzellenz Paul von Braun, weiteren Ehrengästen, einem
abwechslungsreichen Programm mit Hydrantenprobe, Besichtigung der
Pumpstation, bengalischer Beleuchtung, Festbowle und „
Umstandsbrötchen“, wie die Speyerer Zeitung berichtete.
 Klagen über
schlechtes Trinkwasser und neues Wasserwerk am
Tafelsbrunnen…
Klagen über
schlechtes Trinkwasser und neues Wasserwerk am
Tafelsbrunnen…
Erst wurde von manganspeziellen Mikroorganismen
gesprochen; später kam Hofrat Prof. Dr. R. Fresenius aus Wiesbaden
zum niederschmetternden Urteil, „das Wasser entspricht nicht den
Anforderungen, das gutes Trinkwasser haben muss“. 294
Wasserinteressenten schickten eine Resolution nach London.Von dort
traf ein Geologe in Speyer ein um bessere Brunnen zu erkunden.
Am Tafelsbrunnen( Straße nach Berghausen) wurde
Wasser „zur rückhaltlosen Zufriedenheit“ gefunden. In sieben
Monaten wurde durch Speyerer Unternehmen bis Oktober 1891 für 120
000 Mark Wasserwerk II gebaut. Werk I wurde geschlossen.
Flaschenträger erwähnte, dass Wasserwerk II-
Tafelbrunnen- auch nach 130 Jahren, ergänzt durch moderne Technik
und Tiefenbrunnen, beste Wasserqualität liefert. Wie Teilnehmer
Walter Erhard im Gespräch darstellte, habe die gute Wasserqualität
immer positiven Einfluss auf das von Braumeister Franz Müller
gebraute „Domhofbier“.
Heiligenstein wurde 1892 mit Speyerer Wasser
versorgt, Berghausen kam 1898, Mechtersheim 1903 und Dudenhofen
1919 dazu. Nach den Kriegswirren erwarb die Stadt Speyer das
Wasserwerk.
 Distrikpolizeiliche
Vorschrift zum Schutze von öffentlichen Brunnen und
Quellen…
Distrikpolizeiliche
Vorschrift zum Schutze von öffentlichen Brunnen und
Quellen…
Diese Verordnung aus der „bayerischen Zeit“ besagt,
„dass im Umkreis von 500m keine Anlagen errichtet, noch Handlungen
vorgenommen werden, welche eine Verunreinigung des Grundwassers
bewirken könnte“. Dies war die erste „Schutzzone“ auch für das
Wasserwerk Speyer, so Gerd Flaschenträger. Lindemann hatte bereits
vorgesorgt und sämtliche Grundstücke, auf denen Brunnen gebohrt
wurden, erworben oder durch einen Pachtauflösungsvertrag mit
Abfindung den Besitz gesichert.
Durch die Verordnung der Bezirksregierung von
Rheinhessen-Pfalz aus dem Jahre 1973 wird die Schutzzone in drei
Bereiche eingeteilt:
-
Wassererfassungsbereich- Verbot sämtlicher
Bearbeitung, Schädlings-, Unkrautbekämpfung und Düngung
-
Engere Schutzzone- Keine Wohnbebauung, keine
Stall-,Weidetiere, Abwässer
-
Weitere Schutzzone- Keine Heizöl- oder
Chemikalientransporte
Das Wasserschutzgebiet am Wasserwerk Tafelsbrunnen
reicht vom „ Fernblick“ bis zum Rhein und hat eine Fläche von
1,68qkm.
Umstellung auf elektrische Energie,
Wasserförderung, Wasserwerk-Nord…
In den 50iger Jahren wurde durch den damaligen
Direktor der Stadtwerke, Richard Schindler, sowie durch den
Betriebsleiter des Wasserwerkes, Josef Naab, eine grundlegende
Modernisierung eingeleitet. Weiter erfolgte der Bau neuer
Gewinnungsanlagen, Rohrfilterbrunnen, Sammelschachtvergrößerung,
„Heberleitungen“ mit 700 mm Durchmesser und effektiveren
Motorpumpen.
Von 1967-71 entstanden fünf Tiefbrunnen mit
100-140m, die täglich bis 10 000 cbm Wasser fördern können. Weitere
Aufbereitungsanlagen zur Entmanganung und Enteisung wurden für das
Tiefenwasser erforderlich.
 Seit 1975
stehen an der Iggelheimer Straße im Waldbereich, gegenüber dem
ersten Wasserwerk von 1883, eine Wasserspeicheranlage mit zwei
Erdbehältern von je 2500 cbm und ein Netzdruckpumpwerk.
Gleichzeitig wurden Tiefbrunnen bis auf 180m gebohrt. Im
angrenzenden Wasserschutzgebiet Nord können pro Jahr rund 3 Mio cbm
Wasser entnommen werden. Zur Sicherheit bei Stromausfall schalten
sich Notstromaggregate mit 720 PS automatisch ein.
Seit 1975
stehen an der Iggelheimer Straße im Waldbereich, gegenüber dem
ersten Wasserwerk von 1883, eine Wasserspeicheranlage mit zwei
Erdbehältern von je 2500 cbm und ein Netzdruckpumpwerk.
Gleichzeitig wurden Tiefbrunnen bis auf 180m gebohrt. Im
angrenzenden Wasserschutzgebiet Nord können pro Jahr rund 3 Mio cbm
Wasser entnommen werden. Zur Sicherheit bei Stromausfall schalten
sich Notstromaggregate mit 720 PS automatisch ein.
Heute spricht man vom „ Wasserwerk Süd“
(Tafelbrunnen) und vom Wasserwerk Nord (Iggelheimer Straße/
Holzlagerplatz). Mit dem „Trinkwasserverbund Bründelsberg“ haben
die SWS und Germersheim einen übergreifenden Trinkwasserverbund
gegründet, so dass auch in schwierigen Lagen für mehr als 75. 000
Menschen sauberes, natürliches Trink- und Brauchwasser zur
Verfügung steht.
Zukünftige Trinkwasserversorgung im Rahmen der
Europäischen Gemeinschaft, Abwendung von
Grundwasserverschmutzung…
Der Geschäftsführer der SWS, Wolfgang Bühring, Vorsitzender der
Kommunalen Arbeitgeber-Vereinigung von Rheinland Pfalz, erläuterte
die von der EU angestrebte Liberalisierung der europäischen
Wasserversorgung.
Die Ausschreibung und folgende Vergabe von Wasserwerken würde
dann europa- und weltweit operierenden Unternehmen anvertraut, die
„Profitstreben“ und nicht die Grundversorgung aller Menschen mit
dem lebensnotwendigen „Grundnahrungsmittel Wasser“ als Ziel
anstreben. Auf die Wasserrechnung hat dann kein Stadtrat mehr
Einfluss.
Um dies zu verhindern, forderte Bühring auf, die
Bürgerinitiative „ Wasser ist Menschenrecht“ durch Unterschrift zu
unterstützen.
 Geschäftsführer Bühring zeigte
auf, dass:
Geschäftsführer Bühring zeigte
auf, dass:
-allen Bürgern/ Innen ein Recht auf Trinkwasser und sanitäre
Grundversorgung zusteht
-Die Trinkwasserversorgung und die Bewirtschaftung der
Wasserressourcen dürfen nicht den Binnenmarktregeln unterworfen
werden-
-Die Wasserwirtschaft ist von der Liberalisierungsagenda
abzukoppeln.
Die Teilnehmer kamen durch Ausfüllen der „Bürgerinitiativlisten
Wasser ist Leben“ Bührings Aufruf nach und wollten weitere Bürger
davon überzeugen. Weiter erklärte der Geschäftsführer Maßnahmen der
SWS um eine Grundwasserverschmutzung zu verhindern.
Roland Hauck aus Harthausen warb noch für die
Benefizveranstaltung „Brunnen für Togo“ die am 27. April in der
Festhalle Harthausen stattfindet. Aus Solidarität zum Heimatland
eines Mitbürgers möchte man in Togo mit einem Brunnen den Zugang zu
sauberem Trinkwasser erreichen. Khj
05.04.2013
Erstes eisernes Schiff gebaut
 Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling
Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Mit dem Schiffbau stählerner
Schiffe ist die Firmenhistorie der Schiffswerft Braun
in Speyer eng verknüpft. 1901 gründete der Eisenbahnschlosser Josef
Braun das Unternehmen im Alten Floßhafen. Brauns Schwiegersohn
Arthur Hebel kam 1927 als junger Ingenieur in die Werft, führte
moderne Arbeitsmethoden ein, siedelte sie 1928 in den neuen
Rheinhafen um. Sein Sohn Peter Hebel trat 1967 in die
Geschäftsführung ein, unter seiner Regie fand die Umsiedlung auf
die andere Uferseite des Hafens statt. Dass sich die Schiffswerft
Braun über eine so lange Zeit so gut im Markt behaupten konnte, lag
zum Großteil an dem richtigen Riecher und dem unermüdlichen Einsatz
des Inhabers und umtriebigen Geschäftsführers Peter Hebel,
der mit seinen inzwischen immerhin 81 Jahren noch täglich in
seiner Werft nach dem Rechten schaut und jetzt im Erzählcafé
des Seniorenbüros, moderiert von Karl-Heinz Jung, aus
seiner Sicht vor rund 150 Besuchern über das Thema Schiffbau in
Speyer sprach.
Im 19.Jahrhundert waren am Floßhafen die Werftbetriebe von
Johann, Friedrich und Wilhelm Hasselberger, Markus Weis, Franz
Ganninger und Michael Miller mit dem Bau ausschließlich hölzerner
Schiffe beschäftigt. Um die Jahrhundertwende wurde der
Holzschiffbau vom Stahlschiffbau verdrängt. „Das erste eiserne
Schiff baute mein Großvater Josef Braun auf der Werft am
Floßhafen“, erzählte Hebel vom Stapellauf 1902 und über die Anfänge
der Speyerer Werft. Sein Opa war als Schlossermeister bei der
Königlich-Bayrischen Eisenbahn beschäftigt und bei Gleisarbeiten
gelegentlich auf die mobile Schiffsbrücke bei Speyer gekommen. Der
Handwerker interessierte sich so sehr für die Schiffe, dass
er kurzerhand seine Stelle bei der Bahn aufgab und 1897 bei der
Schiffswerft Bärenklau in Zabern den Bau eiserner Schiffe
studierte. Josef Braun wollte damals in Speyer einen Werftplatz
schaffen und hatte schon in Zabern einen Kunden gefunden. Der
Schiffer Keck aus Freistett wünschte, dass Braun ihm ein Peniche,
ein 38,50 Meter langes Kanalschiff mit 320 Registertonnen
Tragfähigkeit baut. Zu seinem Leidwesen
verwehrte ihm die Dedibank jedoch einen Kredit für Werft und
Material. Aber in Speyer hatte es sich schnell herumgesprochen,
dass „de Braune Seppel“ ein Schiff bauen wollte, es aber mangels
Kapital nicht konnte. Der Speyerer Eisenhändler  Gerd Blum
räumte ihm zur Firmengründung einen „Credit von 9000.- Mark
courant“ ein. Dem Bau des ersten eisernen Kanalschiffes folgten
Fähren, Buchtnachen und Schokker (Fischkutter) sowie alle
Arten schwimmender Wasserfahrzeuge – ausnahmslos in genieteter
Konstruktionsbauweise. So stammt auch der heute an der
Rheinpromenade zu besichtigende Aalschokker „Paul“ aus der
Schiffswerft Braun. Diese blieb bis 1926 am Floßhafen und wurde
dann an das Ostufer des zwischen 1920 und 1924 gebauten „neuen
Hafens“ verlegt. Über diesen neuen Hafen wusste Peter Hebel eine
ganz besondere Geschichte zu erzählen. Der im Rahmen einer
Notstandsmaßnahme von Arbeitslosen errichtete Hafen sollte am
Westufer eigentlich eine Binnenschiffsgroßwerft der Familie
Ewersbusch aufnehmen. Den Besitzern der ersten Speyerer
Flugzeugwerke war nach dem verlorenen Weltkrieg in dem von den
Siegermächten diktierten Versailler Vertrag der Flugzeugbau
verboten worden. Sie glaubten durch den nicht verbotenen
Binnenschiffsbau ihren nach dem Krieg verlorenen industriellen Rang
wieder gewinnen zu können. Der Plan misslang vermutlich wegen
Kapitalmangels und einer Fehleinschätzung der Erfolgsaussichten für
den Binnenschifffahrtsbau. Vor Betriebsaufnahme der Großwerft
musste das viel zu groß angelegte Unternehmen aufgegeben werden.
Hebel wies darauf hin, dass die Pfalz-Flugzeugwerke PFW heute noch
Hallen, Bürogebäude und das Kraftwerk der unvollendeten Werftanlage
nutzt.
Gerd Blum
räumte ihm zur Firmengründung einen „Credit von 9000.- Mark
courant“ ein. Dem Bau des ersten eisernen Kanalschiffes folgten
Fähren, Buchtnachen und Schokker (Fischkutter) sowie alle
Arten schwimmender Wasserfahrzeuge – ausnahmslos in genieteter
Konstruktionsbauweise. So stammt auch der heute an der
Rheinpromenade zu besichtigende Aalschokker „Paul“ aus der
Schiffswerft Braun. Diese blieb bis 1926 am Floßhafen und wurde
dann an das Ostufer des zwischen 1920 und 1924 gebauten „neuen
Hafens“ verlegt. Über diesen neuen Hafen wusste Peter Hebel eine
ganz besondere Geschichte zu erzählen. Der im Rahmen einer
Notstandsmaßnahme von Arbeitslosen errichtete Hafen sollte am
Westufer eigentlich eine Binnenschiffsgroßwerft der Familie
Ewersbusch aufnehmen. Den Besitzern der ersten Speyerer
Flugzeugwerke war nach dem verlorenen Weltkrieg in dem von den
Siegermächten diktierten Versailler Vertrag der Flugzeugbau
verboten worden. Sie glaubten durch den nicht verbotenen
Binnenschiffsbau ihren nach dem Krieg verlorenen industriellen Rang
wieder gewinnen zu können. Der Plan misslang vermutlich wegen
Kapitalmangels und einer Fehleinschätzung der Erfolgsaussichten für
den Binnenschifffahrtsbau. Vor Betriebsaufnahme der Großwerft
musste das viel zu groß angelegte Unternehmen aufgegeben werden.
Hebel wies darauf hin, dass die Pfalz-Flugzeugwerke PFW heute noch
Hallen, Bürogebäude und das Kraftwerk der unvollendeten Werftanlage
nutzt.
Als Braun 1928 knapp 50-jährig verstorben ist, übernahm
sein Schwiegersohn Arthur Hebel die Leitung der Werft und wurde
später von seinem Schwager Josef Braun jr. unterstützt. Nach dem
Umzug wurden 67 Meter lange Standardschiffe (940 tons
Tragfähigkeit), Sonderfahrzeuge, Schwimmbagger und Schlepper
gebaut. Nun wurde die laute Handnietung durch
Druckluftnietung ersetzt. Während des Krieges zählte die
Schiffswerft Braun zeitweise 250 Mitarbeiter Nach dem Krieg, von
1945 bis 1950 war das Unternehmen von der französischen
Besatzungsmacht beschlagnahmt und ausnahmslos zur Reparatur von im
Krieg versunkenen Schiffen eingesetzt. Daneben wurden bis 1960
viele neuen Binnenschiffe, Trockenfrachter, Tanker, Eisbrecher,
Feuerlöschboote, Polizeiboote und Hafenboote sowie Siloschiffe für
deutsche und ausländische Kunden gebaut.
 1967 übergab
Arthur Hebel nach 40 Jahren Geschäftsführung die Werftleitung an
seinen Sohn Peter weiter. Der musste bis 1975 einen schrittweisen
Rückgang der Neubauten konstatieren. Wegen der Erweiterung der
ELF-Raffinerie wurde die Werft 1968 mit allen Anlagen an das
Westufer eines neu geschaffenen Hafenbeckens verlegt. Auf dem fünf
Hektar großen Gelände auf der Halbinsel im neuen Hafen waren nach
und nach alle für den Schiffsbau nötigen Gewerke vertreten,
Elektroschweißung, Maschinenbau, Spenglerei und Schreinerei.
Dementsprechend viele Gerätschaften und Spezialwerkzeuge stehen auf
dem Werftgelände weiterhin zur Verfügung. „Aber Neubauten gibt es
heute bei uns praktisch nicht mehr“, bedauert der Speyerer
Schiffbauexperte die Entwicklung. Inzwischen würden schon
Binnenschiffe guter Qualität für europäische Reeder in Shanghai
gebaut. Und die seien selbst nach dem Transport nach
Rotterdam noch billiger. Vor rund 20 Jahren (1983 und 1984) verließ
der bislang letzte Neubau eines Motorschiffs, die „MS Karl
Krieger“, die Speyerer Werft, erzählte Hebel wehmütig. Seine
Erklärung: „Die Binnenschifffahrt, die seit der Wirtschaftskrise
2008 unter dem Rückgang an Frachtaufträgen, unzureichenden Preisen
bei Steigerung ihrer Betriebskosten leidet, verdient nichts mehr
und investiert nur noch das Notwendigste. Die neuen Schiffe drängen
auf den übersättigten Markt und fahren zu jedem Preis. Dies hat zur
bisher schwersten Marktstörung in der Binnenschifffahrt
geführt.“
1967 übergab
Arthur Hebel nach 40 Jahren Geschäftsführung die Werftleitung an
seinen Sohn Peter weiter. Der musste bis 1975 einen schrittweisen
Rückgang der Neubauten konstatieren. Wegen der Erweiterung der
ELF-Raffinerie wurde die Werft 1968 mit allen Anlagen an das
Westufer eines neu geschaffenen Hafenbeckens verlegt. Auf dem fünf
Hektar großen Gelände auf der Halbinsel im neuen Hafen waren nach
und nach alle für den Schiffsbau nötigen Gewerke vertreten,
Elektroschweißung, Maschinenbau, Spenglerei und Schreinerei.
Dementsprechend viele Gerätschaften und Spezialwerkzeuge stehen auf
dem Werftgelände weiterhin zur Verfügung. „Aber Neubauten gibt es
heute bei uns praktisch nicht mehr“, bedauert der Speyerer
Schiffbauexperte die Entwicklung. Inzwischen würden schon
Binnenschiffe guter Qualität für europäische Reeder in Shanghai
gebaut. Und die seien selbst nach dem Transport nach
Rotterdam noch billiger. Vor rund 20 Jahren (1983 und 1984) verließ
der bislang letzte Neubau eines Motorschiffs, die „MS Karl
Krieger“, die Speyerer Werft, erzählte Hebel wehmütig. Seine
Erklärung: „Die Binnenschifffahrt, die seit der Wirtschaftskrise
2008 unter dem Rückgang an Frachtaufträgen, unzureichenden Preisen
bei Steigerung ihrer Betriebskosten leidet, verdient nichts mehr
und investiert nur noch das Notwendigste. Die neuen Schiffe drängen
auf den übersättigten Markt und fahren zu jedem Preis. Dies hat zur
bisher schwersten Marktstörung in der Binnenschifffahrt
geführt.“
In der offenen Gesprächsrunde, in der Peter Hebel einige
Kostproben seines urwüchsigen Humors lieferte, wurde an den
Treidelverkehr (bis Mitte des 19.Jahrhunderts zogen beim
"Treideln" Pferde und Menschen die Schiffe im Strom auf dem eigens
hierzu angelegten Leinpfad an bis zu zwei Zoll dicken Hanfseilen
stromaufwärts und auch daran erinnert, dass auf die Hafenhalbinsel
neben dem jetzigen Werft-Standort im September 1971 beim
Openair-Festival rund 25.000 Rockmusikfans für Aufhorchen und
Aufsehen gesorgt hatten und 2004 das Hausboot der Kelly Familiy in
der Werft auf seinen letzten Ankerplatz im Technik Museum
vorbereitet wurde. Foto: kj
07.03.2013
Geschäftsführer Alfred Böhmer stellt im Erzählcafé die GEWO vor
.jpg) Als Darlehensgeber für
bauwillige Siedler gegründet und nun zur größten
Wohnungsbaugesellschaft Speyers entwickelt….
Als Darlehensgeber für
bauwillige Siedler gegründet und nun zur größten
Wohnungsbaugesellschaft Speyers entwickelt….
Obwohl während des 2. Weltkriegs nur 3 % der Bestandswohnungen
der Stadt nicht bewohnbar waren, mussten bald nach Kriegsende 1000
Familien eine neue Wohnung suchen. Der Stadtrat beschloss im April
1948 die „ Ausweisung von Gelände für Siedlungen der Stadt“, das
dann zur Beseitigung der Wohnungsnot von der Gemeinnützigen
Baugenossenschaft Speyer ( GBS) bebaut werden sollte.
Am 16. Juni 1948 wurde die Gründung einer „ Grundstückserwerbs-,
Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft mbH“ (GEWO) Speyer mit einem
Stammkapital von 4,5 Mio Reichsmark beschlossen. Mitgesellschafter
waren die stadteigene Bürgerhospital- und Waisenhausstiftung. Damit
sollte die Wohnungsnot beseitigt und ein Teil des städtischen
Vermögens vor der Währungsreform gerettet werden. Bis 1953 stellte
die GEWO bauwilligen Siedlern 282.000 DM zur Verfügung.
Wohnungen für Flüchtlinge
Nachdem die französische Besatzung das Zuzugsverbot aufgehoben
hatte strömten ab 1950 Flüchtlinge in die Stadt. Für 1550 Familien,
die im Osten alles verloren hatten, mussten Wohnungen gebaut
werden. Zur Kostenreduzierung baute man mehrgeschossige Wohnblocks
auf Grundstücken der Stadt und der Stiftungen. Bereits 1951 konnten
die ersten Wohnungen für den Bezug freigegeben werden.
Gemeinnützigkeit und Umstrukturierung
Anfang 1950 versuchte die Gesellschaft erstmals die „
Gemeinnützigkeit“ zu erreichen. Dies gestaltete sich schwierig, da
die GBS und das katholische Siedlungswerk bereits als gemeinnützig
anerkannt waren. Im Oktober 1953 wurde Stadtrat Carl-Heinz Josse
hauptamtlicher Geschäftsführer. Er erreichte bald die
Namensänderung in „ Gemeinnützige Wohnungsbau- und
Siedlungsgesellschaft mbH“= GEWO und die Aufnahme in den Verband
der Südwestdeutschen Wohnungsunternehmen.
Entwicklung und Organisation
Bis 1950 hatte die GEWO keine Mitarbeiter. Die Gesellschaft
wurde von städtischen Beamten und Angestellten betreut. Robert
Nuber war der erste Verantwortliche der Stadt.
Ab 1954 waren Karl Kornmann und Christel Sohn (1954-1997) für
die kaufmännische – u. verwaltungstechnische Betreuung zuständig.
Das Bauamt der Stadt trug bis 1959 die technische Verantwortung.
Bereits ein Jahr später hatte die GEWO 18 Mitarbeiter; heute sind
es 43.
Büros und Verwaltungsgebäude
Bis 1954 waren die Büros im alten Stadthaus untergebracht, wo
heute die Touristinformation wirkt. Anschließend baute man in der
Sophie-de-la-Roche-Straße eine Wohnung zum Büro um. 1959 wurde das
Bürogebäude in der Lessingstraße gemeinsam mit der Sparkassen-
Zweigstelle erbaut; erweitert wurde 1982. Seit 2002 ist die
Verwaltung in der ehemaligen Cite de France ( bis 1997 Wohnungen
für französische Offiziersfamilien) zu erreichen.
.jpg) Lebensraum für Alle
und Wohnquartiere
Lebensraum für Alle
und Wohnquartiere
Heute verwaltet die GEWO 2800 eigene Wohnungen, 900 Garagen und
30 div. Gewerbe und soziale Einheiten. Bis 1971 wurden etwa 24%
aller neu geschaffenen Wohnungen in Speyer durch die Gesellschaft
errichtet. Wie Alfred Böhmer ausführte, wohnt jeder Fünfte Speyerer
bei der GEWO. Die Wohnquartiere liegen in Speyer-West im Schatten
der St. Hedwigskirche und westlich der Theodor-Heuss- Straße, in
der Waldsiedlung Speyer-Nord( westlich der Spaldinger Straße),
Speyer- Süd ( ehemalige Cite de France) und am Fischmarkt.
Zur Finanzierung der Bautätigkeit dienten anfangs die Darlehen
der Stadt und der Stiftungen. Ab 1971 war die Finanz- und
Ertragslage der GEWO so stabil, dass eine jährliche Dividende an
die Stadt ausbezahlt werden konnte.
Bis 1980 flossen in Baumaßnahmen der GEWO 11,3 Mio DM als
Darlehen, 25 Mio DM an Fördermitteln des Bundes sowie von
Rheinland-Pfalz und 24 Mio DM an Eigenkapital der Gesellschaft. Der
Aufsichtsrat gab als Zielsetzung vor, „ die Mieten bei positiven
Jahresergebnissen niedrig zu halten und keine Gewinnmaximierung zu
betreiben“.
„Durch die hohe Markpräsens der GEWO in Speyer, diente dieses
Verhalten insbesondere dazu, das Gesamtmietniveau in erträglichem
Bereich zu halten“, so Böhmer.
Konzepte für heute und morgen
Bereits in den 70er Jahren wurden seniorengerechte Wohnungen in
der Danziger- u. Uhland- Straße gebaut. Mit den „
altenheimverbundenen Wohnungen“ am Mausbergweg wurde ein neues
Kapitel aufgeschlagen. Nach und nach werden Barrieren in Wohnungen
abgebaut.
Heute sind etwa 14% aller Wohnungen barrierefrei/arm.
Durch ein Pilotprojekt des Bundes von 2009-2012 wurde die GEWO
zu einem der 16 ausgewählten Unternehmen in Deutschland. Mit Hilfe
von Zuschüssen des Bundes und Darlehen der KFW- Bank( Kreditbank
für Wiederaufbau) sollten barrierefreie Wohnungen im Bestand
geschaffen werden, Zur Zeit laufen die Umbauarbeiten von vier
Geschoßwohnungen in sechs barrierefreie Wohnungen in der
Albert-Einstein-Straße.
Weiter wurde die Quartiersmensa geschaffen, zur Begegnung von
Jung und Alt, wo frühere Räume der Kirchengemeinde St. Hedwig
waren. Etwa 40- 60 Mittagessen werden dort täglich serviert und
daneben entstanden Ausbildungsplätze für Jugendliche. Auch das
Familienzentrum „ KEKS“ , weitere Beratungs- u.
Besprechungsmöglichkeiten sind dort zu finden. „Mit dem in Bau
befindlichen Einkaufszentrum wird dann aus dem GEWO
Schlafstadtbereich wieder eine lebendige Wohnsiedlung“, so der
Geschäftsführer Böhmer.
Ende der Gemeinnützigkeit und neue
Tochtergesellschaft
Ab 1990 wurde allen Wohnungsunternehmen der Status der
„Gemeinnützigkeit“ entzogen. Somit unterliegt die GEWO der
Steuerpflicht. Weitere Einschränkungen brachte die Prüfung der
Gesellschaft durch den Rechnungshof des Landes. Nach Beschluss des
Aufsichtsrats wird
die Gesellschaft nun den Namen „ GEWO Wohnen GmbH“ tragen.
Weiter werden das Mehrgenerationen Haus in Sp.-Nord, die
Quartiersmensa ( Q+H = Quartiersmensa u. St. Hedwig) sowie
zukünftige Sozialprojekte gebündelt und transparent dargestellt mit
dem Namen“ GEWO Leben gGmbH“.
Alfred Böhmer ist seit 1995 Geschäftsführer und folgte auf Karl
Kornmann, Gerhard Klemke, Ludwig Schön. Carl-Heinz Jossé und den
ehrenamtlichen Robert Nuber.
Moderator Bernhard Linvers, vorher Pfarrer von St. Hedwig,
schilderte die Not und das Elend der Flüchtlinge, die aber mit
Hilfe der GEWO eine neue Heimat fanden.. Karl-Heinz
Jung-Khj-
17.02.2013
Ganzes Dorf hilft Leben retten
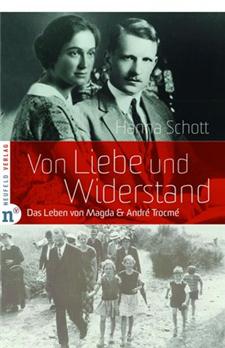 Autorenlesung:
Hanna Schotts Biografie über französisches Ehepaar
Trocmé
Autorenlesung:
Hanna Schotts Biografie über französisches Ehepaar
Trocmé
Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Die große Liebe zweier Menschen
und deren Zivilcourage bringt Licht in einen dunklen Abschnitt der
Geschichte. Wie die Lehrerin Magda und der protestantische Pfarrer
André Trocmé in der tiefsten französischen Provinz das auf einem
Hochplateau gelegene Dorf Le Chambon-sur-Lignon ab dem 22.Juni 1940
zu einem zentralen Ort des Widerstands gemacht und damit zwischen
3500 und 5000 Juden vor den Nationalsozialisten gerettet haben,
zeigt die Autorin Hanna Schott in ihrer 240 Seiten starken
Biografie „Von Liebe und Widerstand“ eindrucksvoll auf. Sie habe
schon viele Biografien geschrieben, aber keine habe sie so sehr
fasziniert wie die über das französisch-deutsch-italienische
Ehepaar, erklärte die in Augsburg geborene und nun in
Haan/Rheinland lebende Redakteurin, Übersetzerin und Lektorin bei
der Autorenlesung im Seniorenbüro der Stadt Speyer.
Dort leitet die in Schwegenheim wohnhafte Französin Nicole von
Rekowski seit 1994 einen Konversationskurs in Französisch. Und sie
und ihr Mann haben in den 50er Jahren das Ehepaar Trocmé kennen
gelernt und pflegten danach noch eine feste Freundschaft mit den
beiden 1901 geborenen Widerstandskämpfern. Der Pfarrer verstarb
1971 nach einem ärztlichen Kunstfehler, seine Frau Magda wurde 95
Jahre alt. Als Einstieg in die Biografie wählte sie das
Kennenlernen der beiden an einem Aprilabend 1926 in New York. Auch
dass der 25-jährige Student der attraktiven Italienerin unumwunden
erklärte, er wolle protestantischer Pfarrer werden und in Armut
leben, tat ihrer tiefen Zuneigung keinen Abbruch. André Trocmé,
dessen Mutter eine Deutsche war, hatte schon als Heranwachsender
beschlossen, er werde den Kriegsdienst verweigern, wolle „Mittler
zwischen Deutschen und Franzosen“ sein und nie eine Waffe in die
Hand nehmen müssen. Trocmés Vater, zum Geldadel zählender
Industrieller, schaffte es, dass die beiden nach der Verlobung in
den Vereinigten Staaten in Frankreich heirateten und sein Sohn dort
Pasteur wurde. Da seine vier Kinder fast alle Lungenprobleme
hatten, bekam der Seelsorger seine zweite Pfarrstelle in dem
abgelegenen Luftkurort im Zentralmassiv. Magda Trocmé beschloss
früh, in dem von einfachem Landleben geprägten Le
Chambon-sur-Lignon eine weiterführende Schule zu gründen, um den
Wegzug junger Familien zu verhindern. Als deutsche Truppen am
24.Juni 1940 Frankreich besetzten, eröffneten sich dem Ehepaar
ungeahnte Möglichkeiten, weil es „am Ende der Welt“ lebte. Mit der
Aufnahme einer jungen deutschen Jüdin im Pfarrhaus begann die
gewaltige Hilfsaktion, die den unscheinbaren Luftkurort zu einem
zentralen Ort des Widerstands werden ließ. Immer mehr verfolgte
Juden, überwiegend Kinder und Frauen, fanden Zuflucht bei den
Bauernfamilien, erhielten gefälschte Ausweispapiere.
Überaus einfühlsam lässt Hanna Schott das Rettungsszenario, das
beeindruckende Miteinander eines ganzen Dorfes vor dem Auge des
Lesers abspielen. Beim bildhaften Schreiben helfen ihr die vielen
„Zitate“, die ihr von Zeitzeugen vor Ort, oft aus Tagebüchern, zur
Hand gegeben wurden. Da weniger hilfsbereite Mitbürger die
Aktivitäten der französischen Resistance ins Quartier der Gestapo
im nahen Le Puy-en-Velay meldeten, wurde Pfarrer Trocmé im Februar
1943 gefangen genommen, wobei das halbe Dorf gegen den Zugriff der
Polizei protestierte, indem die Chambonnais sangen: „C’est un
rempart que notre Dieu – ein feste Burg ist unser Gott.“ Schon nach
drei Wochen wurden Pasteur Trocmé und der ebenso inhaftierte
Schulrektor Edouard Theis aus dem Internierungslager Saint-Paul
d’Eyjeaux auf Anweisung von Ministerpräsident Laval freigelassen.
Am Sonntag nach seiner Rückkehr nach Le Chambon wurden die
Befreiten in der voll besetzten Kirche regelrecht gefeiert.
i: Hanna Schott, „Von Liebe und Widerstand“, Neufeld-Verlag, 240
Seiten mit s/w-fotos, ISBN 978-3-86256-017-2. Weitere Infos unter
www.hanna-schott.de
26.01.2013
Ehrenamt unverzichtbar: Haus am Germansberg dankt für Engagement
 Mit einem
Empfang zu Jahresbeginn bedankte sich das Diakonissen
Seniorenzentrum Haus am Germansberg am 15. Januar bei seinen 64
ehrenamtlich Mitarbeitenden für ihr beständiges
Engagement.
Mit einem
Empfang zu Jahresbeginn bedankte sich das Diakonissen
Seniorenzentrum Haus am Germansberg am 15. Januar bei seinen 64
ehrenamtlich Mitarbeitenden für ihr beständiges
Engagement.
800 Stunden ihrer Zeit hätten die Ehrenamtlichen den
Bewohnerinnen und Bewohnern im vergangenen Jahr geschenkt, so
Heimleiter Klaus-Dieter Schneider: „Sie genießen einen ganz
besonderen Stellenwert in unserem Haus“, sagte Schneider und
betonte, dass auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter einen großen
Anteil an Auszeichnungen wie dem Grünen Haken für Lebensqualität
oder der MDK-Note von 1,0 haben.
Mit elf Angeboten in der Woche, die von Kreativ- über Rolli- bis
zu Musik- und Gottesdienstgruppen reichen, helfen die ehrenamtlich
Mitarbeitenden, „dass Menschen, die hier leben ein Stück Heimat
gefunden haben“, unterstrich Pfarrer Dr. Werner Schwartz, der den
Dank des Vorstandes der Diakonissen Speyer-Mannheim überbrachte.
Wie zahlreich die ehrenamtlichen Angebote für die Bewohner sind
wurde in der Ansprache der 92jährigen Heimbeiratsvorsitzenden Irma
Zund deutlich. „Wir werden geradezu verwöhnt“ schwärmte sie im
Namen ihrer Mitbewohner. Es sei ein Geschenk, wenn zum Beispiel
über Reisen berichtet werde, „die wir selbst nicht mehr machen
können“, wenn ein offenes Ohr geliehen oder Neues aus dem Internet
berichtet werde, bedankte sie sich „für den beliebten und
geachteten Einsatz.“
 Die
Bedeutung des Ehrenamts in der Gesellschaft hob auch Pfarrer Hubert
Ehrmantraut hervor, der den Dank der katholischen Gemeinden
überbrachte: „Ohne Ehrenamt wäre Seelsorge so wie wir sie leisten
möchten, heute fast nicht mehr möglich“, zeigte er sich
überzeugt.
Die
Bedeutung des Ehrenamts in der Gesellschaft hob auch Pfarrer Hubert
Ehrmantraut hervor, der den Dank der katholischen Gemeinden
überbrachte: „Ohne Ehrenamt wäre Seelsorge so wie wir sie leisten
möchten, heute fast nicht mehr möglich“, zeigte er sich
überzeugt.
Bevor Katharina Kieselhorst vom sozialkulturellen Dienst und
Pfarrerin Daniela Körber kleine Präsente überreichten und ein
gemeinsames Abendessen wartete, beschenkte das Haus am Germansberg
noch mit einer besonderen Überraschung: Der Neunjährige Leon
Zimmermann, der bereits nationale und internationale Preise
gewonnen hat, gab in einem kleinen Konzert eine Kostprobe von
seinem Können am Klavier.
Wer Interesse hat, sich ehrenamtlich zu engagieren kann sich im
Haus am Germansberg an Katharina Kieselhorst wenden, Tel. 06232
22-1244 oder 22-1738. Diakonissen Speyer-Mannheim,
Presse
16.01.2013
Historie und Ausblick der Rudergesellschaft im Erzählcafé
 Speyer-
Aus berufenem Munde wurden die rund 50 Besucher des Erzählcafes zum
Jahresauftakt im Veranstaltungssaal des Seniorenbüros im
Maulbronner Hof über die traditionsreiche Vereinsgeschichte der
1883 gegründeten Rudergesellschaft Speyer (RGS) informiert:
Ehrenvorsitzender Hans-Gustav „Hagu“ Schug und Alfred Zimmermann,
seit 2009 RGS-Vorsitzender und seit 42 Jahren in verschiedenen
Funktionen vorwiegend für die Vereinsfinanzen mit maßgebend,
erinnerten an die Anfangszeit, den Bau des RGS-Domizils an der
Hafenspitze und informierten über den nun im Reffenthal geplanten
Bau eines neuen Bootshauses. Wegen der beengten Verhältnisse im
Hafen müssen die Ruderer zum Leistungsporttraining schon seit 1971
ins Reffenthal unter der Obhut der dort stationierten Bundeswehr
ausweichen. Deshalb hat der in Speyer meist als Ruderclub
titulierte Verein bereits vor drei Jahren ein größeres Grundstück
auf dem Bundeswehrgelände gekauft. „Unser jetziges Domizil im Hafen
bleibt jedoch Kernpunkt der RGS“, beruhigte Schug all jene, die
vielleicht Angst davor haben, dass der „Ruderclub“ komplett in
Richtung Otterstadt abwandert.
Speyer-
Aus berufenem Munde wurden die rund 50 Besucher des Erzählcafes zum
Jahresauftakt im Veranstaltungssaal des Seniorenbüros im
Maulbronner Hof über die traditionsreiche Vereinsgeschichte der
1883 gegründeten Rudergesellschaft Speyer (RGS) informiert:
Ehrenvorsitzender Hans-Gustav „Hagu“ Schug und Alfred Zimmermann,
seit 2009 RGS-Vorsitzender und seit 42 Jahren in verschiedenen
Funktionen vorwiegend für die Vereinsfinanzen mit maßgebend,
erinnerten an die Anfangszeit, den Bau des RGS-Domizils an der
Hafenspitze und informierten über den nun im Reffenthal geplanten
Bau eines neuen Bootshauses. Wegen der beengten Verhältnisse im
Hafen müssen die Ruderer zum Leistungsporttraining schon seit 1971
ins Reffenthal unter der Obhut der dort stationierten Bundeswehr
ausweichen. Deshalb hat der in Speyer meist als Ruderclub
titulierte Verein bereits vor drei Jahren ein größeres Grundstück
auf dem Bundeswehrgelände gekauft. „Unser jetziges Domizil im Hafen
bleibt jedoch Kernpunkt der RGS“, beruhigte Schug all jene, die
vielleicht Angst davor haben, dass der „Ruderclub“ komplett in
Richtung Otterstadt abwandert.
„Die Rudergesellschaft ist meine zweite Heimat geworden“,
erzählte Schug, dass sein Vater ihn bereits 1942 bei der RGS
angemeldet hat und er somit seit 70 Jahren Mitglied ist. Der
82-jährige Speyerer hatte auch unzählige Funktionen im
Landesverband und im Deutschen Ruderverband inne, unter anderem
auch als Obmann des internationalen Schiedsrichterwesens. Mit der
RGS-Gründung am 3.August 1883 in der „Alten Pfalz“ in der Wormser
Straße wurde die traditionsreiche Geschichte der Rheinschifffahrt
fortgeschrieben, der Rhein von da an erstmals für sportliche Zwecke
genutzt. Die Ruderer, die ihre Boote im ersten Vereinsschuppen auf
dem Niemand‘schen Gelände neben dem Cafe (heute Standort der Villa
Hollidt) lagerten, mussten anfangs ihre breiten, kiellosen
Fahrzeuge (mit festen Dollen) über das Ufergeröll zum Wasser
schleppen und beim Rudern auf die oft sieben Lastkähne starken
Radschlepperverbände aufpassen. Alfred Zimmermann erinnerte sich,
dass er und sein Bruder Günter als Jungruderer erst lange Zeit
„trocken rudern“ mussten, ehe sie mit aufs Wasser durften. Schon
ein Jahr nach der Vereinsgründung fuhren Speyerer Sportler, stets
im weißen Dress mit rotem Brustring, erste Siege ein. Von damals
bis heute treffen sich Ruderer jeden Donnerstagabend zum
Gedankenaustausch über Vereinsneuigkeiten, zum Plausch über Erfolge
von Rennruderern oder Erlebnisse vom Wanderrudern. Die in der
ganzen Stadt bekannten und in Terminkalendern berücksichtigten
Vereinsabende stärken zudem das Zusammengehörigkeitsgefühl, sind
sich Schug und Zimmermann sicher.
 Erste Pläne für
das neue Bootshaus auf dem Hafengelände stammen vom August 1889. Es
entstand im Sommer 1900 an seinem heutigen Platz und bestand
zunächst aus einer großen Bootshalle. Eine zweite und dritte Halle
mit großem Saal kamen später hinzu. Das zunächst in Eigenregie
bewirtschaftete (und als Zuschussbetrieb geführte) Vereinsdomizil
ist seit längerem an einen soliden Gastwirt verpachtet und bringt
so sicheres Geld in die Vereinskasse. Dass der Blick vom
RGS-Bootshaus auf die wunderschöne Rheinschleife überhaupt möglich
ist, verdanken die Speyerer den damaligen Stadtoberen, die gegen
Tullas Begradigungspläne Einspruch eingelegt hatten, erzählte
Schug, „sonst würde heute der Rhein bei Schwetzingen
verlaufen“.
Erste Pläne für
das neue Bootshaus auf dem Hafengelände stammen vom August 1889. Es
entstand im Sommer 1900 an seinem heutigen Platz und bestand
zunächst aus einer großen Bootshalle. Eine zweite und dritte Halle
mit großem Saal kamen später hinzu. Das zunächst in Eigenregie
bewirtschaftete (und als Zuschussbetrieb geführte) Vereinsdomizil
ist seit längerem an einen soliden Gastwirt verpachtet und bringt
so sicheres Geld in die Vereinskasse. Dass der Blick vom
RGS-Bootshaus auf die wunderschöne Rheinschleife überhaupt möglich
ist, verdanken die Speyerer den damaligen Stadtoberen, die gegen
Tullas Begradigungspläne Einspruch eingelegt hatten, erzählte
Schug, „sonst würde heute der Rhein bei Schwetzingen
verlaufen“.
Von den heute rund 330 Mitgliedern sind rund ein Drittel
weiblichen Geschlechts. Erst 1905 genehmigte die Vorstandschaft der
bis dahin vornehmlich aus Herren aus besseren Kreisen bestehenden
Rudergesellschaft die Gründung einer Damenabteilung.
Im Zweiten Weltkrieg war der Ruderbetrieb fast zum Erliegen
gekommen, in den Anfangsjahren lediglich von Schülern, Jugendlichen
und Frauen aufrecht erhalten worden. 1940 fügte ein schwerer Sturm
dem für ein Flakkommando der Wehrmacht umgerüsteten Bootshaus
schwere Schäden zu. Ab 1944 waren sämtliche oberen Räume des
RGS-Vereinshauses beschlagnahmt. Mit dem Kriegsende und der
Auflösung aller sportlichen Organisationen hatte auch die RGS
praktisch aufgehört zu bestehen. Die wenigen Getreuen, die in der
Heimat zurückgeblieben oder bereits heimgekehrt waren, luden nach
langwierigen Verhandlungen mit der französischen Militärregierung
zur Wiedergründungsversammlung der RGS in den „Domnapf“ ein. Am
22.Juni 1946 wurde Josef Weckbach von 27 Mitgliedern zum
Vorsitzenden gewählt. Das Vereinsleben beschränkte sich lange Zeit
auf die Donnerstagabende im „Domnapf“. Am 1.September 1946 durften
die Ruderer, die während des Krieges Boote in den Räumen der
Kegelgesellschaft und bei der Holzhandlung Schwind ausgelagert
hatten, ihre Holzbaracke auf dem RGS-Gelände beziehen. Bis zum
Start ins neue Ruderjahr 1947 wuchs die Zahl der Mitglieder wieder
auf 72 an und verdoppelte sich im Laufe des Jahres.
Wie eng die Stadtgeschichte mit der RGS-Führungsspitze verbunden
ist, zeigte Schug an einer Reihe Mitglieder auf, von Dr.Otto Baer,
Goswin Ney, Karl Becker, Rudolf Zechner, Dr.Emil Mohr, Adolf
Mühlberger, Walter Lieser, Erich Stopka über Heinz Regel und
Dr.Peter Nahstoll bis hin zu Dr.Harald Schwager. Und erfolgreich
sind die RGS-Sportler auch seit Jahrzehnten, stellten mehrfach
Sportlerin und Sportler des Jahres. Im vergangenen Jahr, berichtete
Zimmermann, fuhren Speyers Rudererer stolze 89 Regattasiege ein.
Zimmermann ging auch auf die stets gut besuchten Hafenfeste und auf
die nun seit einigen Jahren für jedermann/frau veranstalteten
Kirchbootrennen ein. An die tollen Rosenmontagsbälle im RGS-Domizil
erinnerte Karin Ruppert. ws
10.01.2013
Sein Leben war ein Cocktail, bunt gemischt
 Speyer- Wo sollte Harry
Dettmann anfangen, beim Koch, Sänger oder Entertainer? Vor diesem
Problem stand der 1976 in Speyer und Mechtersheim gelandete
Weltenbummler bei seinem Vortrag im Seniorenbüro-Erzählcafe.
Dettmann löste die Aufgabe mit Bravour, fesselte die über 100
Besucher (unter ihnen der 93-jährige Hans Gruber) im Vortragssaal
der Villa Ecarius mit seinen von köstlichen Anekdoten gezeichneten
Erzählungen und reicherte diese mit vier Liedern aus seinem
reichhaltigen Repertoire an, am E-Piano begleitet von Rudi Schimpf.
Moderator Karl-Heinz Jung hatte zusammen mit dem Lebenskünstler
eine Powerpoint-Präsentation mit unzähligen Bildern zu den vielen
Stationen Dettmanns zusammengestellt und dabei aufgezeigt, welchen
prominenten Musik- und Sportgrößen der singende Koch oder kochende
Sänger im Laufe seines Berufswegs begegnet war – an der Spitze sein
großes Idol Freddy Quinn. Dessen Erfolgsschlager „Heimweh“, den
Dettmann als Heranwachsender auf dem Volksempfänger hörte, löste
bei ihm früh die Lust auf diese Musik aus.
Speyer- Wo sollte Harry
Dettmann anfangen, beim Koch, Sänger oder Entertainer? Vor diesem
Problem stand der 1976 in Speyer und Mechtersheim gelandete
Weltenbummler bei seinem Vortrag im Seniorenbüro-Erzählcafe.
Dettmann löste die Aufgabe mit Bravour, fesselte die über 100
Besucher (unter ihnen der 93-jährige Hans Gruber) im Vortragssaal
der Villa Ecarius mit seinen von köstlichen Anekdoten gezeichneten
Erzählungen und reicherte diese mit vier Liedern aus seinem
reichhaltigen Repertoire an, am E-Piano begleitet von Rudi Schimpf.
Moderator Karl-Heinz Jung hatte zusammen mit dem Lebenskünstler
eine Powerpoint-Präsentation mit unzähligen Bildern zu den vielen
Stationen Dettmanns zusammengestellt und dabei aufgezeigt, welchen
prominenten Musik- und Sportgrößen der singende Koch oder kochende
Sänger im Laufe seines Berufswegs begegnet war – an der Spitze sein
großes Idol Freddy Quinn. Dessen Erfolgsschlager „Heimweh“, den
Dettmann als Heranwachsender auf dem Volksempfänger hörte, löste
bei ihm früh die Lust auf diese Musik aus.
 Mit dem Titel „Grüß
mir alle meine Freunde“ zog Dettmann singend in den Saal ein. Und
Freunde sammelte der in Dessau geborene und mit zwei Brüdern in
Süddeutschland (Kirrlach, Karlsruhe und Lahr/Schwarzwald)
aufgewachsene Sänger mit seiner mehr an der Waterkant und am
Seemannslied orientierten Musik in den drei Jahrzehnten in der Tat
reichlich, wie der Absatz seiner LPs und CDs bewies. Mit der
Koch-Lehre im von einem Brand zerstörten Hotel Rad in Tettnang und
darauf im Flughafen-Restaurant in München-Riem hatte alles
angefangen. Hier hatte Dettmann seine erste „großartige“ Begegnung
mit Freddy, aber auch mit Heinz Rühmann, den Rolling Stones und
Franz-Josef Strauß. Nach Feierabend griff der Koch-Lehrling
häufiger zur Gitarre. Einmal machte einer seiner Freunde heimlich
Tonbandaufnahmen. Auf diese Weise kam Dettmann, wie er es
formulierte, „mit dem Musikvirus in Verbindung“. Am 28.Dezember
1965 hatte der singende Koch seinen ersten öffentlichen Auftritt in
der Rumba-Bar, unter anderem mit Titeln wie „Lass mich noch einmal
in die Ferne“, „Heimweh nach St.Pauli“ und „Junge komm bald
wieder“. Der 66-Jährige interpretierte: „Endlich stand ich auf den
Brettern, die die Welt bedeuten, so hatte ich das Gefühl.“ Nach
einem zweiten und einem ersten Platz bei Wettbewerben unterschrieb
das Sangestalent seinen ersten Musikvertrag bei Teddy Parker, der
mit seinem Nachtexpress nach St.Tropez“ einen Tophit gelandet
hatte. Dann sang Dettmann erstmals vor 1500 Gästen im Malteser
Festsaal, begleitet vom Orchester Hugo Strasser, der ihm später
auch einen Titel schrieb.
Mit dem Titel „Grüß
mir alle meine Freunde“ zog Dettmann singend in den Saal ein. Und
Freunde sammelte der in Dessau geborene und mit zwei Brüdern in
Süddeutschland (Kirrlach, Karlsruhe und Lahr/Schwarzwald)
aufgewachsene Sänger mit seiner mehr an der Waterkant und am
Seemannslied orientierten Musik in den drei Jahrzehnten in der Tat
reichlich, wie der Absatz seiner LPs und CDs bewies. Mit der
Koch-Lehre im von einem Brand zerstörten Hotel Rad in Tettnang und
darauf im Flughafen-Restaurant in München-Riem hatte alles
angefangen. Hier hatte Dettmann seine erste „großartige“ Begegnung
mit Freddy, aber auch mit Heinz Rühmann, den Rolling Stones und
Franz-Josef Strauß. Nach Feierabend griff der Koch-Lehrling
häufiger zur Gitarre. Einmal machte einer seiner Freunde heimlich
Tonbandaufnahmen. Auf diese Weise kam Dettmann, wie er es
formulierte, „mit dem Musikvirus in Verbindung“. Am 28.Dezember
1965 hatte der singende Koch seinen ersten öffentlichen Auftritt in
der Rumba-Bar, unter anderem mit Titeln wie „Lass mich noch einmal
in die Ferne“, „Heimweh nach St.Pauli“ und „Junge komm bald
wieder“. Der 66-Jährige interpretierte: „Endlich stand ich auf den
Brettern, die die Welt bedeuten, so hatte ich das Gefühl.“ Nach
einem zweiten und einem ersten Platz bei Wettbewerben unterschrieb
das Sangestalent seinen ersten Musikvertrag bei Teddy Parker, der
mit seinem Nachtexpress nach St.Tropez“ einen Tophit gelandet
hatte. Dann sang Dettmann erstmals vor 1500 Gästen im Malteser
Festsaal, begleitet vom Orchester Hugo Strasser, der ihm später
auch einen Titel schrieb.
Kurz darauf tauschte Eberhard „Harry“ Dettmann „die Kochmütze
gegen den Stahlhelm ein“. Nach gesundheitlichen Rückschlägen, die
auch einen Wechsel zur Polizei verhinderten und einen ersten
Fernsehauftritt platzen ließen, griff der leidenschaftliche Sänger
wieder zum Kochlöffel und leitete drei Jahre lang in Germersheim
Kochkurse für Promis und Hausfrauen. Aber Harry Dettmann sang auch
in dieser Zeit weiter, trat in Mannheim, Karlsruhe, Kaiserslautern
und Nürnberg auf. An diesem Punkt passte sein Song „Hundert Mann
und ein Befehl“ hervorragend. Das war der Titel seiner ersten
Schallplatte nach seinem Sieg beim Wettsingen in der Bonner
Beethovenhalle.
 Trotz seines
Plattenvertrags kehrte er in die Küche des Münchener
Flughafenrestaurants zurück. Nach diesem Intermezzo
(Krankheitsbedingt) verschlug es ihn nach Mannheim, wo er nach
neuen Jobs in der Musikszene suchte. So sang Dettmann bei der Feier
des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Germersheim. Bei von ihm
selbst organisierten Benefizveranstaltungen brachte es der
Alleinunterhalter auf über 10 000 Mark für die „Aktion Sorgenkind“,
woran den Mann mit dem sozialen Seemannsherzen heute noch ein
Autogramm von Wim Thoelke erinnert. Mit Erfolg sang Dettmann nun
auch beim Karnevalverein in Mechtersheim. Im Gasthaus „Zum Stern“
funkte es zwischen ihm und Monika Göck, die er 1976 heiratete. Bei
einer Fasnachtssitzung in Germersheim lernte der Sympathieträger
Hans Gruber kennen. Der SKG-Aktive holte Dettmann zusammen mit
Chefdekorateur Dieter Wenger zum 10.Geburtstag des Speyerer
Kaufhofs. 1970 wurde der Sänger eingeholt von seinen Kochkünsten
und wurde zum Küchenchef in die Kurpfalzkaserne Speyer berufen.
Nach zehn Jahren Kasernenarbeit war die Zeit reif für seine erste
große Auslandstournee nach Kanada, zusammen mit den „Rondos“. Der
Neuspeyerer genoss damals die Auftritte vor 10 000 Besuchern in
einer jeden Abend ausverkauften Halle. Mit dieser erfolgreichen
Tournee wurden Komponist Lothar Olias und Produzent Hajo Blasig auf
den beliebten Sangeskünstler aufmerksam. „Seemann wovon träumst
du?“ lautete der Titel für seiner ersten eigenen Platte. Immer mehr
Produktionen folgten. Hans Gruber stellte Dettmanns erste
Langspielplatte „Das große Hafenwunschkonzert“ im Kaufhof vor. Nun
war der Sänger aus Süddeutschland bestens im Geschäft und mimte bei
vielen Hafenkonzerten in Hamburg herzergreifend den erfahrenen
Seebär. Bei Rundfunksendungen stand Dettmann - einmal mit einem
zweistündigen Programm mit Harald Juhnke – ebenso seinen Seemann
wie bei einer Disco-Tournee des Saarländischen Rundfunks mit
Moderator Manfred Sexauer. In der Domstadt gewann ihn der damalige
Beigeordnete Stefan Scherpf für erste Konzerte an der
Rheinuferpromenade, die stets über 800 Besucher begeisterten. Auf
dem Höhepunkt seiner Karriere sang Harry Dettmann bei insgesamt 14
Tourneen mit über 210 Veranstaltungen durch die USA sowie bei
Schiffstourneen im Mittelmeerraum und einer Reise auf der „MS
Finnstar“ ans Nordkap. Dettmann trug aber immer mal wieder die
Kochmütze, so als Leiter eines Ludwigshafener Kochstudios oder für
den Partyservice „Tischlein deck dich“ der Metzgerei Göck.
Trotz seines
Plattenvertrags kehrte er in die Küche des Münchener
Flughafenrestaurants zurück. Nach diesem Intermezzo
(Krankheitsbedingt) verschlug es ihn nach Mannheim, wo er nach
neuen Jobs in der Musikszene suchte. So sang Dettmann bei der Feier
des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Germersheim. Bei von ihm
selbst organisierten Benefizveranstaltungen brachte es der
Alleinunterhalter auf über 10 000 Mark für die „Aktion Sorgenkind“,
woran den Mann mit dem sozialen Seemannsherzen heute noch ein
Autogramm von Wim Thoelke erinnert. Mit Erfolg sang Dettmann nun
auch beim Karnevalverein in Mechtersheim. Im Gasthaus „Zum Stern“
funkte es zwischen ihm und Monika Göck, die er 1976 heiratete. Bei
einer Fasnachtssitzung in Germersheim lernte der Sympathieträger
Hans Gruber kennen. Der SKG-Aktive holte Dettmann zusammen mit
Chefdekorateur Dieter Wenger zum 10.Geburtstag des Speyerer
Kaufhofs. 1970 wurde der Sänger eingeholt von seinen Kochkünsten
und wurde zum Küchenchef in die Kurpfalzkaserne Speyer berufen.
Nach zehn Jahren Kasernenarbeit war die Zeit reif für seine erste
große Auslandstournee nach Kanada, zusammen mit den „Rondos“. Der
Neuspeyerer genoss damals die Auftritte vor 10 000 Besuchern in
einer jeden Abend ausverkauften Halle. Mit dieser erfolgreichen
Tournee wurden Komponist Lothar Olias und Produzent Hajo Blasig auf
den beliebten Sangeskünstler aufmerksam. „Seemann wovon träumst
du?“ lautete der Titel für seiner ersten eigenen Platte. Immer mehr
Produktionen folgten. Hans Gruber stellte Dettmanns erste
Langspielplatte „Das große Hafenwunschkonzert“ im Kaufhof vor. Nun
war der Sänger aus Süddeutschland bestens im Geschäft und mimte bei
vielen Hafenkonzerten in Hamburg herzergreifend den erfahrenen
Seebär. Bei Rundfunksendungen stand Dettmann - einmal mit einem
zweistündigen Programm mit Harald Juhnke – ebenso seinen Seemann
wie bei einer Disco-Tournee des Saarländischen Rundfunks mit
Moderator Manfred Sexauer. In der Domstadt gewann ihn der damalige
Beigeordnete Stefan Scherpf für erste Konzerte an der
Rheinuferpromenade, die stets über 800 Besucher begeisterten. Auf
dem Höhepunkt seiner Karriere sang Harry Dettmann bei insgesamt 14
Tourneen mit über 210 Veranstaltungen durch die USA sowie bei
Schiffstourneen im Mittelmeerraum und einer Reise auf der „MS
Finnstar“ ans Nordkap. Dettmann trug aber immer mal wieder die
Kochmütze, so als Leiter eines Ludwigshafener Kochstudios oder für
den Partyservice „Tischlein deck dich“ der Metzgerei Göck.
Nach knapp zwei Stunden lebendiger
Erzählung wurde dem Stargast die Zeit zu knapp, um noch mehr über
die vielen Erlebnisse bei Tourneen und Showauftritten oder über
seine Autobiographie, die er 1987 vor allem für seine Frau Monika,
mit der nun bereits 36 Jahre „immer noch glücklich verheiratet“
ist, und Tochter Alexandra auf 250 Seiten niederschrieb. Aber die
Zeit reichte noch, um Moderator Jung zu verraten, dass er zusammen
mit der Stadtverwaltung eine jährliche Rheinpromenade-Matinee
plant. ws; Foto: khj
13.12.2012
Dr. No’s Bande sorgt für Weihnachtsstimmung im Diakonissen Seniorenzentrum
 Mit einem
Adventskonzert erfreuten junge Musiker am 9. Dezember die
Bewohnerinnen und Bewohner des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am
Germansberg.
Mit einem
Adventskonzert erfreuten junge Musiker am 9. Dezember die
Bewohnerinnen und Bewohner des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am
Germansberg.
Das Ensemble „Dr. No’s Bande“ der Städtischen Musikschule
unterhielt mit Solo- und Ensembledarbietungen ältere Bewohner und
jüngere Gäste. Die jungen Musikerinnen und Musiker boten unter
Leitung von Margarethe Hoffer ein buntes Programm, das von
traditionellen Weihnachtsliedern wie „Oh du fröhliche“ über
Popmusik wie „Last Christmas“ bis zu klassischen Stücken von
Vivaldi, Portnoff und Schmitz reichte.
Die Begeisterung des Publikums war so groß, dass Gesangssolistin
Miriam Galm mit einer Zugabe von „Oh du fröhliche“ die Zuhörer zum
Mitsingen bewegte. „Wir freuen uns, dass das Ensemble unseren
Bewohnern und Gästen durch das ehrenamtliche Konzert wieder eine
Adventsfreude bereitet hat“, bedankte sich Katharina Kieselhorst
vom Sozialkulturellen Dienst bei den Mitwirkenden und dem Leiter
der Musikschule Bernhard Sperrfechter. Diakonissen
Speyer-Mannheim, Presse
13.12.2012
Sitz der einzigen deutschen "Verwaltungshochschule" macht die Domstadt in aller Welt bekannt
-01.jpg) Speyer- Einem
der bedeutendsten Speyerer Einrichtungen widmete das Erzählcafe des
Seniorenbüros ihre November-Veranstaltung. Pfarrer i.R. Bernhard
Linvers, 18 Jahre lang als Seelsorger bei der Verwaltungshochschule
mindestens einmal wöchentlich bei der morgendlichen „Frühschicht“
zugast, begrüßte als versierten Referenten Dr. Heinrich Reinermann,
einer der inzwischen 15 entpflichteten Universitätsprofessoren. Der
Kaiserdom ist gemeinhin Speyers größter Werbeträger. Aber nicht
alle wissen, dass der Name der Domstadt in aller Welt bekannt ist,
weil hier der Sitz der einzigen deutschen Verwaltungshochschule,
seit einigen Monaten sogar Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer, ist. Hunderte hochrangiger
Verwaltungsbeamter in Korea, China, Togo oder Kasachstan haben als
Hörer sehr oft zwei Jahre lang in Speyer alles gelernt, was zu
einer öffentlichen Verwaltung gehört.
Speyer- Einem
der bedeutendsten Speyerer Einrichtungen widmete das Erzählcafe des
Seniorenbüros ihre November-Veranstaltung. Pfarrer i.R. Bernhard
Linvers, 18 Jahre lang als Seelsorger bei der Verwaltungshochschule
mindestens einmal wöchentlich bei der morgendlichen „Frühschicht“
zugast, begrüßte als versierten Referenten Dr. Heinrich Reinermann,
einer der inzwischen 15 entpflichteten Universitätsprofessoren. Der
Kaiserdom ist gemeinhin Speyers größter Werbeträger. Aber nicht
alle wissen, dass der Name der Domstadt in aller Welt bekannt ist,
weil hier der Sitz der einzigen deutschen Verwaltungshochschule,
seit einigen Monaten sogar Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer, ist. Hunderte hochrangiger
Verwaltungsbeamter in Korea, China, Togo oder Kasachstan haben als
Hörer sehr oft zwei Jahre lang in Speyer alles gelernt, was zu
einer öffentlichen Verwaltung gehört.
Ausführlich zeichnete der langjährige Lehrstuhlinhaber für
Verwaltungswissenschaften und Informatik die Entwicklung der am
11.Januar 1947 (just am 10.Geburtstag Reinermanns) gegründeten
„Höheren Verwaltungsakademie“ nach. Diese Verwaltungshochschule sei
von den Franzosen in ihrer Besatzungszone (Baden, Rheinland-Pfalz,
Württemberg-Hohenzollern) verfügt worden mit der „Entpreußung von
Verwaltung und Kultur“, zur „Wiedergeburt des demokratischen
Geistes“ als Beweggrund. Warum in Speyer? In der damaligen
Hauptstadt des achten bayerischen Bezirks gab es viele hochrangige
Beamte, unter andrem bei der in Speyer beheimateten Reichsbahn und
Reichspost. Eine Art „Gründervater“ war Charles de Gaulle, der
bereits im Oktober 1945 in Paris mit der ENA (Ecole nationale
d‘administration) eine Eliteeinrichtung für die Beamten ins Leben
gerufen hatte. Schon in den damaligen Statuten der „Höheren
Verwaltungsakademie“ seien „Universtitätsprofessoren“ als Lehrende
verankert gewesen, wies Reinermann auf die ebenso in jener Zeit
gegründeten Unis in Mainz und Saarbrücken hin, die Speyer als
Konkurrenz angesehen“ und gerne als „zu schmale“ Hochschule (ohne
Vollstudium) abgestuft hätten.
-01.jpg) Am 15. Mai
1947 wurde – schon unter dem zweiten Namen die „Staatliche Akademie
für Verwaltungswissenschaften“ in der früheren Lehrerakademie
(heutiges Finanzamt) eröffnet. In diesem Komplex war damals auch
die dem Auswärtigen Amt zugehörende „Diplomatenschule“
untergebracht.
Am 15. Mai
1947 wurde – schon unter dem zweiten Namen die „Staatliche Akademie
für Verwaltungswissenschaften“ in der früheren Lehrerakademie
(heutiges Finanzamt) eröffnet. In diesem Komplex war damals auch
die dem Auswärtigen Amt zugehörende „Diplomatenschule“
untergebracht.
Die Fünfziger Jahre begannen mit der Übernahme durch das Land
Rheinland-Pfalz und endeten mit dem Neubau an der Dudenhofer
Straße. Das Land habe sich zunächst gesträubt und die Reform-und
Sparkommission des Landtages Anfang 1949 die Akademie gar schließen
wollen, weil die Behörden jetzt wieder funktionierten und man die
Sonderausbildung der Referendare in Speyer nicht mehr benötige,
erzählte der emeritierte Universitätsprofessor weiter. Es kam dann
doch zum Errichtungsgesetz vom 30.August 1950 und da schon unter
dem dritten Namen „Hochschule für Verwaltungswissenschaften
Speyer“.
Zur Unterstützung der Einrichtung hatte Buchhändler Wolfgang
Oelbermann schon am 21.November 1949 mit der Gründung der
„Hochschulvereinigung“ ein Zeichen gesetzt. Das erste Hilfspaket
bestand aus 70 Pfund Weizenmehl, erinnerte Reinermann und bedauerte
zugleich, dass die bundesweit für seine hervorragende Arbeit
gerühmte Einrichtung trotz der Aktivitäten ihrer Freunde und
Förderer in der Domstadt nicht ausreichend bekannt sei.
Der von Bund und Ländern beschlossene und vom Land
Rheinland-Pfalz mit 5,5 Millionen Mark finanzierte Neubau wurde am
14.September 1960 von Ministerpräsident Peter Altmeier und
Bundespräsident Heinrich Lübke feierlich übergeben. In den
Folgejahren bestimmten die Verwaltungsreformen, Bildungsreformen
und die von Bund und Länndern gemeinsam getragene
Forschungsförderung das Leben an der Speyerer Hochschule. Dieser
Reformprozess warf viele Fragen auf in puncto Wissensschöpfung für
die Verwaltungshochschule. Ministerpräsident Helmut Kohl setzte
sich im Verwaltungsrat für den Ausbau der Speyerer Einrichtung ein.
In der Sitzung im Oktober 1969 wurde beschlossen, entsprechend dem
Ansatz „Staats- und Kameralwissenschaften“ die Lehrstühle von acht
auf 20 (gilt heute noch) auszubauen. Auch der Forschungsförderung
wurde mehr Freiraum gewidmet.
-01.jpg) Wiedervereinigung
1989 und Hauptstadtbeschluss vom 20.Juni 1991 brachten für die
Speyerer laut Reinermann „die letzte Klippe“: Sollte die
Verwaltungshochschule auch für die „neuen Bundesländer“ zuständig
sein? Schon in der allersten gemeinsamen Sitzung der
Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer am 12.Oktober 1990 wurde
der Weg geebnet. Folgerichtig gab es die vierte Umbenennung – in
„Deutsche“ Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Auf den
„Bologna-Prozess“ mit der Qualitätssicherung und
Internatinalisierung der Hochschulstudiengänge“ reagierte die Uni
Speyer (fünfter Name) mit drei neuen Masterstudiengängen, darunter
der Master für Öffentliche Wirtschaft, ein zweijähriger
Vollzeit-Präsenz-Studiengang. Als einen Vorteil der Speyerer
Universität stellte Reinermann deren Überschaubarkeit mit
durchschnittlich 400 Studierenden pro Semester heraus, was bei rund
120 Dozenten (20 Lehrstühle und rund 100 Lehrbeauftragte) ein
Betreuungsverhältnis von 1:4 ergebe. Zu den Honorarprofessoren und
Privatdozenten zählten unter anderen die ehemaligen
Bundespräsidenten Carl Carstens und Roman Herzog, Dr.Jürgen Strube,
Dr.Bernhard Vogel und Josef Stingl. Auch Thilo Sarrazin kommt
wöchentlich zur Vorlesung nach Speyer. ws; Foto: khj
Wiedervereinigung
1989 und Hauptstadtbeschluss vom 20.Juni 1991 brachten für die
Speyerer laut Reinermann „die letzte Klippe“: Sollte die
Verwaltungshochschule auch für die „neuen Bundesländer“ zuständig
sein? Schon in der allersten gemeinsamen Sitzung der
Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer am 12.Oktober 1990 wurde
der Weg geebnet. Folgerichtig gab es die vierte Umbenennung – in
„Deutsche“ Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Auf den
„Bologna-Prozess“ mit der Qualitätssicherung und
Internatinalisierung der Hochschulstudiengänge“ reagierte die Uni
Speyer (fünfter Name) mit drei neuen Masterstudiengängen, darunter
der Master für Öffentliche Wirtschaft, ein zweijähriger
Vollzeit-Präsenz-Studiengang. Als einen Vorteil der Speyerer
Universität stellte Reinermann deren Überschaubarkeit mit
durchschnittlich 400 Studierenden pro Semester heraus, was bei rund
120 Dozenten (20 Lehrstühle und rund 100 Lehrbeauftragte) ein
Betreuungsverhältnis von 1:4 ergebe. Zu den Honorarprofessoren und
Privatdozenten zählten unter anderen die ehemaligen
Bundespräsidenten Carl Carstens und Roman Herzog, Dr.Jürgen Strube,
Dr.Bernhard Vogel und Josef Stingl. Auch Thilo Sarrazin kommt
wöchentlich zur Vorlesung nach Speyer. ws; Foto: khj
08.11.2012
Speyerer Familiengeschichte von Villmann bis Schumacher-
von Flößern, Braumeistern, Gastwirten, dem
Ziegeleidirektor bis zum Bauunternehmer im Erzählcafé
Die Stationen der Villmann- Familie und ihrer Nachfahren wurden
von Frau Dr. Gislinde Seybert mit einer Power Point Serie bildhaft
dargestellt.
Villmann im „ Halbmond“, der „Alten Pfalz“,“ Neuen
Pfalz“, dem „ Burgtor“
Wo heute das Restaurant „Halbmond“ seine Gäste bewirtet, stand
vor dem „großen Brand“ von 1689 das Haus Villmann, wie
Nachforschungen von Frau Seybert ergaben. Als Flößer und Schiffer
waren die Vorfahren tätig.
 Mit Foto
konnte Andreas Villmann, bis 1919 Brauereibesitzer und Wirt der
„Alten Pfalz“, Maximilianstraße 6 (heute Polizei), vorgestellt
werden. Wie die „Pfälzer Zeitung“ von 1852 und 1870 berichtet, war
im Wirtshaus für 500 Gäste, neben dem Wirtschaftsbetrieb oft auch
Gelegenheit „Patent- Waschmaschinen“ oder „Holzschneidemühlen“ zu
betrachten und zu bestellen.
Mit Foto
konnte Andreas Villmann, bis 1919 Brauereibesitzer und Wirt der
„Alten Pfalz“, Maximilianstraße 6 (heute Polizei), vorgestellt
werden. Wie die „Pfälzer Zeitung“ von 1852 und 1870 berichtet, war
im Wirtshaus für 500 Gäste, neben dem Wirtschaftsbetrieb oft auch
Gelegenheit „Patent- Waschmaschinen“ oder „Holzschneidemühlen“ zu
betrachten und zu bestellen.
Das Reisebuch für das Königreich Bayern von 1870 empfiehlt die „
Alte Pfalz“ mit dem herrlichen Biergarten in Domnähe und dem großen
Eiskeller, welcher 900 Wagen Natureis zur Kühlung lagern konnte. Im
„Burgtor“ wurde eine weitere Gastwirtschaft und ein Bierkeller
eingerichtet. Weiter floss Villmann-Bier in der „ Neuen Pfalz“,
Ecke Wormser/Rützhaubstraße.
Nach dem 1. Weltkrieg verkaufte Villmann den Besitz, da auch die
„Goldmark-Kriegsanleihen“ verloren waren. Der Caritasverband
richtete später in der „ Alten Pfalz“ das „ Heim Nazareth“ ein, das
den katholischen Vereinen zur Verfügung stand. Im „harten Winter“
von 1929, der Rhein war zugefroren, wurde eine „Wärmestube“ für
Speyerer hier eingerichtet; danach war das Wehrbezirks- Kommando
dort tätig, heute die Polizei.
Direktor der Ziegelwerke, Baustoff-, Tabakgroßhändler Paul
Seybert, 1918 Direktor der Vereinigten Speyerer Ziegelwerke, wohnte
mit seiner Ehefrau Marie geb. Villmann in der Direktorenvilla an
der Hafenstraße.
Ein schöner Keramik- Kachelofen der Villa wärmt noch heute
Gislinde Seybert in ihrem Familienbesitz, Rützhaubstraße 9 (
Rützhaub-1689 bis 1708 Speyerer Bürgermeister) und erinnert an
Bratäpfel und schöne Kinderzeit.
Auch Vater Paul musste nach dem Krieg umplanen, wurde
Baustoffhändler, Freund der Baumeister Friedrich /Johann Graf und
half so, weitere herrliche Backsteinbauten zu errichten. Johann
Striebinger, Tabakgroßhändler, durch Heirat mit Familie Seybert
verbunden, ließ sein Haus Nr. 44 in der Bahnhofstraße von Graf
bauen. Ein Backsteinbau mit Sandsteingliederung im Stile der
Neurenaissance.
 Gebäude der
Bahnhofstraße als Zeugnis der Wirtschaftsentwicklung
Gebäude der
Bahnhofstraße als Zeugnis der Wirtschaftsentwicklung
Nachdem 1846 in Speyer der erste repräsentative Bahnhof der
Pfalz entstanden war, obwohl ab 1847 die „Ludwigsbahn“ Speyer „
links liegen ließ“(Verlauf: Ludwigshafen, Schifferstadt, Neustadt),
begann im Umkreis eine große Bautätigkeit.(Der Bahnhof wurde am
16.3.1945 durch Bomben zerstört).
Reichtum durch Ziegelproduktion, kaufmännisches Geschick und
Unternehmermut erlaubten dem Gründer der Vereinigten Ziegelwerke
Speyer, Georg Gund, den Bau hervorragender Häuser, die wir heute
noch bewundern.
Seine Villa am St.-Guido-Stifts-Platz 6, ein spätbarockes
Schlösschen, wurde 1868 von Baumeister Heinrich Jester errichtet. “
Die zurückgesetzte Balustrade, Bildhauerarbeiten an Tür- und
Fensterleibung, prachtvoller Eingangsbereich mit
Keramik-Trinkbrunnen in der Diele sind Zeugnisse der Gründerzeit“,
wie Frau Hopstock erklärte.
 Auch für seine
Töchter ( oder Schwestern) ließ Gund die Doppelvilla Bahnhofstraße
Nr. 54/56 erbauen( heute VHS/Villa Ecarius=Schwiegersohn von Gund).
Ziegel-, Deko- Elemente und Bauausführung wurden sicher auch im
Sinne eines „Musterhauses“ dargeboten.
Auch für seine
Töchter ( oder Schwestern) ließ Gund die Doppelvilla Bahnhofstraße
Nr. 54/56 erbauen( heute VHS/Villa Ecarius=Schwiegersohn von Gund).
Ziegel-, Deko- Elemente und Bauausführung wurden sicher auch im
Sinne eines „Musterhauses“ dargeboten.
Wie Frau Dr. Seybert erläuterte, war die Bahnhofstraße
bevorzugte Wohngegend. August Schwarz, Direktor der Kammer der
Finanzen, wohnte im Haus Nr.38, Max Mayer, Besitzer der
Kaffeerösterei in Nr. 40, ( später die Deutsche Reichsbank). In Nr.
42 lebte der Direktor der Sonnenbrauerei Heinrich Raso und in Haus
46 Geheimrat Max Forthuber.
Johann Schumacher Gründungsmitglied der
Baugenossenschaft
Die Familiengeschichte Villmann/ Seybert wurde durch Einheirat
von Johann Schumacher erweitert, wie Seybert ausführte. So wurde
das Baugewerbe weitergetragen, denn Schumacher war Mitglied der
Baugenossenschaft und bei der Erstellung der Woogbach-,
Burgfeldsiedlung beteiligt. Die Söhne Max und Eugen führten
ebenfalls ein Baugeschäft, waren vor Kriegsbeginn 1937/ 38 auch für
die Organisation Todt tätig, wobei sie im Krieg die gesamten
Baumaschinen verloren.
Die interessante Familiengeschichte mit allen Höhen und Tiefen
gab Anregung zu Gesprächen, Ergänzungen, Erklärungen und stellte
die Bahnhofstraße und ihre damaligen Bewohner in einer neuen
Sichtweise vor.
Dafür dankte Moderator Karl-Heinz Jung, Frau Dr. Gislinde
Seybert, die nach ihrer Tätigkeit an der Universität Hannover nun
wieder im Hause der Familie das kulturelle Leben der Stadt mit
gestalten wird. Karl-Heinz Jung
17.10.2012
Rheinschifffahrt im Erzählcafé….
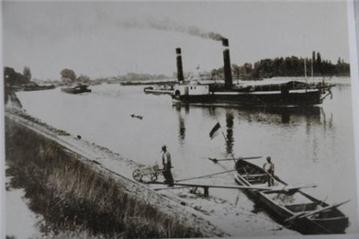 Das Erzählcafé im
Schifferzelt, gut unterhalten und bestens bedient mit Kaffee und
Kuchen-
Das Erzählcafé im
Schifferzelt, gut unterhalten und bestens bedient mit Kaffee und
Kuchen-
Über 60 interessierte Senioren/ Innen lauschten den Ausführungen
von Günter Kuhn ( Ehrenvorsitzender des Schiffer-u. Fischer
Vereins) über die Dampfschifffahrt von 1816 bis 1945.
Betrachten eines Filmausschnitts über die Dampfschifffahrt und
Berichte von selbst Erlebtes( Baden am Rhein) in Erinnerung
gebracht…..
Der Seitenraddampfer eröffnete 1816 ein neues Zeitalter der
Schifffahrt auf dem Rhein
Am 8.Juni1816 legte der aus Holz gebaute Seitenraddampfer „
Prinz von Oranien“ von England kommend in Rotterdam ab und
erreichte vier Tage später Frankfurt. Mit Pferdehilfe war die
Weiterfahrt nach Koblenz möglich. Bereits ein Jahr später fuhr der
Sohn von James Watt, dem Erfinder der Dampfmaschine, als Kapitän
seines 50 PS starken Dampf-Motor-Schiffs mit beiderseitigen
Schaufelrädern auch bis Koblenz; diesmal ohne Pferdehilfe.
In den folgenden Jahren, so Günter Kuhn, boten die mit 120
Personen besetzten „ abscheulich lauten Schiffe“ jeweils ein
Schauspiel zwischen Köln und Bacharach. Die Zuschauer am Ufer
rauften sich oft die „ Haare“ und riefen vor „ Angst
und Schreck“ zum Gebet auf.
Das Zeitalter ohne Schlepphilfe durch „ Mensch oder Pferd“ hatte
begonnen und verschaffte dem Reiseverkehr einen überraschenden
Aufschwung. Im Umfeld des Stromes wurden Unterkünfte, Herbergen und
Hotels für die Reisenden gebaut.
Am 19.September 1825. so Kuhn, passierte das erste
Seiten-Rad-Dampf – Schiff ( SRDS) unsere Stadt. Noch im gleichen
Jahr wurde damit der Rhein bis Straßburg befahren.
Schiffbauer Röntgen plante das erste „ eiserne Schiff“..
Natürlich wurde Röntgen ausgelacht, denn ein „ Schiff aus Eisen
war doch nicht schwimmfähig“, so seine Kritiker.
Im Jahre 1841 war es aber soweit. Der erste „eiserne Kahn“
fuhr mit einer Tragfähigkeit von 250 Tonnen auf dem Rhein.
Vor Baubeginn dieser Schiffe mussten genaue Pläne erstellt werden.
Wasserdichte Schotten, flacher Schiffsboden, spitz zulaufender Bug
und stumpfes Heck mussten genau berechnet werden. Mehr als 100 000
Nieten wurden geglüht, gesetzt und breitgeschlagen. Die erkalteten
Nieten zogen sich zusammen und schufen so die erforderliche Dichte
der „ Stahl- Schiffshaut“. Bereits nach 40 Tagen war ein Kahn
gebaut. Mit den „ eisernen Kähnen“ begann der Transport der Massen-
und Schüttgüter auf dem Rhein.
 Dampfschlepper mit 400
PS Motorleistung konnten bis zu tausend Tonnen Schüttgut ( Sand,
Split, Kies, Erde, Steine) in 6-8 Schleppkähnen auch „ zu Berg „
ziehen. Allerdings waren auf einem Schnell-Rad- Dampf-Schiff auch
ca. 14 Mann damit beschäftigt, der Dampfmaschine die erforderlichen
Kohlen „ in den Rachen“ zu schaufeln, um entsprechende Leistung zu
erzielen.
Dampfschlepper mit 400
PS Motorleistung konnten bis zu tausend Tonnen Schüttgut ( Sand,
Split, Kies, Erde, Steine) in 6-8 Schleppkähnen auch „ zu Berg „
ziehen. Allerdings waren auf einem Schnell-Rad- Dampf-Schiff auch
ca. 14 Mann damit beschäftigt, der Dampfmaschine die erforderlichen
Kohlen „ in den Rachen“ zu schaufeln, um entsprechende Leistung zu
erzielen.
Ketten- und Seilschleppfahrt ab 1873
Die lohnaufwendige Dampfschifffahrt wurde ab 1873 von der
Ketten- und Seiltechnik weitgehend abgelöst. Von Rotterdam bis Köln
legte man Ketten in den Rhein, an denen sich die Schleppkähne
„bergwärts hochzogen“. Ein 200 PS Kettendampfer konnte nun mit der
halben Kraft die Schüttgutmenge von 1000 Tonnen transportieren.
In der Folgezeit wurde zwischen Bad Godesberg und St. Goar
ein 42 mm dickes Stahlseil als Zugseil in den Rhein gelegt.
Gefährlich wurde es, wenn das Seil riss, wobei oft Unfalltode- und
Verletzte zu beklagen waren. Die Reparatur dauerte Monate und
behinderte die Schifffahrt.
Etwa um 1905 endete die sogenannte „ Hexen- Ketten-
Schleppfahrt“.
Der Dieselmotor verhilft der Güter- Motor- Schifffahrt
zum Durchbruch…
Ab 1912 begann der Siegeszug der Gütermotorschiffe mit Hilfe des
Dieselmotors. Der Platz für den Heizkessel, der Kohlenbunker, die
Heizmannschaft wurden entbehrlich. Bald waren auf dem Rhein 32
dieser Schiffe mit 787 PS und rund 4200 Tonnen Tragfähigkeit in
Betrieb. Der zunehmende Schiffsverkehr auf dem Strom brauchte auf
der gefährlichen Rheinstrecke St. Goar bis Bingen erfahrene Lotsen
welche die Schiffe lenkten. Ein“ Vorschaudienst“ mit landseitigen
Fahnensignalen regulierten den Schiffsverkehr an Engstellen. Eine
Begrenzung auf vier Kähne pro Schleppzug wurde angeordnet, weil
auch bei „ Bergfahrt“ im „Binger Loch“ Vorspanndienste erforderlich
waren. Das Anlegen des Lotsenbootes musste bei Raddampfern vor dem
Radkasten erfolgen, ein gewagtes Manöver, wie Kuhn mit Hilfe der
Filmdarstellung erläuterte.
Die Mannheimer Rhein- Schifffahrts- Akte und Problemzone
Basel
Nach der Schifffahrtsakte wurde die „ ungehinderte“ Fahrt auf
dem Rhein erlaubt. Die Personen-Schifffahrt von Basel bis Frankfurt
lief ab 1831. Erst 1903 versuchte der Schlepper „ Justitia“ mit 180
PS „alleinfahrend“ ( ohne Vorspannhilfe) Basel zu erreichen. Es
misslang. Der 32-jährige Johann Kirchgässer aus Oberwesel startete
1904 mit seinem Kahn“ Christine“ und 300 Tonnen Kohlen Basel
anzulaufen. Kurz nach Straßburg, an der „ Neuenburger Brücke“,
ging
es nicht weiter. Mit Sicherungsseilen und Ankerwinden schafften
die Schiffsleute Zentimeter um Zentimeter Bergauffahrt. Nachdem die
„Isteiner- Schwelle“ mit aller Mühe überwunden war erreichte die „
Christine“ am 2. Juni 1904 Basel – St. Johann und wurde mit
Böllerschüssen begrüßt. Die Freude wurde jedoch bei der
Rückfahrt mit 300 Tonnen Split getrübt; die Uferböschung
wurde gerammt, das Schleppseil riss, “Christine“ trieb führerlos
talwärts, schlug an die „Eisabweiser“ (Schutzbalken gegen Treibeis)
der „Hünninger“ Schiffsbrücke und versank.
Rheinausbau durch Max Honsel
Zwischen 1907 bis 1925 baute Honsel Leitwerke und Buhnen in den
Rhein wodurch die Schifffahrt wesentlich leichter wurde.
Tulla hatte den Rhein reguliert um die Anliegerdörfer vor
Hochwasser zu schützen.
Durch Honsels Regulierungseingriffe konnten nun große Kähne und
Gütermotorschiffe riesige Transporte erledigen. In der
Vorkriegszeit wurde Kies für Neubauten, Autobahn, Westwall mit
Schiffen in die Häfen geschafft. Eine umfangreiche Aufstellung des
„ Wasser- und Schifffahrts- Amts“ Speyer, über die
Transportvolumina jener Zeit, konnte Kuhn aufzeigen. Doch ab
1939 wurde die Schifffahrt durch Fliegerangriffe, Treibminen,
gesunkene Schiffe erschwert.
Kurz vor Kriegsende fielen die gesprengten Brückenteile in den
Strom. Über 375 zerstörte Schiffseinheiten lagen nach 1945 an der
pfälzisch-badischen Rheinstrecke.
 Speyerer Bürger und
der Rhein
Speyerer Bürger und
der Rhein
Mit Erlebnissen ihres Vaters konnte Eleonore Winkler aus
der Rheintorstraße die Ausführungen ergänzen. Schmiedemeister
Winkler war bei den Schiffsleuten gefragt. Ein neuer Anker
wurde geschmiedet, die Ankerkette feuergeschweißt verbunden, neue „
Kuhmäuler“ ( Schäkel zum Befestigen von Seilen) hergestellt,
Schäden am Schiffskörper behoben.
Wie Frau Winkler erzählte, waren es interessante Schiffersleute,
die abends bis weit unterhalb der Ziegelei anlegten, denn
eine Nachtfahrt war noch nicht möglich. Speyerer Handwerker,
Schiffer, Kaufleute und besonders die Wirte ( Gasthaus Dulda)
hatten so gutes Einkommen. Zwei Versorgungsboote für Lebensmittel
etc. von Hammer und Brech, liefen die Schiffe an. Die Signalstation
(Einfahrtsregelung) auf einem kleinen Boot lag unterhalb der
Ziegelei
in Ufernähe. Für Schiffer war dies eine „ Tankstelle“; beim
Sonntagsspaziergang zum „Bootsche“ gab es für die Kinder
Brause,
wenn die Familie im Bootsgärtchen saß.
Badeerlebnisse am Rhein
Rudi Höhl konnte auch ausgiebig seine Erlebnisse schildern. Das
„Anschwimmen“ der Schleppkähne war „Bubensache“, die aber auch
oft tödlich endete. Lustig war der Streit mit den
Schiffsleuten, wenn der „Rettungsnachen“(am Seil hinter dem Schiff
hergezogen) von den Schwimmern erreicht wurde. Freude über
die „ Eroberung“, Schaukeln, Wellen, ließen den Nachen oft voll
Wasser laufen; die Ruder trieben davon. Die Schiffer warfen mit
Kohlen, Schrauben nach den Burschen, um sie vom Rettungsnachen zu
vertreiben. Nicht gerne
erinnert sich Höhl an den „ Menning- Schiffer“. Dieser schüttete
einen Eimer Rostfarbe über die Rücken der „ Kahneroberer“.
Beschämt, den Rücken bis zum Hinterteil mit Menningfarbe
beschmiert, schwammen sie zum Ufer und wurden noch lange Zeit als „
Menningärsche“ gehänselt.
Noch viele Begebenheiten vom „ Kohlebock“( Kohlenlager), dem
badischen Apfelklau ließen Erlebnisse aus der Kinder- und
Jugendzeit wach werden, so dass die Zeit wie im Flug verging.
Herzlichen Dank übermittelte Moderator Dr. Thomas Neubert dem
Ehrenvorsitzenden Günter Kuhn, seinem Helferteam für die
Kaffeespende sowie der Spenderin für den leckeren Kuchen. Bild
und Text: Karl-Heinz Jung
18.09.2012
Qualität und Kontinuität
 Klaus-Dieter Schneider, Silvia Bauer, Sabine Seifert, Dr. Werner Schwartz (v. l.)
Klaus-Dieter Schneider, Silvia Bauer, Sabine Seifert, Dr. Werner Schwartz (v. l.)
Die Speyerer Seniorenzentren der Diakonissen
Speyer-Mannheim erhielten im Juli wieder Bestnoten vom
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK).
Mit Gesamtnoten von 1,0 im Haus am Germansberg und 1,2 im
Seniorenstift Bürgerhospital liegen die Einrichtungen überm
Landesdurchschnitt von 1,5. „Das Prüfungsergebnis des MDK spiegelt
die Zufriedenheit unserer Bewohner und ihrer Angehörigen wider“,
hebt Heimleiter Klaus-Dieter Schneider hervor, warum seine
Mitarbeitenden beständig an sich und der Betreuungsqualität
arbeiten: „Die Menschen, die hier leben, sollen sich wohlfühlen.“
Dass das so ist, zeigt sich in den Einzelergebnissen der
Überprüfung: Die Häuser erhielten nicht nur in den Bereichen Pflege
und medizinische Betreuung, Wohnen, Verpflegung und Hygiene, Umgang
mit Demenzangehörigen sowie Soziale Betreuung sehr gute Noten. Bei
der Bewohnerbefragung, die nicht in die Gesamtnote einfließt,
erhielten sie die Bestnote 1,0 bzw. eine 1,1.
„Die große Zufriedenheit der Menschen zeigt uns, dass wir auf
dem richtigen Weg sind“, sagt Sabine Seifert, Pflegedienstleiterin
im Seniorenstift Bürgerhospital. Die sehr gute Bewertung ermutige
sie und ihre Kollegen, die Bemühungen um das Wohlbefinden der
Bewohnerinnen und Bewohner stetig weiterzuentwickeln. Das sieht
ihre Kollegin im Haus am Germansberg, Silvia Bauer, genauso. Sie
ist außerdem überzeugt, dass die geringe Fluktuation unter den
Mitarbeitenden ein Baustein des Erfolgs ist.
Die Bedeutung der Mitarbeitenden unterstreicht auch Dr. Werner
Schwartz, Vorsteher der Diakonissen Speyer-Mannheim: „Wir sind
stolz auf die Mitarbeitenden, die einen nicht nachlassenden Einsatz
zeigen und für die beständig gute Betreuung in unseren
Seniorenzentren sorgen und dafür, dass sich die Menschen bei uns
individuell wahrgenommen und geborgen fühlen.“
Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) führt im
Auftrag der Landesverbände der Pflegekassen jährlich unangemeldet
Qualitätsprüfungen in Pflegeeinrichtungen durch, um für Transparenz
und Vergleichbarkeit der Pflegeangebote zu sorgen. Diakonissen
Speyer-Mannheim, Pressse
03.08.2012
Entstehung und Aufbau der VdK- Siedlung im Erzählcafé
.jpg) Aus der Not
der Nachkriegszeit geboren, vom damaligen VdK- Vorsitzenden Otto
Winter ins Leben gerufen, zur größten Kriegsopfer-Siedlung
Deutschlands herangewachsen, eine Vorbildfunktion für
Frankfurt am Main, gemeinsam Häuser gebaut…..
Aus der Not
der Nachkriegszeit geboren, vom damaligen VdK- Vorsitzenden Otto
Winter ins Leben gerufen, zur größten Kriegsopfer-Siedlung
Deutschlands herangewachsen, eine Vorbildfunktion für
Frankfurt am Main, gemeinsam Häuser gebaut…..
Prof. Dr. Otto Roller, Hans Winter, Emil Magin und viele
Teilnehmer berichten von der gemeinsamen Arbeit in der während der
Planungs-und Bauphase.
In Zeiten großer Wohnungsnot treffen sich
Kriegsbehinderte, Spätheimkehrer und Flüchtlingsfamilien auf
dem Baugebiet zwischen Woogbach und „Ehrlichweg“ und bilden
eine gute Gemeinschaft.
Dr. Roller zeigt an vielen Beispielen die Notsituation Speyerer
Familien in den 50er Jahren auf, welche die Nachkriegsprobleme
meistern mussten, wie auch heute noch in Kriegs- u.
Konfliktgebieten zu beobachten ist. „Wir hatten Glück, so Dr.
Roller, „ dass sich die politischen Verhältnisse innerhalb der
Bundesrepublik mit Hilfe der Besatzungsmächte ( USA, England,
Frankreich) positiv veränderten“.
Wirtschaftliche Hilfe des „Marshallplans“( Vorschlag von
US-Außenminister C. Marshall), Gesundheitsmaßnahmen aus Schweden,
der Schweiz und Lebensmittelhilfen durch religiöse Gruppen aus
Amerika gaben den Menschen hier wieder Mut.
Nun musste auch die Selbsthilfe den „ geschlagenen Körper“
wieder aufrichten und Selbstvertrauen vermitteln.
Otto Winter und der VdK suchen Lösungswege
.jpg) 1952 begann
der damalige VdK-Vorsitzende nac h Wegen zu suchen, wie den
Kriegsbeschädigten, Witwen und Kriegswaisen Wohnungen zu
beschaffen seien.
1952 begann
der damalige VdK-Vorsitzende nac h Wegen zu suchen, wie den
Kriegsbeschädigten, Witwen und Kriegswaisen Wohnungen zu
beschaffen seien.
Bei der Grundstücksbeschaffung ging die Verwaltung unter
Oberbürgermeister Dr. Paulus Skopp und den Ratsfraktionen
unbürokratisch und zügig vor. Zwischen Woogbach und „Ehrlichweg“
wurde ein Baugebiet ausgewiesen. Pro Quadratmeter musste 1.- DM
bezahlt werden. Die Finanzierung organisierte die staatliche
Treuhandstelle „ Heimstätte Rheinland-Pfalz“ aus Mainz.
Wie aus dem Bauvertrag von Brigitte Dannelke zu entnehmen,
„erstellt die Fördergesellschaft für Montagebau ( FFM)
für den Verband der kriegsbeschädigten-, kriegshinterbliebenen
Siedlergemeinschaft in Speyer im I./ II. Bauabschnitt 31
schlüsselfertige Einfamilienhäuser“.
1. Spatenstich im April 1954 durch den
Kriegsblinden Karl Stahl
Hans Winter zitiert aus den Aufzeichnungen seines Vaters, der
bei Problemen bis nach Bonn zu Bundeskanzler Konrad Adenauer
gefahren war, damit das Siedlungswerk vollendet werden konnte.
Vor Baubeginn musste die Finanzierung geklärt werden. Dazu wurde
ein Teil der Rente abgetreten, ein Eigenkapital war vorzuweisen,
Banken gaben Darlehen, das Notprogramm des Bundes ergänzte und
schließlich wurde die „ Muskelhypothek“ (Eigenleistung durch
Ausheben der Baugrube,- Kanalschächte, -Gartenanlage usw.)
eingesetzt.“ Selbsthilfe und Gemeinschaftsarbeit werden bei den
Siedlern im Speyerer Westen groß geschrieben“, titelten die
Zeitungen. Zuhörer berichten, dass sich nach getaner
Berufsarbeit die Baustelle belebte. Es wurde gemeinsame
gearbeitet, alle halfen sich gegenseitig, so dass Haus um Haus
heranwuchs.
Die Häuser hatten eine Wohnfläche von 82 qm. Es gab Kellerräume
mit Waschküche, das Erdgeschoß mit Diele, Küche, WC und zwei kleine
Wohnräume. Das Elterschlafzimmer, zwei Kinderzimmer und ein Bad
waren im Dachgeschoß untergebracht. Der Garten war 300qm groß.
Aufgrund der durchdachten Bauplanung der FFM kostete ein Haus
23.307 DM. An monatlichen Tilgungsraten waren 51,29 - 100,70 DM zu
zahlen.
Weihnachten mit Tränen und der beschwerliche Weg
zur Schule
.jpg) Hans Winter
erinnert sich noch gut an den Einzug am 10. Dez. 1956 in das
unverputzte Haus. Das erste Weihnachtsfest im eigenen Haus
brachte Freudentränen über das Erreichte hervor; es flossen aber
auch Tränen der Trauer um die im Krieg gebliebenen
Familienmitglieder, so Winter.
Hans Winter
erinnert sich noch gut an den Einzug am 10. Dez. 1956 in das
unverputzte Haus. Das erste Weihnachtsfest im eigenen Haus
brachte Freudentränen über das Erreichte hervor; es flossen aber
auch Tränen der Trauer um die im Krieg gebliebenen
Familienmitglieder, so Winter.
Auch Frau Petereit war mit ihren Töchtern aus dem zuvor
überschwemmten Hasenpfuhl voller Freude in das neue Haus gezogen,
auch wenn die Toilette noch nicht sicher funktionierte.
Gerne erinnern sich Zuhörer an Veranstaltungen, die im Rahmen
von Mitgliederversammlungen stattfanden und wobei auch die Häuser
verlost wurden. Frau Roller hatte damals das Los für Haus Nummer
1 gezogen und die gesamte siebenköpfige Familie war darüber
sehr erfreut. Der Quizzmaster stellte dem Ehemann aber so „
schwierige „ Fragen, dass plötzlich das gesamte „Rollersche
Kulturwissen“ eingefroren war; die Familie hatte aber ein neues
Zuhause.
Der Schulweg war voller Matsch und wenn man einer Pfütze
ausweichen wollte, trat man in die andere hinein, so Hans
Winter.
Von der Friedrich- Graf- Straße wurde am dunklen
Wintermorgen die Straßenlaterne bei der Kolbstraße anvisiert und
darauf zumarschiert.
Danach ging es hinunter ins Woogbachtal und über die
Fußgängerbrücke Richtung Steingleis, ein Bahnübergang nördlich des
Bahnhofs. Dann aber auf der Wormser- Straße durch die
Innenstadt zur „ Zeppelinschule“ .Oft entstanden dabei aber
auch „Schulfreundschaften“, an die man noch heute gerne
denkt. Die „Woogbachbrücke“ wurde erst im Spätherbst 1960
eingeweiht und verkürzt so den Weg zur Stadt erheblich.
Versorgungssituation mit Lebensmitteln, Obst, Gemüse und
IV. Bauabschnitt
In nur wenigen Jahren waren die Häuser der Ernst- Reuter,
Friedrich-Graf-, Hans -Boeckler-, Hermann-Ehlers-,
Graf-Stauffenberg-, Friedrich-Profit-, Carl-Goerdeler-,
Paul-Neumann-, Julius-Leber-Straße bewohnt. Das kleine
Milchgeschäft von „ Gauweiler“ wurde durch den „ Magin-Markt“ mit
Fleischwaren, Bäckereiprodukten, einem umfangreichen
Lebensmitteldepot und täglich mit frischem Gemüse und Obst aus den
Nachbardörfern ergänzt. Die „ Siedler“ schätzten die Nähe und gute
Versorgungsmöglichkeit bei Emil und Gertrud Magin.
Oft wurden auch „finanziell schwere Zeiten“ mit gegenseitigem
Vertrauen überbrückt. Ab dem Jahre 1962 wurde ein weiterer
Bauabschnitt zwischen Pulvermühlweg und Iggelheimer Straße
begonnen, oft schon mit Balkonen. Die Straßen wurden nach
Ärzten und Naturheilkundlern, wie Dr.-Robert-Koch, Virchow,
Röntgen, Felke benannt.
Durch Umbaumaßnahmen entstehen schmucke Häuser und
wunderschöne Gärten
.jpg) Heute sind
nur noch wenige Häuser im ursprünglichen Charakter vorzufinden.
Heute sind
nur noch wenige Häuser im ursprünglichen Charakter vorzufinden.
Die Besitzer bauen im Rahmen der Baurichtlinien um, setzen
Solarzellen auf das Dach, verbessern die energetische Struktur,
bauen Balkone und Garagen an und schaffen aus dem „ Gemüsegarten“
eine Wohlfühloase mit Wintergarten. Die Nähe zum Stadtwald im
Westen, dem Naturschutzgebiet „ Speyerer Sandalpen“, dem
Woogbachtal, das durch seine Umgestaltung weitere Naturräume
erhält, Haus Pannonia, Radwege bis zur Haardt und weiter, bringen
den Bewohnern einen hohen Freizeitwert. Die urprüngliche „
Otto-Winter-Siedlung“ o.ä. wie Teilnehmer das Wohngebiet
gerne benannt hätten, leidet aber auch unter dem Lärm der
Umgehungsstraße, seit „mautflüchtige Brummis“ die B9 als
Ausweichstrecke benutzen. Vielleicht ringt sich Rheinland-Pfalz
wenigstens zu einem „lärmreduzierenden Straßenbelag durch ,
so dass auch die Bewohner hier einen erholsamen Schlaf genießen
können.
Organisator Otto Winter hatte zwei Wünsche, die sein
Sohn Hans nochmals vortrug:
1. So vielen Menschen wie möglich zu einem eigenen Haus zu
verhelfen, die in einer guten Gemeinschaft zusammenleben.
2.Dass der VdK eines Tages nicht mehr für Kriegsopfer gebraucht
würde. Text und Foto: Khj
23.07.2012
„Grüner Haken“ wurde der Senioren- Residenz Sankt Sebastian zum dritten Mal bestätigt!
 Die Senioren-
Residenz Sankt Sebastian wurde erneut mit dem Grünen Haken der BIVA
für eine hohe Lebensqualität und ausgewiesene
Verbraucherfreundlichkeit ausgezeichnet, denn, hier fühlen sich
Seniorinnen und Senioren wohl und können ihr Leben selbst
bestimmen.
Die Senioren-
Residenz Sankt Sebastian wurde erneut mit dem Grünen Haken der BIVA
für eine hohe Lebensqualität und ausgewiesene
Verbraucherfreundlichkeit ausgezeichnet, denn, hier fühlen sich
Seniorinnen und Senioren wohl und können ihr Leben selbst
bestimmen.
Am 06. Juni 2012 fand die
Wiederholungszertifizierung durch die Bundesinteressenvertretung,
genannt BIVA in der Senioren Residenz Sankt Sebastian statt.
Die BIVA ist ein unabhängiger Selbsthilfeverband, der sich
bundesweit für die Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner in
stationären Wohn- und Pflegeeinrichtungen einsetzt.Gütesiegel,
Zertifikate, Noten, Bewertungen für Alten- und Pflegeheime gibt es
viele.
 Das
besondere am „Grünen Haken“:
Das
besondere am „Grünen Haken“:
Hier steht die Lebensqualität unserer Bewohnerinnen und Bewohner
im Mittelpunkt.
Herr Horst Müller ( Gutachter von der BIVA) hatte einen ganzen
Tag wieder hinter die Kulissen geschaut und konnte bei einem
gemeinsamen Mittagessen mit den Bewohnerinnen und Bewohnern
beobachten, wie der Umgang mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern gepflegt wird. Zudem richtete er wiederum 160 Fragen an
die Einrichtungs- und Pflegedienstleitung. Nach einem Rundgang
durch die Einrichtung fand eine Befragung der
Interessenvertretung der Bewohnerinnen und Bewohner statt,
bei der die gute Zusammenarbeit mit den Leitungskräften
hervorgehoben wurde.
Weitere Informationen und
Detailergebnisse zur Prüfung finden sie unter : www.heimverzeichnis.de Senioren-Residenz
Dudenhofen GmbH, Presse
28.06.2012
Tabakanbau in der Pfalz - Geschichten um die Heilpflanze im Erzählcafe
.jpg) Speyer-
Viele Tabakschuppen zwischen Rhein und Pfälzerwald zeugen noch
davon, dass der Anbau und die Vermarktung von Tabak in der Pfalz
lange Zeit eine bedeutende wirtschaftliche Rolle spielten. Wie sich
der Tabakbau entwickelt und was sich in den vergangenen rund 100
Jahren alles geändert hat, das zeigten drei Fachmänner Günter
Hechler, Klaus Mayrhofer und Töns Wellensiek im Juni-Erzählcafe des
Seniorenbüros auf. Zum Abschluss des von Dr.Thomas Neubert
moderierten Erzählnachmittag im Vortragssaal der Villia Ecarius
bekamen die annähernd 100 Besucher zudem von Alma Gehrlein aus
Hördt vorgeführt, wie Zigarren gewickelt werden. Und wer wollte,
konnte sich vom langjährigen Tabakbausachverständigen Günter
Hechler zum Preis von 4 Euro eine frisch gewickelte Zigarre
„verpassen“ lassen.
Speyer-
Viele Tabakschuppen zwischen Rhein und Pfälzerwald zeugen noch
davon, dass der Anbau und die Vermarktung von Tabak in der Pfalz
lange Zeit eine bedeutende wirtschaftliche Rolle spielten. Wie sich
der Tabakbau entwickelt und was sich in den vergangenen rund 100
Jahren alles geändert hat, das zeigten drei Fachmänner Günter
Hechler, Klaus Mayrhofer und Töns Wellensiek im Juni-Erzählcafe des
Seniorenbüros auf. Zum Abschluss des von Dr.Thomas Neubert
moderierten Erzählnachmittag im Vortragssaal der Villia Ecarius
bekamen die annähernd 100 Besucher zudem von Alma Gehrlein aus
Hördt vorgeführt, wie Zigarren gewickelt werden. Und wer wollte,
konnte sich vom langjährigen Tabakbausachverständigen Günter
Hechler zum Preis von 4 Euro eine frisch gewickelte Zigarre
„verpassen“ lassen.
Das Ursprungsland der Tabakpflanze ist Amerika. Schon bei seiner
ersten Amerikareise 1492 berichtete Christoph Columbus von
Eingeborenen auf den Westindischen Inseln (Karibik), die ein in
Maisblätter gerolltes Kraut rauchten. Sie nannten es Tobacco,
berichtete Hechler (von 1989 bis 2004 Geschäftsführer und
Tabakbausachverständiger des Landesverbandes rheinland-pfälzischer
Tabakpflanzer). Schon bald ist der Tabak nach Europa gelangt, wo er
zunächst als Heilmittel galt. Ein Diplomat in Diensten Frankreichs
namens Jean Nicot beschäftigte sich in Lissabon mit der Heilwirkung
des Tabaks und schickte im Jahr 1561 Tabaksamen an den
französischen Hof, was zur frühen Verbreitung des Tabaks in
Frankreich führte.
Der französische Botaniker Jacques
Daléchamps gab der Pflanze deshalb 1586 den endgültigen Namen
herba nicotiana. 1828
isolierten die Heidelberger Chemiker Karl Ludwig
Reimann und Christian
Wilhelm Posselt erstmals das in der Tabakpflanze wirksame
Alkaloid und gaben ihm, Jean Nicot zu Ehren, den Namen Nicotin.
.jpg) In der Pfalz begann
im Jahre 1573 der deutsche Tabakbau. Der Hatzenbühler Pfarrer
Anselm Anselmann züchtete in seinem Kirchgarten die ersten
Tabakpflanzen Deutschlands. Zunächst nur als blühende Zier- und als
Heilpflanze benutzt, kam laut Hechler „erst um das Jahr 1600 der
Genuss dazu“ In dieser Zeit habe in Speyer als erster Johann
Joachim Becher zum Tabak Stellung genommen. Zum Gebrauch „von
Toback und Brandtewein“ habe Becher erklärt: „Dieser soll nicht
allezeit, sondern nur als eine Arzeney bey kalten Wetter, bösen
Nebeln und unverdaulicher Kost gebrauchet werden. Um 1700 begann
der Siegeszug des Tabaks in seiner heutigen Anwendung. Der
britische Seefahrer und weltmännische Pfeifenraucher Sir Walter
Raleigh machte das Rauchen hoffähig.
In der Pfalz begann
im Jahre 1573 der deutsche Tabakbau. Der Hatzenbühler Pfarrer
Anselm Anselmann züchtete in seinem Kirchgarten die ersten
Tabakpflanzen Deutschlands. Zunächst nur als blühende Zier- und als
Heilpflanze benutzt, kam laut Hechler „erst um das Jahr 1600 der
Genuss dazu“ In dieser Zeit habe in Speyer als erster Johann
Joachim Becher zum Tabak Stellung genommen. Zum Gebrauch „von
Toback und Brandtewein“ habe Becher erklärt: „Dieser soll nicht
allezeit, sondern nur als eine Arzeney bey kalten Wetter, bösen
Nebeln und unverdaulicher Kost gebrauchet werden. Um 1700 begann
der Siegeszug des Tabaks in seiner heutigen Anwendung. Der
britische Seefahrer und weltmännische Pfeifenraucher Sir Walter
Raleigh machte das Rauchen hoffähig.
Der Tabakanbau hatte in der Pfalz vor über 100 Jahren seine
größte Ausbreitung. 1880 waren in Deutschland über 200 000 Pflanzer
mit dem Anbau auf mehr als 30 000 Hektar beschäftigt. Um gute
Preise für qualitativ gute Ware zu erhalten, vereinbarten die
Tabakbauer Qualitätsrichtlinien, die noch heute gelten. Auch der
Amtssitz des erstmals1916 von der Regierung
eingesetztenTabakbausachverständigen (heute durch Bezirksverband
Pfalz) ist nach wie vor Speyer (seit 2004 Egon Fink).
Linksrheinisch waren in dieser Zeit nach Auskunft Hechlers rund
40000 Menschen im Tabakbau beschäftigt. 66 Betriebe in Speyer
bauten im Jahr 1916 auf einer Gesamtfläche von 21 Hektar Tabak an.
Das Tabakdorf Harthausen lag damals mit 207 registrierten Pflanzern
und einer Fläche von 61,3 Hektar im Hauptzollamtsbezirk
Ludwigshafen auf Platz zwei hinter Iggelheim mit 291 Betrieben und
45,4 Hektar Anbaufläche.
.jpg) Aufgrund des für
Tabakanbau idealen Klimas und der optimalen Bodenverhältnisse
ernten die heute noch 60 Pfälzer Pflanzer leichten und milden, aber
dennoch aromatischen Tabak der Sorten Geudertheimer, Burley und
Virgin, berichtete Töns Wellensiek, Nachkomme einer großen Speyerer
Zigarrenfabrik. Carl Schalk, in Neuwied geborener Kaufmann gründete
zusammen mit dem technisch versierteren Hermann Wellensiek,
Großvater von Töns Wellensiek, die Zigarrenfabrik, die mit
1882 mit zwölf Arbeitern die Produktion aufnahm. 1906 stand die
Firma Wellensiek & Schalk, die sehr sozial eingestellt war und
eine eigene Krankenkasse betrieb, mit 2000 Beschäftigten in voller
Blüte. Im Wellensiekschen Verwaltungsgebäude in der Johannesstraße
sind heute das Sozialamt und das Stadtarchiv beheimatetet.
Aufgrund des für
Tabakanbau idealen Klimas und der optimalen Bodenverhältnisse
ernten die heute noch 60 Pfälzer Pflanzer leichten und milden, aber
dennoch aromatischen Tabak der Sorten Geudertheimer, Burley und
Virgin, berichtete Töns Wellensiek, Nachkomme einer großen Speyerer
Zigarrenfabrik. Carl Schalk, in Neuwied geborener Kaufmann gründete
zusammen mit dem technisch versierteren Hermann Wellensiek,
Großvater von Töns Wellensiek, die Zigarrenfabrik, die mit
1882 mit zwölf Arbeitern die Produktion aufnahm. 1906 stand die
Firma Wellensiek & Schalk, die sehr sozial eingestellt war und
eine eigene Krankenkasse betrieb, mit 2000 Beschäftigten in voller
Blüte. Im Wellensiekschen Verwaltungsgebäude in der Johannesstraße
sind heute das Sozialamt und das Stadtarchiv beheimatetet.
Damit die Mischung für die Tabake (40 Prozent des Tabaks musste
aus Deutschland stammen) stets den gleichen Geschmack hatte,
beschäftigten die Produktionsbetriebe für Zigarillos, Zigaretten
und Pfeifentabake Proberaucher, berichtete Klaus Mayrhofer,
Rohtabakkaufmann und bis 2001 Verkaufsleiter der Heintz van
Landewyck GmbH in Trier und Urenkel von Tabakgroßhändler Albert
Göpfert, auch über die einstige Verkaufsbörse, die so genannte
„Tabakauflage“ bei Liesel Jester im „Weidenberg“ und über die
verschiedenen Möglichkeiten der Fermentation.
Den größten Fermentationsbetrieb rund um Speyer hatte einst die
Firma Ringwald in Schifferstadt. ws; Foto: K-H Jung
Lesen Sie hierzu auch unserren Bericht über die
"Reanimierung" des Tabakanbaues in der Südpfalz

07.06.2012
Das Erzählcafé im Becherhaus in Speyer……
.jpg) Der
Universalgelehrte Johann Joachim Becher, in Speyer geboren, an
vielen Fürstenhöfen Europas als Berater tätig. Mediziner,
Mathematiker, Begründer der Politischen Ökonomie, plante Kanäle,
Schleusen, verbesserte die Technik der Wassermühlen, wollte
Kolonien in Guyana aufbauen, um Rohstoffe zu erhalten, stellte im „
Werkhaus“ das Zusammenwirken von Bildung, Produktion und
Gemeinwesen als zukunfttragendes Konzept vor. Er wurde geehrt und
geachtet, aber auch „gemobbt“ und starb mit 48 Jahren fern
seiner geliebten Heimat in London.
Der
Universalgelehrte Johann Joachim Becher, in Speyer geboren, an
vielen Fürstenhöfen Europas als Berater tätig. Mediziner,
Mathematiker, Begründer der Politischen Ökonomie, plante Kanäle,
Schleusen, verbesserte die Technik der Wassermühlen, wollte
Kolonien in Guyana aufbauen, um Rohstoffe zu erhalten, stellte im „
Werkhaus“ das Zusammenwirken von Bildung, Produktion und
Gemeinwesen als zukunfttragendes Konzept vor. Er wurde geehrt und
geachtet, aber auch „gemobbt“ und starb mit 48 Jahren fern
seiner geliebten Heimat in London.
Prof. Dr. Carl Böhret und Dipl. Ing. Willi Philippe stellten den
Universalgelehrten aus Speyer vor
Es ist ein Glücksfall, so Prof Böhret, dass die Universität
Rostock den handschriftlichen Nachlass von J.J. Becher für
Forschungszwecke zur Verfügung stellt.
Am 6.Mai 1635 wurde Becher in der Großen Himmelsgasse von
Speyer geboren. Von Stockholm, wohin die Familie mit dem
Stiefvater zieht, gerät der Wissbegierige über Würzburg nach
Mainz, wo er Medizin studiert, promoviert, die Tochter von Prof.
Ludwig Hornik heiratet und schon bald dessen Lehrstuhl
übernimmt.
Es war die Zeit des 30-jährigen Krieges. In Deutschland lebten
noch etwa 10 Mio Menschen, die den Frieden und den Neuaufbau
herbeisehnten. Nach einer Ordnung der Aufklärung, der Reformation,
einem Aufbruch zu einer Übergangsgesellschaft wurde gesucht.
Als“ Hofmedicus“ und Berater mit einem „
Merkantilistischen Programm“ von 1664 -1670 bei Kurfürst Ferdinand
Maria von Bayern
Den unruhigen Becher zog es nach Bayern. Der Kurfürst stellte
ihn besonders als okonomisch- technischen Helfer, Projektemacher
und Politik-Berater an, wie Prof. Böhret ausführte.
Ab 1664 entwickelte Becher für den Fürsten sein „
Politökonomisches Programm mit 15 Reguln und Axiomato“. Diese waren
das Skelett des merkantilistischen Grundlagenwerkes
„Politischer Diskurs“. Die Kurzfassung wurde interessiert
verfolgt u. diskutiert:
-Das Geld im Lande halten und es mehren
-Belastung von Luxusgütern- Exporte- mit Steuern (
Reichensteuer)
-Waren möglichst vom Erzeuger beziehen ( kein Zwischenhandel/
Regionale Produkte)
-Rohstoffe einführen und im Lande verarbeiten ( Deutschland =
wenige Bodenschätze)
-Erzeugnisse des Landes vor Importe stellen ( Nahrungsmittel,
Kleidung)
-Förderung von Mittelreichen- gegen den Reichtum in einer Hand
(Mittelstand)
-Ausgewogenheit von Produktion und Konsumtion anstreben( Export-
Eigenkonsum)
-Handwerk, Manufakturen etablieren u. deren Investitionskraft
fördern( Ausbildung)
-Unterstützung des Kaufhandels u. Zulassung von
Mindestgewinnen
-Öffentliches Interesse hat Vorrang vor dem privaten
(Gemeinwohl)
-Monopole, Zünfte, Sozietäten sind nicht zu unterstützen
-Beständige Ordnung, Sprache, Geld, Glaube, Herrschaft stärken
das optimale Land
-Gute Verbindung von Handel und innerer Ordnung( policey) sind
erstrebenswert
-Häuser, Unterkünfte und viele Arbeitskräfte bewirken die Blüte
des Gemeinwesens
-Zum Nutzen einer Stadt dienen eine wohlbestellte „Müntz“, ein
freies Kaufhaus, ein Werkhaus und eine reiche Bank
Der ordnende und steuernde Staat mit einer inneren
Entwicklungspolitik, der Arbeits-, Gesundheitsförderung und einer
Bevölkerung mit Zuwanderung und Integration sollten aufgebaut
werden.
In Ergänzung baute JJ. Becher immer die „Bildung für alle, auch
für Mädchen“ in seine Überlegungen ein. Weiter war sein Ziel „
Wissen umsetzen und technisch ausbauen“.
Bei Fahrten nach Holland und London studierte er die
Kanaltechniken, die Energiegewinnung durch Wasserkraft und Wind (
Wasser-.u. Windmühlen). Seine Vorschläge zur Windenergie
werden in unserer Zeit durch den „ Rhein-Main-Donau Kanal und
„Off-shore Parks“ verwirklicht.
.jpg) Beauftragter und Berater bei
Kaiser Leopold I. und das Werkhausprojekt in Wien
Beauftragter und Berater bei
Kaiser Leopold I. und das Werkhausprojekt in Wien
Wie Prof. Böhret darstellte und am Modell erläuterte konnte
Becher sein merkantilistisches Programm im berühmten „Wiener
Werkhaus“ umsetzten, das Kaiser Leopold I. förderte.
Hier wurde die Verbindung von mehreren Produktionen (Synergie-
Effekte) praktisch umgesetzt( zusammenfassen und zusammenwirken).
Techniken wurden weiterentwickelt.
Hier ergänzte Diplom Ingenieur Willi Philippe, langjähriger
Leiter von Grünzweig& Hartmann Speyer und „ Modellbauchef der
Becher-Gesellschaft“:
Destillier- u. Schmelzöfen, Hammerwerke, Schleifmaschinen,
Pumpwerke arbeiteten in einem abgestimmten Verbund. Die
erforderliche Energie( es gab auf dem Tabor keinen Fluss) wurde mit
Hilfe der „ oberschlächtigen Mühle“( Schrauben/ Radsystem zum
Wassertransport) erzielt. Die Laboratorien analysierten die
Erzeugnisse. Eine in der modernen Industrieproduktion notwendige
Grundlage des Erfolges, wie Philippe mit Erfahrungsberichten
belegte.
Im Werkhaus waren Beschäftigungs- und Ausbildungsprogramme für
Langzeitarbeitslose und Lehrlinge vorgesehen. Eine Art
„Gewerbelehranstalt“; heute Berufsbildende Schule.
Eine „Arbeiterbörse“mit Vermittlung und Verteilung von
Arbeit , Arbeitsbücher, Lohntafeln (Vorläufer der Tarifverträge)
regelten Vergütungen und Arbeitsbedingungen für die verschiedenen
Gruppen von Beschäftigten. Auf „ ausreichendes Einkommen“ zur
Ernährung und Erziehung der Familie wurde geachtet. Weiter durften
die Lebensmittel nicht zu teuer sein.
Wirkmächtige „Artzeney“ und Entwicklungspolitik in
Guyana als „Hanauisch-Indien/Neu Deutschland“
geplant
Als Hofmedicus in München wird Becher von den Hofdamen nach
einem Mittel für die Beschwerden des Alltags gefragt. Er wählt
nichts“ Chymisches von Metallen oder Mineralien nur balsamische
Säfte u. sonstige Stoffe, welche die Stärkung der Natur
unterstützen“. Die Polycrest- Pillen sind in den Vitrinen anzusehen
und erzielten, den Berichten zufolge, nach einigen Tagen ihre
Wirkung.
Für Graf Friedrich Casimir von Hessen Nassau arbeitete
Becher einen Vertrag über ein „ erbliches Lehen über 3000
Quadratmeilen zwischen dem Orinoco und dem Amazonas mit vielen
ökonomischen Vorteilen aus. Zucker, Reis Tabak, Baumwolle und
Specereien( Gewürze, Öle usw). Auswanderung von Handwerkern,
Bauern, Tierzüchtern wurde empfohlen, aber auch moralische
Grundregeln für den Umgang mit Einheimischen erlassen. Die Pläne
waren der Zeit voraus und wurden auch aus finanziellen Gründen
nicht verwirklicht.
Johann Joachim Becher als Prototyp des Multigelehrten,
sein Verhältnis zu G.W. Leibnitz und seine Anerkennung
Johann Joachim Becher gilt als „ Prototyp jener
erfindungsreichen, auf vielen Gebieten agierenden, gelegentlich
auch scheiternden Impulsgeber und umtriebiger Projektemacher.
.jpg) Manch gute
Vorschläge scheiterten, weil die Rahmenbedingungen noch nicht
stimmten. Das von Becher entdeckte Leuchtgas wurde erst gebraucht
als die Frühindustrialisierung begann, so Böhret.
Manch gute
Vorschläge scheiterten, weil die Rahmenbedingungen noch nicht
stimmten. Das von Becher entdeckte Leuchtgas wurde erst gebraucht
als die Frühindustrialisierung begann, so Böhret.
Die Zuhörer konnten sich noch an das Leuchtgas in der
Nachkriegszeit erinnern, wo Wohnungen, später Wanderhütten, damit
ausgeleuchtet wurden. Auch die auf der Schiffswerft Braun im
Vorjahr entstandene „Schiffsmühle“ wurde von den Teilnehmern nun
besser verstanden.
Der „ Erfolgsmensch“ Becher hatte aber auch ein lebenslanges
Duell mit seinem Widersacher Leibnitz auszutragen, was ihn sehr
belastete.
Doch über allem Streit, so Prof. Böhret, leuchtet das Sternbild
von Johann Joachim Becher am abendlichen Himmel, erinnert an einen
„Multigelehrten“, der in Speyer das Licht der Welt erblickte und
nun auch in der „Becher-Gesellschaft“ ehrend und fordernd die Zeit
und Gemeinschaft weiterhin mitgestaltet. Karl-Heinz
Jung
31.05.2012
Berlin-Fahrt von ehrenamtlich akltiven Pfälzer Senioren
 Die Speyerer Reisegruppe in Berlin
Die Speyerer Reisegruppe in Berlin
Speyer- Sie lernen überall dazu: Im
Bundestag, Bundesrat, im Kanzleramt und im Bundespresseamt erfahren
die knapp 50 ehrenamtlich in der Seniorenarbeit engagierten Pfälzer
an drei langen Tagen in Berlin, was die Regierung der
Bundesrepublik Deutschland und die 622 Bundestagsabgeordneten in
der Hauptstadt politisch bewegen, was ihre Aufgaben und
Zielvorstellungen sind. Wie er im Finanzausschuss und im
Energiegremium kräftig und engagiert seit 1996 mit am Polit-Rad
dreht und was er über Christian Wulffs Rückzug und Joachim Gaucks
Wahl zum Bundespräsidenten hält, erzählt CDU-Bundestagsabgeordneter
Norbert Schindler den Besuchern aus seinem Wahlkreis (aus Speyer,
Schifferstadt, Haßloch und Forst) bei einem Abendessen im Lokal
„Zur Kneipe“ recht freimütig, ohne ein Blatt vor den Mund zu
nehmen. Auf Einladung Schindlers können die Senioren überhaupt die
Berlin-Reise machen. Dort stehen überaus interessante Einblicke in
die Politik im Mittelpunkt des Mammutprogramms, welches das
Bundespresseamt zusammengestellt hat.
Offen und bürgernah präsentiert sich das Parlamentsviertel.
Großzügig ausgelegt ist das Grün des Platzes der Republik an der
Westseite des Reichstages – nur wenige hundert Meter entfernt vom
neuen Berliner Hauptbahnhof. Der eindrucksvolle Blick über die
deutsche Hauptstadt belohnt die Besucher, die nach der Führung im
Plenarsaal des Deutschen Bundestages bis auf die Plattform in der
gläsernen Reichstagskuppel hinauf laufen. Den Besuchern wird
dargelegt, warum der Bundestag auf eine effektive Verwaltung
angewiesen ist und insgesamt 5000 Menschen den Abgeordneten
zuarbeiten. Nach flugplatz-tauglichem Sicherheitscheck dürfen die
vom Speyerer Seniorenbeirats-Vize Karl-Heinz Jung angeführten
Pfälzer am Tag darauf im großzügigen Bundeskanzleramt hinter sonst
verschlossene Türen blicken. Nächste Station ist der Bundesrat. Im
stilvoll runderneuerten Gebäude des ehemaligen Preußischen
Herrenhauses kümmert sich der Bundesrat seit dem Jahr 2000 um die
Belange der 16 Bundesländer. Was Regierung, Abgeordnete und
führende Ministerialbeamte alles für Landwirtschaft, Ernährung und
Verbraucherschutz besprechen und regulieren, erfahren die
Berlinreisenden im hierfür zuständigen Ministerium, das in den
vergangenen drei Jahren auf 850 Bedienstete reduziert wurde. Als
ein Diplom-Agraringenieur die Besucher über Sinn und Unsinn von
Mindesthaltbarkeitsdaten aufzuklären versucht, hat der bekannteste
Mitreisende seinen großen Auftritt: Der mit Norbert Schindler
befreundete Paul Tremmel bittet den Referierenden ums Mikro und
liest seine Gedanken zum Thema Haltbarkeit vor, die der
Mundartdichter aus Forst schon vor 20 Jahren in Reim gefasst hat.
Zum Nachlesen schenkt Tremmel dem Ministerialbeamten ein
Bändchen.
Bei einer zweistündigen Stadtrundfahrt wird Halt gemacht am
Brandenburger Tor und an dem erhaltenen und von Künstlern neu
bemalten Reststück der Berliner Mauer, die im Stadtteil
Friedrichshain von der Oberbaumbrücke bis zum Ostbahnhof 1,3
Kilometer entlang der Spree verläuft. In die Heimfahrt integriert
ist ein Besuch des ehemaligen Stasi-Gefängnisses in Potsdam, wo die
Pfälzer Senioren bei der Führung von zwei einst dort inhaftierten
Regimegegnern aus berufenem Munde über die unmenschlichen Verhör-
und Bespitzelungsmethoden der Stasi-Mitarbeiter informiert wurden.
Wie viele DDR-Bürger diese Stasi-Bespitzelung zu spüren bekamen,
wird den Pfälzer Senioren bereits am zweiten Besuchstag im
Bildungszentrum des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR, unweit des einstigen
Grenzübergangs „Checkpoint Charlie“, vor Augen geführt. Unter den
rund 39 Millionen Karteikarten befinden sich unter anderem auch
Bespitzelungsblätter über den ehemaligen Speyerer Caritasdirektor
Ludwig Staufer und den damaligen Speyerer Oberbürgermeister Dr.
Paulus Skopp, wird den Besuchern bei der Museumsführung mitgeteilt.
ws; Foto: privat
29.04.2012
„Gott zur Ehr- dem Nächsten zur Wehr…..“
-03.jpg) Entstehung,
Wirken der Feuerwehr von Speyer in Kriegs- u. Notzeiten im
Erzählcafé….
Entstehung,
Wirken der Feuerwehr von Speyer in Kriegs- u. Notzeiten im
Erzählcafé….
Friedel Flörchinger, Eleonore Winkler, Willi Seither und
interessierte, engagierte Mitbürger berichten über die
Speyerer Feuerwehr.
Die Kriegszeit von 1939 - 1945 ist den meisten Zuhörern in
schlechter Erinnerung. Fliegerangriffe, Bomben, Tote, Zerstörung
und Willkür zwangen zu ständigen Einsätzen der Feuerwehr.
Polizei- und Feuerwehrkommandanten retteten Speyer vor größerem
Schaden.
Entwicklung der Feuerwehr in Speyer
Die älteste, noch handgeschriebene Feuerlöschordnung der Stadt
stammt von 1512, dieser folgte 1728 die „ Zweite Speyerer
Feuerordnung“, dann in gedruckter Ausgabe.
Am 2.August 1848 kam es zur formellen Konstituierung des „
Freiwilligen Löschvereins“, oft als “ Turnerfeuerwehr „
bezeichnet.( Öffentliche Vorstellung einer Spritze mit
Rettungswagen durch eine Turnermannschaft ). Kommandant war Georg
Peter Süß, der bis 1852 im Amt war.
Louis Gilardone bildete mit der neuen Feuerlöschordnung die
„Allgemeine städtische Feuerwehr“, bis ihn 1860 Ludwig Heydenreich
ablöste.
Unter dem Bürgermeister und Feuerwehrkommandant Heydenreich, kam
es zur Gründung des „ Veteranencorps“, für ausgeschiedene,
ehrenwerte Mitglieder. Auch eine „ Kranken- Unterstützungs-
Anstalt“ für arme Wehrleute entstand.
Weiter wurde der „Pfälzische- Feuerwehr- Verband“ aufgebaut;
Stadthaus, Altpörtel, Kaserne und Läutturm durch „Feuertelegrafen“
verbunden.
Nach 24 Jahren gab Heydenreich sein Amt auf, schuf aber mit der
Vollendung der Wasserleitung 1883 auch 116 Hydranten zur
Wasserentnahme.
Von 1884 bis 1919 waren die Kommandanten Friedrich Voelcker,
Philipp Bechtluft, Ernst Knabe, Christian Rücker,
Jean May und Franz Stützel aktiv.
Wie Friedel Flörchinger ausführte, bildete Stützel einen eigenen
Löschzug für kleine Brände und modernisierte die Alarmierung
durch eine „Läutewerkeinrichtung“, die in Aktion „ alle Menschen
aus dem Haus donnerte“, so Flörchinger. Die erprobte
Sturmglocke auf dem Altpörtel wurde erstmals durch eine Sirene
ersetzt.
Opel Motorspritze und erstes motorisiertes
Löschfahrzeug
Der von 1919- 1939 amtierende Kommandant Friedrich Schlamp
beschaffte sich für die Großübung an der Hauptpost anlässlich des
20. Pfälzer Kreisfeuerwehrtages bei den Flugzeugwerken eine Opel
Motorspritze und wurde wegen der enormen Wirkung von den
Kollegen beneidet. Das erste motorisierte
Löschfahrzeug der Wehr wurde 1927 bei der Firma Balcke in
Frankenthal gekauft. Vierzehn Wehrleute saßen auf dem Fahrzeug,
während die Benzin- Motorspritze als Anhänger mitgezogen
wurde (Folienbild).
Die rüstige 88jährige Eleonore Winkler, Tochter des damaligen
stellvertretenden Wehrführers Fritz Vogt, berichtete, wie ihr Vater
zu Übungen „ausrückte“.
„ Strahlend polierter Messinghelm, glänzend geputzte Stiefel,
daran musste ich oft stundenlang polieren“, so Frau Winkler.
Sie erzählte auch vom großen Brand in der Celluloidfabrik 1933,
der zwei Tage dauerte und neun Todesopfer forderte. Auch an
das 1938 erlassene Reichsgesetz über das Feuerlöschwesen mit der
Neuorganisation zur „ Feuerlöschpolizei“, die dem Reichsführer der
SS und Chef der Polizei unterstellt wurde, erinnert sie sich
noch gut, „ denn mein Vater trug nun bei der Feuerwehr eine
Polizeiuniform“, so Frau Winkler.
 Harte, problemreiche
Kriegsjahre erwarten ab 1.7. 1939 Anton Dengler
Harte, problemreiche
Kriegsjahre erwarten ab 1.7. 1939 Anton Dengler
„Schlossermeister mit eigenem Betrieb, Lehrlingswart,
Obermeister, Kreishandwerkermeister und Stadtrat, das waren
Erfahrungsbereiche, die der neue Feuerwehrkommandant mitbrachte“,
so Friedel Flörchinger.
Bereits am 4./ 5. September 1939 wurde die „ Verdunkelung“
(Vorhänge, Läden an Fenstern und Türen schließen, so dass kein
Licht nach außen dringen konnte) und ein „ Blinder Fliegeralarm“
angekündigt. Luftschutzsirenen in den Stadtteilen informierten die
Menschen über bevorstehende Gefahren. Schutzbunker waren in Speyer
kaum vorhanden. Brauerreikeller an der Dudenhofer Straße und die
Domkrypta wurden bei Fliegeralarm aufgesucht.
Für die Feuerwehr in Speyer begann die „ ruhelose“
Kriegszeit.
Die Festhalle brannte 1940 vollständig ab., 6 Spreng- und 5
Brandbomben schlugen am „ Waldschlössel“ (Ausflugslokal) ein, 50
Brandbomben am Rinkenberger Hof. Am 20.Juni zerstörten drei
Sprengbomben das Dachgeschoß der LVA- heute Stadthaus
Maximilianstraße 100.
Während 1941 die Spreng- und Brandbomben meist die
Speyerer Randbezirke trafen wurden 1942/43 Ludwigshafen.
Mainz, Karlsruhe, Philippsburg durch Großangriffe zerstört. Die
Feuerwehr aus Speyer war dort im Einsatz.
Das Jahr 1944 blieb bei vielen Zuhörern mit
Schrecken im Gedächtnis haften und die Schilderungen wollten kein
Ende nehmen: Absturz eines englischen Fliegers im Salmengrund, die
Bombardierung der Flugzeugwerke im Oktober,
Hochwasser bis zum Pegelstand von 8.45 m im November, der
Jagdbomberangriff am 1. Dez. auf den Bahnhof , die Rheinbrücke,
Bahnstrecke nach Schifferstadt.
Weibliche Feuerwehrgruppe von 28 Frauen gebildet
und das Kriegsende…
Die Frauen ersetzten die wehrdienstfähigen Feuerwehrleute, die
an der „ Front“ waren. Die Ausbildung an Geräten, Maschinen
und ihr Einsatz half der Wehr ihrer Aufgabe nachzukommen. Bei den
gezeigten Fotos wussten viele Zuhörer/Innen die „ Mädchennamen“ der
Feuerwehrfrauen. Bei der 150-Jahrfeier waren die Frauen eingeladen
und erhielten von Kommandant Kaiser eine Erinnerungsmedaille
überreicht.
Ohne diese Frauen hätte die Wehr ihre Aufgabe nicht erfüllen
können.
Gerade im Frühjahr 1945 verstärkten die Alliierten die
Fliegerangriffe; dabei waren am 8. Januar 11 Tote, Verletzte
und Verschüttete im Bereich der Goethe- straße zu beklagen. Im März
kam der Rückstrom der Heeresverbände an der letzten Rheinbrücke der
Region wegen Stau fasst zum Erliegen. Am 23. März wurde diese
Brücke gesprengt.
Polizeichef Richard Seither und Feuerwehrkommandant
Anton Dengler retten unter höchster Lebensgefahr Speyer vor der
Zerstörung……..
Wie Willi Seither berichtete, sei er bei der Erstellung seiner
„Familiengeschichte“ auf „ Verwandtschaftsbeziehungen“ zu Richard
Seither aus Ottersheim bei Landau gestoßen. Er verlas einen
Zeitungsbericht, in dem das Geschehen am Tag vor dem Einmarsch
geschildert wird. Danach hat Polizeichef Seither für die Stadt
große Verantwortung übernommen und durch kluges Handeln die Stadt
vor weiterer Zerstörung gerettet. Oberbürgermeister Trampler war
bereits über den Rhein geflohen; die Heeres- Kreisleitung hatte die
Verteidigung befohlen und um ständige Information zum Bunker an der
Rheinhäuser Straße aufgefordert.
Richard Seither schickte die Polizisten, Feuerwehrleute und
Helfer nach Hause,ließ auf dem Altpörtel ein weiße Fahne (Zeichen
der friedlichen Übergabe) aufziehen.
Anton Dengler hatte sich am Tag vor dem Einmarsch bei der
Kreisleitung „missliebig“ gemacht. Er hatte gegen den Barrikadenbau
an der Wormser Straße/ Hirschgraben Bedenken eingelegt.
Deshalb verurteilte ihn der Kampfkommandant zum Tode. Sein Leben
verdankte Dengler OB Rudolf Trampler , der eine Möglichkeit zum
Untertauchen verschaffte.
Richard Seithers Tochter lebt hochbetagt in Frankenthal; Anton
Denglers Tochter, Frau Spiekermann, in Speyer.
Mit einer Panzergranate wurde am nächsten Tag ein
“Maschinengewehrstand“ durch die Amerikaner beseitigt, dann fuhren
die Panzer vor dem Rathaus vor und verlangten eine
Besprechungsdelegation im Rathaus, wie dem Bericht von
Willi Seither zu entnehmen ist.
Neuaufbau der Feuerwehr nach dem II.
Weltkrieg
Die französische Besatzungsbehörde beauftragte Anton Dengler mit
dem Neuaufbau der Feuerwehr in Speyer.
Die ersten Feuerwehrmänner trugen Armbinden mit der Aufschrift
“Pompier“ (franz. f. Feuerwehr). Gerätschaften wurden
freigegeben, mussten von der grünen Tarnfarbe befreit
und erhielten wieder die rote Farbe.
Moderne Feuerwehr mit vielfältigem
Aufgabengebiet……
Nach Karl Jester (1954-67) diente Friedel Flörchinger 25 Jahre
der Stadt als Feuerwehrkommandant. Während seiner Dienstzeit wurde
die Feuerwache an der Industriestraße gebaut und mit erweitertem
Schutzbereich versehen (Chemie-, Oel-, Gefahrgut- und
Verkehrsunfälle verlangen von der Feuerwehr immer weitere
Ausbildungsgänge).
Nach Peter Kaiser (1992-2005) hat nun Michael Hopp das“ Sagen“
bei der Wehr in Speyer.
Während 1946 vier Fahrzeuge verfügbar waren, sind es heute 20
technisch-hochwertige Einsatzobjekte zur Brand- u.
Schadensbekämpfung. 2011 gab es 106 Brände, 223 Technische
Hilfeleistungen, 31 Sicherheitswachen und 98-mal Fehlalarm. Dem
hauptamtlichen Michael Hopp stehen zehn Angestellte zur
Fahrzeug- und Gerätewartung zur Seite. 117 freiwillige
Feuerwehrleute sind blitzschnell im Einsatz, wenn „ Gefahr für
Mensch und Material“ besteht. Karl-Heinz Jung /
khj
09.04.2012
Altbischof Dr. Anton Schlembach im Erzählcafé…
 Geistreich,schlagfertig, humorvoll,
mit tiefsinnigen Anekdoten versehen, stellte der
80-jährige emeritierte Bischof die Berufung zum“
Speyerer Bischof“, sein Leben und Wirken dar.
Geistreich,schlagfertig, humorvoll,
mit tiefsinnigen Anekdoten versehen, stellte der
80-jährige emeritierte Bischof die Berufung zum“
Speyerer Bischof“, sein Leben und Wirken dar.
Aufgewachsen im unterfränkischen Großwenkheim in der Diözese
Würzburg, Studium von 1950- 56 in Rom, von Kardinal König aus Wien
1956 zum Priester geweiht, warteten auf ihn verantwortungsvolle
Aufgaben in seiner Heimatdiözese.
Jeweils drei Jahre war er Direktor des Studienseminars
Aschaffenburg und Regens des Priesterseminars Würzburg. Zwölf Jahre
erteilte er Religionsunterricht am Gymnasium in Hammelburg, bevor
er zum Domkapitular und Generalvikar des Bistums ernannt wurde.
Sprachlos war , so Dr. Schlembach, als ihn der päpstliche Nuntius
(Botschafter des Vatikans in Deutschland) im Kloster Himmelspforte
eröffnete: Der Papst hat ihn zum Bischof von Speyer ernannt
und bittet um baldige Annahme und Einwilligung .Schlembachs
Bedenken, dass er in Speyer kaum Menschen kenne, wurden von Nuntius
Del Mestri entkräftet, dass auch Papst Paul II. als Bischof von
Krakau in Rom vor der Papstwahl wenige kannte. Mit der
schriftlichen Zusage begann der Weg durch die Instanzen.
Die Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland
verlangten eine Unbedenklichkeitserklärung ( Teil der Diözese
Speyer liegt im Saarland). Der Eid auf die Verfassung beider Länder
wurde abgelegt, Zeugnisse überprüft und beglaubigt. Die
Veröffentlichung erfolgt am 29.August 1983. Mit Bischof Dr. Wetter
und Weihbischof Ernst Gutting wurde der Weihetag terminiert,
Talare, Mitren, Ring, Bischofsstab angefertigt und das Motto „ Deus
Salus“- Gott ist das Haus gewählt.
Bischofsweihe am Sonntag, 16. Oktober 1983 im Dom zu
Speyer durch den Amtsvorgänger Erzbischof Dr. Friedrich Wetter aus
München.
Bei der Weihe unterlief dem assistierenden Pfr. Wilhelm ein
Versprecher, denn er bat mit kräftiger Stimme, Dr. Anton Schelmbach
zum Bischof von Speyer zu weihen. Wie der Erzähler berichtet
erschrak er zunächst, dachte auch noch an das schlechte
Wetter, dann wurde aber mit dem Spruch:“ Man muss Gott für alles
danken, auch für einen Unterfranken“ die Spannung gelöst und
Beifall kam auf.
Der Festakt mit vielen prominenten Gästen und die Domnapffüllung
wurden wegen des schlechten Wetters in die Domvorhalle verlegt;
dort begrüßten die Gläubigen ihren neuen Bischof sehr herzlich.
Aktivierung der Gemeinden, Erarbeitung eines Pastoralplanes,
Vorbereitung auf das Christus-Jubiläum im Jahre 2000, ökumenische
Hospizhilfe, Stiftung für Mutter und Kind waren
Arbeitsschwerpunkte.
Bei der Zusammenkunft mit der Diözesanleitung gab Bischof
Schlembach bekannt, dass er keine Bischofserfahrung habe, von
Experimenten abrate, die vorhandene gute Struktur weiterführen
wolle, wobei er um umfassende Kooperation bat.
Mit tieftonigem Lachen ergänzte der Altbischof, „ dass ja der
Hl. Vater durch seine Berufung sicher seine segnende Hände über
Speyer halten werde“. Von der Diözesanleitung wurde
entgegnet, dass die 94-namentlich bekannten Vorgänger ein
angenehmes Christenvolk betreuten und die bereits Verstorbenen
einen natürlichen Tod hatten. Außerdem hätte es ihn als Franken
schlechter treffen können. Bayern und Pfalz gehörten doch lange
Zeit zusammen.
Dr. Schlembach führte nun seine Arbeitsbereiche wie
Dekanatsbesuche, Firmungen, Katholikentag in Johanniskreuz mit je
5000-10000 Besuchern, Wallfahrten nach Maria Rosenberg,
Blieskastel, die Hungermärsche mit über 1,4 Mill. DM als Spenden
für Hilfsprojekte, die Sternsingeraktionen mit dem höchsten
deutschen Spendenergebnis an. Auch die Städtepartnerschaften mit
Chartres, Ravenna, Gnesen und Kursk, die Dr. Schlembach als Bischof
begleitete und schuf so europaweite Kontakte für die
Kirche.
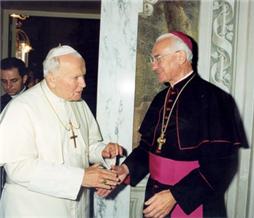 Papstbesuch am
4. Mai 1987 auf Einladung von Bischof Schlembach
Papstbesuch am
4. Mai 1987 auf Einladung von Bischof Schlembach
Bei der Bischofskonferenz 1986 wurde bekannt, dass Papst
Johannes Paul II. seinen zweiten Deutschlandbesuch plane.
Dabei sollte in Köln Edith Stein seliggesprochen werden. Der Hl.
Vater wird die Diözese besuchen, die ihn einladen wird, so die
Ansage. Nach der Zustimmung des Domkapitels schrieb der Speyerer
Bischof an den persönlichen Sekretär des Papstes, telefonierte mit
Kardinal Höffner und erhielt bald die Zusage, dass der Papst nach
Speyer kommt und von dort Deutschland verlassen wird.
Das tolle Ergebnis wurde auch dem Protestantischen
Kirchenpräsidenten mit der Bemerkung mitgeteilt, „ der Papst kommt
nach Speyer, will die Protestanten nicht zu Katholiken machen, wir
freuen uns auf den Besuch, freut euch doch auch mit uns“. Das
erfolgte auch so. Oberbürgermeister Dr. Rosskopf sah bei der
Ankündigung, „ dass Speyer schwarz von Menschen werde“, freute sich
und bot die Mithilfe bei der Organisation an.
 Papstbesuch
als größtes Ereignis
Papstbesuch
als größtes Ereignis
Am kalten 4. Mai 1987 wurden ab 6.00 Uhr entlang der
Maximilianstraße mit Klappstühlen die besten Plätze besetzt.
Nach einer Schleife über dem Dom landete der Hubschrauber um
13.00 Uhr in der Kurpfalzkaserne. Der Papst erlebte einen
einmaligen Einzug über die Via Triumphalis, vorbei an ca.60.000
Menschen, ging die Fahrt zum Bischofshaus. Dort erhielt ein
behinderter Jugendlicher vom Papst den Segen, bevor er an der Tür
Mutter Schlembach begrüßt und fragte, ob sie noch ohne Stock
gehen könne? In der Hauskapelle kniete er auf dem Betstuhl, auf dem
die nun selige Edith Stein einst das Firmsakrament empfangen
hatte.
Das Mittagessen wurde von Gastronom Graf zubereitet und
aus Sicherheitsgründen im 1. Obergeschoss eingenommen. Der
Hl. Vater sprach an den Kaisergräbern den Totenpsalm und
schaffte so eine späte Aussöhnung zwischen Kaiser- und
Papsttum.
Beim anschließenden Gottesdienst mit einer Papstpredigt über
Europa,“ war ich“, so Dr. Schlembach, „ über zwei Stunden lang
neben dem Papst, der 2. Mann der katholischen Kirche.“( Dieses Amt
fällt dem Ortsbischof zu, er steht dabei direkt rechts vom Papst).
Die Kardinäle Ratzinger, Döpfner Höffner und Casaroli ergänzten die
Zelebranten. Nach der Messfeier sprach der Papst in deutscher
Sprache zu den frierenden Gläubigen u.a., „ aber die Liebe
ist wärmer“.
 Hohe
Staatsgäste als Besucher im Dom empfangen….
Hohe
Staatsgäste als Besucher im Dom empfangen….
Ausschließlich Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl verdankte der
Altbischof die Besuche der zwölf Staatsgäste, die mit dem
Ministerpräsidenten der Volksrepublik China Zhao Zigang 1985
begannen und 1997 mit dem spanischen König Juan Carlos I. mit
seiner Frau Sophia endeten.
Ganz unprotokollarisch rief Helmut Kohl bei Dr. Schlembach
an.
„ Herr Bischof , es steht hoher Besuch ins Haus“. Name wurde
genannt, Zeit und Ablauf, (immer gleich), festgelegt und stets
eingehalten.
Die Begrüßung fand vor dem Dom statt.“ Als Hausherr erklärte
ich
1. Den Dom als einzigartiges Bauwerk- größter romanischer Dom-
einst größtes Gotteshaus der Christenheit.
2. Den Dom als Haus Europas-
Von Domhütten aus Ganz Europa geplant und
gebaut;
Ort vieler Reichstage mit europäischen
Politikinhalten;
Grablege von Kaisern und Königen.
3. Den Dom als Architektur im christlichen Credo
Spricht von Gott, von Jesus, von der Kirche
Gottes“, so Dr.Schlembach.
Domorganist Leo Krämer intonierte die Fuge d-moll von Johann
Sebastian Bach, während Apsis, Afrakapelle und die
Kaisergräber besucht wurden. Neben den Gästen waren nur der
Bischof, Weihbischof, Generalvikar, Domkustos , Kirchenpräsident,
Oberbürgermeister, Bürgermeister mit Ehefrau sowie Protokollchef
Guido Nonn zugegen. Die Presse war nicht zugelassen.
Großen Eindruck beim Besuch machten Michael Gorbatschow und
Georg Busch sen. mit ihren Frauen Reissa und Barbara, die damals
mächtigsten Männer der Welt.
Tief bewegt war Bischof Dr. Schlembach von Roman Herzog, der
gerade das Amt des Bundespräsidenten an Johannes Rau übergeben
hatte auf dem Weg von Bonn nach Landshut, in Speyer den Dom
besuchte. Er schrieb folgenden Text ins Goldene Buch: „ Meine
Amtszeit als Bundespräsident habe ich hier beendet, im Herzen des
christlichen Europa. Ich bin unendlich dankbar“.
„Welch wunderbarer Inhalt wurde hier zu Papier gebracht“, so
Bischof Schlembach.
Viele Fragen musste der Altbischof noch
beantworten.
So beschrieb er auch die wunderbaren Wanderungen vom Heldenstein
zum Taubensuhl, wobei der Wald “ihm als Freund zuhörte, nicht
widersprach und eine innere Ruhe einstellen half“.
Moderator Pfarrer Bernhard Linvers hatte eingangs den Werdegang
unseres Altbischofs vorgestellt und danach viele Fragen zum
Kirchenamt und zur Pastoral erklärt.
Mit herzlichem Applaus wurde der erste Bischof
verabschiedete, der nach seiner Emeritierung in Speyer wohnen
bleibt. Karl-Heinz Jung (khj)
09.03.2012
Tag der offenen Tür im Seniorenzentrum
Das Haus am Germansberg präsentiert sich am Samstag, dem
10. März, von 14 bis 17 Uhr bei einem Tag der offenen
Tür.
Das Seniorenzentrum der Diakonissen Speyer-Mannheim in der
Speyerer Else-Krieg-Straße 2 informiert über Wohn- und
Betreuungsangebote für Senioren im Pflegebereich und in betreuten
Wohnungen. Außerdem stehen die Pflegestützpunkte und der hauseigene
ambulante Dienst für Fragen zur Verfügung. Kaffee und Kuchen runden
das Angebot ab, für musikalische Begleitung sorgt das Duo
Miteinander unter Leitung von Johanna Lenßen.
Tag der offenen Tür im Diakonissen Seniorenzentrum Haus
am Germansberg, Else-Krieg-Straße 2, 67346 Speyer am Samstag,
10.3.2012, 14.00-17.00 Uhr
Diakonissen
Speyer-Mannheim, Presse
02.03.2012
Individuelle Computerhilfe
Der Internet-Treff des Seniorenbüros FairNet, in der
Ludwigstraße 15 b bietet am ersten Dienstag im Monat, 6. März 2012,
von 10 bis 12 Uhr individuelle Computerhilfe an. In dieser
persönlichen Einzelberatung stehen die Tutoren des Internet-Treffs
zur Beantwortung und Lösung spezieller Fragen und Computerproblemen
zur Verfügung. Dazu können die Interessierten ihren eigenen Laptop
mitbringen. Seniorenbüro Speyer, Presse
Langjähriger Chefredakteur Werner Hill spricht im Erzählcafe über „Geschichte der Speyerer Zeitung“
Wanderung durch den „Blätterwald“
„Hätte Johannes Gutenberg 1460 nicht das Drucken mit beweglichen
Lettern erfunden, würden wir heute noch vielleicht alle
Informationen nur aus dem Fernseher bekommen“, würzte Journalist
Werner Hill den Einstieg in seine Ausführungen über die „Geschichte
der Speyerer Zeitung“ mit dem ihm eigenen Humor. Im voll besetzten
Saal des Seniorenbüros lud der langjährige Zeitungsredakteur und
e9instige Chefredakteur der „Speyerer Tagespost“, von Moderator Dr.
Thomas Neubert begrüßt, die Erzählcafe-Gäste zu einem Spaziergang
durch den 290 Jahre alten Speyerer „Blätterwald“.
Es dauerte nach Gutenbergs Erfindung mehr als 200 Jahre, bis
Jakob Christian Kolb (Vater von Georg Friedrich Kolb) im September
1783 die erste „Speierische Wochenschrift“ herausbrachte. Kolb war
es auch, der von 1816 bis 1818 die „Neue Speierer Zeitung“ verlegte
und druckte. Von 1817 bis 1868 informierte dann die Familie
Kranzbühler mit Anzeige-Blättern über das Geschehen in und um die
Kreishauptstadt. Julius Kranzbühler übernahm 1905 den
von L. Gilardone bereits 1869 ins Leben gerufenen „Speierer
Anzeiger“ und baute diesen zur „Speyerer Zeitung“ und zum
„Generalanzeiger für Schifferstadt“ aus. Die zuletzt von
Chefredakteur Dr. Richard Mandler geführte und populäre „Spyerer
Zeitung“ wurde ebenso 1936 eingestellt wie die parallel dazu 1934
von der Jagerischen Buchdruckrei in Speyer gedruckte und
herausgegebene „Pfälzer Zeitung“. Deren Verlagerung zur
Südpfälzischen Verlagsanstalt Landau-Speyer verhalf der „Pfälzer
Zeitung“ noch zu zwei weiteren Jahren. Von 1907 bis 1933 verlegte
noch die Jaegerische Buchdruckerei in Speyer das „Rheinische
Volksblatt“. Das amtliche Organ für den Amtsgerichtsbezirk Speyer
war besonders unter der Bezeichnung „Schwarz-Kattel“ bekannt. Die
Einstellungen der Publikationen im Vorfeld des Zweiten Weltkrieges
wurden nach Angaben Hills meist mit Papiermangel begründet. Von
1931 bis 1939 setzte sich die NSZ-Rheinfront (Verlage in
Kaiserslautern und Neustadt) durch, von 1940 bis 1945 erschienen
nur die NSZ-Westmark, die amtliche Tageszeitung der NSDAP für den
Gau Westmark, Ausgabe Landau-Speyer, 1943 und 1944 in Ludwigshafen
zusätzlich die NAZ (Neue Abendzeitung für den Gau Westmark,
Bezirksausgabe Pfalz.
Waren die in Speyer vor dem Zweiten Weltkrieg herausgebrachten
Publikationen nicht periodisch, also täglich oder zu festen Zeiten
wöchentlich, und meist nur aus besonderen Anlässen erschienen,
begann danach die Zeit der Abonnementzeitungen und der
Boulevardpresse. Gleich 1946 kam in Ludwigshafen die „Rheinpfalz“
auf den Markt, anfänglich mit nur drei Ausgaben pro Woche. Die
Lizenzzeitung, die von den Siegermächten die Lizenz erhalten hatte,
schuf das System der Lokalausgaben mit einem Mantelteil
(überregionale Berichterstattung aus Politik, Kultur, Wirtschaft,
Zeitgeschehen und Sport) und erscheint seit der Währungsreform 1948
täglich. Erst 1952 gab der Klambt-Verlag mit der „Speyerer
Tagespost“ in der Domstadt eine Konkurrenzblatt heraus. Der
zunächst für den Mantel der „Tapo“ herangezogene Materndienst (mit
andernorts vorgefertigten Druckvorlagen) wurde 1970 eingestellt und
fortan der Mantelteil vom „Mannheimer Morgen“ bezogen. Nach 47
Jahren verkaufte Klambt die „Tapo“ an die Mannheimer Mediengruppe
Haas, die den „MM“ herausgibt. Zum 31.Dezember 2002 wurde die
beliebte Lokalzeitung mit zuletzt rund 5000 Abonnenten eingestellt.
Die seit 2003 erscheinende „Speyerer Morgenpost“ des Viernheimer
Verlegers Wolfgang Martin hat mit der einstigen „Tapo“ nichts zu
tun und profitierte lediglich vom Stamm der Abonnenten, klärte Hill
auf. Auch die zur Haas-Gruppe gehörende „Schwetzinger Zeitung“, vom
letzten Tagespost-Chefredakteur Jürgen Gruler geleitet, ist seitdem
mit Speyerer Lokalnachrichten auch linksrheinisch auf dem
Markt.
Der Speyerer Redakteur ließ nicht unerwähnt, dass von 1953 bis
1965 der SPD-Verlag Neustadt „Die Freiheit“ herausgab, mit der
späteren Bundestagsabgeordneten Luise Herklotz als Ressortleiterin,
und von 1951 bis 1962 noch „Der Pfälzer“ als Wochenzeitung für
christliche Politik und Kultur herauskam. Wöchentlich erscheinen
die in Speyer beheimaten Kirchenzeitungen „Der Pilger“ und der
„Kirchenbote“. Großer Beliebtheit erfreue sich auch die
Wochenzeitung „Durchblick“, in weiten Teilen auch online
nachzulesen unter www.speyer-aktuell.de. Und nur
im Internet abrufbar sei Lokales unter www.speyer-kurier.de.
In der nachfolgenden Gesprächsrunde auf die Zukunft der
Tageszeitung befragt, wies Hill auf die Veränderungen der
Medienwelt und die dadurch für Abonnementzeitungen entstehenden
Schwierigkeiten und Umdenkungsprozesse bezüglich der nachwachsenden
Leserschaft hin. Der erfahrene Zeitungsmann malte die Zukunft für
die gedruckte Information nicht zu düster und schloss mit Goethe:
„Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost
nach Hause tragen.“ ws
08.02.2012
Im Alter „sicher fit unterwegs“
Vortragsreihe gibt Senioren Tipps und Informationen über
richtiges Verhalten zu Hause und unterwegs / Landesweit
einzigartiges Kooperationsprojekt von Landesverkehrswacht, Polizei
und Apotheken
Wie bei der Veranstaltung „Senioren sicher im Internet“ 2011
versprochen, bietet das Generationenbüro der Stadt Schwetzingen
erneut eine interessante und informative Schulung für die
„Generation 60+“ kostenlos an. „sicher fit unterwegs“ nennt sich
die dreiteilige Veranstaltungsreihe, die den Erhalt sicherer
Mobilität für Senioren zur gemeinsamen Aufgabe hat. In drei
Vortragsveranstaltungen, für die nur eine einmalige Anmeldung
erforderlich ist, informieren die Kooperationspartner zu ihren
Themenbereichen im Palais Hirsch am Schwetzinger Schlossplatz.
Der Landesapothekerverband informiert über die Risiken von
Arzneimitteln im Straßenverkehr. Die Generation 65 plus nimmt 63
Prozent der Arzneimittel ein – gleichzeitig stellen die Senioren
nur 19 Prozent der Bevölkerung. Viele nehmen mehr als fünf
Medikamente täglich ein. Bei dieser Anzahl von Arzneimitteln sind
Neben- und Wechselwirkungen nicht kontrollierbar. Gleichzeitig
ermöglicht die regelmäßige Einnahme von Medikamenten vielen Älteren
(bei Bluthochdruck- oder Diabetes-Patienten) erst die Teilnahme am
Straßenverkehr. Ist der Patient unsicher, sollte er sich in der
Apotheke individuell beraten lassen.
Bei ihrem Vortrag gibt die Polizei Tipps für das Verhalten im
Straßenverkehr. Ob als Radfahrer, Fußgänger oder Nutzer von
öffentlichen Verkehrsmitteln: Senioren sind bei tödlichen
Verkehrsunfällen mit einem Anteil von 25 Prozent überproportional
vertreten. Weiterhin warnt sie die älteren Mitbürger vor den
alltäglichen Gefahren, die an der Haustür oder auf der Straße
lauern. So zum Beispiel vor Trickbetrügern, unseriösen Hausierern
oder Handtaschendieben. Dabei werden Senioren nicht häufiger Opfer
von Straftaten als andere Altersgruppen, sie fühlen sich aber
deutlich unsicherer. Die Veranstaltung gibt Tipps, wie solche
Situationen der Unsicherheit gemeistert werden können.
Die Landesverkehrswacht bietet zum Thema: sicheres Bewegen in
der Öffentlichkeit ihren Vortrag an. Hier werden Kenntnisse zu
Verkehrsregeln aufgefrischt und über Änderungen informiert. Auch
technische Hilfsmittel im Auto wie die Einparkhilfe oder der
Rückspiegel, der Einblicke in den „toten Winkel“ ermöglicht, sind
Themen dieses Teils. Ziel ist, die Senioren nicht aus der Übung
kommen zu lassen, damit sie möglichst lange aktiv und selbstständig
bleiben.
Die Termine sind am 23. März vom Landesapothekerverband, am 30.
März von der Polizei und am13. April von der Landesverkehrswacht,
immer im Palais Hirsch am Schlossplatz ab 14:30 Uhr. Die Vorträge
können nur im Zusammenhang besucht werden, eine Einzelanmeldung für
nur eine Veranstaltung ist nicht möglich. Eine vorherige Anmeldung
ist aber unbedingt erforderlich. Örtliche Seniorenclubs, Vereine
oder Seniorentreffs werden über die Veranstaltungsreihe schriftlich
informiert.
Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, bittet das Generationenbüro
der Stadt Schwetzingen um eine verbindliche Anmeldung unter der
Telefonnummer 06202/95067-93/94 oder per E-Mail: generationenbuero@schwetzingen.de.
Personen ohne vorherige Anmeldung können leider nicht eingelassen
werden. Informationen zur Vortragsreihe "sicher - fit - unterwegs"
und weitere Tipps für Senioren erhalten Sie im Generationenbüro,
Schlossplatz 4 oder im Internet unter www.schwetzingen.de, www.sicherfit-unterwegs.de,
www.lvw-bw.de , www.polizei-bw.de oder www.apotheker.de. Stadtverwaltung
Schwetzingen, Presse
30.01.2012
10-jähriges Jubiläum Seniorenresidenz Sankt-Sebastian Dudenhofen am 14.1.2012
.jpg) Am 14.1.2012
wurde in der Senioren-Residenz Sankt-Sebastian das 10jährige
Jubiläum gefeiert. Zu diesem Festtag waren sehr viele geladene
Gäste, Bewohner, Angehörige und Freunde des Hauses gekommen. Der
festlich dekorierte Speisesaal war voll besetzt.
Am 14.1.2012
wurde in der Senioren-Residenz Sankt-Sebastian das 10jährige
Jubiläum gefeiert. Zu diesem Festtag waren sehr viele geladene
Gäste, Bewohner, Angehörige und Freunde des Hauses gekommen. Der
festlich dekorierte Speisesaal war voll besetzt.
Zu Beginn der Festveranstaltung sang Frau Körner-sie wurde am
Klavier von Frau Karin Schellenberger begleitet- ein Lied von
Mozart vor.
Frau Ehrhardt-Steck begrüßte im Anschluß alle Festgäste
und bedankte sich in ihrer Ansprache bei Ihren Mitarbeitern für den
vorbildlichen Einsatz und die geleistete Arbeit und betonte,
dass ohne einem gut funktionierendem Team eine erfolgreiche
Arbeit nicht zu schaffen ist.
Herr Bochem-Geschäftsführer der Incura-Gruppe gratulierte Frau
Ehrhardt-Steck zum Jubiläum und bedankte sich für die gute
Zusammenarbeit.
Danach trug Frau Körner mit ihrer Begleitung ein weiteres Lied
vor und begeisterte mit ihrer Sopranstimme das Publikum. Einige
Gäste, die das Lied kannten, summten im Hintergrund mit.
Nun sprach Landrat Clemens Körner ein paar Grußworte und
berichtete über den Weg, wie es zu der Errichtung der
Seniorenresidenz in Dudenhofen unter seiner Tätigkeit als Orts- und
Verbandbürgermeister gekommen ist und welche Hürden zu überwinden
waren. Er bedankte sich auch bei den vielen ehrenamtlichen Helfern,
die viele Stunden mit den Senioren verbringen und mit dazu
beitragen, dass sich die Bewohner heimisch in der
Senioren-Residenz fühlen.
Herr Bürgermeister Eberhardt richtete noch Grüsse der Orts-und
Verbandsgemeinde aus und bedankte sich für die gute Zusammenarbeit
auch mit den Vereinen in der Ortsgemeinde, die gerne auch hier in
der Senioren-Residenz gastieren und den Bewohner eine Freude
bereiten.
.jpg) Einige
Mitarbeiter(Frau Heim-Ullrich, Herr Stein,Frau Dix, Frau
Dobberstein, Frau Schütz, Frau Hook, Frau Schäfer) sind schon von
Beginn an dabei und feierten ihr 10jähriges Dienstjubiläum und
wurden von Frau Ehrhardt-Steck geehrt.
Einige
Mitarbeiter(Frau Heim-Ullrich, Herr Stein,Frau Dix, Frau
Dobberstein, Frau Schütz, Frau Hook, Frau Schäfer) sind schon von
Beginn an dabei und feierten ihr 10jähriges Dienstjubiläum und
wurden von Frau Ehrhardt-Steck geehrt.
Auch drei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, Frau Lutz, Frau
Malmer, Frau Nord unterstützen die Betreuung von Anfang an.
Herr Patzer von der Offenen Selbsthilfegruppe bedankte sich in
seiner Grußrede bei seinen vielen Helfern und erinnerte auch
nochmal an den Gründer der Selbsthilfegruppe Herr Roman Patzer, der
leider im vorletzten Jahr verstorben ist
.jpg) Zum Abschluß
des Festprogramms trat die Volkstanzgruppe Mutterstadt in einer
schönen, traditionellen Tracht auf und brachte auch ihre
guten Wünsche zum Jubiläum mit vier volkstümlichen Tänzen.
Zum Abschluß
des Festprogramms trat die Volkstanzgruppe Mutterstadt in einer
schönen, traditionellen Tracht auf und brachte auch ihre
guten Wünsche zum Jubiläum mit vier volkstümlichen Tänzen.
Nun lud Frau Ehrhardt-Steck noch zum Sektempfang und einem
kleinen Imbiß ein, den unser Küchenchef mit seinem Team anbot. Es
wurde noch bis in den Abend viel geredet und Erfahrungen und Ideen
ausgetauscht.
Im Speisesaal war ein grundiertes Mosaik-Bild aufgehängt und die
Festgäste hatten die Gelegenheit ein Teilbild zu malen und viele
beteiligten sich mit ihrer Malkunst. Dieses Bild ist eine bleibende
Erinnerung an die schöne und erfolgreiche Jubiläumsfeier. Julia
Schütz
19.01.2012
Weiberbratenverein im Erzählcafé…
Vor genau 306 Jahren wurde das brennende
Gutleuthaus in Speyer von Milchfrauen aus Berghausen
gelöscht……
Durch das beherzte Eingreifen von 59 Berghäuser
Milchfrauen wurden die Lebrakranken und ihr Gutleuthaus
gerettet.
 Wie in der
Gutleuthaus-Allmosenrechnung Anno 1716 vermerkt ist, erhalten
die Frauen von Berghausen für die „rettende Tat“ jedes Jahr ein
Legat von 14 Pfund (7kg) Ochsen und 14 Pfund Schweinefleisch.
Wie in der
Gutleuthaus-Allmosenrechnung Anno 1716 vermerkt ist, erhalten
die Frauen von Berghausen für die „rettende Tat“ jedes Jahr ein
Legat von 14 Pfund (7kg) Ochsen und 14 Pfund Schweinefleisch.
Dramatiker Martin Greif, Volkskundler Dr. Albert Becker und
viele andere loben die Hilfsbereitschaft der Frauen in Gedichten,
Berichten und Liedern. Alle fünf Jahre wird in Berghausen das „
Weiberbratenfest“ gefeiert.
Den zeitgeschichtlichen Hintergrund zeigte der ehemalige
Beigeordnete Richard Entzminger anhand einer Foto-Show und
Gebietskarten aus dem 16. Jahrhundert auf.
Das brennende Speyer von 1689 infolge des „Pfälzischen
Erbfolgekrieges“(Erbe v Lieselotte von der Pfalz wurde von Ludwig
XIV. verlangt). Weiter brachte der „Spanische Erbfolgekrieg“
Zerstörung, große Not und furchtbares Elend über unsere Heimat, so
Entzminger.
Gruppenfotos von Weiberbratenfesttagen ab 1901 mit bis zu 300
Frauen verdeutlichten die Bedeutung des Festes. Die
Oberbürgermeister Dr. Christian Rosskopf, Werner Schineller und
Hansjörg Eger überbrachten jeweils das Legat der Stadt Speyer.
Ingrid Simon, Edith Gegenhuber, Margarete Kögel und Inge Walburg
in historischer Winterkleidung mit Milchkübeln aus Holz,
stellten die Verbindung zu 1706 her…..
Wie Frau Simon unterhaltsam erzählte, stand das „ Gutleuthaus“ (
für Menschen mit ansteckenden Krankheiten z.B. Lebra) an der
heutigen „Germersheimer Straße“, die bis ins 18. Jh. „ Gutleutweg“
hieß. (Bei der Neutrassierung der Lstr. 507/ B9/B39 wurden
Mauerreste und Gräber gefunden).
Im eiskalten Januar 1706, alle Bäche waren gefroren , gingen 59
Milchfrauen nach Speyer um dort Milch zu verkaufen. Als die Frauen
Rauch und Flammen am „Gutleuthaus“ sahen, handelten sie schnell,
indem sie mit der Milch das Feuer löschten. Bewohner und Haus
wurden gerettet. Dafür erhielten sie immer am 6. Januar die besagte
Fleischmenge mit einem „Trunck“ Wein im Gesamtwert von ca. 5
Gulden, so die Gutleut- Allmosenrechnung von 1716. Der „Braten für
die Weiber“ wurde dann von Berghäuser Frauen verspeist.
In den französischen Revolutionsjahren ( 1794- 1814) war das
Legat ausgeblieben. Die Frauen schrieben an das königliche
Landkommissariat,“ dass die Regierung das Hospital (Bürgerhospital
als Träger der Gesundheitsfürsorge) zur Entrichtung der
Gratification veranlassen solle“.
Im Jahre 1799, so Simon, wurde von der franz. Verwaltung
angeordnet, das Legat „ solle in Geld von der
Bürgerhospital-Stiftung“ ausbezahlt werden.
Seit 1949 wird der jeweilige Oberbürgermeister von Speyer zum
Festakt eingeladen, wobei das „Legat“ mit der Bemerkung,“ ohne
Anerkennung einer Rechtspflicht“, übergeben wird.
Berghäuser Milchfrauen in Medien des 19/20.
Jahrhunderts…
Wie Edith Gegenhuber ausführte, wird über die Taten der
„Berghäuser Weiber“in vielfacher Weise berichtet. Über ein halbes
Dutzend Gedichte „lobpreisen die Hilfeleistungen für
Notleidende“.
Bereits 1844 verfasste Christian Heinrich Gilardone „Die Weiber
von Berghausen“.
Die bekannteste Fassung schuf der 1834 in der Webergasse zu
Speyer geborene Dramatiker
Friedrich Hermann Frey, der sich ab 1882 den Künstlernamen
Martin Greif zulegte ( Im April 2011 wurde in der Pfaffengasse eine
Martin- Greif- Stube eingerichtet).
„ Die Frauen von Berghausen“ von Frey, stammt wohl aus der 2.
Hälfte des 19. Jhd., wurde erstmals in dem Berliner Familienblatt
„Die Gartenlaube“ veröffentlicht und 1902 in der „Neue Lieder und
Mähren“ Sammlung Frey´s abgedruckt.
In vielen Schulbüchern war das Gedicht vorzufinden, zu lernen
und kann noch heute von den 60-70-jährigen mit allen Versen
rezitiert werden. Frau Gegenhuber konnte beim Vortrag den
strengen Winter 1706, das entschlossene Handeln der Milchweiber den
Zuhörern anschaulich vermitteln.
Der Weiberbraten in unserer Zeit…..
Wie Margarete Völcker erklärte, dürfen nur verheiratete Frauen
am Festmahl teilnehmen. Danach geht es mit Musik durch das Dorf, um
besonderen Persönlichkeiten eine Aufwartung zu machen. Den
Zuschauern wird als „ Milchersatz“ Narrenberger-Wein (Flurnamen)
angeboten.
Aus bayrischer- und französischer Zeit bestehen noch
Teilnehmerlisten, denn das hohe königlich-bayrische Bezirksamt
genehmigte das „ Weiberfest“ erst, nachdem die Namen der Frauen mit
Unterschrift vorlagen. Fünf-Markzwanzig kostete die
Genehmigung.
Am Abend durften auch die Männer beim Festball mittanzen. Die „
Tanzlustbarkeit war bis Sonntag 6.00 Uhr beschränkt“, so
Völcker.
Von 1911- 1921 und während des II. Weltkriegs fielen die Feste
aus. Seit 1949 wird alle fünf Jahre wieder kräftig gefeiert, die
Fahne geweiht, Kleidung geschneidert und auf Vorschlag von
Bürgermeister Kögel am 22.8.1969 der „Weiberbratenverein“
gegründet.
Feste feiern wie sie fallen…..
So berichtete die Vorsitzende Inge Walburg, welche die
Vorstandstradition der Straub/ Walburg Familien fortsetzt.
Für Berghausen war die 300-Jahrfeier 2006 der Höhepunkt. Bei
herrlichem Sonnenschein zog ein umfangreicher Festzug durch das
Dorf. Angeführt von den „Jubiläumsschärpen“und der neuen Samtfahne
mit Silberfadenstickerei. Dabei Bürgermeister Manfred
Scharfenberger mit Gattin im edlen Gewand des Fürstenpaares Thurn
und Taxis, die einst als hohe Gäste dem Fest beiwohnten.
Königsbesuch aus Edenkoben, alte Hochzeitszüge mit schwarzen
Brautkleidern, junge Nachwuchskräfte im „Milchkannenlook“, das
Gutleuthaus- Modell und der Speyerer- Festwagen; letzterer als Dank
für die jährliche Teilnahme am Brezelfestumzug.
Inge Walburg und ihr Team unterstützen soziale Aufgaben, spenden
für krebskranke-, strahlengeschädigte Kinder und seit der
Gründung die „Lebenshilfe“.
Karin Ruppert lobte die damalige und heutige Tätigkeit der
Weiberbratenfrauen. Sie trug ihr Weiberbratengedicht in
Pfälzer–Mundart vor, in dem der enttäuschte Mann einer Milchfrau
von 1706 beruhigt wird.
Herzlich bedankte sich Moderator Karl-Heinz Jung beim
Weiberbratenteam, lobte die Vorbildfunktion, die auch für die
Mitmenschen immer Bestand haben sollte.
05.01.2012
„Wir freuen uns auf viel Leben im Haus“
 Im
Rhein-Pfalz-Stift ist der Alltag eingekehrt / Kunterbunter
Veranstaltungskalender
Im
Rhein-Pfalz-Stift ist der Alltag eingekehrt / Kunterbunter
Veranstaltungskalender
Der Jahreswechsel ist vielerorts die Zeit der Besinnung und der
Rückschau – so auch im Rhein-Pfalz-Stift, das im September in
Waldsee eröffnet hat. Die neue Pflegeeinrichtung im Neubaugebiet
Lausbühl bietet 85 vollstationäre und Kurzzeitpflegeplätze. Die
Einzelzimmer sind ebenso wie die großzügigen Gemeinschaftsräume
hell und freundlich gestaltet, das moderne Hausgemeinschaftskonzept
sorgt für reges Leben innerhalb des Hauses. Wir haben mit der
Heimleiterin Angelika Kortyka gesprochen.
Frau Kortyka, haben Sie sich bereits in Waldsee
eingelebt?
Angelika Kortyka: Ja, auf alle Fälle! Wir wurden hier so
freundlich in der Gemeinde aufgenommen. Viele Vereine kamen schon
zu uns ins Haus und haben uns und die Bewohner besucht oder nutzen
unsere Räumlichkeiten für Veranstaltungen. Wir freuen uns schon auf
die kommenden Monate – unser Veranstaltungskalender ist prall
gefüllt und wir hoffen, dass wir viele Gäste im Rhein-Pfalz-Stift
begrüßen dürfen. Darüber hinaus gibt es bereits Pläne für
regelmäßige Angebote für Groß und Klein.
Und die Bewohner fühlen sich wohl im
Rhein-Pfalz-Stift?
Angelika Kortyka: Natürlich ist der Umzug von den eigenen
Wänden in eine Pflegeeinrichtung immer ein großer und sehr
emotionaler Schritt. Doch unsere Bewohner leben sich hier wirklich
schnell ein und fühlen sich sichtlich wohl. Das liegt zum einen
sicherlich daran, dass die Zimmer ganz nach eigenem Geschmack
eingerichtet und gestaltet werden können. Wir bieten eine
Grundmöblierung an – bis auf das Pflegebett ist aber alles
individuell veränderbar. Zum anderen liegt das sicher an unserem
hochmotivierten Team. Alle Kollegen sorgen sehr liebevoll dafür,
dass sich unsere Bewohner hier wohlfühlen – wie in einer großen
Familie.
Haben Sie denn noch Platz für Neuaufnahmen?Und wie sieht es
aus mit dem Verkauf der Pflegeapartments?
Angelika Kortyka: Wir haben natürlich langsam angefangen
– das Haus war neu, das Team war neu, da musste sich erstmal alles
zusammenfinden. Und für die Bewohner ist es hilfreich, wenn sie
ganz in Ruhe einziehen und alles erkunden können. Das braucht Zeit
– und die geben wir unseren Bewohnern genauso wie uns. Deshalb
haben wir durchaus noch Kapazitäten frei und freuen uns auf noch
mehr Leben im Haus. Die Pflegeapartments sind binnen kurzer Zeit
verkauft gewesen – sehr zur Freude des Investors.
Was bieten Sie denn überhaupt alles an im
Rhein-Pfalz-Stift?
Angelika Kortyka: Neben der klassischen vollstationäre
Pflege nehmen wir auch Gäste in Kurzzeitpflege auf, eventuell
werden wir unser Angebot noch um Tages- und Nachtpflege erweitern –
hier kommt es auf die Nachfrage an. Und natürlich überlassen wir
unsere Cafeteria oder andere Gemeinschaftsräume gerne für
Veranstaltungen aller Art. Das Rhein-Pfalz-Stift ist ein offenes
Haus, eine Begegnungsstätte für Jung und Alt.

Kontakt:
Rhein-Pfalz-Stift
Sophie-Scholl-Str. 1
67165 Waldsee
Telefon 06 236 / 44 94-0
E-Mail rheinpfalzstift@dus.de
www.avendi-Senioren.de
29.12.2011
Jung erfreut Alt mit Adventskonzert
 Mit einer
besonderen Form des ehrenamtlichen Engagements erfreuten junge
Musiker am 17. Dezember die Bewohnerinnen und Bewohner des
Seniorenzentrums Haus am Germansberg.
Mit einer
besonderen Form des ehrenamtlichen Engagements erfreuten junge
Musiker am 17. Dezember die Bewohnerinnen und Bewohner des
Seniorenzentrums Haus am Germansberg.
Das Ensemble „Dr. No’s Bande“ der Städtischen Musikschule
verbreitete mit Solo- und Ensembledarbietungen besinnliche
Weihnachtsstimmung. Die 40 jungen Musikerinnen und Musiker boten
unter Leitung von Margarethe Hoffer ein buntes Programm, das von
traditionellen Weihnachtsliedern wie „Oh du fröhliche“ über die
„Weihnachtsbäckerei“ von Rolf Zuckowski bis zum ersten Satz von
Vivaldis Konzert in G-Dur reichte.
„Der Nachmittag hat unseren Bewohnerinnen und Bewohnern viel
Freude gemacht“, sagt Heimleiter Klaus-Dieter Schneider, der neben
dem musikalischen Genuss vor allem die Bedeutung der Begegnung
zwischen Jung und Alt im Rahmen des Konzerts hervorhebt. „Vier
Ensemble-Mitglieder haben sich sogar bereit erklärt, eine
Stationsweihnachtsfeier musikalisch zu begleiten“, freut sich auch
Katharina Kieselhorst vom Sozialkulturellen Dienst über den
freiwilligen Einsatz der jungen Leute. Diakonissen
Speyer-Mannheim, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
20.12.2011
Halbjahresprogramm des Erzählcafés 2012
Halbjahresprogramm des Erzählcafés 2012 mit mutigen,
reaktionsschnellen Frauen, dem Universalgelehrten J.J. Becher aus
Speyer, der Speyerer Zeitungsgeschichte, Erlebnisse und
Erfahrungen unseres Altbischofs Dr. Anton Schlemmbach,
Feuerwehraktionen, Tabakanbau und der Zigarrenproduktion
sowie Bau der VdK- Siedlung als Hilfe zur
Selbsthilfe……..
Am 3. Januar 2012, 15.00 Uhr werden die „
Weiberbratenfrauen“ von Berghausen berichten, wie im Jahre 1706
durch mutiges, beherztes Eingreifen der Marktfrauen die Flammen des
Speyerer- Gutleuthauses gelöscht wurden und warum noch heute das
„Weiberbratenfest“ gefeiert wird.
Am 7. Februar, 15. Uhr wird der ehemalige
Chefredakteur Werner Hill im Maulbronner Hof die Geschichte der „
Speyerer Zeitung“ vorstellen. Hierbei werden auch das „ Hambacher
Fest“ und die Speyerer Kämpfer für die Freiheit des Wortes
gewürdigt.
Die Erfahrungen und Erlebnisse, die Altbischof Dr. Anton
Schlemmbach in den 25 Jahren seiner Bischofstätigkeit als „ Franke“
in Speyer hatte, werden am 6. März, 15.00 Uhr im
Maulbronner Hof viele interessierte Zuhörer finden.
Am 3. April 15.00 Uhr wird der langjährige
Speyerer Feuerwehrkommandant Friedel Flörchinger über
Aktionen Feuerwehr in „Kriegs-, Notzeiten und im Alltag“, im
Historischen Ratssaal berichten.
Den Bogen der Geschichte zum Universalgelehrten Johann Joachim
Becher, der 1635 in Speyer geboren wurde,“ hochgelobt und viel
geschmäht“, der viele praktikable Vorschläge zu Ordnungs-,
Wachstums-, Bevölkerungs- und Bildungspolitik aufzeigte, werden
Prof. Dr. Carl Böhret und Dipl. Ing. Willi Philippe am 8.
Mai 14.30 und 16.00 Uhr im Becherhaus schlagen.
Vom wichtigen „Tabakanbau und der Zigarrenproduktion in Speyer“
werden Firmennachkomme Töns Wellensiek, der Zigarrensachverständige
mit Brasilien- Erfahrung Günter Hechler und Tabakverkaufsleiter
Klaus Mayrhofer am 5. Juni 15.00 Uhr in der Villa
Ecarius erzählen.
„Die VdK- Siedlung in Speyer-West,- eine Hilfe zur Selbsthilfe“
von Stadtrat Otto Winter einst organisiert, verhalf vielen Menschen
zu Haus und Garten. Hans Winter (Sohn), Prof. Dr. Otto Roller, Emil
Magin u.a. werden am 3. Juli 15.00 Uhr im Haus
Pannonia, Friedrich-Ebert-Str. 106 darüber sprechen.
15.12.2011
Weihnachtsgebäck, Musik und Geschichten im Erzählcafe
 Speyer- Köstliches
Weihnachtsgebäck, wohlklingende Adventsmusik und in die
Vorweihnachtszeit passende Gedichte und Geschichten ließen das
Dezember-Erzählcafe im voll besetzten Veranstaltungsraum des
Seniorenbüros im Maulbronner Hof für die Besucher zu einem
stimmungsvollen Nachmittag werden. Mit Erinnerungen aus seiner
Kindheit in Mitteldeutschland (bei Magdeburg)
bereicherte Dr.Thomas Neubert als einfühlsamer
Moderator die adventliche Kaffeestunde, die obendrein noch einen
Ausflug in eine fremde Kultur brachte. Denn das Römerberger Ehepaar
Hermann und Wilma Kögel, das 1997 im Selbstverlag ein (aufgrund der
eigenen Rezepturen leider völlig vergriffenes) Backbuch
herausgebracht hatte, lebte lange Zeit in Schweden und hat im
Seniorenbüro-Saal nun erzählt über das Luciafest, das in dem
nordeuropäischen Land am 13.Dezember gefeiert wird. Traditionell
gibt es zur Lucia-Feier rund um die längste Nacht des Jahres
hauchdünne Pfefferkuchen und goldgelbe „Luciakatzen“ (kleine
Hefeteigfiguren mit viel Safran). Körbchen mit Kostproben von
beidem hat die leidenschaftliche Hobbybäckerin Wilma Kögel zum
Kaffee herumreichen lassen. Hermann Kögel brachte fürs Seniorenbüro
ein von ihm gemaltes Bild mit. Es zeigt drei junge Frauen, von
denen eine eine Lucia-Krone (Kopfleuchter mit Kerzen) trägt. An
vielen schwedischen Schulen werden junge Mädchen jedes Jahr zu
einer Lucia gewählt.
Speyer- Köstliches
Weihnachtsgebäck, wohlklingende Adventsmusik und in die
Vorweihnachtszeit passende Gedichte und Geschichten ließen das
Dezember-Erzählcafe im voll besetzten Veranstaltungsraum des
Seniorenbüros im Maulbronner Hof für die Besucher zu einem
stimmungsvollen Nachmittag werden. Mit Erinnerungen aus seiner
Kindheit in Mitteldeutschland (bei Magdeburg)
bereicherte Dr.Thomas Neubert als einfühlsamer
Moderator die adventliche Kaffeestunde, die obendrein noch einen
Ausflug in eine fremde Kultur brachte. Denn das Römerberger Ehepaar
Hermann und Wilma Kögel, das 1997 im Selbstverlag ein (aufgrund der
eigenen Rezepturen leider völlig vergriffenes) Backbuch
herausgebracht hatte, lebte lange Zeit in Schweden und hat im
Seniorenbüro-Saal nun erzählt über das Luciafest, das in dem
nordeuropäischen Land am 13.Dezember gefeiert wird. Traditionell
gibt es zur Lucia-Feier rund um die längste Nacht des Jahres
hauchdünne Pfefferkuchen und goldgelbe „Luciakatzen“ (kleine
Hefeteigfiguren mit viel Safran). Körbchen mit Kostproben von
beidem hat die leidenschaftliche Hobbybäckerin Wilma Kögel zum
Kaffee herumreichen lassen. Hermann Kögel brachte fürs Seniorenbüro
ein von ihm gemaltes Bild mit. Es zeigt drei junge Frauen, von
denen eine eine Lucia-Krone (Kopfleuchter mit Kerzen) trägt. An
vielen schwedischen Schulen werden junge Mädchen jedes Jahr zu
einer Lucia gewählt.
Ursula Wörn (am Klavier) sorgte im Einklang mit Inge Wettmann
(Geige) nicht nur für musikalische Untermalung, sondern
kredenzte den Besuchern das Weihnachtsgebäck, mit dem sie vor zwei
Jahren bei einem Wettbewerb der „Rheinpfalz“ den zweiten Preis
belegt hatte. Ihre schmackhaften Haferflockenplätzchen waren
schnell in aller Munde. Und die mit Texten versorgten Senioren
sangen begeistert mit bei „Lasst uns froh und munter sein“ und
„Sankta Lucia“.
Mit einem Gedicht über den Wandel des Weihnachtsfestes trug Ilse
Schall zum besinnlichen Teil des Nachmittags bei. Hermann Vögeli
erinnerte an die überwiegend traurigen Weihnachtstage von 1943 bis
1950, als die meisten Familien nicht einmal etwas zu essen hatten,
von Weihnachtsgebäck und Geschenken ganz zu schweigen. Zum
Erzählcafe-Abschluss spielten Inge Wettmann und Ursula Wörn
vierhändig auf dem Klavier „Peterchens Schlittenfahrt“.
Für alle, die sich gerne selbst einmal an den leckeren
„Gebäcksel“ versuchen möchten, haben Wilma Kögel und Ursula Wörn
ihre Rezepte zur Verfügung gestellt.
Schwedische Pfefferkuchen
Zutaten:
300 g Butter, 150 g Rübensirup, 300 g Zucker, 1 EL Zimt, 1 EL
Ingwer, ¼ TL gem. Nelken, 150 g Wasser, 800 g Mehl, 1 EL Natron
Zubereitung:
Butter erwärmen, Sirup, Zucker und Gewürze zugeben und das
Wasser unterrühren. Mehl mit Natron vermischt unterarbeiten und den
Teig einige Stunden ruhen lassen, bis er formbar ist. Stangen oder
Rollen formen von ca. 4 bis 6 cm Durchmesser, ca. 3 Stunden ins
Gefrierfach geben, mit der Brotschneidemaschine in dünne Scheiben
schneiden und bei 175 Grad wenige Minuten backen.
Haferflockenplätzchen
Zutaten:
250 g kernige Haferflocken, 200 g Butter, 100 g Mehl, 1
ge-strichener TL Backpulver, 180 g Zucker, 1 Päckchen
Vanillezucker, 1 Ei, Haselnüsse
Zubereitung:
Haferflocken mit kochender Butter übergießen, verrühren,
erkalten lassen. Danach Mehl/Backpulvergemisch dazugeben, dann
Zucker, dann das Ei. Den krümeligen Teig gut durchmischen. Kleine
Häufchen auf ein Blech, belegt mit Backpapier, geben. Auf jedes
Häufchen eine Haselnuss setzen. 15 bis 20 Minuten bei 200 Grad
backen. ws; Foto:k-h-j
08.12.2011
Seniorenbeirat mit umfangreicher Tagesordnung berät in der Villa Ecarius….
 Barrierefreiheit,
Seniorenservice, Nachlese, Vorschau der Beiratsarbeit, Berichte der
Arbeitskreise Kultur und Verkehr, Überlegungen über „ Leitpfade“
waren die Themen.
Barrierefreiheit,
Seniorenservice, Nachlese, Vorschau der Beiratsarbeit, Berichte der
Arbeitskreise Kultur und Verkehr, Überlegungen über „ Leitpfade“
waren die Themen.
Der Leiter der VHS Ewald Gaden begrüßte den Seniorenbeirat,
stellte die Bildungs -einrichtungen wie Musik-, Volkshochschule,
die Stadtbücherei vor und konnte von steigenden Angeboten und
Nutzungen berichten.
Vorsitzender Ludwig Schultheis bedankte sich bei Gaden und hieß
Bürgermeisterin Monika Kabs, Frau Krampitz und Herrn Herrling
willkommen. In einem kurzen Statement stellte Kabs die
Überarbeitung einer Info-Broschüre für Senioren unter Mitarbeit des
Seniorenbeirats in Aussicht.
Frau Birgit Welke von der städtischen Wirtschaftsförderung
besprach verschiedenen Seniorenservice und Barrierefreiheit, wie
Wohn-, Freizeit- Leben- bzw. barrierefreies Einkaufen für die
Generation 50+,wodurch ein selbstständiges Leben auf Dauer und
nachhaltig zu gestalten sei. Bauliche Standards, Servicegrundlagen
wie Hauswirtschaftsleistungen, Essen auf Rädern, Einkaufen,
Fahrdienste sind darunter zu verstehen.
Wohnen in der eigenen Wohnung könne so lange gewährleistet
werden. Wohnen im Mehrgenerationenhaus , der Wohngemeinschaft von
Senioren sowie Alten- u. Pflegeheime wurden vorgestellt und mit
Beispielen aus Speyer ergänzt. Der Freizeitservice, organisiert von
90 Ehrenamtlichen, lädt zu Tages-, Mehrtagesfahrten,
Stadtführungen, Internetttreff, Sprach- Handarbeitsstunden, zum
Erzählcafé ein und erfreut sich in Speyer reger Teilnahme.
Frau Welge stellte einen umfangreichen Katalog vor, wie
Geschäfte durch Umbaumaßnahmen Barrierefreiheit ermöglichen.
Als neues Projekt wurde „Die nette Toilette“ besprochen. Hierbei
wird mit städtischer Hilfe ein flächendeckendes Netz von frei
zugänglichen Toiletten in Gaststätten geschaffen und mit einem Logo
darauf hingewiesen. Klärungsfragen stehen noch an, während in 90
Städten dies bereits Standard ist.
Über den Aktionsplan der Landesregierung „Gut Leben im Alter“
berichtete Vorsitzender Schultheis. Im Bericht wurden auch die
Gespräche mit Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Bürgermeisterin Kabs
und dem Seniorenbeirat erwähnt, wobei es um die Erhaltung des
Seniorenbüros und der Mitarbeiter ging.
Als Vorschau wird ein Aktionstag 2012 angedacht,
worüber in der Februarsitzung diskutiert werden soll.
Helma Rieser, vom Arbeitskreis Kultur, berichtete von gut
besuchten Museums- u. Ausstellungsführungen (Salier, Judaica
etc).Eine Führung durch die „Speyerer Synagoge“ ist für 2012
vorgesehen.
Herr Thomas Zander und Herr Uwe Rudingsdorfer stellten im
Arbeitskreis Verkehr den jetzigen Stand des
Verkehr-Entwicklungs-Plans vor, wie Karl-Heinz Jung ausführte.
Der Arbeitskreis gab den aufgeschlossenen „Städtischen“
Forderungen der Senioren/Innen mit auf den Planungsweg:
Zügige Barrierefreiheit durch Randsteinabsenkung schaffen,
-
Kreuzungsbereiche überschaubarer gestalten( Schumacher-
Iggelheimer Straße),
-
Radwegbeschilderung bzw. Radweg- nur in zwingenden Fällen
entfernen,
-
Linienpläne des ÖPNV an neue Wohngebiete, bzw. Zentren
schaffen,
-
Haltemöglichkeit am Ärztezentrum für „Frischoperierte“
ermöglichen,
-
Linienpläne seniorengerecht gestalten (Anbringung, Schrift),
-
Sitzbänke im Innenstadtbereich und in Freizeitzonen auch in
„Sitzhöhe“ für Senioren bereitstellen.
Wie Jung berichtet, wird Thomas Zander in der März/April Sitzung
des Beirates den VEP im Seniorenbeirat vorstellen. Die
Stadtteilveranstaltungen, bei denen der VEP erklärt wird,
sollten zur Information besucht werden.
Unter „Verschiedenes“ stellte Klaus Bohn „Leitpfade“ für
Seniorenbeauftragte vor, die in einer Frühjahrssitzung diskutiert
werden können. Karl-Heinz Jung
01.12.2011
Trickdiebstahl im Seniorenheim
 (Ludwigshafen)
– Am Dienstag, 22.11.2011, gegen 10.30 Uhr, erschien ein
bislang unbekannter Mann an der Wohnung eines 78-jährigen Seniors
in einem Seniorenheim in der Pranckhstraße. Der Unbekannte gab vor,
nach dem Fernseher des 78-Jährigen schauen zu wollen, weil das
Gerät auf das digitale Programm umgestellt werden solle. Daraufhin
ließ der Senior den Unbekannten in die Wohnung, der dann wohl einen
unbeobachteten Moment nutzte um mehrere hundert Euro Bargeld aus
der Jackentasche des Wohnungsinhabers zu entwenden.
(Ludwigshafen)
– Am Dienstag, 22.11.2011, gegen 10.30 Uhr, erschien ein
bislang unbekannter Mann an der Wohnung eines 78-jährigen Seniors
in einem Seniorenheim in der Pranckhstraße. Der Unbekannte gab vor,
nach dem Fernseher des 78-Jährigen schauen zu wollen, weil das
Gerät auf das digitale Programm umgestellt werden solle. Daraufhin
ließ der Senior den Unbekannten in die Wohnung, der dann wohl einen
unbeobachteten Moment nutzte um mehrere hundert Euro Bargeld aus
der Jackentasche des Wohnungsinhabers zu entwenden.
Der Geschädigte war kurz vor der Tat bei seiner Bank und hatte
sich einen größeren Bargeldbetrag am Schalter auszahlen lassen. Im
Nachhinein erinnerte er sich an eine junge Frau in der Bank, die
ganz in der Nähe gestanden war und ihn möglicherweise dabei
beobachtet hatte.
Täterbeschreibung:
Ca. 19 Jahre alt, ca. 175 cm groß, schlank, osteuropäisches
Aussehen, sprach mit osteuropäischem Akzent, dunkle Jacke,
Pullover, Jeans, blaue Turnschuhe.
Hinweise an die Kriminalinspektion Ludwigshafen, Tel. 0621
963-1163.
24.11.2011
Alpenverein im Erzählcafe
 Speyer- Dass die
Sektion Speyer im Deutschen Alpenverein (DAV) mit über 1200
Mitgliedern zu den größten Vereinen der Domstadt zählt, wissen die
wenigsten. Und sie ist sehr aktiv: Es gibt eine große Wandergruppe,
andere klettern gemeinsam, und es gibt natürlich auch viele
„Älpler“, die richtig Berge besteigen. Und das nicht immer nur in
den Alpen, wie der langjährige Vorsitzende (1983 bis 97) und
heutige Ehrenvorsitzende Emil Nord beim Erzählcafe des
Seniorenbüros eindrucksvoll schilderte. Im Mittelpunkt seiner
Erzählungen über das Vereinsleben im größten und ältesten
Naturschutzverein Deutschlands stand eine einmonatige Expedition im
Jahre 1993, die Nord zusammen mit 17 weiteren Alpenfreunden zum so
genannten „Dach der Welt“, zum Bergsteigen ins
zentralasiatische Pamirgebirge, führte.
Speyer- Dass die
Sektion Speyer im Deutschen Alpenverein (DAV) mit über 1200
Mitgliedern zu den größten Vereinen der Domstadt zählt, wissen die
wenigsten. Und sie ist sehr aktiv: Es gibt eine große Wandergruppe,
andere klettern gemeinsam, und es gibt natürlich auch viele
„Älpler“, die richtig Berge besteigen. Und das nicht immer nur in
den Alpen, wie der langjährige Vorsitzende (1983 bis 97) und
heutige Ehrenvorsitzende Emil Nord beim Erzählcafe des
Seniorenbüros eindrucksvoll schilderte. Im Mittelpunkt seiner
Erzählungen über das Vereinsleben im größten und ältesten
Naturschutzverein Deutschlands stand eine einmonatige Expedition im
Jahre 1993, die Nord zusammen mit 17 weiteren Alpenfreunden zum so
genannten „Dach der Welt“, zum Bergsteigen ins
zentralasiatische Pamirgebirge, führte.
Mit herrlichen Aufnahmen der Berge in den Alpen führte Moderator
Karl-Heinz Jung die Erzählcafe-Besucher in das Thema ein, ehe Nord
zunächst in die Geschichte des Alpenvereins und der Sektion Speyer
einführte. Der Alpenverein wurde 1869 in München gegründet, als
privater Klub zur Förderung des Fremdenverkehrs in den verarmten
Alpenregionen Bayerns und Oesterreichs. Nach dem Krieg 1951
wiedergegründet, wuchs die Mitgliederzahl ständig an. 1974 gehörten
bereits 287 326 Mitglieder aus 248 Sektionen mit 248 Hütten
dem DAV an, heute sind es rund 893000 Mitglieder in 353 regionalen
Vereinen, beim Alpenverein Sektionen genannt. DER DAV betreut
mittlerweile 326 öffentlich zugängliche Berg- und Schutzhütten in
den Alpen und deutschen Mittelgebirgen. Jährlich werden dort über
zwei Millionen Tagesgäste gezählt und 800000 Übernachtungen
registriert. Zudem unterhält der DAV 200 Kletteranlagen und zählt
30 000 Besucher im Haus des Alpinismus auf der Münchner
Praterinsel. Der Speyerer Ehrenvorsitzende würdigte auch die Arbeit
der ca. 12 200 vom DAV ausgebildeten ehrenamtlichen Kursleiter für
alle Formen des Bergsports und derr Familien-, Kinder- und
Jugendarbeit.
 Die Sektion
Speyer wurde 1899 in der Gaststätte „Zur Sonne“ (später Wienerwald,
dann McDonalds, jetzt Gerry Weber) gegründet und war laut Nord
zunächst „ein elitärer Verein“(mit Kgl.Bayerischem Major,
Bankdirektor, und kgl. Regierungskommissär) . Für die Aufnahme
brauchten Interessenten zwei Bürgen. Nach einem Film von Luis
Trenker von der Bergwelt fasziniert, wollte Nord 1950 als
17-Jähriger in den Alpenverein eintreten. Da habe ihn der damalige
Vorsitzende gefragt, was er denn alles schon gemacht und somit
vorzuweisen habe. Nord verbildlichte diese Nachfrage: „Das ist so,
wie wenn man zum Klavierlehrer kommt und der fragt, wo man schon
überall gespielt hat.“ Wenn dieser Vorsitzende wüsste, dass der
junge Bergfreund später 14 Jahre lang den Verein führte und
inzwischen sein Ehrenvorsitzender ist, „würde er sich wohl im Grab
rumdrehen“, meinte Nord. Besonders aktiv ist heute in der Sektion
Speyer neben der engagierten Jugendgruppe die von Helga und
Reinhard Gruner geleitete Seniorengruppe, bei der sich nicht alles
nur ums Wandern und Bergthemen dreht, sondern auch „Kultur
angesagt ist“.
Die Sektion
Speyer wurde 1899 in der Gaststätte „Zur Sonne“ (später Wienerwald,
dann McDonalds, jetzt Gerry Weber) gegründet und war laut Nord
zunächst „ein elitärer Verein“(mit Kgl.Bayerischem Major,
Bankdirektor, und kgl. Regierungskommissär) . Für die Aufnahme
brauchten Interessenten zwei Bürgen. Nach einem Film von Luis
Trenker von der Bergwelt fasziniert, wollte Nord 1950 als
17-Jähriger in den Alpenverein eintreten. Da habe ihn der damalige
Vorsitzende gefragt, was er denn alles schon gemacht und somit
vorzuweisen habe. Nord verbildlichte diese Nachfrage: „Das ist so,
wie wenn man zum Klavierlehrer kommt und der fragt, wo man schon
überall gespielt hat.“ Wenn dieser Vorsitzende wüsste, dass der
junge Bergfreund später 14 Jahre lang den Verein führte und
inzwischen sein Ehrenvorsitzender ist, „würde er sich wohl im Grab
rumdrehen“, meinte Nord. Besonders aktiv ist heute in der Sektion
Speyer neben der engagierten Jugendgruppe die von Helga und
Reinhard Gruner geleitete Seniorengruppe, bei der sich nicht alles
nur ums Wandern und Bergthemen dreht, sondern auch „Kultur
angesagt ist“.
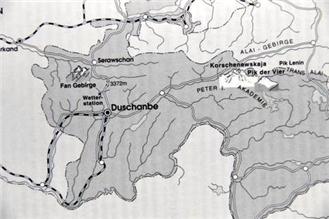 1991 beschlossen
Nord und andere „Älpler“, dass sie sich auf die Spuren des
deutschen Forschers Rieckmer-Rieckmers, der 1928 das Pamirgebirge
erkundete und die Erstbesteigung des 7 134 Meter hohen Pik Lenin
leitete, begeben wollten. Auf diese Idee brachten sie Sportler aus
der Partnerstadt Kursk, die beim Kanuclub zu Gast waren und über
Rudi Unser nachfragen ließen, ob Speyerer Alpinisten nicht
Lust hätten, die Berge in der heutigen GUS zu besteigen. Es war von
Tien Shan, Kaukasus und Pamir die Rede, erinnerte Nord. Über die
Kursker kam der Alpenverein in Kontakt mit einem Sportclub aus
Odessa, der Berrgsteigertouren organisiert. Da Nord und sein Sohn
Stefan als ausgebildete Führungskräfte schon immer vom Bergsteigen
an den hohen Pamir-Bergen träumten, wurde die Forschungsreise
beschlossen. Welche Hindernisse in der nahezu zwei Jahre
dauernden Vorplanung zu überwinden waren, schilderte Emil Nord mit
nachempfindbarer Begeisterung. Erstes Problem war die Größe der
Gruppe.
1991 beschlossen
Nord und andere „Älpler“, dass sie sich auf die Spuren des
deutschen Forschers Rieckmer-Rieckmers, der 1928 das Pamirgebirge
erkundete und die Erstbesteigung des 7 134 Meter hohen Pik Lenin
leitete, begeben wollten. Auf diese Idee brachten sie Sportler aus
der Partnerstadt Kursk, die beim Kanuclub zu Gast waren und über
Rudi Unser nachfragen ließen, ob Speyerer Alpinisten nicht
Lust hätten, die Berge in der heutigen GUS zu besteigen. Es war von
Tien Shan, Kaukasus und Pamir die Rede, erinnerte Nord. Über die
Kursker kam der Alpenverein in Kontakt mit einem Sportclub aus
Odessa, der Berrgsteigertouren organisiert. Da Nord und sein Sohn
Stefan als ausgebildete Führungskräfte schon immer vom Bergsteigen
an den hohen Pamir-Bergen träumten, wurde die Forschungsreise
beschlossen. Welche Hindernisse in der nahezu zwei Jahre
dauernden Vorplanung zu überwinden waren, schilderte Emil Nord mit
nachempfindbarer Begeisterung. Erstes Problem war die Größe der
Gruppe.
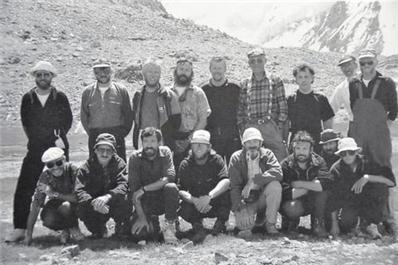 Je mehr
Teilnehmer es waren, desto niedriger konnte der Preis kalkuliert
werden. Je größer die Gruppe werden würde, desto geringer war
die Chance, alle Bergsteiger bis zu den Gipfeln zu bekommen. Nicht
gerechnet hatte Nord mit der enorm großen Zahl der Interessenten
aus ganz Deutschland. So erfolgte die Auswahl nach der Reihenfolge
der Anmeldung. Von den letztlich 18 Pamir-Fahrern kamen vier aus
der Sektion Speyer und die anderen aus der gesamten Pfalz. Dank
einiger Sponsoren konnte der Preis für die gewaltige Bergtour auf
rund 3000 Mark kalkuliert werde. Zusammenstellen der Ausrüstung,
Besorgen der Visa und Überprüfen der Sportlichkeit aller
Pamir-Freunde schilderte der damalige Vereinschef ebenso
eindrucksvoll wie das Problem mit der rund eine Tonne schweren
Gesamtausrüstung (Schlafsäcke, Zelte, Kocher, Kleidung,
Spezialschuhe) und das Verstauen der Fracht auf dem Frankfurter
Flughafen. Am 16.Juli 1993 ging endlich der Flieger Richtung Kiew.
Zur Überraschung der Pfälzer hatte sich die Gruppe aus Odessa
mittlerweile aufgelöst und wurde die Betreuung der Deutschen von
einem Moskauer Klub übernommen, „was vielleicht unser Glück war“,
kommentierte Nord. Überaus abenteuerlich am nächsten Tag der
Weiterflug in einem zweimotorigen Propeller-Frachtflugzeug Antonow
26B. Zwischen ihrem Gepäck sitzend landete das Alpenvereinteam
(nach Zwischenlandung auf Wüstenflugplatz Krasnovodsk in
Turkmenistan) mitten in der Nacht in Duschambe. Am nächsten Tag
ging’s dann mit Lkw und Kleinbussen hinauf in die Berge ins
über 4200 Meter hoch gelegene Basislager Moskwin zum Pik
Korschenewskkaja/Pik Kommunismus, wo’s zur Begrüßung einen
ausgezeichneten Natur-Pfefferminztee gab.
Je mehr
Teilnehmer es waren, desto niedriger konnte der Preis kalkuliert
werden. Je größer die Gruppe werden würde, desto geringer war
die Chance, alle Bergsteiger bis zu den Gipfeln zu bekommen. Nicht
gerechnet hatte Nord mit der enorm großen Zahl der Interessenten
aus ganz Deutschland. So erfolgte die Auswahl nach der Reihenfolge
der Anmeldung. Von den letztlich 18 Pamir-Fahrern kamen vier aus
der Sektion Speyer und die anderen aus der gesamten Pfalz. Dank
einiger Sponsoren konnte der Preis für die gewaltige Bergtour auf
rund 3000 Mark kalkuliert werde. Zusammenstellen der Ausrüstung,
Besorgen der Visa und Überprüfen der Sportlichkeit aller
Pamir-Freunde schilderte der damalige Vereinschef ebenso
eindrucksvoll wie das Problem mit der rund eine Tonne schweren
Gesamtausrüstung (Schlafsäcke, Zelte, Kocher, Kleidung,
Spezialschuhe) und das Verstauen der Fracht auf dem Frankfurter
Flughafen. Am 16.Juli 1993 ging endlich der Flieger Richtung Kiew.
Zur Überraschung der Pfälzer hatte sich die Gruppe aus Odessa
mittlerweile aufgelöst und wurde die Betreuung der Deutschen von
einem Moskauer Klub übernommen, „was vielleicht unser Glück war“,
kommentierte Nord. Überaus abenteuerlich am nächsten Tag der
Weiterflug in einem zweimotorigen Propeller-Frachtflugzeug Antonow
26B. Zwischen ihrem Gepäck sitzend landete das Alpenvereinteam
(nach Zwischenlandung auf Wüstenflugplatz Krasnovodsk in
Turkmenistan) mitten in der Nacht in Duschambe. Am nächsten Tag
ging’s dann mit Lkw und Kleinbussen hinauf in die Berge ins
über 4200 Meter hoch gelegene Basislager Moskwin zum Pik
Korschenewskkaja/Pik Kommunismus, wo’s zur Begrüßung einen
ausgezeichneten Natur-Pfefferminztee gab.
Da es für eine gemeinsame Tour zu viele Teilnehmer waren, ging
es in den nächsten Tagen gruppenweise mit drei bis fünf
Bergsteigern nach oben. Details von den doch schwierigen Aufstiegen
trug nun auch Pamir-Teilnehmer Manfred Sydow bei, der es ebenso am
Pik Korschenewskaja auf über 7105 Meter Höhe schaffte und
einräumte, „die letzten Meter waren oft schwer zu bewältigen“.
Zum Abschluss der Pamir-Tour erstatteten die Bergsteiger
noch dem Kreml in Moskau einen Besuch ab, ehe es nach den vier
Abenteuer-Wochen wieder nach Hause zu den besorgten Familien
ging.
Der Deutsche Alpenverein brachte zur Forschungsreise ein
80-seitiges Heftchen mit Erlebnisberichten von allen
Teilnehmern mit dem Titel „Pamir „93“ heraus. Text:ws,
Fotos:khj
05.12.2011
„Über diesen Facharzt hört man nur Gutes, er ist ein anerkannter Psychopath.“
.jpg) Speyer. „Keine Stadt
in Deutschland weist ein so altes Klinikwesen auf wie Speyer“,
behauptet Dr.Adalbert Orth. Der Sanitätsrat war in vielen
Funktionen als Mediziner ehrenamtlich engagiert und stand unter
anderem 25 Jahre lang an der Spitze der Ärztlichen Kreisvereinigung
Speyer und plauderte nun im von Karl-Heinz Jung moderierten
„Ezählcafe“ des Seniorenbüros im gut besuchten Versammlungsraum des
Maulbronner Hofs über die medizinische Versorgung von Speyer und
freimütig aus dem Nähkästchen, sprich: aus der Praxis. Und da kam
einiges zusammen. Schließlich haben sich ja schon Großvater Daniel
und Onkel Bernhard Orth in Speyer als Ärzte einen Namen gemacht.
Und Tochter Anna-Marie setzt die Orthsche Tradition fort.
Speyer. „Keine Stadt
in Deutschland weist ein so altes Klinikwesen auf wie Speyer“,
behauptet Dr.Adalbert Orth. Der Sanitätsrat war in vielen
Funktionen als Mediziner ehrenamtlich engagiert und stand unter
anderem 25 Jahre lang an der Spitze der Ärztlichen Kreisvereinigung
Speyer und plauderte nun im von Karl-Heinz Jung moderierten
„Ezählcafe“ des Seniorenbüros im gut besuchten Versammlungsraum des
Maulbronner Hofs über die medizinische Versorgung von Speyer und
freimütig aus dem Nähkästchen, sprich: aus der Praxis. Und da kam
einiges zusammen. Schließlich haben sich ja schon Großvater Daniel
und Onkel Bernhard Orth in Speyer als Ärzte einen Namen gemacht.
Und Tochter Anna-Marie setzt die Orthsche Tradition fort.
Die Geschichte Speyers beginnt nach Orths Dafürhalten mit einem
Frauenkopf. Im Jahr 1974 wurde im Binsfeld der Schädel einer Frau
geborgen, die nach den Forschungsergebnissen bereits vor 22000
Jahren hier gelebt haben soll.
Bereits vor dem 13.Jahrhundert bestand bei der zum Germansstift
gehörenden St.Stefanskapelle das alte Domstiftische Spital. 1220
übergab Bischof Konrad von Metz und Speyer die an den
Bischofssitzen zu Speyer gelegene, dem Dom als stiftisches Spital
zugehörige Anstalt den Deutschordensbrüdern. Möglicherweise befand
sich eine Krankenpflegegenossenschaft von 1239 im Leprosenspital
St.Nikolaus zu Speyer, blickte der Arzt weiter in die medizinische
Stadtgeschichte zurück.
1261 wurde in Speyer eine Dreierpflegeschaft für das
St.Georgen-Spital festgelegt. Selten hatten die Spitäler damals
eigene Ärzte. Der Stadtmedicus versorgte die Kranken. Ihm wurden
ein „Apothekersknecht“ und eine Doktorsmagd“ zugebilligt, erzählte
Orth weiter. Die „Spitäler“ seien auch Stätten medizinischer Pflege
gewesen. Mitte des 12.Jahrhunderts wurde das Spital bei der
Ägidienkirche, ein Jahrhundert später das Spital bei St.Stefan und
ebenfalls Mitte des 13.Jahrhunderts das Spital bei St.Georg
gegründet, auf welches nach Orths Recherche das heutige
Stiftungskrankenhaus zurückgeht.
.jpg) Bekanntlich
ist die Heidelberger Universität die älteste auf deutschem Boden.
Aber schon lange vor ihrer Gründung waren in den rheinischen
Städten Heilkundige anzutreffen, die den Titel medicus oder
physicus führten und demnach als studierte Ärzte anzusehen waren.
In Deutschland wurde damals die Arzneikunde nur in Klostern und
Domschulen gepflegt. Es ist anzunehmen, so denkt Orth, dass an der
Speyerer Domschule Medizin gelehrt wurde, längst bevor die erste
deutsche medizinische Fakultät, 1390 an der Universität Heidelberg
gegründet, Medizin vermittelte.
Bekanntlich
ist die Heidelberger Universität die älteste auf deutschem Boden.
Aber schon lange vor ihrer Gründung waren in den rheinischen
Städten Heilkundige anzutreffen, die den Titel medicus oder
physicus führten und demnach als studierte Ärzte anzusehen waren.
In Deutschland wurde damals die Arzneikunde nur in Klostern und
Domschulen gepflegt. Es ist anzunehmen, so denkt Orth, dass an der
Speyerer Domschule Medizin gelehrt wurde, längst bevor die erste
deutsche medizinische Fakultät, 1390 an der Universität Heidelberg
gegründet, Medizin vermittelte.
Mitte des 15.Jahrhunderts blühte die Medizin in der Pfalz
besonders, was einerseits mit der Förderung durch die Speyerer
Bischöfe und andererseits mit dem Aufschwung der Buchdruckerkunst
zwischen Mainz und Straßburg zusammenhing. Ende des 15.Jahrhunderts
wurde in Speyer wegen Seuchen und ansteckender Krankheiten ein
Stadtarzt angestellt. 1533 wurde die Domstadt von der Lues
heimgesucht. Im Oktober brach ein großes Sterben über die Stadt
herein, und erst im Juni 1540 klang die Seuche ab. Die Stadtväter
und der Stadtarzt beschlossen im 16.Jahrhundert eine
Verordnung, die Weisheit und für die damalige Zeit erstaunliche
medizinische Kenntnisse verriet. Auch dass alle, auch die Ärmsten,
mit Nahrung und Medikamenten zu versorgen sind, war verordnet
worden.
Desweiteren erinnerte Dr.Orth an den Speyerer
„Artztneien-Docktor“ Johann Joachim Becher, der von 1635 bis 1682
lebte und bei Erzbischof Johann Phillip von Mainz das Amt eines
Mathematicus und Medicus versah.
In der Gegenwart angekommen, würdigte der engagierte Mediziner
„die medizinische Großtat“, die dem Speyerer Hals-, Nasen-Ohrenarzt
Dr.Reinhard Seithel gelang. Der Sanitätsrat entwickelte eine
Methode, mit der man mittels der Neuraltherapie auf die
Rachendachhypophyse heilend einwirken kann. Orth erläuterte, dass
hierdurch das im gesamten Hormonsystem des Menschen übergeordnete
Organ, das Bindeglied zwischen Gehirn und Drüsensystem, beeinflusst
werden kann. Speyer ist seitdem auch Sitz der Akademie für
Neuraltherapie, die es sich zum Ziel gesetzt hat, diese Heilmethode
in die Lehrmedizin zu integrieren. Die Akademie, in der sich auch
Dr.Orth einbrachte, hat schon sehr viel deutsche und ausländische
Ärzte „in dieser äußerst nebenwirkungsarmen, aber auch sehr
effektiven Heilmethode ausgebildet“.
.jpg) Heute sei die
Domstadt medizinisch bestens mit Krankenhäusern, über das Ärztenetz
PRAVO (Praxisnetz Vorderpfalz), Ökumenischer Sozialstation,
Ärztlichen Notfalldienst, mit einem rührigen Kneipp-Verein
sowie guten Physio- und Ergotherapeuten versorgt. Auch das
Hospiz im Wilhelminenstift und das Sterntaler-Kinderhospiz leisten
segensreiche Arbeit, betonte Orth .
Heute sei die
Domstadt medizinisch bestens mit Krankenhäusern, über das Ärztenetz
PRAVO (Praxisnetz Vorderpfalz), Ökumenischer Sozialstation,
Ärztlichen Notfalldienst, mit einem rührigen Kneipp-Verein
sowie guten Physio- und Ergotherapeuten versorgt. Auch das
Hospiz im Wilhelminenstift und das Sterntaler-Kinderhospiz leisten
segensreiche Arbeit, betonte Orth .
Auch auf die veränderten Arbeitsbedingungen und
Verkehrsverhältnisse ging Orth ebenso ein. Sein Großvater Daniel,
Chefarzt am Stiftungskrankenhaus, sei jeden Morgen von Bellheim
nach Speyer gelaufen. Er selbst habe sich in seiner Funktion als
Vorsitzender der Ärztlichen Kreisvereinigung mit Nachdruck und
vielen Leserbriefen für den Bau der Umgehung eingesetzt, da Ärzte
und Rettungsfahrzeuge sehr häufig in Ludwigstraße oder
Johannesstraße in Staus steckengeblieben seien.
Geschickt würzte der Referent seinen Vortrag über die
medizinische Versorgung in der Domstadt mit ein paar amüsanten
Anekdoten und spaßigen Verwechslungen aus seinem langjährigen
Berufsleben, wie etwa diesen gut gemeinten Ratschlag einer
Patientin: „Über diesen Facharzt hört man nur Gutes, er ist ein
anerkannter Psychopath.“ Sein Onkel Bernhard Orth habe oftmals
nachts im Krankenhaus operiert und sei erst morgens heimgekommen
und habe ein Mal angesichts der Schlange vor seiner Praxis Stühle
vor die Tür getragen und gesagt: „Schee, dass ihr all do seid, do
bin ich nedd so alläh.“ ws Foto: khj
05.10.2011
Wohl der Mitarbeitenden auch zum Wohl der Bewohner
 Kfm. Vorstand Friedhelm Reith, Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Vorsteher Dr. Werner Schwartz und Heimleiter Klaus-Dieter Schneider (vordere Reihe v. l.) bei der Ergebnispräsentation
Kfm. Vorstand Friedhelm Reith, Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Vorsteher Dr. Werner Schwartz und Heimleiter Klaus-Dieter Schneider (vordere Reihe v. l.) bei der Ergebnispräsentation
Das Seniorenstift Bürgerhospital hat in einem
18monatigen Projekt seine Arbeitsabläufe in der Altenpflege
analysiert und verbessert. Am 31. August wurden die Ergebnisse in
von al.i.d.a in Anwesenheit von Oberbürgermeister Hansjörg Eger und
Bürgermeisterin Monika Kabs in Speyer vorgestellt.
al.i.d.a steht für Arbeitslogistik in der Altenpflege und hat
zum Ziel, dass Mitarbeitende in der Pflege entspannt, in
angemessener Zeit und somit gesundheitsförderlich ihre Arbeit
erledigen können. „Nur mit motivierten, zufriedenen und gesunden
Mitarbeitenden können wir die hohe Betreuungsqualität für unsere
Bewohner sichern“, begründet Heimleiter Klaus-Dieter Schneider,
warum sich die Einrichtung an dem Projekt der Berufsgenossenschaft
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) beteiligt hat.
Starke soziale Sachzwänge und ein hoher Zeitdruck seien
charakteristisch in der Pflege, erklärte auch Pflegedienstleiterin
Sabine Seifert am Mittwoch in Speyer: „Wenn dadurch das
Wohlbefinden der Mitarbeitenden beeinträchtigt wird und die
psychischen Anforderungen steigen, kann das zu Krankheiten der
Mitarbeitenden und zu einer sinkenden Betreuungsqualität führen“,
sagte sie. Eine weitere Folge könne eine hohe Fluktuation in den
Pflegeberufen sein, so Manfred Erkelenz, Technischer
Aufsichtsbeamter der BGW Bezirksstelle Mainz, der erläuterte, warum
die Berufsgenossenschaft ein solches Projekt ins Leben gerufen
habe: „Unser Ziel ist, arbeitsschutzgerechtes und
gesundheitsförderliches Arbeiten in den Pflegealltag zu
integrieren.“
 An
diesem Ziel hat das Seniorenstift Bürgerhospital, geleitet von
einem externen Moderator, eineinhalb Jahre gearbeitet: Zunächst
wurden mit einem anonymen Fragebogen Mitarbeitende zu ihrer
Tätigkeit befragt und die Pflegetätigkeiten digital erfasst. Die
daraus gewonnen Erkenntnisse über Arbeitsabläufe und Schwachstellen
flossen in der Folge in Arbeitsgruppen ein, die sich mit
Einzelfragen befassten und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiteten.
„Sehr wichtig war, dass das Projekt von Anfang an transparent war.
Wir haben die Mitarbeitenden von Beginn an eingebunden, so dass sie
sich sehr engagiert beteiligt haben“, freut sich Sabine Seifert
über die gemeinsame Arbeit am Projekt. „Nun müssen wir darauf
achten, dass wir die gewonnen Erkenntnisse und Ergebnisse auch in
Zukunft in unserem Alltag berücksichtigen, um uns auch weiter
optimal um unsere Bewohner kümmern zu können.“ Dem schloss sich
auch Pfarrer Dr. Werner Schwartz, Vorsteher der Diakonissen
Speyer-Mannheim, an. Er gratulierte dem Seniorenstift zu der
erfolgreichen Durchführung des Projektes und betonte: „Die
Mitarbeitenden sind für uns ein hohes Gut. Sie sorgen dafür, dass
alte, kranke und behinderte Menschen sowie Kinder und Jugendliche
in den Einrichtungen der Diakonissen Speyer-Mannheim Betreuung und
Unterstützung finden.“ Diakonissen Speyer-Mannheim, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit Dr. Katja Jewski
An
diesem Ziel hat das Seniorenstift Bürgerhospital, geleitet von
einem externen Moderator, eineinhalb Jahre gearbeitet: Zunächst
wurden mit einem anonymen Fragebogen Mitarbeitende zu ihrer
Tätigkeit befragt und die Pflegetätigkeiten digital erfasst. Die
daraus gewonnen Erkenntnisse über Arbeitsabläufe und Schwachstellen
flossen in der Folge in Arbeitsgruppen ein, die sich mit
Einzelfragen befassten und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiteten.
„Sehr wichtig war, dass das Projekt von Anfang an transparent war.
Wir haben die Mitarbeitenden von Beginn an eingebunden, so dass sie
sich sehr engagiert beteiligt haben“, freut sich Sabine Seifert
über die gemeinsame Arbeit am Projekt. „Nun müssen wir darauf
achten, dass wir die gewonnen Erkenntnisse und Ergebnisse auch in
Zukunft in unserem Alltag berücksichtigen, um uns auch weiter
optimal um unsere Bewohner kümmern zu können.“ Dem schloss sich
auch Pfarrer Dr. Werner Schwartz, Vorsteher der Diakonissen
Speyer-Mannheim, an. Er gratulierte dem Seniorenstift zu der
erfolgreichen Durchführung des Projektes und betonte: „Die
Mitarbeitenden sind für uns ein hohes Gut. Sie sorgen dafür, dass
alte, kranke und behinderte Menschen sowie Kinder und Jugendliche
in den Einrichtungen der Diakonissen Speyer-Mannheim Betreuung und
Unterstützung finden.“ Diakonissen Speyer-Mannheim, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit Dr. Katja Jewski
Foto-2: Pflegedienstleitung Sabine Seifert (rechts)
erläutert Ergebnisse einer Arbeitsgruppe
01.09.2011
Rauch wabert durch den Raum - Feuerwehr in vier Minuten vor Ort
 Während dem
Abendessen im Wohnbereich „Lausbühl“ wabert plötzlich Rauch durch
den Raum, binnen kürzester Zeit breitet er sich aus; das Zimmer
einer bettlägerigen Bewohnerin ist völlig verqualmt. Schnell
erfolgt der Anruf bei der örtlichen Feuerwehr, und nur 4 Minuten
später biegt das Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn um
die Ecke - ein Szenario, das so hoffentlich niemals Realität wird.
Im RHEIN-PFALZ-STIFT in Waldsee wurde kurz vor der Eröffnung der
Ernstfall geprobt. Die „Bewohner“ werden von den Mitarbeitern der
stationären Pflegeeinrichtung dargestellt, fürs Abendessen sorgt
Heimleiterin Angelika Kortyka. Und bei Pizza stimmen sich die
Kollegen auf ihre Rollen ein, haben sichtlich Spaß.
Während dem
Abendessen im Wohnbereich „Lausbühl“ wabert plötzlich Rauch durch
den Raum, binnen kürzester Zeit breitet er sich aus; das Zimmer
einer bettlägerigen Bewohnerin ist völlig verqualmt. Schnell
erfolgt der Anruf bei der örtlichen Feuerwehr, und nur 4 Minuten
später biegt das Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn um
die Ecke - ein Szenario, das so hoffentlich niemals Realität wird.
Im RHEIN-PFALZ-STIFT in Waldsee wurde kurz vor der Eröffnung der
Ernstfall geprobt. Die „Bewohner“ werden von den Mitarbeitern der
stationären Pflegeeinrichtung dargestellt, fürs Abendessen sorgt
Heimleiterin Angelika Kortyka. Und bei Pizza stimmen sich die
Kollegen auf ihre Rollen ein, haben sichtlich Spaß.
Doch dann wird es ernst. Im dichten Rauch ist die Hand vor Augen
nicht mehr zu sehen. Erzeugt wird er von einer Nebelmaschine, die
in regelmäßigen Abständen für Nachschub sorgt, so dass der
komplette Wohnbereich binnen kürzester Zeit eingenebelt ist. Wie
die Hobby-Schauspieler schnell feststellen, ist es doch
beängstigend, hier auszuharren, bis die Feuerwehrleute mit
Atemschutzgerät endlich zu ihnen vorgedrungen sind.
Im Einsatz sind heute die Wehren aus Altrip und Neuhofen –
einige Einsatzkräfte aus Waldsee, die die Rettung per Drehleiter
vom Dach üben wollten, werden schon kurz nach dem Eintreffen wieder
abgezogen: Ein echter Einsatz hat Vorrang.
 Nach und nach
werden die „verletzten Bewohner“ aus der Wohnküche geborgen, zu Fuß
oder auf Tragen ins Freie geschafft. Alle treffen sich am
Sammelfahrzeug, wo sie mit Decken und Getränken versorgt werden –
inzwischen hat es angefangen zu regnen, die wärmenden Umhänge
kommen also gerade recht. Um die Ecke biegt ein Notarztwagen, in
dem ein bewusstloser „Bewohner“ und die „Verletzten“ versorgt
werden. Am Sammelpunkt wird derweil kontrolliert, ob alle
„Bewohner“ geborgen sind, auf Listen werden die Namen notiert sowie
der Ort, wo sie aufgefunden wurden. Dann der Schreck: Zwei
„Bewohner“ fehlen. Schnell machen sich die Einsatzkräfte auf die
Suche, nachdem die Lage im Haus unter Kontrolle ist. Auch die
beiden Damen sind bald in Sicherheit.
Nach und nach
werden die „verletzten Bewohner“ aus der Wohnküche geborgen, zu Fuß
oder auf Tragen ins Freie geschafft. Alle treffen sich am
Sammelfahrzeug, wo sie mit Decken und Getränken versorgt werden –
inzwischen hat es angefangen zu regnen, die wärmenden Umhänge
kommen also gerade recht. Um die Ecke biegt ein Notarztwagen, in
dem ein bewusstloser „Bewohner“ und die „Verletzten“ versorgt
werden. Am Sammelpunkt wird derweil kontrolliert, ob alle
„Bewohner“ geborgen sind, auf Listen werden die Namen notiert sowie
der Ort, wo sie aufgefunden wurden. Dann der Schreck: Zwei
„Bewohner“ fehlen. Schnell machen sich die Einsatzkräfte auf die
Suche, nachdem die Lage im Haus unter Kontrolle ist. Auch die
beiden Damen sind bald in Sicherheit.
Der Regen und der Temperatursturz zieht die Mitarbeiter des
RHEIN-PFALZ-STIFT bald ins Haus. Hier wird noch fleißig Hand
angelegt, bis alles wieder verstaut ist, Schläuche eingerollt und
Tragen oder Leitern eingepackt sind. Beim anschließenden
gemeinsamen Umtrunk sind sich alle einig: Die Übung hilft, um auf
einen eventuellen Ernstfall besser vorbereitet zu sein. Und auch
für das junge Team der Pflegeeinrichtung war der schauspielerische
Einsatz eine tolle Erfahrung – „das macht einen schon
nachdenklich“, „gut, dass wir das mal so erlebt haben, wie es ist,
in so einem verqualmten Raum zu sein“ und „man hat überhaupt nichts
gesehen, da kann man schon in Panik geraten“ war im Anschluss an
die Übung zu vernehmen. „Das hat uns sicher auch noch mehr
zusammengeschweißt“, ist sich Einrichtungsleiterin Angelika Kortyka
sicher und blickt zuversichtlich in die Zukunft des
RHEIN-PFALZ-STIFT, in das Anfang September mit den ersten Bewohnern
Leben einziehen wird.Susanne Frank Fotos:sim
01.09.2011
Sommerfest 2011 mit mexikanischem Flair in der Senioren - Residenz Sankt Sebastian
.jpg) Am zweiten
Augustwochenende fand in der Senioren - Residenz Sankt Sebastian
das diesjährige Sommerfest statt, das unter dem Motto Mexiko
gefeiert wurde.
Am zweiten
Augustwochenende fand in der Senioren - Residenz Sankt Sebastian
das diesjährige Sommerfest statt, das unter dem Motto Mexiko
gefeiert wurde.
Der Speisesaal war in den Farben der mexikanischen Flagge
(grün-weiß-rot ) bunt geschmückt, auf jedem Tisch stand ein Topf
mit Chilischoten und mexikanischem Fähnchen, die Bühne war mit
selbst gebastelten Kakteen und Sombreros dekoriert und an der Decke
hingen bunte Girlanden mit „mexikanischen“ Dingen, wie Maiskolben
und Chili –selbst gebastelt in der Kreativgruppe mit Frau Lutz.
Frau Ehrhardt-Steck eröffnete gegen 14.30 Uhr das Fest und
begrüßte die vielen Bewohner und auch die vielen Gäste - darunter
Herrn Peter Eberhardt, Ortsbürgermeister und Verbandsbürgermeister
CDU, Herrn Clemens Körner Landrat CDU, Herr Lardon FDP, Herr
Dudenhöfer FWG und Frau Ball, Ortsbeigeordnete CDU.
Nach dem Kaffeetrinken begann das Programm, durch das Frau
Schütz vom Betreuungsdienst führte mit peppiger Unterhaltungsmusik
der „Sorgenbrecher“.
.jpg) Die erste
Tanzrunde wurde eröffnet und alsbald war die Tanzfläche gut
gefüllt.
Die erste
Tanzrunde wurde eröffnet und alsbald war die Tanzfläche gut
gefüllt.
Danach trat die mexikanische Tanzgruppe vom
deutsch-mexikanischem Kulturkreis Amistad Speyer auf. Diese
erfreuten alle in ihren wunderschönen mexikanischen Kleider mit
Volkstänzen aus Mexiko und animierten so den ein oder anderen zum
Mittanzen und Mitbewegen.
Draußen im Garten und auch im Speisesaal waren
verschiedene Stände aufgebaut. So gab es zwei Stände mit Schmuck
(Frau Damarau / KreativWerkstatt und Frau LindeFath-Weinkämmerer),
einen Verkaufstand mit Hausgemachte Konfitüren, Gelees und Chutneys
(von Frau Sabine Haas-Grundhöfer – Schwegenheim), einen Stand der
Blumen, Dekoartikel und Präsentgalerie Dickerhof (aus
Lingenfeld).
Außerdem konnte man am Stand der Offenen Selbsthilfegruppe ein
Gläschen Sekt genießen, am Glücksrad drehen oder ein Los für die
Tombola mit vielen, schönen Sachspenden der Sebastianus-Apotheke
Harthausen, Volksbank und Kreissparkasse Dudenhofen, der Löwen- und
Schillerapotheke Dudenhofen, der Rheinpfalz und von privaten
Personen kaufen. Frau Hook vom Betreuungsdienst bot noch einen
Bücherflohmarkt an. Für den Getränkeausschank waren Herr Koger und
Herr Löffler von der Freiwilligen Feuerwehr Dudenhofen zuständig,
die uns schon das neunte Jahr unterstützen.
Gegen 17 Uhr gab es dann Grillspezialitäten mit verschiedenen
Salaten und Chili con Carne - vom Küchenteam der Senioren-Residenz
gegrillt/gekocht.
Nach dem reichhaltigen Büffet zog es noch einige Bewohner auf
die Tanzfläche zur Abschluss -Tanzrunde und dann war das Sommerfest
auch schon wieder zu Ende.
Ein herzliches Dankeschön geht auch noch mal an alle
Ehrenamtlichen und alle Mitarbeiter die mitgeholfen haben, dass das
Sommerfest ein großer Erfolg wurde. Julia Schütz
23.08.2011
Sommerfest im Haus am Germansberg
 Buntes Treiben beim Sommerfest im Haus am Germansberg
Buntes Treiben beim Sommerfest im Haus am Germansberg
Mit Fanfaren des Fanfarenzugs Rot-Weiß Speyer begrüßte
das Seniorenzentrum Haus am Germansberg am 13. August zahlreiche
Gäste zum Sommerfest.
Das bunte Programm lockte wieder zahlreiche Besucher in die
Einrichtung in der Else-Kreig-Straße. Die Gäste ließen sich im
Wellnesspavillon mit Maniküren und Massagen verwöhnen oder
stöberten auf dem Bücherflohmarkt der Grünen Damen und im Angebot
des Weltladens. Die Ludwigapotheke überprüfte den Blutzucker der
Besucher während das Hörzentrum Speyer Hörtests durchführte.
Bei Gegrilltem und Kaffee und Kuchen sorgten Kindertanzgruppen
des TSV Speyer unter Leitung von Renate Behm und die Speyerer
Spätlese für Unterhaltung, bevor die Squaredancegruppe Tupsy
Turtles Lust zum Mitmachen machte und die Speyerer Brezelkracher
die Stimmung zum Kochen brachten.
Von den vielen Auftritten angesteckt, sangen Bewohner und
Besucher zum Abschluss mit dem Chor der Marinekameradschaft Speyer
zünftige Seemannslieder, bevor sie ihre attraktiven Gewinne aus der
Tombola nach Hause brachten. Er freue sich über die Unterstützung,
die das Fest auch in diesem Jahr wieder erfahren habe, so
Einrichtungsleiter Klaus-Dieter Schneider: „Besonders zu danken ist
den zahlreichen Spendern für unsere Tombola und den vielen
ehrenamtlichen Helfern, die zum Gelingend es Festes beigetragen
haben.“ Diakonissen Speyer-Mannheim, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit www.diakonissen.de
16.08.2011
Alltag an Bord der „Gorch Fock“
Fregattenkapitän d. R. Martin Schoof im
Seniorenzentrum
 Böhl-Iggelheim:
Christian Schramm, der stellvertretende Leiter des Seniorenzentrums
konnte in der Cafeteria des Betreuten Wohnens ca. 30 Seniorinnen
und Senioren begrüßen. Sein besonderer Willkommensgruß galt Martin
Schoof, Fregattenkapitän d. R. aus Haßloch. Marin Schoof ist bei
den Senioren kein Unbekannter. Schon 2010 hatte er
eindrucksvoll über das Thema „Die Zeit der großen Windjammer“
referiert.
Böhl-Iggelheim:
Christian Schramm, der stellvertretende Leiter des Seniorenzentrums
konnte in der Cafeteria des Betreuten Wohnens ca. 30 Seniorinnen
und Senioren begrüßen. Sein besonderer Willkommensgruß galt Martin
Schoof, Fregattenkapitän d. R. aus Haßloch. Marin Schoof ist bei
den Senioren kein Unbekannter. Schon 2010 hatte er
eindrucksvoll über das Thema „Die Zeit der großen Windjammer“
referiert.
Über den Alltag an Bord des Segelschulschiffes der Deutschen
Bundesmarine, Gorch Fock“, berichtete Martin Schoof in einer
anschaulichen Power Point Präsentation mit bestechenden Bildern
über und unter Deck. Ein kurzer Film, gedreht während einer
Umrundung von Kap Horn, vervollständigte das visuelle
Anschauungsmaterial. Fregattenkapitän Schoof war während
seiner seemännischen Ausbildung selbst auf der „Gorch Fock“
gefahren und kennt das Leben an Bord aus eigener Erfahrung. Durch
den tödlichen Unfall am 07. November 2010 war die „Gorch Fock“ ja
ins Fadenkreuz vieler Kritik und in die politische Diskussion
geraten.
An Hand seiner eigenen Logbucheitragungen und die der „Gorch
Fock“ die Schoof einsehen konnte, erläuterte der Fregattenkapitän
i. R. den gesamten Dienst- und Tagesablauf. Ein Dienst der der
sechzig- bis siebzigköpfigen Stammbesatzung und den 120
Auszubildenden an Bord Alles abverlangt. Die Zeit vom Wecken bis
zum Schlafengehen ist minutiös geregelt. Das Zusammenleben auf
engstem Raum, ohne persönliche Rückzugsmöglichkeiten, ist die
schwerste Bewährungsprobe, wie Schoof erklärte. „Das WIR und in der
Gruppe agieren zu können ist das Wichtigste“ betonte der Kapitän.
Eine Tatsache die gerade in der heutigen Zeit, in der bei den
Kinder schon der Individualismus sehr ausgeprägt ist, bei den
jungen Kadetten eines ganz großen Lernprozesses bedarf. Ein
Lernprozess, der aber gerade für die Offiziersanwärter nach Schoofs
Meinung für ihre berufliche Führungsverantwortung bei der Marine
ungemein wichtig ist. „Denn führen heißt nicht befehlen“ betonte
Schoof.
 Beeindruckend
für die Zuhörer einige technische Daten des Seglers. Die „Gorch
Fock“ wurde 1958 bei der Werft Bloom und Foss gebaut. Es ist die
„Gorch Fock“ 2, nachdem des erste Schiff diese Namens gesunken war.
Es besitzt drei Masten mit 23 Segeln deren Fläche ein halbes
Fußballfeld bedecken würde. Es befindet sich eine eigene
Trinkwasseraufbereitungsanlage an Bord und die eigene biologische
Kläranlage sorgt für Sauberkeit. Moderne Sanitäranlagen und eine
Ausgabeküche sind im Gegensatz zu der Zeit als Schoof auf der
„Gorch Fock“ fuhr heute vorhanden. Unter Segel erreicht das
Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten, das entspricht 30
Stundenkilometer.
Beeindruckend
für die Zuhörer einige technische Daten des Seglers. Die „Gorch
Fock“ wurde 1958 bei der Werft Bloom und Foss gebaut. Es ist die
„Gorch Fock“ 2, nachdem des erste Schiff diese Namens gesunken war.
Es besitzt drei Masten mit 23 Segeln deren Fläche ein halbes
Fußballfeld bedecken würde. Es befindet sich eine eigene
Trinkwasseraufbereitungsanlage an Bord und die eigene biologische
Kläranlage sorgt für Sauberkeit. Moderne Sanitäranlagen und eine
Ausgabeküche sind im Gegensatz zu der Zeit als Schoof auf der
„Gorch Fock“ fuhr heute vorhanden. Unter Segel erreicht das
Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten, das entspricht 30
Stundenkilometer.
Natürlich klammerte der Kapitän die in Zusammenhang mit dem
Unfall seinerzeit erhobenen Vorwürfe wie sexuelle Nötigung,
abartige Rituale oder wilde Saufgelage nicht aus. Nach seiner
Meinung war es mehr als unangemessen, nachdem am 07. November der
schreckliche Unfall geschehen war, am 11. November einen großen
Ausbildungsumtrunk – Kadetten, Ausbilder- abzuhalten.
Offensichtlich wurden auch Ausbilder nicht nachhaltig und
sorgfältig kontrolliert. Eine Kontrolle, die gerade bei längeren
Ausbildungsfahrten unerlässlich erscheint, wie Schoof eindringlich
betonte.
Die angeprangerten Rituale, z. B. bei der sogenannten
„Äquatortaufe“, sind seit alters her seemännische Tradition und auf
der „Gorch Fock“ seit jeher freiwillig. Keine Kadettin oder
Kadett wird gezwungen sich daran zu beteiligen.
Konsequenzen wurden mittlerweile dahingehend gezogen, dass die
„Gorch Fock“ nach Flensburg verlegt wurde. Die Kadetten werden erst
nach 6 Monaten, nicht schon nach 6 Wochen, endgültig zur „Gorch
Fock“ kommandiert und die Segelmanöver werden schon im Hafen
trainiert um sich so einen Eindruck über die praktische
Tauglichkeit der Offiziersanwärterinnen und Offiziersanwärter zu
verschaffen. Zudem wird es einen eigenen Offizier für die Belange
der Kadetten geben, der keinen Vorgesetztenstatus gegenüber den
Kadetten hat, und nur für deren Sorgen und Nöte da ist.
Fregattenkapitän i. R. Martin Schoof bezeichnet das bekannte
Segelschulschiff der Bundesmarine als einen anerkannten Botschafter
Deutschland in der Welt und wünscht ihm allzeit „Gute
Fahrt“.
Der nächste Vortrag Schoof´s über seemännische Redensarten ist
schon fast fertig. Vielleicht gastiert Martin Schoof, der Mitglied
in der Marinekameradschaft Haßloch ist und im dortigen Shanty-Chor
singt, auch mit diesem Klangkörper demnächst im Seniorenzentrum in
Böhl-Iggelheim. Eine Abwechslung über die Bewohner der Einrichtung
und viele Gäste bestimmt sehr dankbar wären. Wort und Bild
kajef
27.07.2011
Kunstausstellung Pfälzer Maler in der Seniorenresidenz
 von links: Leo Weiland, Angelika Schwarz, Robert Rissel
von links: Leo Weiland, Angelika Schwarz, Robert Rissel
Seit Anfang Juli können bei uns in der Seniorenresidenz Sankt
Sebastian Kunstwerke von drei Künstlern aus der Region bewundert
werden.
Es werden Bilder von Herrn Robert Rissel, Frau Angelika Schwarz
und Herrn Leo Weiland gezeigt.
Herr Rissel-Künstler aus Hassloch- wählt viele Motive aus der
Natur, lässt sich aber auch von Ereignissen und Gebäuden aus seiner
Heimat inspirieren.
Eines von seinen schönen Bildern hat er der Seniorenresidenz
Sankt Sebastian als Geschenk überlassen.
Frau Angelika Schwarz aus Schifferstadt malt seit 15
Jahren-Ölmalerei und Acrylbilder und Herr Leo Weiland –aus
Rülzheim,83 Jahre alt- bezeichnet sich selbst als Hobbymaler und
malt in allen Techniken(Öl,Acryl,Aquarell und Monotophie.
Alle drei Künstler sind außerdem Mitglieder in der
Vereinigung der „Pfälzer Maler e. V.“ und haben in diesem Rahmen
schon häufig sowohl bei Einzel- als auch bei Gruppenausstellungen
ihre Werke ausgestellt.
Bis Ende August können die Bilder in der Seniorenresidenz Sankt
Sebastian in der Zeit von 9 Uhr bis 16 Uhr besichtigt
werden. J.Schütz, Betreuungsdienst
14.07.2011
Brunnenfest in der Senioren- Residenz Sankt Sebastian in Dudenhofen
 Am zweiten Juli-Wochenende
fand in der Senioren- Residenz Sankt Sebastian in Dudenhofen ein
Brunnenfest statt. Eingeladen hierzu hatte die Offene
Selbsthilfegruppe unter Vorsitz von Herrn Peter Patzer. Nach einer
kurzen Begrüßung der Ehrengäste Frau Evi Ehrhardt-Steck(
Einrichtungsleitung), Herrn Ortsbürgermeister Herr Peter Eberhardt
und den beiden katholischen Pfarrern Herr Hary und Herr Dörzapf
wurde der neu gestaltete Brunnenplatz vor dem Eingang der Senioren-
Residenz eingeweiht und von Pfarrer Hary gesegnet. Dieser Platz
dient einmal als Erinnerungsort für unseren leider viel zu
verstorbenen Mitarbeiter und Gründer der OSHG Herr Roman Eggert
.Außerdem haben- so Frau Ehrhardt-Steck -Bewohner und Besucher die
Möglichkeit, Ruhe, ein wenig Besinnlichkeit, aber auch Fröhlichkeit
zu genießen.
Am zweiten Juli-Wochenende
fand in der Senioren- Residenz Sankt Sebastian in Dudenhofen ein
Brunnenfest statt. Eingeladen hierzu hatte die Offene
Selbsthilfegruppe unter Vorsitz von Herrn Peter Patzer. Nach einer
kurzen Begrüßung der Ehrengäste Frau Evi Ehrhardt-Steck(
Einrichtungsleitung), Herrn Ortsbürgermeister Herr Peter Eberhardt
und den beiden katholischen Pfarrern Herr Hary und Herr Dörzapf
wurde der neu gestaltete Brunnenplatz vor dem Eingang der Senioren-
Residenz eingeweiht und von Pfarrer Hary gesegnet. Dieser Platz
dient einmal als Erinnerungsort für unseren leider viel zu
verstorbenen Mitarbeiter und Gründer der OSHG Herr Roman Eggert
.Außerdem haben- so Frau Ehrhardt-Steck -Bewohner und Besucher die
Möglichkeit, Ruhe, ein wenig Besinnlichkeit, aber auch Fröhlichkeit
zu genießen.
 Das neu geschaffene
Plätzchen ist eine Bereicherung für die Senioren- Residenz und
stellt zusammen mit dem mediterranen Staudenbeet, dass vor 2 Jahren
im Rahmen des Projektes“ Wir schaffen was gemeinsam“ angelegt wurde
und weitere optischen Attraktion dar.
Das neu geschaffene
Plätzchen ist eine Bereicherung für die Senioren- Residenz und
stellt zusammen mit dem mediterranen Staudenbeet, dass vor 2 Jahren
im Rahmen des Projektes“ Wir schaffen was gemeinsam“ angelegt wurde
und weitere optischen Attraktion dar.
Bei der Gestaltung des Brunnenplatzes wurde Herr Patzer (OSHG)
von Herrn Dennis Becker und Herrn Dieter Stein tatkräftig
unterstützt. Musikalisch gestaltet wurde die kleine Feier vom
Fanfarenzug Dirmstein, der auch ein Lied Roman Eggert –dem Gründer
der Selbsthilfegruppe widmete. Herr Patzer bedankte sich
herzlichst bei allen Mitwirkenden. Im Anschluss gab es im
Speisesaal Unterhaltungsmusik mit Hans Lützel. Der eine oder andere
nutzte die geliebte Schlagermusik für eine kleine Tanzrunde. Das
Küchenteam der Senioren - Residenz verwöhnte die Gäste mit Pfälzer
Spezialitäten und so wurde noch bis 18 Uhr fröhlich gefeiert.
Julia Schütz
15.07.2011
„Demenz und Kommune“: Konzepte – Erfahrungen – Impulse
Demenz – eine Begleiterscheinung moderner
Gesellschaften? Was hat Demenz mit Kommune zu tun?
Familienfreundlich, kinderfreundlich, nun sollen unsere Städte
und Gemeinden auch noch demenzfreundlich werden? Fragen, die bei
einer Veranstaltung im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis am 29. Juni
2011, im Rahmen der Reihe „Mittendrin - Dazugehören – auf dem Weg
zu einer demenzfreundlichen Kommune“ im Mittelpunkt standen.
Irmgard Behler, Dezernentin für Recht und Ordnung im Landratsamt
Rhein- Neckar-Kreis, hob in ihrer Begrüßung hervor: „Zur Wahrung
der Würde von Demenzerkrankten, zum Leben und sterben in Würde
eines jeden von uns, ist es wirklich wichtig, jedem Menschen in
jeder Lebenslage mit Respekt, Mitmenschlichkeit und Güte zu
begegnen.“
Laut Peter Wißmann, Geschäftsführer vom Demenz Support
Stuttgart, bleibt den Kommunen gar keine andere Wahl, als sich dem
Thema Demenz zu stellen, betrachtet man die wachsenden Zahlen
Demenzkranker und die demographische Entwicklung. Demenz ist zu
einer möglichen Form des Altwerdens geworden und kann nicht dem
Pflegesektor oder den Angehörigen überlassen werden.
Demenz hat sich zu einer großen sozialen, ökonomischen und
humanen Herausforderung entwickelt, der nur sektoren-,
berufsgruppen- und disziplinübergreifend zu begegnen ist und die
Einbeziehung aller gesellschaftlichen Bereiche bedarf. In der
öffentlichen Diskussion, so Wißmann, gehe es vorrangig um die
Versorgung, das Optimierungspotentiale in Heimen, um Kosten. Wobei
fast immer das fortgeschrittene Stadium der Demenz im Fokus steht.
Es sollte mehr Energie in Fragen fließen, wie Menschen mit einer
Demenz und deren Angehörigen integriert in der Gemeinschaft würdig
umsorgt, unterstützt und gehalten werden können. Dort, wo die
Menschen leben, arbeiten, betreut werden, sterben und ihren Alltag
gestalten, müssen Initiativen ansetzen, denen es um eine veränderte
Wahrnehmung, einen veränderten Umgang und ein verändertes Handeln
mit Blick auf die Demenz geht, lautet sein eindringlicher
Appell.
Zum Glück melden sich inzwischen Menschen mit Demenz zu Wort.
Sie lassen uns wissen, es gibt ein Leben nach der Diagnose, ein
gutes Leben mit Demenz ist möglich. Trotz leidvoller Erfahrungen
und schwierigster Lebenslagen können neue Wege beschritten,
Ausdruckformen gefunden werden, die ein Leben in den bisherigen
Bezügen ermöglichen. Betroffene fordern, sich weiter als Teil der
Gesellschaft erfahren zu können. Gabriele Beck, Sozialplanerin in
Ostfildern, berichtet von der Demenzkampagne „Wir sind Nachbarn“,
die 2007/2008 in der Stadt durchgeführt wurde. Sie ist überzeugt:
demenzfreundliche Kommunen sind „menschenfreundliche Kommunen“.
Alle profitieren davon. In Ostfildern standen nicht das „Endstadium
der Demenz“ im Mittelpunkt der Kampagne, sondern die vielen, zuvor
liegenden Jahren, in denen die Betroffenen aufgrund von
Orientierungs- und Gedächtnisstörungen vor allem auf eines
angewiesen sind: auf Unterstützung im Alltag, auf Kontakt und
Begegnung. Insbesondere in den Anfangsjahren dieser Erkrankung
benötigen die Betroffenen nicht vorrangig professionelle Hilfen.
Die wohl wichtigste Medizin für die Betroffenen sei Begegnung mit
anderen. Eine gute Vernetzung der professionellen Dienste und der
informellen Netzwerke erleichtert bei Fortschreiten der Erkrankung
gemeinsam individuelle Lösungen zu finden oder auch schwierigste
Situation gemeinsam zu tragen und auszuhalten.
Demenz geht alle an. „Menschen, die an einer Demenz erkrankt
sind, können uns überall in der Stadt begegnen, sei es beim Bäcker,
in der Apotheke oder auf dem Wochenmarkt“. Nach der Kampagne
„www.demenz-ostfildern.de“, so Gabriele Beck, wurde Demenz zu einem
Gesprächsthema in der Stadt. Familien werden nicht länger in die
Isolation gedrängt. Das Wissen über Demenz sei gewachsen. Die
Anlauf- und Beratungsstellen konnten ihren Bekanntheitsgrad
steigern. Das Bewusstsein bei den Menschen - „Jeder kann etwas
tun!“ - sei ebenfalls gewachsen.
Bei der anschließenden Diskussion wurden Fragen erörtert wie
„Können demenzfreundliche Gemeinwesen die Großfamilie des 21.
Jahrhunderts sein, wo man sich – obgleich nicht verwandt –
umeinander kümmert, Netzwerke der Solidarität entstehen lässt? oder
Wie kann die erforderliche Koppelung mit dem professionellen
Diensten und Einrichtungen gelingen?“ Auf den Weg machen, mit
Kreativität und Fantasie, ermutigten die beiden Referenten die
Veranstalter und Besucher.
14.07.2011
Spargelessen in der Senioren-Residenz Sankt Sebastian Dudenhofen
 In der
Spargelzeit ist es nun schon eine Tradition geworden, dass uns
Bürgermeister Peter Eberhardt in der Seniorenresidenz besucht und
zusammen mit allen Bewohnern und Mitarbeitern Dudenhofener Spargel
gegessen werden.
In der
Spargelzeit ist es nun schon eine Tradition geworden, dass uns
Bürgermeister Peter Eberhardt in der Seniorenresidenz besucht und
zusammen mit allen Bewohnern und Mitarbeitern Dudenhofener Spargel
gegessen werden.
Gespendet werden die Spargel von der Ortsgemeinde und der
Küchenchef der Seniorenresidenz stellt ein leckeres Essen zusammen.
Am 17.06.2011 ab 12 Uhr war der Speisesaal gut gefüllt und alle
Bewohner erfreuten sich an der Dudenhofener Delikatesse.
Bürgermeister Peter Eberhardt kam in diesem Jahr in Begleitung
von Frau Irmgard Ball , Herrn Ronni Zürker und einer
Gruppe aus der Partnergemeinde Martell , u.a. mit Bürgermeister
Georg Altstätter und der amtierenden Erdbeerkönigin zum
Spargelessen in die Residenz. Unsere Bewohner ließen es sich nicht
nehmen, dem Besuch ein kleines „Ständchen“ zu geben und sich beim
„Spender“ mit einem „Trullala“ zu bedanken.
Leider geht die Spargelzeit nun dem Ende zu, aber wir freuen uns
alle schon wieder auf das Spargelessen im nächsten Jahr.
J.Schütz
26.06.2011
Orientalischer Tanz mit Frau Karsch
 Am vergangenen
Wochenende wurden die Bewohner der Seniorenresidenz St.Sebastian in
die Welt des Orients entführt. Zusammen mit Ihren Tanzgruppen „El
Fayoum“ und „El Javahir“ hatte „Zaphira“(Petra Karsch) ein buntes
Showprogramm zusammengestellt.
Am vergangenen
Wochenende wurden die Bewohner der Seniorenresidenz St.Sebastian in
die Welt des Orients entführt. Zusammen mit Ihren Tanzgruppen „El
Fayoum“ und „El Javahir“ hatte „Zaphira“(Petra Karsch) ein buntes
Showprogramm zusammengestellt.
Es umfasste klassischen Orientalischen Tanz(Bauchtanz),Arabic
Flamenco-eine Mischung aus Flamenco und Bauchtanz), Bollywood(Tänze
aus Indien) und Folklore(Stocktanz aus Oberägypten). In ihren
wunderschönen Kostümen begeisterten die 10 Tänzerinnen im Alter von
13- 60 Jahren unsere Bewohner, die sich zahlreich im Speisesaal
eingefunden hatten. Die Gruppe trainiert schon seit mehr als 6
Jahren in der Tanzschule Thiele, Speyer, vorher an der VHS und
haben bereits mehrere Tanzshows(„ Orient-Express 2006 und
„Oriental-Dreams“ 2009) veranstaltet.
Eine Bewohnerin, die im vergangenen Oktober ihren 100.
Geburtstag feierte, sagte: „Es ist toll, was ich hier in der
Seniorenresidenz in meinem Alter noch erleben darf“ und erfreute
sich vor allem als ehemalige Schneiderin an den Kostümen. Bei dem
einen oder anderen Bewohner bemerkte man, dass manche Bewegungen
versucht wurden, nachzumachen und es wurde im Takt zur Musik
mitgeklatscht. Die fleißigen Tänzerinnen wurden mit einem großen
Applaus verabschiedet und deuteten an, dass sie sehr gerne noch mal
zu uns in die Residenz kommen möchten. (Julia
Schütz(Betreuungsdienst)
26.06.2011
Männerstammtisch in der Senioren-Residenz Sankt Sebastian
Am vergangenen Freitag haben wir nach großer Ankündigung in der
Senioren-Residenz Sankt Sebastian den Vatertag im Rahmen des „1.
Stammtisches“ nachgefeiert.
 Dank dem
schönen Wetter, konnten wir eine Tafel auf der Terrasse passend zum
Thema blau-weiß eindecken. Das Bierfass – eisgekühlt – würde
angestochen und gegen 15.00 Uhr trafen die ersten Herren ein. Nach
anfangs eher verhaltener Stimmung wurde die Runde nach dem 1.
Bierchen immer lockerer. Auch für Alkohol-freies Bier war gesorgt.
Insgesamt waren ca. 16 Herren vom Haus und auf von außerhalb
gekommen und genossen ihr Bier, Brezeln und Erdbeeren in geselliger
Runde natürlich kostenlos. Herr Peter Patzer, Leiter der Offenen
Selbsthilfegruppe, organisierte Schlagermusik, es wurden Karten
gespielt und erzählt.
Dank dem
schönen Wetter, konnten wir eine Tafel auf der Terrasse passend zum
Thema blau-weiß eindecken. Das Bierfass – eisgekühlt – würde
angestochen und gegen 15.00 Uhr trafen die ersten Herren ein. Nach
anfangs eher verhaltener Stimmung wurde die Runde nach dem 1.
Bierchen immer lockerer. Auch für Alkohol-freies Bier war gesorgt.
Insgesamt waren ca. 16 Herren vom Haus und auf von außerhalb
gekommen und genossen ihr Bier, Brezeln und Erdbeeren in geselliger
Runde natürlich kostenlos. Herr Peter Patzer, Leiter der Offenen
Selbsthilfegruppe, organisierte Schlagermusik, es wurden Karten
gespielt und erzählt.
Allen Herren gefiel der Stammtisch sehr gut und nach diesem
Erfolg, wird der nächste Stammtisch nach Vorankündigung auch
zeitnah stattfinden.
Selbstverständlich sind auch wieder Herren vom Dorf oder
Umgebung herzlich eingeladen.
26.06.2011
„Die Verbindung zu Menschen macht unser Leben wertvoll“
Durch die steigenden Anforderungen an die Betreuung älterer
Menschen, wird das Einbeziehen ehrenamtlich tätiger Mitarbeitern
immer wichtiger. Daher ist die Unterstützung des Betreuungsdienstes
durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen ein integrativer Bestandteil
unseres Betreuungskonzeptes.
Ehrenamtliche Mitarbeiter setzen einen Teil ihrer Freizeit für
Mitmenschen ein und bereichern dadurch den Alltag beider
Parteien.
In diesem Jahr kann sich die Senioren-Residenz Sankt Sebastian
in Dudenhofen über die derzeit 35 ehrenamtlichen Mitarbeiter im
Alter zwischen 13-80 Jahren und aus den unterschiedlichsten Berufen
und Lebensumständen glücklich schätzen.
Diese bereichern auf unterschiedlichste Art und Weise das Leben
der Bewohner. So sind Spaziergänge, Gespräche und Spiele genauso
wertvoll wie die einfache Gesellschaft und das Gefühl von Nähe.
Einige Bewohner haben kaum Angehörige und Bekannte und sind
daher für jede kleine Aufmerksamkeit dankbar, welche im stressigen
Pflegealltag leider oft zu kurz kommt.
Wenn auch Sie Interesse daran haben, Ihr Leben durch die
„Verbindung zu Menschen wertvoller zu machen“ – laden wir Sie
herzlich ein unser Haus und unsere Bewohner kennen zu lernen und
durch eine ehrenamtliche Tätigkeit, egal in welchem Umfang,
Menschen glücklich zu machen. Senioren-Residenz Sankt
Sebastian, Dudenhofen
26.06.2011
Unsere Bewohnerinnen und Bewohner können über ihr Leben selbst bestimmen
Der Senioren-Residenz Sankt Sebastian in Dudenhofen
wurde zum zweiten Mal in einem Gutachten Lebensqualität
im Pflegeheim attestiert
Seit heute haben wir es wieder schwarz auf weiß:
Respektvoller Umgang, Selbstbestimmung und Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben sind für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
in unserer Einrichtung jederzeit gewährleistet. Das bestätigt die
Urkunde mit dem grünen Haken, die von der BIVA e.V., der einzigen
unabhängigen und bundesweiten Interessenvertretung, die sich für
die Rechte der Bewohnerinnen und Bewohner in stationären Wohn- und
Pflegeeinrichtungen einsetzt.
Wir wissen, dass sich die Seniorinnen und Senioren in unserem
Hause wohlfühlen, umso mehr freuen wir uns, dass uns dies wiederum
von einem unabhängigen Gutachter bestätigt wurde. Diesem stand
unsere Einrichtung einen ganzen Tag lang offen. Die Begutachtung
umfasste 121 Fragen, gerichtet an die Einrichtungsleitung Frau Evi
Ehrhardt- Steck und den Heimbeiratsmitgliedern Herrn Peter Patzer
(Vorsitzender), Frau Roswitha Bettag ( stellv. Vorsitzende) Frau
Erika Lang ( Mitglied ) Herr Karl-Heinz Koch ( Ehrenmitglied).
Herzlichen Glückwunsch!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Die Detailergebnisse unserer Begutachtung findet jeder
Interessierte im Internet unter www.heimverzeichnis.de .

von links nach rechts:
Fr. Bettag (Heimbeirat),Hr. Patzer(Heimbeirat), Fr. Ehrhardt-
Steck (Einrichtungsleitung),Hr. Müller(Gutachter der BIVA), Fr.
Lang(Heimbeirat), Hr. Koch(Heimbeirat)
26.06.2011
Erster Ausflug der Rollstuhlspazierganggruppe
Am Donnerstag den 12. Mai fand der erste Ausflug der neu
gegründeten Rollstuhlspazierganggruppe in der Senioren-Residenz
Sankt Sebastian statt. Zum Ausflug hatten sich 5 Ehrenamtliche und
zwei Mitarbeiter des Betreuungsdienstes angemeldet. So traf sich
die Gruppe pünktlich um 14.30 Uhr am Empfang der Residenz, um mit
den sieben Rollstuhlfahrern und zwei Bewohnern die zu Fuß gingen
einen Spaziergang zum Abenteuerspielplatz zu unternehmen.
Wir liefen durchs Dorf und über den Friedhof, haben den neuen
Kindergarten bewundert und die Sonne und die frische Luft genossen.
Circa eine halbe Stunde später sind wir am Spielplatz angekommen,
wo die Betreiber des Kiosk´s so freundlich und hilfsbereit waren
uns Tische und Stühle zu stellen. Dort saßen wir gemütlich unter
Bäumen, packten die Lunchpakete aus und plauderten. Eine Stunde
später haben wir uns auf den Heimweg gemacht und sind entspannt und
gut gelaunt wieder an der Residenz angekommen.
An dieser Stelle möchte ich unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern
ein herzliches Dank aussprechen und hoffe, dass wir ab jetzt solche
Spaziergänge mit dieser tatkräftigen Unterstützung öfters in unser
Programm aufnehmen können.
26.06.2011







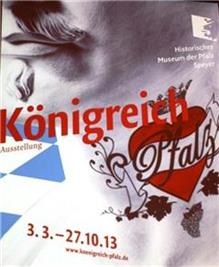



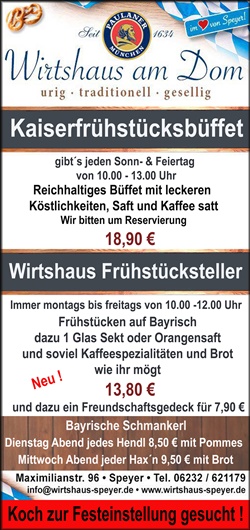
.jpg)



.png)

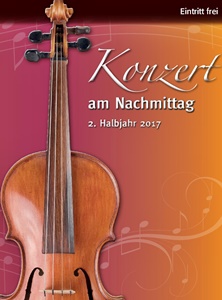 Speyer- Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ des
Seniorenbüros Speyer besteht 2017 zehn Jahre. In dieser Zeit sind
diese Veranstaltungen zu einem festen Bestandteil der Speyerer
Kultur geworden. Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf
alle gesellschaftlichen Bereiche. Wenn es also abends mehr und mehr
Menschen gibt, die nicht mehr gerne aus dem Haus gehen, dann muss
es auch tagsüber ein interessantes und qualitatives gutes Programm
geben.
Speyer- Die Reihe „Konzert am Nachmittag“ des
Seniorenbüros Speyer besteht 2017 zehn Jahre. In dieser Zeit sind
diese Veranstaltungen zu einem festen Bestandteil der Speyerer
Kultur geworden. Die demografische Entwicklung hat Auswirkungen auf
alle gesellschaftlichen Bereiche. Wenn es also abends mehr und mehr
Menschen gibt, die nicht mehr gerne aus dem Haus gehen, dann muss
es auch tagsüber ein interessantes und qualitatives gutes Programm
geben. Kulturelle
Teilhabe für Menschen mit Demenz
Kulturelle
Teilhabe für Menschen mit Demenz

 Bald ist er wieder gefragt. Weiter geht’s mit Liedern.
Manchmal entwickeln die Bewohner eine Eigendynamik. Bei „Freut Euch
des Lebens“, stimmt erst eine die „Großmutter wird mit der Sense
rasiert“-Version an. Das kennen auch die Herren, fallen mit ein und
schon hat der stattliche Chor Dietmar Schöffel übertönt. Simone
Joder und ihre Kolleginnen sind mittendrin im Geschehen, nehmen
immer wieder mal einen der Bewohner herzlich in den Arm, schunkeln
zum Takt der Lieder oder halten ihnen eine Zeit lang die Hand.
Bald ist er wieder gefragt. Weiter geht’s mit Liedern.
Manchmal entwickeln die Bewohner eine Eigendynamik. Bei „Freut Euch
des Lebens“, stimmt erst eine die „Großmutter wird mit der Sense
rasiert“-Version an. Das kennen auch die Herren, fallen mit ein und
schon hat der stattliche Chor Dietmar Schöffel übertönt. Simone
Joder und ihre Kolleginnen sind mittendrin im Geschehen, nehmen
immer wieder mal einen der Bewohner herzlich in den Arm, schunkeln
zum Takt der Lieder oder halten ihnen eine Zeit lang die Hand.
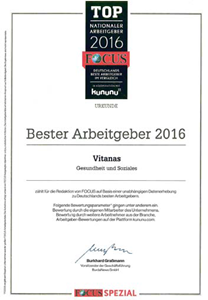 Top
Arbeitsumfeld im Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer
Top
Arbeitsumfeld im Vitanas Senioren Centrum Am Rheinufer Menschen mit Demenz
besuchen Archäologisches Schaufenster
Menschen mit Demenz
besuchen Archäologisches Schaufenster
 Stefan Mross
feiert letzte Live-Sendung
Stefan Mross
feiert letzte Live-Sendung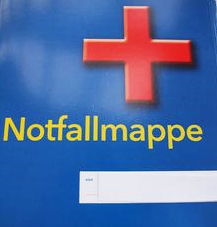 Wichtige
Daten auf einen Blick
Wichtige
Daten auf einen Blick Auch Speyerer „Salierstift“ setzt jetzt auf Wärme- und
Warmwasserversorgung aus Fernwärme der Stadtwerke
Speyer
Auch Speyerer „Salierstift“ setzt jetzt auf Wärme- und
Warmwasserversorgung aus Fernwärme der Stadtwerke
Speyer Und das Ergebnis, so erläuterte Flaschenträger jetzt bei
der offiziellen Übergabe der neuen Anlage, war selbst für ihn als
Experten durchaus überraschend: Denn hätte man für die Installation
einer neuen, der alten Anlage entsprechenden und die durchgehende
Versorgung des Objektes mit Heizenergie und Warmwasser sichernden
stationären Heizungsanlage mit zwei Heizkesseln vor Ort im Keller
des „Salierstifts“ oder für ein entsprechend leistungsfähiges
Blockheizkraftwerk rund 210.000 Euro aufwenden müssen, so boten die
Stadtwerke Speyer den Anschluss an das Fernwärmenetz und damit die
zukünftige versorgungssichere Belieferung mit Heizenergie und
Warmwasser mit nur 89.000 Euro deutlich günstiger an.
Und das Ergebnis, so erläuterte Flaschenträger jetzt bei
der offiziellen Übergabe der neuen Anlage, war selbst für ihn als
Experten durchaus überraschend: Denn hätte man für die Installation
einer neuen, der alten Anlage entsprechenden und die durchgehende
Versorgung des Objektes mit Heizenergie und Warmwasser sichernden
stationären Heizungsanlage mit zwei Heizkesseln vor Ort im Keller
des „Salierstifts“ oder für ein entsprechend leistungsfähiges
Blockheizkraftwerk rund 210.000 Euro aufwenden müssen, so boten die
Stadtwerke Speyer den Anschluss an das Fernwärmenetz und damit die
zukünftige versorgungssichere Belieferung mit Heizenergie und
Warmwasser mit nur 89.000 Euro deutlich günstiger an. „Ganz toll - die gesamte Umbaumaßnahme hat störungsfrei
und wunderbar geklappt“. lobte auch der
Geschäftsführer des „Salierstifts“, Ulrich
Heberger, der darauf verwies, dass durch den
fachlich-kompetenten Einsatz der Stadtwerke-Mitarbeiter um
Norbert Pelgen und Markus Sohn
sein Haus keinen Moment auf Wärme und Warmwasser verzichten
musste.
„Ganz toll - die gesamte Umbaumaßnahme hat störungsfrei
und wunderbar geklappt“. lobte auch der
Geschäftsführer des „Salierstifts“, Ulrich
Heberger, der darauf verwies, dass durch den
fachlich-kompetenten Einsatz der Stadtwerke-Mitarbeiter um
Norbert Pelgen und Markus Sohn
sein Haus keinen Moment auf Wärme und Warmwasser verzichten
musste. Dieser Tag – übrigens auch draußen einer der „heißesten“
des Jahres - gab auch Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang
Bühring Gelegenheit, auf die Vorzüge der Fernwärme zu
verweisen, die sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit und
Versorgungssicherheit auszeichne. „Doch auch der Umstand, dass
Fernwärmenutzer keinen zusätzlichen, großen Warmwasserspeicher
benötigen, weil warmes Wasser bei ihnen stets bedarfsgerecht und
kontinuierlich in den Haushalt gelangt, macht dieses Produkt so
konkurrenzlos und komfortabel“, unterstrich Bühring, der daran
erinnerte, dass die „grüne Fernwärme“ auch bei der Stromerzeugung
eine zunehmend größere Bedeutung erlange. Und deshalb setze sich
Fernwärme auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Speyer immer
mehr durch – würden sich immer mehr Hausbesitzer dafür entscheiden,
ihre Immobilie an diese modernste und „sauberste“ Form der
Wärmeversorgung anzuschließen.
Dieser Tag – übrigens auch draußen einer der „heißesten“
des Jahres - gab auch Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang
Bühring Gelegenheit, auf die Vorzüge der Fernwärme zu
verweisen, die sich insbesondere durch ihre Zuverlässigkeit und
Versorgungssicherheit auszeichne. „Doch auch der Umstand, dass
Fernwärmenutzer keinen zusätzlichen, großen Warmwasserspeicher
benötigen, weil warmes Wasser bei ihnen stets bedarfsgerecht und
kontinuierlich in den Haushalt gelangt, macht dieses Produkt so
konkurrenzlos und komfortabel“, unterstrich Bühring, der daran
erinnerte, dass die „grüne Fernwärme“ auch bei der Stromerzeugung
eine zunehmend größere Bedeutung erlange. Und deshalb setze sich
Fernwärme auch im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Speyer immer
mehr durch – würden sich immer mehr Hausbesitzer dafür entscheiden,
ihre Immobilie an diese modernste und „sauberste“ Form der
Wärmeversorgung anzuschließen. Menschen mit Demenz
besuchen das Purrmann-Haus
Menschen mit Demenz
besuchen das Purrmann-Haus Zur Einstimmung
bekamen alle eine Rose in die Hand. Als das Lied „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“ erklang, stimmten alle Gäste mit ein. Es war
bewegend zuhören und zu sehen, mit welcher Intensität sie dabei
waren und alle Strophen auswendig singen konnten. Auch hier sorgte
die Atmosphäre, die der Raum ausstrahlte, für eine angenehme
Stimmung. Menschen mit Demenz sind empfindsam, sie spüren, ob sie
willkommen sind. Im Purrmann Haus waren sie das. „Es herrschten
eine unglaubliche Aufmerksamkeit und Offenheit“, bestätigt auch
Anke Nader von der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz. Maria
Leitmeyer fesselte mit Erzählungen aus dem Leben der Künstlerin
Mathilde VollmoellerPurrmann und weckte damit auch Erinnerungen der
Besucherinnen und Besucher. Immer wieder gab es Äußerungen, die
deutlich machten, dass die Gäste interessiert bei der Sache
waren.
Zur Einstimmung
bekamen alle eine Rose in die Hand. Als das Lied „Sah ein Knab ein
Röslein stehn“ erklang, stimmten alle Gäste mit ein. Es war
bewegend zuhören und zu sehen, mit welcher Intensität sie dabei
waren und alle Strophen auswendig singen konnten. Auch hier sorgte
die Atmosphäre, die der Raum ausstrahlte, für eine angenehme
Stimmung. Menschen mit Demenz sind empfindsam, sie spüren, ob sie
willkommen sind. Im Purrmann Haus waren sie das. „Es herrschten
eine unglaubliche Aufmerksamkeit und Offenheit“, bestätigt auch
Anke Nader von der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz. Maria
Leitmeyer fesselte mit Erzählungen aus dem Leben der Künstlerin
Mathilde VollmoellerPurrmann und weckte damit auch Erinnerungen der
Besucherinnen und Besucher. Immer wieder gab es Äußerungen, die
deutlich machten, dass die Gäste interessiert bei der Sache
waren.
 Speyerer
Seniorenbüro präsentiert Modellprojekte zur Betreuung von Menschen
mit Demenz – Ehrenamtliche Helfer gesucht
Speyerer
Seniorenbüro präsentiert Modellprojekte zur Betreuung von Menschen
mit Demenz – Ehrenamtliche Helfer gesucht „Mit
Musik geht vieles leichter – Menschen mit Demenz musikalisch
einfühlsam begleiten“ ist das eine Projekt überschrieben -
„Abenteuer Kultur wagen – Menschen mit Demenz im
Museum“ das andere. Für beide Projekte können sich
Interessenten für eine ehrenamtliche Mitwirkung beim Seniorenbüro
Speyer, Frau Ria Krampitz, Maulbronner Hof 1 A, 67346 Speyer,
e-mail:
„Mit
Musik geht vieles leichter – Menschen mit Demenz musikalisch
einfühlsam begleiten“ ist das eine Projekt überschrieben -
„Abenteuer Kultur wagen – Menschen mit Demenz im
Museum“ das andere. Für beide Projekte können sich
Interessenten für eine ehrenamtliche Mitwirkung beim Seniorenbüro
Speyer, Frau Ria Krampitz, Maulbronner Hof 1 A, 67346 Speyer,
e-mail:  In diesem
Seminar vermittelt die Musiktherapeutin Simone
Willig Hintergründe und praktische Tipps für den gezielten
und sinnstiftenden Einsatz von Musik in der Begleitung von Menschen
mit Demenz. Wann ist der
In diesem
Seminar vermittelt die Musiktherapeutin Simone
Willig Hintergründe und praktische Tipps für den gezielten
und sinnstiftenden Einsatz von Musik in der Begleitung von Menschen
mit Demenz. Wann ist der Auch für die
Interessenten an einer ehrenamtlichen Begleitung von
Demenz-Patienten im zweiten Projekt „Abenteuer Kultur wagen
– Menschen mit Demenz im Museum“ wird es ein einführendes
Seminar geben, das - in zwei Abschnitte gegliedert – gemeinsam von
der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Uschi
Baetz und MitarbeiterInnen der beiden ersten, in das
Projekt einbezogene Speyerer „Kunsttempeln“ abgehalten wird. Um
seinen Ablauf im Detail zu erläutern, waren zu dem Pressegespräch
als Vertreter dieser beiden Einrichtungen der Direktor des
Historischen Museums der Pfalz, Dr. Alexander Schubert und
die Kustodin des „Purrmann-Hauses“ in Speyer, Maria Leitmeyer M.A,
hinzugekommen.
Auch für die
Interessenten an einer ehrenamtlichen Begleitung von
Demenz-Patienten im zweiten Projekt „Abenteuer Kultur wagen
– Menschen mit Demenz im Museum“ wird es ein einführendes
Seminar geben, das - in zwei Abschnitte gegliedert – gemeinsam von
der Kunsthistorikerin und Kunstvermittlerin Uschi
Baetz und MitarbeiterInnen der beiden ersten, in das
Projekt einbezogene Speyerer „Kunsttempeln“ abgehalten wird. Um
seinen Ablauf im Detail zu erläutern, waren zu dem Pressegespräch
als Vertreter dieser beiden Einrichtungen der Direktor des
Historischen Museums der Pfalz, Dr. Alexander Schubert und
die Kustodin des „Purrmann-Hauses“ in Speyer, Maria Leitmeyer M.A,
hinzugekommen. Dieses Seminar,
organisiert von der „Arbeitsgruppe Demenz Speyer“, stellt
Möglichkeiten, Barrieren und Erfolge der Arbeit mit Menschen mit
Demenz im Museum vor und möchte Ansätze für örtliche Projekte
aufzeigen. Zielgruppen sind hier MitarbeiterInnen von Museen,
Angehörige, Ehrenamtliche und alle, die sich in diesem Bereich
engagieren möchten
Dieses Seminar,
organisiert von der „Arbeitsgruppe Demenz Speyer“, stellt
Möglichkeiten, Barrieren und Erfolge der Arbeit mit Menschen mit
Demenz im Museum vor und möchte Ansätze für örtliche Projekte
aufzeigen. Zielgruppen sind hier MitarbeiterInnen von Museen,
Angehörige, Ehrenamtliche und alle, die sich in diesem Bereich
engagieren möchten Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
 Auf Teilen des vor ein paar Jahren an einen Investor
verkauften Fabrikgeländes entstanden inzwischen ein
Supermarkt, ein Drogeriemarkt, Therapie- und Arztpraxen und ein
großer Wohnkomplex. Noch ungewiss ist die Zukunft eines unter
Denkmalschutz stehenden Gartenhäuschens. Das um 1716
erbaute barocke Schlösschen diente einstmals Geistlichen und
später wohl dem Verwalter als Unterkunft.
Auf Teilen des vor ein paar Jahren an einen Investor
verkauften Fabrikgeländes entstanden inzwischen ein
Supermarkt, ein Drogeriemarkt, Therapie- und Arztpraxen und ein
großer Wohnkomplex. Noch ungewiss ist die Zukunft eines unter
Denkmalschutz stehenden Gartenhäuschens. Das um 1716
erbaute barocke Schlösschen diente einstmals Geistlichen und
später wohl dem Verwalter als Unterkunft. Speyer- Die Geschichte des 20.Jahrhunderts
aus seiner Sicht machte Dr.Bernhard Vogel, von 1976 bis 1988
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003
Regierungschef von Thüringen, beim Dezember-Erzählcafé des
Seniorenbüros im Historischen Rathaus an drei markanten Punkten „im
Jahr des Gedenkens“ fest: Am Beginn des ersten Weltkriegs vor
100 Jahren, am Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren
und am 9.November 1989, dem Tag des Mauerfalls. Hierzu
erklärte der 81-jährige Speyerer Ehrenbürger: „Das hab ich nie
gedacht, dass ich den erleben darf.“
Speyer- Die Geschichte des 20.Jahrhunderts
aus seiner Sicht machte Dr.Bernhard Vogel, von 1976 bis 1988
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz und von 1992 bis 2003
Regierungschef von Thüringen, beim Dezember-Erzählcafé des
Seniorenbüros im Historischen Rathaus an drei markanten Punkten „im
Jahr des Gedenkens“ fest: Am Beginn des ersten Weltkriegs vor
100 Jahren, am Beginn des Zweiten Weltkriegs vor 75 Jahren
und am 9.November 1989, dem Tag des Mauerfalls. Hierzu
erklärte der 81-jährige Speyerer Ehrenbürger: „Das hab ich nie
gedacht, dass ich den erleben darf.“ „Nach 25 Jahren besteht kein Zweifel daran, dass die
Wiedervereinigung alles in allem gelungen ist“, stört Dr.Bernhard
Vogel beispielsweise der Unterschied, dass in den
West-Bundesländern die Einkommens- und Besitzverhältnisse fast
doppelt so hoch sind wie in Ostdeutschland. „Es ist in der
Tat ein Wunder, dass kein Schuss gefallen und kein Tropfen Blut
geflossen ist.“ Vogel zum nicht immer reibungslosen Zusammenwachsen
von neuen und alten Bundesländern: „Wenn wir uns freuen, dass die
Revolution unblutig verlaufen ist, dürfen wir uns auf der anderen
Seite“ nicht wundern, dass hinterher alle noch da sind!“ Die drei
großen Wegbereiter der deutschen Einheit waren für ihn Michail
Gorbatschow. George Bush sen. und Helmut Kohl, „der Vater der
Wiedervereinigung“. 1989 seien in der DDR noch 80 000 russische
Soldaten stationiert gewesen. Dass der ehemalige sowjetische
Staatschef nicht intervenierte, war für Vogel nicht nur ein Zeichen
von Stärke, sondern auch von Schwäche – angesichts des sich
abzeichnenden Zusammenbruchs der UDSSR. Nicht alle europäischen
Staatschefs hätten die Wiedervereinigung begrüßt, erzählte Vogel.
So habe Giulio Andreotti gesagt: „Ich liebe Deutschland so sehr,
dass ich zwei davon will.“ Und Margret Thatcher habe geäußert.
„Zweimal haben wir sie besiegt, jetzt sind sie schon wieder
da.“
„Nach 25 Jahren besteht kein Zweifel daran, dass die
Wiedervereinigung alles in allem gelungen ist“, stört Dr.Bernhard
Vogel beispielsweise der Unterschied, dass in den
West-Bundesländern die Einkommens- und Besitzverhältnisse fast
doppelt so hoch sind wie in Ostdeutschland. „Es ist in der
Tat ein Wunder, dass kein Schuss gefallen und kein Tropfen Blut
geflossen ist.“ Vogel zum nicht immer reibungslosen Zusammenwachsen
von neuen und alten Bundesländern: „Wenn wir uns freuen, dass die
Revolution unblutig verlaufen ist, dürfen wir uns auf der anderen
Seite“ nicht wundern, dass hinterher alle noch da sind!“ Die drei
großen Wegbereiter der deutschen Einheit waren für ihn Michail
Gorbatschow. George Bush sen. und Helmut Kohl, „der Vater der
Wiedervereinigung“. 1989 seien in der DDR noch 80 000 russische
Soldaten stationiert gewesen. Dass der ehemalige sowjetische
Staatschef nicht intervenierte, war für Vogel nicht nur ein Zeichen
von Stärke, sondern auch von Schwäche – angesichts des sich
abzeichnenden Zusammenbruchs der UDSSR. Nicht alle europäischen
Staatschefs hätten die Wiedervereinigung begrüßt, erzählte Vogel.
So habe Giulio Andreotti gesagt: „Ich liebe Deutschland so sehr,
dass ich zwei davon will.“ Und Margret Thatcher habe geäußert.
„Zweimal haben wir sie besiegt, jetzt sind sie schon wieder
da.“ Ihm war klar, dass den Gipfelsturm-Freuden eine trockene
Ebene folgen würde, der Übergang aus sozialer Planwirtschaft in
eine kapitalistische Marktwirtschaft nicht problemlos
vonstattengehe. „Die Wiedervereinigung kam über Nacht!“ So gab es
kein Ministerium zum Planen der Privatisierung volkseigener
Betriebe und keine Zeit zum Gründen einer Kommission, erinnerte
Vogel an die Schwierigkeiten beim Aneinanderfügen der beiden so
lange getrennten Teile. Einen für ihn erfreulichen Aspekt
sprach Bernhard Vogel noch an. In der DDR hatte es keine frei
gewählten Gemeinderäte gegeben, und es war „für mich erstaunlich“,
wieviele Bürger sich bei der ersten demokratischen Wahl in
Ostdeutschland für Stadt-und Gemeinderat haben aufstellen
lassen.
Ihm war klar, dass den Gipfelsturm-Freuden eine trockene
Ebene folgen würde, der Übergang aus sozialer Planwirtschaft in
eine kapitalistische Marktwirtschaft nicht problemlos
vonstattengehe. „Die Wiedervereinigung kam über Nacht!“ So gab es
kein Ministerium zum Planen der Privatisierung volkseigener
Betriebe und keine Zeit zum Gründen einer Kommission, erinnerte
Vogel an die Schwierigkeiten beim Aneinanderfügen der beiden so
lange getrennten Teile. Einen für ihn erfreulichen Aspekt
sprach Bernhard Vogel noch an. In der DDR hatte es keine frei
gewählten Gemeinderäte gegeben, und es war „für mich erstaunlich“,
wieviele Bürger sich bei der ersten demokratischen Wahl in
Ostdeutschland für Stadt-und Gemeinderat haben aufstellen
lassen. Speyer- Über das Institut St.Dominikus in
Speyer und seinen Einsatz in Ghana berichtete Schwester Miguela
0.P.beim Erzählcafé des Speyerer Seniorenbüros. Dass die gelernte
Hebamme und Krankenschwester ihre Hilfe mit Herz und Seele
leistete, war ihren eindrucksvollen Schilderungen deutlich
anzumerken. Bestens nachvollziehbar war für die knapp 50 Besucher
im Historischen Rathaus und für Moderator Bernhard Linvers, warum
die aus dem südpfälzischen Leimersheim stammende Ordensschwester
für ihr Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
wurde. Vor drei Jahren erhielt Schwester Miguela Keller die fast 50
Jahre in Ghana wirkte, den "Millenium Excellenz Preis", eine der
höchsten Ehrungen des afrikanischen Staates. Mit dem Preis werden
Gruppen oder einzelne Persönlichkeiten ausgezeichnet, die
„unermüdlich für Gesundheit, Menschenrechte und Seuchenkontrolle in
Afrika kämpfen“.
Speyer- Über das Institut St.Dominikus in
Speyer und seinen Einsatz in Ghana berichtete Schwester Miguela
0.P.beim Erzählcafé des Speyerer Seniorenbüros. Dass die gelernte
Hebamme und Krankenschwester ihre Hilfe mit Herz und Seele
leistete, war ihren eindrucksvollen Schilderungen deutlich
anzumerken. Bestens nachvollziehbar war für die knapp 50 Besucher
im Historischen Rathaus und für Moderator Bernhard Linvers, warum
die aus dem südpfälzischen Leimersheim stammende Ordensschwester
für ihr Lebenswerk mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet
wurde. Vor drei Jahren erhielt Schwester Miguela Keller die fast 50
Jahre in Ghana wirkte, den "Millenium Excellenz Preis", eine der
höchsten Ehrungen des afrikanischen Staates. Mit dem Preis werden
Gruppen oder einzelne Persönlichkeiten ausgezeichnet, die
„unermüdlich für Gesundheit, Menschenrechte und Seuchenkontrolle in
Afrika kämpfen“. 1957, im Jahr der
Unabhängigkeit Ghanas, waren die ersten vier Schwestern vom
Institut St.Dominikus ausgesandt worden Sie sollten eine
Wochenstation übernehmen und eine kleine Klinik. Eine deutsche
Gynäkologin hatte eine Praxis in ihrem Bungalow eröffnet.
Eindrucksvoll berichtete die engagierte Entwicklungshelferin
von den schwierigen Anfängen - „kein Strom, Wasser aus einem
Tank, kein Telefon“ - und dem mühsamen Ausbau der Geburtenstation
zum Allgemeinen Krankenhaus. Schwester Miguela erinnerte an
Verständigungsschwierigkeiten und an Einzelschicksale, wie das
einer jungen Frau: Ihr erstes Kind war an Malaria
gestorben. Aus Angst davor, das zweite Kind auf die gleiche Weise
zu verlieren, kam sie trotz Verbot des Vaters in die Klinik
gelaufen. Die Kenntnis der Sitten und Gebräuche sowie
das Erlernen der schwierigen Sprache der Einheimischen waren für
die Arbeit der Schwestern enorm wichtig, betonte die
Referentin.
1957, im Jahr der
Unabhängigkeit Ghanas, waren die ersten vier Schwestern vom
Institut St.Dominikus ausgesandt worden Sie sollten eine
Wochenstation übernehmen und eine kleine Klinik. Eine deutsche
Gynäkologin hatte eine Praxis in ihrem Bungalow eröffnet.
Eindrucksvoll berichtete die engagierte Entwicklungshelferin
von den schwierigen Anfängen - „kein Strom, Wasser aus einem
Tank, kein Telefon“ - und dem mühsamen Ausbau der Geburtenstation
zum Allgemeinen Krankenhaus. Schwester Miguela erinnerte an
Verständigungsschwierigkeiten und an Einzelschicksale, wie das
einer jungen Frau: Ihr erstes Kind war an Malaria
gestorben. Aus Angst davor, das zweite Kind auf die gleiche Weise
zu verlieren, kam sie trotz Verbot des Vaters in die Klinik
gelaufen. Die Kenntnis der Sitten und Gebräuche sowie
das Erlernen der schwierigen Sprache der Einheimischen waren für
die Arbeit der Schwestern enorm wichtig, betonte die
Referentin. Neben ihrem Einsatz
im Gesundheitswesen kümmerte sich Schwester Miguela nahezu 30 Jahre
lang zudem um die medizinische und soziale Betreuung der
Häftlinge im größten Gefängnis Ghanas. Als sie das erste Mal
dorthin kam, erschrak sie: „Ich sah lebende Skelette hinter
Gittern.“ Da war ihr schnell klar, dass diese armen Menschen, -
überwiegend politische Häftlinge - bisweilen Zuspruch und
regelmäßig von den Mitschwestern gebackenes Brot benötigten.
Neben ihrem Einsatz
im Gesundheitswesen kümmerte sich Schwester Miguela nahezu 30 Jahre
lang zudem um die medizinische und soziale Betreuung der
Häftlinge im größten Gefängnis Ghanas. Als sie das erste Mal
dorthin kam, erschrak sie: „Ich sah lebende Skelette hinter
Gittern.“ Da war ihr schnell klar, dass diese armen Menschen, -
überwiegend politische Häftlinge - bisweilen Zuspruch und
regelmäßig von den Mitschwestern gebackenes Brot benötigten. Speyer. Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich
Schiller, Friedrich Hölderlin, Ludwig Uhland, Joseph von
Eichendorff, Victor Hugo, Eugen Roth und Günter Grass -um nur
einige zu nennen – haben eines gemeinsam: Sie alle haben irgendwann
einmal in einem Gedicht, Geschichten oder Erinnerungen etwas über
die Stadt Speyer geschrieben. Manchmal waren es nur ein paar
Zeilen, aber bisweilen sind es auch größere Abhandlungen. Und alle
Lobeshymnen und die wenigen negativen Erlebnisberichte haben der
damalige Bürgermeister und spätere Oberbürgermeister Werner
Schineller und Verleger Hermann G.Klein gesammelt und 1986 in einem
Lesebuch herausgegeben. Nun erinnerte Schineller im Erzählcafé des
Seniorenbüros auszugsweise an die unter dem Buchtitel „Macht euch
auf nach Speyer“ zu Papier gebrachten Gedanken der Schriftsteller,
Dichter oder Künstler und ergänzte den bemerkenswerten
Literatur-Spiegel durch Äußerungen von Politikern, Kirchenleuten
und Kulturschaffenden. Viele Zitate nutzte Schineller zum Aufbau
seiner „einigen tausend Grußworte“.
Speyer. Johann Wolfgang von Goethe, Friedrich
Schiller, Friedrich Hölderlin, Ludwig Uhland, Joseph von
Eichendorff, Victor Hugo, Eugen Roth und Günter Grass -um nur
einige zu nennen – haben eines gemeinsam: Sie alle haben irgendwann
einmal in einem Gedicht, Geschichten oder Erinnerungen etwas über
die Stadt Speyer geschrieben. Manchmal waren es nur ein paar
Zeilen, aber bisweilen sind es auch größere Abhandlungen. Und alle
Lobeshymnen und die wenigen negativen Erlebnisberichte haben der
damalige Bürgermeister und spätere Oberbürgermeister Werner
Schineller und Verleger Hermann G.Klein gesammelt und 1986 in einem
Lesebuch herausgegeben. Nun erinnerte Schineller im Erzählcafé des
Seniorenbüros auszugsweise an die unter dem Buchtitel „Macht euch
auf nach Speyer“ zu Papier gebrachten Gedanken der Schriftsteller,
Dichter oder Künstler und ergänzte den bemerkenswerten
Literatur-Spiegel durch Äußerungen von Politikern, Kirchenleuten
und Kulturschaffenden. Viele Zitate nutzte Schineller zum Aufbau
seiner „einigen tausend Grußworte“. Bei dem von Karl-Heinz Jung moderierten und mit
Powerpoint-Fotos unterlegten Vortrag im gut besuchten Historischen
Rathaus räumte Schineller freilich den Speyerern breiten Raum ein.
So zitierte er aus dem „Vermächtnis“ des in der Domstadt geborenen
Malers Anselm Feuerbach (1829 bis 1880) eine passage, in der die
Domstadt nicht ganz so gut wegkommt. Bildhaft umschreibt der 1839
in Speyer zur Welt gekommene Ly
Bei dem von Karl-Heinz Jung moderierten und mit
Powerpoint-Fotos unterlegten Vortrag im gut besuchten Historischen
Rathaus räumte Schineller freilich den Speyerern breiten Raum ein.
So zitierte er aus dem „Vermächtnis“ des in der Domstadt geborenen
Malers Anselm Feuerbach (1829 bis 1880) eine passage, in der die
Domstadt nicht ganz so gut wegkommt. Bildhaft umschreibt der 1839
in Speyer zur Welt gekommene Ly-01.jpg) Speyer- Neben den Passagier- und
Transportschiffen stellte der langjährige Vorsitzende des
Schiffervereins, Günter Kuhn, Klapp-, Mess-, Hebe-, Bergungs- u.
Fährschiffe sowie Feuerlösch- und Polizeiboote vor.
Speyer- Neben den Passagier- und
Transportschiffen stellte der langjährige Vorsitzende des
Schiffervereins, Günter Kuhn, Klapp-, Mess-, Hebe-, Bergungs- u.
Fährschiffe sowie Feuerlösch- und Polizeiboote vor.-01.jpg) Günter Kuhn beobachtet die Versorgung der Schiffe mit
Kühlwagen und Containern voll Lebensmittel, die aus Holland
angeliefert werden( Vollverpflegung an Bord). Auch Busse mit
osteuropäischen Kennzeichen werden eingesetzt. Selbst die
Liegegebühren versuchen die Kapitäne zu umgehen, indem die
Wartezeit durch „Ankern“ auf der „badischen Seite“ versucht wird.
Hier erfolgt das Verbot durch die Wasserschutzpolizei jedoch
umgehend.
Günter Kuhn beobachtet die Versorgung der Schiffe mit
Kühlwagen und Containern voll Lebensmittel, die aus Holland
angeliefert werden( Vollverpflegung an Bord). Auch Busse mit
osteuropäischen Kennzeichen werden eingesetzt. Selbst die
Liegegebühren versuchen die Kapitäne zu umgehen, indem die
Wartezeit durch „Ankern“ auf der „badischen Seite“ versucht wird.
Hier erfolgt das Verbot durch die Wasserschutzpolizei jedoch
umgehend.-01.jpg) Lasten wie Schüttgut (Sand, Kies, Steine, Kohlen) sind in
Stauräumen durch Längs- u. Querschotten (Stahlwände) gesichert.
Container, in den Maschinen, Autos, Möbel usw. transportiert
werden, sind mit besonderen Sicherheitssystemen befestigt. Trotzdem
musste Günter Kuhn mit seinem „Hebebock“ mehrmals verlorene
Container im Rhein suchen und bergen. Die Strömung verschiebt diese
Container sehr schnell „zu Tal“ und sie gefährden dadurch weitere
Schiffe. Taucher und Froschmänner sind bei der Suche behilflich und
erledigen dabei einen lebensbedrohlichen Job.
Lasten wie Schüttgut (Sand, Kies, Steine, Kohlen) sind in
Stauräumen durch Längs- u. Querschotten (Stahlwände) gesichert.
Container, in den Maschinen, Autos, Möbel usw. transportiert
werden, sind mit besonderen Sicherheitssystemen befestigt. Trotzdem
musste Günter Kuhn mit seinem „Hebebock“ mehrmals verlorene
Container im Rhein suchen und bergen. Die Strömung verschiebt diese
Container sehr schnell „zu Tal“ und sie gefährden dadurch weitere
Schiffe. Taucher und Froschmänner sind bei der Suche behilflich und
erledigen dabei einen lebensbedrohlichen Job.-01.jpg) Der rege Schiffsverkehr auf dem Rhein verlangt eine
Sicherung der Fahrrinne durch Bojen, welche auch auf
„Gefahrenquellen“ hinweisen. Das „ Kies- u. Sandgeschiebe“ schafft
aber oft Hindernisse, die markiert und mit Hilfe der „Eimerbagger“
beseitigt werden. Vor den Staustufen wird der Kies aufgehalten,
hinter dem Bauwerk nagt das strömende Wasser an den Fundamenten der
Bauwerke. Hier hilft der Einsatz der „Klappschiffe“. Mit Kies
beladen kann so ein Ausgleich auf der Flusssohle hergestellt
werden, indem Kies über die Bodenklappe in den Fluss geschüttet
wird. Obwohl genügend Wasser vorhanden ist, kann ein Feuer auf dem
Schiff nur von Feuerlöschbooten bekämpft werden. Mit dem
„Stäubesystem“ (Feuer berieseln) wird dem Feuer der Sauerstoff
entzogen und somit erstickt. Die Löschboote verfügen über
eine Innen-Überdruckkabine, die vor schädlichen Gasen
schützt. Der „Schottelantrieb“ befähigt das zu Boot zu
umfangreicher, schneller Positionierung.
Der rege Schiffsverkehr auf dem Rhein verlangt eine
Sicherung der Fahrrinne durch Bojen, welche auch auf
„Gefahrenquellen“ hinweisen. Das „ Kies- u. Sandgeschiebe“ schafft
aber oft Hindernisse, die markiert und mit Hilfe der „Eimerbagger“
beseitigt werden. Vor den Staustufen wird der Kies aufgehalten,
hinter dem Bauwerk nagt das strömende Wasser an den Fundamenten der
Bauwerke. Hier hilft der Einsatz der „Klappschiffe“. Mit Kies
beladen kann so ein Ausgleich auf der Flusssohle hergestellt
werden, indem Kies über die Bodenklappe in den Fluss geschüttet
wird. Obwohl genügend Wasser vorhanden ist, kann ein Feuer auf dem
Schiff nur von Feuerlöschbooten bekämpft werden. Mit dem
„Stäubesystem“ (Feuer berieseln) wird dem Feuer der Sauerstoff
entzogen und somit erstickt. Die Löschboote verfügen über
eine Innen-Überdruckkabine, die vor schädlichen Gasen
schützt. Der „Schottelantrieb“ befähigt das zu Boot zu
umfangreicher, schneller Positionierung. Historische
Rheinübergänge bei Speyer mit Rudi Höhl
Historische
Rheinübergänge bei Speyer mit Rudi Höhl.jpg) Die
zweite Fähre querte im Süden der Stadt, etwa ab 1290, nach
Lußheim, auch in die Besitzungen des Speyerer Bischofs, der in
Bruchsal Stadtherr war. Urkundlich erwähnt sind ferner Fähren bei
Rheinsheim (1191), Rheinhausen (1296) und Udenheim -Philippsburg
(1297). Nach nur wenigen Jahren wurde ein Fährbetrieb von
Mechtersheim nach Philippsburg wegen Gebiets- und Erbstreitigkeiten
aufgegeben.
Die
zweite Fähre querte im Süden der Stadt, etwa ab 1290, nach
Lußheim, auch in die Besitzungen des Speyerer Bischofs, der in
Bruchsal Stadtherr war. Urkundlich erwähnt sind ferner Fähren bei
Rheinsheim (1191), Rheinhausen (1296) und Udenheim -Philippsburg
(1297). Nach nur wenigen Jahren wurde ein Fährbetrieb von
Mechtersheim nach Philippsburg wegen Gebiets- und Erbstreitigkeiten
aufgegeben..jpg) Wegen des
ständig steigenden Schiffsverkehrs musste die Schiffsbrücke bis zu
30 Mal am Tag geöffnet werden. Der Wunsch des Speyerer
Stadtrates nach einer festen Rheinbrücke wurde mehrfach
negativ beschieden. Erst Jahre 1929 und 1930 stellte die Regierung
die Mittel bereit. Der Spatenstich für die Speyerer Rheinbrücke
erfolgte am 23.September 1938, die Einweihung 1938. Nur ganze
sieben Jahre hielt die tolle Verbindung „von hiwwe nach driwwe“. Am
23.März 1945 wurde sie beim Rückzug von der Wehrmacht gesprengt,
die Fähren in Rheinhausen und Oberhausen wurden am badischen Ufer
gesprengt und versenkt. Schon am 31.März erbaute die
französische Armee an der Stelle der alten Speyerer
Schiffsbrücke eine Pontonbrücke und erweiterte ihre militärischen
Aktionen ins Badische.
Wegen des
ständig steigenden Schiffsverkehrs musste die Schiffsbrücke bis zu
30 Mal am Tag geöffnet werden. Der Wunsch des Speyerer
Stadtrates nach einer festen Rheinbrücke wurde mehrfach
negativ beschieden. Erst Jahre 1929 und 1930 stellte die Regierung
die Mittel bereit. Der Spatenstich für die Speyerer Rheinbrücke
erfolgte am 23.September 1938, die Einweihung 1938. Nur ganze
sieben Jahre hielt die tolle Verbindung „von hiwwe nach driwwe“. Am
23.März 1945 wurde sie beim Rückzug von der Wehrmacht gesprengt,
die Fähren in Rheinhausen und Oberhausen wurden am badischen Ufer
gesprengt und versenkt. Schon am 31.März erbaute die
französische Armee an der Stelle der alten Speyerer
Schiffsbrücke eine Pontonbrücke und erweiterte ihre militärischen
Aktionen ins Badische.
 Speyer- Einige Senioren hatten auf ein
Probier-Gläschen gehofft, wenn es schon eine gute Stunde lang rund
um den Ruländerwein ging. Aber die Kehlen blieben trocken beim
Vortrag von Stadtarchiv-Leiter Dr.Joachim Kemper, der sein Thema
„Speyer, der Ruländer und die Weinstadt am Rhein“ mit historischen
Bildern beleuchtete . Anhand einer Karte von 1821 zeigte Moderator
Karl-Heinz Jung einleitend auf, wie viele Rebstöcke in dieser Zeit
im Stadtgebiet standen – die meisten an Klöstern, wie dem St.
Magdalena-Kloster im Hasenpfuhl. Seine Erklärung hierfür: „Der Wein
war sauber, das Wasser nicht immer.“
Speyer- Einige Senioren hatten auf ein
Probier-Gläschen gehofft, wenn es schon eine gute Stunde lang rund
um den Ruländerwein ging. Aber die Kehlen blieben trocken beim
Vortrag von Stadtarchiv-Leiter Dr.Joachim Kemper, der sein Thema
„Speyer, der Ruländer und die Weinstadt am Rhein“ mit historischen
Bildern beleuchtete . Anhand einer Karte von 1821 zeigte Moderator
Karl-Heinz Jung einleitend auf, wie viele Rebstöcke in dieser Zeit
im Stadtgebiet standen – die meisten an Klöstern, wie dem St.
Magdalena-Kloster im Hasenpfuhl. Seine Erklärung hierfür: „Der Wein
war sauber, das Wasser nicht immer.“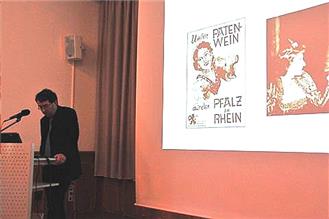 Der von vielen
Landesherren geförderte Ruländeranbau sorgte für eine
zunehmende Verbreitung dieser Rebsorte. Die rötlich-rot
gefärbte Ruländerrebe ist im deutschen Sprachraum unter der
Bezeichnung Grauburgunder bekannt und zu der Zeit von Rulands
„Entdeckung“ auch schon weit verbreitet gewesen. Man versteht
darunter die eher trockene Variante des Weines, während die
Bezeichnung „Ruländer“ in de Regel den lieblichen Ausbau der
Rebsorte aus reifen und zum Teil edelfaulen Trauben meint. In
Frankreich, Australien und Luxemburg, dominiert die Bezeichnung
Pinot gris, in Italien heißt der Grauburgunder Pinot grigio. Die im
Elsass lange gebräuchliche Sortenbezeichnung „Tokayer“ darf seit
kurzem aufgrund einer Klage aus Ungarn (Weinanbaugebiet Tokajer)
nicht mehr verwendet werden, erklärte Kemper.
Der von vielen
Landesherren geförderte Ruländeranbau sorgte für eine
zunehmende Verbreitung dieser Rebsorte. Die rötlich-rot
gefärbte Ruländerrebe ist im deutschen Sprachraum unter der
Bezeichnung Grauburgunder bekannt und zu der Zeit von Rulands
„Entdeckung“ auch schon weit verbreitet gewesen. Man versteht
darunter die eher trockene Variante des Weines, während die
Bezeichnung „Ruländer“ in de Regel den lieblichen Ausbau der
Rebsorte aus reifen und zum Teil edelfaulen Trauben meint. In
Frankreich, Australien und Luxemburg, dominiert die Bezeichnung
Pinot gris, in Italien heißt der Grauburgunder Pinot grigio. Die im
Elsass lange gebräuchliche Sortenbezeichnung „Tokayer“ darf seit
kurzem aufgrund einer Klage aus Ungarn (Weinanbaugebiet Tokajer)
nicht mehr verwendet werden, erklärte Kemper. Rebsorte. Seit 32
Jahren darf sich Speyer laut Joachim Kemper ganz offiziell
wieder Weinbaugemeinde nennen. Der damals neu angelegte Wingert am
Tafelsbrunnen (Richtung Römerberg) umfasst elf Rebzeilen mit rund
660 Rebstöcken. Die Erntemenge liegt bei durchschnittlich 1000
Litern. Immerhin zweimal erhielt der Ruländerwein der Stadt die
„Bronzene Kammerpreismünze“, ein Mal gar die Silberne. Die Trauben
werden in Neustadt gekeltert und für die Stadtverwaltung in
0,7-Liter-Flaschen abgefüllt. Der Ruländer wird als
regelrechter Repräsentationswein gerne verschenkt, aber auch gerne
bei feierlichen Anlässen getrunken.
Rebsorte. Seit 32
Jahren darf sich Speyer laut Joachim Kemper ganz offiziell
wieder Weinbaugemeinde nennen. Der damals neu angelegte Wingert am
Tafelsbrunnen (Richtung Römerberg) umfasst elf Rebzeilen mit rund
660 Rebstöcken. Die Erntemenge liegt bei durchschnittlich 1000
Litern. Immerhin zweimal erhielt der Ruländerwein der Stadt die
„Bronzene Kammerpreismünze“, ein Mal gar die Silberne. Die Trauben
werden in Neustadt gekeltert und für die Stadtverwaltung in
0,7-Liter-Flaschen abgefüllt. Der Ruländer wird als
regelrechter Repräsentationswein gerne verschenkt, aber auch gerne
bei feierlichen Anlässen getrunken.
 Ebenso erfreut waren die Mitarbeitenden, die
Heimleiterin Sabine Rumpf-Alles und Pflegedienstleiter Dado Plavsic
im Diakonissen Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden
jeweils zu Schichtbeginn persönlich mit einem kleinen Dankeschön in
Empfang nahmen.
Ebenso erfreut waren die Mitarbeitenden, die
Heimleiterin Sabine Rumpf-Alles und Pflegedienstleiter Dado Plavsic
im Diakonissen Seniorenzentrum Wolffstift in Kirchheimbolanden
jeweils zu Schichtbeginn persönlich mit einem kleinen Dankeschön in
Empfang nahmen. Speyer- Am
25. Mai 1959 wurde die Urkunde von Oberbürgermeister Paulus Skopp
und seinem französischen Kollegen Joseph Pichard in Chartres
unterschrieben und somit die Partnerschaft zwischen beiden Städten
feierlich besiegelt. „Die Urkunde beruft sich auf eine gemeinsame
Tradition und beide Städte verpflichten sich mit dem
Dokument, beständige Verbindung zu pflegen, den Austausch der
Bürger zu fördern und damit die europäische Bruderschaft zu
stärken“(siehe Goldenes Buch der Partnerschaften).
Speyer- Am
25. Mai 1959 wurde die Urkunde von Oberbürgermeister Paulus Skopp
und seinem französischen Kollegen Joseph Pichard in Chartres
unterschrieben und somit die Partnerschaft zwischen beiden Städten
feierlich besiegelt. „Die Urkunde beruft sich auf eine gemeinsame
Tradition und beide Städte verpflichten sich mit dem
Dokument, beständige Verbindung zu pflegen, den Austausch der
Bürger zu fördern und damit die europäische Bruderschaft zu
stärken“(siehe Goldenes Buch der Partnerschaften). Dr. Roßkopf stellte
Speyer und Chartres als Schwesterstädte im besten Sinn des Begriffs
vor. Dies bezieht sich nicht nur auf den majestätischen romanischen
Dom und die weltberühmte gotische Kathedrale mit herrlichen
Glasfenstern sondern auch auf die Funde keltischen Ursprungs,
die bei Grabungen in beiden Städten immer wieder auftauchen.
Beide Bischofsstädte hatten einflussreiche Domschulen; in Chartres
wurde der französische Heinrich IV. gekrönt, Speyer war Stadt des
Reichskammergerichts bis 1688 und erlangte große Bedeutung durch
die Reichstage von 1526 und 1529. Besondere Erwähnung fand
auch Bernhard von Clairveaux , der an Weihnachten 1146 den
deutschen König Konrad III. im Speyerer Dom zum Kreuzzug
aufforderte.
Dr. Roßkopf stellte
Speyer und Chartres als Schwesterstädte im besten Sinn des Begriffs
vor. Dies bezieht sich nicht nur auf den majestätischen romanischen
Dom und die weltberühmte gotische Kathedrale mit herrlichen
Glasfenstern sondern auch auf die Funde keltischen Ursprungs,
die bei Grabungen in beiden Städten immer wieder auftauchen.
Beide Bischofsstädte hatten einflussreiche Domschulen; in Chartres
wurde der französische Heinrich IV. gekrönt, Speyer war Stadt des
Reichskammergerichts bis 1688 und erlangte große Bedeutung durch
die Reichstage von 1526 und 1529. Besondere Erwähnung fand
auch Bernhard von Clairveaux , der an Weihnachten 1146 den
deutschen König Konrad III. im Speyerer Dom zum Kreuzzug
aufforderte.  „Nirgendwo hat
sich die Aussöhnung spontaner und überzeugender erwiesen als in der
Städtepartnerschaft, die als Freundschaft wahrgenommen wurde“, so
Dr. Roßkopf. Über 1000 Bürger aus Speyer und dem Umland fuhren in
einem Sonderzug 1972 nach Chartres, wo bereits weitere
„Chartresfreunde“ mit Pkw eingetroffen waren; 1969 waren 700
Besucher aus Chartres nach Speyer gekommen. Die
Pfingsttreffen „bewegten“ die Speyerer und die Chartrainer
wechselseitig in West- und Ostrichtung zur „Jumelage“.
„Nirgendwo hat
sich die Aussöhnung spontaner und überzeugender erwiesen als in der
Städtepartnerschaft, die als Freundschaft wahrgenommen wurde“, so
Dr. Roßkopf. Über 1000 Bürger aus Speyer und dem Umland fuhren in
einem Sonderzug 1972 nach Chartres, wo bereits weitere
„Chartresfreunde“ mit Pkw eingetroffen waren; 1969 waren 700
Besucher aus Chartres nach Speyer gekommen. Die
Pfingsttreffen „bewegten“ die Speyerer und die Chartrainer
wechselseitig in West- und Ostrichtung zur „Jumelage“. Die besondere
Bedeutung von Giscard d`Estaing, ehemaliger Präsident Frankreichs
und Helmut Schmidt, früherer deutscher Bundeskanzler,
erhalten den Deutsch-Französischen Medienpreis, für den neuen
Elan, den beide den deutsch-französischen Beziehungen verliehen
haben. Darin wird nach Dr. Roßkopf auch die Rolle der Nachbarländer
für die Einheit Europas gewürdigt. So könnten auch die
Städtepartnerschaften nach 55 Jahren sich weitere Situationen
suchen, um hilfreich das Rückgrat Europas zu stärken. „Das
Bewusstsein bleibender Zusammengehörigkeit und gleichzeitig
aufgeschlossen und neugierig für weiterführende Gemeinsamkeiten
sein, woraus weiterführende ASPEKTE und Anregungen zu erwarten
sind; im Bereich der Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr
und der politischen Praxis“, so der Wunsch von Herrn Dr.
Roßkopf.
Die besondere
Bedeutung von Giscard d`Estaing, ehemaliger Präsident Frankreichs
und Helmut Schmidt, früherer deutscher Bundeskanzler,
erhalten den Deutsch-Französischen Medienpreis, für den neuen
Elan, den beide den deutsch-französischen Beziehungen verliehen
haben. Darin wird nach Dr. Roßkopf auch die Rolle der Nachbarländer
für die Einheit Europas gewürdigt. So könnten auch die
Städtepartnerschaften nach 55 Jahren sich weitere Situationen
suchen, um hilfreich das Rückgrat Europas zu stärken. „Das
Bewusstsein bleibender Zusammengehörigkeit und gleichzeitig
aufgeschlossen und neugierig für weiterführende Gemeinsamkeiten
sein, woraus weiterführende ASPEKTE und Anregungen zu erwarten
sind; im Bereich der Stadtentwicklung, Bauen, Verkehr
und der politischen Praxis“, so der Wunsch von Herrn Dr.
Roßkopf. Der
ehemalige Kirchenpräsident Eberhard Cherdron im
Erzählcafé
Der
ehemalige Kirchenpräsident Eberhard Cherdron im
Erzählcafé „ Das
Deckengemälde der Barockkirche zeigt König David beim Harfenspiel.
Erin großes Orchester von Engeln mit verschiedenen Instrumenten
umschweben die Orgel, bis die heilige Cäcilia den Musikkreis
ergänzt“, so Eberhard Cherdron. „ Der umfangreiche Bilderschmuck an
den Emporen, meist eine Verbindung zwischen dem Alten und Neuen
Testament, stellt einen reichen Schatz dieses Gotteshauses dar, dem
man einen ganzen Erzählnachmittag widmen könnte. Die vorgesehene
Restaurierung der Bilder wird viele Monate in Anspruch nehmen,
damit bei der 300-Jahrfeier 2017 eine strahlende Bilderwelt zu
bestaunen sein wird“, so der Kirchenpräsident in Ruhe.
„ Das
Deckengemälde der Barockkirche zeigt König David beim Harfenspiel.
Erin großes Orchester von Engeln mit verschiedenen Instrumenten
umschweben die Orgel, bis die heilige Cäcilia den Musikkreis
ergänzt“, so Eberhard Cherdron. „ Der umfangreiche Bilderschmuck an
den Emporen, meist eine Verbindung zwischen dem Alten und Neuen
Testament, stellt einen reichen Schatz dieses Gotteshauses dar, dem
man einen ganzen Erzählnachmittag widmen könnte. Die vorgesehene
Restaurierung der Bilder wird viele Monate in Anspruch nehmen,
damit bei der 300-Jahrfeier 2017 eine strahlende Bilderwelt zu
bestaunen sein wird“, so der Kirchenpräsident in Ruhe. Dort
berichtete der ehemalige Kirchenpräsidenten erstmals einiges
über seine Bilderbuchkarriere. Nach dem Staatsexamen und einer
einjährigen Ausbildung im Predigerseminar Landau trat er seine
Vikariatsstelle an. Damit war es erstmals genug mit der
Theologie, es schloss sich das Studium der Volkswirtschaft in
Mannheim an, das er unter anderem damit finanzierte, dass er in der
Edith-Stein-Schule Religionsunterricht gab. Doch nach diesem
Studium trat er seine erste Pfarrstelle für drei Jahre in Neuhofen
an. Von dort berief man ihn als Landesjugendpfarrer nach
Kaiserslautern, wo er sich mit Freuden für sieben Jahre mit
Leib und Seele einbrachte.
Dort
berichtete der ehemalige Kirchenpräsidenten erstmals einiges
über seine Bilderbuchkarriere. Nach dem Staatsexamen und einer
einjährigen Ausbildung im Predigerseminar Landau trat er seine
Vikariatsstelle an. Damit war es erstmals genug mit der
Theologie, es schloss sich das Studium der Volkswirtschaft in
Mannheim an, das er unter anderem damit finanzierte, dass er in der
Edith-Stein-Schule Religionsunterricht gab. Doch nach diesem
Studium trat er seine erste Pfarrstelle für drei Jahre in Neuhofen
an. Von dort berief man ihn als Landesjugendpfarrer nach
Kaiserslautern, wo er sich mit Freuden für sieben Jahre mit
Leib und Seele einbrachte. Während
des Dienstes ergeben sich viele Kontaktgespräche mit Politikern des
Landes, auch mit Repräsentanten der Kirchen anderer Länder und auch
Völker. Zusammen mit Pfarrer Linvers wies er auch auf die seit
Jahrzehnten gute Zusammenarbeit mit den Katholiken hin, ein
Verhältnis, das durch die Nähe der Sitze beider und die
Übereinstimmung der Grenzen profitiere.
Während
des Dienstes ergeben sich viele Kontaktgespräche mit Politikern des
Landes, auch mit Repräsentanten der Kirchen anderer Länder und auch
Völker. Zusammen mit Pfarrer Linvers wies er auch auf die seit
Jahrzehnten gute Zusammenarbeit mit den Katholiken hin, ein
Verhältnis, das durch die Nähe der Sitze beider und die
Übereinstimmung der Grenzen profitiere. Speyer- Eine Gruppe Senioren, die im Rahmen
der Reihe „Hören und Sehen“ des Seniorenbüros Speyer einer
Einladung von Hans Günther Glaser gefolgt waren sah dies genauso
und mancher Besucher lies sich karikieren.
Speyer- Eine Gruppe Senioren, die im Rahmen
der Reihe „Hören und Sehen“ des Seniorenbüros Speyer einer
Einladung von Hans Günther Glaser gefolgt waren sah dies genauso
und mancher Besucher lies sich karikieren. Ein sehr gutes
Ergebnis für die Waldseer Pflegeeinrichtung der Mannheimer avendi
Senioren Service GmbH
Ein sehr gutes
Ergebnis für die Waldseer Pflegeeinrichtung der Mannheimer avendi
Senioren Service GmbH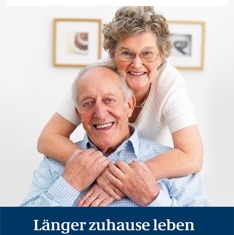 Die Ansprüche an die eigene Wohnumgebung verändern sich im
Laufe des Lebens. Ein Zuhause für die ganze Familie muss andere
Anforderungen erfüllen, als für ein Leben zu zweit nach dem Auszug
der Kinder. Der klassische Grundriss für Einfamilienhäuser der
1960er bis 1980er sah neben dem Keller einen abgetrennten Ess- und
Küchenbereich, Garderobe, Wohnzimmer, Schlafzimmer und
Gästetoilette im Erdgeschoss vor sowie Kinderzimmer, Bad und
Gästezimmer im Obergeschoss und einen geräumigen Dachboden, zu dem
nicht selten eine Holzleiter oder schmale Wendeltreppe
führte.
Die Ansprüche an die eigene Wohnumgebung verändern sich im
Laufe des Lebens. Ein Zuhause für die ganze Familie muss andere
Anforderungen erfüllen, als für ein Leben zu zweit nach dem Auszug
der Kinder. Der klassische Grundriss für Einfamilienhäuser der
1960er bis 1980er sah neben dem Keller einen abgetrennten Ess- und
Küchenbereich, Garderobe, Wohnzimmer, Schlafzimmer und
Gästetoilette im Erdgeschoss vor sowie Kinderzimmer, Bad und
Gästezimmer im Obergeschoss und einen geräumigen Dachboden, zu dem
nicht selten eine Holzleiter oder schmale Wendeltreppe
führte.
 Tanzschule Thiele vor der 90-Jahr-Feier voll in
Schwung…….
Tanzschule Thiele vor der 90-Jahr-Feier voll in
Schwung……. Als Vater Albert als entlassener Kriegsgefangener wieder
in Speyer eintraf, ging das Tanzstundentraining umgehend in
gemieteten Räumen weiter.- So ist die Tanzstundenzeit in den
Cafés Hilzinger und Ebert, der Schwarz´schen Brauerei, dem
Domnapf, Sternemoos, Gambrinus, Wittelsbacher Hof, Goldener Adler,
im Katholischen Vereinshaus, bei der Rudergesellschaft, dem
Wassersportverein und im Pfarrzentrum St. Otto, vielen anwesenden-
Junggebliebenen in bester Erinnerung, wie in Redebeiträgen bekundet
wurde. Interessant ist auch Frau Thieles Aussage zu werten, „
dass Privatunterricht für Speyerer Prominenz im ausgeräumten
Wohnzimmer der Krügers arrangiert wurde“. Sie erzählte ganz
begeistert von ihrem Vater, der nach weiteren Prüfungen 1929
zum Mitglied der Fachprüfungskommission ernannt, mit 27 Jahren
seine erste Goldmedaille für Leistungen als Fachlehrer erhielt und
anerkannter Wertungsrichter mit zahlreichen Einsätzen bei
repräsentativen Turnieren wurde. „Er lehrte stets das Neueste,
vergaß aber nie die Vermittlung des Traditionellen. War dezenter
Regisseur bei der Polonaise, lenkte mit Charme und Witz schwierige
Tanzpassagen und wurde von Tanzschülern, wie bei mitbegründeten
Tischtennisclub, bei Billard und Schachfreunden liebevoll - Papa
Krüger - genannt“, so Ursula Thiele. Weiter berichtete sie,
dass ihr Vater mit seinen Neugründungen stets Glück hatte, so auch
mit dem „ Hobbykreis Grün-Gold“, aus dem sich später der
erfolgreiche Tanzsportclub entwickelte.
Als Vater Albert als entlassener Kriegsgefangener wieder
in Speyer eintraf, ging das Tanzstundentraining umgehend in
gemieteten Räumen weiter.- So ist die Tanzstundenzeit in den
Cafés Hilzinger und Ebert, der Schwarz´schen Brauerei, dem
Domnapf, Sternemoos, Gambrinus, Wittelsbacher Hof, Goldener Adler,
im Katholischen Vereinshaus, bei der Rudergesellschaft, dem
Wassersportverein und im Pfarrzentrum St. Otto, vielen anwesenden-
Junggebliebenen in bester Erinnerung, wie in Redebeiträgen bekundet
wurde. Interessant ist auch Frau Thieles Aussage zu werten, „
dass Privatunterricht für Speyerer Prominenz im ausgeräumten
Wohnzimmer der Krügers arrangiert wurde“. Sie erzählte ganz
begeistert von ihrem Vater, der nach weiteren Prüfungen 1929
zum Mitglied der Fachprüfungskommission ernannt, mit 27 Jahren
seine erste Goldmedaille für Leistungen als Fachlehrer erhielt und
anerkannter Wertungsrichter mit zahlreichen Einsätzen bei
repräsentativen Turnieren wurde. „Er lehrte stets das Neueste,
vergaß aber nie die Vermittlung des Traditionellen. War dezenter
Regisseur bei der Polonaise, lenkte mit Charme und Witz schwierige
Tanzpassagen und wurde von Tanzschülern, wie bei mitbegründeten
Tischtennisclub, bei Billard und Schachfreunden liebevoll - Papa
Krüger - genannt“, so Ursula Thiele. Weiter berichtete sie,
dass ihr Vater mit seinen Neugründungen stets Glück hatte, so auch
mit dem „ Hobbykreis Grün-Gold“, aus dem sich später der
erfolgreiche Tanzsportclub entwickelte. Nach einigen Schwierigkeiten konnte 1973 der Neubau in der
Raiffeisenstraße in herrlicher Umgebung, mit großem
Parkplatz, viel Tageslicht, vom Stadtzentrum gut erreichbar,
bezogen werden. Ballett, Gymnastik, Yoga, Jazztanz wurden von den
engagierten Gisèle Santoro ( Brasilien) und Anneliese Theobald
angeboten. Weitere Tanzkreise entstanden. Werner und Ursula Thiele
hielten sich jahrelang bei erfolgreichen Profiturnieren (Slowfox/
Samba) für ihren Club fit. Schmunzelnd erzählte Herr Thiele vom
verlorenen Unterkleid seiner Partnerin und den Problemen mit seiner
„ verjüngenden“ Perücke. Als Landestrainer,
Fachbeiratsmitglieder, Übungsleiter, Wertungsrichter wurden Ehepaar
Thiele verpflichtet. Ursula Thiele berichtete, dass alle drei
Kinder schon früh die Liebe zum Tanzen entdeckten. Peter für Boogie
und Rock`n Roll, Monika tanzt Turnier in der
lateinamerikanischen Sektion, wurde Landesmeister in der D-und
C-Klasse. Ulla begeisterte sich nach der klassischen
Ballettausbildung auch für Jazz-, Step-Tanz, Rock`n Roll und
gewann mehrere Landesmeisterschaften im Standard und Latein.
Nach einigen Schwierigkeiten konnte 1973 der Neubau in der
Raiffeisenstraße in herrlicher Umgebung, mit großem
Parkplatz, viel Tageslicht, vom Stadtzentrum gut erreichbar,
bezogen werden. Ballett, Gymnastik, Yoga, Jazztanz wurden von den
engagierten Gisèle Santoro ( Brasilien) und Anneliese Theobald
angeboten. Weitere Tanzkreise entstanden. Werner und Ursula Thiele
hielten sich jahrelang bei erfolgreichen Profiturnieren (Slowfox/
Samba) für ihren Club fit. Schmunzelnd erzählte Herr Thiele vom
verlorenen Unterkleid seiner Partnerin und den Problemen mit seiner
„ verjüngenden“ Perücke. Als Landestrainer,
Fachbeiratsmitglieder, Übungsleiter, Wertungsrichter wurden Ehepaar
Thiele verpflichtet. Ursula Thiele berichtete, dass alle drei
Kinder schon früh die Liebe zum Tanzen entdeckten. Peter für Boogie
und Rock`n Roll, Monika tanzt Turnier in der
lateinamerikanischen Sektion, wurde Landesmeister in der D-und
C-Klasse. Ulla begeisterte sich nach der klassischen
Ballettausbildung auch für Jazz-, Step-Tanz, Rock`n Roll und
gewann mehrere Landesmeisterschaften im Standard und Latein.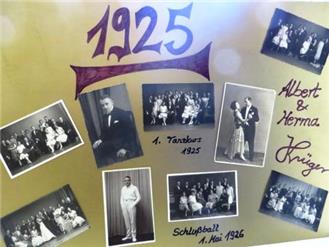 Nach der Ausbildung zu Tanzlehrern bei Weltmeister
Trautz und Opitz-Hädrich stiegen Ulla und Peter verstärkt an der
Raiffeisenstraße ein. Ulla gründete die „ Pink Panther“, Peter
organisierte eine quirlige Booggieformation, woraus Marc Stegmann
und Sabine Zillmann 1993 hervorgingen, welche vor 3000
Zuschauern den 1. Platz ertanzten und Deutschland in New York
vertreten durften. Mike Appelmann und Petra Fedlmeier ergänzen den
Tanzlehrerkreis. „Mit Wehmut im Herzen“, so Ursula und Werner
Thiehle, „ denken wir an schöne Jahre als Tanzlehrer zurück“. In
besonderer Erinnerung blieben die Verleihung der Ehrennadel in Gold
vom Landessportverband, die Silbermedaille des Deutschen
Tanzsportverbandes und die Sportmedaille der Stadt Speyer, so die
Erzähler.
Nach der Ausbildung zu Tanzlehrern bei Weltmeister
Trautz und Opitz-Hädrich stiegen Ulla und Peter verstärkt an der
Raiffeisenstraße ein. Ulla gründete die „ Pink Panther“, Peter
organisierte eine quirlige Booggieformation, woraus Marc Stegmann
und Sabine Zillmann 1993 hervorgingen, welche vor 3000
Zuschauern den 1. Platz ertanzten und Deutschland in New York
vertreten durften. Mike Appelmann und Petra Fedlmeier ergänzen den
Tanzlehrerkreis. „Mit Wehmut im Herzen“, so Ursula und Werner
Thiehle, „ denken wir an schöne Jahre als Tanzlehrer zurück“. In
besonderer Erinnerung blieben die Verleihung der Ehrennadel in Gold
vom Landessportverband, die Silbermedaille des Deutschen
Tanzsportverbandes und die Sportmedaille der Stadt Speyer, so die
Erzähler. Biertresen wurden durch Einkaufstheken
ersetzt
Biertresen wurden durch Einkaufstheken
ersetzt Am heutigen Postplatz residierte einstmals eine der
vielen Speyerer Brauereien. Die Brauerei Zum Storchen
gab ums Jahr 1900 dem Areal seinen Namen „Storchenplatz“ (mit
großräumiger Pferdetränke), ehe die Brauerei in ihre
Neubauten in der Oberen Langgasse umzog. Das
Abbruchmaterial verwendete die Stadt zur Jahrhundertwende zum Bau
des Festplatzes. Geschichte ist auch die Spanische Weinhalle
„Zur Stadt Barcelona“, in der bereits 1862 Wein ausgeschenkt worden
sein soll. Roberto Serra hat in dem früher als Gilgenstraße 3
geführten Anwesen neben dem direkt benachbarten Bayerischen
Hof (heute Schuhgeschäft) von 1914 bis Sommer 1917 eine
Weinwirtschaft betrieben, dann ging das Gebäude in den Besitz von
Fritz Detzner über, der es als „Weinstube Detzner“ führte. Die
Gaststätte, von 1952 in „Zum Falken“ umbenannt, war noch 1996 in
Familienbesitz, zuletzt nach umfangreicher Renovierung als „Bistro
am Altpörtel“. Auch eine Bürgerinitiative konnte 1958 nicht den
Abriss der beliebten Weinwirtschaft „Zum Rössel“ in der
Gilgenstraße 7/8, Geburtshaus des Pfälzer Heimatdichters Fridrich
Blaul und ein 200 Jahre altes Fachwerkhaus, verhindern. Nach Fritz
Wirth stillte in den
Am heutigen Postplatz residierte einstmals eine der
vielen Speyerer Brauereien. Die Brauerei Zum Storchen
gab ums Jahr 1900 dem Areal seinen Namen „Storchenplatz“ (mit
großräumiger Pferdetränke), ehe die Brauerei in ihre
Neubauten in der Oberen Langgasse umzog. Das
Abbruchmaterial verwendete die Stadt zur Jahrhundertwende zum Bau
des Festplatzes. Geschichte ist auch die Spanische Weinhalle
„Zur Stadt Barcelona“, in der bereits 1862 Wein ausgeschenkt worden
sein soll. Roberto Serra hat in dem früher als Gilgenstraße 3
geführten Anwesen neben dem direkt benachbarten Bayerischen
Hof (heute Schuhgeschäft) von 1914 bis Sommer 1917 eine
Weinwirtschaft betrieben, dann ging das Gebäude in den Besitz von
Fritz Detzner über, der es als „Weinstube Detzner“ führte. Die
Gaststätte, von 1952 in „Zum Falken“ umbenannt, war noch 1996 in
Familienbesitz, zuletzt nach umfangreicher Renovierung als „Bistro
am Altpörtel“. Auch eine Bürgerinitiative konnte 1958 nicht den
Abriss der beliebten Weinwirtschaft „Zum Rössel“ in der
Gilgenstraße 7/8, Geburtshaus des Pfälzer Heimatdichters Fridrich
Blaul und ein 200 Jahre altes Fachwerkhaus, verhindern. Nach Fritz
Wirth stillte in den  Zwanziger Jahren Karl Durst den Durst der Gäste, was
ab 1939 „Schorsch“ Hornbach übernahm. Dieser war Mitbegründer der
Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) und im Vorstand des
Verkehrsvereins aktiv. Während „Landauer Tor“ und „Goldene Rose“ in
der Gilgenstraße von der Bildfläche verschwanden, haben sich
der „Goldene Engel“ dort gehalten. Das Gasthaus und somit der
Grundstein des heutigen Hotelkomplexes entstand ums
Jahr 1700 und zählt nach Hopstocks Recherche zu den ältesten
Speyerer Gaststätten. Das Gelände erwarb um 1870 der Bäcker Michael
Schäfer. Dessen Sohn Josef nutzte 1899 bei der Neugestaltung
des „Storchenplatzes“ die Gunst der Stunde und errichtete
neben dem Goldenen Engel eine weitere Gaststätte, der er den
freigewordenen Namen „Zum Storchen“ gab. Als das Wirtshaus
1932 in den Besitz der Bellheimer Brauerei Silbernagel
überging, wurde es in „Zum Pfalzgrafen“ umbenannt.
Zwanziger Jahren Karl Durst den Durst der Gäste, was
ab 1939 „Schorsch“ Hornbach übernahm. Dieser war Mitbegründer der
Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) und im Vorstand des
Verkehrsvereins aktiv. Während „Landauer Tor“ und „Goldene Rose“ in
der Gilgenstraße von der Bildfläche verschwanden, haben sich
der „Goldene Engel“ dort gehalten. Das Gasthaus und somit der
Grundstein des heutigen Hotelkomplexes entstand ums
Jahr 1700 und zählt nach Hopstocks Recherche zu den ältesten
Speyerer Gaststätten. Das Gelände erwarb um 1870 der Bäcker Michael
Schäfer. Dessen Sohn Josef nutzte 1899 bei der Neugestaltung
des „Storchenplatzes“ die Gunst der Stunde und errichtete
neben dem Goldenen Engel eine weitere Gaststätte, der er den
freigewordenen Namen „Zum Storchen“ gab. Als das Wirtshaus
1932 in den Besitz der Bellheimer Brauerei Silbernagel
überging, wurde es in „Zum Pfalzgrafen“ umbenannt. Auf mehr als 220 Jahre bewegte Lokalgeschichte kann auch
die Weinstube „Schwarzamsel“ verweisen. Nachdem bis 1814
zunächst eine Metzgerei in dem Anwesen beheimatet war,
errichtetete Heinrich Brinkmann um 1850 die „Restauration zum
Hahnen“ ein. Um 1914 nannte Karl Schirmer die Wirtschaft in
„Schwarzamsel“ um. Viel gab’s auch zu erzählen über das
„Stermemoos“ in der Karlsgasse. In dem 1714 erbauten
Haus gründete Bierbrauer Wilhelm Hahn 1834 das Gasthaus
„Zum Stern“. Um 1870 erwarb es Heinrich Moos. Da es um diese Zeit
viele Familien mit Namen Moos in Speyer gab, erhielt es den
Beinamen und schließlich die Gaststättenbezeichnung „Zum
Sternemoos“. Im Frühjahr 1960 kam das aus für das
Wirtshaus.
Auf mehr als 220 Jahre bewegte Lokalgeschichte kann auch
die Weinstube „Schwarzamsel“ verweisen. Nachdem bis 1814
zunächst eine Metzgerei in dem Anwesen beheimatet war,
errichtetete Heinrich Brinkmann um 1850 die „Restauration zum
Hahnen“ ein. Um 1914 nannte Karl Schirmer die Wirtschaft in
„Schwarzamsel“ um. Viel gab’s auch zu erzählen über das
„Stermemoos“ in der Karlsgasse. In dem 1714 erbauten
Haus gründete Bierbrauer Wilhelm Hahn 1834 das Gasthaus
„Zum Stern“. Um 1870 erwarb es Heinrich Moos. Da es um diese Zeit
viele Familien mit Namen Moos in Speyer gab, erhielt es den
Beinamen und schließlich die Gaststättenbezeichnung „Zum
Sternemoos“. Im Frühjahr 1960 kam das aus für das
Wirtshaus. An das sehr beliebte „Café Ihm“ neben dem Altpörtel
und das Café-Restaurant Schwesinger“ (heute im Besitz der Deutschen
Bank) am Postplatz erinnerten sich noch viele
Erzählcafe-Besucher. Auch an „Pfälzer Hof“, „Rodensteiner“,
„Domschänke“ und Pfennig-
An das sehr beliebte „Café Ihm“ neben dem Altpörtel
und das Café-Restaurant Schwesinger“ (heute im Besitz der Deutschen
Bank) am Postplatz erinnerten sich noch viele
Erzählcafe-Besucher. Auch an „Pfälzer Hof“, „Rodensteiner“,
„Domschänke“ und Pfennig- ws.Speyer- Die
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist noch heute größer als das
Angebot, das die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS)
seinen Mitgliedern machen kann. An die Anfänge vor 95 Jahren und
die Entwicklung der GBS erinnerten Aufsichtsratsvorsitzende Elke
Jäckle und der frühere kaufmännische Vorstand Bernhard Mückain im
Januar-Erzählcafé des Seniorenbüros. „Ich kenne keine andere
gesellschaftsrechtliche Form, die dem Wohle seiner Mitglieder in
ähnlicher Weise Rechnung trägt“, stellte Mückain die Speyerer
Baugenossenschaft als „etwas Besonderes“ heraus. Zuvor hatte es nur
in Pirmasens und Ludwigshafen Wohnungsbaugesellschaften
gegeben.
ws.Speyer- Die
Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum ist noch heute größer als das
Angebot, das die Gemeinnützige Baugenossenschaft Speyer (GBS)
seinen Mitgliedern machen kann. An die Anfänge vor 95 Jahren und
die Entwicklung der GBS erinnerten Aufsichtsratsvorsitzende Elke
Jäckle und der frühere kaufmännische Vorstand Bernhard Mückain im
Januar-Erzählcafé des Seniorenbüros. „Ich kenne keine andere
gesellschaftsrechtliche Form, die dem Wohle seiner Mitglieder in
ähnlicher Weise Rechnung trägt“, stellte Mückain die Speyerer
Baugenossenschaft als „etwas Besonderes“ heraus. Zuvor hatte es nur
in Pirmasens und Ludwigshafen Wohnungsbaugesellschaften
gegeben..jpg) Senioren Herz
erwärmt
Senioren Herz
erwärmt.jpg) Der Chor, der
mittwochs mit Dirigentin Susanne May-Rohde im Haus Trinitatis
probt, bereichert drei bis vier Gottesdienste im Jahr mit
musikalischer Umrahmung, singt auch mal bei Hochzeiten und
Geburtstagen sowie bei ökumenischen Gemeindefesten zusammen mit
anderen Chören, wie etwa dem Chor der benachbarten Dompfarrei. Bei
Landeskirchen- und Dekanatsmusiktagen und bei der Speyerer
Kult(o)urnacht ist „DreiCant“ stets gerne mit von der Partie.
Der Chor, der
mittwochs mit Dirigentin Susanne May-Rohde im Haus Trinitatis
probt, bereichert drei bis vier Gottesdienste im Jahr mit
musikalischer Umrahmung, singt auch mal bei Hochzeiten und
Geburtstagen sowie bei ökumenischen Gemeindefesten zusammen mit
anderen Chören, wie etwa dem Chor der benachbarten Dompfarrei. Bei
Landeskirchen- und Dekanatsmusiktagen und bei der Speyerer
Kult(o)urnacht ist „DreiCant“ stets gerne mit von der Partie..jpg) Für die
Chorleiterin, die 1990 in die Pfalz kam, war der Beginn an der
Dreifaltigkeitskirche zunächst ein „Kinderspiel“. May-Rohde übte
anfangs Kindersingspiele für Kindergottesdienste ein. Daraus
entwickelte sich ein Kinderchor, der mit über 20 Kindern- vom
Vorschulalter bis hin zu Sechstklässlern, seitdem jedes Jahr im
Herbst mit den Proben beginnt für den Auftritt in der
Vorweihnachtszeit. Und 1999 war dann die Geburtsstunde von
DreiCant, kam May-Rohde dem Wunsch nach Gründung des
Erwachsenenchors nach. Geselligkeit und Gemeinschaftssinn sind bei
DreiCant ebenso hoch angesiedelt wie die Freude am Singen, betrieb
die Chorleiterin Werbung in eigener Sache. Besonders Männerstimmen
sind sehr begehrt.
Für die
Chorleiterin, die 1990 in die Pfalz kam, war der Beginn an der
Dreifaltigkeitskirche zunächst ein „Kinderspiel“. May-Rohde übte
anfangs Kindersingspiele für Kindergottesdienste ein. Daraus
entwickelte sich ein Kinderchor, der mit über 20 Kindern- vom
Vorschulalter bis hin zu Sechstklässlern, seitdem jedes Jahr im
Herbst mit den Proben beginnt für den Auftritt in der
Vorweihnachtszeit. Und 1999 war dann die Geburtsstunde von
DreiCant, kam May-Rohde dem Wunsch nach Gründung des
Erwachsenenchors nach. Geselligkeit und Gemeinschaftssinn sind bei
DreiCant ebenso hoch angesiedelt wie die Freude am Singen, betrieb
die Chorleiterin Werbung in eigener Sache. Besonders Männerstimmen
sind sehr begehrt..jpg) Bei der Auswahl
der Chorliteratur – die Notenwerke werden ohnehin meist aus der
Chorkasse finanziert – für die Gottesdienste lassen die Pfarrer der
Dreifaltigkeitskirchengemeinde der Dirigentin freie Hand, freut
sich Susanne May-Rohde über die künstlerische Freiheit und
schneidet Lieder speziell auf den Chor zu und arrangiert sie neu.
Sie sei zwar „von Haus aus Kirchenmusikerin“, doch sucht sie für
ihren „DreiCant“-Chor gerne moderne, zeitgenössische Stücke aus und
unternimmt auch mal Ausflüge in die folkloristische Musik. Für die
Sänger besonders anspruchsvoll wird es, wenn die Chorleiterin
Lieder in Fremdsprachen einstudiert, wobei es nicht immer nur
englisch ist, sondern auch mal rumänisch oder griechisch sein kann.
Am ersten Adventsonntag hatte der DreiCant-Chor zwei Tage vorher
mit Christmas Carols beim Konzert in der Gedächtniskirche für
Aufhorchen gesorgt. Fürs Erzählcafé wählte Chorleiterin May-Rohde
deutschsprachiges Liedgut und nur einen Konzertbeitrag, das
Glockenlang nachahmende „God rest ye, merry gentlemen“ aus.
Nach „Hört der Engel große Freud“, „Es ist ein Ros entsprungen“,
„Vom Himmel hoch“ und den „Königen vom Morgenland“ lud die
Chorleitern zum Abschluss alle Zuhörer ein zum Mitsingen von „O du
Fröhliche“. Dieser Einladung kamen die Senioren gerne nach, und
Allgemeinmediziner Dr. Thomas Neubert lachte das Herz und gab zu
wissen: „Es gibt nichts Gesünderes als Singen!“
Bei der Auswahl
der Chorliteratur – die Notenwerke werden ohnehin meist aus der
Chorkasse finanziert – für die Gottesdienste lassen die Pfarrer der
Dreifaltigkeitskirchengemeinde der Dirigentin freie Hand, freut
sich Susanne May-Rohde über die künstlerische Freiheit und
schneidet Lieder speziell auf den Chor zu und arrangiert sie neu.
Sie sei zwar „von Haus aus Kirchenmusikerin“, doch sucht sie für
ihren „DreiCant“-Chor gerne moderne, zeitgenössische Stücke aus und
unternimmt auch mal Ausflüge in die folkloristische Musik. Für die
Sänger besonders anspruchsvoll wird es, wenn die Chorleiterin
Lieder in Fremdsprachen einstudiert, wobei es nicht immer nur
englisch ist, sondern auch mal rumänisch oder griechisch sein kann.
Am ersten Adventsonntag hatte der DreiCant-Chor zwei Tage vorher
mit Christmas Carols beim Konzert in der Gedächtniskirche für
Aufhorchen gesorgt. Fürs Erzählcafé wählte Chorleiterin May-Rohde
deutschsprachiges Liedgut und nur einen Konzertbeitrag, das
Glockenlang nachahmende „God rest ye, merry gentlemen“ aus.
Nach „Hört der Engel große Freud“, „Es ist ein Ros entsprungen“,
„Vom Himmel hoch“ und den „Königen vom Morgenland“ lud die
Chorleitern zum Abschluss alle Zuhörer ein zum Mitsingen von „O du
Fröhliche“. Dieser Einladung kamen die Senioren gerne nach, und
Allgemeinmediziner Dr. Thomas Neubert lachte das Herz und gab zu
wissen: „Es gibt nichts Gesünderes als Singen!“

 Die
ehrenamtlich Mitarbeitenden standen Ende vergangener Woche im
Mittelpunkt einer Feier im Diakonissen Seniorenstift
Bürgerhospital.
Die
ehrenamtlich Mitarbeitenden standen Ende vergangener Woche im
Mittelpunkt einer Feier im Diakonissen Seniorenstift
Bürgerhospital. Prof. Dr.
Andreas Kruse beim 20jährigen Jubiläum von Seniorenbeirat und
Seniorenbüro in Speyer
Prof. Dr.
Andreas Kruse beim 20jährigen Jubiläum von Seniorenbeirat und
Seniorenbüro in Speyer Eingebettet in
frei rezitierte, beziehungsreiche Gedichte aus Barock und Romantik
sowie – quasi als Unterstützung der Vertiefungsphasen zu dem
Gehörten – durch den Referenten gekonnt am Flügel dargebotene
Kompositionen des großen Johann Sebastian Bach, ermutigte der
studierte Philosoph, Psychologe und Musiker Prof. Dr. Kruse nämlich
die zahlreichen Zuhörer dazu, bis ans Ende ihres Lebensweges offen
zu bleiben für Neues. Dazu zitierte der Referent gleich zu Beginn
seiner Ausführungen aus einer erst kürzlich abgeschlossenen Studie
unter 85 bis 101jährigen Menschen, die es darin als „ihr zentrales
Thema im Alter“ bezeichnet hatten, „etwas für die Gemeinschaft zu
tun“ . Dadurch -so hätten sie in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl
erklärt – sei für sie „auch in hohem und höchsten Alter noch ein
erfülltes Leben möglich“.
Eingebettet in
frei rezitierte, beziehungsreiche Gedichte aus Barock und Romantik
sowie – quasi als Unterstützung der Vertiefungsphasen zu dem
Gehörten – durch den Referenten gekonnt am Flügel dargebotene
Kompositionen des großen Johann Sebastian Bach, ermutigte der
studierte Philosoph, Psychologe und Musiker Prof. Dr. Kruse nämlich
die zahlreichen Zuhörer dazu, bis ans Ende ihres Lebensweges offen
zu bleiben für Neues. Dazu zitierte der Referent gleich zu Beginn
seiner Ausführungen aus einer erst kürzlich abgeschlossenen Studie
unter 85 bis 101jährigen Menschen, die es darin als „ihr zentrales
Thema im Alter“ bezeichnet hatten, „etwas für die Gemeinschaft zu
tun“ . Dadurch -so hätten sie in ihrer weit überwiegenden Mehrzahl
erklärt – sei für sie „auch in hohem und höchsten Alter noch ein
erfülltes Leben möglich“. Nach
gesicherten wissenschaftlichen Beobachtungen gehe der
Alterungsprozess des Menschen mit zunehmender Selbstreflexion
einher - „Menschen erlangen meist erst im Alter Klarheit darüber,
was und wer sie sind“. Die besten Gespräche könnten deshalb – oft
mit viel Witz und Selbstirone gewürzt - mit hochbetagten Menschen
geführt werden, weil sie dann zu ihren eigenen Ursprüngen
zurückkehrten. Dabei gehe es ihnen in aller Regel nicht um eine
verklärte Sichtweise auf Vergangenes, sondern um die Erkenntnis,
dass „in einer Sorgekultur für andere der tiefere Sinn des Lebens
liegt“. Dieser „Selbstgestaltung“, wie sie der Wissenschaftler
definiert, stellt Prof. Dr. Kruse die „Weltgestaltung“ gegenüber,
für deren Wirkungskraft er anhand eines Gedichtes des
Barock-Dichters Andreas Gryphius die ungeheuren schöpferischen
Kräfte aufführte, die gealterte und durch den 30jährigen Krieg
scheinbar zermürbte Menschen noch in hohem Alter entwickelt hätten.
Ihnen gehe es dabei im wesentlichen darum, im Gespräch mit der
nachfolgenden Generation eigene Erfahrungen an jüngere
weiterzugeben. „Dabei sollten sich beide Generationen – junge und
alte – immer „zugleich als Lehrende wie als Lernende“ verstehen, so
Prof. Dr. Kruse.
Nach
gesicherten wissenschaftlichen Beobachtungen gehe der
Alterungsprozess des Menschen mit zunehmender Selbstreflexion
einher - „Menschen erlangen meist erst im Alter Klarheit darüber,
was und wer sie sind“. Die besten Gespräche könnten deshalb – oft
mit viel Witz und Selbstirone gewürzt - mit hochbetagten Menschen
geführt werden, weil sie dann zu ihren eigenen Ursprüngen
zurückkehrten. Dabei gehe es ihnen in aller Regel nicht um eine
verklärte Sichtweise auf Vergangenes, sondern um die Erkenntnis,
dass „in einer Sorgekultur für andere der tiefere Sinn des Lebens
liegt“. Dieser „Selbstgestaltung“, wie sie der Wissenschaftler
definiert, stellt Prof. Dr. Kruse die „Weltgestaltung“ gegenüber,
für deren Wirkungskraft er anhand eines Gedichtes des
Barock-Dichters Andreas Gryphius die ungeheuren schöpferischen
Kräfte aufführte, die gealterte und durch den 30jährigen Krieg
scheinbar zermürbte Menschen noch in hohem Alter entwickelt hätten.
Ihnen gehe es dabei im wesentlichen darum, im Gespräch mit der
nachfolgenden Generation eigene Erfahrungen an jüngere
weiterzugeben. „Dabei sollten sich beide Generationen – junge und
alte – immer „zugleich als Lehrende wie als Lernende“ verstehen, so
Prof. Dr. Kruse. Weltgestaltung
sei der Wissenschaft aber auich zum „großen Thema“ geworden, als
sie sich mit den Auswirkungen des Schicksals jüdischer Menschen
nach dem Ende der NS-Zeit auseinandersetzte. Bei diesen Menschen
seien die Erinnerungen an diese für sie so schwere Zeit oft erst
wieder im hohen Alter stärker geworden und habe sie ermutigt, damit
in die Schulen zu gehen und der nachwachsenden Generation deutlich
zu machen, was eine funktionierende Demokratie bedeute. Dabei
hätten sie immer wieder erfahren können, dass dadurch auch das
Interesse der jungen Generation an diesen Zusammenhängen deutlich
gewachsen sei.
Weltgestaltung
sei der Wissenschaft aber auich zum „großen Thema“ geworden, als
sie sich mit den Auswirkungen des Schicksals jüdischer Menschen
nach dem Ende der NS-Zeit auseinandersetzte. Bei diesen Menschen
seien die Erinnerungen an diese für sie so schwere Zeit oft erst
wieder im hohen Alter stärker geworden und habe sie ermutigt, damit
in die Schulen zu gehen und der nachwachsenden Generation deutlich
zu machen, was eine funktionierende Demokratie bedeute. Dabei
hätten sie immer wieder erfahren können, dass dadurch auch das
Interesse der jungen Generation an diesen Zusammenhängen deutlich
gewachsen sei. Die dieser
Erkenntnis innewohende Endlichkeitserfahrung könne aber bei manchen
Menschen auch dazu führen, dass sie sich erst in höherem Alter –
also nicht schon unmittelbar nach dem „Ausstieg“ aus dem Arbeits-
und Berufsleben – dazu entschließen würden, „noch etwas für die
Allgemeinheit zu leisten“.
Die dieser
Erkenntnis innewohende Endlichkeitserfahrung könne aber bei manchen
Menschen auch dazu führen, dass sie sich erst in höherem Alter –
also nicht schon unmittelbar nach dem „Ausstieg“ aus dem Arbeits-
und Berufsleben – dazu entschließen würden, „noch etwas für die
Allgemeinheit zu leisten“. Eine so
angelegte Gerontologie brauche öffentliche Räume, in denen sich
Menschen über die Grenzen der eigenen Generation hinweg begegnen
könnten. „Nur im Kontakt mit anderen Menschen werden wir kreativ“,
unterstrich der Wissenschaftler zum Abschluss seines Referates,,
als er Speyer zu dem entsprechenden öffentlichen Raum für diese
Arbeit in Seniorenbeirat und Seniorenbüro gratulierte und allen
Speyerern zu einer Stadt, die auch für ihn selbst zu einer seiner
Lieblingsstädte zähle, in der er gemeinsam mit seiner Frau immer
wieder gerne zu Gast sei.
Eine so
angelegte Gerontologie brauche öffentliche Räume, in denen sich
Menschen über die Grenzen der eigenen Generation hinweg begegnen
könnten. „Nur im Kontakt mit anderen Menschen werden wir kreativ“,
unterstrich der Wissenschaftler zum Abschluss seines Referates,,
als er Speyer zu dem entsprechenden öffentlichen Raum für diese
Arbeit in Seniorenbeirat und Seniorenbüro gratulierte und allen
Speyerern zu einer Stadt, die auch für ihn selbst zu einer seiner
Lieblingsstädte zähle, in der er gemeinsam mit seiner Frau immer
wieder gerne zu Gast sei.-01.jpg) Speyer-
„Speyer- ist von starken Mauern umgeben mit Türmen, die so
hoch wie unsere Kirchtürme sind, die höchsten Türme in einer
Mauer, die ich auf meiner Reise sah“, so der Engländer Thomas
Coryate in - Die Venedig- und Rheinfahrt 1608.
Speyer-
„Speyer- ist von starken Mauern umgeben mit Türmen, die so
hoch wie unsere Kirchtürme sind, die höchsten Türme in einer
Mauer, die ich auf meiner Reise sah“, so der Engländer Thomas
Coryate in - Die Venedig- und Rheinfahrt 1608.-01.jpg) Sie begrenzte
die Bischofspfalz im Bereich des Heidenturms, zog nach Süden zum
Stephanspförtchen, der Großen Pfaffen- und Webergasse, „Alter
Marktplatz“ und „Läutturm“, zog im Norden zur Torgasse am
Hasenpfuhl, streifte die Margaretengasse und führte zum
Archivgarten. Die Einfälle der Normannen im 9.-u. der Ungarn im 10.
Jh. zeigten, dass nur befestigte Städte widerstanden.
Früh- und spätsalische Erweiterung. Um 1050 ließ
Bischof Sigibodos die frühsalische Stadtmauer bis zur Ludwigstraße,
dem Altpörtel (Westpforte mit zwei Stockwerken), über die
Greifengasse zur bestehenden Mauer weiterführen. Die spätsalische
rechteckige Norderweiterung umschloss das Johannes-/ St.
Guidostift, wurde durch Bischof Johannes I.-Neffe Kaiser
Heinrich IV. -(1090-1100) erbaut und ließ die Belagerung durch
Erzbischof Adalbert von Mainz 1116 scheitern. Der rote Turm
an der Nordflanke und das Weidentor waren Ergänzungen.
Sie begrenzte
die Bischofspfalz im Bereich des Heidenturms, zog nach Süden zum
Stephanspförtchen, der Großen Pfaffen- und Webergasse, „Alter
Marktplatz“ und „Läutturm“, zog im Norden zur Torgasse am
Hasenpfuhl, streifte die Margaretengasse und führte zum
Archivgarten. Die Einfälle der Normannen im 9.-u. der Ungarn im 10.
Jh. zeigten, dass nur befestigte Städte widerstanden.
Früh- und spätsalische Erweiterung. Um 1050 ließ
Bischof Sigibodos die frühsalische Stadtmauer bis zur Ludwigstraße,
dem Altpörtel (Westpforte mit zwei Stockwerken), über die
Greifengasse zur bestehenden Mauer weiterführen. Die spätsalische
rechteckige Norderweiterung umschloss das Johannes-/ St.
Guidostift, wurde durch Bischof Johannes I.-Neffe Kaiser
Heinrich IV. -(1090-1100) erbaut und ließ die Belagerung durch
Erzbischof Adalbert von Mainz 1116 scheitern. Der rote Turm
an der Nordflanke und das Weidentor waren Ergänzungen.-01.jpg) Dr. Müller
erläuterte mit Hilfe der Fotoshow die noch sichtbaren
Teile der Stadtmauer mit Ausgangspunkt
Altpörtel. Am höchsten Torturm Deutschlands (1197
erstmals erwähnt, 1230 erneuert, 1512/1514 aufgestockt) sind
Mauervertiefungen (Holzgatter), Auflagen der Wehrbrüstung,
Gefängniszelle im Tordurchgang und „Musterelle“ zu erkennen. Hinter
der „Postgalerie“ steht am Klipfelstor ein Mauerzeugnis aus
roten Kleinsandsteinquadern. Im Café daneben ist ein
Rundbogenscheitel als Wasserpforte der spätsalischen
Erweiterungsmauer versteckt. Mit Sträuchern ist der
„Postgraben“(ehemals Tiergraben) zugewachsen. Zur Bahnhofstraße hin
sieht man das einzige erhaltene Grabenprofil mit der
besonderen Bauweise der „Kontereskarpe“- und
„Bermenmauer“(Vorschutzmauern), wie Dr. Müller anhand einer
Skizze erklärte. Ein Foto zeigt den Windmühlturm(Runder
Turm), der an der Rützhaubstraße stand und weiter nördlich
den Roten Turm . Am ehemals 10 m tiefen
Hirschgraben mit der Außenfuttermauer am Alten
Friedhof(Adenauerpark), sind die spätsalische Mauer,
das stauferzeitliche Haus mit rotem
Kleinquadermauerwerk, Zinnen, Wurfscharten, Schießscharten
und zwei gotische Zierfenster(1200) am Wehrgang zu erkennen.
Die Stadtmauer ist hier 1,2 m dick und 8m hoch, war oft umkämpft,
diente als Zugang zum Eiskeller, später zum Luftschutzbunker und
hält heute noch stand. Durch Straßenbegradigung um 1810
entstand der St.-Guido-Stifts-Platz, wo sich das Weidentor
als einziges Nordtor befand. Am N
eubau der Petschengasse 1 steht eine Infotafel mit
Detailplan der Stadtmauern, direkt daneben die
erhaltene spät salische Hauptmauer.
Dr. Müller
erläuterte mit Hilfe der Fotoshow die noch sichtbaren
Teile der Stadtmauer mit Ausgangspunkt
Altpörtel. Am höchsten Torturm Deutschlands (1197
erstmals erwähnt, 1230 erneuert, 1512/1514 aufgestockt) sind
Mauervertiefungen (Holzgatter), Auflagen der Wehrbrüstung,
Gefängniszelle im Tordurchgang und „Musterelle“ zu erkennen. Hinter
der „Postgalerie“ steht am Klipfelstor ein Mauerzeugnis aus
roten Kleinsandsteinquadern. Im Café daneben ist ein
Rundbogenscheitel als Wasserpforte der spätsalischen
Erweiterungsmauer versteckt. Mit Sträuchern ist der
„Postgraben“(ehemals Tiergraben) zugewachsen. Zur Bahnhofstraße hin
sieht man das einzige erhaltene Grabenprofil mit der
besonderen Bauweise der „Kontereskarpe“- und
„Bermenmauer“(Vorschutzmauern), wie Dr. Müller anhand einer
Skizze erklärte. Ein Foto zeigt den Windmühlturm(Runder
Turm), der an der Rützhaubstraße stand und weiter nördlich
den Roten Turm . Am ehemals 10 m tiefen
Hirschgraben mit der Außenfuttermauer am Alten
Friedhof(Adenauerpark), sind die spätsalische Mauer,
das stauferzeitliche Haus mit rotem
Kleinquadermauerwerk, Zinnen, Wurfscharten, Schießscharten
und zwei gotische Zierfenster(1200) am Wehrgang zu erkennen.
Die Stadtmauer ist hier 1,2 m dick und 8m hoch, war oft umkämpft,
diente als Zugang zum Eiskeller, später zum Luftschutzbunker und
hält heute noch stand. Durch Straßenbegradigung um 1810
entstand der St.-Guido-Stifts-Platz, wo sich das Weidentor
als einziges Nordtor befand. Am N
eubau der Petschengasse 1 steht eine Infotafel mit
Detailplan der Stadtmauern, direkt daneben die
erhaltene spät salische Hauptmauer.-01.jpg) In einem
Kurz-Durchgang stellte der Buchautor Müller noch die Vorstadtmauern
vor, welche im 14. Jh. entstanden sind. Die im Jahre 1111 von
Kaiser Heinrich V . an Speyerer Bürger verliehenen
Privilegien, die 1198 von Herzog Philipp von Schwaben
übergebene Selbstverwaltung und der 1294 übertragene
Status einer Freien Reichsstadt, boten persönliche
Freiheit im Stadtgebiet und förderten die wirtschaftliche
Entwicklung, so dass Vorstädte immer größer und nun auch
durch Schutzmauern Sicherung erhielten. Um 1325 wurde
in der Ägidien Vorstadt entlang des
Gilgengrabens eine Mauer mit 19 Rundtürmen in Ziegelwerk
aufgebaut. Vom Drachenturm ist nur das offene
Untergeschoß vorhanden, den Taubenturm in
50 m Abstand ziert noch ein Kegeldach, der Turm zum Bock
besteht noch als Mauerstumpf und hat als einziger Turm dieser
Stadtmauer keinen Vogelnamen. Die Vorstadt über dem
Hasenpfuhl wurde 1335 durch eine Mauer geschützt und
hatte vier Türme . Beim Oberen Bachriegel mit
zwei Rundbögen auf schweren Quaderpfeilern und einer
Wehrgangsbrüstung mit einer Zinne war die Vorstadtmauer an
den innerstädtischen Lauerzwinger angeschlossen.
Einige Meter südlich des Riegelbogens sieht man untere
Gewändeteile der Allmendpforte, die für
Töpfer offen blieb, damit sie zu ihren Tonlagern gelangen
konnten. Vom Bärenturm ragt noch die äußere
Hälfte als Stumpf in den Graben; am Klostergarten zu St.
Magdalena steht der Löwenturm, vom Widderturm
sind noch Mauerreste zu finden. .Der Farrenturm
stand auf der Stadtmauerecke, wurde einem Garten-
später einem Bauernhaus einverleibt, das im
Kindergartenbereich zu erkennen ist. Das Küh-, später
Rheintor, verschwand um 1860 im Durchbruch der
Hasenpfuhlstraße . Am Brauhaus des Gasthofs zum Anker ist
noch ein Teil der Vorstadtmauer zu erkennen, daneben stand
der Gackturm mit schwerem Gatter als Unterer
Mauerriegel. Die Markus-Vorstadt wurde
1360 durch eine Mauer geschützt, die ab dem
Dreißigjährigen Krieg verschwunden war. Der Graben nach Osten war
vom Fischertor ab durch den Marxendamm vom
Altrheingelände(Festplatz) abgetrennt. Seit Mitte des 20.Jh. füllt
ihn die Karl-Leiling-Allee aus. Mauerreste sind noch am
Rot-Kreuz-Haus zu sehen. Das St. Marxentor war
eines der drei wichtigsten Stadttore und führte zur Rheinhäuser
Fähre, wie Dr. Müller mit Fotos beweisen konnte. Die
Vorstadt Altspeyer erhielt erst um 1380
eine Stadtmauer, obwohl das Dorf „ Spira“ dort
seit dem 6. Jahrhundert neben einem Judenviertel
bestand. Nur die Westmauer ( 1502 ) am Alten Friedhof
(Bahnhofstraße) blieb übrig. Bis zur Villa Velten( vor der
Araltankstelle) zogen sich bis 1830 die Stadtmauerflucht und
der schmale“ Judensand“(Friedhof) zum
Birkenturm(Siechenturm) hin. Der Speyerbach-Woog
vor der Dietbrücke, der Diebsturm und das
Heiliggrabtor standen im Bereich des Rauschenden Wassers an
der jetzigen Wormser Straßenbrücke.
In einem
Kurz-Durchgang stellte der Buchautor Müller noch die Vorstadtmauern
vor, welche im 14. Jh. entstanden sind. Die im Jahre 1111 von
Kaiser Heinrich V . an Speyerer Bürger verliehenen
Privilegien, die 1198 von Herzog Philipp von Schwaben
übergebene Selbstverwaltung und der 1294 übertragene
Status einer Freien Reichsstadt, boten persönliche
Freiheit im Stadtgebiet und förderten die wirtschaftliche
Entwicklung, so dass Vorstädte immer größer und nun auch
durch Schutzmauern Sicherung erhielten. Um 1325 wurde
in der Ägidien Vorstadt entlang des
Gilgengrabens eine Mauer mit 19 Rundtürmen in Ziegelwerk
aufgebaut. Vom Drachenturm ist nur das offene
Untergeschoß vorhanden, den Taubenturm in
50 m Abstand ziert noch ein Kegeldach, der Turm zum Bock
besteht noch als Mauerstumpf und hat als einziger Turm dieser
Stadtmauer keinen Vogelnamen. Die Vorstadt über dem
Hasenpfuhl wurde 1335 durch eine Mauer geschützt und
hatte vier Türme . Beim Oberen Bachriegel mit
zwei Rundbögen auf schweren Quaderpfeilern und einer
Wehrgangsbrüstung mit einer Zinne war die Vorstadtmauer an
den innerstädtischen Lauerzwinger angeschlossen.
Einige Meter südlich des Riegelbogens sieht man untere
Gewändeteile der Allmendpforte, die für
Töpfer offen blieb, damit sie zu ihren Tonlagern gelangen
konnten. Vom Bärenturm ragt noch die äußere
Hälfte als Stumpf in den Graben; am Klostergarten zu St.
Magdalena steht der Löwenturm, vom Widderturm
sind noch Mauerreste zu finden. .Der Farrenturm
stand auf der Stadtmauerecke, wurde einem Garten-
später einem Bauernhaus einverleibt, das im
Kindergartenbereich zu erkennen ist. Das Küh-, später
Rheintor, verschwand um 1860 im Durchbruch der
Hasenpfuhlstraße . Am Brauhaus des Gasthofs zum Anker ist
noch ein Teil der Vorstadtmauer zu erkennen, daneben stand
der Gackturm mit schwerem Gatter als Unterer
Mauerriegel. Die Markus-Vorstadt wurde
1360 durch eine Mauer geschützt, die ab dem
Dreißigjährigen Krieg verschwunden war. Der Graben nach Osten war
vom Fischertor ab durch den Marxendamm vom
Altrheingelände(Festplatz) abgetrennt. Seit Mitte des 20.Jh. füllt
ihn die Karl-Leiling-Allee aus. Mauerreste sind noch am
Rot-Kreuz-Haus zu sehen. Das St. Marxentor war
eines der drei wichtigsten Stadttore und führte zur Rheinhäuser
Fähre, wie Dr. Müller mit Fotos beweisen konnte. Die
Vorstadt Altspeyer erhielt erst um 1380
eine Stadtmauer, obwohl das Dorf „ Spira“ dort
seit dem 6. Jahrhundert neben einem Judenviertel
bestand. Nur die Westmauer ( 1502 ) am Alten Friedhof
(Bahnhofstraße) blieb übrig. Bis zur Villa Velten( vor der
Araltankstelle) zogen sich bis 1830 die Stadtmauerflucht und
der schmale“ Judensand“(Friedhof) zum
Birkenturm(Siechenturm) hin. Der Speyerbach-Woog
vor der Dietbrücke, der Diebsturm und das
Heiliggrabtor standen im Bereich des Rauschenden Wassers an
der jetzigen Wormser Straßenbrücke.
 Team alla
hopp!: Erstes Mitglied Laci Legenstein ermutigt zu mehr
Bewegung
Team alla
hopp!: Erstes Mitglied Laci Legenstein ermutigt zu mehr
Bewegung Beim
Golfspielen so gut wie im Tennis
Beim
Golfspielen so gut wie im Tennis Fitness ist nach
seiner Erfahrung nicht vom Alter abhängig und es braucht dazu auch
keine Profilaufbahn. Wichtig sei nur eins: dass es Spaß macht.
Deshalb sieht Laci Legenstein in alla hopp! ein hervorragendes
Angebot für alle Generationen. Auf seine Jugendtage blickt er
gerne, wenn auch mit etwas Wehmut zurück. „Es war eine schöne Zeit,
aber wir hatten viel geringere Entfaltungsmöglichkeiten. So etwas
wie einen kostenlosen Bewegungsparcours gab es damals nicht. Ich
freue mich darauf, bald einen solchen Parcours in der
Rhein-Neckar-Region zu testen“, sagt Legenstein.
Fitness ist nach
seiner Erfahrung nicht vom Alter abhängig und es braucht dazu auch
keine Profilaufbahn. Wichtig sei nur eins: dass es Spaß macht.
Deshalb sieht Laci Legenstein in alla hopp! ein hervorragendes
Angebot für alle Generationen. Auf seine Jugendtage blickt er
gerne, wenn auch mit etwas Wehmut zurück. „Es war eine schöne Zeit,
aber wir hatten viel geringere Entfaltungsmöglichkeiten. So etwas
wie einen kostenlosen Bewegungsparcours gab es damals nicht. Ich
freue mich darauf, bald einen solchen Parcours in der
Rhein-Neckar-Region zu testen“, sagt Legenstein.

 Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling
Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling Sofort im
April 1945 begannen die amerikanischen und französischen Truppen
mit der Errichtung behelfsmäßiger Übersetzstellen, um den
Armeenachschub nach der rechten Rheinseite sicherzustellen. Bis
Juli dauerte der Bau der amerikanischen Noteisenbahnbrücke 50
Meter unterhalb der zerstörten Rheinbrücke Mannheim-Ludwigshafen.
Außerdem stellten die Truppen ab April Pontonbrücken mit
wechselnden Standorten bei Speyer, Rheinhausen, Germersheim und
Maximiliansau auf, berichtete Kuhn von den Schwierigkeiten, an die
andere Uferseite zu kommen. Im Juli begannen die
Amerikaner damit, in den zerstörten Brücken
Schifffahrtsöffnungen herzustellen.
Sofort im
April 1945 begannen die amerikanischen und französischen Truppen
mit der Errichtung behelfsmäßiger Übersetzstellen, um den
Armeenachschub nach der rechten Rheinseite sicherzustellen. Bis
Juli dauerte der Bau der amerikanischen Noteisenbahnbrücke 50
Meter unterhalb der zerstörten Rheinbrücke Mannheim-Ludwigshafen.
Außerdem stellten die Truppen ab April Pontonbrücken mit
wechselnden Standorten bei Speyer, Rheinhausen, Germersheim und
Maximiliansau auf, berichtete Kuhn von den Schwierigkeiten, an die
andere Uferseite zu kommen. Im Juli begannen die
Amerikaner damit, in den zerstörten Brücken
Schifffahrtsöffnungen herzustellen.  Die
gesprengten oder zertrümmerten Konstruktionsteile sind aber nicht
gehoben, sondern im Flussbett belassen worden, wo sie sich in die
Sohle verlagerten und teilweise rasch einkiesten. Diese
Arbeitsweise erschwerte die späteren Räumungsarbeiten durch
deutsche Stellen erheblich. Die von den Besatzungsmächten
geschaffenen Durchfahrtsöffnungen waren für den im September 1945
freigegebenen Schiffsverkehr „sehr ungünstig und gefahrvoll“,
erinnerte der SSFV-Ehrenvorsitzende. Die Brückenstellen waren nur
äußerst schwer zu passieren. Die Speyerer Stelle war
besonders schwierig zu befahren, da hier in der starken
Rheinbiegung laut Kuhn nur eine 48 Meter breite Schifahrtsöffnung
zur Verfügung stand. In den folgenden Jahren seien alle für den
Rhein zuständigen Stellen damit beschäftigt gewesen, die im
Strom liegenden Fahrzeugwracks und restlichen Brückenteile zu heben
und aus der Fahrrinne zu räumen.
Die
gesprengten oder zertrümmerten Konstruktionsteile sind aber nicht
gehoben, sondern im Flussbett belassen worden, wo sie sich in die
Sohle verlagerten und teilweise rasch einkiesten. Diese
Arbeitsweise erschwerte die späteren Räumungsarbeiten durch
deutsche Stellen erheblich. Die von den Besatzungsmächten
geschaffenen Durchfahrtsöffnungen waren für den im September 1945
freigegebenen Schiffsverkehr „sehr ungünstig und gefahrvoll“,
erinnerte der SSFV-Ehrenvorsitzende. Die Brückenstellen waren nur
äußerst schwer zu passieren. Die Speyerer Stelle war
besonders schwierig zu befahren, da hier in der starken
Rheinbiegung laut Kuhn nur eine 48 Meter breite Schifahrtsöffnung
zur Verfügung stand. In den folgenden Jahren seien alle für den
Rhein zuständigen Stellen damit beschäftigt gewesen, die im
Strom liegenden Fahrzeugwracks und restlichen Brückenteile zu heben
und aus der Fahrrinne zu räumen..jpg) Prof.
Dr. Ursula Lehr ruft Senioren zur aktiven Mitwirkung an einer
„präventiven Umweltgestaltung“ auf. (Teil 3/3)
Prof.
Dr. Ursula Lehr ruft Senioren zur aktiven Mitwirkung an einer
„präventiven Umweltgestaltung“ auf. (Teil 3/3).jpg) Straßenbeleuchtungen –
sind sie hell genug?
Straßenbeleuchtungen –
sind sie hell genug?.jpg) Dann kam
Prof. Dr.Lehr auch auf die Gestaltung von kulturellen Einrichtungen
zu sprechen: Theater und Kinos, wo zu breite Sitzreihen das
Erreichen des Sitzplatzes in der Mitte der Reihe erschweren.Hier
könnten Zwischengänge in angemessenen Abständen Abhilfe
schaffen.
Dann kam
Prof. Dr.Lehr auch auf die Gestaltung von kulturellen Einrichtungen
zu sprechen: Theater und Kinos, wo zu breite Sitzreihen das
Erreichen des Sitzplatzes in der Mitte der Reihe erschweren.Hier
könnten Zwischengänge in angemessenen Abständen Abhilfe
schaffen..jpg) Der
demografische Wandel, so ist sich Prof. Dr. Lehr sicher, werde auch
dazu führen, dass Tankstellen wieder verstärkt einen Bedienservice
anbieten müssten, um älteren Kunden das beschwerliche Aussteigen zu
ersparen.
Der
demografische Wandel, so ist sich Prof. Dr. Lehr sicher, werde auch
dazu führen, dass Tankstellen wieder verstärkt einen Bedienservice
anbieten müssten, um älteren Kunden das beschwerliche Aussteigen zu
ersparen..jpg) Auch an
die Gestaltung von Ladengeschäften stellt Prof. Dr. Lehr geänderte
Anforderungen: Sie sollten leicht erreicchbar sein und über gute
Parkmöglcihkeiten mit breiten Parkplätzen verfügen, die es auch
Menschen z.B. mit Knieproblemen überhaupt erst möglich machten, ihr
Fahrzeug schmerzfrei zu verlassen. Bei den Zugängen sollte auf die
Beschaffenheit von Stufen, auf eventuell fehlende Handläufe oder zu
schwere Türen geachtet werden, die einen zu hohen Kraftaufwand
erforderten. Auf glatte Fussböden und auch hier sollte auf
Glasböden ganz verzichtet werden. Treppen sollten generell nicht
offen und dadurch durchsichtig sein, weil dies Unsicherheit
auslöst, Handläufe sollten rund und gut zu umgreifen und auch an
Rolltreppen sollten gut zu greifende Handläufe montiert sein. Die
Gänge in den Ladengeschäften sollten zudem so breit sein, dass auch
mit dem Rollator bequem zu befahren sind.
Auch an
die Gestaltung von Ladengeschäften stellt Prof. Dr. Lehr geänderte
Anforderungen: Sie sollten leicht erreicchbar sein und über gute
Parkmöglcihkeiten mit breiten Parkplätzen verfügen, die es auch
Menschen z.B. mit Knieproblemen überhaupt erst möglich machten, ihr
Fahrzeug schmerzfrei zu verlassen. Bei den Zugängen sollte auf die
Beschaffenheit von Stufen, auf eventuell fehlende Handläufe oder zu
schwere Türen geachtet werden, die einen zu hohen Kraftaufwand
erforderten. Auf glatte Fussböden und auch hier sollte auf
Glasböden ganz verzichtet werden. Treppen sollten generell nicht
offen und dadurch durchsichtig sein, weil dies Unsicherheit
auslöst, Handläufe sollten rund und gut zu umgreifen und auch an
Rolltreppen sollten gut zu greifende Handläufe montiert sein. Die
Gänge in den Ladengeschäften sollten zudem so breit sein, dass auch
mit dem Rollator bequem zu befahren sind..jpg) Am Ende
eine Einkaufstour durch den Grooßmarkt schließlich empfiehlt die
Altersforscherin auch an den Kassen dringend Verbesserungen:
Ablagemöglichkeiten für Handtaschen und eventuell eine
Klemmvorrichtung für den Gehstock sollten angebracht werden, um zu
vermeiden, dass der Stock zu Boden fällt und unter großen Mühen
wieder aufgehoben werden muss. An den Kassen sollten große und
deshalb gut ablesbare Zahlen die Rechnungssumme anzeigen, um auch
Sehbehinderten gerecht zu werden, leicht geschwungene Schalen
helfen zudem, das Aufnehmen von Münzgeld zu erleichtern.
Am Ende
eine Einkaufstour durch den Grooßmarkt schließlich empfiehlt die
Altersforscherin auch an den Kassen dringend Verbesserungen:
Ablagemöglichkeiten für Handtaschen und eventuell eine
Klemmvorrichtung für den Gehstock sollten angebracht werden, um zu
vermeiden, dass der Stock zu Boden fällt und unter großen Mühen
wieder aufgehoben werden muss. An den Kassen sollten große und
deshalb gut ablesbare Zahlen die Rechnungssumme anzeigen, um auch
Sehbehinderten gerecht zu werden, leicht geschwungene Schalen
helfen zudem, das Aufnehmen von Münzgeld zu erleichtern..jpg) Dem
Grunde nach eigentlich alles „Kleinigkeiten“, lappalien, die ohne
großen Aufwand und Mühe zu verändern wären, würden sich Designer
und Marketing-Verantwortliche für einen Moment in die
Lebenssituation von Senioren versetzen. Wenn sie sich
vergegenwärtigen würden, dass heute bereits nur noch ein Prozent
aller über 70jährigen über seine uneingeschränkte Sehkraft verfügt,
dann würden sie vielleicht darauf achten, dass Beipackzettel von
Medikamenten oder Bedienungsanleitungen von Geräten ausreichend
groß gedruckt sind, dass darauf verzichtet wird, aus Design-Gründen
graue Schriften auf einen grauen Untergrund zu drucken oder dass
verschnörkelte und deshalb kaum leserliche Schriftarten verwendet
werden.
Dem
Grunde nach eigentlich alles „Kleinigkeiten“, lappalien, die ohne
großen Aufwand und Mühe zu verändern wären, würden sich Designer
und Marketing-Verantwortliche für einen Moment in die
Lebenssituation von Senioren versetzen. Wenn sie sich
vergegenwärtigen würden, dass heute bereits nur noch ein Prozent
aller über 70jährigen über seine uneingeschränkte Sehkraft verfügt,
dann würden sie vielleicht darauf achten, dass Beipackzettel von
Medikamenten oder Bedienungsanleitungen von Geräten ausreichend
groß gedruckt sind, dass darauf verzichtet wird, aus Design-Gründen
graue Schriften auf einen grauen Untergrund zu drucken oder dass
verschnörkelte und deshalb kaum leserliche Schriftarten verwendet
werden. „Es darf aber
kein 'soziales Pflichtjahr für Ältere' daraus werden“ - Tipps für
Möglichkeiten, sich für andere einzubringen. (Teil
2/3)
„Es darf aber
kein 'soziales Pflichtjahr für Ältere' daraus werden“ - Tipps für
Möglichkeiten, sich für andere einzubringen. (Teil
2/3) „Großelterndienste“
hält die Wissenschaftlerin aber auch in anderer Form für hilfreich:
Senioren, die mit ihrem Erfahrungshorizont und ihren wertvollen
Kontakten in der Gesellschaft in Schulen in einer Form von
ergänzendem Unterricht über „ihren“ früheren Beruf berichten und
die Schulabgänger als „Paten“ bei der Berufswahl und der
Ausbildungsplatzsuche unterstützen können – besonders wichtig
gerade auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund, denen
Senioren auch bei der Optimierung ihrer Lese-, Sprach- und
Schreibkompetenzen helfen könnten – andere aber auch, die als
„neutrale Dritte“ helfen können, Konflikte in den Schulen zu
entschärfen.
„Großelterndienste“
hält die Wissenschaftlerin aber auch in anderer Form für hilfreich:
Senioren, die mit ihrem Erfahrungshorizont und ihren wertvollen
Kontakten in der Gesellschaft in Schulen in einer Form von
ergänzendem Unterricht über „ihren“ früheren Beruf berichten und
die Schulabgänger als „Paten“ bei der Berufswahl und der
Ausbildungsplatzsuche unterstützen können – besonders wichtig
gerade auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund, denen
Senioren auch bei der Optimierung ihrer Lese-, Sprach- und
Schreibkompetenzen helfen könnten – andere aber auch, die als
„neutrale Dritte“ helfen können, Konflikte in den Schulen zu
entschärfen. Dabei, so die
Professorin, brauche auch das Ehrenamt quasi eine
„berufsbegleitende“ Weiterbildung durch gegenseitige Aussprache,
Erfahrungsaustausch, aber auch durch gegenseitige Ermutigung. „Wir
wollen das freiwillige Engagement der Senioren fördern, es darf
aber kein „soziales Pflichtjahr für Ältere“ daraus werden“, stellte
die Wissenschaftlerin klar. Auch die Stärkung der Motivation und
das Ergründen und Beseitigen von Barrieren gehöre zu den
Herausforderungen an die Seniorenbeiräte. Dazu gehöre die Schaffung
und die Verbesserung geeigneter Rahmenbedingungen für diese Arbeit,
z.B. durch die Einrichtung von Seniorenbüros und
Mehrgenerationenhäuser – soweit nicht schon vorhanden – sowie durch
den Ausbau einer ihr Engagement fördernden Infrastruktur.
Dabei, so die
Professorin, brauche auch das Ehrenamt quasi eine
„berufsbegleitende“ Weiterbildung durch gegenseitige Aussprache,
Erfahrungsaustausch, aber auch durch gegenseitige Ermutigung. „Wir
wollen das freiwillige Engagement der Senioren fördern, es darf
aber kein „soziales Pflichtjahr für Ältere“ daraus werden“, stellte
die Wissenschaftlerin klar. Auch die Stärkung der Motivation und
das Ergründen und Beseitigen von Barrieren gehöre zu den
Herausforderungen an die Seniorenbeiräte. Dazu gehöre die Schaffung
und die Verbesserung geeigneter Rahmenbedingungen für diese Arbeit,
z.B. durch die Einrichtung von Seniorenbüros und
Mehrgenerationenhäuser – soweit nicht schon vorhanden – sowie durch
den Ausbau einer ihr Engagement fördernden Infrastruktur.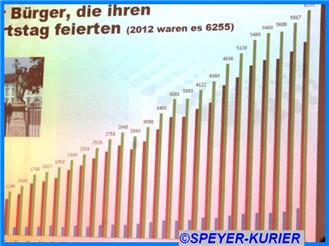 Noch
dramatischer die Verschiebungen im Altersaufbau in der sich derart
verändernden Bevölkerungsstruktur: Wird sich der Anteil der über
60jährigen in Deutschland vom Jahr 2000 bis 2025 von 23,2% auf
33,2% und 25 Jahre weiter auf 38.1% erhöhen, so wird der Anteil der
über 80jährigen von 3,6% im Jahr 2000 bis 2050 gar auf 13,2% und
die Zahl der über 90jährigen von 10.000 noch im Jahr 2000 auf
44.000 im Jahr 2020 und bis 2050 auf 114.700 klettern. Dann wird
sich auch die Zahl der Höchstbetagten, die statistisch gesehen 105
Jahre und älter sind, und deren Zahl von 1970 bis 2009 von 7 auf
447 Fälle gestiegen ist, sich entscheidend weiter nach oben
entwickeln.
Noch
dramatischer die Verschiebungen im Altersaufbau in der sich derart
verändernden Bevölkerungsstruktur: Wird sich der Anteil der über
60jährigen in Deutschland vom Jahr 2000 bis 2025 von 23,2% auf
33,2% und 25 Jahre weiter auf 38.1% erhöhen, so wird der Anteil der
über 80jährigen von 3,6% im Jahr 2000 bis 2050 gar auf 13,2% und
die Zahl der über 90jährigen von 10.000 noch im Jahr 2000 auf
44.000 im Jahr 2020 und bis 2050 auf 114.700 klettern. Dann wird
sich auch die Zahl der Höchstbetagten, die statistisch gesehen 105
Jahre und älter sind, und deren Zahl von 1970 bis 2009 von 7 auf
447 Fälle gestiegen ist, sich entscheidend weiter nach oben
entwickeln. Habe ein
klasssiches Familienbild früher ein Großelternpaar porträtiert,
umgeben von mehreren Kindern und einer Schar von Enkeln, so zeige
es immer öfter den „Einzelenkel“, umgeben von vier Großeltern, 2
Urgroßeltern und zusätzlich oft genug auch noch von einigen
„Stiefgroßeltern“. Die Tendenz vom 3-Generationen-Haushalt zum
1-Personen-Haushalt verstärke sich immer mehr, so die
Altersforscherin, die erst kürzlich in ihrem Amt als Vorsitzende
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO
bestätigt wurde.
Habe ein
klasssiches Familienbild früher ein Großelternpaar porträtiert,
umgeben von mehreren Kindern und einer Schar von Enkeln, so zeige
es immer öfter den „Einzelenkel“, umgeben von vier Großeltern, 2
Urgroßeltern und zusätzlich oft genug auch noch von einigen
„Stiefgroßeltern“. Die Tendenz vom 3-Generationen-Haushalt zum
1-Personen-Haushalt verstärke sich immer mehr, so die
Altersforscherin, die erst kürzlich in ihrem Amt als Vorsitzende
der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisationen BAGSO
bestätigt wurde. Gleiches gelte
auch für die geistigen Aktivitäten. „Wir müssen ein Leben lang mehr
lernen und „anders“ lernen als unsere Vorfahren“, betonte die
Referentin. Dies würden die Veränderungen unserer Umwelt mit immer
größerer Beschleunigung ebenso erzwingen wie die technischen
Entwicklungen, die zu einer Erleichterung der Kommunikation und
einer Stärkung der Sozialkontakte geführt habe.
Gleiches gelte
auch für die geistigen Aktivitäten. „Wir müssen ein Leben lang mehr
lernen und „anders“ lernen als unsere Vorfahren“, betonte die
Referentin. Dies würden die Veränderungen unserer Umwelt mit immer
größerer Beschleunigung ebenso erzwingen wie die technischen
Entwicklungen, die zu einer Erleichterung der Kommunikation und
einer Stärkung der Sozialkontakte geführt habe. Heute seien
60% der über 65jährigen ehrenamtlich tätig. Für die meisten der
zahlreichen Gäste, die zu dieser ungewöhnlichen Zeit in den alten
Ratssal gekommen waren, eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Vertreter unterschiedlichster Senioreninitiativen in der Stadt
waren gekommen – dazu die Sozialdezernentin,
Bürgermeisterin Monika Kabs, die die prominante
Wissenschaftlerin eingangs begrüßte, sodann der u.a. für das
Ehrenamt zuständige Städtische Beigeordnete Dr. Wolf
Böhm und die Leiterin des Seniorenbüros, Ria
Krampitz. Eröffnet hatte den hochinteressanten Nachmittag
als Sprecher der LandesSeniorenVertretung deren
Vorstandmitglied Horst Weller, der der Referentin für ihre
Bereitschaft dankte, mit diesem Referat nun schon zum zweiten Male
nach Rheinland-Pfalz gekommen zu sein.
Heute seien
60% der über 65jährigen ehrenamtlich tätig. Für die meisten der
zahlreichen Gäste, die zu dieser ungewöhnlichen Zeit in den alten
Ratssal gekommen waren, eigentlich eine Selbstverständlichkeit.
Vertreter unterschiedlichster Senioreninitiativen in der Stadt
waren gekommen – dazu die Sozialdezernentin,
Bürgermeisterin Monika Kabs, die die prominante
Wissenschaftlerin eingangs begrüßte, sodann der u.a. für das
Ehrenamt zuständige Städtische Beigeordnete Dr. Wolf
Böhm und die Leiterin des Seniorenbüros, Ria
Krampitz. Eröffnet hatte den hochinteressanten Nachmittag
als Sprecher der LandesSeniorenVertretung deren
Vorstandmitglied Horst Weller, der der Referentin für ihre
Bereitschaft dankte, mit diesem Referat nun schon zum zweiten Male
nach Rheinland-Pfalz gekommen zu sein. Am Ende gab es
noch Geschenke für die lebhaft und höchst humorvoll agierende
Wissenschaftlerin – den neuen Bildband über die Stadt Speyer und
dazu – aus der Hand von Monika Kabs - etwas, was man nirgends
kaufen kann: Zwei Flaschen Ruländer-Wein aus dem Städtischen
Weinberg am Tafelsbrunnen.
Am Ende gab es
noch Geschenke für die lebhaft und höchst humorvoll agierende
Wissenschaftlerin – den neuen Bildband über die Stadt Speyer und
dazu – aus der Hand von Monika Kabs - etwas, was man nirgends
kaufen kann: Zwei Flaschen Ruländer-Wein aus dem Städtischen
Weinberg am Tafelsbrunnen.-01.jpg) Erzählcafé
beim Kanuclub…
Erzählcafé
beim Kanuclub…-01.jpg) Wie Hans Spies
ausführte, trafen sich vor genau 88 Jahren sieben Anhänger des
Faltbootsports in einem kleinen Musikpavillon einer
Rheinwirtschaft, wo die Boote untergebracht waren. Bereits vier
Jahre später wurde das erste Bootshaus in der Nähe der heutigen
Hafeneinfahrt mit eigenen Mitteln errichtet. Beim Bau der
Eisenbahnbrücke stand es im Weg, so dass ein Neubau im Nahbereich
der Schiffswerft Braun am Westufer des Ölhafens erstellt wurde. Bei
der „Überführung in den Verein für Leibeserziehung“ 1938 blieb die
Abteilung Kanusport erhalten.
Wie Hans Spies
ausführte, trafen sich vor genau 88 Jahren sieben Anhänger des
Faltbootsports in einem kleinen Musikpavillon einer
Rheinwirtschaft, wo die Boote untergebracht waren. Bereits vier
Jahre später wurde das erste Bootshaus in der Nähe der heutigen
Hafeneinfahrt mit eigenen Mitteln errichtet. Beim Bau der
Eisenbahnbrücke stand es im Weg, so dass ein Neubau im Nahbereich
der Schiffswerft Braun am Westufer des Ölhafens erstellt wurde. Bei
der „Überführung in den Verein für Leibeserziehung“ 1938 blieb die
Abteilung Kanusport erhalten.-01.jpg) Mit einem
kurzen Rundgang in der Bootshalle erklärte Hans-Peter Schäfer die
verschiedenen Bootstypen, den Aufbau, die Handhabung beim Rennen,
Wartung und Pflege. So wurden Wander-, Zweier-, Wildwasserkajaks,
Faltboote, Kanu Kanadier, Familien-, Rennboote und die großen
Vereinskanadier bestaunt und erklärt. Wie Schäfer ausführte, waren
die 50er/60er Jahre die Erfolgsjahre des KC Speyer mit Erfolgen bei
Regatten und Meisterschaften in Süddeutschland. Hans Spies,
Hans-Peter Schäfer, Peter Schubert, Peter Fleischbein führten die
Vereinsfarben zu Siegen und brachten Pokale heim. Probleme gab es
beim Transport der Boote. Oft half der „ Opel-Blitz vom
„Kohlen-Seidel“, der Fahrschulwagen von Emil Oppinger oder die
„Doppelkabine“ von Waldi Löser, versehen mit Dachträgern oder
Anhängern die Boote ans Ziel zu bringen.
Mit einem
kurzen Rundgang in der Bootshalle erklärte Hans-Peter Schäfer die
verschiedenen Bootstypen, den Aufbau, die Handhabung beim Rennen,
Wartung und Pflege. So wurden Wander-, Zweier-, Wildwasserkajaks,
Faltboote, Kanu Kanadier, Familien-, Rennboote und die großen
Vereinskanadier bestaunt und erklärt. Wie Schäfer ausführte, waren
die 50er/60er Jahre die Erfolgsjahre des KC Speyer mit Erfolgen bei
Regatten und Meisterschaften in Süddeutschland. Hans Spies,
Hans-Peter Schäfer, Peter Schubert, Peter Fleischbein führten die
Vereinsfarben zu Siegen und brachten Pokale heim. Probleme gab es
beim Transport der Boote. Oft half der „ Opel-Blitz vom
„Kohlen-Seidel“, der Fahrschulwagen von Emil Oppinger oder die
„Doppelkabine“ von Waldi Löser, versehen mit Dachträgern oder
Anhängern die Boote ans Ziel zu bringen.-01.jpg) Beim Rundgang
warf Norbert Schwarz einen wehmütigen Blick hinauf zu seinem „69er
Pfalzzweier in Langversion“, den er gerne wieder einmal auf seine
Schnelligkeit testen möchte. In Gedanken waren auch die
„Altkanuten“ beim früheren Vorsitzenden Pfr. Herbert Slach, Leiter
des St. Josef- Konfikts = „Seppelskaschde“, der bei einer
Wildwasserfahrt im Zillertal tödlich verunglückte.
Beim Rundgang
warf Norbert Schwarz einen wehmütigen Blick hinauf zu seinem „69er
Pfalzzweier in Langversion“, den er gerne wieder einmal auf seine
Schnelligkeit testen möchte. In Gedanken waren auch die
„Altkanuten“ beim früheren Vorsitzenden Pfr. Herbert Slach, Leiter
des St. Josef- Konfikts = „Seppelskaschde“, der bei einer
Wildwasserfahrt im Zillertal tödlich verunglückte. -Die Vereinten
Nationen erklären Wasser zum Menschenrecht-
-Die Vereinten
Nationen erklären Wasser zum Menschenrecht- Gerd
Flaschenträger, ehemaliger Fachbereichsleiter der SWS, berichtete
vom ersten Wasserwerk im Waldgebiet „ Jägerrast“ an der Iggelheimer
Straße.
Gerd
Flaschenträger, ehemaliger Fachbereichsleiter der SWS, berichtete
vom ersten Wasserwerk im Waldgebiet „ Jägerrast“ an der Iggelheimer
Straße. Wasserturm zum
Festpreis von 52.000 Mark von Bauunternehmer Fritz Felder aus
Hilden in vier Monaten erbaut…
Wasserturm zum
Festpreis von 52.000 Mark von Bauunternehmer Fritz Felder aus
Hilden in vier Monaten erbaut… Klagen über
schlechtes Trinkwasser und neues Wasserwerk am
Tafelsbrunnen…
Klagen über
schlechtes Trinkwasser und neues Wasserwerk am
Tafelsbrunnen… Distrikpolizeiliche
Vorschrift zum Schutze von öffentlichen Brunnen und
Quellen…
Distrikpolizeiliche
Vorschrift zum Schutze von öffentlichen Brunnen und
Quellen… Seit 1975
stehen an der Iggelheimer Straße im Waldbereich, gegenüber dem
ersten Wasserwerk von 1883, eine Wasserspeicheranlage mit zwei
Erdbehältern von je 2500 cbm und ein Netzdruckpumpwerk.
Gleichzeitig wurden Tiefbrunnen bis auf 180m gebohrt. Im
angrenzenden Wasserschutzgebiet Nord können pro Jahr rund 3 Mio cbm
Wasser entnommen werden. Zur Sicherheit bei Stromausfall schalten
sich Notstromaggregate mit 720 PS automatisch ein.
Seit 1975
stehen an der Iggelheimer Straße im Waldbereich, gegenüber dem
ersten Wasserwerk von 1883, eine Wasserspeicheranlage mit zwei
Erdbehältern von je 2500 cbm und ein Netzdruckpumpwerk.
Gleichzeitig wurden Tiefbrunnen bis auf 180m gebohrt. Im
angrenzenden Wasserschutzgebiet Nord können pro Jahr rund 3 Mio cbm
Wasser entnommen werden. Zur Sicherheit bei Stromausfall schalten
sich Notstromaggregate mit 720 PS automatisch ein. Geschäftsführer Bühring zeigte
auf, dass:
Geschäftsführer Bühring zeigte
auf, dass: Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling
Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling Gerd Blum
räumte ihm zur Firmengründung einen „Credit von 9000.- Mark
courant“ ein. Dem Bau des ersten eisernen Kanalschiffes folgten
Fähren, Buchtnachen und Schokker (Fischkutter) sowie alle
Arten schwimmender Wasserfahrzeuge – ausnahmslos in genieteter
Konstruktionsbauweise. So stammt auch der heute an der
Rheinpromenade zu besichtigende Aalschokker „Paul“ aus der
Schiffswerft Braun. Diese blieb bis 1926 am Floßhafen und wurde
dann an das Ostufer des zwischen 1920 und 1924 gebauten „neuen
Hafens“ verlegt. Über diesen neuen Hafen wusste Peter Hebel eine
ganz besondere Geschichte zu erzählen. Der im Rahmen einer
Notstandsmaßnahme von Arbeitslosen errichtete Hafen sollte am
Westufer eigentlich eine Binnenschiffsgroßwerft der Familie
Ewersbusch aufnehmen. Den Besitzern der ersten Speyerer
Flugzeugwerke war nach dem verlorenen Weltkrieg in dem von den
Siegermächten diktierten Versailler Vertrag der Flugzeugbau
verboten worden. Sie glaubten durch den nicht verbotenen
Binnenschiffsbau ihren nach dem Krieg verlorenen industriellen Rang
wieder gewinnen zu können. Der Plan misslang vermutlich wegen
Kapitalmangels und einer Fehleinschätzung der Erfolgsaussichten für
den Binnenschifffahrtsbau. Vor Betriebsaufnahme der Großwerft
musste das viel zu groß angelegte Unternehmen aufgegeben werden.
Hebel wies darauf hin, dass die Pfalz-Flugzeugwerke PFW heute noch
Hallen, Bürogebäude und das Kraftwerk der unvollendeten Werftanlage
nutzt.
Gerd Blum
räumte ihm zur Firmengründung einen „Credit von 9000.- Mark
courant“ ein. Dem Bau des ersten eisernen Kanalschiffes folgten
Fähren, Buchtnachen und Schokker (Fischkutter) sowie alle
Arten schwimmender Wasserfahrzeuge – ausnahmslos in genieteter
Konstruktionsbauweise. So stammt auch der heute an der
Rheinpromenade zu besichtigende Aalschokker „Paul“ aus der
Schiffswerft Braun. Diese blieb bis 1926 am Floßhafen und wurde
dann an das Ostufer des zwischen 1920 und 1924 gebauten „neuen
Hafens“ verlegt. Über diesen neuen Hafen wusste Peter Hebel eine
ganz besondere Geschichte zu erzählen. Der im Rahmen einer
Notstandsmaßnahme von Arbeitslosen errichtete Hafen sollte am
Westufer eigentlich eine Binnenschiffsgroßwerft der Familie
Ewersbusch aufnehmen. Den Besitzern der ersten Speyerer
Flugzeugwerke war nach dem verlorenen Weltkrieg in dem von den
Siegermächten diktierten Versailler Vertrag der Flugzeugbau
verboten worden. Sie glaubten durch den nicht verbotenen
Binnenschiffsbau ihren nach dem Krieg verlorenen industriellen Rang
wieder gewinnen zu können. Der Plan misslang vermutlich wegen
Kapitalmangels und einer Fehleinschätzung der Erfolgsaussichten für
den Binnenschifffahrtsbau. Vor Betriebsaufnahme der Großwerft
musste das viel zu groß angelegte Unternehmen aufgegeben werden.
Hebel wies darauf hin, dass die Pfalz-Flugzeugwerke PFW heute noch
Hallen, Bürogebäude und das Kraftwerk der unvollendeten Werftanlage
nutzt. 1967 übergab
Arthur Hebel nach 40 Jahren Geschäftsführung die Werftleitung an
seinen Sohn Peter weiter. Der musste bis 1975 einen schrittweisen
Rückgang der Neubauten konstatieren. Wegen der Erweiterung der
ELF-Raffinerie wurde die Werft 1968 mit allen Anlagen an das
Westufer eines neu geschaffenen Hafenbeckens verlegt. Auf dem fünf
Hektar großen Gelände auf der Halbinsel im neuen Hafen waren nach
und nach alle für den Schiffsbau nötigen Gewerke vertreten,
Elektroschweißung, Maschinenbau, Spenglerei und Schreinerei.
Dementsprechend viele Gerätschaften und Spezialwerkzeuge stehen auf
dem Werftgelände weiterhin zur Verfügung. „Aber Neubauten gibt es
heute bei uns praktisch nicht mehr“, bedauert der Speyerer
Schiffbauexperte die Entwicklung. Inzwischen würden schon
Binnenschiffe guter Qualität für europäische Reeder in Shanghai
gebaut. Und die seien selbst nach dem Transport nach
Rotterdam noch billiger. Vor rund 20 Jahren (1983 und 1984) verließ
der bislang letzte Neubau eines Motorschiffs, die „MS Karl
Krieger“, die Speyerer Werft, erzählte Hebel wehmütig. Seine
Erklärung: „Die Binnenschifffahrt, die seit der Wirtschaftskrise
2008 unter dem Rückgang an Frachtaufträgen, unzureichenden Preisen
bei Steigerung ihrer Betriebskosten leidet, verdient nichts mehr
und investiert nur noch das Notwendigste. Die neuen Schiffe drängen
auf den übersättigten Markt und fahren zu jedem Preis. Dies hat zur
bisher schwersten Marktstörung in der Binnenschifffahrt
geführt.“
1967 übergab
Arthur Hebel nach 40 Jahren Geschäftsführung die Werftleitung an
seinen Sohn Peter weiter. Der musste bis 1975 einen schrittweisen
Rückgang der Neubauten konstatieren. Wegen der Erweiterung der
ELF-Raffinerie wurde die Werft 1968 mit allen Anlagen an das
Westufer eines neu geschaffenen Hafenbeckens verlegt. Auf dem fünf
Hektar großen Gelände auf der Halbinsel im neuen Hafen waren nach
und nach alle für den Schiffsbau nötigen Gewerke vertreten,
Elektroschweißung, Maschinenbau, Spenglerei und Schreinerei.
Dementsprechend viele Gerätschaften und Spezialwerkzeuge stehen auf
dem Werftgelände weiterhin zur Verfügung. „Aber Neubauten gibt es
heute bei uns praktisch nicht mehr“, bedauert der Speyerer
Schiffbauexperte die Entwicklung. Inzwischen würden schon
Binnenschiffe guter Qualität für europäische Reeder in Shanghai
gebaut. Und die seien selbst nach dem Transport nach
Rotterdam noch billiger. Vor rund 20 Jahren (1983 und 1984) verließ
der bislang letzte Neubau eines Motorschiffs, die „MS Karl
Krieger“, die Speyerer Werft, erzählte Hebel wehmütig. Seine
Erklärung: „Die Binnenschifffahrt, die seit der Wirtschaftskrise
2008 unter dem Rückgang an Frachtaufträgen, unzureichenden Preisen
bei Steigerung ihrer Betriebskosten leidet, verdient nichts mehr
und investiert nur noch das Notwendigste. Die neuen Schiffe drängen
auf den übersättigten Markt und fahren zu jedem Preis. Dies hat zur
bisher schwersten Marktstörung in der Binnenschifffahrt
geführt.“.jpg) Als Darlehensgeber für
bauwillige Siedler gegründet und nun zur größten
Wohnungsbaugesellschaft Speyers entwickelt….
Als Darlehensgeber für
bauwillige Siedler gegründet und nun zur größten
Wohnungsbaugesellschaft Speyers entwickelt…..jpg) Lebensraum für Alle
und Wohnquartiere
Lebensraum für Alle
und Wohnquartiere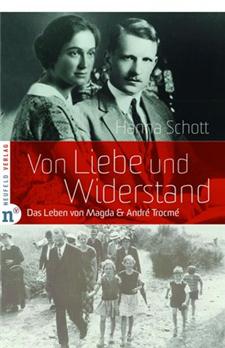 Autorenlesung:
Hanna Schotts Biografie über französisches Ehepaar
Trocmé
Autorenlesung:
Hanna Schotts Biografie über französisches Ehepaar
Trocmé Mit einem
Empfang zu Jahresbeginn bedankte sich das Diakonissen
Seniorenzentrum Haus am Germansberg am 15. Januar bei seinen 64
ehrenamtlich Mitarbeitenden für ihr beständiges
Engagement.
Mit einem
Empfang zu Jahresbeginn bedankte sich das Diakonissen
Seniorenzentrum Haus am Germansberg am 15. Januar bei seinen 64
ehrenamtlich Mitarbeitenden für ihr beständiges
Engagement. Die
Bedeutung des Ehrenamts in der Gesellschaft hob auch Pfarrer Hubert
Ehrmantraut hervor, der den Dank der katholischen Gemeinden
überbrachte: „Ohne Ehrenamt wäre Seelsorge so wie wir sie leisten
möchten, heute fast nicht mehr möglich“, zeigte er sich
überzeugt.
Die
Bedeutung des Ehrenamts in der Gesellschaft hob auch Pfarrer Hubert
Ehrmantraut hervor, der den Dank der katholischen Gemeinden
überbrachte: „Ohne Ehrenamt wäre Seelsorge so wie wir sie leisten
möchten, heute fast nicht mehr möglich“, zeigte er sich
überzeugt. Speyer-
Aus berufenem Munde wurden die rund 50 Besucher des Erzählcafes zum
Jahresauftakt im Veranstaltungssaal des Seniorenbüros im
Maulbronner Hof über die traditionsreiche Vereinsgeschichte der
1883 gegründeten Rudergesellschaft Speyer (RGS) informiert:
Ehrenvorsitzender Hans-Gustav „Hagu“ Schug und Alfred Zimmermann,
seit 2009 RGS-Vorsitzender und seit 42 Jahren in verschiedenen
Funktionen vorwiegend für die Vereinsfinanzen mit maßgebend,
erinnerten an die Anfangszeit, den Bau des RGS-Domizils an der
Hafenspitze und informierten über den nun im Reffenthal geplanten
Bau eines neuen Bootshauses. Wegen der beengten Verhältnisse im
Hafen müssen die Ruderer zum Leistungsporttraining schon seit 1971
ins Reffenthal unter der Obhut der dort stationierten Bundeswehr
ausweichen. Deshalb hat der in Speyer meist als Ruderclub
titulierte Verein bereits vor drei Jahren ein größeres Grundstück
auf dem Bundeswehrgelände gekauft. „Unser jetziges Domizil im Hafen
bleibt jedoch Kernpunkt der RGS“, beruhigte Schug all jene, die
vielleicht Angst davor haben, dass der „Ruderclub“ komplett in
Richtung Otterstadt abwandert.
Speyer-
Aus berufenem Munde wurden die rund 50 Besucher des Erzählcafes zum
Jahresauftakt im Veranstaltungssaal des Seniorenbüros im
Maulbronner Hof über die traditionsreiche Vereinsgeschichte der
1883 gegründeten Rudergesellschaft Speyer (RGS) informiert:
Ehrenvorsitzender Hans-Gustav „Hagu“ Schug und Alfred Zimmermann,
seit 2009 RGS-Vorsitzender und seit 42 Jahren in verschiedenen
Funktionen vorwiegend für die Vereinsfinanzen mit maßgebend,
erinnerten an die Anfangszeit, den Bau des RGS-Domizils an der
Hafenspitze und informierten über den nun im Reffenthal geplanten
Bau eines neuen Bootshauses. Wegen der beengten Verhältnisse im
Hafen müssen die Ruderer zum Leistungsporttraining schon seit 1971
ins Reffenthal unter der Obhut der dort stationierten Bundeswehr
ausweichen. Deshalb hat der in Speyer meist als Ruderclub
titulierte Verein bereits vor drei Jahren ein größeres Grundstück
auf dem Bundeswehrgelände gekauft. „Unser jetziges Domizil im Hafen
bleibt jedoch Kernpunkt der RGS“, beruhigte Schug all jene, die
vielleicht Angst davor haben, dass der „Ruderclub“ komplett in
Richtung Otterstadt abwandert. Erste Pläne für
das neue Bootshaus auf dem Hafengelände stammen vom August 1889. Es
entstand im Sommer 1900 an seinem heutigen Platz und bestand
zunächst aus einer großen Bootshalle. Eine zweite und dritte Halle
mit großem Saal kamen später hinzu. Das zunächst in Eigenregie
bewirtschaftete (und als Zuschussbetrieb geführte) Vereinsdomizil
ist seit längerem an einen soliden Gastwirt verpachtet und bringt
so sicheres Geld in die Vereinskasse. Dass der Blick vom
RGS-Bootshaus auf die wunderschöne Rheinschleife überhaupt möglich
ist, verdanken die Speyerer den damaligen Stadtoberen, die gegen
Tullas Begradigungspläne Einspruch eingelegt hatten, erzählte
Schug, „sonst würde heute der Rhein bei Schwetzingen
verlaufen“.
Erste Pläne für
das neue Bootshaus auf dem Hafengelände stammen vom August 1889. Es
entstand im Sommer 1900 an seinem heutigen Platz und bestand
zunächst aus einer großen Bootshalle. Eine zweite und dritte Halle
mit großem Saal kamen später hinzu. Das zunächst in Eigenregie
bewirtschaftete (und als Zuschussbetrieb geführte) Vereinsdomizil
ist seit längerem an einen soliden Gastwirt verpachtet und bringt
so sicheres Geld in die Vereinskasse. Dass der Blick vom
RGS-Bootshaus auf die wunderschöne Rheinschleife überhaupt möglich
ist, verdanken die Speyerer den damaligen Stadtoberen, die gegen
Tullas Begradigungspläne Einspruch eingelegt hatten, erzählte
Schug, „sonst würde heute der Rhein bei Schwetzingen
verlaufen“. Speyer- Wo sollte Harry
Dettmann anfangen, beim Koch, Sänger oder Entertainer? Vor diesem
Problem stand der 1976 in Speyer und Mechtersheim gelandete
Weltenbummler bei seinem Vortrag im Seniorenbüro-Erzählcafe.
Dettmann löste die Aufgabe mit Bravour, fesselte die über 100
Besucher (unter ihnen der 93-jährige Hans Gruber) im Vortragssaal
der Villa Ecarius mit seinen von köstlichen Anekdoten gezeichneten
Erzählungen und reicherte diese mit vier Liedern aus seinem
reichhaltigen Repertoire an, am E-Piano begleitet von Rudi Schimpf.
Moderator Karl-Heinz Jung hatte zusammen mit dem Lebenskünstler
eine Powerpoint-Präsentation mit unzähligen Bildern zu den vielen
Stationen Dettmanns zusammengestellt und dabei aufgezeigt, welchen
prominenten Musik- und Sportgrößen der singende Koch oder kochende
Sänger im Laufe seines Berufswegs begegnet war – an der Spitze sein
großes Idol Freddy Quinn. Dessen Erfolgsschlager „Heimweh“, den
Dettmann als Heranwachsender auf dem Volksempfänger hörte, löste
bei ihm früh die Lust auf diese Musik aus.
Speyer- Wo sollte Harry
Dettmann anfangen, beim Koch, Sänger oder Entertainer? Vor diesem
Problem stand der 1976 in Speyer und Mechtersheim gelandete
Weltenbummler bei seinem Vortrag im Seniorenbüro-Erzählcafe.
Dettmann löste die Aufgabe mit Bravour, fesselte die über 100
Besucher (unter ihnen der 93-jährige Hans Gruber) im Vortragssaal
der Villa Ecarius mit seinen von köstlichen Anekdoten gezeichneten
Erzählungen und reicherte diese mit vier Liedern aus seinem
reichhaltigen Repertoire an, am E-Piano begleitet von Rudi Schimpf.
Moderator Karl-Heinz Jung hatte zusammen mit dem Lebenskünstler
eine Powerpoint-Präsentation mit unzähligen Bildern zu den vielen
Stationen Dettmanns zusammengestellt und dabei aufgezeigt, welchen
prominenten Musik- und Sportgrößen der singende Koch oder kochende
Sänger im Laufe seines Berufswegs begegnet war – an der Spitze sein
großes Idol Freddy Quinn. Dessen Erfolgsschlager „Heimweh“, den
Dettmann als Heranwachsender auf dem Volksempfänger hörte, löste
bei ihm früh die Lust auf diese Musik aus. Mit dem Titel „Grüß
mir alle meine Freunde“ zog Dettmann singend in den Saal ein. Und
Freunde sammelte der in Dessau geborene und mit zwei Brüdern in
Süddeutschland (Kirrlach, Karlsruhe und Lahr/Schwarzwald)
aufgewachsene Sänger mit seiner mehr an der Waterkant und am
Seemannslied orientierten Musik in den drei Jahrzehnten in der Tat
reichlich, wie der Absatz seiner LPs und CDs bewies. Mit der
Koch-Lehre im von einem Brand zerstörten Hotel Rad in Tettnang und
darauf im Flughafen-Restaurant in München-Riem hatte alles
angefangen. Hier hatte Dettmann seine erste „großartige“ Begegnung
mit Freddy, aber auch mit Heinz Rühmann, den Rolling Stones und
Franz-Josef Strauß. Nach Feierabend griff der Koch-Lehrling
häufiger zur Gitarre. Einmal machte einer seiner Freunde heimlich
Tonbandaufnahmen. Auf diese Weise kam Dettmann, wie er es
formulierte, „mit dem Musikvirus in Verbindung“. Am 28.Dezember
1965 hatte der singende Koch seinen ersten öffentlichen Auftritt in
der Rumba-Bar, unter anderem mit Titeln wie „Lass mich noch einmal
in die Ferne“, „Heimweh nach St.Pauli“ und „Junge komm bald
wieder“. Der 66-Jährige interpretierte: „Endlich stand ich auf den
Brettern, die die Welt bedeuten, so hatte ich das Gefühl.“ Nach
einem zweiten und einem ersten Platz bei Wettbewerben unterschrieb
das Sangestalent seinen ersten Musikvertrag bei Teddy Parker, der
mit seinem Nachtexpress nach St.Tropez“ einen Tophit gelandet
hatte. Dann sang Dettmann erstmals vor 1500 Gästen im Malteser
Festsaal, begleitet vom Orchester Hugo Strasser, der ihm später
auch einen Titel schrieb.
Mit dem Titel „Grüß
mir alle meine Freunde“ zog Dettmann singend in den Saal ein. Und
Freunde sammelte der in Dessau geborene und mit zwei Brüdern in
Süddeutschland (Kirrlach, Karlsruhe und Lahr/Schwarzwald)
aufgewachsene Sänger mit seiner mehr an der Waterkant und am
Seemannslied orientierten Musik in den drei Jahrzehnten in der Tat
reichlich, wie der Absatz seiner LPs und CDs bewies. Mit der
Koch-Lehre im von einem Brand zerstörten Hotel Rad in Tettnang und
darauf im Flughafen-Restaurant in München-Riem hatte alles
angefangen. Hier hatte Dettmann seine erste „großartige“ Begegnung
mit Freddy, aber auch mit Heinz Rühmann, den Rolling Stones und
Franz-Josef Strauß. Nach Feierabend griff der Koch-Lehrling
häufiger zur Gitarre. Einmal machte einer seiner Freunde heimlich
Tonbandaufnahmen. Auf diese Weise kam Dettmann, wie er es
formulierte, „mit dem Musikvirus in Verbindung“. Am 28.Dezember
1965 hatte der singende Koch seinen ersten öffentlichen Auftritt in
der Rumba-Bar, unter anderem mit Titeln wie „Lass mich noch einmal
in die Ferne“, „Heimweh nach St.Pauli“ und „Junge komm bald
wieder“. Der 66-Jährige interpretierte: „Endlich stand ich auf den
Brettern, die die Welt bedeuten, so hatte ich das Gefühl.“ Nach
einem zweiten und einem ersten Platz bei Wettbewerben unterschrieb
das Sangestalent seinen ersten Musikvertrag bei Teddy Parker, der
mit seinem Nachtexpress nach St.Tropez“ einen Tophit gelandet
hatte. Dann sang Dettmann erstmals vor 1500 Gästen im Malteser
Festsaal, begleitet vom Orchester Hugo Strasser, der ihm später
auch einen Titel schrieb. Trotz seines
Plattenvertrags kehrte er in die Küche des Münchener
Flughafenrestaurants zurück. Nach diesem Intermezzo
(Krankheitsbedingt) verschlug es ihn nach Mannheim, wo er nach
neuen Jobs in der Musikszene suchte. So sang Dettmann bei der Feier
des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Germersheim. Bei von ihm
selbst organisierten Benefizveranstaltungen brachte es der
Alleinunterhalter auf über 10 000 Mark für die „Aktion Sorgenkind“,
woran den Mann mit dem sozialen Seemannsherzen heute noch ein
Autogramm von Wim Thoelke erinnert. Mit Erfolg sang Dettmann nun
auch beim Karnevalverein in Mechtersheim. Im Gasthaus „Zum Stern“
funkte es zwischen ihm und Monika Göck, die er 1976 heiratete. Bei
einer Fasnachtssitzung in Germersheim lernte der Sympathieträger
Hans Gruber kennen. Der SKG-Aktive holte Dettmann zusammen mit
Chefdekorateur Dieter Wenger zum 10.Geburtstag des Speyerer
Kaufhofs. 1970 wurde der Sänger eingeholt von seinen Kochkünsten
und wurde zum Küchenchef in die Kurpfalzkaserne Speyer berufen.
Nach zehn Jahren Kasernenarbeit war die Zeit reif für seine erste
große Auslandstournee nach Kanada, zusammen mit den „Rondos“. Der
Neuspeyerer genoss damals die Auftritte vor 10 000 Besuchern in
einer jeden Abend ausverkauften Halle. Mit dieser erfolgreichen
Tournee wurden Komponist Lothar Olias und Produzent Hajo Blasig auf
den beliebten Sangeskünstler aufmerksam. „Seemann wovon träumst
du?“ lautete der Titel für seiner ersten eigenen Platte. Immer mehr
Produktionen folgten. Hans Gruber stellte Dettmanns erste
Langspielplatte „Das große Hafenwunschkonzert“ im Kaufhof vor. Nun
war der Sänger aus Süddeutschland bestens im Geschäft und mimte bei
vielen Hafenkonzerten in Hamburg herzergreifend den erfahrenen
Seebär. Bei Rundfunksendungen stand Dettmann - einmal mit einem
zweistündigen Programm mit Harald Juhnke – ebenso seinen Seemann
wie bei einer Disco-Tournee des Saarländischen Rundfunks mit
Moderator Manfred Sexauer. In der Domstadt gewann ihn der damalige
Beigeordnete Stefan Scherpf für erste Konzerte an der
Rheinuferpromenade, die stets über 800 Besucher begeisterten. Auf
dem Höhepunkt seiner Karriere sang Harry Dettmann bei insgesamt 14
Tourneen mit über 210 Veranstaltungen durch die USA sowie bei
Schiffstourneen im Mittelmeerraum und einer Reise auf der „MS
Finnstar“ ans Nordkap. Dettmann trug aber immer mal wieder die
Kochmütze, so als Leiter eines Ludwigshafener Kochstudios oder für
den Partyservice „Tischlein deck dich“ der Metzgerei Göck.
Trotz seines
Plattenvertrags kehrte er in die Küche des Münchener
Flughafenrestaurants zurück. Nach diesem Intermezzo
(Krankheitsbedingt) verschlug es ihn nach Mannheim, wo er nach
neuen Jobs in der Musikszene suchte. So sang Dettmann bei der Feier
des 100-jährigen Bestehens der Feuerwehr Germersheim. Bei von ihm
selbst organisierten Benefizveranstaltungen brachte es der
Alleinunterhalter auf über 10 000 Mark für die „Aktion Sorgenkind“,
woran den Mann mit dem sozialen Seemannsherzen heute noch ein
Autogramm von Wim Thoelke erinnert. Mit Erfolg sang Dettmann nun
auch beim Karnevalverein in Mechtersheim. Im Gasthaus „Zum Stern“
funkte es zwischen ihm und Monika Göck, die er 1976 heiratete. Bei
einer Fasnachtssitzung in Germersheim lernte der Sympathieträger
Hans Gruber kennen. Der SKG-Aktive holte Dettmann zusammen mit
Chefdekorateur Dieter Wenger zum 10.Geburtstag des Speyerer
Kaufhofs. 1970 wurde der Sänger eingeholt von seinen Kochkünsten
und wurde zum Küchenchef in die Kurpfalzkaserne Speyer berufen.
Nach zehn Jahren Kasernenarbeit war die Zeit reif für seine erste
große Auslandstournee nach Kanada, zusammen mit den „Rondos“. Der
Neuspeyerer genoss damals die Auftritte vor 10 000 Besuchern in
einer jeden Abend ausverkauften Halle. Mit dieser erfolgreichen
Tournee wurden Komponist Lothar Olias und Produzent Hajo Blasig auf
den beliebten Sangeskünstler aufmerksam. „Seemann wovon träumst
du?“ lautete der Titel für seiner ersten eigenen Platte. Immer mehr
Produktionen folgten. Hans Gruber stellte Dettmanns erste
Langspielplatte „Das große Hafenwunschkonzert“ im Kaufhof vor. Nun
war der Sänger aus Süddeutschland bestens im Geschäft und mimte bei
vielen Hafenkonzerten in Hamburg herzergreifend den erfahrenen
Seebär. Bei Rundfunksendungen stand Dettmann - einmal mit einem
zweistündigen Programm mit Harald Juhnke – ebenso seinen Seemann
wie bei einer Disco-Tournee des Saarländischen Rundfunks mit
Moderator Manfred Sexauer. In der Domstadt gewann ihn der damalige
Beigeordnete Stefan Scherpf für erste Konzerte an der
Rheinuferpromenade, die stets über 800 Besucher begeisterten. Auf
dem Höhepunkt seiner Karriere sang Harry Dettmann bei insgesamt 14
Tourneen mit über 210 Veranstaltungen durch die USA sowie bei
Schiffstourneen im Mittelmeerraum und einer Reise auf der „MS
Finnstar“ ans Nordkap. Dettmann trug aber immer mal wieder die
Kochmütze, so als Leiter eines Ludwigshafener Kochstudios oder für
den Partyservice „Tischlein deck dich“ der Metzgerei Göck. Mit einem
Adventskonzert erfreuten junge Musiker am 9. Dezember die
Bewohnerinnen und Bewohner des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am
Germansberg.
Mit einem
Adventskonzert erfreuten junge Musiker am 9. Dezember die
Bewohnerinnen und Bewohner des Diakonissen Seniorenzentrums Haus am
Germansberg.-01.jpg) Speyer- Einem
der bedeutendsten Speyerer Einrichtungen widmete das Erzählcafe des
Seniorenbüros ihre November-Veranstaltung. Pfarrer i.R. Bernhard
Linvers, 18 Jahre lang als Seelsorger bei der Verwaltungshochschule
mindestens einmal wöchentlich bei der morgendlichen „Frühschicht“
zugast, begrüßte als versierten Referenten Dr. Heinrich Reinermann,
einer der inzwischen 15 entpflichteten Universitätsprofessoren. Der
Kaiserdom ist gemeinhin Speyers größter Werbeträger. Aber nicht
alle wissen, dass der Name der Domstadt in aller Welt bekannt ist,
weil hier der Sitz der einzigen deutschen Verwaltungshochschule,
seit einigen Monaten sogar Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer, ist. Hunderte hochrangiger
Verwaltungsbeamter in Korea, China, Togo oder Kasachstan haben als
Hörer sehr oft zwei Jahre lang in Speyer alles gelernt, was zu
einer öffentlichen Verwaltung gehört.
Speyer- Einem
der bedeutendsten Speyerer Einrichtungen widmete das Erzählcafe des
Seniorenbüros ihre November-Veranstaltung. Pfarrer i.R. Bernhard
Linvers, 18 Jahre lang als Seelsorger bei der Verwaltungshochschule
mindestens einmal wöchentlich bei der morgendlichen „Frühschicht“
zugast, begrüßte als versierten Referenten Dr. Heinrich Reinermann,
einer der inzwischen 15 entpflichteten Universitätsprofessoren. Der
Kaiserdom ist gemeinhin Speyers größter Werbeträger. Aber nicht
alle wissen, dass der Name der Domstadt in aller Welt bekannt ist,
weil hier der Sitz der einzigen deutschen Verwaltungshochschule,
seit einigen Monaten sogar Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer, ist. Hunderte hochrangiger
Verwaltungsbeamter in Korea, China, Togo oder Kasachstan haben als
Hörer sehr oft zwei Jahre lang in Speyer alles gelernt, was zu
einer öffentlichen Verwaltung gehört.-01.jpg) Am 15. Mai
1947 wurde – schon unter dem zweiten Namen die „Staatliche Akademie
für Verwaltungswissenschaften“ in der früheren Lehrerakademie
(heutiges Finanzamt) eröffnet. In diesem Komplex war damals auch
die dem Auswärtigen Amt zugehörende „Diplomatenschule“
untergebracht.
Am 15. Mai
1947 wurde – schon unter dem zweiten Namen die „Staatliche Akademie
für Verwaltungswissenschaften“ in der früheren Lehrerakademie
(heutiges Finanzamt) eröffnet. In diesem Komplex war damals auch
die dem Auswärtigen Amt zugehörende „Diplomatenschule“
untergebracht.-01.jpg) Wiedervereinigung
1989 und Hauptstadtbeschluss vom 20.Juni 1991 brachten für die
Speyerer laut Reinermann „die letzte Klippe“: Sollte die
Verwaltungshochschule auch für die „neuen Bundesländer“ zuständig
sein? Schon in der allersten gemeinsamen Sitzung der
Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer am 12.Oktober 1990 wurde
der Weg geebnet. Folgerichtig gab es die vierte Umbenennung – in
„Deutsche“ Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Auf den
„Bologna-Prozess“ mit der Qualitätssicherung und
Internatinalisierung der Hochschulstudiengänge“ reagierte die Uni
Speyer (fünfter Name) mit drei neuen Masterstudiengängen, darunter
der Master für Öffentliche Wirtschaft, ein zweijähriger
Vollzeit-Präsenz-Studiengang. Als einen Vorteil der Speyerer
Universität stellte Reinermann deren Überschaubarkeit mit
durchschnittlich 400 Studierenden pro Semester heraus, was bei rund
120 Dozenten (20 Lehrstühle und rund 100 Lehrbeauftragte) ein
Betreuungsverhältnis von 1:4 ergebe. Zu den Honorarprofessoren und
Privatdozenten zählten unter anderen die ehemaligen
Bundespräsidenten Carl Carstens und Roman Herzog, Dr.Jürgen Strube,
Dr.Bernhard Vogel und Josef Stingl. Auch Thilo Sarrazin kommt
wöchentlich zur Vorlesung nach Speyer. ws; Foto: khj
Wiedervereinigung
1989 und Hauptstadtbeschluss vom 20.Juni 1991 brachten für die
Speyerer laut Reinermann „die letzte Klippe“: Sollte die
Verwaltungshochschule auch für die „neuen Bundesländer“ zuständig
sein? Schon in der allersten gemeinsamen Sitzung der
Ministerpräsidenten aller 16 Bundesländer am 12.Oktober 1990 wurde
der Weg geebnet. Folgerichtig gab es die vierte Umbenennung – in
„Deutsche“ Hochschule für Verwaltungswissenschaften Speyer. Auf den
„Bologna-Prozess“ mit der Qualitätssicherung und
Internatinalisierung der Hochschulstudiengänge“ reagierte die Uni
Speyer (fünfter Name) mit drei neuen Masterstudiengängen, darunter
der Master für Öffentliche Wirtschaft, ein zweijähriger
Vollzeit-Präsenz-Studiengang. Als einen Vorteil der Speyerer
Universität stellte Reinermann deren Überschaubarkeit mit
durchschnittlich 400 Studierenden pro Semester heraus, was bei rund
120 Dozenten (20 Lehrstühle und rund 100 Lehrbeauftragte) ein
Betreuungsverhältnis von 1:4 ergebe. Zu den Honorarprofessoren und
Privatdozenten zählten unter anderen die ehemaligen
Bundespräsidenten Carl Carstens und Roman Herzog, Dr.Jürgen Strube,
Dr.Bernhard Vogel und Josef Stingl. Auch Thilo Sarrazin kommt
wöchentlich zur Vorlesung nach Speyer. ws; Foto: khj Mit Foto
konnte Andreas Villmann, bis 1919 Brauereibesitzer und Wirt der
„Alten Pfalz“, Maximilianstraße 6 (heute Polizei), vorgestellt
werden. Wie die „Pfälzer Zeitung“ von 1852 und 1870 berichtet, war
im Wirtshaus für 500 Gäste, neben dem Wirtschaftsbetrieb oft auch
Gelegenheit „Patent- Waschmaschinen“ oder „Holzschneidemühlen“ zu
betrachten und zu bestellen.
Mit Foto
konnte Andreas Villmann, bis 1919 Brauereibesitzer und Wirt der
„Alten Pfalz“, Maximilianstraße 6 (heute Polizei), vorgestellt
werden. Wie die „Pfälzer Zeitung“ von 1852 und 1870 berichtet, war
im Wirtshaus für 500 Gäste, neben dem Wirtschaftsbetrieb oft auch
Gelegenheit „Patent- Waschmaschinen“ oder „Holzschneidemühlen“ zu
betrachten und zu bestellen. Gebäude der
Bahnhofstraße als Zeugnis der Wirtschaftsentwicklung
Gebäude der
Bahnhofstraße als Zeugnis der Wirtschaftsentwicklung Auch für seine
Töchter ( oder Schwestern) ließ Gund die Doppelvilla Bahnhofstraße
Nr. 54/56 erbauen( heute VHS/Villa Ecarius=Schwiegersohn von Gund).
Ziegel-, Deko- Elemente und Bauausführung wurden sicher auch im
Sinne eines „Musterhauses“ dargeboten.
Auch für seine
Töchter ( oder Schwestern) ließ Gund die Doppelvilla Bahnhofstraße
Nr. 54/56 erbauen( heute VHS/Villa Ecarius=Schwiegersohn von Gund).
Ziegel-, Deko- Elemente und Bauausführung wurden sicher auch im
Sinne eines „Musterhauses“ dargeboten.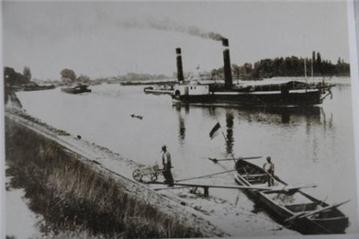 Das Erzählcafé im
Schifferzelt, gut unterhalten und bestens bedient mit Kaffee und
Kuchen-
Das Erzählcafé im
Schifferzelt, gut unterhalten und bestens bedient mit Kaffee und
Kuchen- Dampfschlepper mit 400
PS Motorleistung konnten bis zu tausend Tonnen Schüttgut ( Sand,
Split, Kies, Erde, Steine) in 6-8 Schleppkähnen auch „ zu Berg „
ziehen. Allerdings waren auf einem Schnell-Rad- Dampf-Schiff auch
ca. 14 Mann damit beschäftigt, der Dampfmaschine die erforderlichen
Kohlen „ in den Rachen“ zu schaufeln, um entsprechende Leistung zu
erzielen.
Dampfschlepper mit 400
PS Motorleistung konnten bis zu tausend Tonnen Schüttgut ( Sand,
Split, Kies, Erde, Steine) in 6-8 Schleppkähnen auch „ zu Berg „
ziehen. Allerdings waren auf einem Schnell-Rad- Dampf-Schiff auch
ca. 14 Mann damit beschäftigt, der Dampfmaschine die erforderlichen
Kohlen „ in den Rachen“ zu schaufeln, um entsprechende Leistung zu
erzielen. Speyerer Bürger und
der Rhein
Speyerer Bürger und
der Rhein
.jpg) Aus der Not
der Nachkriegszeit geboren, vom damaligen VdK- Vorsitzenden Otto
Winter ins Leben gerufen, zur größten Kriegsopfer-Siedlung
Deutschlands herangewachsen, eine Vorbildfunktion für
Frankfurt am Main, gemeinsam Häuser gebaut…..
Aus der Not
der Nachkriegszeit geboren, vom damaligen VdK- Vorsitzenden Otto
Winter ins Leben gerufen, zur größten Kriegsopfer-Siedlung
Deutschlands herangewachsen, eine Vorbildfunktion für
Frankfurt am Main, gemeinsam Häuser gebaut…...jpg) 1952 begann
der damalige VdK-Vorsitzende nac h Wegen zu suchen, wie den
Kriegsbeschädigten, Witwen und Kriegswaisen Wohnungen zu
beschaffen seien.
1952 begann
der damalige VdK-Vorsitzende nac h Wegen zu suchen, wie den
Kriegsbeschädigten, Witwen und Kriegswaisen Wohnungen zu
beschaffen seien..jpg) Hans Winter
erinnert sich noch gut an den Einzug am 10. Dez. 1956 in das
unverputzte Haus. Das erste Weihnachtsfest im eigenen Haus
brachte Freudentränen über das Erreichte hervor; es flossen aber
auch Tränen der Trauer um die im Krieg gebliebenen
Familienmitglieder, so Winter.
Hans Winter
erinnert sich noch gut an den Einzug am 10. Dez. 1956 in das
unverputzte Haus. Das erste Weihnachtsfest im eigenen Haus
brachte Freudentränen über das Erreichte hervor; es flossen aber
auch Tränen der Trauer um die im Krieg gebliebenen
Familienmitglieder, so Winter..jpg) Heute sind
nur noch wenige Häuser im ursprünglichen Charakter vorzufinden.
Heute sind
nur noch wenige Häuser im ursprünglichen Charakter vorzufinden. Die Senioren-
Residenz Sankt Sebastian wurde erneut mit dem Grünen Haken der BIVA
für eine hohe Lebensqualität und ausgewiesene
Verbraucherfreundlichkeit ausgezeichnet, denn, hier fühlen sich
Seniorinnen und Senioren wohl und können ihr Leben selbst
bestimmen.
Die Senioren-
Residenz Sankt Sebastian wurde erneut mit dem Grünen Haken der BIVA
für eine hohe Lebensqualität und ausgewiesene
Verbraucherfreundlichkeit ausgezeichnet, denn, hier fühlen sich
Seniorinnen und Senioren wohl und können ihr Leben selbst
bestimmen. Das
besondere am „Grünen Haken“:
Das
besondere am „Grünen Haken“:.jpg) Speyer-
Viele Tabakschuppen zwischen Rhein und Pfälzerwald zeugen noch
davon, dass der Anbau und die Vermarktung von Tabak in der Pfalz
lange Zeit eine bedeutende wirtschaftliche Rolle spielten. Wie sich
der Tabakbau entwickelt und was sich in den vergangenen rund 100
Jahren alles geändert hat, das zeigten drei Fachmänner Günter
Hechler, Klaus Mayrhofer und Töns Wellensiek im Juni-Erzählcafe des
Seniorenbüros auf. Zum Abschluss des von Dr.Thomas Neubert
moderierten Erzählnachmittag im Vortragssaal der Villia Ecarius
bekamen die annähernd 100 Besucher zudem von Alma Gehrlein aus
Hördt vorgeführt, wie Zigarren gewickelt werden. Und wer wollte,
konnte sich vom langjährigen Tabakbausachverständigen Günter
Hechler zum Preis von 4 Euro eine frisch gewickelte Zigarre
„verpassen“ lassen.
Speyer-
Viele Tabakschuppen zwischen Rhein und Pfälzerwald zeugen noch
davon, dass der Anbau und die Vermarktung von Tabak in der Pfalz
lange Zeit eine bedeutende wirtschaftliche Rolle spielten. Wie sich
der Tabakbau entwickelt und was sich in den vergangenen rund 100
Jahren alles geändert hat, das zeigten drei Fachmänner Günter
Hechler, Klaus Mayrhofer und Töns Wellensiek im Juni-Erzählcafe des
Seniorenbüros auf. Zum Abschluss des von Dr.Thomas Neubert
moderierten Erzählnachmittag im Vortragssaal der Villia Ecarius
bekamen die annähernd 100 Besucher zudem von Alma Gehrlein aus
Hördt vorgeführt, wie Zigarren gewickelt werden. Und wer wollte,
konnte sich vom langjährigen Tabakbausachverständigen Günter
Hechler zum Preis von 4 Euro eine frisch gewickelte Zigarre
„verpassen“ lassen..jpg) In der Pfalz begann
im Jahre 1573 der deutsche Tabakbau. Der Hatzenbühler Pfarrer
Anselm Anselmann züchtete in seinem Kirchgarten die ersten
Tabakpflanzen Deutschlands. Zunächst nur als blühende Zier- und als
Heilpflanze benutzt, kam laut Hechler „erst um das Jahr 1600 der
Genuss dazu“ In dieser Zeit habe in Speyer als erster Johann
Joachim Becher zum Tabak Stellung genommen. Zum Gebrauch „von
Toback und Brandtewein“ habe Becher erklärt: „Dieser soll nicht
allezeit, sondern nur als eine Arzeney bey kalten Wetter, bösen
Nebeln und unverdaulicher Kost gebrauchet werden. Um 1700 begann
der Siegeszug des Tabaks in seiner heutigen Anwendung. Der
britische Seefahrer und weltmännische Pfeifenraucher Sir Walter
Raleigh machte das Rauchen hoffähig.
In der Pfalz begann
im Jahre 1573 der deutsche Tabakbau. Der Hatzenbühler Pfarrer
Anselm Anselmann züchtete in seinem Kirchgarten die ersten
Tabakpflanzen Deutschlands. Zunächst nur als blühende Zier- und als
Heilpflanze benutzt, kam laut Hechler „erst um das Jahr 1600 der
Genuss dazu“ In dieser Zeit habe in Speyer als erster Johann
Joachim Becher zum Tabak Stellung genommen. Zum Gebrauch „von
Toback und Brandtewein“ habe Becher erklärt: „Dieser soll nicht
allezeit, sondern nur als eine Arzeney bey kalten Wetter, bösen
Nebeln und unverdaulicher Kost gebrauchet werden. Um 1700 begann
der Siegeszug des Tabaks in seiner heutigen Anwendung. Der
britische Seefahrer und weltmännische Pfeifenraucher Sir Walter
Raleigh machte das Rauchen hoffähig..jpg) Aufgrund des für
Tabakanbau idealen Klimas und der optimalen Bodenverhältnisse
ernten die heute noch 60 Pfälzer Pflanzer leichten und milden, aber
dennoch aromatischen Tabak der Sorten Geudertheimer, Burley und
Virgin, berichtete Töns Wellensiek, Nachkomme einer großen Speyerer
Zigarrenfabrik. Carl Schalk, in Neuwied geborener Kaufmann gründete
zusammen mit dem technisch versierteren Hermann Wellensiek,
Großvater von Töns Wellensiek, die Zigarrenfabrik, die mit
1882 mit zwölf Arbeitern die Produktion aufnahm. 1906 stand die
Firma Wellensiek & Schalk, die sehr sozial eingestellt war und
eine eigene Krankenkasse betrieb, mit 2000 Beschäftigten in voller
Blüte. Im Wellensiekschen Verwaltungsgebäude in der Johannesstraße
sind heute das Sozialamt und das Stadtarchiv beheimatetet.
Aufgrund des für
Tabakanbau idealen Klimas und der optimalen Bodenverhältnisse
ernten die heute noch 60 Pfälzer Pflanzer leichten und milden, aber
dennoch aromatischen Tabak der Sorten Geudertheimer, Burley und
Virgin, berichtete Töns Wellensiek, Nachkomme einer großen Speyerer
Zigarrenfabrik. Carl Schalk, in Neuwied geborener Kaufmann gründete
zusammen mit dem technisch versierteren Hermann Wellensiek,
Großvater von Töns Wellensiek, die Zigarrenfabrik, die mit
1882 mit zwölf Arbeitern die Produktion aufnahm. 1906 stand die
Firma Wellensiek & Schalk, die sehr sozial eingestellt war und
eine eigene Krankenkasse betrieb, mit 2000 Beschäftigten in voller
Blüte. Im Wellensiekschen Verwaltungsgebäude in der Johannesstraße
sind heute das Sozialamt und das Stadtarchiv beheimatetet.
.jpg) Der
Universalgelehrte Johann Joachim Becher, in Speyer geboren, an
vielen Fürstenhöfen Europas als Berater tätig. Mediziner,
Mathematiker, Begründer der Politischen Ökonomie, plante Kanäle,
Schleusen, verbesserte die Technik der Wassermühlen, wollte
Kolonien in Guyana aufbauen, um Rohstoffe zu erhalten, stellte im „
Werkhaus“ das Zusammenwirken von Bildung, Produktion und
Gemeinwesen als zukunfttragendes Konzept vor. Er wurde geehrt und
geachtet, aber auch „gemobbt“ und starb mit 48 Jahren fern
seiner geliebten Heimat in London.
Der
Universalgelehrte Johann Joachim Becher, in Speyer geboren, an
vielen Fürstenhöfen Europas als Berater tätig. Mediziner,
Mathematiker, Begründer der Politischen Ökonomie, plante Kanäle,
Schleusen, verbesserte die Technik der Wassermühlen, wollte
Kolonien in Guyana aufbauen, um Rohstoffe zu erhalten, stellte im „
Werkhaus“ das Zusammenwirken von Bildung, Produktion und
Gemeinwesen als zukunfttragendes Konzept vor. Er wurde geehrt und
geachtet, aber auch „gemobbt“ und starb mit 48 Jahren fern
seiner geliebten Heimat in London..jpg) Beauftragter und Berater bei
Kaiser Leopold I. und das Werkhausprojekt in Wien
Beauftragter und Berater bei
Kaiser Leopold I. und das Werkhausprojekt in Wien.jpg) Manch gute
Vorschläge scheiterten, weil die Rahmenbedingungen noch nicht
stimmten. Das von Becher entdeckte Leuchtgas wurde erst gebraucht
als die Frühindustrialisierung begann, so Böhret.
Manch gute
Vorschläge scheiterten, weil die Rahmenbedingungen noch nicht
stimmten. Das von Becher entdeckte Leuchtgas wurde erst gebraucht
als die Frühindustrialisierung begann, so Böhret.
-03.jpg) Entstehung,
Wirken der Feuerwehr von Speyer in Kriegs- u. Notzeiten im
Erzählcafé….
Entstehung,
Wirken der Feuerwehr von Speyer in Kriegs- u. Notzeiten im
Erzählcafé…. Harte, problemreiche
Kriegsjahre erwarten ab 1.7. 1939 Anton Dengler
Harte, problemreiche
Kriegsjahre erwarten ab 1.7. 1939 Anton Dengler Geistreich,schlagfertig, humorvoll,
mit tiefsinnigen Anekdoten versehen, stellte der
80-jährige emeritierte Bischof die Berufung zum“
Speyerer Bischof“, sein Leben und Wirken dar.
Geistreich,schlagfertig, humorvoll,
mit tiefsinnigen Anekdoten versehen, stellte der
80-jährige emeritierte Bischof die Berufung zum“
Speyerer Bischof“, sein Leben und Wirken dar.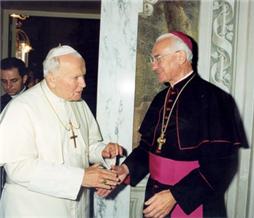 Papstbesuch am
4. Mai 1987 auf Einladung von Bischof Schlembach
Papstbesuch am
4. Mai 1987 auf Einladung von Bischof Schlembach Papstbesuch
als größtes Ereignis
Papstbesuch
als größtes Ereignis Hohe
Staatsgäste als Besucher im Dom empfangen….
Hohe
Staatsgäste als Besucher im Dom empfangen…..jpg) Am 14.1.2012
wurde in der Senioren-Residenz Sankt-Sebastian das 10jährige
Jubiläum gefeiert. Zu diesem Festtag waren sehr viele geladene
Gäste, Bewohner, Angehörige und Freunde des Hauses gekommen. Der
festlich dekorierte Speisesaal war voll besetzt.
Am 14.1.2012
wurde in der Senioren-Residenz Sankt-Sebastian das 10jährige
Jubiläum gefeiert. Zu diesem Festtag waren sehr viele geladene
Gäste, Bewohner, Angehörige und Freunde des Hauses gekommen. Der
festlich dekorierte Speisesaal war voll besetzt..jpg) Einige
Mitarbeiter(Frau Heim-Ullrich, Herr Stein,Frau Dix, Frau
Dobberstein, Frau Schütz, Frau Hook, Frau Schäfer) sind schon von
Beginn an dabei und feierten ihr 10jähriges Dienstjubiläum und
wurden von Frau Ehrhardt-Steck geehrt.
Einige
Mitarbeiter(Frau Heim-Ullrich, Herr Stein,Frau Dix, Frau
Dobberstein, Frau Schütz, Frau Hook, Frau Schäfer) sind schon von
Beginn an dabei und feierten ihr 10jähriges Dienstjubiläum und
wurden von Frau Ehrhardt-Steck geehrt..jpg) Zum Abschluß
des Festprogramms trat die Volkstanzgruppe Mutterstadt in einer
schönen, traditionellen Tracht auf und brachte auch ihre
guten Wünsche zum Jubiläum mit vier volkstümlichen Tänzen.
Zum Abschluß
des Festprogramms trat die Volkstanzgruppe Mutterstadt in einer
schönen, traditionellen Tracht auf und brachte auch ihre
guten Wünsche zum Jubiläum mit vier volkstümlichen Tänzen. Wie in der
Gutleuthaus-Allmosenrechnung Anno 1716 vermerkt ist, erhalten
die Frauen von Berghausen für die „rettende Tat“ jedes Jahr ein
Legat von 14 Pfund (7kg) Ochsen und 14 Pfund Schweinefleisch.
Wie in der
Gutleuthaus-Allmosenrechnung Anno 1716 vermerkt ist, erhalten
die Frauen von Berghausen für die „rettende Tat“ jedes Jahr ein
Legat von 14 Pfund (7kg) Ochsen und 14 Pfund Schweinefleisch. Im
Rhein-Pfalz-Stift ist der Alltag eingekehrt / Kunterbunter
Veranstaltungskalender
Im
Rhein-Pfalz-Stift ist der Alltag eingekehrt / Kunterbunter
Veranstaltungskalender
 Mit einer
besonderen Form des ehrenamtlichen Engagements erfreuten junge
Musiker am 17. Dezember die Bewohnerinnen und Bewohner des
Seniorenzentrums Haus am Germansberg.
Mit einer
besonderen Form des ehrenamtlichen Engagements erfreuten junge
Musiker am 17. Dezember die Bewohnerinnen und Bewohner des
Seniorenzentrums Haus am Germansberg. Speyer- Köstliches
Weihnachtsgebäck, wohlklingende Adventsmusik und in die
Vorweihnachtszeit passende Gedichte und Geschichten ließen das
Dezember-Erzählcafe im voll besetzten Veranstaltungsraum des
Seniorenbüros im Maulbronner Hof für die Besucher zu einem
stimmungsvollen Nachmittag werden. Mit Erinnerungen aus seiner
Kindheit in Mitteldeutschland (bei Magdeburg)
bereicherte Dr.Thomas Neubert als einfühlsamer
Moderator die adventliche Kaffeestunde, die obendrein noch einen
Ausflug in eine fremde Kultur brachte. Denn das Römerberger Ehepaar
Hermann und Wilma Kögel, das 1997 im Selbstverlag ein (aufgrund der
eigenen Rezepturen leider völlig vergriffenes) Backbuch
herausgebracht hatte, lebte lange Zeit in Schweden und hat im
Seniorenbüro-Saal nun erzählt über das Luciafest, das in dem
nordeuropäischen Land am 13.Dezember gefeiert wird. Traditionell
gibt es zur Lucia-Feier rund um die längste Nacht des Jahres
hauchdünne Pfefferkuchen und goldgelbe „Luciakatzen“ (kleine
Hefeteigfiguren mit viel Safran). Körbchen mit Kostproben von
beidem hat die leidenschaftliche Hobbybäckerin Wilma Kögel zum
Kaffee herumreichen lassen. Hermann Kögel brachte fürs Seniorenbüro
ein von ihm gemaltes Bild mit. Es zeigt drei junge Frauen, von
denen eine eine Lucia-Krone (Kopfleuchter mit Kerzen) trägt. An
vielen schwedischen Schulen werden junge Mädchen jedes Jahr zu
einer Lucia gewählt.
Speyer- Köstliches
Weihnachtsgebäck, wohlklingende Adventsmusik und in die
Vorweihnachtszeit passende Gedichte und Geschichten ließen das
Dezember-Erzählcafe im voll besetzten Veranstaltungsraum des
Seniorenbüros im Maulbronner Hof für die Besucher zu einem
stimmungsvollen Nachmittag werden. Mit Erinnerungen aus seiner
Kindheit in Mitteldeutschland (bei Magdeburg)
bereicherte Dr.Thomas Neubert als einfühlsamer
Moderator die adventliche Kaffeestunde, die obendrein noch einen
Ausflug in eine fremde Kultur brachte. Denn das Römerberger Ehepaar
Hermann und Wilma Kögel, das 1997 im Selbstverlag ein (aufgrund der
eigenen Rezepturen leider völlig vergriffenes) Backbuch
herausgebracht hatte, lebte lange Zeit in Schweden und hat im
Seniorenbüro-Saal nun erzählt über das Luciafest, das in dem
nordeuropäischen Land am 13.Dezember gefeiert wird. Traditionell
gibt es zur Lucia-Feier rund um die längste Nacht des Jahres
hauchdünne Pfefferkuchen und goldgelbe „Luciakatzen“ (kleine
Hefeteigfiguren mit viel Safran). Körbchen mit Kostproben von
beidem hat die leidenschaftliche Hobbybäckerin Wilma Kögel zum
Kaffee herumreichen lassen. Hermann Kögel brachte fürs Seniorenbüro
ein von ihm gemaltes Bild mit. Es zeigt drei junge Frauen, von
denen eine eine Lucia-Krone (Kopfleuchter mit Kerzen) trägt. An
vielen schwedischen Schulen werden junge Mädchen jedes Jahr zu
einer Lucia gewählt. Barrierefreiheit,
Seniorenservice, Nachlese, Vorschau der Beiratsarbeit, Berichte der
Arbeitskreise Kultur und Verkehr, Überlegungen über „ Leitpfade“
waren die Themen.
Barrierefreiheit,
Seniorenservice, Nachlese, Vorschau der Beiratsarbeit, Berichte der
Arbeitskreise Kultur und Verkehr, Überlegungen über „ Leitpfade“
waren die Themen. (Ludwigshafen)
– Am Dienstag, 22.11.2011, gegen 10.30 Uhr, erschien ein
bislang unbekannter Mann an der Wohnung eines 78-jährigen Seniors
in einem Seniorenheim in der Pranckhstraße. Der Unbekannte gab vor,
nach dem Fernseher des 78-Jährigen schauen zu wollen, weil das
Gerät auf das digitale Programm umgestellt werden solle. Daraufhin
ließ der Senior den Unbekannten in die Wohnung, der dann wohl einen
unbeobachteten Moment nutzte um mehrere hundert Euro Bargeld aus
der Jackentasche des Wohnungsinhabers zu entwenden.
(Ludwigshafen)
– Am Dienstag, 22.11.2011, gegen 10.30 Uhr, erschien ein
bislang unbekannter Mann an der Wohnung eines 78-jährigen Seniors
in einem Seniorenheim in der Pranckhstraße. Der Unbekannte gab vor,
nach dem Fernseher des 78-Jährigen schauen zu wollen, weil das
Gerät auf das digitale Programm umgestellt werden solle. Daraufhin
ließ der Senior den Unbekannten in die Wohnung, der dann wohl einen
unbeobachteten Moment nutzte um mehrere hundert Euro Bargeld aus
der Jackentasche des Wohnungsinhabers zu entwenden. Speyer- Dass die
Sektion Speyer im Deutschen Alpenverein (DAV) mit über 1200
Mitgliedern zu den größten Vereinen der Domstadt zählt, wissen die
wenigsten. Und sie ist sehr aktiv: Es gibt eine große Wandergruppe,
andere klettern gemeinsam, und es gibt natürlich auch viele
„Älpler“, die richtig Berge besteigen. Und das nicht immer nur in
den Alpen, wie der langjährige Vorsitzende (1983 bis 97) und
heutige Ehrenvorsitzende Emil Nord beim Erzählcafe des
Seniorenbüros eindrucksvoll schilderte. Im Mittelpunkt seiner
Erzählungen über das Vereinsleben im größten und ältesten
Naturschutzverein Deutschlands stand eine einmonatige Expedition im
Jahre 1993, die Nord zusammen mit 17 weiteren Alpenfreunden zum so
genannten „Dach der Welt“, zum Bergsteigen ins
zentralasiatische Pamirgebirge, führte.
Speyer- Dass die
Sektion Speyer im Deutschen Alpenverein (DAV) mit über 1200
Mitgliedern zu den größten Vereinen der Domstadt zählt, wissen die
wenigsten. Und sie ist sehr aktiv: Es gibt eine große Wandergruppe,
andere klettern gemeinsam, und es gibt natürlich auch viele
„Älpler“, die richtig Berge besteigen. Und das nicht immer nur in
den Alpen, wie der langjährige Vorsitzende (1983 bis 97) und
heutige Ehrenvorsitzende Emil Nord beim Erzählcafe des
Seniorenbüros eindrucksvoll schilderte. Im Mittelpunkt seiner
Erzählungen über das Vereinsleben im größten und ältesten
Naturschutzverein Deutschlands stand eine einmonatige Expedition im
Jahre 1993, die Nord zusammen mit 17 weiteren Alpenfreunden zum so
genannten „Dach der Welt“, zum Bergsteigen ins
zentralasiatische Pamirgebirge, führte.  Die Sektion
Speyer wurde 1899 in der Gaststätte „Zur Sonne“ (später Wienerwald,
dann McDonalds, jetzt Gerry Weber) gegründet und war laut Nord
zunächst „ein elitärer Verein“(mit Kgl.Bayerischem Major,
Bankdirektor, und kgl. Regierungskommissär) . Für die Aufnahme
brauchten Interessenten zwei Bürgen. Nach einem Film von Luis
Trenker von der Bergwelt fasziniert, wollte Nord 1950 als
17-Jähriger in den Alpenverein eintreten. Da habe ihn der damalige
Vorsitzende gefragt, was er denn alles schon gemacht und somit
vorzuweisen habe. Nord verbildlichte diese Nachfrage: „Das ist so,
wie wenn man zum Klavierlehrer kommt und der fragt, wo man schon
überall gespielt hat.“ Wenn dieser Vorsitzende wüsste, dass der
junge Bergfreund später 14 Jahre lang den Verein führte und
inzwischen sein Ehrenvorsitzender ist, „würde er sich wohl im Grab
rumdrehen“, meinte Nord. Besonders aktiv ist heute in der Sektion
Speyer neben der engagierten Jugendgruppe die von Helga und
Reinhard Gruner geleitete Seniorengruppe, bei der sich nicht alles
nur ums Wandern und Bergthemen dreht, sondern auch „Kultur
angesagt ist“.
Die Sektion
Speyer wurde 1899 in der Gaststätte „Zur Sonne“ (später Wienerwald,
dann McDonalds, jetzt Gerry Weber) gegründet und war laut Nord
zunächst „ein elitärer Verein“(mit Kgl.Bayerischem Major,
Bankdirektor, und kgl. Regierungskommissär) . Für die Aufnahme
brauchten Interessenten zwei Bürgen. Nach einem Film von Luis
Trenker von der Bergwelt fasziniert, wollte Nord 1950 als
17-Jähriger in den Alpenverein eintreten. Da habe ihn der damalige
Vorsitzende gefragt, was er denn alles schon gemacht und somit
vorzuweisen habe. Nord verbildlichte diese Nachfrage: „Das ist so,
wie wenn man zum Klavierlehrer kommt und der fragt, wo man schon
überall gespielt hat.“ Wenn dieser Vorsitzende wüsste, dass der
junge Bergfreund später 14 Jahre lang den Verein führte und
inzwischen sein Ehrenvorsitzender ist, „würde er sich wohl im Grab
rumdrehen“, meinte Nord. Besonders aktiv ist heute in der Sektion
Speyer neben der engagierten Jugendgruppe die von Helga und
Reinhard Gruner geleitete Seniorengruppe, bei der sich nicht alles
nur ums Wandern und Bergthemen dreht, sondern auch „Kultur
angesagt ist“.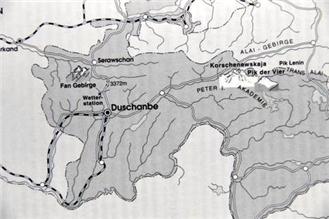 1991 beschlossen
Nord und andere „Älpler“, dass sie sich auf die Spuren des
deutschen Forschers Rieckmer-Rieckmers, der 1928 das Pamirgebirge
erkundete und die Erstbesteigung des 7 134 Meter hohen Pik Lenin
leitete, begeben wollten. Auf diese Idee brachten sie Sportler aus
der Partnerstadt Kursk, die beim Kanuclub zu Gast waren und über
Rudi Unser nachfragen ließen, ob Speyerer Alpinisten nicht
Lust hätten, die Berge in der heutigen GUS zu besteigen. Es war von
Tien Shan, Kaukasus und Pamir die Rede, erinnerte Nord. Über die
Kursker kam der Alpenverein in Kontakt mit einem Sportclub aus
Odessa, der Berrgsteigertouren organisiert. Da Nord und sein Sohn
Stefan als ausgebildete Führungskräfte schon immer vom Bergsteigen
an den hohen Pamir-Bergen träumten, wurde die Forschungsreise
beschlossen. Welche Hindernisse in der nahezu zwei Jahre
dauernden Vorplanung zu überwinden waren, schilderte Emil Nord mit
nachempfindbarer Begeisterung. Erstes Problem war die Größe der
Gruppe.
1991 beschlossen
Nord und andere „Älpler“, dass sie sich auf die Spuren des
deutschen Forschers Rieckmer-Rieckmers, der 1928 das Pamirgebirge
erkundete und die Erstbesteigung des 7 134 Meter hohen Pik Lenin
leitete, begeben wollten. Auf diese Idee brachten sie Sportler aus
der Partnerstadt Kursk, die beim Kanuclub zu Gast waren und über
Rudi Unser nachfragen ließen, ob Speyerer Alpinisten nicht
Lust hätten, die Berge in der heutigen GUS zu besteigen. Es war von
Tien Shan, Kaukasus und Pamir die Rede, erinnerte Nord. Über die
Kursker kam der Alpenverein in Kontakt mit einem Sportclub aus
Odessa, der Berrgsteigertouren organisiert. Da Nord und sein Sohn
Stefan als ausgebildete Führungskräfte schon immer vom Bergsteigen
an den hohen Pamir-Bergen träumten, wurde die Forschungsreise
beschlossen. Welche Hindernisse in der nahezu zwei Jahre
dauernden Vorplanung zu überwinden waren, schilderte Emil Nord mit
nachempfindbarer Begeisterung. Erstes Problem war die Größe der
Gruppe.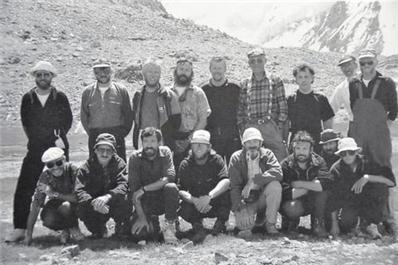 Je mehr
Teilnehmer es waren, desto niedriger konnte der Preis kalkuliert
werden. Je größer die Gruppe werden würde, desto geringer war
die Chance, alle Bergsteiger bis zu den Gipfeln zu bekommen. Nicht
gerechnet hatte Nord mit der enorm großen Zahl der Interessenten
aus ganz Deutschland. So erfolgte die Auswahl nach der Reihenfolge
der Anmeldung. Von den letztlich 18 Pamir-Fahrern kamen vier aus
der Sektion Speyer und die anderen aus der gesamten Pfalz. Dank
einiger Sponsoren konnte der Preis für die gewaltige Bergtour auf
rund 3000 Mark kalkuliert werde. Zusammenstellen der Ausrüstung,
Besorgen der Visa und Überprüfen der Sportlichkeit aller
Pamir-Freunde schilderte der damalige Vereinschef ebenso
eindrucksvoll wie das Problem mit der rund eine Tonne schweren
Gesamtausrüstung (Schlafsäcke, Zelte, Kocher, Kleidung,
Spezialschuhe) und das Verstauen der Fracht auf dem Frankfurter
Flughafen. Am 16.Juli 1993 ging endlich der Flieger Richtung Kiew.
Zur Überraschung der Pfälzer hatte sich die Gruppe aus Odessa
mittlerweile aufgelöst und wurde die Betreuung der Deutschen von
einem Moskauer Klub übernommen, „was vielleicht unser Glück war“,
kommentierte Nord. Überaus abenteuerlich am nächsten Tag der
Weiterflug in einem zweimotorigen Propeller-Frachtflugzeug Antonow
26B. Zwischen ihrem Gepäck sitzend landete das Alpenvereinteam
(nach Zwischenlandung auf Wüstenflugplatz Krasnovodsk in
Turkmenistan) mitten in der Nacht in Duschambe. Am nächsten Tag
ging’s dann mit Lkw und Kleinbussen hinauf in die Berge ins
über 4200 Meter hoch gelegene Basislager Moskwin zum Pik
Korschenewskkaja/Pik Kommunismus, wo’s zur Begrüßung einen
ausgezeichneten Natur-Pfefferminztee gab.
Je mehr
Teilnehmer es waren, desto niedriger konnte der Preis kalkuliert
werden. Je größer die Gruppe werden würde, desto geringer war
die Chance, alle Bergsteiger bis zu den Gipfeln zu bekommen. Nicht
gerechnet hatte Nord mit der enorm großen Zahl der Interessenten
aus ganz Deutschland. So erfolgte die Auswahl nach der Reihenfolge
der Anmeldung. Von den letztlich 18 Pamir-Fahrern kamen vier aus
der Sektion Speyer und die anderen aus der gesamten Pfalz. Dank
einiger Sponsoren konnte der Preis für die gewaltige Bergtour auf
rund 3000 Mark kalkuliert werde. Zusammenstellen der Ausrüstung,
Besorgen der Visa und Überprüfen der Sportlichkeit aller
Pamir-Freunde schilderte der damalige Vereinschef ebenso
eindrucksvoll wie das Problem mit der rund eine Tonne schweren
Gesamtausrüstung (Schlafsäcke, Zelte, Kocher, Kleidung,
Spezialschuhe) und das Verstauen der Fracht auf dem Frankfurter
Flughafen. Am 16.Juli 1993 ging endlich der Flieger Richtung Kiew.
Zur Überraschung der Pfälzer hatte sich die Gruppe aus Odessa
mittlerweile aufgelöst und wurde die Betreuung der Deutschen von
einem Moskauer Klub übernommen, „was vielleicht unser Glück war“,
kommentierte Nord. Überaus abenteuerlich am nächsten Tag der
Weiterflug in einem zweimotorigen Propeller-Frachtflugzeug Antonow
26B. Zwischen ihrem Gepäck sitzend landete das Alpenvereinteam
(nach Zwischenlandung auf Wüstenflugplatz Krasnovodsk in
Turkmenistan) mitten in der Nacht in Duschambe. Am nächsten Tag
ging’s dann mit Lkw und Kleinbussen hinauf in die Berge ins
über 4200 Meter hoch gelegene Basislager Moskwin zum Pik
Korschenewskkaja/Pik Kommunismus, wo’s zur Begrüßung einen
ausgezeichneten Natur-Pfefferminztee gab..jpg) Speyer. „Keine Stadt
in Deutschland weist ein so altes Klinikwesen auf wie Speyer“,
behauptet Dr.Adalbert Orth. Der Sanitätsrat war in vielen
Funktionen als Mediziner ehrenamtlich engagiert und stand unter
anderem 25 Jahre lang an der Spitze der Ärztlichen Kreisvereinigung
Speyer und plauderte nun im von Karl-Heinz Jung moderierten
„Ezählcafe“ des Seniorenbüros im gut besuchten Versammlungsraum des
Maulbronner Hofs über die medizinische Versorgung von Speyer und
freimütig aus dem Nähkästchen, sprich: aus der Praxis. Und da kam
einiges zusammen. Schließlich haben sich ja schon Großvater Daniel
und Onkel Bernhard Orth in Speyer als Ärzte einen Namen gemacht.
Und Tochter Anna-Marie setzt die Orthsche Tradition fort.
Speyer. „Keine Stadt
in Deutschland weist ein so altes Klinikwesen auf wie Speyer“,
behauptet Dr.Adalbert Orth. Der Sanitätsrat war in vielen
Funktionen als Mediziner ehrenamtlich engagiert und stand unter
anderem 25 Jahre lang an der Spitze der Ärztlichen Kreisvereinigung
Speyer und plauderte nun im von Karl-Heinz Jung moderierten
„Ezählcafe“ des Seniorenbüros im gut besuchten Versammlungsraum des
Maulbronner Hofs über die medizinische Versorgung von Speyer und
freimütig aus dem Nähkästchen, sprich: aus der Praxis. Und da kam
einiges zusammen. Schließlich haben sich ja schon Großvater Daniel
und Onkel Bernhard Orth in Speyer als Ärzte einen Namen gemacht.
Und Tochter Anna-Marie setzt die Orthsche Tradition fort..jpg) Bekanntlich
ist die Heidelberger Universität die älteste auf deutschem Boden.
Aber schon lange vor ihrer Gründung waren in den rheinischen
Städten Heilkundige anzutreffen, die den Titel medicus oder
physicus führten und demnach als studierte Ärzte anzusehen waren.
In Deutschland wurde damals die Arzneikunde nur in Klostern und
Domschulen gepflegt. Es ist anzunehmen, so denkt Orth, dass an der
Speyerer Domschule Medizin gelehrt wurde, längst bevor die erste
deutsche medizinische Fakultät, 1390 an der Universität Heidelberg
gegründet, Medizin vermittelte.
Bekanntlich
ist die Heidelberger Universität die älteste auf deutschem Boden.
Aber schon lange vor ihrer Gründung waren in den rheinischen
Städten Heilkundige anzutreffen, die den Titel medicus oder
physicus führten und demnach als studierte Ärzte anzusehen waren.
In Deutschland wurde damals die Arzneikunde nur in Klostern und
Domschulen gepflegt. Es ist anzunehmen, so denkt Orth, dass an der
Speyerer Domschule Medizin gelehrt wurde, längst bevor die erste
deutsche medizinische Fakultät, 1390 an der Universität Heidelberg
gegründet, Medizin vermittelte..jpg) Heute sei die
Domstadt medizinisch bestens mit Krankenhäusern, über das Ärztenetz
PRAVO (Praxisnetz Vorderpfalz), Ökumenischer Sozialstation,
Ärztlichen Notfalldienst, mit einem rührigen Kneipp-Verein
sowie guten Physio- und Ergotherapeuten versorgt. Auch das
Hospiz im Wilhelminenstift und das Sterntaler-Kinderhospiz leisten
segensreiche Arbeit, betonte Orth .
Heute sei die
Domstadt medizinisch bestens mit Krankenhäusern, über das Ärztenetz
PRAVO (Praxisnetz Vorderpfalz), Ökumenischer Sozialstation,
Ärztlichen Notfalldienst, mit einem rührigen Kneipp-Verein
sowie guten Physio- und Ergotherapeuten versorgt. Auch das
Hospiz im Wilhelminenstift und das Sterntaler-Kinderhospiz leisten
segensreiche Arbeit, betonte Orth .
 An
diesem Ziel hat das Seniorenstift Bürgerhospital, geleitet von
einem externen Moderator, eineinhalb Jahre gearbeitet: Zunächst
wurden mit einem anonymen Fragebogen Mitarbeitende zu ihrer
Tätigkeit befragt und die Pflegetätigkeiten digital erfasst. Die
daraus gewonnen Erkenntnisse über Arbeitsabläufe und Schwachstellen
flossen in der Folge in Arbeitsgruppen ein, die sich mit
Einzelfragen befassten und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiteten.
„Sehr wichtig war, dass das Projekt von Anfang an transparent war.
Wir haben die Mitarbeitenden von Beginn an eingebunden, so dass sie
sich sehr engagiert beteiligt haben“, freut sich Sabine Seifert
über die gemeinsame Arbeit am Projekt. „Nun müssen wir darauf
achten, dass wir die gewonnen Erkenntnisse und Ergebnisse auch in
Zukunft in unserem Alltag berücksichtigen, um uns auch weiter
optimal um unsere Bewohner kümmern zu können.“ Dem schloss sich
auch Pfarrer Dr. Werner Schwartz, Vorsteher der Diakonissen
Speyer-Mannheim, an. Er gratulierte dem Seniorenstift zu der
erfolgreichen Durchführung des Projektes und betonte: „Die
Mitarbeitenden sind für uns ein hohes Gut. Sie sorgen dafür, dass
alte, kranke und behinderte Menschen sowie Kinder und Jugendliche
in den Einrichtungen der Diakonissen Speyer-Mannheim Betreuung und
Unterstützung finden.“ Diakonissen Speyer-Mannheim, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit Dr. Katja Jewski
An
diesem Ziel hat das Seniorenstift Bürgerhospital, geleitet von
einem externen Moderator, eineinhalb Jahre gearbeitet: Zunächst
wurden mit einem anonymen Fragebogen Mitarbeitende zu ihrer
Tätigkeit befragt und die Pflegetätigkeiten digital erfasst. Die
daraus gewonnen Erkenntnisse über Arbeitsabläufe und Schwachstellen
flossen in der Folge in Arbeitsgruppen ein, die sich mit
Einzelfragen befassten und Verbesserungsmöglichkeiten erarbeiteten.
„Sehr wichtig war, dass das Projekt von Anfang an transparent war.
Wir haben die Mitarbeitenden von Beginn an eingebunden, so dass sie
sich sehr engagiert beteiligt haben“, freut sich Sabine Seifert
über die gemeinsame Arbeit am Projekt. „Nun müssen wir darauf
achten, dass wir die gewonnen Erkenntnisse und Ergebnisse auch in
Zukunft in unserem Alltag berücksichtigen, um uns auch weiter
optimal um unsere Bewohner kümmern zu können.“ Dem schloss sich
auch Pfarrer Dr. Werner Schwartz, Vorsteher der Diakonissen
Speyer-Mannheim, an. Er gratulierte dem Seniorenstift zu der
erfolgreichen Durchführung des Projektes und betonte: „Die
Mitarbeitenden sind für uns ein hohes Gut. Sie sorgen dafür, dass
alte, kranke und behinderte Menschen sowie Kinder und Jugendliche
in den Einrichtungen der Diakonissen Speyer-Mannheim Betreuung und
Unterstützung finden.“ Diakonissen Speyer-Mannheim, Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit Dr. Katja Jewski Während dem
Abendessen im Wohnbereich „Lausbühl“ wabert plötzlich Rauch durch
den Raum, binnen kürzester Zeit breitet er sich aus; das Zimmer
einer bettlägerigen Bewohnerin ist völlig verqualmt. Schnell
erfolgt der Anruf bei der örtlichen Feuerwehr, und nur 4 Minuten
später biegt das Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn um
die Ecke - ein Szenario, das so hoffentlich niemals Realität wird.
Im RHEIN-PFALZ-STIFT in Waldsee wurde kurz vor der Eröffnung der
Ernstfall geprobt. Die „Bewohner“ werden von den Mitarbeitern der
stationären Pflegeeinrichtung dargestellt, fürs Abendessen sorgt
Heimleiterin Angelika Kortyka. Und bei Pizza stimmen sich die
Kollegen auf ihre Rollen ein, haben sichtlich Spaß.
Während dem
Abendessen im Wohnbereich „Lausbühl“ wabert plötzlich Rauch durch
den Raum, binnen kürzester Zeit breitet er sich aus; das Zimmer
einer bettlägerigen Bewohnerin ist völlig verqualmt. Schnell
erfolgt der Anruf bei der örtlichen Feuerwehr, und nur 4 Minuten
später biegt das Einsatzfahrzeug mit Blaulicht und Martinshorn um
die Ecke - ein Szenario, das so hoffentlich niemals Realität wird.
Im RHEIN-PFALZ-STIFT in Waldsee wurde kurz vor der Eröffnung der
Ernstfall geprobt. Die „Bewohner“ werden von den Mitarbeitern der
stationären Pflegeeinrichtung dargestellt, fürs Abendessen sorgt
Heimleiterin Angelika Kortyka. Und bei Pizza stimmen sich die
Kollegen auf ihre Rollen ein, haben sichtlich Spaß. Nach und nach
werden die „verletzten Bewohner“ aus der Wohnküche geborgen, zu Fuß
oder auf Tragen ins Freie geschafft. Alle treffen sich am
Sammelfahrzeug, wo sie mit Decken und Getränken versorgt werden –
inzwischen hat es angefangen zu regnen, die wärmenden Umhänge
kommen also gerade recht. Um die Ecke biegt ein Notarztwagen, in
dem ein bewusstloser „Bewohner“ und die „Verletzten“ versorgt
werden. Am Sammelpunkt wird derweil kontrolliert, ob alle
„Bewohner“ geborgen sind, auf Listen werden die Namen notiert sowie
der Ort, wo sie aufgefunden wurden. Dann der Schreck: Zwei
„Bewohner“ fehlen. Schnell machen sich die Einsatzkräfte auf die
Suche, nachdem die Lage im Haus unter Kontrolle ist. Auch die
beiden Damen sind bald in Sicherheit.
Nach und nach
werden die „verletzten Bewohner“ aus der Wohnküche geborgen, zu Fuß
oder auf Tragen ins Freie geschafft. Alle treffen sich am
Sammelfahrzeug, wo sie mit Decken und Getränken versorgt werden –
inzwischen hat es angefangen zu regnen, die wärmenden Umhänge
kommen also gerade recht. Um die Ecke biegt ein Notarztwagen, in
dem ein bewusstloser „Bewohner“ und die „Verletzten“ versorgt
werden. Am Sammelpunkt wird derweil kontrolliert, ob alle
„Bewohner“ geborgen sind, auf Listen werden die Namen notiert sowie
der Ort, wo sie aufgefunden wurden. Dann der Schreck: Zwei
„Bewohner“ fehlen. Schnell machen sich die Einsatzkräfte auf die
Suche, nachdem die Lage im Haus unter Kontrolle ist. Auch die
beiden Damen sind bald in Sicherheit..jpg) Am zweiten
Augustwochenende fand in der Senioren - Residenz Sankt Sebastian
das diesjährige Sommerfest statt, das unter dem Motto Mexiko
gefeiert wurde.
Am zweiten
Augustwochenende fand in der Senioren - Residenz Sankt Sebastian
das diesjährige Sommerfest statt, das unter dem Motto Mexiko
gefeiert wurde..jpg) Die erste
Tanzrunde wurde eröffnet und alsbald war die Tanzfläche gut
gefüllt.
Die erste
Tanzrunde wurde eröffnet und alsbald war die Tanzfläche gut
gefüllt.
 Böhl-Iggelheim:
Christian Schramm, der stellvertretende Leiter des Seniorenzentrums
konnte in der Cafeteria des Betreuten Wohnens ca. 30 Seniorinnen
und Senioren begrüßen. Sein besonderer Willkommensgruß galt Martin
Schoof, Fregattenkapitän d. R. aus Haßloch. Marin Schoof ist bei
den Senioren kein Unbekannter. Schon 2010 hatte er
eindrucksvoll über das Thema „Die Zeit der großen Windjammer“
referiert.
Böhl-Iggelheim:
Christian Schramm, der stellvertretende Leiter des Seniorenzentrums
konnte in der Cafeteria des Betreuten Wohnens ca. 30 Seniorinnen
und Senioren begrüßen. Sein besonderer Willkommensgruß galt Martin
Schoof, Fregattenkapitän d. R. aus Haßloch. Marin Schoof ist bei
den Senioren kein Unbekannter. Schon 2010 hatte er
eindrucksvoll über das Thema „Die Zeit der großen Windjammer“
referiert. Beeindruckend
für die Zuhörer einige technische Daten des Seglers. Die „Gorch
Fock“ wurde 1958 bei der Werft Bloom und Foss gebaut. Es ist die
„Gorch Fock“ 2, nachdem des erste Schiff diese Namens gesunken war.
Es besitzt drei Masten mit 23 Segeln deren Fläche ein halbes
Fußballfeld bedecken würde. Es befindet sich eine eigene
Trinkwasseraufbereitungsanlage an Bord und die eigene biologische
Kläranlage sorgt für Sauberkeit. Moderne Sanitäranlagen und eine
Ausgabeküche sind im Gegensatz zu der Zeit als Schoof auf der
„Gorch Fock“ fuhr heute vorhanden. Unter Segel erreicht das
Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten, das entspricht 30
Stundenkilometer.
Beeindruckend
für die Zuhörer einige technische Daten des Seglers. Die „Gorch
Fock“ wurde 1958 bei der Werft Bloom und Foss gebaut. Es ist die
„Gorch Fock“ 2, nachdem des erste Schiff diese Namens gesunken war.
Es besitzt drei Masten mit 23 Segeln deren Fläche ein halbes
Fußballfeld bedecken würde. Es befindet sich eine eigene
Trinkwasseraufbereitungsanlage an Bord und die eigene biologische
Kläranlage sorgt für Sauberkeit. Moderne Sanitäranlagen und eine
Ausgabeküche sind im Gegensatz zu der Zeit als Schoof auf der
„Gorch Fock“ fuhr heute vorhanden. Unter Segel erreicht das
Schiff eine Höchstgeschwindigkeit von 16 Knoten, das entspricht 30
Stundenkilometer.
 Am zweiten Juli-Wochenende
fand in der Senioren- Residenz Sankt Sebastian in Dudenhofen ein
Brunnenfest statt. Eingeladen hierzu hatte die Offene
Selbsthilfegruppe unter Vorsitz von Herrn Peter Patzer. Nach einer
kurzen Begrüßung der Ehrengäste Frau Evi Ehrhardt-Steck(
Einrichtungsleitung), Herrn Ortsbürgermeister Herr Peter Eberhardt
und den beiden katholischen Pfarrern Herr Hary und Herr Dörzapf
wurde der neu gestaltete Brunnenplatz vor dem Eingang der Senioren-
Residenz eingeweiht und von Pfarrer Hary gesegnet. Dieser Platz
dient einmal als Erinnerungsort für unseren leider viel zu
verstorbenen Mitarbeiter und Gründer der OSHG Herr Roman Eggert
.Außerdem haben- so Frau Ehrhardt-Steck -Bewohner und Besucher die
Möglichkeit, Ruhe, ein wenig Besinnlichkeit, aber auch Fröhlichkeit
zu genießen.
Am zweiten Juli-Wochenende
fand in der Senioren- Residenz Sankt Sebastian in Dudenhofen ein
Brunnenfest statt. Eingeladen hierzu hatte die Offene
Selbsthilfegruppe unter Vorsitz von Herrn Peter Patzer. Nach einer
kurzen Begrüßung der Ehrengäste Frau Evi Ehrhardt-Steck(
Einrichtungsleitung), Herrn Ortsbürgermeister Herr Peter Eberhardt
und den beiden katholischen Pfarrern Herr Hary und Herr Dörzapf
wurde der neu gestaltete Brunnenplatz vor dem Eingang der Senioren-
Residenz eingeweiht und von Pfarrer Hary gesegnet. Dieser Platz
dient einmal als Erinnerungsort für unseren leider viel zu
verstorbenen Mitarbeiter und Gründer der OSHG Herr Roman Eggert
.Außerdem haben- so Frau Ehrhardt-Steck -Bewohner und Besucher die
Möglichkeit, Ruhe, ein wenig Besinnlichkeit, aber auch Fröhlichkeit
zu genießen. Das neu geschaffene
Plätzchen ist eine Bereicherung für die Senioren- Residenz und
stellt zusammen mit dem mediterranen Staudenbeet, dass vor 2 Jahren
im Rahmen des Projektes“ Wir schaffen was gemeinsam“ angelegt wurde
und weitere optischen Attraktion dar.
Das neu geschaffene
Plätzchen ist eine Bereicherung für die Senioren- Residenz und
stellt zusammen mit dem mediterranen Staudenbeet, dass vor 2 Jahren
im Rahmen des Projektes“ Wir schaffen was gemeinsam“ angelegt wurde
und weitere optischen Attraktion dar. In der
Spargelzeit ist es nun schon eine Tradition geworden, dass uns
Bürgermeister Peter Eberhardt in der Seniorenresidenz besucht und
zusammen mit allen Bewohnern und Mitarbeitern Dudenhofener Spargel
gegessen werden.
In der
Spargelzeit ist es nun schon eine Tradition geworden, dass uns
Bürgermeister Peter Eberhardt in der Seniorenresidenz besucht und
zusammen mit allen Bewohnern und Mitarbeitern Dudenhofener Spargel
gegessen werden.  Am vergangenen
Wochenende wurden die Bewohner der Seniorenresidenz St.Sebastian in
die Welt des Orients entführt. Zusammen mit Ihren Tanzgruppen „El
Fayoum“ und „El Javahir“ hatte „Zaphira“(Petra Karsch) ein buntes
Showprogramm zusammengestellt.
Am vergangenen
Wochenende wurden die Bewohner der Seniorenresidenz St.Sebastian in
die Welt des Orients entführt. Zusammen mit Ihren Tanzgruppen „El
Fayoum“ und „El Javahir“ hatte „Zaphira“(Petra Karsch) ein buntes
Showprogramm zusammengestellt. Dank dem
schönen Wetter, konnten wir eine Tafel auf der Terrasse passend zum
Thema blau-weiß eindecken. Das Bierfass – eisgekühlt – würde
angestochen und gegen 15.00 Uhr trafen die ersten Herren ein. Nach
anfangs eher verhaltener Stimmung wurde die Runde nach dem 1.
Bierchen immer lockerer. Auch für Alkohol-freies Bier war gesorgt.
Insgesamt waren ca. 16 Herren vom Haus und auf von außerhalb
gekommen und genossen ihr Bier, Brezeln und Erdbeeren in geselliger
Runde natürlich kostenlos. Herr Peter Patzer, Leiter der Offenen
Selbsthilfegruppe, organisierte Schlagermusik, es wurden Karten
gespielt und erzählt.
Dank dem
schönen Wetter, konnten wir eine Tafel auf der Terrasse passend zum
Thema blau-weiß eindecken. Das Bierfass – eisgekühlt – würde
angestochen und gegen 15.00 Uhr trafen die ersten Herren ein. Nach
anfangs eher verhaltener Stimmung wurde die Runde nach dem 1.
Bierchen immer lockerer. Auch für Alkohol-freies Bier war gesorgt.
Insgesamt waren ca. 16 Herren vom Haus und auf von außerhalb
gekommen und genossen ihr Bier, Brezeln und Erdbeeren in geselliger
Runde natürlich kostenlos. Herr Peter Patzer, Leiter der Offenen
Selbsthilfegruppe, organisierte Schlagermusik, es wurden Karten
gespielt und erzählt.
