Lernen im interkulturellen Miteinander: Freiwilligendienste für Geflüchtete
 Speyer/Berlin- Anlässlich der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements vom 8. bis 17. September setzt sich
die Diakonie dafür ein, das Sonderprogramm
"Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit Flüchtlingsbezug" auch nach
2018 fortzuführen. BFD-Stellen mit Flüchtlingsbezug sind einerseits
Stellen, in denen Freiwillige mit Flüchtlingen arbeiten,
andererseits BFD-Stellen für Flüchtlinge. Der
Bundesfreiwilligendienst steht auch Menschen über 27 Jahren
offen.
Speyer/Berlin- Anlässlich der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements vom 8. bis 17. September setzt sich
die Diakonie dafür ein, das Sonderprogramm
"Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit Flüchtlingsbezug" auch nach
2018 fortzuführen. BFD-Stellen mit Flüchtlingsbezug sind einerseits
Stellen, in denen Freiwillige mit Flüchtlingen arbeiten,
andererseits BFD-Stellen für Flüchtlinge. Der
Bundesfreiwilligendienst steht auch Menschen über 27 Jahren
offen.
"Mit ihren Erfahrungen, auch mit ihren schweren Erlebnissen,
bringen Flüchtlinge eine besondere Qualität in die Arbeit ein. Dazu
gehört ihre Art, anderen Menschen zu begegnen und sich in
schwierige Lebenssituationen von Menschen einzufühlen", sagt
Albrecht Bähr, Landespfarrer für Diakonie.
Auch die Flüchtlinge profitieren von ihrem Einsatz: Sie lernen
schneller Deutsch, haben eine sinnvolle Beschäftigung und
verbessern ihre Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt. Das stärkt ihr
Selbstbewusstsein.
Im Einsatzbereich der Diakonie Pfalz leisten derzeit elf
Geflüchtete einen Bundesfreiwilligendienst. Sie sind in der
Geschäftsstelle des Diakonischen Werkes Pfalz in Speyer, in der
Sozialstation Landau, einer Kindertagesstätte in Neustadt, in
Altenheimen in Frankenthal und Haßloch, in einer Kirchengemeinde in
Neustadt, einer Tagesförderstätte für behinderte Menschen in
Ludwigshafen, Ganztagsschulen in Kusel und Ludwigshafen sowie im
Mehrgenerationenhaus in Ludwigshafen eingesetzt. Sechs weitere
Freiwillige leisten darüber hinaus ihren BFD mit
Flüchtlingsbezug.
Nach wie vor gibt es offene Stellen für die Freiwilligendienste
und eine Bewerbung ist möglich. „Wir ermutigen Flüchtlinge, diese
Chance zu ergreifen und sich bei uns zu bewerben. Wir bitten auch
Haupt- und Ehrenamtliche in der Flüchtlingshilfe, die Flüchtlinge
auf diese Möglichkeit aufmerksam zu machen“ sagt Bähr. Um
Flüchtlingen im BFD den Einstieg zu erleichtern gibt es ein
besonderes Begleitkonzept, zu dem neben der Vorbereitung auf die
Arbeit in der Einsatzstelle auch Sprachkurse und Unterstützung bei
Alltagsfragen gehören. Prinzipiell stehen den Flüchtlingen alle
Einsatzstellen offen, die die Diakonie Pfalz anbietet.
Interessenten können sich auf der Homepage des Diakonischen
Werkes der Pfalz www.diakonie-pfalz.de unter dem
Menüpunkt „Ich möchte helfen“ direkt bewerben oder die Unterlagen
herunterladen. Bewerbungen sind auch per Mail an fsj@diakonie-pfalz.de möglich.
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz,
Presse
11.09.2017
Diözesanes Forum stellt die Weichen für neue „Diözesanversammlung“
 Diözesanversammlung soll künftig die Funktion des
Diözesanpastoralrats übernehmen / Forumsmitglieder plädieren für
Fortsetzung der Katholikentage in veränderter Form
Diözesanversammlung soll künftig die Funktion des
Diözesanpastoralrats übernehmen / Forumsmitglieder plädieren für
Fortsetzung der Katholikentage in veränderter Form
Speyer- Mit einem neuen Seelsorgekonzept und
der Errichtung von 70 neuen Pfarreien hat das Bistum Speyer zu
Beginn des Jahres 2016 eine deutliche Zäsur gesetzt. Wo stehen die
Pfarreien heute? Wie kann der christliche Glaube auch an anderen
Orten gestärkt werden? Und wie gelingt es, mit neuen Angeboten auf
die Menschen zuzugehen? Um diese Fragen ging es beim achten
Diözesanen Forum, das am 8. und 9. September im Heinrich-Pesch-Haus
in Ludwigshafen tagte.
Intensiv diskutierten die rund 85 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
über die Bildung einer neuen „Diözesanversammlung“. Sie soll
künftig die Funktion des Diözesanpastoralrats übernehmen. „Mit
diesem Schritt wollen wir die Partizipation im Bistum Speyer
stärken“, erklärte Generalvikar Dr. Franz Jung. Die
Diözesanversammlung soll die Aufgabe haben, den Bischof zu beraten,
zum Beispiel hinsichtlich der Einschätzung gesellschaftlicher und
kirchlicher Entwicklungen oder bei der Festlegung von Grundsätzen
und Schwerpunkten für die Seelsorge. Die Mitglieder des Forums
begrüßten die Bildung einer Diözesanversammlung. Sie sprachen sich
dafür aus, in der Diözesanversammlung auch eine kurze Beratung über
den Haushaltsplan des Bistums vorzusehen. Die Rolle der
Diözesanversammlung wie auch die Rolle ihres Vorsitzenden bedürfen
aus Sicht des Diözesanen Forums noch einer präziseren Ausarbeitung.
Der Entwurf der Satzung wird in den Räten des Bistums bis zum
nächsten Diözesanen Forum weiter beraten. Von März bis Mai des
kommenden Jahres können Änderungsvorschläge dazu eingebracht
werden.
Was macht eine lebendige Gemeinde aus?
Das Diözesane Forum befasste sich mit dem Thema Gemeindebildung
und richtete den Fokus vor allem auf die 376 territorialen
Gemeinden, die zurzeit innerhalb der Pfarreien des Bistums
bestehen. Als Kriterien für ein lebendiges „Gemeinde-Sein“ wurden
unter anderem die regelmäßige Feier von Gottesdiensten, Angebote
zur Glaubensweitergabe sowie die Bildung eines Gemeindeausschusses
bekräftigt. Das neue Seelsorgekonzept der Diözese sieht vor, dass
es innerhalb der 70 Pfarreien im Bistum eine variable Zahl von
Gemeinden geben kann. Die Forumsteilnehmer vertraten die Ansicht,
dass in den Pfarreien regelmäßig überprüft werden soll, ob sich die
Festlegung der Gemeinden bewährt hat. Allerdings plädierte eine
Mehrheit dafür, die Überprüfung bis zu den nächsten
Pfarrgremien-Wahlen im Jahr 2019 noch nicht für alle Pfarreien
verpflichtend, sondern auf freiwilliger Basis einzuführen. Den
Pfarreien und Gemeinden soll auf diese Weise ausreichend Zeit
gegeben werden, die erst seit 2016 bestehenden neuen Strukturen zu
erproben.
Der Glaube lebt an vielen Orten
Die Diskussion des Diözesanen Forums machte nicht an den
Pfarreigrenzen Halt, sondern bezog auch andere Formen und Orte von
Kirche mit ein, zum Beispiel die Seelsorge in der kirchlichen
Jugendarbeit, an Schulen und Hochschulen, in Krankenhäusern,
Altenheimen sowie anderen Einrichtungen der Caritas. „Hier
entwickeln sich neue Formen von Ehrenamtlichkeit. Wir begegnen in
diesen Feldern zunehmend Menschen, denen das kirchliche Leben in
der Pfarrei vielleicht fremd ist, die aber doch stark interessiert
daran sind, sich im Rahmen eines qualifizierten und gut begleiteten
Ehrenamts zu engagieren“, berichtete Generalvikar Jung. Er
ermutigte die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Seelsorge
dazu, über das Bestehende hinaus zu denken und - nach einem Wort
von Papst Franziskus - „an die Ränder zu gehen“.
Die Mitglieder des Diözesanen Forums waren von der Notwendigkeit
überzeugt, mehr bei den konkreten Bedürfnissen der Menschen
anzusetzen und verstärkt Projekte mit missionarisch-experimentellem
Charakter anzugehen. Sie regten an, die seelsorglichen Angebote
stärker zu vernetzen, die Pfarrer und pastoralen Mitarbeiter noch
mehr von Verwaltungsaufgaben zu entlasten und die kirchlichen
Berufe attraktiver zu machen. Konkret wurde zum Beispiel ein
Orientierungsjahr für Jugendliche und junge Erwachsene
vorgeschlagen. „Wir werden in den nächsten Jahren einen starken
Rückgang des pastoralen Personals erleben. Wir müssen jetzt
Prioritäten setzen - auch um Raum für innovative Angebote zu
schaffen“, beschrieb Generalvikar Jung die aktuelle
Herausforderung. Die Hauptabteilungen des Bischöflichen Ordinariats
haben den Auftrag, bis zum Ende des Jahres dafür konkrete
Vorschläge zu entwickeln.
Katholikentag soll stärker den Charakter eines Bistumsfests
bekommen
In der Beratung über die Zukunft der diözesanen Katholikentage
wurde deutlich, dass die Mehrheit der Forumsteilnehmer einen
gemeinsamen Tag für das gesamte Bistum weiterhin als sinnvoll
erachtet. Die Tendenz ging zu einem Treffen an einem festen Ort im
jährlichen Rhythmus. Eine ökumenische Ausrichtung wurde begrüßt.
Die Ideen von Forumsteilnehmern, zum Beispiel das
Landesgartenschaugelände in Kaiserslautern als Ort für den
Katholikentag zu nutzen oder den Tag als Wallfahrt oder
Solidaritätsaktion zu gestalten, versprach Domkapitular Franz
Vogelgesang in die zuständige Arbeitsgruppe mitzunehmen und knüpfte
daran die Einladung zur Mitarbeit an alle Interessierten.
Verlegung des zentralen Gottesdienstortes nur bei
schwerwiegenden Gründen
 Mit der Einführung
des neuen Seelsorgekonzepts im Jahr 2016 war die Entscheidung für
einen zentralen Gottesdienstort in jeder Pfarrei verbunden: In
dieser Kirche wird an jedem Sonntag oder Feiertag immer zur
gleichen Zeit die Eucharistie als Hauptgottesdienst der Pfarrei
gefeiert. Das Diözesane Forum schloss sich der Überzeugung an, dass
eine Antragstellung zur Verlegung des zentralen Gottesdienstortes
frühestens ab Januar 2019 und nur bei Vorliegen schwerwiegender
pastoraler Gründe möglich sein soll. Es bedürfe dazu einer
ausführlichen Diskussion in den Gremien der Pfarrei. Entscheidet
sich der Pfarreirat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die
Verlegung, soll der Antrag dem Bischof zur Genehmigung vorgelegt
werden.
Mit der Einführung
des neuen Seelsorgekonzepts im Jahr 2016 war die Entscheidung für
einen zentralen Gottesdienstort in jeder Pfarrei verbunden: In
dieser Kirche wird an jedem Sonntag oder Feiertag immer zur
gleichen Zeit die Eucharistie als Hauptgottesdienst der Pfarrei
gefeiert. Das Diözesane Forum schloss sich der Überzeugung an, dass
eine Antragstellung zur Verlegung des zentralen Gottesdienstortes
frühestens ab Januar 2019 und nur bei Vorliegen schwerwiegender
pastoraler Gründe möglich sein soll. Es bedürfe dazu einer
ausführlichen Diskussion in den Gremien der Pfarrei. Entscheidet
sich der Pfarreirat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die
Verlegung, soll der Antrag dem Bischof zur Genehmigung vorgelegt
werden.
Nicht nur die Liturgie, sondern auch Finanz- und Personalfragen
beschäftigten das Diözesane Forum. So informierten sich die
Teilnehmer über die neu berechneten Indexzahlen. Sie stellen ein
Instrument zur gerechten Verteilung der vorhandenen Mittel an die
Pfarreien dar und werden vor allem zur Bemessung des
Personalschlüssels in den Pfarreien genutzt. Vorgestellt wurde auch
der aktuelle Haushaltsplan des Bistums.
Große Bandbreite an Themen kennzeichnet den Weg der
vergangenen Jahre
Ein Austausch über die Entwicklungen seit dem letzten Diözesanen
Forum vor zwei Jahren machte vor allem eines deutlich: Viele Themen
wurden in den vergangen Jahren im Bistum Speyer auf den Weg
gebracht, „auch wenn sich jetzt vieles erst noch richtig einspielen
muss“, so Generalvikar Jung. Er räumte ein, dass das Engagement der
früheren Kirchenrechner vom Bistum unterschätzt worden sei. Es
seien jedoch Maßnahmen ergriffen worden, um die Situation zu
verbessern und die Pfarreien weiter von Verwaltungsaufgaben zu
entlasten. Erfreut zeigte er sich darüber, dass fast alle Pfarreien
damit begonnen haben, ihr pastorales Konzept zu entwickeln. Mit der
Einführung des Qualitätsmanagements in den Kindertagesstätten und
den Kundschafterreisen in verschiedene Länder der Weltkirche seien
wichtige Impulse gesetzt worden. Teilnehmer des Diözesanen Forums
berichteten davon, dass in den Pfarreien viel Mühe und Ausdauer
gefragt sind, damit alle in ihre neuen Rollen hineinfinden und die
Gläubigen sich mit der neuen Pfarrei identifizieren. Aus
zahlreichen Schilderungen sprach das Bemühen, neue Wege für die
Weitergabe des Glaubens zu finden.
„Die Beratungskultur früherer Diözesaner Foren trägt Früchte. Es
hat sich erneut gezeigt, dass wir zu einem guten und konstruktiven
Austausch in der Lage sind. Dabei ist viel Vertrauen gewachsen“,
dankte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Diözesanen Forums für ihr Engagement. Die
Diözesanen Foren wurden im Jahr 2010 im Zusammenhang mit dem
Erneuerungsprozess „Gemeindepastoral 2015“ eingerichtet. Sie
bestehen aus den Mitgliedern des Allgemeinen Geistlichen Rates, des
Priesterrats, des Diözesanpastoralrats und des Katholikenrats. Zum
Abschluss ihres Treffens feierten die Teilnehmer mit Bischof
Wiesemann einen Gottesdienst in der Kapelle des
Heinrich-Pesch-Hauses. Das nächste Diözesan Forum findet am 24. und
25. August 2018 statt. Als Veranstaltungsort ist wiederum das
Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen vorgesehen.
Weitere Informationen:
https://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4811&cHash=1df815fa4cf005c26bbd36fa26f9777f
Text und Foto. is
10.09.2017
Tod Matildas von England vor 850 Jahren
 Deutsche
Kaiserin und Englische Regentin – Ahnherrin von Richard
Löwenherz
Deutsche
Kaiserin und Englische Regentin – Ahnherrin von Richard
Löwenherz
Speyer- Am 10. September 1167 verstarb
Matilda von England, die Frau des letzten salischen Kaisers
Heinrich V. Als Kaiserin unterstützte sie ihren Mann, indem sie bei
zahlreichen Konflikten als Vermittlerin auftrat und während seiner
Abwesenheit Regierungsaufgaben übernahm. Als Heinrich 1125
verstarb, war sie 23 Jahre alt. Da die Ehe kinderlos geblieben war,
erlosch damit die salische Dynastie. Heinrich V. liegt zusammen mit
seinen Eltern, seinem Groß- und seinem Urgroßvater im Speyerer Dom
begraben.
Nach dem Tod ihres Mannes regelte Matilda noch die wichtigsten
Angelegenheiten zur neuen Wahl, bevor sie sich, auf Wunsch ihres
Vaters, zurück in ihre englische Heimat begab. Der englische König
Heinrich I. versuchte zunächst, seine Tochter als Herrscherin zu
etablieren. Er ließ die englische Aristokratie und Geistlichkeit
per Eid bezeugen, dass Matilda seine legitime Nachfolgerin auf dem
Königsthron sei.
Ihre Macht und die Machtansprüche ihrer Nachkommen musste
Matilda jedoch mehrfach verteidigen. Aus politischen Gründen
heirate sie den angevinischen Erbgrafen Gottfried Plantagenet.
Durch diese Ehe wurde sie zur Begründerin einer neuen Dynastie: Ihr
Sohn Heinrich II. war der erste englische Herrscher aus dem Hause
Plantagenet. Der Ehe Heinrichs II. mit Eleonore von Aquitanien
entsprang der berühmte Ritterkönig Richard Löwenherz. Das Wappen
dieses Herrscherhauses Plantagenet zieren drei goldene Löwen.
Im Kampf um den englischen Thron ließ Matilde von England 1141
ihren Gegenspieler Stephan von Blois gefangen nehmen und wurde zur
Herrin der Engländer proklamiert. Sie war damit kurzzeitig für
einige Monate die erste weibliche Regentin des Königreichs England,
wurde aber nicht gekrönt. Ihr Sohn Heinrich II. wurde schließlich
nach dem Tod seines Vaters und der Beilegung weiterer Querelen
englischer König. Matilda blieb Beraterin ihres Sohnes und hatte
nachweislich Einfluss auf ihn. Im Konflikt zwischen Heinrich II.
und dem Erzbischof Canterbury Thomas Becket agierte sie als
Vermittlerin. Bereits als Kaiserin und verstärkt nach der
Thronbesteigung ihres Sohnes in England förderte sie kirchliche
Einrichtungen durch Stiftungen.
Bis zu ihrem Tod ließ sich Matilda als „empress”, also als
Kaiserin, ansprechen, führte aber das Siegel einer römischen
Königin. Die Herrscherin starb am 10. September 1167 in Rouen. In
einer feierlichen, vom Erzbischof Rotrou geleiteten Zeremonie fand
ihre Beisetzung vor dem Hochaltar der Abteikirche von Bec-Hellouin
statt. Einige Zeilen von Matildas Grabinschrift lauteten: „Hier
liegt die Tochter, Ehefrau und Mutter Heinrichs; groß durch Geburt,
größer durch Heirat, doch am größten durch ihre Nachkommen.“ Durch
den historischen Roman „Die Säulen der Erde“ gelangte Matilda von
England in neuerer Zeit wieder zu einiger Bekanntheit. Text und
Foto: is
07.09.2017
Familienfest bei Diakonissen Speyer-Mannheim

Speyer- Rechtzeitig zum Jahresfest der
Diakonissen Speyer-Mannheim am ersten Septembersonntag kehrte der
Spätsommer nach Speyer zurück: Entsprechend gut besucht war die
Freiluftveranstaltung im Park beim Mutterhaus mit rund 600
Gästen.
 Viele von ihnen kamen schon zum Gospel-Gottesdienst mit
Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt, der musikalisch begleitet
wurde vom Posaunenchor CVJM Schifferstadt und dem Schwegenheimer
Gospelchor „Spirit of Sound“. Die Kollekte in Höhe von 1.206 Euro
sowie Spenden in Höhe von 1.706 Euro kommen zu gleichen Teilen dem
Hospiz im Wilhelminenstift Speyer, den geplanten Hospizen in Bad
Dürkheim und Landau sowie der im Aufbau befindlichen ambulanten
Palliativarbeit der Diakonissen Speyer-Mannheim zugute.
Viele von ihnen kamen schon zum Gospel-Gottesdienst mit
Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt, der musikalisch begleitet
wurde vom Posaunenchor CVJM Schifferstadt und dem Schwegenheimer
Gospelchor „Spirit of Sound“. Die Kollekte in Höhe von 1.206 Euro
sowie Spenden in Höhe von 1.706 Euro kommen zu gleichen Teilen dem
Hospiz im Wilhelminenstift Speyer, den geplanten Hospizen in Bad
Dürkheim und Landau sowie der im Aufbau befindlichen ambulanten
Palliativarbeit der Diakonissen Speyer-Mannheim zugute.
Im Anschluss an den Gottesdienst informierten sich die Gäste
über Krankenhäuser, Seniorenzentren, Einrichtungen der Kinder-,
Jugend- und Behindertenhilfe sowie über Ausbildungsmöglichkeiten,
Hospizarbeit und die Diakonische Gemeinschaft.
Diakonissen-Einrichtungen aus Speyer, Mannheim, Landau,
Ludwigshafen, Kirchheimbolanden und Homburg boten neben
Informationen auch Mitmach-Aktionen und viele Spiel- und
Bastel-Möglichkeiten für Kinder. Besuchermagneten waren wie immer
die Hygiene- und Gesundheitstests sowie Erste-Hilfe-Tipps der
Krankenhäuser sowie die Spiele der Kitas und der Maudacher
Werkstatt: Vom „Pflegedoktor“ über Riesenseifenblasen bis zum
Kletterbaum reichten die Angebote. Die Senioreneinrichtungen, die
ehrenamtlichen Gruppen und das Hospiz überzeugten mit Beispielen
ihrer Arbeit, die Produkte des Flohmarkts fanden ebenso zahlreiche
Abnehmer wie die „Cocktail-Bar“ der Diakonischen Gemeinschaft. Neu
war in diesem Jahr eine Aufführung von Beschäftigten der Maudacher
Werkstatt für Menschen mit Behinderung: Sie unterhielten die Gäste
mit Sketchen, Gedichten und Tänzen.
Bereits am Vorabend des traditionellen Jahresfestes fand
erstmals ein Cocktail-Kino-Abend im Mutterhaus statt. Zu exotischen
Getränken und Popcorn wurde der Film „Wie im Himmel“ gezeigt.
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
04.09.2017
Sternsinger sammeln seit 1959 mehr als eine Milliarde Euro
-04.jpg) Rund 1,21
Millionen Euro kamen bei der Aktion Dreikönigssingen zu Beginn des
Jahres im Bistum Speyer zusammen
Rund 1,21
Millionen Euro kamen bei der Aktion Dreikönigssingen zu Beginn des
Jahres im Bistum Speyer zusammen
Aachen/Speyer- Die Kinder und
Jugendlichen, die als Sternsinger unterwegs sind, haben seit dem
Start ihrer Aktion Dreikönigssingen in Deutschland 1959 mehr als
eine Milliarde Euro gesammelt. Rund 71.700 Projekte für
benachteiligte Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien und
Osteuropa konnten damit seit Beginn der weltweit größten
Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder unterstützt werden. Die
beeindruckende Gesamtzahl von rund 1.040.800.000 Euro wurde dank
des Ergebnisses in diesem Jahr erreicht. Bundesweit sammelten die
engagierten Sternsinger Anfang 2017 rund 46,8 Millionen und damit
550.000 Euro mehr als im Vorjahr. 300.000 Mädchen und Jungen sowie
90.000 jugendliche und erwachsene Begleiter in 10.328
Pfarrgemeinden, Schulen, Kindergärten und weitere Einrichtungen
nahmen an der Aktion teil.
Im Bistum Speyer sammelten die Sternsinger aus 200 beteiligten
Pfarreien, Gruppen und Einrichtungen genau 1.210.659,74 Euro. Im
Vorjahr lag das Ergebnis in der Diözese Speyer bei 1.185.560,12
Euro. Die Zahlen gehen hervor aus dem jetzt veröffentlichten
Jahresbericht des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘.
-04.jpg) Das
Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), die Träger der Aktion, danken allen Sternsingern und
Begleitenden für dieses große Engagement. „Wir sind dankbar, dass
wir als Hilfswerk der Sternsinger an der Seite dieser vielen
begeisternden Mädchen und Jungen, Jugendlichen und Erwachsenen
stehen dürfen, die sich Jahr für Jahr in den Dienst der guten Sache
stellen“, so Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des
Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘. „Immer wieder überraschen
uns die Sternsinger aufs Neue mit einem tollen Sammelergebnis.
Rekorde und Superlative sind uns sicherlich nicht wichtig, aber
jeder gesammelte Euro, jeder gesammelte Cent ist ein Stück Hilfe
für benachteiligte Kinder in der Einen Welt.“
Das
Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), die Träger der Aktion, danken allen Sternsingern und
Begleitenden für dieses große Engagement. „Wir sind dankbar, dass
wir als Hilfswerk der Sternsinger an der Seite dieser vielen
begeisternden Mädchen und Jungen, Jugendlichen und Erwachsenen
stehen dürfen, die sich Jahr für Jahr in den Dienst der guten Sache
stellen“, so Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des
Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘. „Immer wieder überraschen
uns die Sternsinger aufs Neue mit einem tollen Sammelergebnis.
Rekorde und Superlative sind uns sicherlich nicht wichtig, aber
jeder gesammelte Euro, jeder gesammelte Cent ist ein Stück Hilfe
für benachteiligte Kinder in der Einen Welt.“
Pfarrer Carsten Leinhäuser, BDKJ-Diözesanpräses, schließt sich
an: „Wir sind stolz, dass sich jedes Jahr so viele Kinder und
Jugendliche aus den Verbänden und anderen Gruppen auf den Weg
machen. Sie setzen sich für eine gerechtere Welt ein. Die
Sternsingeraktion ist auch großartige Bildungsarbeit: Bevor die
Kinder bei Wind und Wetter von Tür zu Tür unterwegs sind, lernen
sie eine Menge über die Länder, für die sie sammeln. Sie wissen
deshalb, wie die politischen Gegebenheiten in anderen Ländern sind,
was Kinder weltweit bewegt und wie sie selbst konkret helfen
können. Die Sternsingeraktion ist ein beeindruckendes Projekt, weil
die Kinder den Erwachsenen zeigen, was es heißt Christ zu sein und
Glauben zu leben: Sie informieren sich, sehen im Nächsten Jesus und
machen sich für dessen Wohlergehen stark.“
1.639 Projekte in 107 Ländern
Im Jahr 2016 wurden mit den Erlösen aus der Aktion
Dreikönigssingen 1.639 Projekte in 107 Ländern unterstützt. Erneut
nahm die Förderung der Bildung mit 746 Projekten den größten Anteil
ein. Darüber hinaus wurden unter anderem 169 Gesundheitsprojekte,
88 Maßnahmen zur Ernährungssicherung und 17 Nothilfeprojekte
gefördert. In den Ländern Afrikas wurden 523 Projekte unterstützt,
in Lateinamerika 487 Maßnahmen und in Asien 420 Projekte.
Rund um den kommenden Jahreswechsel werden sich die Sternsinger
bei ihrer 60. Aktion Dreikönigssingen auf den Weg zu den Menschen
machen. „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam gegen Kinderarbeit –
in Indien und weltweit!“ heißt dann ihr Leitwort. Eröffnet wird die
Aktion am 29. Dezember in Trier. Text und Foto:
Sternsinger.de
01.09.2017
Theologie-Studierende aus der Pfalz treffen Apostolischen Nuntius in Israel
 Gemeinsame Studienfahrt der theologischen Fakultät der
Universität Landau und der Hochschulabteilung des Bistums
Speyer
Gemeinsame Studienfahrt der theologischen Fakultät der
Universität Landau und der Hochschulabteilung des Bistums
Speyer
Jerusalem/Speyer- Auf einer Studienfahrt der
Theologie-Studentinnen und -Studenten der Universität Landau mit
der Hochschulabteilung des Bistum Speyers gehört auch immer der
Besuch des Tempelbergs in Jerusalem. Bei der derzeitigen Fahrt traf
die Gruppe mit Mentorin und Studienbegleiterin Birgitta Greif den
Apostolischen Nuntius Monsignore Giuseppe Lazzarotto. Der seit 2012
für Zypern und Israel ständige Vertreter des Papstes vor Ort steht
zurzeit in schwierigen politischen Diskussionen in Jerusalem.
Vielen Besucherinnen und Besuchern ist der Besuch des
geschichtsträchtigen Tempelbergs über Wochen nicht möglich
gewesen.
„Die Fahrt ins Heilige Land ist für uns Christen etwas
Besonderes. Es ist keine Studienreise, so wie wir sie vielleicht zu
anderen Stätten der antiken Welt durchführen. Es ist eine Fahrt zu
jenem Fleckchen Erde, in dem sich Gott in besonderer Weise
geoffenbart hat. Und darum erfasst wohl jeden Gläubigen ein
eigenartiger Schauer, wenn er den Boden dieses Landes betritt. Wenn
er am See Genezareth steht, wenn er die uralten Ölbäume im Garten
Getsemani sieht oder wenn er vom Ölberg hinüberschaut auf
Jerusalem, die Heilige Stadt für alle Abrahamitischen Religionen,“
erklärt Birgitta Greif für ihr Seminar. Text und Foto:
is
01.09.2017
Gutes Spendenergebnis für Brot für die Welt
 Evangelisches Hilfswerk legt Jahresbilanz für 2016 vor –
über 1 Million Euro Spenden aus der Pfalz
Evangelisches Hilfswerk legt Jahresbilanz für 2016 vor –
über 1 Million Euro Spenden aus der Pfalz
Speyer- Die Menschen in der Pfalz und der
Saarpfalz haben im vergangenen Jahr 1.029.609 Millionen Euro für
Brot für die Welt gespendet. In dieser Summe sind Kollekten und
Spenden, die in Kirchengemeinden gesammelt wurden, sowie direkte
Überweisungen an das evangelische Hilfswerk zusammengefasst.
Das Spendenaufkommen bewegt sich trotz eines leichten Rückgangs
auf dem Niveau des Vorjahres (1.030.258). Die meisten Spenden
gingen mit 2,32 Euro pro Kirchenmitglied im Kirchenbezirk Bad
Dürkheim ein, gefolgt vom Kirchenbezirk Neustadt mit 1,67 Euro pro
Kirchenmitglied und dem Kirchenbezirk Frankenthal mit 1,59 Euro pro
Kirchenmitglied.
„Wir freuen uns sehr, dass Spenderinnen und Spender Brot für die
Welt auch 2016 ihr Vertrauen geschenkt haben und uns in der
weltweiten Arbeit gegen Hunger, Armut und Ungerechtigkeit
unterstützen“, sagt Kirchenpräsident Christian Schad „Allen, die
dazu beigetragen haben, danke ich herzlich.“
Bundesweit haben Spenderinnen und Spender die Arbeit von Brot
für die Welt im vergangenen Jahr mit mehr als 61, 7 Millionen Euro
unterstützt. Das ist ein deutliches Plus von 4,2 Millionen Euro
gegenüber dem Vorjahr (57,5 Mio. Euro).
Brot für die Welt arbeitet weltweit mit lokalen
Partnerorganisationen zusammen. Im vergangenen Jahr wurden 617
Projekte in 93 Ländern neu bewilligt, davon sind mit 203 Projekten
die meisten in Afrika. Im Zentrum stehen langfristige Maßnahmen,
die Hunger und Mangelernährung überwinden, Bildung und Gesundheit
fördern, Zugang zu sauberem Wasser schaffen, die Achtung der
Menschenrechte und Demokratie stärken und den Schutz der
natürlichen Lebensgrundlagen unterstützen.
Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt 2016
Mittel des Kirchlichen Entwicklungsdienstes und Beiträge Dritter,
vor allem aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Insgesamt standen dem
Hilfswerk der evangelischen Kirchen und Freikirchen 273,5 Millionen
Euro zur Verfügung. Die Gesamtausgaben für Projekte betrugen 246,7
Millionen Euro (91,3 Prozent der Mittel). Für Werbe- und
Verwaltungsaufgaben wurden 8,7 Prozent eingesetzt. Das Deutsche
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bewertet den Anteil der
Werbe- und Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben als
niedrig.
Brot für die Welt wurde 1959 gegründet. Das weltweit tätige
Hilfswerk der evangelischen Landes- und Freikirchen fördert heute
in mehr als 90 Ländern Projekte zur Überwindung von Hunger, Armut
und Ungerechtigkeit. dwp
31.08.2017
„Der Funke muss überspringen“
 Bischof
Wiesemann sendet vier junge Frauen in den seelsorglichen Dienst im
Bistum Speyer aus
Bischof
Wiesemann sendet vier junge Frauen in den seelsorglichen Dienst im
Bistum Speyer aus
Speyer- Menschen aus allen Teilen des
Bistums waren am Sonntag, den 27. August in den Speyerer Dom
gekommen, um bei der Beauftragung und Aussendung der drei
Pastoralassistentinnen Nina Bender, Dominique Haas und Kerstin Humm
sowie der Gemeindeassistentin Amanda Wrzos in den seelsorglichen
Dienst im Bistum Speyer dabei zu sein. Bischof Wiesemann begrüßte
Familie und Freunde, Vertreter der Heimatpfarreien und der
aktuellen Dienststellen der vier jungen Frauen zu einer feierlichen
Messe. Der Gottesdienst stand unter dem Motto: „Macht euch keine
Sorgen, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke.“ (Neh 8,10).
Diesen Bibelvers hatten die vier Beauftragten zu ihrem gemeinsamen
Leitwort erklärt.
In seiner Predigt verglich Bischof Wiesemann die Motivation der
vier jungen Frauen immer wieder mit einem Feuer: „In ihnen muss
etwas brennen, damit sie sagen; ‚Ja, ich stelle mich in den Dienst
der Kirche‘.“ Dabei machte der Bischof deutlich, wie sehr er sich
über das „ja“ der vier jungen Frauen freue und dankte ihnen für
ihre Bereitschaft zum Dienst in der Kirche. Trotz vieler Einwände,
die ihnen vielleicht auf ihrem Weg begegnet seien, sei das Feuer
durch die Familie, die Heimatgemeinde oder am Studienort immer
wieder neu entzündet worden. „Ein Christ von heute muss entzündet
sein, damit er in dieser Welt Zeugnis geben kann“, bekräftigte der
Bischof, „wir müssen etwas rüberbringen, der Funke muss
überspringen“.
 In den Lesungen
des Tages stand Petrus im Zentrum der Betrachtung. Auf ihn verwies
Bischof Wiesemann als Vorbild für die pastoralen Mitarbeiter. Zum
einen sei es Petrus gewesen, der das Christusbekenntnis
ausgesprochen habe. Des Weiteren berichte die Bibel darüber, dass
Petrus Christus verleugnet und danach bitterlich geweint habe.
Emotionalität sei wichtig für den Dienst am Menschen, um „mitgehen
zu können, nicht zu verdecken, zu vertuschen oder zu überhöhen“.
Zuletzt wies der Bischof darauf hin, dass Petrus bis zum Schluss
„nicht fertig“ gewesen sei. Es sei wichtig, dass Kirche lerne und
sich nicht verenge. Die im Kirchendienst Tätigen müssten „Mut zur
Entwicklung haben, sich auf die Herausforderungen der jeweiligen
Zeit und die Menschen einzulassen, um im Christusbekenntnis zu
bleiben“.
In den Lesungen
des Tages stand Petrus im Zentrum der Betrachtung. Auf ihn verwies
Bischof Wiesemann als Vorbild für die pastoralen Mitarbeiter. Zum
einen sei es Petrus gewesen, der das Christusbekenntnis
ausgesprochen habe. Des Weiteren berichte die Bibel darüber, dass
Petrus Christus verleugnet und danach bitterlich geweint habe.
Emotionalität sei wichtig für den Dienst am Menschen, um „mitgehen
zu können, nicht zu verdecken, zu vertuschen oder zu überhöhen“.
Zuletzt wies der Bischof darauf hin, dass Petrus bis zum Schluss
„nicht fertig“ gewesen sei. Es sei wichtig, dass Kirche lerne und
sich nicht verenge. Die im Kirchendienst Tätigen müssten „Mut zur
Entwicklung haben, sich auf die Herausforderungen der jeweiligen
Zeit und die Menschen einzulassen, um im Christusbekenntnis zu
bleiben“.
„Ich freue mich, dass ich sie heute aussenden darf und bitte,
dass der Herr seine Hand so über ihnen hält, dass die Freude am
Herrn ihre Stärke bleibt“, schloss Bischof Wiesemann seine
Predigt.
Die formelle Beauftragung erfolgte durch den Bischof, nachdem
die vier Frauen mit einem laut vernehmlichen „Hier bin ich“
vorgetreten waren. Im Anschluss gratulierte er jeder von ihnen
einzeln zu ihrer Aussendung.
 Am Ende des
Gottesdienstes ergriffen Nina Bender, Dominique Haas, Kerstin Humm
und Amanda Wrzos selbst das Wort. Sie dankten dem Bischof, ihren
Ausbildern sowie den anwesenden Familienmitgliedern, Freunden und
den Kurskollegen. Ein besonderer Dank ging in die Heimat- und die
Praktikumspfarreien. Die versammelte Gemeinde gratulierte den vier
Beauftragten mit anhaltendem Applaus.
Am Ende des
Gottesdienstes ergriffen Nina Bender, Dominique Haas, Kerstin Humm
und Amanda Wrzos selbst das Wort. Sie dankten dem Bischof, ihren
Ausbildern sowie den anwesenden Familienmitgliedern, Freunden und
den Kurskollegen. Ein besonderer Dank ging in die Heimat- und die
Praktikumspfarreien. Die versammelte Gemeinde gratulierte den vier
Beauftragten mit anhaltendem Applaus.
Die vier beauftragten Frauen
Nina Bender stammt aus Eppenbrunn. Ihre Praktikumszeit während
des zweijährigen Pastoralkurses absolvierte sie in der Pfarrei
Heiliger Petrus in Dahn. Seit dem 1. August arbeitet sie als
Pastoralassistentin in der Pfarrei Heilige Elisabeth in
Zweibrücken.
Dominique Haas wurde in Ludwigshafen geboren. Die
pastoralpraktische Ausbildung absolvierte sie in der Pfarrei Maria
Schutz in Kaiserslautern. Seit 1. August arbeitet sie in der
Pfarrei Heilige Elisabeth in Grünstadt.
Kerstin Humm aus Waldsee verbrachte ihre Praktikumszeit in der
Pfarrei Heiliger Wendelinus in Ramstein. Am 1. August begann ihr
Einsatz als Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Disibod in
Feilbingert.
Amanda Wrzos stammt aus Zweibrücken. In ihrer
pastoralpraktischen Ausbildungszeit in der Pfarrei Heiliger Petrus
und Paulus in Ludwigshafen sammelte sie Erfahrungen in der Kinder-
und Jugendarbeit sowie in der Seniorenseelsorge. Seit dem 1. August
ist sie in der Pfarrei Heilige Katharina von Alexandria in
Hauenstein tätig.
Text: Friederike Walter / Fotos: Klaus Landry
27.08.2017
Minitag lockt 650 Messdiener nach Kaiserslautern
 Rund 650 Messdiener aus der Pfalz und dem Saarland waren
als "Agenten" unterwegs | Rätselspiel verknüpft Wissen und
Kreativität mit Spaß und Action
Rund 650 Messdiener aus der Pfalz und dem Saarland waren
als "Agenten" unterwegs | Rätselspiel verknüpft Wissen und
Kreativität mit Spaß und Action
Kaiserslautern- Da hätte James Bond mit
Blick auf die Treppenstufen der Kirche Maria Schutz in
Kaiserslautern heute seine helle Freude gehabt: Drei
Nachwuchsagenten seilten sich mit professioneller Hilfe am
Treppengeländer ab. Sie übten Knoten und Schlingen, testeten den
Seilzug und vor Allem ihren Mut. Aus ihrer Heimatpfarrei in
Ludwigshafen hatten sie sich heute auf den Weg nach Kaiserslautern
gemacht. Rund um die Kirche im Stadtzentrum fand der Diözesane
Ministrantentag - kurz: Minitag - statt, zu dem mehr als 650
Messdiener aus den Pfarreien des Bistums Speyer angereist waren.
Das Messdienerreferat im Bistum Speyer sowie der Bund der deutschen
katholischen Jugend (BDKJ) Speyer hatten zur Veranstaltung
eingeladen. Unter dem Motto "Secret Service" waren die kleinen und
großen Teilnehmer inkognito als Agenten unterwegs. Ihre
Tagesaufgabe hatten sie von den Profiagenten des Leitungsteams
erhalten: In schwarze Anzüge gekleidet hatten Gruppenleitern aus
den Verbänden im BDKJ zu Beginn der Veranstaltung die Kirche zum
Sicherheitsbereich erklärt: Hier sei gerade ein Einbruch verübt
worden. Die dabei entwendeten Gegenstände gelte es nun mit Hilfe
der Nachwuchsagenten zu finden. Schließlich handele es sich um
Dinge, die für die Feier des Gottesdienstes unbedingt benötigt
würden: Messschale und Weihrauchfass fehlten ebenso wie Fahne und
Weinkännchen. Für die Lösung des Falls bekamen die Nachwuchsagenten
per Skype-Anruf von höchster Stelle Unterstützung für ihre Suche.
Der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wurde zugeschaltet,
ließ sich den Sachverhalt erklären und sprach den Agenten Mut
zu.
Spurensuche in Form von Workshopangeboten
 Die große Agentenausbildung begann mit Workshops, die vom
Bau einer Brücke aus Holzteilen bis zu einem Sportparcours in der
Turnhalle reichten. Sie fand auf den Gelände von Maria Schutz,
ebenso wie rund um das Edith-Stein-Haus, die Kirche St. Martin und
das St.-Franziskus-Gymnasium statt. Zu den Angeboten zählte auch
die Abseilaktion am Treppengeländer von Maria Schutz, die auf dem
Plan der Ludwigshafener Gruppe stand. Neben dem sportlichen durften
die Messdiener aber auch kreatives Geschick zeigen und mit bunten
Farben große Stoffsegel bemalen. Sie schmückten während des
Abschlussgottesdienstes den Kirchenraum. Außerdem entstanden im
Pfarrgarten von Maria Schutz so genannte "Ich-Boxen", bunt
gestaltete Kisten, mit deren Hilfe das eigenen Leben betrachtet
wird. Finja (10) aus Dunzweiler erklärte: "Das ist eine Box, die
mein Leben darstellt. Außen klebe ich auf, was Menschen von außen
ausmacht. Dafür haben wir hier Papier und Zeitungsausschnitte.
Innen kleben wir die Dinge hinein, die in uns sind. Ich habe meine
Geheimnisse eingeklebt." In einem weiteren Kreativ-Workshop
bildeten die Nachwuchagenten "Quadratologos". Die quadratischen
Farbflächen bilden, je nach Zusammensetzung, verschieden bunte
Bilder. Es entstanden Kunstwerke, die in ihrer Farbenpracht für die
Vielfalt der Gesellschaft stehen. In einem Workshopbereich der
"Young Caritas" mussten die Messdiener ihre Teamfähigkeit unter
Beweis stellen: An insgesamt neun Stationen kam es darauf an,
gemeinsam Punkte zu sammeln. Für den Weg durch das Labyrinth aus
Zurufen fand nur, wer sich zuvor in seinem Team gut abgestimmt
hatte. Auch der Würfelturm war nur als Gemeinschaftsproduktion zu
meistern. Die Pappkästchen mussten so aufeinander gestapelt werden,
dass eine möglichst große Höhe erreicht wurde ohne dabei den Turm
zu stützen oder zum Einsturz zu bringen.
Die große Agentenausbildung begann mit Workshops, die vom
Bau einer Brücke aus Holzteilen bis zu einem Sportparcours in der
Turnhalle reichten. Sie fand auf den Gelände von Maria Schutz,
ebenso wie rund um das Edith-Stein-Haus, die Kirche St. Martin und
das St.-Franziskus-Gymnasium statt. Zu den Angeboten zählte auch
die Abseilaktion am Treppengeländer von Maria Schutz, die auf dem
Plan der Ludwigshafener Gruppe stand. Neben dem sportlichen durften
die Messdiener aber auch kreatives Geschick zeigen und mit bunten
Farben große Stoffsegel bemalen. Sie schmückten während des
Abschlussgottesdienstes den Kirchenraum. Außerdem entstanden im
Pfarrgarten von Maria Schutz so genannte "Ich-Boxen", bunt
gestaltete Kisten, mit deren Hilfe das eigenen Leben betrachtet
wird. Finja (10) aus Dunzweiler erklärte: "Das ist eine Box, die
mein Leben darstellt. Außen klebe ich auf, was Menschen von außen
ausmacht. Dafür haben wir hier Papier und Zeitungsausschnitte.
Innen kleben wir die Dinge hinein, die in uns sind. Ich habe meine
Geheimnisse eingeklebt." In einem weiteren Kreativ-Workshop
bildeten die Nachwuchagenten "Quadratologos". Die quadratischen
Farbflächen bilden, je nach Zusammensetzung, verschieden bunte
Bilder. Es entstanden Kunstwerke, die in ihrer Farbenpracht für die
Vielfalt der Gesellschaft stehen. In einem Workshopbereich der
"Young Caritas" mussten die Messdiener ihre Teamfähigkeit unter
Beweis stellen: An insgesamt neun Stationen kam es darauf an,
gemeinsam Punkte zu sammeln. Für den Weg durch das Labyrinth aus
Zurufen fand nur, wer sich zuvor in seinem Team gut abgestimmt
hatte. Auch der Würfelturm war nur als Gemeinschaftsproduktion zu
meistern. Die Pappkästchen mussten so aufeinander gestapelt werden,
dass eine möglichst große Höhe erreicht wurde ohne dabei den Turm
zu stützen oder zum Einsturz zu bringen.
Abschlussgottesdienst mit Bischof Wiesemann
 Für jede besuchte Workshopstation erhielten die
Nachwuchagenten einen Stempel in ihrem Agentenausweis. Die Ausweise
dienten bei Erreichen der dritten Workshopstation als "Lösegeld".
In Verbindung mit einem Tipp in Form eines Fotos des gestohlenen
Gegenstandes konnten die Teilnehmer die gestohlenen Gegenstände
zurück erhalten. Dafür reichte die Zeit von der Ankunft am
Vormittag bis zum späten Nachmittag gerade eben aus. Um 16.30 Uhr
wurde Bischof Wiesemann zum Abschlussgottesdienst erwartet. Es war
erklärtes Ziel der Messdiener-Agenten, bis zu diesem Zeitpunkt alle
Gegenstände für die Feier des Gottesdienstes wieder in der Kirche
zur Verfügung zu haben. Um Punkt 16.30 Uhr hatten sie ihr Ziel
erreicht: Mit allen nötigen Gegenständen ausgestattet begrüßten die
Messdiener Bischof Wiesemann und feierten gemeinsam mit ihm
Gottesdienst. Dabei wurde auch das Motto des Tages genauer unter
die Agenten-Lupe genommen: Als "Service", als "Dienst" verstehen
die Messdiener ihr Tun während der Gottesdienste in den Gemeinden
des Bistums. Bischof Wiesemann sagte in seiner Predigt: "Ihr Minis
gebt das Geheimnis unseres Glaubens durch euren Dienst weiter. In
diesem Sinne seid ihr Agentinnen und Agenten Gottes, die seinem
Geheimnis auf der Spur sind." Die Mädchen und Jungen nehmen ihren
Dienst - für den der Diözesane Minitag auch ein großer Dank sein
soll - sehr ernst. Sie sind aber auch mit viel Spaß dabei.
"Ich liebe messdienen!", sagte Anton (9) aus Kaiserslautern und
erklärt auch gleich, warum das so ist: "Weil das viel Spaß macht!
Da kann ich die Fürbitten vorlesen und das ist cool! Außerdem
treffe ich da viele Freunde." Sein Klassenkamerad Tim, ebenfalls 9
Jahre alt, stimmte ihm zu: "Ich sehe das genauso wie Anton." Marie
aus Hochspeyer ging es um etwas anders. Die Neunjährige antwortet
auf die Frage, warum sie Messdienerin sei: "Weil ich da im
Gottesdienst ganz viel helfen kann!"
Für jede besuchte Workshopstation erhielten die
Nachwuchagenten einen Stempel in ihrem Agentenausweis. Die Ausweise
dienten bei Erreichen der dritten Workshopstation als "Lösegeld".
In Verbindung mit einem Tipp in Form eines Fotos des gestohlenen
Gegenstandes konnten die Teilnehmer die gestohlenen Gegenstände
zurück erhalten. Dafür reichte die Zeit von der Ankunft am
Vormittag bis zum späten Nachmittag gerade eben aus. Um 16.30 Uhr
wurde Bischof Wiesemann zum Abschlussgottesdienst erwartet. Es war
erklärtes Ziel der Messdiener-Agenten, bis zu diesem Zeitpunkt alle
Gegenstände für die Feier des Gottesdienstes wieder in der Kirche
zur Verfügung zu haben. Um Punkt 16.30 Uhr hatten sie ihr Ziel
erreicht: Mit allen nötigen Gegenständen ausgestattet begrüßten die
Messdiener Bischof Wiesemann und feierten gemeinsam mit ihm
Gottesdienst. Dabei wurde auch das Motto des Tages genauer unter
die Agenten-Lupe genommen: Als "Service", als "Dienst" verstehen
die Messdiener ihr Tun während der Gottesdienste in den Gemeinden
des Bistums. Bischof Wiesemann sagte in seiner Predigt: "Ihr Minis
gebt das Geheimnis unseres Glaubens durch euren Dienst weiter. In
diesem Sinne seid ihr Agentinnen und Agenten Gottes, die seinem
Geheimnis auf der Spur sind." Die Mädchen und Jungen nehmen ihren
Dienst - für den der Diözesane Minitag auch ein großer Dank sein
soll - sehr ernst. Sie sind aber auch mit viel Spaß dabei.
"Ich liebe messdienen!", sagte Anton (9) aus Kaiserslautern und
erklärt auch gleich, warum das so ist: "Weil das viel Spaß macht!
Da kann ich die Fürbitten vorlesen und das ist cool! Außerdem
treffe ich da viele Freunde." Sein Klassenkamerad Tim, ebenfalls 9
Jahre alt, stimmte ihm zu: "Ich sehe das genauso wie Anton." Marie
aus Hochspeyer ging es um etwas anders. Die Neunjährige antwortet
auf die Frage, warum sie Messdienerin sei: "Weil ich da im
Gottesdienst ganz viel helfen kann!"
Die Jugendband "Gods Child" aus Ludwigshafen gestaltete den
Gottesdienst musikalisch, das Gottesdienstteam der Jugendkirche
"Lumen" in Ludwigshafen hatte ihn vorbereitet. Damit war der
Gottesdienst zum Abschluss des Minitags 2017 auch eine kleine
Premiere für "Lumen". Erstmals ging das Jugendkirchenteam mit dem
Format "lumen on tour" aus der Stadtgrenze Ludwigshafens
heraus auf Reisen.
Der bistumsweite Minitag findet etwa alle vier bis fünf Jahre
statt. Zuletzt trafen sich Minis 2012 in Kaiserslautern. Der Tag
ist eine gemeinsame Aktion des Ministratenreferates in der
Abteilung Jugendseelsorge des Bistums Speyer und des
Jugenddachverbandes BDKJ Speyer. Der BDKJ Speyer vertritt die
Anliegen von 7.500 Mitgliedern aus sieben Verbänden in Kirche,
Politik und Gesellschaft. Mehr: www.bdkj-speyer.de Text und Foto: BDKJ
Speyer
27.08.2017
MessdienerInnen als "Agenten" unterwegs
„Die Sicherheit in Person“
 Verabschiedung von
Peter Ruffra, langjähriger Leiter des Referates „Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz“ im Bistum Speyer
Verabschiedung von
Peter Ruffra, langjähriger Leiter des Referates „Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz“ im Bistum Speyer
Speyer- Am 31. Juli 2017 beendete Peter
Ruffra seine langjährige Tätigkeit als Leiter des Referates
„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“ im Bistum Speyer. Heute
wurde er im Rahmen einer kleinen Feier im Priesterseminar St.
German in Speyer offiziell verabschiedet. Seine Nachfolge tritt die
32-jährige Sicherheitsingenieurin Stefanie Mohr aus Rheinzabern
an.
Peter Ruffra, der in Oberotterbach lebt, war rund 18 Jahre als
Fachkraft für Arbeitssicherheit in der Diözese Speyer tätig. Nach
einem Architekturstudium arbeitete er zunächst bei einem
Ingenieurbüro und absolvierte ein Zusatzstudium der Baubiologie. 13
Jahre war Ruffra danach als selbständiger Architekt tätig. In
dieser Zeit betreute er viele Baumaßnahmen im kirchlichen Bereich,
bevor er im Januar 2000 die Aufgabe als Fachkraft für
Arbeitssicherheit im Bischöflichen Ordinariat übernahm.
„Du hast das bis dahin noch vollkommen unbearbeitete
Aufgabengebiet ‚Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz‘ übernommen
und aufgebaut. Ich denke, man kann mit Recht sagen, dass Du in
diesem Aufgabenbereich in der katholischen Welt der Pfalz und
Saarpfalz Pionierarbeit geleistet hast“, würdigte Kanzleidirektor
Wolfgang Jochim die Arbeit Ruffras. Der in Pfarreien und im
Ordinariat oft gehörte Spruch „Ach Gott, wonn des de Ruffra sieht“
sei nie mit persönlicher Abneigung verbunden gewesen, sondern im
Grunde mit der Erkenntnis eines mangelhaften Sicherheitszustandes
und Ausdruck schlechten Gewissens. Peter Ruffra sei es gelungen,
als „hoch motivierter und engagierter Sicherheitsingenieur“ für
diese wichtige Thematik der Arbeitssicherheit zu sensibilisieren.
„Das Thema Gesundheitsschutz und Sicherheit der Menschen ging und
geht Dir durch und durch. Deine Aufgabe war Dir geradezu auf den
Leib geschrieben. Ich würde behaupten, Du bist für viele sozusagen
die Sicherheit in Person“, lobte Jochim. Als Dank und Anerkennung
für seine Dienste für das Bistum Speyer überreichte er Ruffra eine
Dankurkunde von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
Mit dem Ende seiner Tätigkeit als Leiter des Referates
„Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“ geht Peter Ruffra jedoch
noch nicht in den Ruhestand. Er engagiert sich weiter als
hauptamtlicher Diakon mit halber Stelle in der Pfarrei Hl. Edith
Stein, Bad Bergzabern.
In seiner Dankrede zum Abschied verwies Ruffra auf die
„religiöse Dimension der Arbeitssicherheit“, die im Gebot der
Nächstenliebe enthalten sei. „Wenn ich will, dass meinem Nächsten
kein Unheil zustoßen soll, unternehme ich alles Erdenkliche um dies
zu verhindern. Nächstenliebe und ein gesunder Verstand sind aus
meiner Sicht die wichtigsten Grundlagen einer neuen Kultur der
Arbeitssicherheit, nicht nur im Raum der Kirche, und nicht starre
Anhäufungen von Gesetzen, deren Berge schon jetzt nicht mehr
überschaubar sind.“
Unter den Gästen der Feier waren neben der Ehefrau von Peter
Ruffra und zahlreichen Kolleginnen und Kollegen auch Generalvikar
Dr. Franz Jung, Domkapitular Franz Vogelgesang, Dr. Sabine Decker
als Vertretung des Arbeitsmedizinischen Dienstes des TÜV und Dr.
Klaus Pohl von der Verwaltungsberufsgenossenschaft Mainz.
Text: is; Foto: Peter Ruffra © Bistum Speyer
26.08.2017
Town & Country Stiftung vergibt Spende an Kinderförderprojekt
 von links: Tanja Gambino, Silvia Lösch, Brigitte Thalmann, Michaela Feiniler.
von links: Tanja Gambino, Silvia Lösch, Brigitte Thalmann, Michaela Feiniler.
„Kinder- und Jugenderholung an der
Nordsee“ vom Diakonischen Werk Pfalz KdöR
Speyer- Die Town & Country Stiftung übergab
anlässlich des Betreuerfestes vom Diakonischen Werk Pfalz in Speyer
eine Spende in Höhe von 1.000 Euro an die Einrichtung. Mit der
Spende soll eine Ferienfreizeit für Kinder und Jugendliche an der
Nordsee realisiert werden.
Der Town & Country Stiftungspreis wird 2017 bereits zum
fünften Mal von der Town & Country Stiftung vergeben. Der Fokus
der Förderung im Rahmen des Stiftungspreises liegt auf der
Unterstützung benachteiligter Kinder. In diesem Jahr werden 500
Kinderhilfsprojekte mit jeweils 1.000 Euro unterstützt. Das
Diakonische Werk Pfalz ist eine der 500 Einrichtungen, die die
Auswahlkriterien erfüllt hat. Aus allen nominierten Projekten wird
eine unabhängige Jury jeweils ein Projekt pro Bundesland auswählen,
an das im November 2017 ein weiterer Förderbetrag in Höhe von 5.000
Euro im Rahmen einer feierlichen Gala vergeben werden soll.
Die Town & Country Stiftung unterstützt mit dem
Stiftungspreis das wichtige und unermüdliche Engagement aller
Mitarbeiter und Ehrenamtlichen der Einrichtung. „Vielen Familien
mit wenig Einkommen ist es kaum möglich in den Sommerferien zu
verreisen. Mit den Ferienfreizeiten möchte das Diakonische Werk den
Kindern und Jugendlichen trotzdem eine unbeschwerte Zeit
verschaffen. So können die jungen Teilnehmer nach den Ferien in der
Schule von ihrem Urlaub berichten und werden sozial integriert“,
sagte Silvia Lösch, Botschafterin der Town & Country Stiftung
und Geschäftsführerin der Südwest Massivhaus GmbH. Brigitte
Thalmann, Mitglied der Geschäftsführung, Leitung der Abteilung
Soziales und Freiwilligendienste | Diakonisches Werk der
Evangelischen Kirche der Pfalz fügte dem hinzu: „Mit uns fahren
jedes Jahr ca. 300 Kinder in die Ferien an die Nordsee. Nur dank
Spendengeldern können wir neben der Organisation der Fahrten auch
noch Reisekostenzuschüsse für benachteiligte Kinder ermöglichen,
die sonst keine Chance hätten, in die Ferien zu fahren“.
Die Town & Country Stiftung wurde 2009 von Gabriele und
Jürgen Dawo mit dem Anliegen ins Leben gerufen, um unverschuldet in
Not geratenen Hauseigentümern und benachteiligten Kindern zu
helfen. Die Arbeit der Stiftung wird durch die Spendenbereitschaft
der Town & Country Lizenzpartner des Town & Country
Franchise-Systems ermöglicht, wobei die ursprünglichen
Satzungszwecke zwischenzeitlich noch erweitert worden sind.
Text und Foto: Town & Country Stiftung
22.08.2017
Bischof Wiesemann in Maria Laach
Pontifikalamt und Vortrag am 24. August in der
Benediktinerabtei
Maria Laach- Unter dem Leitwort „Sehnsucht
nach dem Haus Gottes“ hat die Benediktinerabtei Maria Laach
vom 13. bis 24. August zu ihrer traditionellen Laacher Festwoche
eingeladen. Zum Abschluss findet am Donnerstag, 24. August, das
Kirchweihfest statt. Es beginnt um 10 Uhr mit einem feierlichen
Pontifikalamt mit dem Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in
der Abteikirche.
Am Nachmittag, um 15 Uhr, wird Bischof Wiesemann, der auch
Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in
Deutschland (ACK) ist, zum Abschluss der Laacher Festwoche und
gleichzeitig zur Finissage der Ausstellung „Luther in Laach“ einen
Vortrag halten. Das Thema lautet „Eins in Christus – Gelebte
Ökumene 500 Jahre nach der Reformation“. Die Ausstellung wird
anschließend vom 22. September bis 31. Oktober im
Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz in Koblenz zu sehen sein.
is
21.08.2017
Dankbarkeit für viele gemeinsame Jahre
 Feier der
Ehejubiläen mit Bischof Wiesemann im Dom zu Speyer
Feier der
Ehejubiläen mit Bischof Wiesemann im Dom zu Speyer
Speyer- Auch im zehnten Jahr hat die Feier
der Ehejubiläen ihre Anziehungskraft nicht verloren – im Gegenteil.
Wie vor drei Jahren konnte das Bistum Speyer die Feier nun wieder
an zwei Tagen anbieten: Samstag wie auch Sonntag strömten hunderte
Paare zum Pontifikalamt mit anschließendem Sektempfang und tanzten
zum Abschluss Walzer um den Domnapf.
Dieses Jahr passte es terminlich gut für eine Doppelauflage der
Feier – zur Freude der Paare, der Geistlichen und der
Organisatoren. "Wir können der Nachfrage gerecht werden", erklärte
Rita Höfer, die die Veranstaltung der Ehe- und
Familienseelsorge im Bischöflichen Ordinariat
mitorganisiert. Mit Bedauern habe sie in anderen Jahren Paaren
absagen müssen, weil der Platz im Dom begrenzt ist. Letztes Jahr
erneuerten rund 560 Paare ihr Eheversprechen, nun waren es
insgesamt mehr als 650. Während der Sonntag schnell ausgebucht war,
konnten sich Jubelpaare noch für den Samstag anmelden – und taten
das bis zuletzt. Trotz der Verteilung auf beide Tage war der Dom
jeweils nahezu voll besetzt.
Die starke Nachfrage erklärte Rita Höfer mit einem einfachen
Grund: "Die Eheleute haben ein sehr großes Bedürfnis, dass ihre
Lebensleistung wahrgenommen wird. Den Jubelpaaren sei es ebenso ein
großes Anliegen, für das Vergangene zu danken und um Gottes Segen
für den weiteren gemeinsamen Lebensweg zu bitten.
 "Ihre
Dankbarkeit steht im Mittelpunkt dieser Feier", betonte Bischof
Karl-Heinz Wiesemann zu Beginn des Gottesdienstes, den er an beiden
Tagen leitete. In einer langen Ehezeit steckten viel Liebe, Treue,
Glauben, vielleicht auch Tränen und Schmerz, sagte er und fügte mit
Blick nach vorn hinzu: "In unserem Dom sollen Sie mit einem
besonderen Segen gestärkt werden."
"Ihre
Dankbarkeit steht im Mittelpunkt dieser Feier", betonte Bischof
Karl-Heinz Wiesemann zu Beginn des Gottesdienstes, den er an beiden
Tagen leitete. In einer langen Ehezeit steckten viel Liebe, Treue,
Glauben, vielleicht auch Tränen und Schmerz, sagte er und fügte mit
Blick nach vorn hinzu: "In unserem Dom sollen Sie mit einem
besonderen Segen gestärkt werden."
In seiner Predigt griff der Bischof die Frage auf, was Liebe ist
und machte deutlich, wie eng Eheleute mit Gott verbunden sind und
dass sie sich seiner Liebe und Treue immer sicher sein können. Auch
wenn Partner an ihrer Ehe zweifelten oder sich trennten, bestehe
Gottes Liebe und Treue fort, der Herr spende Gnade und Berufung:
"Wenn wir nicht mehr an die Ehe glauben, er glaubt daran – das ist
das Sakrament der Ehe."
Einen weiteren Aspekt führte Wiesemann an. "Liebe ist nie
einfach gegeben, sie muss immer wieder im Miteinander errungen
werden." Dennoch seien Anstrengung und Arbeit nicht das Fundament
von Liebe. "Es braucht jemanden, der an einen glaubt." Die Treue,
die die Jubelpaare unter Beweis stellten, berühre und sei mehr als
Arbeit. Der Bischof danke den Eheleuten ausdrücklich für ihr
Lebenszeugnis.
Er zeigte sich beeindruckt von den vielen Jahren, die die
Jubelpaare bisher gemeinsam verbrachten. Alle Ehejahre
zusammengezählt, sagte er, würden das Alter des Domes um ein
Vielfaches übersteigen. Die meisten Jubelpaare – genauer gesagt 272
– feiern in diesem Jahr Goldene Hochzeit, 105 Silberne Hochzeit. 67
Ehepaare sind seit 60 Jahren verheiratet, neun blicken auf 65
gemeinsame Jahre zurück. Ein Paar feiert gar 67 Ehejahre.
 Nach der
Kommunion folgte ein weiterer Höhepunkt: Alle Ehepartner sprachen
gemeinsam und jeweils zueinander gewandt das Gebet der Jubilare,
das mit der Erneuerung des Eheversprechens endete. Wie immer setzte
die Einzelsegnung der Paare durch Bischof, Mitglieder des
Domkapitels, Priester und Diakone den Schlusspunkt des
Gottesdienstes – ein weiterer bewegender Moment für die Paare. Hier
wechselten sie auch einige persönliche Worte mit den Geistlichen
und mehr noch beim anschließenden Sektempfang.
Nach der
Kommunion folgte ein weiterer Höhepunkt: Alle Ehepartner sprachen
gemeinsam und jeweils zueinander gewandt das Gebet der Jubilare,
das mit der Erneuerung des Eheversprechens endete. Wie immer setzte
die Einzelsegnung der Paare durch Bischof, Mitglieder des
Domkapitels, Priester und Diakone den Schlusspunkt des
Gottesdienstes – ein weiterer bewegender Moment für die Paare. Hier
wechselten sie auch einige persönliche Worte mit den Geistlichen
und mehr noch beim anschließenden Sektempfang.
Die Paare kamen aus der gesamten Diözese, nahmen teilweise weite
Wege auf sich. Marianne und Baldur Schirrer hatten sich aus
Ramstein-Miesenbach auf den Weg gemacht und feiern in diesem Jahr
Goldene Hochzeit. Das Paar hatte schon vor fünf Jahren an der Feier
teilgenommen und war auch dieses Mal berührt. Den Gottesdienst
bezeichneten sie als "ergreifend und wunderbar", die Predigt habe
Zuversicht gegeben. Bereits zum dritten Mal sind Marianne und Paul
Warkus aus Neustadt-Hambach dabei, die 57 Jahre verheiratet sind.
"Es ist feierlich und schön", loben sie die gesamte Veranstaltung
und wollen selbstverständlich auch zu ihren 60. Hochzeitstag hier
sein.
Musikalisch gestaltet wurden die beiden Messen von einer
Kantorenschola der Dommusik unter der Leitung von Domkantor Joachim
Weller sowie von den Domorganisten Christoph Keggenhoff (Samstag)
und Markus Eichenlaub (Sonntag). Die Musik zum Tanz um den Domnapf
spielten Walter Ast (Keyboard) und Timo Wagner (Saxofon).
Text und Fotos: Yvette Wagner
20.08.2017
Bischof Wiesemann sendet vier junge Frauen in den seelsorglichen Dienst aus
 Sie werden von Bischof Wiesemann für ihren Dienst beauftragt (von links): Nina Bender, Kerstin Humm, Amanda Wrzos und Dominique Haas.
Sie werden von Bischof Wiesemann für ihren Dienst beauftragt (von links): Nina Bender, Kerstin Humm, Amanda Wrzos und Dominique Haas.
Beauftragungsfeier am 27. August im Dom
zu Speyer
Speyer- Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wird
am Sonntag, 27. August, die drei Pastoralassistentinnen Nina
Bender, Dominique Haas und Kerstin Humm sowie die
Gemeindeassistentin Amanda Wrzos in den seelsorglichen Dienst im
Bistum Speyer aussenden. Die Beauftragung erfolgt im Rahmen eines
feierlichen Gottesdienstes, der um 10 Uhr beginnt, im Speyerer
Dom.
Nina Bender stammt aus Eppenbrunn und engagierte sich
schon früh als Messdienerin in ihrer Pfarrei, war Oberministrantin
und Sprecherin des Messdienerleitungsteams der damaligen
Pfarreiengemeinschaft St. Pirminius Pirmasens-Land. Prägende
Erfahrungen aus dieser Zeit und der Besuch mehrerer Weltjugendtage
bestärkten sie in ihrer Berufswahl. Nach der Mittleren Reife
wechselte sie auf das Gymnasium und machte Abitur. Danach studierte
die 27-Jährige Theologie in Mainz und München. Ihre Praktikumszeit
während des zweijährigen Pastoralkurses absolvierte sie in der
Pfarrei Heiliger Petrus in Dahn. Seit dem 1. August arbeitet sie
als Pastoralassistentin in der Pfarrei Heilige Elisabeth in
Zweibrücken.
Dominique Haas wurde in Ludwigshafen geboren. In ihrer
Heimatpfarrei beteiligte sie sich an einem Gesprächskreis mit
jungen Leuten, engagierte sich in der Firmvorbereitung und war
Mitglied in einer Band für die Gestaltung von Gottesdiensten. Nach
ihrem Abitur absolvierte sie einen zehnmonatigen Freiwilligendienst
im schwedischen Uppsala. Sie kümmerte sich dort um Kinder und
Jugendliche sowie um Menschen, die vom evangelisch-lutherischen zum
katholischen Glauben konvertierten. Anschließend studierte sie in
Münster Theologie. Während des Studiums schloss sie sich der
„Nightfever“-Bewegung, einer Initiative junger Christen zur
Neuevangelisierung, an. Die pastoralpraktische Ausbildung
absolvierte die 28-Jährige in der Pfarrei Maria Schutz in
Kaiserslautern. Seit dem 1. August arbeitet sie in der Pfarrei
Heilige Elisabeth in Grünstadt.
Kerstin Humm aus Waldsee ging nach dem Abitur als Au-Pair
nach Italien. Im Anschluss begann sie in Mainz zunächst ein
Lehramtsstudium mit den Fächern Theologie, Italienisch, Latein und
Bildungswissenschaften. Da dabei für sie die Theologie zu kurz kam,
studierte sie zusätzlich Theologie mit Abschluss Diplom. Sie
entschied sich dann für den Beruf der Pastoralreferentin, da ihr
bewusst wurde „dass ich als Pastoralreferentin auch in den
Schulunterricht gehen kann“ und der Beruf sehr viele Möglichkeiten
biete. Ihre Praktikumszeit verbrachte die 29-Jährige in der Pfarrei
Heiliger Wendelinus in Ramstein. Am 1. August begann ihr Einsatz
als Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Disibod in
Feilbingert.
Amanda Wrzos stammt aus Zweibrücken. Nach dem Abitur
bewarb sie sich zwar auch für ein Lehramtsstudium in den Fächern
Englisch und katholische Theologie, entschied sich dann aber dafür,
an die Katholische Fachhochschule in Mainz zu gehen, um praktische
Theologie als ersten Teil für die Ausbildung zur Gemeindereferentin
zu studieren. In ihrer pastoralpraktischen Ausbildungszeit in der
Pfarrei Heiliger Petrus und Paulus in Ludwigshafen von September
2015 bis Juni 2017 sammelte die 25-Jährige vielfältige Erfahrungen
in der Kinder- und Jugendarbeit sowie in der Seniorenseelsorge.
Seit dem 1. August ist Amanda Wrzos in der Pfarrei Heilige
Katharina von Alexandria in Hauenstein tätig.
Insgesamt gibt es im Bistum Speyer zurzeit 108
Pastoralassistenten/-referenten. Etwa die Hälfte ist in der
Pfarrseelsorge tätig, rund ein Drittel als Religionslehrerin oder
Religionslehrer, die übrigen arbeiten in der außerordentlichen
Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen oder als
Bildungsreferenten und in der kirchlichen Verwaltung. Die
Pastoralassistenten erhalten ihre Ausbildung im Theologiestudium an
einer Universität und in einem zweijährigen pastoralpraktischen
Kurs im Priesterseminar in Speyer. Nach der Beauftragung folgt
zunächst eine zweijährige Tätigkeit als Pastoralassistent, bevor
ihnen nach der zweiten Dienstprüfung der Titel Pastoralreferent
verliehen wird. Außerdem sind im Bistum zurzeit 123
Gemeindeassistenten/-referenten tätig. Gemeindeassistenten
studieren drei Jahre an einer Hochschule für Praktische Theologie
oder an einer Fachakademie und absolvieren ein Praxisjahr in einer
Gemeinde.
Interessenten an den beiden pastoralen Berufen erhalten Auskünfte
bei der Beratungs- und Informationsstelle "Berufe
der Kirche", Pfarrer Ralf Feix, Telefon 0 62 32/10 23 37, sowie
im Bischöflichen Ordinariat Speyer bei den Verantwortlichen für die
beiden Berufsgruppen, Matthias Zech (Pastoralreferent(inn)en),
Telefon 0 62 32/10 23 54, und Marianne Steffen
(Gemeindereferent(inn)en), Telefon 0 62 32/10 23
22. Text: is; Foto: Privat
18.08.2017
Religion neu in die Schule bringen
 v.l.: Fabian Lauer, Angela Purkart, Bernhard Kaas, Irina Kreusch
v.l.: Fabian Lauer, Angela Purkart, Bernhard Kaas, Irina Kreusch
Bistum Speyer mit neuem Fortbildungsteam
Speyer- Mit dem neuen Schuljahr legt das
Bistum Speyer neue Schwerpunkte im Schulbereich. Für die
Fortbildungsleitung beginnen Angela Purkart aus Sandhausen,
Bernhard Kaas aus Speyer und Fabian Lauer aus Radolfzell ihre
Tätigkeit im kirchlichen Auftrag.
Im Bistum Speyer gibt es rund 2.300 Religionslehrerinnen und
-lehrer, davon ein Großteil im Einsatz von Klasse 5 bis 10, der
Sekundarstufe I. Sie sind wie alle Pädagogen mit den Entwicklungen
an den Schulen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland gefordert auf
ihre Schülerinnen und Schüler einzugehen. Mit dem Fach katholische
Religion ermöglichen sie Zugänge für Kinder und Jugendliche zu
Sinn- und Lebensfragen aus christlicher Perspektive. Hier stehen
die Religionslehrer mit Fachwissen und auch ihrer persönlichen
Einstellung vor der Klasse. Warum glauben Sie? Woran zweifeln sie?
Wie sind Glaube an Gott und Hoffnung möglich, wenn so viele
Menschen Leid widerfährt? In der Aus- und Fortbildung müssen Lehrer
sich mit vielen dieser identitätsstiftenden Fragen
auseinandersetzen.
Das Bistum will den aktuellen Fragen an Schulen gerecht werden
und in der Religionspädagogischen Fortbildung Lehrerinnen und
Lehrer fachlich wie persönlich unterstützen.
Das neue Team für die Sekundarstufe I bringt dazu ganz
unterschiedliche Kompetenzen mit. Angela Purkart mit den Fächern
Bildende Kunst, Englisch und Katholische Religion hat bisher
Realschullehrer in Baden-Württemberg ausgebildet. Bernhard Kaas ist
Gymnasiallehrer am Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer mit den
Fächern Geschichte und Katholische Religion. Er war am
Studienseminar Speyer ebenso für die Fachausbildung der Referendare
zuständig und wechselt nun in die Fortbildung. Fabian Lauer ist
ausgebildeter Haupt- und Realschullehrer mit Erfahrung im
Förderbereich, er beginnt zugleich als Lehrer an den Realschulen in
Haßloch und Neustadt als Religionslehrer.
Weitere Informationen und Angebote zum neuen
Schuljahr:
HA II / 2 Religionsunterricht und Schule, Abteilungsleitung
Dr. Irina Kreusch; Tel. 06232-102-121, ru-fortbildung@bistum-speyer.de;
https://www.bistum-speyer.de/erziehung-schule-bildung/religionspaedagogische-fortbildungen
Text: is; Foto: © Bistum Speyer
17.08.2017
„Glaube ist Beziehung“
 Bischof
Wiesemann predigt zum Patronatsfest Mariä Himmelfahrt in voll
besetztem Dom - Weitere Gottesdienste am Nachmittag und
Abend
Bischof
Wiesemann predigt zum Patronatsfest Mariä Himmelfahrt in voll
besetztem Dom - Weitere Gottesdienste am Nachmittag und
Abend
Speyer- Mariä Himmelfahrt ist nicht nur ein
Hochfest in der katholischen Kirche, sondern gleichzeitig das
Patronatsfest des Doms und des Bistums Speyer. Gleich zwei Gründe,
die die Gläubigen an diesem Tag in den Dom strömen ließ. Viele
hatten gemäß der alten Tradition Sträuße mit Blumen und Kräutern
mitgebracht, um sie segnen zu lassen. Den offiziellen Auftakt des
Festtages bildete ein Pontifikalamt mit Bischof Karl-Heinz
Wiesemann.
Der Bischof von Speyer ließ die Gläubigen an seiner Freude über
diesen besonderen Tag teilhaben. „Wir wollen diesen Gottesdienst
als Festgottesdienst in der Freude über die Erlösung feiern“, rief
er ihnen zu Beginn zu. In seiner energisch vorgetragenen Predigt
widersprach Bischof Wiesemann Kritik und Vorbehalten gegenüber der
Marienfrömmigkeit, die in der katholischen und orthodoxen Kirche
hohen Stellenwert besitzt. Die Marienverehrung gehöre „in das Herz
des christlichen Glaubens“, betonte er und untermauerte dies mit
drei Gedanken. „Gott will unser Heil nicht allein bewirken, er will
unsere Mitwirkung in einem partnerschaftlichen Bund“, führte
Wiesemann aus. Dabei besäßen die Geschöpfe die Freiheit zur
Mitwirkung. Die Marienfrömmigkeit wiederum betrachte das Geheimnis
der Freiheit der Geschöpfe, sagte der Bischof. Er sähre die
Muttergottes ein Vorbild, die sich stets offen hielt für Gott, um
durch ihn zu wirken. Von diesem Punkt schlug er den Bogen zum
politisch-gesellschaftlichen Leben: „Unsere Demokratie lebt von der
Mitwirkung des Einzelnen.“ Weiterhin stehe Marienfrömmigkeit
für die Ur-Beziehung des Menschen. Sichtbar werde die innige
Verbundenheit durch Marienbilder, auf denen die Muttergottes Jesus
im Arm hält – als Neugeborenen wie als Gekreuzigten. „Glaube ist
Beziehung“, so Wiesemann, der dem Alleinsein von Christen eine
Absage erteilte. „Gemeinschaft gehört zum Glauben.“ Zum
Dritten sei der Glaube ein Glaube an eine Erlösung von Leib und
Seele. Die  Marienfrömmigkeit weise darauf hin, „dass wir uns
wiedersehen können, dass Gott unser Heil in Leib und Seele will“.
Seit der Auferstehung Christi gehöre das Leibliche zum Göttlichen.
Diese Leiblichkeit komme ebenfalls in den Marienbildern zum
Ausdruck. Bischof Wiesemann forderte, Menschen auch in ihrer
Leiblichkeit Würde zu geben. Er verurteilte medizinische
Experimente mit Embryos und den nachlässigen Umgang mit alten,
gebrechlichen Menschen.
Marienfrömmigkeit weise darauf hin, „dass wir uns
wiedersehen können, dass Gott unser Heil in Leib und Seele will“.
Seit der Auferstehung Christi gehöre das Leibliche zum Göttlichen.
Diese Leiblichkeit komme ebenfalls in den Marienbildern zum
Ausdruck. Bischof Wiesemann forderte, Menschen auch in ihrer
Leiblichkeit Würde zu geben. Er verurteilte medizinische
Experimente mit Embryos und den nachlässigen Umgang mit alten,
gebrechlichen Menschen.
Nach der Eucharistiefeier segnete der Bischof die Blumen- und
Kräutersträuße. Mariä Himmelfahrt sei auch ein Fest, das an die
Gaben der Schöpfung erinnere, an die Heilkraft und an das, was Leib
und Seele erfreut, erläuterte er. Anschließend erteilte Bischof
Karl-Heinz Wiesemann den Apostolischen Segen.
Für die umfangreiche musikalische Gestaltung beim Pontifikalamt
sorgte die Capella Spirensis unter der Leitung von Domkapellmeister
Markus Melchiori. Die Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub.
Das Pontifikalamt bildete den Auftakt des Festtages. Es folgten
am Nachmittag eine Pontifikalvesper, die Abendmesse, sowie am
späteren Abend ein Rosenkranz-Gebet und die Marienfeier mit Bischof
Wiesemann, die mit einer Lichterprozession durch den Domgarten
abschloss. Die Kräuterweihe fand in allen Gottesdiensten
statt.
Text/Fotos: Yvette Wagner
15.08.2017
Den Menschen hinter der Uniform sehen
 Polizeiseelsorgerin Anne Henning spricht über die
momentanen Stresssituationen der Polizei und über die
Herausforderungen, die sich dadurch für sie als Seelsorgerin
ergeben
Polizeiseelsorgerin Anne Henning spricht über die
momentanen Stresssituationen der Polizei und über die
Herausforderungen, die sich dadurch für sie als Seelsorgerin
ergeben
Neustadt- Seit zwei Jahren ist Anne
Henning als Evangelische Seelsorgerin im Bereich Polizei- und
Notfallseelsorge in Rheinland-Pfalz tätig. Davor war sie
zwölf Jahre Oberpfarrerin bei der Bundespolizei in St. Augustin bei
Bonn. „Christ sein bedeutet nicht nur Kirchenbesuch, wir müssen
auch für die Menschen in ihrem alltäglichen Leben da sein“,
begründet Henning ihren Wechsel zur Polizeiseelsorge. „Dies
betrifft auch die Menschen mittleren Alters, die fest im Beruf
stehen und vermeintlich nur wenig Hilfe benötigen. Bei den
Polizisten kommt außerdem noch hinzu, dass viele nur den Beamten in
Uniform sehen, wenige blicken auf den Menschen, der dahinter
steht.“ Besonders in den letzten Monaten sei der Berufsalltag für
die Polizeibeamten in Rheinland-Pfalz belastend gewesen.
Zwei Ereignisse seien hierfür maßgeblich, meint die
Seelsorgerin. Zum einen werden die Beamten in Rheinland-Pfalz, so
wie bereits in diversen anderen Bundesländern, seit Beginn dieses
Jahres einer speziellen Antiterrorausbildung unterzogen. Diese soll
den Beamten, die im Falle eines Anschlages meist schon vor den
Spezialkräften am Tatort eintreffen, den Umgang mit der dortigen
Situation ermöglichen. Zum anderen wurden auch viele Beamte aus
Rheinland-Pfalz beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli nach Hamburg
beordert. Dort waren sie mit einem bisher nicht gekannten Ausmaß
gewaltsamer Demonstrationen konfrontiert. Zudem wurde über die
Rolle der Polizei während des Einsatzes in den Medien und in der
Gesellschaft kontrovers diskutiert. Über die besonderen
Herausforderungen, die diese Ereignisse für die Seelsorge bedeuten,
spricht Anne Henning mit uns im Interview:
Inwieweit hat sich die neue Gefahrenlage durch den Terror und
die darauf folgenden Maßnahmen der Polizei spürbar auf Ihre Arbeit
als Seelsorgerin ausgewirkt?
Wir sind als beratende Stimme im Bereich der Ethik gefragt.
Nehmen wir ein Beispiel: Ein Täter ist mit einem Sprengstoffgürtel
ausgestattet. Er verletzt während seiner Tat einen Kollegen mit
einer Schusswaffe lebensgefährlich. Was tue ich? Verfolge ich den
Täter weiter, um nach Möglichkeit Schlimmeres zu verhindern? Oder
leiste ich bei dem Kollegen, von dem ich weiß, dass er dreifacher
Familienvater ist, Erste Hilfe, weil er sonst verbluten würde,
nähme aber dabei in Kauf, dass der Täter ein großes Blutbad
anrichtet, wenn er sich in die Luft sprengt. Das sind unglaublich
schwierige Fragen. Und – egal – wie sich der Beamte entscheidet, er
wird mit den Folgen leben müssen.
Ähnliche ethische Fragen mussten sich Polizeibeamte
natürlich bereits in der Vergangenheit stellen.
Ja, aber durch den Terror haben diese Fragen eine völlig neue
Größenordnung und Brisanz gewonnen.
Welche neuen Herausforderungen ergeben sich daraus?
An der Hochschule der Polizei gibt es konkrete Planungen zu
Ethikmodulen, die den Einsatztrainern helfen können, solche ethisch
brisanten Fragen mit den Beamtinnen und Beamten durchzudenken.
Schon jetzt nimmt die Seelsorge beobachtend an solchen Trainings
teil. Die Seelsorgenden sind als Beratende angefragt, die
einfühlsam gute Fragen stellen. So können wir dazu anregen, den
eigenen Standpunkt zu reflektieren.
Wie wird die Situation durch die Beamten selbst eingeschätzt?
Gibt es hier erkennbar starke Unterschiede?
Der Dienst ist in den letzten Jahren komplexer und gefährlicher
geworden. Als Polizeiseelsorge nehmen wir die Beamtinnen und
Beamten in ihrer Unterschiedlichkeit wahr. Da gibt es Typen, die
diese Fragen intensiv durchdenken. Andere setzen lieber auf
Verdrängen, weil sie Sorge haben, im Einsatz sonst nicht mehr so
gut funktionieren zu können. Das ist ein schmaler Grat. Beide
Herangehensweisen haben etwas für sich.
Hat sich also der Stresslevel der Beamten durch die
Antiterror-Ausbildung deutlich erhöht?
Ein Antiterror-Einsatz bedeutet absoluten Hochstress. Natürlich
verlangt die Ausbildung den Polizistinnen und Polizisten körperlich
und mental etwas ab. Hinzu kommt der Zeitfaktor. Das ist noch eine
weitere Schulung, die bei einer ohnehin viel zu dünnen
Personaldecke die Zeit der Beamten fordert. Das bringt schon mehr
Stress in der sogenannte Alltagsorganisation, weil man sich
gegenseitig vertreten muss. Die Fortbildungsteilnehmer fehlen dann
im Alltagsgeschäft.
Wie schätzen Sie die langfristigen Auswirkungen auf den
Polizeiberuf ein? Wird die Antiterror-Ausbildung für die Beamten
zur „normalen“ Routine oder bleibt sie auch in näherer Zeit eine
spezielle Situation?
Ich schätze, die Antiterrorausbildung wird ebenso zur Routine
werden, wie das Trainieren von Amoklagen. Allerdings werden solche
Einsätze und die Auseinandersetzung damit nie zur Normalität
werden. Das macht ja auch etwas mit den Familien der Beamten. Ich
kann mir auch vorstellen, dass manche junge interessierte Menschen
mit dieser Gefahrenlage im Kopf, sich gegen die Ausbildung zum
Polizeibeamten entscheiden.
Kommen wir zu den Ereignissen in Hamburg. Sie sagten im
Vorfeld unseres Gespräches, dass dieses Thema ihrem Eindruck nach
innerhalb der Polizei momentan von noch größerer Brisanz ist als
die immerhin schon eine Weile laufende Antiterrorausbildung. Wie
wurden die chaotischen Zustände in Hamburg durch die Beamten
wahrgenommen, was wurde als besonders belastend empfunden?
Der Einsatz wurde von den Beamten als sehr belastend
wahrgenommen. Es bestand unmittelbare Gefahr an Leib und Leben. Sie
mussten aufgrund der fordernden Einsatzlage mit extrem wenig Schlaf
auskommen. Dabei war das bisher ungekannte Ausmaß an blanker Gewalt
und blindem Hass gepaart mit dem Eindruck von Schaulustigen und
Gaffern, die zum Teil mit ihren Handykameras gefilmt und das Ganze
scheinbar als spannende Action und Riesenspaß wahrgenommen haben.
Das sind groteske Einsatzbedingungen.
Die Ereignisse in Hamburg wurden ja von großen Teilen der
Gesellschaft als ähnlich „grotesk“ wahrgenommen, es war für lange
Zeit das Nummer Eins Thema in Politik und Medien. Dabei haben sich
jedoch auch harte Fronten innerhalb der Gesellschaft
herausgebildet. Wie reagierten die Beamten auf die
Berichterstattung über die Geschehnisse in Hamburg in den folgenden
Wochen? Gibt es hierbei auch innerhalb der Polizei ähnlich
gespaltene Lager?
Polizeibeamte sind keine einheitliche Masse, sondern
individuell. Es schmerzt sie, wenn den
Beamten Vorwürfe gemacht werden, sie hätten falsch agiert. Sie
haben in einer Einsatzlage mit einem bisher ungekannten Ausmaß an
Gewalt hervorragende Arbeit unter Einsatz ihrer Gesundheit
geleistet. Und viele vergessen, dass hinter jeder Uniform, unter
jedem Einsatzhelm ein Mensch steckt, viele sind Familienväter und
Mütter, die ihren Dienst zum Wohl unserer Gesellschaft ausüben.
Dabei haben die meisten ein sehr hohes Arbeitsethos.
Inwieweit ist es möglich, dass die Ereignisse in Hamburg auch
das Selbstverständnis der Polizisten für die Zukunft
verändert?
Das muss sich mittelfristig zeigen. Klar ist, dass die
Eigengefährdung in solchen Einsätzen ungleich höher ist, als wir
das bisher gekannt haben. Mancher Beamte fragt sich nach solchen
Einsätzen auch, welche Rolle unsere Gesellschaft der Polizei heute
zuschreibt. Da spielt auch die Erfahrung der vielen Schaulustigen
eine Rolle. Manche sehen nur die Uniform. Wir als Seelsorgerin und
Seelsorger sehen auch den Menschen dahinter. Polizistinnen und
Polizisten müssen im Dienst vor allem funktionieren. Im Kontakt mit
uns ist dagegen auch Zeit und Raum für den Menschen, die Beamten
können Fragen, Sorgen und Freuden ausdrücken.
Welche besonderen Herausforderungen ergeben sich nach solch
großen und politisch brisanten Einsätzen für Sie als zuständige
Seelsorgerin?
Die Seelsorge unterstützt die Beamtinnen und Beamten durch
vielfältige Formen der Begleitung. Wir bieten über das Jahr
verteilt viele Seminare an, die zur inneren Stärkung dienen,
neudeutsch nennt man das „Resilienz“. Wir begleiten in Einsätzen.
So bereitet sich auch die Seelsorge bereits auf die zentrale Feier
zum Tag der deutschen Einheit in Mainz vor. Außerdem stehen wir
natürlich ständig für Einzelgespräche bereit. Da kann es um
Unterstützung in privat-persönlichen Krisen gehen oder um
dienstliche schwierige Situationen. Oft hilft es den Kolleginnen
und Kollegen, gemeinsam laut zu denken, Sachverhalte zu
reflektieren und so zu neuer Selbstvergewisserung zu finden.
Außerdem spüren uns die Beamtinnen und Beamten ab, woraus wir Kraft
schöpfen. Das weckt Interesse und daraus ergibt sich manches
Gespräch über den Glauben als Lebenshilfe und Kraftquelle.
Vielen Dank für das Gespräch.
Information:
Die Polizeiseelsorge ist für die Beamten in Rheinland-Pfalz rund
um die Uhr zugänglich. Um dies trotz Urlaubszeiten oder Ausfällen
zu ermöglichen, befindet sich Anne Henning im ständigen Austausch
mit ihrem katholischen Amtskollegen Patrick Stöbener. Zudem sind
beide Seelsorger Teil eines geschulten Kriseninterventionsteams.
Ökumene funktioniere bei der Polizeiseelsorge ausgezeichnet, meint
Henning. Es mache kaum einen Unterschied, ob sie mit Beamten
protestantischen oder katholischen Glaubens spreche oder mit
solchen, die überhaupt keiner christlichen Konfession angehören.
Letztlich ginge es immer um den Menschen.
Mehr zum Thema Polizei-und Notfallseelsorge: Homepage der
Ev. Kirche der Pfalz
https://www.evkirchepfalz.de/begleitung-und-hilfe/seelsorge/polizei-und-notfallseelsorge/
Text und Foto: is
14.08.2017
Höhepunkt der Musikwallfahrt - Theater-Oratorium „Psalm 2016“

Erste Musikwallfahrt der katholischen Jugend mit
Komponist Gregor Linßen führt von Bad Dürkheim nach Speyer |
Inszenierung und Aufführung des Theater-Oratoriums mit Projektchor
in der Friedenskirche St. Bernhard in Speyer
Speyer/Bad Dürkheim- Die Aufführung des
Oratoriums "Psalm 2016" von Gregor Linßen in der Friedenskirche St.
Bernhard in Speyer beschloss am 11.8.17 die erste Musikwallfahrt
des Bundes der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) Speyer. Das
Publikum gab den rund 80 Musikern, Schauspielern und dem
Projektchor Standing Ovations für eine wort- und bildgewaltige
Inszenierung. Sie verband die gesellschaftliche Diskussion des
Jahres 2016 um Flucht, Vertreibung und Migration mit
alttestamentlichen Psalmentexten. Der Komponist Gregor
Linßen stand selbst am Dirigentenpult. Der Musiker
aus Köln hatte den Projektchor zuvor bereits durch die Proben- und
Wallfahrtswoche geführt. Sie begann am 4.8. in Bad Dürkheim und
führte die Pilgergruppe über Haßloch nach Speyer.
 Dort mündete sie in die Aufführung des "Psalm 2016". Im
Mittelpunkt des Oratoriums steht eine neue Vertonung der Psalmen,
die als Spiegel der menschlichen Lebenserfahrungen gedeutet werden.
Nicht umsonst gilt das Buch der Psalmen Juden, Muslimen und
Christen gemeinsam als Heilige Schrift. Die Beschäftigung mit den
Textvertonungen war für die Teilnehmer auch eine Auseinandersetzung
mit ihren Glaubensüberzeugungen. "Psalm 2016" lebt aber nicht
alleine von der Vertonung, sondern insbesondere vom Schauspiel. Das
Oratorium stellt zwei Menschen in die direkte Begegnung miteinander
und mit der Frage "Was zerstört (meine) Welt?“. Alma Gildenast und
Thorsten Brunow gaben durch ihre beeindruckende Interpretation den
beiden Charakteren Gestalt. Die Psalmen und Lieder klangen vor
diesem Hintergrund wie eine Kommentierung der Gedanken und eine
Fortführung des Geschehens.
Dort mündete sie in die Aufführung des "Psalm 2016". Im
Mittelpunkt des Oratoriums steht eine neue Vertonung der Psalmen,
die als Spiegel der menschlichen Lebenserfahrungen gedeutet werden.
Nicht umsonst gilt das Buch der Psalmen Juden, Muslimen und
Christen gemeinsam als Heilige Schrift. Die Beschäftigung mit den
Textvertonungen war für die Teilnehmer auch eine Auseinandersetzung
mit ihren Glaubensüberzeugungen. "Psalm 2016" lebt aber nicht
alleine von der Vertonung, sondern insbesondere vom Schauspiel. Das
Oratorium stellt zwei Menschen in die direkte Begegnung miteinander
und mit der Frage "Was zerstört (meine) Welt?“. Alma Gildenast und
Thorsten Brunow gaben durch ihre beeindruckende Interpretation den
beiden Charakteren Gestalt. Die Psalmen und Lieder klangen vor
diesem Hintergrund wie eine Kommentierung der Gedanken und eine
Fortführung des Geschehens.
 Die Musikwallfahrt bot einen ungewöhnlichen Rahmen für die
Probenwoche des Projektchores. Probenzeiten wechselten mit
Wanderzeiten ab. Die ersten Probeneinheiten fanden im Jugendhaus
St. Christophorus in Bad Dürkheim statt. Von dort aus führten
Tagestouren mit weiteren Einheiten zunächst wieder nach Bad
Dürkheim zurück, bevor die Teilnehmer die größeren Etappen
meisterten. Am Donnerstag führte sie der Weg von Bad Dürkheim nach
Haßloch. Am Freitag folgte die Schlussetappe von Haßloch nach
Speyer.
Die Musikwallfahrt bot einen ungewöhnlichen Rahmen für die
Probenwoche des Projektchores. Probenzeiten wechselten mit
Wanderzeiten ab. Die ersten Probeneinheiten fanden im Jugendhaus
St. Christophorus in Bad Dürkheim statt. Von dort aus führten
Tagestouren mit weiteren Einheiten zunächst wieder nach Bad
Dürkheim zurück, bevor die Teilnehmer die größeren Etappen
meisterten. Am Donnerstag führte sie der Weg von Bad Dürkheim nach
Haßloch. Am Freitag folgte die Schlussetappe von Haßloch nach
Speyer.
Christian Knoll ist Referent für Religiöse Bildung beim BDKJ
Speyer. Er leitet den Arbeitskreis "Neues Geistliches Lied" und die
erste Musikwallfahrt: "Es waren schon anstrengende Tage und das
Wetter hat es nicht immer gut mit uns gemeint. Eine Etappe mussten
wir wegen eines echten Wolkenbruchs unterbrechen", erzählt er und
fährt fort: "Der Stimmung im Team hat das aber nicht geschadet. Wir
hatten ein Ziel vor Augen: Die Aufführung am Freitag in Speyer.
Damit sie gelingen konnte, haben wir acht Stunden am Tag geübt. Das
schweißt zusammen- genauso wie das gemeinsame Unterwegs-Sein. Auf
dem Weg gab es viel Gesprächsbedarf. Im Zentrum stand die Frage
nach den Psalmentexten. Da haben wir viel Neues entdeckt, haben
unsere Fragen und manchmal auch Antworten gefunden und waren auf
jeden Fall immer in dem Bewusstsein unterwegs, dass Gott mit uns
geht".
An der Aufführung waren neben dem Wallfahrtsprojektchor die Band
AMI, ein Streicherensemble sowie das Theater Gildenast beteiligt.
Die Musikwallfahrt war ein Projekt des Arbeitskreises
Neues Geistliches Lied (AK NGL) des BDKJ Speyer. Text und
Foto: BDKJ Speyer
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer ist
Dachverband von sieben Kinder- und Jugendverbänden im Bistum
Speyer. Er vertritt die Anliegen von 7.500 Mitgliedern in Kirche,
Politik und Gesellschaft. Mehr: www.bdkj-speyer.de.
13.08.2017
Theater-Oratorium „Psalm 2016“ - Bilderalbum
Eine Broschüre zum 1000. Geburtstag von Kaiser Heinrich III.
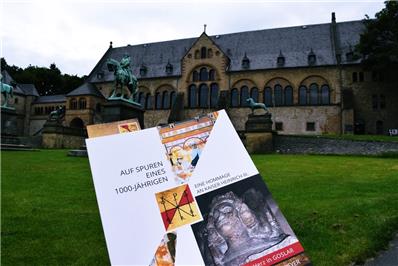 Informationen zu Veranstaltungen und Geschichte –
Kooperation mit Speyer
Informationen zu Veranstaltungen und Geschichte –
Kooperation mit Speyer
Goslar/Speyer- Es ist eine Hommage an Kaiser
Heinrich III.: Ein Magazin erzählt zu seinem 1000. Geburtstag die
Geschichte Heinrichs III. und erklärt den Zusammenhang zwischen dem
Kaiser, dem Bau der Kaiserpfalz, der Blütezeit des Bergbaus und dem
damit verbundenen Aufschwung der Stadt Goslar. Auch Heinrichs Bezug
zum Dom von Speyer sowie das berühmte Evangeliar, das im September
für sechs Monate nach Goslar kommen wird, werden im Magazin
beleuchtet. Ebenso wird die Diskussion um das genaue Geburtsjahr
des Kaisers aufgegriffen – unter dem Motto: „Wenn zwei sich
streiten… feiern wir trotzdem!“
Zum Jubiläumsjahr hat der Museumsverein Goslar e.V. in
Kooperation mit der Stadt Goslar ein Programm mit Ausstellung der
Prachtbibel, Festakt zum Geburtstag und mehr erstellt, um die
Geschichte um Heinrich III. und seine Bedeutung für die Stadt ins
Bewusstsein zu rücken. Zum „Geburtstagsprogramm“ gehören weiterhin
eine hochrangig besetzte Vortragsreihe des Geschichtsvereins Goslar
e.V., das Jubiläumskonzert „Ein Tusch für Heinrich III.“ der
Kulturinitiative Goslar e.V. und ein von einem weiteren
Vortragsprogramm begleitetes neues Diorama in „Deutschlands
schönstem Zinnfigurenmuseum“.
Konzipiert von der design office Agentur für Kommunikation GmbH
und gedruckt von der Quensen Druckerei + Verlag GmbH soll das nun
erschienene Magazin zum Besuch Goslars, des Rammelsberges und der
Ausstellung der Kaiserbibel in der Kaiserpfalz animieren. Dazu
tragen Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Bischof von Speyer, und Goslars
Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk mit  Grußworten bei. Die beiden Städte haben durch die
Initiative von Unternehmensberater Reiner Dressler für das
Heinrich-III-Jubiläum eine Marketingzusammenarbeit geschlossen:
Besucher des Doms in Speyer erhalten gegen Vorlage ihrer Tickets
Ermäßigung in Goslar und umgekehrt. Als Sponsor für das Magazin
konnte die Meisterküchen GmbH gewonnen werden.
Grußworten bei. Die beiden Städte haben durch die
Initiative von Unternehmensberater Reiner Dressler für das
Heinrich-III-Jubiläum eine Marketingzusammenarbeit geschlossen:
Besucher des Doms in Speyer erhalten gegen Vorlage ihrer Tickets
Ermäßigung in Goslar und umgekehrt. Als Sponsor für das Magazin
konnte die Meisterküchen GmbH gewonnen werden.
Der 1000. Geburtstag des Kaisers sei etwas ganz großes für
Goslar, sagte Oberbürgermeister Dr. Oliver Junk bei der
Präsentation der Broschüre. Doch Heinrich III. sei in der
Bevölkerung relativ unbekannt. Seine Geschichte wolle man nun
sichtbar machen und zwar so, „dass es nicht nur Wissenschaftler
verstehen“. Er war sich mit Silke Duda-Koch, Geschäftsführerin der
design office Agentur für Kommunikation, einig: Kulturmarketing ist
ein wichtiger Aspekt. Während der Museumsverein um Vorsitzenden
Jörg-Utz Hapke der Impulsgeber für das Jubiläumsprogramm insgesamt
war, hat Duda-Koch die Idee eines Magazins angestoßen.
Ausdrückliches Lob von allen Seiten gab es für die gute
Zusammenarbeit – auch in Hinblick auf die Ausstellung, die gerade
in der Kaiserpfalz entsteht. Kerstin Müller von design office und
Dr. Jan Habermann in Doppelfunktion für Stadt und Museumsverein
schaffen eine Ausstellung mit sechs Inseln um das
Hauptausstellungsstück herum, die Kaiserbibel. Auch davon berichtet
das Magazin, zeigt, wieviel Arbeit es kostet, und bietet damit
keine trockenen Jahreszahlen, sondern „Geschichte(n) zum Merken,
Staunen und Begeistern“.
Es wurde eine Auflage von 10.000 Exemplaren gedruckt, die in
Speyer und Goslar – dort in Kaiserpfalz, Museum Tourist-Info und im
Zinnfigurenmuseum – ausliegen. Das Jubiläumsmagazin ist gegen eine
Schutzgebühr von 2,50 Euro zu haben. Text und Foto: Stadt
Goslar
12.08.2017
Broschüre zum 1000. Geburtstag von Kaiser Heinrich III. - Bilderalbum
Junge Europäer bringen am Dom „Steine zum Sprechen“
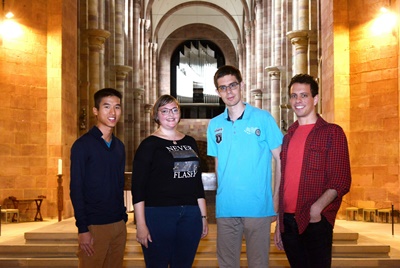 Die ARC-Domführer 2017: v.l.: Pierre Fabry (Frankreich), Katharina Scholz (Deutschland), Mathijs Zoeter (Niederlande) und Travis LaCouter (USA).
Die ARC-Domführer 2017: v.l.: Pierre Fabry (Frankreich), Katharina Scholz (Deutschland), Mathijs Zoeter (Niederlande) und Travis LaCouter (USA).
Spontan und kostenlos laden ARC-Domführer zum Erkunden der
Kathedrale und UNESCO-Welterbestätte ein
Speyer- Vom 12. bis zum 27. August
erwartet die Besucher des Doms in Speyer ein besonderes Angebot:
Pierre Fabry aus Frankreich, Travis La Couter aus den USA,
Katharina Scholz aus Deutschland und Mathijs Zoeter aus den
Niederlanden bieten kostenlos und spontan Domführungen in ihrer
jeweiligen Landessprache an. Sie sind damit Teil eines Projekts der
ökumenischen Organisation ARC. Diese entsendet junge Leute aus ganz
Europa an bedeutende Kirchen, um mit dem Projekt für ein
internationales und überkonfessionelles Miteinander zu werben. Der
Dom zu Speyer unterstützt das Projekt bereits seit vielen
Jahren.
„Die Anwesenheit der ARC-Teilnehmer ist für uns und unsere
Besucher immer eine besondere Bereicherung“, so Bastian Hoffmann,
Leiter des Dom-Besuchermanagements. „Es ist schon toll, wenn man
aus dem Ausland nach Speyer kommt und dort in seiner Muttersprache
begrüßt wird.“
2017 bieten vier junge Europäer Führungen in deutscher,
englischer, französischer und niederländischer Sprache an. Am Dom
wollen sie, gemäß dem Motto der Organisation ARC, „Steine zum
Sprechen bringen“. Ziel ist es, in der Begegnung mit den Besuchern
die spirituellen und historischen Dimensionen des beinahe
1000jährigen Bauwerks erlebbar machen.
Das Angebot besteht täglich außer mittwochs, jeweils von 10 bis
12:30 Uhr und 14:30 bis 17:30 Uhr, sonntags nach der Messe ab ca.
11:30 Uhr. Besucher können das Angebot ohne Voranmeldung je nach
Verfügbarkeit in Anspruch nehmen. Treffpunkt ist die Vorhalle. Um
eine Spende zu Gunsten des ARC-Projektes wird gebeten.
Die ARC-Teilnehmer 2017
Pierre Fabry ist 20 Jahre alt und stammt aus Südfrankreich. Er
hat gerade das erste Jahr seines Studiums im Fach Kunstgeschichte
an der Ecole Nationale des Chartes in Paris hinter sich gebracht.
Er interessiert sich besonders das Mittelalter und freut sich daher
sehr auf seine Zeit am Speyerer Dom.
Der US-Amerikaner Travis LaCouter promiviert an der Universität
von Oxford im Fach katholische Theologie. Zuvor hat der 26-jährige
an der Universität von Massachusetts Politik und Philosophie
studiert. Von dem ARC-Projekt hat er von einer früheren
Teilnehmerin erfahren. Als Theologe interessiert ihn besonders, wie
die Menschen den Dom zum Gebet nutzen.
Katharina Scholz ist 25 Jahre alt und kommt gebürtig aus
Mindelheim, einer kleinen Stadt in der Nähe von Augsburg. Ihr
Studium absolviert sie in Benediktbeuern und widmet sich dort den
Fächern Soziale Arbeit sowie Religionspädagogik. Sie hat bereits
erste Erfahrungen mit Besuchergruppen, da sie durch das Kloster
Benediktbeuern führt.
Mathijs Zoeter studiert an der Radboud University in Nijmegen
klassische Sprachen und Geschichte. Der 23-jährige Student hat sich
für das ARC-Projekt beworben, da Kirchen von jeher eine besondere
Faszination auf ihn ausübten.
Leben als internationale, christliche Gemeinschaft
Teil des Projekts ist das Leben als internationale, christliche
Gemeinschaft. Die vier jungen Leute eint nicht nur ihre Tätigkeit
am Dom. Sie leben als internationale, christliche Gemeinschaft in
einer Unterkunft und verbringen ihre Freizeit miteinander – auch
dies ist Teil der Grundidee des Programms. Das Besuchermanagement
des Doms organisiert aus diesem Grund verschiedene gemeinsame
Aktivitäten. So stehen in diesem Jahr sowohl Besuche in Mainz und
Worms als auch eine Wanderung im Pfälzer Wald auf dem Programm.
Zur Vorbereitung erhielten die Studenten vorab Informationen
über den Speyerer Dom. Während ihrer Zeit in der Pfalz werden sie
selbst an Führungen teilnehmen, etwa durch den Domschatz, die Stadt
Speyer aber auch durch Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.
ARC
ARC ist eine internationale ökumenische Organisation, die in den
Sommermonaten Führungen an bedeutenden europäischen Kathedralen
organisiert. Die drei Buchstaben ARC stehen für die französischen
Wörter „Accueil“ (Empfang), „Rencontre“ (Begegnung) und
„Communauté“ (Gemeinschaft). ARC gibt es auch in Belgien, den
Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien.
Jedes Land entsendet Teilnehmer zu den einzelnen
Kirchenführerprojekten – so entstehen kleine ARC-Gruppen mit jungen
Menschen aus verschiedenen Ländern. Außer in Speyer engagieren sich
ARC-Führer europaweit an vielen großen Kathedralen, etwa in Florenz
und Venedig, in Bordeaux und Rouen, in London und Oxford, in
Luxemburg sowie im belgischen Gent. In Deutschland sind sie 2017
noch in Berlin (Kirche der Versöhnung), Erfurt, Münster und
Konstanz im Einsatz. Weitere Informationen: http://www.arc-deutschland.de
Text: is; Foto: Die ARC-Domführer 2017 © Domkapitel Speyer,
Foto: Klaus Landry
10.08.2017
Spiel und Spaß in der Ferienoase der katholischen Kitas der Pfarrei Pax Christi
 Wasserspiele: Kinder der Ferienoase mit Erzieherin Jasmin Weller
Wasserspiele: Kinder der Ferienoase mit Erzieherin Jasmin Weller
Ohne das Engagement von GABIS und VFBB wäre die
"Ferienoase" nicht machbar gewesen
Speyer- „Ich habe meinen neuen Job gerade erst
begonnen und konnte keinen Urlaub beantragen. Zum Glück konnte mein
Sohn in die Ferienoase gehen“, Aussage einer berufstätigen Mutter
eines dreijährigen Sohnes.
Seit Jahren hat sich die Ferienoase als Notbetreuung in den
Schließtagen der Kindertagesstätten in den Sommerfeiern etabliert.
„Wohin mit meinem Kind in den Sommerferien?“ Mit dieser Frage
beschäftigen sich immer mehr Eltern in der Stadt Speyer.
Darauf reagierten die katholischen Einrichtungen und haben zum
wiederholten Mal eine Ferienoase für die Kinder aus ihren
Einrichtungen angeboten. Engagierte Fachkräfte mit Honorarverträgen
betreuten ca. 20 Kinder vom 24. Juli bis 04. August 2017 im
Kindergarten St. Joseph. Der zentrale Standort im Herzen von Speyer
ermöglichte nicht nur allen Eltern der Pax Christi- Einrichtungen
ein stressfreies Bringen ihrer Kinder, sondern war auch ein guter
Startpunkt für Ausflüge in die Stadt und mit der Bahn.
Ein gemeinsames Frühstück, leckeres gemeinsames Mittagessen mit
den Senioren im Seniorenheim St. Martha und ein Lunch waren
Bestandteil der Betreuung der Kinder von 2 Jahren bis zum
Schuleintritt. Das bunte Ferienprogramm mit Ausflügen zu
Spielplätzen, dem Toben und Planschen im Wasser sowie ein Ausflug
zum Luisenpark und Vogelpark ließen die Kinderaugen leuchten.
Schlechtwetterprogramm mit Basteln, Malen und Backen gab es
natürlich auch.
Finanziert werden konnte dies mit Unterstützung von der GABIS
GmbH. Vertragsabwicklung übernahm zum wiederholten Mal der VFBB.
Aufgrund der Ausweitung des Angebotes auf alle acht katholischen
Einrichtungen und der damit verbundenen steigenden Nachfrage waren
dieses Jahr erstmalig zwei Projektleitungen eingesetzt. Frau Britta
Öktem und Frau Sabrina Wöhlert sind bereits in der Reflexion und
haben schon jetzt kreative Ideen für die Umsetzung 2018.
Am Ende des Ferienprogramms waren sich alle Kinder und die
Fachkräfte einig: „Das war toll!“ und freuen sich schon auf das
nächste Jahr. Text und Foto: Kita St. Elisabeth
04.08.2017
Prälat Alfred Haffner verstorben
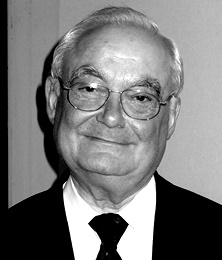 Ehemaliger
Leiter der Hauptabteilung "Schulen und Hochschulen" im
Bischöflichen Ordinariat Speyer und Verantwortlicher für die Orden
im Bistum
Ehemaliger
Leiter der Hauptabteilung "Schulen und Hochschulen" im
Bischöflichen Ordinariat Speyer und Verantwortlicher für die Orden
im Bistum
Speyer/Ludwigshafen- Gestern, am 2. August, ist
Prälat Alfred Haffner, ehemaliger Schuldezernent und Ordensreferent
des Bistums Speyer, im Alter von 87 Jahren in Ludwigshafen
verstorben. Als Leiter der Hauptabteilung "Schulen und Hochschulen"
im Bischöflichen Ordinariat Speyer war der Geistliche über 30 Jahre
für die Organisation des Religionsunterrichtes, die Aus- und
Weiterbildung der Religionslehrer, die kirchlichen Privatschulen
und die Hochschulseelsorge in der Pfalz und Saarpfalz
verantwortlich.
Der Studiendirektor i. R., der aus Kaiserslautern stammte, wurde
nach dem Theologiestudium in Mainz und München 1955 zum Priester
geweiht. Nach zweijähriger Kaplanszeit in der Pfarrei Herz Jesu in
Ludwigshafen wirkte er fünf Jahre als Domvikar in Speyer. 1962 ging
Haffner als Religionslehrer nach Ludwigshafen ans
Geschwister-Scholl-Gymnasium. Dieses schulische Engagement gab er
auch nicht auf, als er 1971 Dezernent für den Religionsunterricht
an den Gymnasien wurde und 1973 die Leitung der Hauptabteilung
"Schulen und Hochschulen" im Bischöflichen Ordinariat übernahm.
1987 kam die Leitung der Abteilung "Klösterliche Verbände" hinzu.
2004 löste Domdekan Dr. Christoph Kohl Haffner an der Spitze der
Hauptabteilung ab. Der Prälat blieb jedoch weiterhin - bis zu
seiner Versetzung in den Ruhestand Ende 2006 - für die Schulen
in kirchlicher Trägerschaft sowie die Orden zuständig.
Wohnsitz von Prälat Haffner war über Jahrzehnte das St.
Annastift in Ludwigshafen-Mundenheim, wo er als Hausgeistlicher der
Dominikanerinnen wirkte. Da das St. Annastift auf dem Territorium
der heutigen Pfarrei „Hll. Petrus und Paulus“ liegt, war Prälat
Haffner auch aushilfsweise über Jahrzehnte im seelsorgerlichen
Dienst in den dortigen Gemeinden St. Sebastian, Hl. Geist und St.
Ludwig tätig.
Das Totenoffizium und Requiem für Prälat Alfred Haffner
finden am Montag, 7. August 2017, um 10 Uhr in der Kirche St.
Sebastian in Ludwigshafen-Mundenheim statt. Anschließend ist um 12
Uhr die Beisetzung des Verstorbenen auf dem Friedhof in
Ludwigshafen-Mundenheim.
Text: is; Foto: Alfred Haffner © Bistum Speyer
03.08.2017
Gedächtniskirche: Tonnenschwere Lutherglocke mit neuem Schwung
 Größte Bronzeglocke der Pfalz ist Dank zweier neuer
Läutemaschinen wieder betriebsfähig
Größte Bronzeglocke der Pfalz ist Dank zweier neuer
Läutemaschinen wieder betriebsfähig
Speyer- Der Probelauf am 31. Juli um
Punkt 10 Uhr war erfolgreich, jetzt ertönt vom Turm der Speyerer
Gedächtniskirche wieder das altbekannte Geläut: Die Lutherglocke,
schwerste Bronzeglocke der Pfalz, ist nach fast fünf Monaten
Stillstand wieder in Schwung gekommen. Grund für die Unterbrechung
war ein Defekt im Getriebe der elektrischen Läutemaschine, die die
7,4 Tonnen schwere Glocke mit ihrem allein 800 Kilogramm schweren
Klöppel zum Klingen bringt. Nun wurde die alte Maschine nicht nur
durch ein neueres Modell ersetzt, zum besseren und sichereren
Betrieb in Zukunft wurde auch eine zweite Läutemaschine
installiert.
Glockensachverständige Birgit Müller und Erich Müller von der
Firma Hörz, die für die Installation der Maschine verantwortlich
war, haben die neuen Läutemaschinen einer genauen Prüfung
unterzogen und sie zum ersten Mal in Betrieb gesetzt. Erst
nacheinander die sieben anderen Glocken, wovon die kleinste,
genannt Bader-Glocke, immer noch stattliche 443 Kilogramm wiegt,
dann die mächtige Lutherglocke. 38,8 Mal schlägt sie in der Minute.
„Jetzt noch einmal Vollgeläut“, sagt Birgit Müller mit einem
Lächeln und betätigt nacheinander die Knöpfe ihrer Fernbedienung,
die das Geläut der Gedächtniskirche in Gang setzt. „Die
Fernsteuerung muss immer so aufbewahrt werden, dass nicht aus
Versehen ein spontanes Glockenkonzert ausgelöst wird“, weist die
Glockensachverständige auf die Reichweite des hochsensiblen Gerätes
hin.
Das Glockengeläut der Speyerer Gedächtniskirche ist das
schwerste und tontiefste Bronzegeläut der Pfalz. Unabhängig vom
Material wird es nur vom Geläut des Speyerer Doms und von dem
Gussstahlgeläut der Neustadter Stiftskirche übertroffen. Die
Lutherglocke, unterste der acht Glocken im Turm der
Gedächtniskirche, hängt genau über dem Denkmal ihres Namenspatrons,
das in der Vorhalle der protestantischen Kirche steht. Birgit
Müller ist mit den neuen Läutemaschinen zufrieden. Hier und da sei
noch eine kleine Feinjustierung nötig, damit Schwungbewegung und
Klang auch wirklich perfekt sitzen. Die Speyerer jedenfalls sind an
diesem Vormittag öfter als sonst in den Genuss des Glockengeläuts
gekommen. Text und Foto: lk
Mehr zum Thema: Homepage der Protestantischen
Gedächtniskirche Speyer http://www.gedaechtniskirchengemeinde.de/
01.08.2017
Christoph Fuhrbach fährt für Europa
 Referent für Weltkirche im Bistum Speyer nimmt im Trikot
von Renovabis an Radrennen quer durch Europa teil
Referent für Weltkirche im Bistum Speyer nimmt im Trikot
von Renovabis an Radrennen quer durch Europa teil
Speyer/ Geraardsbergen- Heute Abend macht
sich Christoph Fuhrbach, Weltkirche-Referent im Bistum
Speyer und Ausdauersportler, auf einen langen Weg – mit dem
Fahrrad von Belgien über Deutschland, Österreich, Italien, die
Slowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Mazedonien bis nach
Griechenland. Fast 4000 Kilometer liegen in den nächsten zehn Tagen
vor ihm. Mit der Startnummer 146 nimmt er im Trikot von Renovabis,
dem Osteuropa-Hilfswerk der Katholischen Kirche
in Deutschland, am „Transcontinental Race (TRC)“ teil. Es ist
eines der härtesten Radrennen, bei dem die Radler ohne
Unterstützung fahren - kein Teambus, keine Wasserholer.
Fuhrbach, der in Neustadt/Weinstr. wohnt, reizt bei dem Rennen
nicht allein die sportliche Herausforderung und das Abenteuer. Er
möchte mit seiner Teilnahme auch für die Idee eines geeinten
Europas und für Solidarität mit Menschen, die in Armut leben,
werben. Sein Engagement und die Arbeit von Renovabis kann man mit
einer Spende unterstützen: Sein Ziel ist, pro gefahrenen Kilometer
einen Euro zu sammeln.
Mit Renovabis, das im vergangenen Jahr seine bundesweite
Pfingstaktion im Bistum Speyer eröffnete, war Christoph Fuhrbach im
Jahr 2015 und 2016 in Bosnien unterwegs, um Projekte kennenzulernen
und Kontakte und Begegnungen mit aufzubauen. Auch diese Reisen
hatte er mit dem Rad bestritten. In seinem Blog „Voll das
Leben“ schreibt er über seine Touren und seine Motivation,
Leistungssport und Engagement für die "Eine Welt"
zusammenzubringen. Für das TCR hat er dort eine eigene
Kategorie: transcontinental-2017.
Beim Transcontinental Race planen die Radfahrerinnen und
Radfahrer ihre Route selbst. Sie sind ohne Unterstützung von außen
unterwegs und müssen sich selbst um Verpflegung und Unterkunft
kümmern. Im Rahmen der Tour müssen sie vier Kontrollpunkte
anfahren. Zielort sind die Metéora-Klöster in Griechenland.
Das Hilfswerk Renovabis hat Bilder und Informationen zu
Christoph Fuhrbach und seiner Teilnahme am TRC unter: www.renovabis.de/tcr
zusammengestellt. Aktuelle Berichte vom Rennen und Eindrücke von
Begegnungen mit Renovabis-Partnern in der Slowakei, Rumänien und
Mazedonien plant das Hilfswerk unter www.facebook.de/renovabis zu
veröffentlichen. Text: is, Foto: Quelle:
Renovabis

28.07.2017
Bistum Speyer mit Innovationspreis ausgezeichnet
 Auszeichnung für das Bistum Speyer (von links nach rechts): Peter S. Nowak (Sprecher der KVI Initiative), Dr. Achim Knoll (Bischöfliches Ordinariat Speyer) und Adalbert Bayer (Vorsitzender des KVI Beirats).
Auszeichnung für das Bistum Speyer (von links nach rechts): Peter S. Nowak (Sprecher der KVI Initiative), Dr. Achim Knoll (Bischöfliches Ordinariat Speyer) und Adalbert Bayer (Vorsitzender des KVI Beirats).
Die Bistümer Trier, Speyer und Freiburg belegten die ersten
drei Plätze des KVI Innovationspreises 2017 – Feierliche
Preisverleihung auf dem KVI Kongress in Mainz
Speyer- Für das Projekt „Einführung einer
bistumsweiten Pfarrverwaltungslösung“ ist das Bistum Speyer mit dem
zweiten Platz beim Innovationspreis der „Initiative Kirche,
Verwaltung und Information“ (KVI) ausgezeichnet worden. Den Preis
in Form einer Urkunde nahm Dr. Achim Knoll, Leiter der Abteilung
EDV des Bischöflichen Ordinariats, entgegen. Erster Sieger wurde
das Bistum Trier, den dritten Platz belegte das Erzbistum
Freiburg.
„Die drei Prämierten haben bereits vor einiger Zeit die Chancen
erkannt, die mit der digitalen Transformation der Verwaltung
verbunden sind und gehen mutig der Zukunft entgegen“, begründete
die Jury ihre Entscheidung. Digitale Prozesse, innovative
Softwarelösungen und neue Arbeitsabläufe veränderten zunehmend auch
kirchliche Verwaltungen. Das Softwareprodukt InGenius-Office,
entwickelt vom mittelständischen Softwareunternehmen Compelec
Computersysteme aus Wadgassen, bedeute eine Standardisierung und
Vereinfachung von Verwaltungsabläufen. Mit dem Innovationspreis
werden Unternehmen und Behörden ausgezeichnet, die für die
Digitalisierung innovative und zukunftsorientierte Strategien
entwickeln. Der Preis würdigt herausragende und nachhaltige
Leistungen mit Vorbildcharakter für andere Bistümer, Landeskirchen
sowie kirchennahe Organisationen.
Die Auszeichnung erfolgte auf dem KVI-Kongress im Erbacher Hof
in Mainz. Die „Initiative Kirche, Verwaltung und Information“
verfolgt seit ihrer Gründung im Jahr 2004 das Ziel, Führungskräften
in kirchlichen und kirchennahen Organisationen neue Impulse für
ihre Arbeit zu geben. Die KVI führt Menschen aus verschiedenen
Arbeitsfeldern zusammen, dient als Plattform für den
Erfahrungsaustausch und fördert den Dialog mit Experten und der
Wissenschaft. Das diesjährige Motto des KVI-Kongress lautete „Sich
dem Wandel stellen“. In zahlreichen Vorträgen wurde eine breite
Palette von Themen erörtert: von Fragen der Digitalisierung,
Energie und Umwelt, Finanzen, Informationstechnologien bis hin zu
Organisation, Personal-, Qualitäts- und Verwaltungsmanagement.
Text: is; Foto: Patricia C. Lucas
26.07.2017
"Zukunftszeit" goes Taizé
 BDKJ-Team
beteiligt sich mit einem Workshop zu Toleranz und Weltoffenheit
aktuell an ökumenischen Jugendtreffen in Taizé
BDKJ-Team
beteiligt sich mit einem Workshop zu Toleranz und Weltoffenheit
aktuell an ökumenischen Jugendtreffen in Taizé
Speyer/Taizé(Frankreich)- Vier junge
Erwachsene des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Speyer sind derzeit in Taizé in Frankreich, um mit Jugendlichen aus
aller Welt über Demokratie, Toleranz und die Integration
Geflüchteter ins Gespräch zu kommen. Der Dialogworkshop während des
Jugendtreffens der Communauté de Taizé fand im Kontext der
deutschlandweiten Aktion "Zukunftszeit" des BDKJ statt. Mit der
Aktion wirbt der Dachverband der katholischen Kinder- und
Jugendverbände im Vorfeld der Bundestagswahl in Deutschland im
September für Toleranz und Weltoffenheit.
Der ökumenische Männerorden in Frankreich ist besonders als
internationaler und ökumenischer Treffpunkt für Jugendgruppen und
für seine besondere Gebetsatmosphäre bekannt. "Es war uns wichtig,
die Themen mit Jugendlichen zu diskutieren, die aus der
Außenperspektive heraus auf Deutschland schauen. Was uns hier aber
trotz aller Internationalität verbindet, ist unser gemeinsamer
Glaube und der Wunsch, friedlich miteinander zu leben. Während des
Workshopgespräches gestern wurde heiß diskutiert, insbesondere die
Frage nach geeigneten Maßnahmen zur Integration Geflüchteter",
berichtet Lukas Dieckmann. 
Der Vorstandsreferent des BDKJ Speyer freut sich, mit den
Gesprächen in Taizé eine Verbindung zwischen Politik und Kirche
hergestellt zu haben. Insgesamt hatten 44 junge Menschen aus
verschiedenen Ländern den Workshop besucht. Zunächst stellte das
BDKJ-Team aus Speyer anhand der Fragen der Teilnehmerinnen und
Teilnehmern auch über Ländergrenzen hinausgehende Gemeinsamkeiten
heraus. Anschließend stellte das Team die Aktion "Zukunftszeit" vor
und erklärte deren Ziel, als katholische Kinder- und Jugendverbände
für eine weltoffene Gesellschaft zu werben. "In einem dritten Teil
haben wir in Kleingruppen über Toleranz, Demokratie, Mitsprache von
Jugendlichen und vor allem über Integration von Geflüchteten
gesprochen", erklärt Dieckmann. "Dabei gab es teilweise auch etwas
hitzigere Debatten, was wir denn mit dieser Aktion erreichen können
und wollen und ob etwas konkretes dabei als Ergebnis stehen kann.
Es ist ein spannender Workshop mit vielfältigen Gesprächen, die
sehr positiv angenommen wurden".
 Insgesamt
sind derzeit knapp 3000 junge Leute aus 60 Ländern in Taizé.
Während des BDKJ-Workshops gesten fanden parallel noch diverse
andere Workshops statt. Auf das Stundenkonto der Aktion
"Zukunftszeit" konnte der BDKJ Speyer mit dem Workshopangebot 66
Stunde verbuchen. Das fiktive Stundenkonto zählt Projektstunden der
Verbände für Toleranz und Weltoffenheit. Ursprünglich sollten bis
zur Bundestagswahl im September 35.000 Stunden gesammelt werden.
Das Ziel ist zwischenzeitlich bereits weit übertroffen worden.
Aktuell beläuft sich der Zählerstand auf 96.876 Stunden.
Insgesamt
sind derzeit knapp 3000 junge Leute aus 60 Ländern in Taizé.
Während des BDKJ-Workshops gesten fanden parallel noch diverse
andere Workshops statt. Auf das Stundenkonto der Aktion
"Zukunftszeit" konnte der BDKJ Speyer mit dem Workshopangebot 66
Stunde verbuchen. Das fiktive Stundenkonto zählt Projektstunden der
Verbände für Toleranz und Weltoffenheit. Ursprünglich sollten bis
zur Bundestagswahl im September 35.000 Stunden gesammelt werden.
Das Ziel ist zwischenzeitlich bereits weit übertroffen worden.
Aktuell beläuft sich der Zählerstand auf 96.876 Stunden.
Der Bund der deutschen katholischen Jugend (BDKJ) Speyer ist
Dachverband von sieben katholischen Kinder- und Jugendverbänden im
Bistum Speyer (Rheinland-Pfalz/Saarland). Er vertritt die
Interessen von 7.500 Mitgliedern in Kirche, Politik und
Gesellschaft. Mehr: www.bdkj-speyer.de.
Die nächste Zukunftszeit-Aktion des BDKJ Speyer ist das
Social-Media-Camp für Jugendliche vom 31.7. bis 4.8. in Bad
Dürkheim. Mehr dazu: zukunftszeit.bdkj-speyer.de
Text und Foto: BDKJ Speyer
23.07.2017
Rund 537.000 Gläubige gehören aktuell dem Bistum Speyer an
---Kopie.jpg) Bistum stellt Statistik für das vergangene Jahr vor –
Abnahme der Kirchenaustritte, doch zugleich sinkt die Quote der
regelmäßigen Gottesdienstbesucher
Bistum stellt Statistik für das vergangene Jahr vor –
Abnahme der Kirchenaustritte, doch zugleich sinkt die Quote der
regelmäßigen Gottesdienstbesucher
Speyer- Das Bistum Speyer hat seine Statistik
für das Jahr 2016 vorgelegt. Die Zahlen dokumentieren die
Entwicklungen des kirchlichen Lebens im Bistum Speyer.
Die Zahl der Katholiken hat gegenüber dem Vorjahr um rund 8.000
Gläubige abgenommen. Aktuell gehören rund 537.000 Frauen und Männer
der katholischen Kirche im Bistum Speyer an. Der Anteil der
regelmäßigen Gottesdienstbesucher beträgt acht Prozent. Das
bedeutet, dass jeden Sonntag rund 43.000 Menschen die katholischen
Gottesdienste in der Pfalz und im Saarpfalzkreis besuchen.
Gegenüber dem Jahr 2015 hat die Quote jedoch um ein halbes Prozent
abgenommen. „Vor etwa 20 Jahren war der Anteil der regelmäßigen
Gottesdienstbesucher noch mehr als doppelt so hoch“, erklärt der
stellvertretende Generalvikar Josef Szuba. Die abnehmende
Kirchenbindung sei jedoch ein Phänomen, das in allen westlichen
Ländern zu beobachten sei.
Leichte Anstiege sind bei der Zahl der Täuflinge, der
Kommunionkinder und der Firmlinge zu verzeichnen, während die
Zahlen der Trauungen und der Bestattungen etwas unter dem Niveau
des Vorjahres liegen. „Diese Zahlen schwanken immer etwas von Jahr
zu Jahr, ohne dass man daraus einen Trend ableiten kann“, erläutert
Szuba.
Die Zahl der Austritte hat gegenüber den beiden Vorjahren erneut
abgenommen: Knapp 4.000 Menschen haben der katholischen Kirche im
Bistum Speyer im vergangenen Jahr den Rücken gekehrt. Vor zwei
Jahren waren es noch mehr als 5.400. „Dennoch ist die hohe Zahl von
Austritten für uns weiterhin besorgniserregend. Denn sie enthält
die Botschaft: Hier haben sich Menschen aus Gründen, über die wir
nur spekulieren können, bewusst gegen eine weitere Mitgliedschaft
in der Kirche entschieden“, unterstreicht Szuba. Als „kleinen
Hoffnungsschimmer“ wertet er, dass die Zahl der Wiederaufnahmen in
die Kirche angestiegen ist: von 124 Personen im Jahr 2015 auf 142
Personen im Jahr 2016. „Wir können die Menschen nur als Einzelne
und auf sehr individuelle Weise für den Glauben und die Kirche
zurückgewinnen“, ist er überzeugt.
Weitere Informationen:
https://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/zahlen-und-statistik/?L=1
Bischöfliches Ordenariat Speyer, Presse
.jpg)
.jpg)
21.07.2017
Diakonie fordert Abschiebungsstopp nach Italien
 Diakonie Hessen und
Rheinland-Pfalz: Verschiebebahnhof für Flüchtlinge beenden /
Solidarität statt Abschottung
Diakonie Hessen und
Rheinland-Pfalz: Verschiebebahnhof für Flüchtlinge beenden /
Solidarität statt Abschottung
Mainz/Frankfurt- Eine sofortige Aussetzung der
Abschiebungen von Asylsuchenden nach Italien fordern Horst Rühl,
Vorstandsvorsitzender der Diakonie Hessen, und Albrecht Bähr,
Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Diakonie in
Rheinland-Pfalz.
Rühl und Bähr reagieren damit auf die Ankündigung des
Auswärtigen Amtes, künftig monatlich 750 Asylbewerber von Italien
in Deutschland aufzunehmen.
„Der Zusage der Bundesregierung, schutzsuchende Menschen aus
Italien aufzunehmen, widerspricht ihre zeitgleiche Intention,
möglichst viele Asylsuchende auf Grundlage der
Dublin-III-Verordnung wieder Richtung Italien abzuschieben“, so
Rühl. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) forderte
Italien allein im ersten Quartal 2017 auf, 6.743 Asylbewerber, die
sich bereits in Deutschland befanden, zurückzunehmen.
„Das ist ein Mehrfaches der Zahl, die nun aus Italien
aufgenommen werden soll. Damit läuft die von Deutschland zugesagte
Unterstützung Italiens weitgehend ins Leere“, kritisiert Rühl.
Bereits im Jahr 2015 hatte Deutschland im Rahmen eines sogenannten
Relocation-Programms zugesagt, bis 2017 insgesamt 27.500
Asylsuchende aus Italien aufzunehmen, um das Land zu entlasten. Bis
heute sind es gerade mal 3.000.
Lage von Flüchtlingen in Italien prekär
“Wir fordern, diesen Verschiebebahnhof zu beenden und
Dublin-Abschiebungen nach Italien vollständig auszusetzen“, fordert
Albrecht Bähr. „Die meisten Flüchtlinge berichten, dass sie in
Italien in überfüllten Lagern oder auf der Straße leben mussten,
auch Frauen und Familien mit Kindern sind von Obdachlosigkeit und
Verelendung betroffen.“ Die offensichtlich prekäre Lage von
Schutzsuchenden in Italien beschäftigt zurzeit auch das
Bundesverwaltungsgericht (BVerwG). Es legte mit Beschluss vom
26.6.2017 dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg die Frage vor,
ob nach dessen Ansicht Italien bei der Behandlung von Flüchtlingen
gegen die Menschenrechte verstößt.
EU: Seenotrettung soll erschwert werden
Italien ist aufgrund seiner geographischen Lage zurzeit das
Hauptaufnahmeland für Flüchtlinge in Europa, bekommt aber von den
anderen 27 EU-Staaten keine adäquate Unterstützung. Stattdessen
setzt die EU nun zusammen mit Italien die falschen Schwerpunkte.
„Die Rettung von Menschenleben soll erschwert werden, das ist ein
Verrat an den europäischen Werten. Wir halten es für einen
Trugschluss zu glauben, dem Treiben der Schlepper Einhalt gebieten
zu können, indem man die Retter an ihrer Arbeit hindert“,
kritisieren die Diakonie-Chefs. „Dadurch werden nicht
Fluchtursachen, sondern geflüchtete Menschen bekämpft. Was wir in
Europa brauchen, ist nicht Abschottung, sondern Solidarität.“
Hintergrund Dublin III
Die sogenannte Dublin III-Verordnung besagt, dass in der Regel
jener EU-Mitgliedstaat für die Durchführung des Asylverfahrens
zuständig ist, in dem die geflüchteten Menschen erstmals
registriert wurden. Da die meisten Schutzsuchenden über den Land-
oder Seeweg kommen, sind überwiegend die Länder Griechenland und
Italien für das Asylverfahren zuständig.
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz,
Presse
17.07.2017
Jutta Kruppenbacher neue Leiterin der Maria-Ward-Schule in Landau
 Speyer/Landau- Das Bistum Speyer überträgt Jutta
Kruppenbacher zu Beginn des neuen Schuljahres die Leitung der
Maria-Ward-Schule in Landau. Sie folgt als neue Schulleiterin auf
Klaus Neubecker, der zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand
getreten ist.
Speyer/Landau- Das Bistum Speyer überträgt Jutta
Kruppenbacher zu Beginn des neuen Schuljahres die Leitung der
Maria-Ward-Schule in Landau. Sie folgt als neue Schulleiterin auf
Klaus Neubecker, der zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand
getreten ist.
Jutta Kruppenbacher hat Physik und Mathematik für das Lehramt an
Gymnasien studiert. Seit 2013 war sie ständige Vertreterin des
Schulleiters am Gymnasium Edenkoben. Zuvor wirkte sie als
Studiendirektorin am Käthe-Kollwitz-Gymnasium in Neustadt, das sie
schon aus der eigenen Schulzeit kennt, damals noch als reines
Mädchen-Gymnasium. Jutta Kruppenbacher stammt aus
Neustadt-Diedesfeld, wohnt heute in Kirrweiler, ist verheiratet und
Mutter von zwei erwachsenen Kindern.
Die Maria-Ward-Schule in Landau ist die einzige katholische
Schule in der Pfalz, die sich in direkter Trägerschaft des Bistums
Speyer befindet. Im Jahr 1858 gegründet, vereint sie heute ein
Gymnasium und eine Realschule. Aktuell besuchen rund 1.200
Schülerinnen die als reine Mädchenschule geführte Einrichtung.
Schwerpunkte des Bildungs- und Unterrichtsangebots sind die
Naturwissenschaften und der musikalische Bereich. Text und
Foto: is
07.07.2017
Bistum Speyer veröffentlicht Video zum „Glaubensfeuer“ im Speyerer Dom

Spektakuläre Licht-Klang-Installation wurde anlässlich des
200-jährigen Jubiläums der Neugründung gezeigt – Begeisterte
Reaktionen der Besucherinnen und Besucher
Speyer- Das Bistum Speyer veröffentlicht ein
Video, das die an Pfingsten im Speyerer Dom gezeigte
Licht-Klang-Installation „Glaubensfeuer“ dokumentiert. „Die
Resonanz der Zuschauerinnen und Zuschauer war überwältigend. Mit
dem Video bieten wir die Möglichkeit, sich dieses herausragende
Erlebnis noch einmal vor Augen zu führen“, erklärt der Speyerer
Generalvikar Dr. Franz Jung.
 Das
„Glaubensfeuer“ kombinierte biblische Texte, Lichteffekte,
Farbstimmungen und Musik. Im Mittelpunkt der knapp einstündigen
Präsentation standen die christlichen Symbole Wasser, Licht und
Feuer. „Die Menschen erlebten den Kirchenraum mit allen Sinnen auf
eine neue, ungewöhnliche und unerwartete Weise“, so Generalvikar
Jung.
Das
„Glaubensfeuer“ kombinierte biblische Texte, Lichteffekte,
Farbstimmungen und Musik. Im Mittelpunkt der knapp einstündigen
Präsentation standen die christlichen Symbole Wasser, Licht und
Feuer. „Die Menschen erlebten den Kirchenraum mit allen Sinnen auf
eine neue, ungewöhnliche und unerwartete Weise“, so Generalvikar
Jung.
Entwickelt wurde das „Glaubensfeuer“ vom Bistum Mainz in
Zusammenarbeit mit dem Licht- und Mediadesigner Thomas Gerdon, der
schon mehrfach für große Fernsehproduktionen gearbeitet hat und
auch international tätig ist. Für die Präsentation kamen über 250
computergesteuerte LED Moving-Lights und 4.000 Meter Kabel zum
Einsatz. Hochleistungs-Flammenwerfer, Flammenfächer,
Video-Großbildprojektionen und eine eigens für den Dom konzipierte
Beschallungsanlage sorgten für aufsehenerregende Effekte. Das
Interesse im Rahmen des Bistumsjubiläums war so groß, dass binnen
kurzer Zeit alle Einlassbändchen vergeben waren. Am Pfingstsonntag
wurde daher noch kurzfristig eine weitere Aufführung um Mitternacht
angeboten.
Das Video zum „Glaubensfeuer“ hat eine Länge von acht Minuten.
Es zeigt den Aufbau wie auch die Aufführungen im Speyerer Dom.
Besucher schildern im Vorfeld ihre Erwartungen und berichten
anschließend von ihren Eindrücken. Produziert wurde das Video von
der bei Worms ansässigen Agentur „medienproduktion 2.0“ im Auftrag
des Bistums Speyer.
Die Installation „Glaubensfeuer“ im Video: https://youtu.be/RxFviwdVDKA
Weitere Videos, Berichte und Fotos zum
Bistumsjubiläum:
https://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4158&cHash=35b9034ad84190c00d9e37eef261bf41
Text: is; Foto: „Bistum Speyer / Klaus Landry“
06.07.2017
Pilgerreise des Bistums Speyer nach Lourdes im September
-01.jpg) Eines der größten Marienheiligtümer der Welt –
Buswallfahrt als „pilger“-Leserreise
Eines der größten Marienheiligtümer der Welt –
Buswallfahrt als „pilger“-Leserreise
Speyer- Der berühmte Marienwallfahrtsort
Lourdes ist Ziel einer Wallfahrt des Bistums Speyer vom 23. bis 27.
September als Flugwallfahrt und vom 21. bis 28. September als
Buswallfahrt. Vor Ort absolvieren beide Gruppen gemeinsam das
Programm.
In der Nähe der Grotte von Massabielle erschien die weiße Frau,
die sich als „Unbefleckte Empfängnis“ zu erkennen gab, insgesamt 18
Mal dem jungen Hirtenmädchen Bernadette Soubirous. Während einer
dieser Erscheinungen wurde eine Quelle in der Grotte freigelegt.
Bernadette erhielt den Auftrag, „den Priestern zu sagen, hier eine
Kapelle zu bauen und dass man hierher in Prozessionen kommen
solle“. Bereits 1862 wurden ihre Erscheinungen von Ortsbischof
Laurence anerkannt. 1891 erkannte auch Papst Leo XIII die
Erscheinungen offiziell an. Die Seligsprechung Bernadettes erfolgte
am 14. Juni 1925, ihre Heiligsprechung am 8. Dezember 1933. Bereits
zu ihren Lebzeiten begann die Verehrung Bernadettes.
Inzwischen reisen Jahr für Jahr mehrere Millionen Pilger,
darunter auch Zehntausende Kranke und Behinderte, in den rund 16000
Einwohner zählenden Ort. Dem Wasser aus der Quelle nahe der
Mariengrotte werden heilende Kräfte zugeschrieben. 30000 Heilungen
soll es bislang gegeben haben; 6000 sind dokumentiert, 2000 gelten
als „medizinisch unerklärlich“. 67 hat die katholische Kirche als
Wunder anerkannt. Pilger, die nach Lourdes kommen, können jeden Tag
an einem umfangreichen Wallfahrtsprogramm teilnehmen. So findet
bereits seit dem Jahr 1872 täglich um 21 Uhr eine Lichterprozession
statt, bei der der Rosenkranz gebetet wird. Weitere Angebote sind
Heilige Messen, eucharistische Anbetungen, Krankensalbungen,
Kreuzwege sowie Beichtgelegenheiten.
Die Pilger, die mit dem Bus reisen, legen auf dem Hinweg einen
Zwischenstopp in Ars ein, wo Pfarrer Jean-Marie Vianney lebte, auf
der Rückreise macht die Pilgergruppe Station in Nevers am Grab der
heiligen Bernadette. Im Kloster St. Gildard, wo die Heilige lebte,
feiern die Pilger den Abschlussgottesdienst der Pilgerreise.
Ansonsten ist das Pilger-Programm der Bus- und Flug-Pilger
identisch: In der Erscheinungsgrotte von Massabielle feiern die
Teilnehmer gemeinsam einen Gottesdienst. Im alten Lourdes wandeln
sie auf den Spuren der Heiligen, besuchen ihr Geburtshaus, das
„Cachot“, ein früheres Gefängnis, in dem die Familie Soubirous aus
Armut über ein Jahr lebte. Die Pfarrkirche und das Hospiz sind
weitere Stationen des Rundgangs.-01.jpg)
Im Heiligen Bezirk besuchen die Pilger außerdem die
Erscheinungsgrotte und die drei übereinanderliegenden Kirchen und
nehmen an einer Sakramentsprozession durch den Heiligen Bezirk
teil. In der unterirdischen Basilika St. Pius X., die Platz für
25000 Besucher bietet, erleben die Pilger bei einer Internationalen
Messe mit Gläubigen von allen Kontinenten Weltkirche hautnah. Auf
dem Kalvarienberg betet man gemeinsam den Kreuzweg. An allen
Abenden besteht die Möglichkeit, an den beeindruckenden
Lichterprozessionen teilzunehmen. Zudem bietet die Pilgerreise auch
Raum, um den Marienerscheinungsort ganz für sich selbst zu
entdecken.
Begleitet wird die Wallfahrt erneut von Pfarrer Raymond Rambaud,
Klinikseelsorger in Homburg-Die Busreise, die in diesem Jahr eine
der beliebten „pilger“-Leserreisen ist, geht ab/bis Ludwigshafen,
Speyer, Kaiserslautern und Homburg und kostet bei Übernachtung im
Doppelzimmer inklusive Vollpension in Lourdes und Halbpension in
den anderen Orten ab 798 Euro (Einzelzimmerzuschlag ab 225 Euro).
Die Flugreise mit einer Chartermaschine ab/bis Saarbrücken-Ensheim
kostet ab 789 Euro (Einzelzimmerzuschlag ab 136 Euro). Text:
Bistum Speyer; Foto:spk-Archiv
Weitere Informationen und Anmeldung:
Pilgerbüro Speyer
Telefon 06232/102423
info@pilgerreisen-speyer.de
06.07.2017
Feierlicher Abschied vor den Augen der Welt

Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann: „Das befruchtende
Zueinander des Politikers und des gläubigen Christen hat Helmut
Kohl zu einem herausragenden Staatsmann gemacht“
Speyer- Mit einem feierlichen Requiem im
Speyerer Dom haben Angehörige, Freunde, Politiker, Weggefährten und
Öffentlichkeit Abschied von Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl
genommen. „Die große Zahl hochrangiger Gäste aus aller Welt, die
zum europäischen Trauerakt nach Straßburg und nun zum Requiem
gekommen sind, zeigt die herausragende Bedeutung seiner Verdienste
um Deutschland und Europa, ja um Versöhnung und Frieden in
 der Welt an. Wir nehmen Abschied von einem wahrhaft
großen Staatsmann, der seine pfälzische Heimat und sein deutsches
Vaterland liebte und aus einem weiten, universalen Horizont heraus
lebte und handelte“, würdigte der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann die politische Lebensleistung Helmut Kohls. Er feierte
das Requiem gemeinsam mit dem Apostolischen Nuntius in Deutschland
Erzbischof Nikola Eterović, dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising, Reinhard
Kardinal Marx, Friedrich Kardinal Wetter (Bischof von Speyer von
1968 bis 1982), Bischof em. Dr. Anton Schlembach (Bischof von
Speyer von 1983 bis 2007) und Weihbischof Otto Georgens.
der Welt an. Wir nehmen Abschied von einem wahrhaft
großen Staatsmann, der seine pfälzische Heimat und sein deutsches
Vaterland liebte und aus einem weiten, universalen Horizont heraus
lebte und handelte“, würdigte der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann die politische Lebensleistung Helmut Kohls. Er feierte
das Requiem gemeinsam mit dem Apostolischen Nuntius in Deutschland
Erzbischof Nikola Eterović, dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising, Reinhard
Kardinal Marx, Friedrich Kardinal Wetter (Bischof von Speyer von
1968 bis 1982), Bischof em. Dr. Anton Schlembach (Bischof von
Speyer von 1983 bis 2007) und Weihbischof Otto Georgens.
„Wir nehmen Abschied von einem Menschen mit allem, was
Menschsein in Kraft und in Schwäche bedeutet. Uns berührt und
erschüttert das Große wie auch das nach Erlösung Rufende, das
diesen Tod umgibt. Wir legen es in Gottes Hände“, sagte Bischof
Wiesemann in der Predigt. Der Speyerer Dom sei für Helmut Kohl ein
Symbol gewesen für das, was ihm im Leben wichtig war, „die
Verschmelzung tiefer Heimatverwurzelung mit dem großen Atem der
Geschichte, mit den weiten Bögen geistiger, kultureller und
religiöser Zusammengehörigkeit Europas.“ Patriot und Europäer zu
sein, seien für Helmut Kohl zwei Seiten ein und derselben Medaille
gewesen.
 „Die deutsche Einheit, fest eingebunden in die Europäische
Gemeinschaft, wird zu Recht immer mit Helmut Kohls Namen verbunden
bleiben“, so der Bischof. Das „Zusammentreffen der Gunst der Stunde
mit dem Menschen, der sie ergreift“ sei das „Geheimnis der
Geschichte“. Helmut Kohl sei in den Speyerer Dom immer auch als
Beter gekommen. Das „befruchtende Zueinander des Politikers und des
gläubigen Christen“ habe Helmut Kohl zu einem herausragenden
Staatsmann und zu einer weltweit geachteten Persönlichkeit werden
lassen. Den Gottesdienst feierte Bischof Wiesemann in „ökumenischer
Verbundenheit und in Verbundenheit mit allen Menschen, gleich
welcher Religion oder Weltanschauung, die Anteil nehmen am Tod von
Helmut Kohl und ihrer Dankbarkeit Ausdruck verleihen wollen,
insbesondere für das große Geschenk der deutschen Einheit.“
„Die deutsche Einheit, fest eingebunden in die Europäische
Gemeinschaft, wird zu Recht immer mit Helmut Kohls Namen verbunden
bleiben“, so der Bischof. Das „Zusammentreffen der Gunst der Stunde
mit dem Menschen, der sie ergreift“ sei das „Geheimnis der
Geschichte“. Helmut Kohl sei in den Speyerer Dom immer auch als
Beter gekommen. Das „befruchtende Zueinander des Politikers und des
gläubigen Christen“ habe Helmut Kohl zu einem herausragenden
Staatsmann und zu einer weltweit geachteten Persönlichkeit werden
lassen. Den Gottesdienst feierte Bischof Wiesemann in „ökumenischer
Verbundenheit und in Verbundenheit mit allen Menschen, gleich
welcher Religion oder Weltanschauung, die Anteil nehmen am Tod von
Helmut Kohl und ihrer Dankbarkeit Ausdruck verleihen wollen,
insbesondere für das große Geschenk der deutschen Einheit.“
Zur musikalischen Gestaltung trugen der Domchor Speyer, die
Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz und Domorganist Markus
Eichenlaub bei. Sie brachten Stücke von Komponisten aus Frankreich,
England, Russland, Österreich und Deutschland zum Erklingen, die
symbolhaft für den europäischen Gedanken stehen. Im Dom waren rund
900 geladene Gäste anwesend. Rund 2.500 Menschen feierten den
Gottesdienst im südlichen Domgarten mit, wohin die Messe mit einer
Bildschirmleinwand übertragen wurde. Der SWR übertrug den
Gottesdienst aus dem Speyerer Dom auf Fernsehschirme in aller Welt.
Besonders eindrucksvoll gestaltete sich der Auszug, als der Sarg
Helmut Kohls von Soldaten der Bundeswehr durch das Mittelschiff des
Domes, begleitet vom Läuten der Totenglocke, auf den Domplatz
getragen wurde.
Weitere Informationen:
https://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4373&cHash=8631fe5bac4b121b24b6295002500aa6
Text und Foto: Bistum Speyer; Fotograf: Klaus
Landry
02.07.2017
Abschied vor den Augen der Welt - Bilderalbum
Erzieher und Sozialassistenten feiern Examen
 Die Erzieherinnen und Erzieher mit Lehrkräften und Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter (vorn links).
Die Erzieherinnen und Erzieher mit Lehrkräften und Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter (vorn links).
Speyer- Für 104 Schülerinnen und Schüler der
Diakonissen Fachschule für Sozialwesen gab es in dieser Woche Grund
zu feiern: Sie schlossen erfolgreich ihre Ausbildung in den
Bildungsgängen Sozialpädagogik und Höhere Berufsfachschule
Sozialassistenz ab.
83 Erzieherinnen und Erzieher haben am 28. Juni ihre Examen an
der Diakonissen Fachschule für Sozialwesen gefeiert, bereits zwei
Tage zuvor erhielten 21 staatlich geprüfte Sozialassistentinnen und
–assistenten ihre Zeugnisse. Acht von ihnen haben zugleich ihre
Fachhochschulreife erlangt.
Einen anspruchsvollen Beruf hätten sie sich ausgesucht, betonte
Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter anlässlich der Abschlussfeiern
im Diakonissen-Mutterhaus: „Einen Beruf, der ein großes Feld
abdeckt von den Kleinsten, der Kindertagesstätte, über die
Ganztagsschule, die Kinder- und Jugendhilfe bis zu Menschen mit
sozialpädagogischem Förderbedarf.“ 18 Absolventinnen und
Absolventen der Erzieherausbildung hatten die Gelegenheit genutzt,
die ebenso anspruchsvolle Ausbildung berufsbegleitend
durchzuführen. Sie hätten sich aber auch einen schönen Beruf
ausgesucht, so Kreiter: „Die gute  Entwicklung, das Wachsen von Menschen zu
selbstbewussten, geliebten und wertgeschätzten Individuen ist eine
zentrale Aufgabe Ihres Berufes.“ Erzieher und Sozialassistenten
hätten davon profitiert, dass in der Diakonissen Fachschule für
Sozialwesen als kirchlicher Privatschule der Wert von Bildung für
den Menschen in seiner Ganzheit, seinem Körper, seinem Geist und
seiner Seele gelebt werde, sagte Kreiter auch mit Blick auf die
guten Voraussetzungen, die der Träger geschaffen habe.
Entwicklung, das Wachsen von Menschen zu
selbstbewussten, geliebten und wertgeschätzten Individuen ist eine
zentrale Aufgabe Ihres Berufes.“ Erzieher und Sozialassistenten
hätten davon profitiert, dass in der Diakonissen Fachschule für
Sozialwesen als kirchlicher Privatschule der Wert von Bildung für
den Menschen in seiner Ganzheit, seinem Körper, seinem Geist und
seiner Seele gelebt werde, sagte Kreiter auch mit Blick auf die
guten Voraussetzungen, die der Träger geschaffen habe.
Für den Träger sprach Oberin Sr. Isabelle Wien. Sie überbrachte
Glückwünsche des Vorstands der Diakonissen Speyer-Mannheim und wies
auf die drei Ursprungssäulen der Mutterhausdiakonie Erziehung,
Bildung und Pflege hin, „auf die auch Sie aufgebaut haben.“ Sie
wünsche sich, so Wien, dass im Unterricht neben Wissen auch eine
Haltung fürs Leben vermittelt worden sei.
Für herausragende Leistungen erhielten je drei Schüler
Auszeichnungen des Fördervereins der Fachschule. Deren neue
Vorsitzende Dr. Ute Gehrke nutzte die Gelegenheit, für eine
Mitgliedschaft zu werben: Sie sei eine gute Möglichkeit, um auch
nach dem Abschluss mit der Schule im Kontakt zu bleiben und
zugleich künftige Schülergeneration zu fördern. Text und Foto:
Diakonissen Speyer-Mannheim
Informationen zur Ausbildung: www.diakonissen.de
30.06.2017
Diakonissen kooperieren mit Realschule Plus Dudenhofen
 v.l.: Christiane Langner-Feith, Klaus-Dieter Schneider, Claudia Berger, Michael Wendelken
v.l.: Christiane Langner-Feith, Klaus-Dieter Schneider, Claudia Berger, Michael Wendelken
Weitere Kooperation der Diakonissen Speyer-Mannheim zur
Fachkräftegewinnung
Speyer/Dudenhofen- Um Fachkräfte im
Pflegebereich zu gewinnen, kooperieren die beiden Speyerer
Diakonissen Seniorenzentren Haus am Germansberg und Seniorenstift
Bürgerhospital mit der Realschule Plus Dudenhofen. Am 28. Juni
unterzeichneten sie einen entsprechenden Vertrag.
„Ein Berufsorientierungspraktikum zeigt die Vielseitigkeit des
Pflegeberufs und unterstützt die Schüler bei ihrer Berufswahl,
indem sie erste Kontakte zu Bewohnern und dem Alltag in einer
Pflegeeinrichtung erhalten“, erklärt Christiane Langner-Feith,
Verantwortliche für Berufsorientierung bei der Realschule Plus
Dudenhofen. Neben gemeinsamen Projekten in Schule und
Altenpflegeeinrichtungen könne man besonders geeigneten Schülern am
Ende der neunten Klasse sogar eine Ausbildungsplatzgarantie
anbieten, unterstreicht Klaus-Dieter Schneider, Einrichtungsleiter
der beiden Speyerer Seniorenzentren: „Das gilt für Schülerinnen und
Schüler, die definierte Bedingungen wie etwa ein mit gut
beurteiltes Praktikum in unseren Einrichtungen, gute bis
befriedigende Noten und soziales Engagement erfüllen.“
In einem zweiwöchigen Praktikum erhalten bis zu acht Schüler die
Möglichkeit, mit einem festen Ansprechpartner über
Zugangsvoraussetzungen und Entwicklungschancen im Pflegeberuf zu
sprechen und sich auszutauschen. „Wir möchten ein spannendes und
abwechslungsreiches Praktikum bieten, in dem die Schüler
feststellen können, ob ein innovativer und krisenfester Beruf in
der Pflege etwas für sie sein könnte“, sagt Michael Wendelken,
Leiter der Abteilung Personalentwicklung bei den Diakonissen
Speyer-Mannheim. „Wir hoffen, dass unsere Schüler mit einer
konkreten Idee noch motivierter sind“, ergänzt Claudia Berger,
Rektorin der Realschule Plus Dudenhofen.
Die Diakonissen Speyer-Mannheim haben schon gute Erfahrungen mit
ähnlichen Schul-Kooperationen: Bereits seit drei Jahren arbeitet
das Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer mit dem
Edith-Stein-Gymnasium und dem Schwerd-Gymnasium zusammen, um
Schülerinnen und Schüler bei der Berufsorientierung zu unterstützen
und ihnen berufliche Optionen im Bereich der Pflege zu erläutern.
Seit einigen Wochen kooperiert in einem vergleichbaren Projekt auch
das Mannheimer Diakonissenkrankenhaus mit einer Schule vor Ort.
Diakonissen Speyer-Mannheim
Die Diakonissen Speyer-Mannheim sind ein sozialdiakonisches
Unternehmen, das mit etwa 4.500 Mitarbeitenden Krankenhäuser,
Seniorenzentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kinder
und Jugendliche sowie Schulen und ein Hospiz betreibt.
Das Unternehmen steht in der Tradition der
Diakonissenmutterhäuser und betreibt seine Einrichtungen in
mehreren Orten in Rheinland-Pfalz sowie in Mannheim und Homburg/
Saarland. Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
29.06.2017
Kondolenzbuch jetzt im Friedrich-Spee-Haus
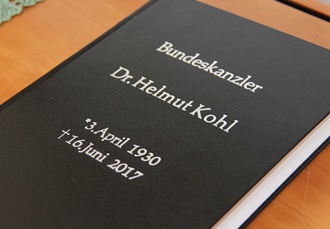 Speyer- Das
Kondolenzbuch des Bistums Speyer für Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut
Kohl liegt ab Donnerstag, den 29. Juni, im Friedrich-Spee-Haus in
Speyer aus. Im Foyer des Pfarrbüros der Dompfarrei Pax Christi
haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Gefühle und Gedanken
angesichts des Todes von Helmut Kohl in Worte zu fassen.
Speyer- Das
Kondolenzbuch des Bistums Speyer für Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut
Kohl liegt ab Donnerstag, den 29. Juni, im Friedrich-Spee-Haus in
Speyer aus. Im Foyer des Pfarrbüros der Dompfarrei Pax Christi
haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Gefühle und Gedanken
angesichts des Todes von Helmut Kohl in Worte zu fassen.
Das Kondolenzbuch war seit dem 19. Juli im Speyerer Dom, der
seit Mittwoch, den 27. Juni, für die Vorbereitung des Requiems am
kommenden Samstag geschlossen ist. Viele Menschen haben in den
vergangenen Tagen in das Kondolenzbuch geschrieben. Der Dank für
die Deutsche Einheit und die Bewahrung des Friedens in Europa sind
Themen, die dabei besonders häufig anklingen.
Das Friedrich-Spee-Haus liegt am Edith-Stein-Platz 6-7 auf der
Nordseite des Domes. Es ist am Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von
16 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag können sich Interessierte
zwischen 10 und 12 Uhr in das Kondolenzbuch eintragen. Text und
Foto: is
28.06.2017
Carsten Leinhäuser im Amt des BDKJ-Diözesanpräses bestätigt
 BDKJ-Diözesanversammlung (Gruppenbild))
BDKJ-Diözesanversammlung (Gruppenbild))
Diözesanversammlung des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) wählt gebürtigen Saarpfälzer erneut an die Spitze der
katholischen Jugend | Inhaltliche Schwerpunkte der
Versammlung: Beschlüsse zu Tourbus-Projekt, Beteiligung
an Jugendsynode und Sozialaktion 2019
(Homburg/Speyer- Carsten Leinhäuser ist
auf der Diözesanversammlung des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) in Homburg/Saar erneut an die Spitze des
Dachverbandes der katholischen Kinder- und Jugendverbände gewählt
worden. Leinhäuser ist Pfarrer und in Personalunion sowohl
BDKJ-Diözesanpräses als auch Leiter der Abteilung Jugendseelsorge
des Bischöflichen Ordinariates. Der gebürtige Saarpfälzer lebt in
Waldsee und kandidierte nach 2014 nun zum zweiten Mal für den
BDKJ-Diözesanvorstand. Die Diözesanversammlung sprach dem
38-jährigen das Vertrauen aus. Die Versammlung ist das höchste
beschlussfassende Gremium des BDKJ Speyer.
Inhaltliche Arbeit - Beschlüsse zu Tourbus-Projekt,
Beteiligung an Jugendsynode und Sozialaktion 2019
Die Delegierten aus den Dekanaten und Mitgliedsverbänden
stimmten über eine Beteiligung an der von Papst Franziskus
initiierten Befragung der Jugend zu kirchlichen Themen ab. In den
kommenden Wochen wird die vom Vatikan veröffentlichte
Online-Umfrage zu Jugendthemen auch in einer offiziellen deutschen
Version abrufbar sein. Der BDKJ Speyer wird dann vielfältige
Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche sowohl in als auch über
die Verbände hinaus ermöglichen. "Im Herbst 2018 wird die
Bischofssynode zum Thema "Die Jugendlichen, der Glaube und die
Berufungsunterscheidung" stattfinden", erklärt Leinhäuser die
Hintergründe: "Papst Franziskus bittet deshalb Jugendliche aus der
ganzen Welt um Rückmeldungen, Wünsche und Kritik. Der BDKJ Speyer
wird dabei sein: Wir laden Jugendliche ein, an der Umfrage zur
Synode teilzunehmen. Außerdem folgen wir der Einladung des Papstes
und treffen uns am Weltjugendtag (Palmsonntag) 2018 mit
Jugendlichen und Bischof Wiesemann, um gemeinsam über die
Herzensanliegen junger Menschen ins Gespräch zu kommen." Die
digitale Umfrage soll durch Diskussionsformate unterstützt werden,
um die Themen der Jugendlichen im Bistum Speyer möglichst umfassend
nach Rom übermitteln zu können.
 Andere Orte möchte der BDKJ Speyer in den kommenden zwei
Jahren auch mit dem Tourbus erreichen. Die Versammlung beschloss
ein entsprechendes Projekt, das mit einem mobilen Angebot die
Themen der Jugendverbände an ungewohnte Orte bringen wird. Der Bus
wird mit Material zu politische Themen, aber auch Fragen zu Gott
und Welt unterwegs auf Festivals und Großveranstaltungen, vor Kinos
und in Fußgängerzonen sein. Er wird von einem Planungsteam und
Jugendlichen aus den Verbänden betreut werden. So besteht für jeden
der sieben Mitgliedsverbände auch die Möglichkeit, das je eigene
Verbandsprofil deutlich zu machen. Der Tourbus soll spielerisch
Einblick insbesondere in die politische Arbeit des BDKJ geben. Eine
digitale Vernetzung der Tourbusangebote mit den
Social-Media-Plattformen der Jugendverbände ist angedacht. So soll
gewährleistet werden, dass das regionale Angebot des Tourbus auch
eine überregionale Beteiligung ermöglicht. Leinhäuser fasst die
Projektidee zusammen: "Mit dem bunten BDKJ-Tourbus werden wir
in den nächsten beiden Jahren quer durch die Pfalz und das Saarland
tingeln. Ziel ist es, den BDKJ und die Jugendverbände zu Kindern
und Jugendlichen zu bringen - zu den Orten, wo sie sich aufhalten
und wohlfühlen."
Andere Orte möchte der BDKJ Speyer in den kommenden zwei
Jahren auch mit dem Tourbus erreichen. Die Versammlung beschloss
ein entsprechendes Projekt, das mit einem mobilen Angebot die
Themen der Jugendverbände an ungewohnte Orte bringen wird. Der Bus
wird mit Material zu politische Themen, aber auch Fragen zu Gott
und Welt unterwegs auf Festivals und Großveranstaltungen, vor Kinos
und in Fußgängerzonen sein. Er wird von einem Planungsteam und
Jugendlichen aus den Verbänden betreut werden. So besteht für jeden
der sieben Mitgliedsverbände auch die Möglichkeit, das je eigene
Verbandsprofil deutlich zu machen. Der Tourbus soll spielerisch
Einblick insbesondere in die politische Arbeit des BDKJ geben. Eine
digitale Vernetzung der Tourbusangebote mit den
Social-Media-Plattformen der Jugendverbände ist angedacht. So soll
gewährleistet werden, dass das regionale Angebot des Tourbus auch
eine überregionale Beteiligung ermöglicht. Leinhäuser fasst die
Projektidee zusammen: "Mit dem bunten BDKJ-Tourbus werden wir
in den nächsten beiden Jahren quer durch die Pfalz und das Saarland
tingeln. Ziel ist es, den BDKJ und die Jugendverbände zu Kindern
und Jugendlichen zu bringen - zu den Orten, wo sie sich aufhalten
und wohlfühlen."
Der Diözesanverband Speyer wird 2019 wieder an der bundesweiten
Sozialaktion des BDKJ teilnehmen. Die "72-Stundenaktion", bei der
Verbandsgruppen innerhalb von drei Tagen ein soziales Projekt
umsetzen, wird vom 23. bis 26. Mai 2019 stattfinden. Die
bundesweite Aktion fand zuletzt 2013 statt.
Zwei vakante Vorstandsstellen konnten nicht besetzt werden, da
keine Kandidatinnen und Kandidaten zur Verfügung standen.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer ist
Dachverband von sieben Kinder- und Jugendverbänden im Bistum
Speyer. Er vertritt die Interessen von 7.500 Mitgliedern in Kirche,
Politik und Gesellschaft. www.bdkj-speyer.de
Text und Foto: BDKJ Speyer
25.06.2017
Bischöfe freuen sich über Weinzehnt aus Kirrweiler
 Gemeinsames Anstoßen mit Weihbischof Otto Georgens (links außen), Bischof Karl-Heinz Wiesemann (Zweiter von links), Weinprinzessin Janine I., Kirrweiler (Mitte) Pfarrer Peter Nirmaier und Kirrweilers Bürgermeister Rolf Metzger (ganz rechts).
Gemeinsames Anstoßen mit Weihbischof Otto Georgens (links außen), Bischof Karl-Heinz Wiesemann (Zweiter von links), Weinprinzessin Janine I., Kirrweiler (Mitte) Pfarrer Peter Nirmaier und Kirrweilers Bürgermeister Rolf Metzger (ganz rechts).
Delegation aus der Südpfalz bringt Weingeschenk nach
Speyer
Speyer- Eine besondere Überraschung haben
die Kirrweiler bei der diesjährigen Weinzehnt-Übergabe geboten.
Kaum war das Gefolge aus der Südpfalz mit Kutsche und Blaskapelle
am Dom eingetroffen, tönte es laut aus dem Domnapf: "Herbei ihr
Leut! Kommt herbei!" Der Kirrweiler Georg Weis war in die Rolle des
Verwalters des göttlichen Weinkellers geschlüpft und hatte unter
anderem gute Ratschläge für Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und
Weihbischof Otto Georgens parat. Sie sollten im kommenden Jahr für
gutes Wetter sorgen, denn sonst bliebe ihr Weinkeller leer, mahnte
der "Verwalter". Trotz eines schwierigen Weinjahrs 2016 konnten
sich Wiesemann und Georgens über jeweils 136 Flaschen freuen – wie
immer Grauburgunder.
Die Kirrweiler waren wie gewohnt mit einem großen Gefolge nach
Speyer gezogen. Nicht nur Mitglieder des Gemeinderates, der Vereine
und Weinbrüder begleiteten Bürgermeister Rolf Metzger, sondern wie
gewohnt auch die Weinprinzessin, die dieses Mal Janine I. heißt.
Mit dabei war ebenfalls der neue Kirrweiler Pfarrer Peter Nirmaier,
der durch seine eine historische Pfarrerskleidung in der Menge
herausstach.
 Auf die Historie Kirrweilers ging Bürgermeister Metzger
in seiner Ansprache ein. Der Ort habe sich in den letzten Jahren
stark auf seine Geschichte besonnen, erklärte er. Dazu gehöre auch
der Weihnzehnt, den die Kirrweiler vom Mittelalter bis 1793 dem
Bischof von Speyer ablieferten. Denn der südpfälzische Ort war bis
dahin Sommerresidenz der Fürstbischöfe und noch immer besteht hier
ein bischöflicher Weinberg. Nachdem das Bistum Speyer 1817 neu
begründet wurde, gab es zunächst keine Weinzehnt-Abgabe, bei der
dem bischöflichen Landesherrn ein Zehntel des Weinertrages
abgeliefert werden musste. Erst vor sieben Jahren belebten die
Kirrweiler die Tradition anlässlich des 950. Domweihe-Jubiläums
neu. Von da an handele es sich um eine freiwillige Abgabe, betonte
Metzger.
Auf die Historie Kirrweilers ging Bürgermeister Metzger
in seiner Ansprache ein. Der Ort habe sich in den letzten Jahren
stark auf seine Geschichte besonnen, erklärte er. Dazu gehöre auch
der Weihnzehnt, den die Kirrweiler vom Mittelalter bis 1793 dem
Bischof von Speyer ablieferten. Denn der südpfälzische Ort war bis
dahin Sommerresidenz der Fürstbischöfe und noch immer besteht hier
ein bischöflicher Weinberg. Nachdem das Bistum Speyer 1817 neu
begründet wurde, gab es zunächst keine Weinzehnt-Abgabe, bei der
dem bischöflichen Landesherrn ein Zehntel des Weinertrages
abgeliefert werden musste. Erst vor sieben Jahren belebten die
Kirrweiler die Tradition anlässlich des 950. Domweihe-Jubiläums
neu. Von da an handele es sich um eine freiwillige Abgabe, betonte
Metzger.
Die Kirrweiler Ortsgeschichte ist auch Inhalt eines
Theaterspaziergangs, der seit letztem Jahr und noch bis zum
September durch und um den Weinort führt. Die Szene, die Georg Weis
darbot, stammt aus diesem Stück, wobei er die Rolle für die
Weinzehnt-Übergabe ein wenig abgeändert hatte. "Der Auftritt war
eine sehr spontane Idee", verriet er.
Bischof Wiesemann bedankte sich herzlich für den Tropfen und
versicherte: "Wir nehmen den Wein nicht für uns persönlich, sondern
er wird bei besonderen Anlässen ausgeschenkt." Dadurch werde der
Weinzehnt vielen Menschen Freude bereiten. Weihbischof Georgens
hatte wie immer ein  blaues Winzerhemd übergestreift und gab ausgesuchte Zeilen
zum Besten. Dabei warf er wie Bürgermeister Metzger einen Blick in
die Geschichte und zitierte aus der Wein-Epistel von Pfarrer Carl
Theodor Schultz, die dieser 1964 für seine Kirrweiler Winzer
geschrieben hatte. Mit dem Zitat verdeutlichte Georgens, wie die
Bibel den Wein huldigt, aber auch zum maßvollen und bewussten
Genuss mahnt. Daran schloss er ein französisches Gebet des Winzers
an.
blaues Winzerhemd übergestreift und gab ausgesuchte Zeilen
zum Besten. Dabei warf er wie Bürgermeister Metzger einen Blick in
die Geschichte und zitierte aus der Wein-Epistel von Pfarrer Carl
Theodor Schultz, die dieser 1964 für seine Kirrweiler Winzer
geschrieben hatte. Mit dem Zitat verdeutlichte Georgens, wie die
Bibel den Wein huldigt, aber auch zum maßvollen und bewussten
Genuss mahnt. Daran schloss er ein französisches Gebet des Winzers
an.
Bürgermeister Metzger bedauerte, dass 2016 ein schwieriges Jahr
für den Wein war mit viel Nässe und Pilzbefall. Dennoch umfasst der
Weinzehnt insgesamt 272 Flaschen. Der Wein stammt in diesem Jahr
vom Weingut Schlössel, das bei der Verkostung durch Fachleute des
DLR (Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum) in Neustadt ausgewählt
wurde. Kirrweiler Winzer können sich mit ihren Tropfen für den
Weinzehnt bewerben. Die Trauben seien am 10. Oktober 2016 gelesen
worden, es handele sich um eine Spätlese trocken, fruchtig mit
wenig Säure, erläuterte Metzger den Bischöfen, bevor sie die
Schenkungsurkunde unterzeichneten. Anschließend stießen alle
miteinander an – selbstverständlich mit dem Weinzehnt-Wein, ehe die
Bischöfe mit den zahlreichen Schaulustigen plauderten. Für
Stimmung, die manche sogar schunkeln ließ, sorgten die St. Martiner
Weinschlauchdudler, die mit ihrer Blasmusik zum ersten Mal die
Weinzehnt-Übergabe begleiteten. Text: Yvette Wagner; Foto:
pem
24.06.2017
Weinzehnt 2017 am Dom übergeben - Bilderalbum
Im Dom zu Speyer liegt Kondolenzbuch zum Tod von Helmut Kohl aus
 Besucher der Kathedrale können persönlich Abschied nehmen
und ihre Trauer in Worte fassen
Besucher der Kathedrale können persönlich Abschied nehmen
und ihre Trauer in Worte fassen
Speyer- Im Speyerer Dom liegt seit gestern ein
Kondolenzbuch aus, in das sich die Besucherinnen und Besucher der
Kathedrale eintragen und damit persönlich Abschied von
Bundeskanzler Helmut Kohl nehmen können. Dieser ist am Freitag in
seinem Wohnhaus in Ludwigshafen-Oggersheim im Alter von 87 Jahren
gestorben. Mit dem Speyerer Dom verband den gläubigen Katholiken
eine lebenslange intensive Beziehung. In seiner Amtszeit als
Bundeskanzler hatte Kohl zahlreiche ausländische Staatsgäste nach
Speyer geführt, darunter Margaret Thatcher, Michael Gorbatschow,
George Bush, Vaclav Havel, Boris Jelzin und König Juan Carlos. Am
Beispiel des Domes hat er ihnen die Bedeutung des christlichen
Glaubens für ein Zusammenleben in Gerechtigkeit und Frieden in
Deutschland, Europa und der Welt verdeutlicht. Das Kondolenzbuch
liegt im südlichen Seitenschiff des Domes aus. Daneben erinnert ein
Foto an den ehemaligen Bundeskanzler.
„Ich habe Helmut Kohl als beeindruckenden Menschen schätzen
lernen dürfen“, erinnert sich Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann an
Begegnungen mit Helmut Kohl, auch im kleinen Kreis in seinem Haus
in Oggersheim. „Ich durfte mit teilnehmen an seinem
gesundheitlichen Auf und Ab und habe einen Menschen kennengelernt,
der das Leben liebte und auch aus der Kraft seines Glaubens seine
Leiden geduldig trug.“ Heimatliebe und universale Weite
europäischen Geistes, Geschichtsverbundenheit und Atem der
Ewigkeit, in diesem großen Spannungsbogen, für den der Speyrer Dom
ihm zeitlebens das Symbol schlechthin war, habe Helmut Kohl sein
Leben und seinen Auftrag verstanden. „Als ich das letzte Mal Ende
Dezember mit ihm und seiner Gattin im Dom war, konnte er all das
nicht mehr in Worten ausdrücken – in seinen leuchtenden Augen aber
spiegelte es sich wieder. Danach habe ich ihn erst wieder auf dem
Totenbett gesehen. Ich durfte einem großen Menschen begegnen“, so
Bischof Wiesemann. Text und Foto: is
Öffnungszeiten des Domes:
Mo, Mi, Do, Sa 9–19 Uhr
Di + Fr 9–17.30 Uhr
Sonntag 12–17.30 Uhr
20.06.2017
„Wer sich hingibt, wird ganz neu leben“
 Tag
der Freude und des Dankes: Bischof Wiesemann weiht fünf neue
Priester im Speyerer Dom
Tag
der Freude und des Dankes: Bischof Wiesemann weiht fünf neue
Priester im Speyerer Dom
Speyer- Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
hat am Samstag im Kaiser- und Mariendom zu Speyer fünf junge Männer
aus dem Bistum zu Priestern geweiht. Begleitet von zahlreichen
Gläubigen und Vertretern aus allen Seelsorgebereichen der Diözese
sagten Moritz Fuchs (Kaiserslautern), Peter Heinke (Blieskastel),
Thomas Ott (Waldmohr), Dominik Schindler (Homburg) und Matthias
Schmitt (Schifferstadt) Ja zu ihrem Dienst für die Menschen in
ihren zukünftigen Gemeinden.
Das Feuer des Glaubens brenne in diesen Männern, so der Bischof.
Es mache ihn stolz und dankbar, denn die Dynamik, mit der sie das
Evangelium lebten, sei ein fester Grund, auf dem aufgebaut werden
könne. Seine Predigt orientierte sich an dem gemeinsamen Leitwort
der Weihekandidaten aus dem 1. Brief des Apostels Paulus an die
Korinther: "Denn einen anderen Grund kann niemand legen, als den,
der gelegt ist."
Wiesemann stellte den Heiligen Paulus als großen Aufbauer seiner
Gemeinden vor. "Er spricht von sich Veränderndem, sich
Entwickelndem und davon, sich auf neue Herausforderungen
einzulassen", betonte der Bischof. Erwartet werde das auch heute
noch von Priestern. Nicht nur verwalten, sondern bauen, erschaffen,
fortentwickeln sollten diese. "Wer sich hingibt", hob Wiesemann
hervor, "wird ganz neu leben."
 Eben
diese Hingebung drückten die Weihekandidaten aus. Mit fester Stimme
sicherten sie zu, künftig zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs
sein zu wollen. Die jahrelange Vorbereitung auf die Priesterweihe
verdichtete sich schon zu Beginn des Gottesdienstes in einem
deutlich hörbaren "Hier bin ich" der Kandidaten im voll besetzten
Dom. Das Gotteshaus war aus Anlass des Jubeltages mit feierlichen
Fanfarenklängen, innigen Chorälen und klangvollem Orgelspiel
gefüllt.
Eben
diese Hingebung drückten die Weihekandidaten aus. Mit fester Stimme
sicherten sie zu, künftig zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs
sein zu wollen. Die jahrelange Vorbereitung auf die Priesterweihe
verdichtete sich schon zu Beginn des Gottesdienstes in einem
deutlich hörbaren "Hier bin ich" der Kandidaten im voll besetzten
Dom. Das Gotteshaus war aus Anlass des Jubeltages mit feierlichen
Fanfarenklängen, innigen Chorälen und klangvollem Orgelspiel
gefüllt.
Bevor in der Eucharistiefeier das Sanctus und Agnus Dei aus der
Missa "Cum Jubilo" von Maurice Duruflé erklang, durften die
Gläubigen den Riten folgen, die wie die Handauflegung des Bischofs
und der anwesenden Priester zur Weihe gehören: Das Anlegen der
priesterlichen Gewänder - Stola und Messgewand – durch die Pfarrer
der jeweiligen Heimatpfarrei; die Salbung der Hände machte
die besondere Beziehung zu Christus deutlich, der nach der Heiligen
Schrift der "Gesalbte des Vaters" ist. Mit der Übergabe von Brot
und Wein wurde der unersetzbare Auftrag eines Priesters
symbolisiert: die Feier der Eucharistie. Die Umarmung der
Neugeweihten durch den Bischof stand als Zeichen der Verbundenheit
und dem Wunsch für den Frieden Christi am Ende der feierlichen
rituellen Abfolge.
 "Das
ist ein Tag der Freude und des Dankes für unser Bistum", stellte
Wiesemann heraus. Nicht alleine, dass sich junge Männer dem Dienst
Gottes mit brennendem Herzen verschrieben, sondern dass sie dabei
in eine neue, notwendig gewordene Mobilität des Geistes finden
wollten, bezeichnete der Bischof als bewundernswert. "Gott selbst
vollende nun das gute Werk, das er an dir begonnen hat", gab er den
neugeweihten Priestern mit auf den Weg, nachdem diese ihre neue
Aufgabe mit einem deutlichen Ja angenommen hatten.
"Das
ist ein Tag der Freude und des Dankes für unser Bistum", stellte
Wiesemann heraus. Nicht alleine, dass sich junge Männer dem Dienst
Gottes mit brennendem Herzen verschrieben, sondern dass sie dabei
in eine neue, notwendig gewordene Mobilität des Geistes finden
wollten, bezeichnete der Bischof als bewundernswert. "Gott selbst
vollende nun das gute Werk, das er an dir begonnen hat", gab er den
neugeweihten Priestern mit auf den Weg, nachdem diese ihre neue
Aufgabe mit einem deutlichen Ja angenommen hatten.
Im Anschluss an den Weihegottesdienst blieb Raum zum
persönlichen Austausch mit den Neu-Priestern auf dem Gelände des
Priesterseminars. Alle fünf feierten am Sonntagmorgen ihre Primiz
in ihren Heimatgemeinden. Den ersten Segen hatten sie bereits im
Dom spenden dürfen.
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes lag in Händen von
Domorganist Markus Eichenlaub, den Dombläsern sowie den
Männerstimmen des Domchores unter der Leitung von Domkapellmeister
Markus Melchiori und Domkantor Joachim Weller. Text: Susanne
Kühner; Fotos: Klaus Landry
18.06.2017
Ein Zeugnis für den Glauben
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann trägt bei der Fronleichnamsprozession durch die Speyerer Innenstadt die Monstranz mit dem Allerheiligsten
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann trägt bei der Fronleichnamsprozession durch die Speyerer Innenstadt die Monstranz mit dem Allerheiligsten
Fronleichnamsfest in Speyer unter dem Leitwort „Seht, ich
mach alles neu“
Speyer- „Überall, wo wir Christus in der
Monstranz hintragen, bekennen wir: Christus ist dort. Christus ist
in den Straßen unserer Stadt, in den Häusern unserer Familien, am
Arbeitsplatz, in den Büros. Wir tragen die Monstranz in die Welt
unseres Alltags. Wir lernen dadurch, diese Welt, unsere Mitmenschen
mit anderen Augen zu sehen“, erklärte Weihbischof Otto Georgens in
seiner Predigt im Dom zum Abschluss der Fronleichnamsprozession in
Speyer. Die Liebe, die Jesus mit seiner Hingabe am Kreuz gezeigt
habe, diese Liebe werde an Fronleichnam mit dem Allerheiligsten in
die Welt getragen. In Anlehnung an das Leitwort des
Bistumsjubiläums stand die Fronleichnamsfeier der Pfarrei Pax
Christi in der Domstadt in diesem Jahr unter dem Titel „Seht, ich
mach alles neu“ (Offb 21, 5).
In seiner Ansprache im Dom charakterisierte Weihbischof Georgens
Fronleichnam als „typisch weibliches Fest“. Er verwies auf die
Entstehungsgeschichte der Feier, die auf eine Vision von Juliana
von Lüttich zurückgehe. Frauen öffneten sich zudem „leichter dem
Geheimnis des Lebens, dem Geheimnis der Schöpfung, dem Geheimnis,
dass Gott in allem zu finden ist.“ Trotzdem gebe es bei Frauen und
Männern eine „Blindheit“ gegenüber diesem Geheimnis. Darum sei es
gut, darum zu bitten: „Gott heile die Blindheit unseres Herzens.
Schenke mir die Augen des Glaubens, damit ich sehe und erkenne, wie
sehr du mich liebst, mich, meine Mitmenschen, unsere Stadt, die
ganze Welt, alles was du geschaffen hast.“
An der Fronleichnamsprozession von der Kirche St. Joseph aus zum
Dom durch die Gilgen- und Maximilianstraße, in dessen Mitte Bischof
Dr. Karl-Heinz Wiesemann die Monstranz mit dem Allerheiligsten
trug, beteiligten sich zuvor etwa 1000 Gläubige. Die Texte,
Lesungen aus der Bibel, Gebete und Lieder waren passend zum
Leitwort „Seht, ich mach alles neu“ vom Liturgieausschuss der
Speyerer Pfarrei Pax Christi vorbereitet und zusammengestellt
worden.
 Die Statio vor dem Eingang der Kathedrale gestalteten
Kommunionkinder der Speyerer Gemeinden mit. Das Leitwort der
Fronleichnamsfeier wurde auch in dem bunten Blumenteppich am Dom
als Schriftzug aufgegriffen. Ein weiteres Motiv war eine
Darstellung der Dreifaltigkeit („Die wahre Dreiheit in der wahren
Einheit“) aus dem Scivias-Kodex von Hildegard von Bingen.
Die Statio vor dem Eingang der Kathedrale gestalteten
Kommunionkinder der Speyerer Gemeinden mit. Das Leitwort der
Fronleichnamsfeier wurde auch in dem bunten Blumenteppich am Dom
als Schriftzug aufgegriffen. Ein weiteres Motiv war eine
Darstellung der Dreifaltigkeit („Die wahre Dreiheit in der wahren
Einheit“) aus dem Scivias-Kodex von Hildegard von Bingen.
Der Prozession vorausgegangen war ein Pontifikalamt in der
vollbesetzten Kirche St. Joseph, das Bischof Wiesemann mit
Weihbischof Georgens und den Speyerer Seelsorgern zelebrierte. In
seiner Begrüßung verwies Bischof Wiesemann darauf, dass
Fronleichnam das Fest sei „um in den Straßen unserer Stadt Zeugnis
abzulegen von Gott“. Einem Gott, der die Welt, die Menschen mit
seiner umfassenden Liebe beschenke. Diese Liebe Christi gelte es in
die Welt hinauszutragen
Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgten der
Chor der Domgemeinde und der Kirchenchor St. Konrad sowie ein
Streichorchester. Sie sangen und spielten die Missa brevis in F von
Joseph Haydn. Als Solisten wirkten Josephine und Ulrike Ott mit. An
der Orgel in St. Joseph und im Dom spielte Christoph Keggenhoff,
die Gesamtleitung lag in Händen von Monika Keggenhoff. Die
Prozession begleiteten die Dombläser mit Liedern aus dem Gotteslob.
Im Dom sangen die Chöre das „Tantum Ergo in D“ von Anton
Bruckner.
Zum Abschluss der Fronleichnamsfeier spendete Bischof Wiesemann
den Gläubigen den sakramentalen Segen. Anschließend fand in der
Gemeinde St. Joseph eine Reunion statt. Text und Foto:
is
16.06.2017
Fronleichnamsfest in Speyer - Bilderalbum
„Priesterweihe intensiv“
Angebot der Stabsstelle „Berufungspastoral“ im Bistum
Speyer für junge Erwachsene und Jugendliche ab 16
Jahren
Speyer- Die Stabsstelle
„Berufungspastoral“ im Bistum Speyer lädt am 16. und 17.
Juni junge Erwachsene und Jugendliche ab 16 Jahren unter
der Überschrift „Priesterweihe intensiv“ in das Priester- und
Pastoralseminar und zur Priesterweihe in den Speyerer Dom ein.
Am Vorabend der Weihe haben die Teilnehmer Gelegenheit, die fünf
Weihekandidaten kennenzulernen und sich darüber auszutauschen, wie
der eigene Lebensweg, die eigene Berufung aussehen könnte. Beginn
ist um 18 Uhr in der Kirche des Priesterseminars. Eingebettet in
das Vespergebet werden die Kelche der angehenden Neupriester
geweiht.
Ab 20 Uhr folgt eine Gebetsnacht mit Lobpreis, Anbetung,
meditativen Elementen und Stille. Während der gesamten Nacht halten
Beterinnen und Beter eine Gebetsnachtwache. Die Initiativgruppe
„Berufungspastoral Speyer“ eröffnet und gestaltet die ersten
Nachtgebetsstunden zwischen 21 Uhr und Mitternacht. Bis dahin ist
die Kirche für alle Beter geöffnet. „Diese Zeit des gemeinsamen
Gebetes und des Verweilens vor dem Allerheiligsten in Stille möchte
Unterstützung für alle bieten, die sich in dieser Gebetsform Fragen
der je eigenen Berufung stellen möchten“, so Pfarrer Ralf Feix, der
dieses Angebot verantwortet. Die Gebetsnacht vor der Priesterweihe
knüpfe an eine alte Tradition der Kirche an.
Zwischen Mitternacht und 7 Uhr am Morgen des Weihetages (17. Juni)
wird es Stundenschichten geben, die einzelne Beterinnen und Beter
übernehmen, die sich vorher unter gebetsnacht@gmx.de
anmelden können. „Wer daran teilnehmen möchte, ist herzlich
eingeladen. Die Stunden können beliebig gestaltet werden: Lieder,
Gebete, Litaneien – oder auch ganz still“, so Feix.
Informationen unter: www.dein-leben-dein-weg.de , facebook/BerufederKirche
, ralf.feix@bistum-speyer.de oder 06232-120 337.
is
09.06.2017
Diakonissen Speyer-Mannheim und VFBB bieten Migranten neue Chancen
 Pfarrer Dr. Günter Geisthardt, Doris Eberle, Michael Wendelken, und Praxisanleiterin Birgit Müller (hinten von links) mit einigen der Teilnehmenden: Mustafa Esleem (Syrien), Haj Setaifi (Syrien), Nuria Santamaria (Spanien), Diana Bayat (Afghanistan) (vorn von links).
Pfarrer Dr. Günter Geisthardt, Doris Eberle, Michael Wendelken, und Praxisanleiterin Birgit Müller (hinten von links) mit einigen der Teilnehmenden: Mustafa Esleem (Syrien), Haj Setaifi (Syrien), Nuria Santamaria (Spanien), Diana Bayat (Afghanistan) (vorn von links).
Speyer- Zwölf Migranten und Flüchtlinge nehmen
an einem neuen Kooperationsprojekt der Diakonissen Speyer-Mannheim
und des Vereins zur Förderung der beruflichen Bildung (VFBB) teil,
um eine ausbildungsvorbereitende Grundqualifikation im Pflege- oder
Hauswirtschaftsbereich zu erhalten. Vier von Ihnen stellten am 6.
Juni gemeinsam mit Vertretern der Kooperationspartner die Maßnahme
vor.
Er sehe das Projekt als große Chance für alle Beteiligten, sagte
Michael Wendelken, Personalentwickler im Bereich Gesundheit und
Soziales bei den Diakonissen Speyer-Mannheim: „Für die
Teilnehmenden besteht die Chance der gesellschaftlichen Integration
durch Teilhabe am Arbeitsmarkt, für uns die Möglichkeit, Fachkräfte
für die Zukunft zu gewinnen“, so Wendelken. Mit dem Angebot würden
die Diakonissen Speyer-Mannheim ihrem Auftrag gerecht, soziale
Verantwortung zu übernehmen, betonte Diakonissen-Vorsteher Pfarrer
Dr. Günter Geisthardt. Sein Unternehmen bietet den Teilnehmenden
verschiedener Nationalitäten bis Dezember die Möglichkeit, in
Einrichtungen der Kranken- und Altenpflege den Pflege- und
Hauswirtschaftsalltag kennenzulernen. Ergänzt wird der praktische
Teil durch theoretischen und berufsbezogenen Sprachunterricht bei
der VFBB. „Häufig sind Menschen qualifiziert und motiviert,
verfügen aber nicht über das notwendige Fachvokabular“, sagte Doris
Eberle, VFBB-Geschäftsführerin.
Die Teilnehmenden aus Syrien, Afghanistan und Spanien verfügen
über unterschiedliche Voraussetzungen: So freut sich etwa die
Spanierin Nuria Santamaria, ihre in der Familie gesammelten
Pflegeerfahrungen im Seniorenzentrum Haus am Germansberg
professionell anwenden zu können, während beispielsweise Diana
Bayat aus Afghanistan bereits über Berufserfahrungen als Hebamme in
ihrem Heimatland verfügt und in den nächsten Monaten die Praxis auf
der Geburtshilfestation des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses
kennenlernt. Ziel ist, dass die Teilnehmenden nach der
Qualifizierungsmaßnahme geeignet sind, eine einjährige Ausbildung
als Pflegehelfer zu absolvieren. „Wenn alles gut geht und alle
Voraussetzungen erfüllt sind, können sich daran weitere
Fortbildungen oder zum Beispiel eine dreijährige Ausbildung im
Bereich der Kranken- oder Altenpflege anschließen“, betonte Michael
Wendelken.
Voraussetzung für die Qualifizierung ist ein Mindestalter von 21
Jahren, die Teilnehmenden müssen einen Hauptschulabschluss oder
zehn Jahre Schulbesuch im Heimatland vorweisen und einen
Bildungsgutschein der Agentur für Arbeit oder des Jobcenters.
„Durch die AZAV-Zertifizierung unseres Projektes erstatten
Arbeitsagentur und Jobcenter die Kosten der Qualifikation und einen
Teil der Lebenshaltungskosten“, erläuterte Eberle. Die Maßnahme
stehe auch deutschen Bewerbern offen.
Diakonissen Speyer-Mannheim
Die Diakonissen Speyer-Mannheim sind ein sozialdiakonisches
Unternehmen, das mit etwa 4.500 Mitarbeitenden Krankenhäuser,
Seniorenzentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kinder
und Jugendliche sowie Schulen und ein Hospiz betreibt.
Das Unternehmen steht in der Tradition der Diakonissenmutterhäuser
und betreibt seine Einrichtungen in mehreren Orten in
Rheinland-Pfalz sowie in Mannheim und Homburg/ Saarland.
Text
und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim08.06.2017
Es geht weiter – nur anders
.jpg) Kirchenpräsident Christian Schad nahm die Einsegnung von Corinna Kloss (hinten) vor und erneuerte den Segen von Oberin Sr. Isabelle Wien.
Kirchenpräsident Christian Schad nahm die Einsegnung von Corinna Kloss (hinten) vor und erneuerte den Segen von Oberin Sr. Isabelle Wien.
Diakonissen feiern Tag der
Gemeinschaftserneuerung
Speyer- Zwei Frauen haben 1859 den Anfang
gemacht, wirkten als erste Diakonissen in Speyer. Fast 160 Jahre
später sind es wieder zwei Frauen, die den Anfang machen: Oberin
Diakonisse Isabelle Wien wechselte am Pfingstsonntag im Rahmen
eines Festgottesdienstes in der Gedächtniskirche von der Diakonisse
bisheriger in die neue Form, Pfarrerin Corinna Kloss wurde in das
Amt der Diakonisse neuer Form eingesegnet.
„Ecclesia semper reformanda“, die Kirche und die Diakonie als
Lebens- und Wesensäußerung der Kirche seien stets im Werden, fasste
Kirchenpräsident Christian Schad den Schritt der
Gemeinschaftserneuerung der Diakonissen Speyer-Mannheim zusammen:
Die Diakonissen öffnen ihre Gemeinschaft für evangelische Frauen
und Männer aller Lebensformen, die den Wunsch verspüren, zu einer
verbindlichen Gemeinschaft zu gehören. „Gerade heute spüren
Menschen die Sehnsucht in sich, Diakonie in Gemeinschaft zu leben,
ihren Glauben zu vertiefen und für andere da zu sein“, betonte der
Kirchenpräsident vor rund 400 Gottesdienst-Besuchern. Dazu brauche
es allerdings „neue Formen, Öffnungen für Frauen und auch für
Männer aus unterschiedlichen Lebenskontexten, die diesen Weg
beschreiten wollen. Es bedarf des Aufbruchs, mitten im Umbruch“, so
Schad.
.jpg) Vordergründig geht für die Diakonissen neuer Form mit
diesem Umbruch einher, dass sie keine Tracht mehr tragen, außerdem
nicht mehr Ehelosigkeit und Gehaltsverzicht versprechen. So ist
Pfarrerin Corinna Kloss, die Pfingsten als Diakonisse eingesegnet
wurde, berufstätige verheiratete Mutter von drei Kindern. Der
Dreiklang von Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft beinhalte
für sie vieles, das ihr im Glaubensleben wichtig sei, begründet die
38jährige ihren Beitritt. Dieser liegt bei Oberin Sr. Isabelle Wien
bereits 25 Jahre zurück. Seinerzeit zählte die Gemeinschaft noch
über 140 Speyerer Diakonissen, heute leben noch 22 Diakonissen aus
Speyer und Mannheim im Mutterhaus – alle außer der Oberin bereits
im Feierabend. „Wenn sich eine Situation wie die der zu Ende
gehenden Gemeinschaft der Diakonissen bisheriger Form wandelt,
Leben sich verändert, sind wir aufgerufen, uns aktiv oder passiv zu
verhalten, entweder noch einmal zu versuchen, Mutterhausdiakonie
neu zu gestalten oder sie enden zu lassen“, sagt die 45jährige über
den Transformationsprozess: „Die Mutterhausdiakonie geht weiter –
nur anders“, ist Sr. Isabelle überzeugt. Im Herbst startet ein
erster Kurs für Männer und Frauen, die in den Kreis der Diakonissen
und Diakone der Diakonissen Speyer-Mannheim eintreten möchten.
Vordergründig geht für die Diakonissen neuer Form mit
diesem Umbruch einher, dass sie keine Tracht mehr tragen, außerdem
nicht mehr Ehelosigkeit und Gehaltsverzicht versprechen. So ist
Pfarrerin Corinna Kloss, die Pfingsten als Diakonisse eingesegnet
wurde, berufstätige verheiratete Mutter von drei Kindern. Der
Dreiklang von Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft beinhalte
für sie vieles, das ihr im Glaubensleben wichtig sei, begründet die
38jährige ihren Beitritt. Dieser liegt bei Oberin Sr. Isabelle Wien
bereits 25 Jahre zurück. Seinerzeit zählte die Gemeinschaft noch
über 140 Speyerer Diakonissen, heute leben noch 22 Diakonissen aus
Speyer und Mannheim im Mutterhaus – alle außer der Oberin bereits
im Feierabend. „Wenn sich eine Situation wie die der zu Ende
gehenden Gemeinschaft der Diakonissen bisheriger Form wandelt,
Leben sich verändert, sind wir aufgerufen, uns aktiv oder passiv zu
verhalten, entweder noch einmal zu versuchen, Mutterhausdiakonie
neu zu gestalten oder sie enden zu lassen“, sagt die 45jährige über
den Transformationsprozess: „Die Mutterhausdiakonie geht weiter –
nur anders“, ist Sr. Isabelle überzeugt. Im Herbst startet ein
erster Kurs für Männer und Frauen, die in den Kreis der Diakonissen
und Diakone der Diakonissen Speyer-Mannheim eintreten möchten.
Nicht nur die Gemeinschaft der Diakonissen hat sich Pfingsten
geöffnet: Die Gemeinschaft der Diakonischen Schwestern und Brüder
hat sich ökumenisch geweitet, steht nun Menschen unterschiedlicher
christlicher Konfessionen offen.
Hintergrund:
Diakonisse neuer Form
Diakonissen neuer Form kommen aus verschiedenen Lebensformen,
Professionen und Lebensalter, deren Lebensmittelpunkt nicht das
Mutterhaus ist. Diakonisse neuer Form oder Diakon der Diakonissen
Speyer-Mannheim können evangelische Frauen und Männer werden, die
im Haupt- oder Ehrenamt diakonisch tätig sind oder werden wollen
und sich mit Glauben, Leben und Dienst einer verbindlichen
Gemeinschaft zugehörig fühlen. Ihr geistliches Zentrum ist das
Mutterhaus, sie kommen aber aus unterschiedlichen Lebenssituationen
und leben an verschiedenen Orten. Sie haben eine
theologisch-diakonische Ausbildung oder erhalten sie durch ein
Grundlagenseminar, das die Diakonissen Speyer-Mannheim ab Oktober
gemeinsam mit dem Missionarisch-Ökumenischen Dienst der
Landeskirche anbieten. Die Übernahme des Amtes der Diakonisse neuer
Form oder des Diakons der Diakonissen Speyer-Mannheim erfolgt durch
die Einsegnung im Gottesdienst.
Diakonissen Speyer-Mannheim
Die Diakonissen Speyer-Mannheim sind ein sozialdiakonisches
Unternehmen, das mit etwa 4.500 Mitarbeitenden Krankenhäuser,
Seniorenzentren, Einrichtungen für Menschen mit Behinderung, Kinder
und Jugendliche sowie Schulen und ein Hospiz betreibt.
Das Unternehmen steht in der Tradition der
Diakonissenmutterhäuser und betreibt seine Einrichtungen in
mehreren Orten in Rheinland-Pfalz sowie in Mannheim und Homburg/
Saarland.
06.06.2017
Menschenrechtsaktivist aus Vietnam zu Besuch im Bischofshaus in Speyer
 Franz-Xaver Dang-Xuan-Dieu (5. von rechts) mit Bischof Wiesemann (links neben Dang-Xuan-Dieu) und Mitgliedern der Freilassungsinitiative.
Franz-Xaver Dang-Xuan-Dieu (5. von rechts) mit Bischof Wiesemann (links neben Dang-Xuan-Dieu) und Mitgliedern der Freilassungsinitiative.
Franz-Xaver Dang-Xuan-Dieu berichtet von seiner Haft und der
Situation in seinem Heimatland
Speyer- Im Januar 2017 wurde der zu einer
langjährigen Gefängnisstrafe verurteilte vietnamesische Christ und
Menschenrechtsaktivist Franz-Xaver Dang-Xuan-Dieu in seinem
Heimatland aus der Haft entlassen und nach Paris abgeschoben. Sechs
Jahre verbrachte der tiefgläubige Katholik, der sich für Demokratie
und Menschenrechte in Vietnam engagiert, in Einzelhaft. Für seine
Freilassung hatte sich auch eine von vielen Persönlichkeiten aus
der Pfalz und ganz Deutschland mitgetragene Initiative eingesetzt,
die von Vertretern des Bistums Speyer, darunter Weihbischof Otto
Georgens und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, unterstützt wurde.
Gestern Nachmittag bedankte sich Franz-Xaver Dang-Xuan-Dieu bei
einem Besuch im Bischofshaus in Speyer für den Beistand durch die
Speyerer Bistumsleitung. Initiiert hatte den Besuch der langjährige
Caritasmitarbeiter und Mitglied im Katholikenrat der Diözese Speyer
Ton-Vinh Trinh-Do, der 1979 als Jugendlicher aus seiner Heimat
geflüchtet war und damals Aufnahme im Kloster St. Dominikus in
Speyer fand.
Wie Franz-Xaver Dang-Xuan-Dieu im Bischofshaus berichtete, wurde
er 2011 gemeinsam mit 13 anderen jungen vietnamesischen Christen
verhaftet und zu einer 13-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Der
Vorwurf der Justiz lautete: versuchter Umsturz des Staates. „Wir
haben uns aus unserem christlichen Glauben heraus für Freiheit und
Menschenrechte eingesetzt. Das haben die staatlichen Behörden als
Bedrohung empfunden und das war der Grund für unsere Verhaftung“,
erklärte Dang-Xuan-Dieu. Da er das Urteil nicht anerkannte und sich
außerdem weigerte Gefängniskleidung zu tragen, weil er sich nicht
als „Verbrecher“ betrachtete, war er im Gefängnis großen
Repressalien ausgesetzt. Er protestierte gegen die Haftbedingungen
und das ungerechtfertigte Urteil mit insgesamt 100 Tagen
Hungerstreik während der sechs Jahre Haft. „In dieser Notlage,
knapp vor dem Tod, berichtete mir ein Freund von der Kampagne für
meine Freilassung und das so viele Menschen für mich beten. Das hat
mir sehr viel Hoffnung und Kraft gegeben, denn man hatte mir auch
verboten, Besuch von Angehörigen zu empfangen“, erzählte
Dang-Xuan-Dieu. Die Abschiebung nach Paris kam für ihn
überraschend.
Seine Bitte: Die immer noch im Gefängnis sitzenden
Glaubensschwestern und – brüder nicht zu vergessen, für sie
weiterhin zu beten und für ihre Freilassung zu kämpfen. Er
überreichte Bischof Wiesemann eine Liste mit Namen und Fotos
inhaftierter Weggefährten.
Ein weiteres Anliegen ist ihm die Unterstützung der von einer
Umweltkatastrophe betroffenen Küstenbewohner in seiner
Heimatdiözese Vinh. „Über 250 Kilometer Küste wurden in
Mittelvietnam durch Abwässer eines Werkes des Stahlkonzerns Formosa
verseucht. Die Kirche unterstützt die Opfer bei ihrem Bemühen, von
dem Unternehmen eine Entschädigung zu bekommen“, so Dang-Xuan-Dieu.
Die Regierung in Vietnam fördere die Ansiedlung von
Industrieunternehmen vor allem aus China, die ohne Rücksicht auf
die Umwelt produzierten. Dagegen wehrten sich auch viele Christen
und würden deshalb bedroht.
„Wir fühlen uns in großer Solidarität mit den verfolgten Christen
in Vietnam verbunden“, erklärte Bischof Wiesemann, der sich von den
Schilderungen Dang-Xuan-Dieus „sehr bewegt“ zeigte. Er verwies auf
den Besuch von Kardinal Marx in Vietnam im vergangenen Jahr, mit
dem die Verbundenheit der Kirche in Deutschland mit den Katholiken
in Vietnam zum Ausdruck gebracht worden sei. Allen Unterstützern
der Freilassungsinitiative dankte er für ihr Engagement.
Begleitet wurde Dang-Xuan-Dieu bei seinem Besuch im Bischofshaus
von Ton-Vinh Trinh-Do und dessen Ehefrau Theresia Hoa Truong sowie
den Mitgliedern der Freilassungsinitiative Prof. Dr. med. Stefan
Grüne von der Universität Mainz, dem ärztlichen Direktor des
Krankenhauses „Zum Guten Hirten“ in Ludwigshafen, Dr. Jörg
Breitmaier, Prof. Arnd Götzelmann von der Hochschule Ludwigshafen,
den beiden ehemaligen Richtern am Landgericht in Neustadt Gudrun
und Otmar Freiermuth sowie Sr. Johanna Gillich vom Institut St.
Dominikus in Speyer.
Weitere Informationen zu der Initiative: http://www.thongtinducquoc.de/node/2515
Text und Foto: is
02.06.2017
Segen empfangen und weitergegeben
 Die Jubilarinnen und Jubilare mit Pfarrer Dr. Günter Geisthardt (r.)
Die Jubilarinnen und Jubilare mit Pfarrer Dr. Günter Geisthardt (r.)
Diakonissen Schwesternjubiläum
Speyer- Auf 810 Jahre Zugehörigkeit zur
Diakonischen Gemeinschaft bringen es die 16 Diakonissen und
Diakonischen Schwestern, die im Speyerer Mutterhaus an Christi
Himmelfahrt Schwesternjubiläum feierten.
Bei der Feier blickte Pfarrer Dr. Günter Geisthardt mit den
Jubilarinnen auf die einzelnen Lebensgeschichten, die sich hinter
diesen 810 Jahren verbergen, auf ihre Arbeit in unterschiedlichen
Einrichtungen etwa der Krankenpflege oder Kinderbetreuung. „Wir
hoffen, dass bei allen Änderungen, die geschehen, etwas von Ihrer
Haltung in unseren Einrichtungen erhalten bleibt“, so Geisthardt.
Er dankte den Jubilarinnen für ihren Dienst am Nächsten, ihren
„Dienst der Nächstenliebe“, den viele der Schwestern auch nach
ihrer aktiven beruflichen Zeit im so genannten Feierabend versehen
würden: „Diakonie und Diakonische Gemeinschaft sind etwas
außerordentlich Lebendiges“, betonte der Vorsteher der Diakonissen
Speyer-Mannheim, bevor er den Jubilarinnen, darunter Oberin
Diakonisse Isabelle Wien, die vor 25 Jahren in die Gemeinschaft
eintrat, die Kronenkreuze in Gold der Diakonie Deutschland
verlieh.
Bereits vor 70 Jahren sind die Diakonissen Liesel Gebhardt,
Karola Nebling, Henny Schäfer und Annelotte Welker der Gemeinschaft
beigetreten, für 65 Jahre Zugehörigkeit wurden die Diakonissen Else
Agne, Charlotte Heiß und Ruth Herr geehrt. Seit 60 Jahren ist
Irmtraud Anetsberger Diakonische Schwester, Friederike Bußer, Karin
Döbrich, Ursula Fröhlich, Ruth Moock und Elke Stauffer gehören seit
40 Jahren zur Gemeinschaft der Diakonischen Schwestern und Brüder.
Neben Diakonisse Isabelle Wien feierten die Diakonischen Schwestern
Ruth Christ und Christiane Hell ihre 25. Jubiläen.
Das nächste große Fest steht bereits bevor: Am Pfingstsonntag
feiern die Diakonissen Speyer-Mannheim den Tag der
Gemeinschaftserneuerung. In einem Gottesdienst ab 10.00 Uhr in der
Speyerer Gedächtniskirche wird Pfarrerin Corinna Kloss als
Diakonisse neuer Form eingesegnet und Oberin Sr. Isabelle Wien
wechselt von der Diakonisse alter in die neue Form. Die Einsegnung
nimmt Kirchenpräsident Christian Schad vor, die Predigt hält Sr.
Anke Frickmann aus Bethel. Text und Foto: Diakonissen
Speyer-Mannheim
26.05.2017
Presbyteriumswahl: Kandidatensuche soll einfacher werden
Landessynode hat sich auf Eckpunkte zur Reform des
Wahlrechts verständigt
Mit Blick auf die Presbyteriumswahlen 2020 hat die Landessynode
Eckpunkte für eine Reform des Wahlrechts auf den Weg gebracht. Ziel
sei es vor allem, die Suche nach geeigneten Kandidaten zu
erleichtern, erklärte Oberkirchenrat Dieter Lutz. Die Abstimmung
über die Eckpunkte zur Wahlrechtsreform gebe ein Stimmungsbild
wieder. Mit ihrer Positionierung ermögliche es die Synode
interessierten Gemeindemitgliedern, sich in einem Presbyterium zu
engagieren. Über das neue Wahlgesetz selbst werde die Landessynode
in einer ihrer nächsten Tagungen entscheiden.
Die Landessynode hat sich u.a. dafür ausgesprochen, dass in den
Gemeinden je nach Größe die Zahl der zu wählenden
Presbyteriumsmitglieder und somit die Zahl der benötigten
Kandidierenden reduziert oder erhöht werden kann. Einem
Presbyterium müssen aber wie bisher mindestens vier Presbyter
angehören. Außerdem soll für die Wahlunterlagen die so genannte
„leichte Sprache“ gelten, um Menschen mit Handicap die Teilnahme an
der Wahl zu erleichtern.
Keine Mehrheit fanden die Vorschläge, das Wählbarkeitsalter von
18 auf 16 herabzusetzen und bei der Presbyteriumswahl 2020 auch
online die Stimme abgeben zu können. Dagegen sprächen ein zu hoher
Kosten- und Verwaltungsaufwand sowie Datenschutzgründe. Das
Beispiel der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck habe zudem
gezeigt, dass die Möglichkeit, online zu wählen, keine nennenswerte
Erhöhung der Wahlbeteiligung ergeben habe, so Lutz.
Mit Blick auf die Wahlen zur Landes- und zur Bezirkssynode
sollen Wahlanfechtungen keine aufschiebende Wirkung haben. Das
heißt, Synodale, deren Wahl in Frage steht, würden dennoch
eingeführt und könnten während des Einspruchsverfahrens bis zur
rechtskräftigen Ungültigkeitserklärung ihrer Wahl rechtswirksam in
der Landes-, bzw. Bezirkssynode mitwirken. Damit werde
sichergestellt, dass die Gremien handlungsfähig bleiben, erklärte
Oberkirchenrat Dieter Lutz.
Der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz gehören 70
Synodale an – 46 weltliche und 24 geistliche. Acht der 70
Mitglieder sind berufen, davon zwei als Jugendvertreter.
Synodalpräsident ist der Kaiserslauterer Jurist Hermann Lorenz. Dem
Präsidium gehören außerdem der Dekan des Kirchenbezirks An Alsenz
und Lauter, Matthias Schwarz, als erster Vizepräsident und
Ministerialrat Joachim Schäfer aus Birkenheide als zweiter
Vizepräsident sowie Rommi Keller-Hilgert und Daniela Freyer als
Beisitzerinnen an. Die Landessynode ist als kirchliche
Volksvertretung die Inhaberin der Kirchengewalt. Sie trifft
wesentliche Entscheidungen in den geistlichen, rechtlichen und
finanziellen Bereichen der Landeskirche. Ihre Amtszeit beträgt
sechs Jahre. Die Landessynode kommt in der Regel zwei Mal im Jahr
zusammen, im Frühjahr und im Herbst. Die nächste Tagung findet vom
30. November bis 2. Dezember in Speyer statt.
14.05.2017
„Pflanzstätte für die Diözese“ wiedereröffnet
 Bischof Wiesemann segnet generalsaniertes Priesterseminar
und weiht Altar in der Seminarkirche
Bischof Wiesemann segnet generalsaniertes Priesterseminar
und weiht Altar in der Seminarkirche
Speyer- Es war ein Festtag für die gesamte
Diözese Speyer, optisch schon von weitem durch die Bistumsfahnen
erkennbar. Am vergangenen Samstag wurde nach fast zweijähriger
Renovierungszeit das Priesterseminar Sankt German in Speyer
feierlich wiedereröffnet. Dem Festakt voraus ging am Vormittag ein
Pontifikalamt, in dem Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann die neu
gestaltete Seminarkirche segnete und sowohl den Altar als auch den
Ambo weihte. Im Fuß des Altars wurden zudem Reliquien des Seligen
Pfarrers Paul Josef Nardini beigesetzt. Der Künstler Bernhard
Mathäss aus Neustadt-Duttweiler hatte den Chorraum ungestaltet.
Zahlreiche Gäste hatten an dem bedeutenden Ereignis
teilgenommen, darunter auch Bischof em. Dr. Anton Schlembach, eine
Vielzahl an weiteren kirchlichen Würdenträgern sowie der Speyerer
Oberbürgermeister Hansjörg Eger. „In zwei Monaten ist es 60 Jahre
her, dass die Seminarkirche geweiht wurde“, sagte der Leiter der
Einrichtung, Regens Markus Magin, zu Beginn des Gottesdienstes und
hieß Bischof Wiesemann als den eigentlichen Hausherrn des
Priesterseminars besonders willkommen. Vieles habe sich in den
vergangenen Jahrzehnten an Aufgaben und in der Arbeitsweise
verändert. So sei das Haus mittlerweile auch Tagungsstätte.
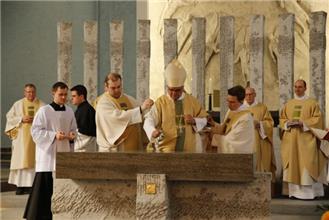 Der Speyerer Oberhirte zeigte sich erfreut über das Ende
der Umbau- und Renovierungsarbeiten auf dem Germansberg, die
insgesamt 12,5 Millionen Euro kosten. Seit dem Zweiten
Vatikanischen Konzil gelte das Priesterseminar als Herz der
Diözese, „und ich bin froh, dass wir die Operation am offenen
Herzen in guter Weise abschließen können“. Das lateinische Wort
„Seminarium“ bedeute Pflanzstätte, und in diesem Sinne sei das
Priesterseminar „die Pflanzstätte der Diözese, ein Raum des
Wachsens und der Entwicklung aus der Kraft des Wortes Gottes und
der Berufung, die uns Christus schenkt“. Als Pastoralseminar stehe
es allen kirchlichen Berufsgruppen – Priestern, Diakonen, Pastoral-
und Gemeindereferenten – aber auch Ehrenamtlichen in Aus- und
Fortbildung offen. „Somit wollen wir das Priesterseminar als Haus
für die ganze Diözese wiedereröffnen.“ Wiesemann sprach auch die
Belastungen der vergangenen beiden Jahre während der Umgestaltung
an und dankte allen, die sich engagiert hätten, um das Projekt zu
einem guten Abschluss zu bringen. Gleichzeitig erinnerte er an den
geschichtsträchtigen Boden, auf dem sich das Priesterseminar
befinde. „Hier sind die ältesten Spuren des Christentums in Speyer
zu finden“, betonte der Bischof und verwies auf Keltengräber, einen
Friedhof und auf ein frühes Kloster.
Der Speyerer Oberhirte zeigte sich erfreut über das Ende
der Umbau- und Renovierungsarbeiten auf dem Germansberg, die
insgesamt 12,5 Millionen Euro kosten. Seit dem Zweiten
Vatikanischen Konzil gelte das Priesterseminar als Herz der
Diözese, „und ich bin froh, dass wir die Operation am offenen
Herzen in guter Weise abschließen können“. Das lateinische Wort
„Seminarium“ bedeute Pflanzstätte, und in diesem Sinne sei das
Priesterseminar „die Pflanzstätte der Diözese, ein Raum des
Wachsens und der Entwicklung aus der Kraft des Wortes Gottes und
der Berufung, die uns Christus schenkt“. Als Pastoralseminar stehe
es allen kirchlichen Berufsgruppen – Priestern, Diakonen, Pastoral-
und Gemeindereferenten – aber auch Ehrenamtlichen in Aus- und
Fortbildung offen. „Somit wollen wir das Priesterseminar als Haus
für die ganze Diözese wiedereröffnen.“ Wiesemann sprach auch die
Belastungen der vergangenen beiden Jahre während der Umgestaltung
an und dankte allen, die sich engagiert hätten, um das Projekt zu
einem guten Abschluss zu bringen. Gleichzeitig erinnerte er an den
geschichtsträchtigen Boden, auf dem sich das Priesterseminar
befinde. „Hier sind die ältesten Spuren des Christentums in Speyer
zu finden“, betonte der Bischof und verwies auf Keltengräber, einen
Friedhof und auf ein frühes Kloster.
Festakt mit Segnung des Hauses
 Regens Markus Magin läutete den Festakt am Nachmittag im
wahrsten Sinne des Wortes mit einer kleinen Glocke ein. Ihr Klang
habe für ihn eine besondere Bedeutung, denn Ende August 2009 habe
sein Vorgänger, Pfarrer Dieter Rottenwöhrer, ihm dieses kleine
Instrument überreicht und damit symbolisch auch das Amt als
Direktor des Bistumshauses St. Ludwig übergeben. „Für mich war
damals klar, dass die Glocke erst dann wieder läuten wird, wenn das
Bistumshaus St. Ludwig renoviert und das Priesterseminar in die
Einrichtung integriert ist.“ Dass die Entwicklung eine andere
Wendung nehmen würde, hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen
können. Acht Jahre später werde nun das Priesterseminar St. German
wieder in Dienst gestellt, und die Glocke läute das Ende der
Bauphase ein. Diese ließ Magin, untermalt mit einigen Bildern und
einer gehörigen Brise Humor, noch einmal Revue passieren. Dabei
ging er nicht nur auf die zeitliche Abfolge der Ereignisse ein,
angefangen von der Entscheidung der Bistumsleitung im Jahr 2014,
sich vom Bistumshaus St. Ludwig mit der dazugehörigen Kirche St.
Ludwig zu trennen und stattdessen das Priesterseminar general zu
sanieren, bis zur Renovierung und liturgischen Umgestaltung der
Seminarkirche in den vergangenen Monaten. Er beschrieb auch
anschaulich die Widrigkeiten wie Staub und Lärm während der
umfangreichen Arbeiten.
Regens Markus Magin läutete den Festakt am Nachmittag im
wahrsten Sinne des Wortes mit einer kleinen Glocke ein. Ihr Klang
habe für ihn eine besondere Bedeutung, denn Ende August 2009 habe
sein Vorgänger, Pfarrer Dieter Rottenwöhrer, ihm dieses kleine
Instrument überreicht und damit symbolisch auch das Amt als
Direktor des Bistumshauses St. Ludwig übergeben. „Für mich war
damals klar, dass die Glocke erst dann wieder läuten wird, wenn das
Bistumshaus St. Ludwig renoviert und das Priesterseminar in die
Einrichtung integriert ist.“ Dass die Entwicklung eine andere
Wendung nehmen würde, hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen
können. Acht Jahre später werde nun das Priesterseminar St. German
wieder in Dienst gestellt, und die Glocke läute das Ende der
Bauphase ein. Diese ließ Magin, untermalt mit einigen Bildern und
einer gehörigen Brise Humor, noch einmal Revue passieren. Dabei
ging er nicht nur auf die zeitliche Abfolge der Ereignisse ein,
angefangen von der Entscheidung der Bistumsleitung im Jahr 2014,
sich vom Bistumshaus St. Ludwig mit der dazugehörigen Kirche St.
Ludwig zu trennen und stattdessen das Priesterseminar general zu
sanieren, bis zur Renovierung und liturgischen Umgestaltung der
Seminarkirche in den vergangenen Monaten. Er beschrieb auch
anschaulich die Widrigkeiten wie Staub und Lärm während der
umfangreichen Arbeiten.
Bevor Bischof Wiesemann das Priesterseminar segnete, bekräftigte
er noch einmal, „wie glücklich ich bin, dass wir dieses Haus
haben“. Allerdings sei die Entscheidung für diesen Standort nicht
leicht gewesen und habe eine schmerzhafte Seite, nämlich das
Bistumshaus St. Ludwig abzugeben, „um den finanziellen
Herausforderungen Genüge zu tun“. Wiesemann schloss mit den Worten:
„Möge Gott uns Kraft geben und Berufungen schenken, die wir so
dringend brauchen.“
Segenswünsche für das Haus
 Den Reigen der Grußworte eröffnete der stellvertretende
Vorsitzende der Deutschen Regentenkonferenz, Dr. Christian Heß. Es
habe für ihn drei gute Gründe gegeben, hier zu den Feierlichkeiten
in die Domstadt zu kommen, unterstrich der Leiter des
Priesterseminars der Diözese Freiburg, der aus Bruchsal stammt.
„Ich bin mit Speyer aufgewachsen, denn über der Tür des Pfarrhauses
meines Heimatortes hängt das Wappen der Fürstbischöfe von Speyer“,
so Heß, der damit ins Bewusstsein rief, dass weite Teile des
rechtsrheinischen badischen und württembergischen Gebietes bis zu
seinem Untergang im Jahr 1801 zum Fürstbistum Speyer gehörten.
Darüber hinaus überbrachte Heß die Glück- und Segenswünsche des
Vorsitzenden der Deutschen Regentenkonferenz, Helmut Niehues aus
Münster, und nicht zuletzt machte er deutlich, dass die
südwestdeutschen Regenten einen regelmäßigen Kontakt pflegen.
Den Reigen der Grußworte eröffnete der stellvertretende
Vorsitzende der Deutschen Regentenkonferenz, Dr. Christian Heß. Es
habe für ihn drei gute Gründe gegeben, hier zu den Feierlichkeiten
in die Domstadt zu kommen, unterstrich der Leiter des
Priesterseminars der Diözese Freiburg, der aus Bruchsal stammt.
„Ich bin mit Speyer aufgewachsen, denn über der Tür des Pfarrhauses
meines Heimatortes hängt das Wappen der Fürstbischöfe von Speyer“,
so Heß, der damit ins Bewusstsein rief, dass weite Teile des
rechtsrheinischen badischen und württembergischen Gebietes bis zu
seinem Untergang im Jahr 1801 zum Fürstbistum Speyer gehörten.
Darüber hinaus überbrachte Heß die Glück- und Segenswünsche des
Vorsitzenden der Deutschen Regentenkonferenz, Helmut Niehues aus
Münster, und nicht zuletzt machte er deutlich, dass die
südwestdeutschen Regenten einen regelmäßigen Kontakt pflegen.
Grüße des Präsidenten der Evangelischen Landeskirche der Pfalz,
Christian Schad, und des Landeskirchenrates übermittelte der Leiter
des Protestantischen Predigerseminars in Landau, Pfarrer Professor
Dr. Peter Busch. Er konnte die von Regens Magin geschilderten
Begleiterscheinungen während des Umbaus des Priesterseminars gut
nachempfinden, „denn wir haben beide die vergangenen zwei Jahre auf
einer Baustelle verbracht“. In Landau dauerten die Arbeiten jedoch
noch an.
 „Ich freue mich, dass auf dem Germansberg das
Priesterseminar neu gegründet und zukunftsfest gemacht wird“,
unterstrich der Speyerer Oberbürgermeister Hansjörg Eger.
Bildungseinrichtungen seien das Herz einer Gesellschaft, „weil dort
Wertevermittlung geschieht“. Im Jahr der 200-jährigen Neugründung
des Bistums sei dies ein gutes Zeichen für den Bildungsstandort
Speyer. Das Stadtoberhaupt erwähnte in diesem Zusammenhang auch die
mehr als 140 Wohnungen für alle Schichten der Bevölkerung, die neu
geschaffen werden können. Denn zur Mitfinanzierung der
Generalsanierung des Priesterseminars wurde eine Teilfläche seines
Grundstücks verkauft. Eger wünschte dem Lehrpersonal und den
Lernenden viel Geduld und Gelassenheit im Bewusstsein, dass hier
Bildung zum Wohl der Gesellschaft vermittelt werde.
„Ich freue mich, dass auf dem Germansberg das
Priesterseminar neu gegründet und zukunftsfest gemacht wird“,
unterstrich der Speyerer Oberbürgermeister Hansjörg Eger.
Bildungseinrichtungen seien das Herz einer Gesellschaft, „weil dort
Wertevermittlung geschieht“. Im Jahr der 200-jährigen Neugründung
des Bistums sei dies ein gutes Zeichen für den Bildungsstandort
Speyer. Das Stadtoberhaupt erwähnte in diesem Zusammenhang auch die
mehr als 140 Wohnungen für alle Schichten der Bevölkerung, die neu
geschaffen werden können. Denn zur Mitfinanzierung der
Generalsanierung des Priesterseminars wurde eine Teilfläche seines
Grundstücks verkauft. Eger wünschte dem Lehrpersonal und den
Lernenden viel Geduld und Gelassenheit im Bewusstsein, dass hier
Bildung zum Wohl der Gesellschaft vermittelt werde.
Das Beste aus dem Gebäude zu machen, das war das Ziel von Oliver
Brünjes vom gleichnamigen Architektenbüro mit Sitz in Saarbrücken.
„Unsere Projekte sind wie unsere Kinder. Irgendwann müssen wir sie
loslassen“, gestand der Bauexperte, der den Entwurf für den Umbau
erstellte und die Maßnahme betreute. „Jetzt ist es Zeit, dies zu
tun und das Gebäude an den Bischof, den Regens, das Bistum und an
die Gäste zu übergeben.“ Dem Leiter des Priesterseminars wünschte
Brünjes, dass er sich in dem Haus, in dem er auch wohnt,
wohlfühlt.
 Schließlich kamen auch diejenigen zu Wort, für die das
Priesterseminar in erster Linie bestimmt ist: Vertreter der
Bewerberkreise für die pastoralen Berufe. Auf unterhaltsame, aber
auch tiefgründige Weise sprachen der Priesteramtskandidat Peter
Heinke und die Pastoralassistentin Nina Bender über ihre eigene
Berufung, nannten in baulicher Hinsicht die „Highlights“ ihrer
sanierten Ausbildungsstätte, etwa „der ästhetisch ansprechende
Sakralraum der Nardinikapelle“, und lobten die Möglichkeiten, die
das Haus ihnen bietet, ihre vorhandenen Potenziale zu
verwirklichen, indem sie beispielsweise lernten, zu
unterrichten.
Schließlich kamen auch diejenigen zu Wort, für die das
Priesterseminar in erster Linie bestimmt ist: Vertreter der
Bewerberkreise für die pastoralen Berufe. Auf unterhaltsame, aber
auch tiefgründige Weise sprachen der Priesteramtskandidat Peter
Heinke und die Pastoralassistentin Nina Bender über ihre eigene
Berufung, nannten in baulicher Hinsicht die „Highlights“ ihrer
sanierten Ausbildungsstätte, etwa „der ästhetisch ansprechende
Sakralraum der Nardinikapelle“, und lobten die Möglichkeiten, die
das Haus ihnen bietet, ihre vorhandenen Potenziale zu
verwirklichen, indem sie beispielsweise lernten, zu
unterrichten.
Am Ende des Festaktes stellte Regens Markus Magin sein Buch
„Farben – Frohe Botschaft“ vor, in dem er die Bilder der
Buntglasfenster des Künstlers Valentin Feuerstein in der
Nardini-Kapelle des Priesterseminars geistlich erschließt. Das Buch
ist im Pilgerverlag erschienen und wurde in die Schriftenreihe des
Bistumsarchivs aufgenommen. Das Vorwort stammt von Bischof
Wiesemann, dem Magin auch das erste Exemplar des Buches
überreichte. Das zweite Exemplar erhielt Oberbürgermeister
Eger.
Tag der offenen Seminartür
Die Öffentlichkeit konnte das sanierte Priesterseminar am
gestrigen Sonntag im Rahmen eines Tages der offenen Tür
kennenlernen.
Text und Fotos: Petra Derst
11.05.2017
Bischof Wiesemann segnet Priesterseminar - Bilderalbum
„Wir sind verbunden durch seinen Geist“
.jpg) Wallfahrt muttersprachlicher Gemeinden: Bischof ruft zu
Mut für Begegnung auf
Wallfahrt muttersprachlicher Gemeinden: Bischof ruft zu
Mut für Begegnung auf
Speyer- Die Kraft des gemeinsamen Glaubens als
friedliches Werkzeug gegen das Zerstörerische in der Welt zu
nutzen, dazu rief Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am Sonntag im
Pontifikalamt zur Wallfahrt der muttersprachlichen Gemeinden auf.
Dieses zelebrierte er mit Seelsorgern der verschiedenen Gemeinden
aus der Diözese im Speyerer Dom.
Ein außergewöhnliches und eindrucksvolles Bild zugleich bot sich
zwischen den ehrwürdigen Mauern der Kathedrale. Eine Vielzahl von
Mitgliedern unterschiedlicher muttersprachlicher Gemeinden hatte
sich in landestypischen Trachten neben den deutschstämmigen
Gläubigen eingefunden. Auf dieses Miteinander wies Bischof
Wiesemann hin: „Es ist etwas Besonderes, wenn aus unterschiedlichen
Nationen die eine Kirche wieder anschaulich wächst und wir spüren,
dass wir eine Weltkirche sind.“
So wenig wie persönliche Barrieren gab es bei der
Eucharistiefeier auch sprachliche Grenzen. Ob es die
Apostelgeschichte auf Ukrainisch, die Lesung aus dem ersten Brief
des Apostels Petrus auf Vietnamesisch oder die gesangliche
Kommunionbegleitung auf Kroatisch war: Der gemeinsame Glaube an
Gott half zu verstehen. Und er bot besondere Momente für
diejenigen, die einer anderen muttersprachlichen Gemeinde
angehörten.
Die nigerianische Gabenprozession wurde zum Ausdruck unendlicher
Lebensfreude im Gedenken an den Erlöser. Vietnamesische Frauen und
Kinder drückten ihre Ehrfurcht vor Gott in einem Tanz aus, brachten
ihm verschiedenfarbige Blumen als besondere Gaben dar. Dem
ukrainischen Gemeindechor oblag die gesangliche Untermalung eines
multikulturell strahlenden, feierlichen Gottesdienstes zum
Orgelspiel von Domorganist Markus Eichenlaub.
.jpg) Angelehnt an das Evangelium aus Johannes 10 sprach
Bischof Wiesemann in seiner Predigt den schmalen Grat zwischen
Vertrauen und Vorsicht an, den die meisten Menschen heute gehen.
Dass oft die Angst vor Fremdem dominiere und der Eintritt ins Haus
als Sinnbild der eigenen Persönlichkeit verwehrt werde, sei nicht
zuletzt verletzenden Begebenheiten geschuldet. „Die Menschheit ist
an der Türschwelle bereits verwundet“, sagte Wiesemann. Auf das
Evangelium bezogen verwies er jedoch auf Jesus als „Tür zu den
Schafen“. Einen Hirten wie ihn zu haben, der die Menschen selbst
über die sensibelste Stelle des eigenen Lebens führt, sei eine
Gewissheit des Glaubens.
Angelehnt an das Evangelium aus Johannes 10 sprach
Bischof Wiesemann in seiner Predigt den schmalen Grat zwischen
Vertrauen und Vorsicht an, den die meisten Menschen heute gehen.
Dass oft die Angst vor Fremdem dominiere und der Eintritt ins Haus
als Sinnbild der eigenen Persönlichkeit verwehrt werde, sei nicht
zuletzt verletzenden Begebenheiten geschuldet. „Die Menschheit ist
an der Türschwelle bereits verwundet“, sagte Wiesemann. Auf das
Evangelium bezogen verwies er jedoch auf Jesus als „Tür zu den
Schafen“. Einen Hirten wie ihn zu haben, der die Menschen selbst
über die sensibelste Stelle des eigenen Lebens führt, sei eine
Gewissheit des Glaubens.
„Jesus selbst ist da. Er ist kein religiöser Guru, der uns ins
Schlepptau nehmen will und kein Machthaber, dem es am Ende nicht um
die Menschheit geht“, machte Wiesemann deutlich und erinnerte
daran, dass Jesus selbst das geschlachtete Lamm, ein Opfer der
Gewalt, gewesen sei.
„Aber die Kraft der Liebe Gottes ist stärker als alle
Verletzungen durch die Brutalität dieser Welt“, stellte der Bischof
heraus. Er rief dazu auf, selbst bei allen politischen
Entwicklungen hin zum Rückzug in die eigene Nation, den Schritt hin
zu Begegnungen mit anderen zu wagen. „Nur so können wir wachsen,
auch über uns hinaus“, betonte Wiesemann. Es gebe es zwar viele
muttersprachliche Gemeinden, aber nur den einen Christus, der in
allen Herzen ist. „Wir sind verbunden durch seinen Geist“, so der
Bischof.
Im Anschluss an das Pontifikalamt waren alle zur offenen
Begegnung in der Vorhalle des Domes eingeladen, die von der
ukrainischen Gemeinde ausgerichtet wurde. Der Abschluss der
Wallfahrt führte zum mehrsprachigen Rosenkranzgebet am frühen
Nachmittag ins Kloster St. Magdalena.
Text und Fotos: Susanne Kühner
08.05.2017
Missionspreis 2017 für die Netzgemeinde DA_ZWISCHEN
 Felix Goldinger (2. von rechts) nahm die Auszeichnung für sein Projekt in Hamburg entgegen.
Felix Goldinger (2. von rechts) nahm die Auszeichnung für sein Projekt in Hamburg entgegen.
Internetgemeinde des Bistums Speyer wird mit dem
Missionspreis von "Andere Zeiten" geehrt
Speyer/Hamburg- Der Missionspreis des
Vereins "Andere Zeiten" geht in diesem Jahr an ein Projekt aus dem
Bistum Speyer. Der mit 5.000 Euro dotierte Preis wurde am 4. Mai in
Hamburg an die Netzgemeinde DA_ZWISCHEN und zwei weitere Projekte
verliehen.
Die Netzgemeinde lebt von einer Begegnungsmöglichkeit im
Internet und den sozialen Netzwerken. Per WhatsApp und anderen
Messengerdiensten werden montags und freitags Impulse verschickt,
die Spiritualität im Alltag erfahrbar machen. Das Angebot richtet
sich an Menschen, die Gott suchen, aber nicht oder nicht mehr an
eine Kirchengemeinde angebunden sind.
Ideengeber und Initiator der Netzgemeinde ist Felix Goldinger.
Er ist Pastoralreferent und Referent für Missionarische Pastoral im
Bistum Speyer. "Mir war es wichtig, dass Glauben im Alltag
erfahrbar werden kann. Deshalb sind die Impulse für die
Netzgemeinde auch immer kurz und knapp. Mal ist es eine Frage am
Montag, mal ein kurzer Filmimpuls oder ein Bild. Wer möchte, der
kann den Input gleich am Morgen lesen und die ganze Woche im
Hinterkopf behalten. Man kann aber auch wirklich eine Pause, das
Warten an der Bushaltestelle oder beim Arzt nutzen, um sich
da_zwischen einen guten Gedanken abzuholen. Freitags schließen wir
diesen dann immer ab. Meistens ist das keine Antwort im
eigentlichen Sinn, sondern eine Sammlung der Ideen, die die
Netzgemeinde im Laufe der Woche an uns zurückgegeben hat", erklärt
Goldinger das Grundprinzip. Er freut sich über eine Gemeinde von
mittlerweile rund 1040 Mitgliedern und deren rege Beteiligung.
Weil unter den Mitgliedern auch viele waren, die mehr wollten
als kurze Impulse, experimentierte Goldinger zwischenzeitlich mit
verschiedenen Formaten: "Wir haben manchmal einen Link zu unserer
Homepage mit längeren Texten oder weiterführenden Gedanken
angeboten. Dort waren dann auch Bibeltexte in voller Länge
hinterlegt oder auch ein Predigttext." In der Fastenzeit 2017 gab
es zudem die Möglichkeit, an Exerzitien in begleiteten Kleingruppen
teilzunehmen. "DA_ZWISCHEN hat für die Exerzitien sehr von den
Ideen und Texten meines Kollegen Peter Hundertmark profitiert. Es
war ein großes Glück, die reale mit der virtuellen Welt verknüpfen
zu können".
Einige aktive „Gemeindemitglieder“ haben sich zudem mit
Fahrrad-Rikschas auf den Weg gemacht, um den Teilnehmern des
Weinstraßenfestes 2016 ihr digitales Projekt nahe zu bringen und
sie an Stationen zu Beispielimpulsen eingeladen. Die Netzgemeinde
richtet sich primär an junge Erwachsene. »Es ist eine Initiative,
die leichten Zugang ermöglicht, flexibel ist, sich lebensnah der
sozialen Netzwerke bedient, sich dennoch als ‚Gemeinde‘ versteht
und sich auch auf den Weg macht, um Menschen persönlich zu
erreichen«, so die Jury.
Der persönliche Bezug ist auch Goldingers wichtigstes Anliegen.
Er sieht den Missionspreis als Ermutigung, hier weiter zu
experimentieren: "DA_ZWISCHEN ist rund um die Uhr erreichbar. Das
ist gut und wichtig so. Wir sind auch mit einer Seite auf Facebook
und Instagram vertreten, aber das virtuelle Gespräch über die
Messengerdienste bleibt unser zentrales und wichtigstes Standbein.
Die Exerzitien waren ein guter Schritt, mehr Nähe in den
Kleingruppen zu schaffen. Da möchte ich gerne weiter dran bleiben."
Schließlich seien die Gespräche via WhatsApp oder Telegram vor
allem eines: Seelsorgliche Begleitung und persönliches
Gespräch.
Die Netzgemeinde DA_ZWISCHEN steht Ihnen jederzeit offen.
Besuchen Sie uns gerne auf www.netzgemeinde-dazwischen.de.
"Andere Zeiten" wurde 1998 als gemeinnütziger Verein gegründet.
Der Verein ist ökumenisch und eigenständig, steht aber den
christlichen Kirchen nah. www.anderezeiten.de Text
und Foto: is
08.05.2017
Mitarbeitervertretung des Bistums Speyer in neuen Räumlichkeiten
Zusammenschluss von rund 135 Mitarbeitervertretungen im
Bistum – Interessenvertretung für rund 15.000 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter
Speyer- Seit Anfang Mai befindet sich die
Geschäftsstelle der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen (DiAG-MAV) in neuen Räumlichkeiten in der
Zentrale des Caritasverbandes in Speyer. Erstmals seit Bestehen der
DiAG-MAV steht der Dachorganisation der Mitarbeitervertretungen des
Bistums sowohl ein eigenes Büro als auch eine Sekretärin zur
Verfügung. Stephanie Friebe unterstützt ab sofort den Vorstand der
DiAG-MAV in allen administrativen Angelegenheiten.
Die Mitarbeitervertretungen haben in kirchlichen Einrichtungen
die Aufgaben, die denen eines Betriebs- oder Personalrats
entsprechen. Alle rund 135 Mitarbeitervertretungen des Bistums
schließen sich in der DiAG-MAV zusammen. Diese berät ihre
Mitglieder in allen Angelegenheiten des Arbeitsrechts und vertritt
die Interessen der rund 15.000 Beschäftigten gegenüber der
Bistumsleitung. isKontakt:
DiAG-MAV im Bistum Speyer
Nikolaus-von-Weis-Str. 6,
67346 Speyer
Telefon: 06232 209-255/256
www.diag-mav-speyer.de
05.05.2017
Schülertage im Bistum Speyer feiern fünfjähriges Jubiläum
 "Eine sehr gute Mischung zwischen Information und
authentischen Glaubensvertretern"
"Eine sehr gute Mischung zwischen Information und
authentischen Glaubensvertretern"
Speyer- Die Schülertage unter dem Titel
"Meine Diözese" feiern gerade ihr erstes Jubiläum. Zum fünften Mal
sind Schülerinnen und Schüler nach Speyer eingeladen, mehr über das
Bistum, den Dom, die Caritas, über das Engagement und Berufe in der
Kirche zu erfahren, mit diözesanen Mitarbeitern ins Gespräch zu
kommen und mit der Bistumsleitung zu diskutieren. Die Jugendlichen
pendeln zwischen dem Klostergelände St. Magdalena, dem Haus der
Kirchenmusik, Dom und Bistumsarchiv. Das Interesse ist groß: Auch
in diesem Jahr übersteigt die Nachfrage das Platzangebot. Bis
einschließlich Dienstag (2. Mai) lernen rund 470 Schüler ihr Bistum
aus der Nähe kennen – die meisten kamen in dieser Woche. Am
nächsten Dienstag beschließt die Bischöfliche Maria-Ward-Schule
Landau die diesjährigen Schülertage.
"Es fehlte ein Angebot für Schüler", blickt Schulrätin i.K. und
Leiterin der Schülertage Irina Kreusch einige Jahre zurück. Es gab
zwar ein Informationsangebot für Religionslehrer an Gymnasien, aber
"wir wollten mehr bieten". Zumal wie sie sagt, Kirche als
Institution auf dem Lehrplan der Oberstufen steht – indes
"Schulbücher bieten nichts zur eigenen Diözese", weiß die
Schulrätin. Sie fragte bei Schulen nach, ob Interesse an
Schülertagen besteht und stellte schnell fest: Der Bedarf war da.
Gleich beim ersten Mal meldeten sich viele Schulen an, so dass ein
einwöchiges Programm aus der Taufe gehoben wurde. Jetzt, im fünften
Jahr, freut sich Irina Kreusch über den ungebrochenen Zuspruch von
Schulen – und von diözesanen Mitarbeitern, von denen immer wieder
weitere mit neuen Angeboten dazustoßen.
 "Glauben zum Erleben – Mit Gott auf du und du" war der
Titel des Workshops, der neu ins Programm kam. Christian Knoll,
Referent für religiöse Bildung beim Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) Speyer, suchte mit Jugendlichen das Gespräch über
persönliche Glaubensfragen – so persönlich, dass Lehrer gebeten
wurden, nicht dabei zu sein. Ebenfalls ohne Lehrer lief "Dein
Leben, dein Weg", bei dem Schüler wie Workshop-Leiter intensive
Erfahrungen machten. "Gott hat für jeden einen Plan", formulierte
Pfarrer Ralf Feix die These. "Dafür wollen wir sensibilisieren."
Feix, Pastoralreferentin Sandra Petrollo-Shahtout und Schwester
Carla haben in den Gesprächen die Qual der Wahl gespürt, die
Jugendliche umtreibt. Nach dem Abitur stehen viele Wege offen, aber
welcher ist der richtige? Sehr offen sprachen die Schüler über ihre
Situation und den Druck, den sie sich selbst machen.
Entscheidungsfreiheit macht nicht glücklich, stellten die
Workshop-Leiter fest.
"Glauben zum Erleben – Mit Gott auf du und du" war der
Titel des Workshops, der neu ins Programm kam. Christian Knoll,
Referent für religiöse Bildung beim Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) Speyer, suchte mit Jugendlichen das Gespräch über
persönliche Glaubensfragen – so persönlich, dass Lehrer gebeten
wurden, nicht dabei zu sein. Ebenfalls ohne Lehrer lief "Dein
Leben, dein Weg", bei dem Schüler wie Workshop-Leiter intensive
Erfahrungen machten. "Gott hat für jeden einen Plan", formulierte
Pfarrer Ralf Feix die These. "Dafür wollen wir sensibilisieren."
Feix, Pastoralreferentin Sandra Petrollo-Shahtout und Schwester
Carla haben in den Gesprächen die Qual der Wahl gespürt, die
Jugendliche umtreibt. Nach dem Abitur stehen viele Wege offen, aber
welcher ist der richtige? Sehr offen sprachen die Schüler über ihre
Situation und den Druck, den sie sich selbst machen.
Entscheidungsfreiheit macht nicht glücklich, stellten die
Workshop-Leiter fest.
Ein besonders beliebter Workshop war auch in diesem Jahr der mit
Gefängnisseelsorgern. Neben Pastoralreferent Johannes Finck, der in
der Justizvollzugsanstalt (JVA) Schifferstadt tätig ist, war
Pastoralreferent Manfred Heitz neu dabei. Er stellte seine Arbeit
und seinen Einsatzort, die JVA Frankenthal, vor. Er machte klar,
dass auch Bagatelldelikte wie Schwarzfahren oder Diebstahl
Straftaten sind und zog eine Schlussfolgerung: "Die Vorstellung,
wir sind die Guten und die die Bösen, funktioniert nicht."
Gefangene sind für Heitz nicht Menschen zweiter Klasse. "Ich
begegne ihnen auf Augenhöhe." Er schilderte den Tagesablauf im
Gefängnis, zeigte Bilder vom Haftraum und verdeutlichte mit
ausgelegten Folien, wie groß ein Haftraum und wie er möbliert ist.
Die Schüler hörten aufmerksam zu und stellten viele Fragen: Gibt es
Hierarchien unter Gefangenen? Wie hoch ist die Selbstmordgefahr
unter Gefangenen? Wie viel Geld bekommen Inhaftierte? Wie
funktioniert Einkaufen im Gefängnis? Sie fragten Heitz wie auch
seinen Kollegen Fink, wie die Seelsorger Mördern begegnen und waren
beeindruckt, wie menschenfreundlich beide auch Tätern, die getötet
haben, begegnen.
 Weiterer Höhepunkt im Tagesprogramm: das Gespräch
mit der Bistumsleitung. Neben Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
stellten sich die Domkapitulare Franz Vogelgesang und Josef Damian
Szuba den kritischen Fragen. Ein Thema sprachen die Schüler jedem
Tag an: Warum können Frauen in der Kirche nicht die gleichen Ämter
wie Männer übernehmen? Bischof Wiesemann erläuterte den Ursprung
des Priestertums, dass Jesus es an seine Jünger übertragen hat.
Daneben habe es in der Kirche stets sehr aktive Frauen gegeben, die
großen Einfluss nahmen. Bei der Diskussion um Diakoninnen "tut sich
die Kirche schwer", räumte der Bischof ein und betonte: "Was die
Würde betrifft, gibt es in der Kirche keinen Unterschied zwischen
Frau und Mann." Bei der Frage nach dem Zölibat erläuterte er
ebenfalls die Hintergründe, wie das Gebot der Ehelosigkeit entstand
und blickte nach vorn: "Es kann sein, dass sich am Pflichtzölibat
etwas tut." Er erklärte die Haltung der Kirche gegenüber
Homosexualität und diskutierte mit den Schülern über das Thema
Missbrauch in der Kirche. Er erklärte wie Vorsorge getroffen wird,
um künftig solchen Taten vorzubeugen, und wie Aufklärung betrieben
wird. Er versicherte: "Wir nehmen jeden Fall ernst". Der Bischof
gewährte den Schülern Einblicke in sein privates Leben, etwa als er
die Frage nach seiner Berufung beantwortete. Lehrerin Doris Eichert
vom Siebenpfeiffer-Gymnasium aus Kusel zollte dem Bischof Respekt:
"Er hat sich bei theologischen Themen sehr kritisch und zeitgemäß
gezeigt und ist offen auf die Fragen der Schüler eingegangen."
Weiterer Höhepunkt im Tagesprogramm: das Gespräch
mit der Bistumsleitung. Neben Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
stellten sich die Domkapitulare Franz Vogelgesang und Josef Damian
Szuba den kritischen Fragen. Ein Thema sprachen die Schüler jedem
Tag an: Warum können Frauen in der Kirche nicht die gleichen Ämter
wie Männer übernehmen? Bischof Wiesemann erläuterte den Ursprung
des Priestertums, dass Jesus es an seine Jünger übertragen hat.
Daneben habe es in der Kirche stets sehr aktive Frauen gegeben, die
großen Einfluss nahmen. Bei der Diskussion um Diakoninnen "tut sich
die Kirche schwer", räumte der Bischof ein und betonte: "Was die
Würde betrifft, gibt es in der Kirche keinen Unterschied zwischen
Frau und Mann." Bei der Frage nach dem Zölibat erläuterte er
ebenfalls die Hintergründe, wie das Gebot der Ehelosigkeit entstand
und blickte nach vorn: "Es kann sein, dass sich am Pflichtzölibat
etwas tut." Er erklärte die Haltung der Kirche gegenüber
Homosexualität und diskutierte mit den Schülern über das Thema
Missbrauch in der Kirche. Er erklärte wie Vorsorge getroffen wird,
um künftig solchen Taten vorzubeugen, und wie Aufklärung betrieben
wird. Er versicherte: "Wir nehmen jeden Fall ernst". Der Bischof
gewährte den Schülern Einblicke in sein privates Leben, etwa als er
die Frage nach seiner Berufung beantwortete. Lehrerin Doris Eichert
vom Siebenpfeiffer-Gymnasium aus Kusel zollte dem Bischof Respekt:
"Er hat sich bei theologischen Themen sehr kritisch und zeitgemäß
gezeigt und ist offen auf die Fragen der Schüler eingegangen."
Schüler des Landauer Eduard-Spranger-Gymnasiums bedauerten, an
einem Tag nach Speyer gekommen zu sein, an dem der Bischof nicht
zur Verfügung stand, sagten Jana (17) und Benedikt (18). Er hätte
gerne mehr über den Dom erfahren, etwa den Kaisersaal. Beim
Dombesuch konnten die Jugendlichen wählen, ob sie mehr über die
Krypta, Orgel, Katharinenkapelle, Domarchitektur, gregorianischen
Gesang oder die Sakristei mit dem Codex Aureus erfahren wollen.
Anschließend wurden Informationen über das Bistum und Schwerpunkte
des Caritasverbandes für die Diözese Speyer präsentiert.
Hoch im Kurs standen bei Benedikt und seinen Schulkameraden die
Workshops. "Gut, weil praxisbezogen", meinte David (18), der das
Bistumsarchiv und die "pilger"-Redaktion besuchte. Olivia (17)
informierte sich bei "Young Caritas" über ein Freiwilliges Soziales
Jahr (FSJ) sowie bei der Gefängnisseelsorge. Sie und David fanden
schade, dass nicht mehr Zeit für Workshops blieb – beide hätten
gerne statt zwei noch einen dritten besucht.
Für manche Schulen sind die Reisekosten eine Hürde, erläutert
Schulrätin Irina Kreusch. Umso mehr freute sie sich über die
Schüler des Siebenpfeiffer-Gymnasiums aus Kusel, die dieses Jahr
den weitesten Weg nach Speyer zurücklegten. Wegen des großen
Aufwandes reiste die Schule nicht nur mit der zwölften
Jahrgangsstufe an, sondern auch mit der elften und zehnten. Ein
Aufwand, der sich lohnte. Lehrerin Doris Eichert war begeistert:
"Eine sehr gute Mischung zwischen Information über das eigene
Bistum und authentischen Glaubensvertretern." Text und
Fotos: Yvette Wagner
01.05.2017
Am Pfingstmontag wird erstmals wieder der Domnapf gefüllt
 Bistum feiert Jubiläum seiner Neugründung vor 200
Jahren
Bistum feiert Jubiläum seiner Neugründung vor 200
Jahren
spk. Speyer- Mit einem ganz besonderen Geschenk zur
Feier des 200-jährigen Jubiläums der Neugründung des Bistums
Speyer wartete an diesem Freitag die „Weinbruderschaft der Pfalz“
im Rahmen eines Pressegesprächs im „Blauen Salon“ des Bischöflichen
Ordinariats in Speyer auf. Der Ordensmeister der Vereinigung,
Oliver Stiess, konnte nämlich ankündigen, dass am
Pfingstmontag, dem 5. Juni - erstmals seit dem 950.
Weihejubiläum der Kathedrale - wieder der Domnapf, der steinerne
Napf vor dem Speyerer Gotteshaus - mit edlem Pfälzer Wein gefüllt
und sein Inhalt dank der großzügigen Spende der Bruderschaft im
Anschluss an das feierliche Pontifikalamt kostenlos an die
Mitfeiernden ausgeschenkt werden wird.
Mit diesem Gottesdienst (und dem anschließenden Weinausschank),
zu dem sich auf kirchlicher Seite neben zahlreichen Bischöfen
benachbarter Diözesen auch der Nuntius des Apostolischen Stuhls
in Berlin, Erzbischof Eterovic, sowie auf weltlicher Seite u.a.
die Ministerpräsidentinnen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland,
Malu Dreyer und Annegret Kramp-Karrenbauer ihre Teilnahme
angekündigt haben, finden die Feierlichkeiten zum 200-jährigen
Jubiläum des wiedererstandenen Bistums ihren Höhepunkt. Zuvor
schon, am 16. Mai, wird das umfangreiche Jubiläums-Programm mit
einem wissenschaftlichen Vortrag von Prof. Dr. Klaus
Unterburger von der Universität Regensburg zum Thema „200 Jahre
Neues Bistum Speyer“ eröffnet, ein Programm, das von zahlreichen
weiteren Veranstaltungen, u.a. der Uraufführung des eigens zu
diesem Anlass für das „Chawwerrusch Theater“ Herxheim verfassten
Theaterstücks „Wer die Wahrheit tut – Scheidewege des neuen
Bistums“ begleitet wird.
 „Seht, ich mache alles neu“ (Off 21,5) – unter
dieses Leitwort haben die Verantwortlichen des Bistums diese
zentrale Feier am Pfingstmontag gestellt, die genau 200 Jahre nach
der Unterzeichnung des Bayerischen Konkordats stattfinden wird, mit
dem das Bistum Speyer 1817 in den Grenzen des bayerischen
„Rheinkreises“ wieder errichtet worden war. Zuvor schon war das
frühere Fürstbistum Speyer in der Folge der Französischen
Revolution im Jahr 1801 untergegangen.
„Seht, ich mache alles neu“ (Off 21,5) – unter
dieses Leitwort haben die Verantwortlichen des Bistums diese
zentrale Feier am Pfingstmontag gestellt, die genau 200 Jahre nach
der Unterzeichnung des Bayerischen Konkordats stattfinden wird, mit
dem das Bistum Speyer 1817 in den Grenzen des bayerischen
„Rheinkreises“ wieder errichtet worden war. Zuvor schon war das
frühere Fürstbistum Speyer in der Folge der Französischen
Revolution im Jahr 1801 untergegangen.
Domnapf als historischer Blickfang vor der Kathedrale
Seine historische Aufgabe als Markstein zwischen den
Hoheitsgebieten von Bischof und Stadt hat der steinerne Napf vor
dem Speyerer Dom zwar längst verloren, doch hat ein beliebter
Brauch aus dem Mittelalter die Zeitläufte überdauert: Bei
besonderen kirchlichen Ereignissen, insbesondere bei der Weihe
eines neuen Bischofs, wird der Domnapf noch immer "zu des Volkes
Lust und Fröhlichkeit" mit einem "guten Fuder weißen oder roten
Weines" gefüllt, wie der geschichtsbewußte Weihbischof und
Dompropst Otto Georgens bei dem Pressegespräch zu der
bevorstehenden Domnapffüllung berichten konnte. Erstmals urkundlich
erwähnt worden sei die steinerne Schüssel im Jahr 1314, so Georgens
- in ihrer jetzigen Gestalt stamme sie allerdings erst aus dem Jahr
1490.
 Im Mittelalter markierte die steinerne Schüssel die Grenze
zwischen der Freien Reichsstadt und dem Hochstift Speyer, in dem
bischöfliches Recht galt. Ein in der Reichsstadt Verurteilter
konnte so also Zuflucht im Herrschaftsbereich des Bischofs suchen
und auf dessen Gnade hoffen. Für ihn wurde der Domnapf also auch zu
einer Art Freiheitssymbol – ein frühes, gerade heute wieder heftig
diskutiertes „Kirchenasyl“.
Im Mittelalter markierte die steinerne Schüssel die Grenze
zwischen der Freien Reichsstadt und dem Hochstift Speyer, in dem
bischöfliches Recht galt. Ein in der Reichsstadt Verurteilter
konnte so also Zuflucht im Herrschaftsbereich des Bischofs suchen
und auf dessen Gnade hoffen. Für ihn wurde der Domnapf also auch zu
einer Art Freiheitssymbol – ein frühes, gerade heute wieder heftig
diskutiertes „Kirchenasyl“.
Vom Domnapf aus wurden in jener Zeit aber auch Urteile
vollstreckt: „Böszüngige Weiber“ und „ungetreue Männer“ z.B.
mussten, fast nackt, unter dem Gespött der Bevölkerung, einen
sogenannten Schandstein am Hals vom Domnapf über die etwa
700 Meter lange heutige Maximilianstraße bis zum Altpörtel
tragen. Auch der Pranger war damals neben dem Domnapf aufgestellt
und im Jahr 1361, so berichtet der Chronist, schnitt man dort sogar
einem Gotteslästerer die Zunge ab.
 Zu Zeiten des Fürstbistums Speyer durften sich die
Speyerer letztmals im Januar 1611 über eine Domnapffüllung freuen,
als der neue Bischof Philipp Christoph von Sötern in die
Stadt einzog. Anschließend verhinderten dann wohl Kriege wie der
„Dreißigjährige Krieg“ und der „Pfälzische Erbfolgekrieg“ und die
damit einhergehenden Zerstörungen größere Feiern. 1794 wurde der
Domnapf von den französischen Revolutionstruppen gar ganz entfernt
und durch den besagten „Freiheitsbaum“ ersetzt. Nach dem Anschluss
der linksrheinischen deutschen Gebiete an Frankreich wurde das
Fürstbistum schließlich säkularisiert. Doch schon um das Jahr 1822
rückte der Domnapf wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit,
berichtete der Weihbischof weiter. Zunächst südlich vom Dom
platziert erhielt „die Dumschissel“ - so der Kosenamen der Speyerer
für „ihren Domnapf“ - im Rahmen der 900 Jahr Feier der
Grundsteinlegung des Domes im Jahr 1930 wieder ihren angestammten,
zentralen Platz vor der Kathedrale, wenige Meter nur von der Stelle
entfernt, an der er schon im Mittelalter stand. Anlässe für
Domnapffüllungen in den vergangenen zehn Jahren waren die
Amtseinführung von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 2.
März 2008 sowie das 950. Weihejubiläum des Domes am 20. Oktober
2011.
Zu Zeiten des Fürstbistums Speyer durften sich die
Speyerer letztmals im Januar 1611 über eine Domnapffüllung freuen,
als der neue Bischof Philipp Christoph von Sötern in die
Stadt einzog. Anschließend verhinderten dann wohl Kriege wie der
„Dreißigjährige Krieg“ und der „Pfälzische Erbfolgekrieg“ und die
damit einhergehenden Zerstörungen größere Feiern. 1794 wurde der
Domnapf von den französischen Revolutionstruppen gar ganz entfernt
und durch den besagten „Freiheitsbaum“ ersetzt. Nach dem Anschluss
der linksrheinischen deutschen Gebiete an Frankreich wurde das
Fürstbistum schließlich säkularisiert. Doch schon um das Jahr 1822
rückte der Domnapf wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit,
berichtete der Weihbischof weiter. Zunächst südlich vom Dom
platziert erhielt „die Dumschissel“ - so der Kosenamen der Speyerer
für „ihren Domnapf“ - im Rahmen der 900 Jahr Feier der
Grundsteinlegung des Domes im Jahr 1930 wieder ihren angestammten,
zentralen Platz vor der Kathedrale, wenige Meter nur von der Stelle
entfernt, an der er schon im Mittelalter stand. Anlässe für
Domnapffüllungen in den vergangenen zehn Jahren waren die
Amtseinführung von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 2.
März 2008 sowie das 950. Weihejubiläum des Domes am 20. Oktober
2011.
 Die historische Bedeutung des Domnapfs erklärt auch eine
Inschrift in lateinischer Sprache auf dem wulstartigen, bronzenen
Reif am oberen Rand des Domnapfs; eine Bronzetafel zu Füssen des
Steintrogs erklärt den Domnapf in einer zeitgemäßen Sprache, die
Weihbischof Georgens, ein durchaus begabter Dichter, in eine
feinsinnig gereimte Form gegossen hat.
Die historische Bedeutung des Domnapfs erklärt auch eine
Inschrift in lateinischer Sprache auf dem wulstartigen, bronzenen
Reif am oberen Rand des Domnapfs; eine Bronzetafel zu Füssen des
Steintrogs erklärt den Domnapf in einer zeitgemäßen Sprache, die
Weihbischof Georgens, ein durchaus begabter Dichter, in eine
feinsinnig gereimte Form gegossen hat.
Wurde der Wein in früheren Zeiten noch mittels Schöpfkellen aus
einer dem Napf angepassten Metallwanne ausgeschenkt, so fertigten
aus Anlass der 2000-Jahr-Feier der Stadt Speyer im Jahr 1990
Mitarbeiter der BASF-Kunststoffwerkstatt eine Schale aus
glasfaserverstärktem Polyesterharz. Aus dieser wird heute –
durchaus allerhöchsten hygienischen Ansprüchen entsprechend - der
edle Rebensaft - jeweils rund 1400 Liter - über eine gläserne
Ringleitung mit acht Zapfstellen in eigens zu den festlichen
Anlässen gestaltete Gläser gefüllt.
„Vermählung“ zwischen Ober- und Mittelhaardt - Rieslingweine
aus Frankweiler und Mußbach zu edlem Cuvée verbunden
Bei dem Wein, der diesmal von der Weinbruderschaft der
Pfalz gestiftet wird, handelt es sich um ein 2016er
Riesling-Cuveé, das, so Bernhard Lidy von den
Weingütern Lidy in Frankweiler (Südliche Weinstraße)
„ohne Einsatz einer Pumpe oder anderer technischer Hilfsmittel auf
traditionelle, herkömmliche Art aus zwei Riesling-Weinen bester
Pfälzer Provenienz „vermählt“ worden seien“ - aus einem Riesling
aus der Lage „Frankweiler Kalkgrube“ aus Lidys eigenem
Weinbaubetrieb und einem zweiten Wein der gleichen Rebsorte aus der
Lage „Gimmeldinger Meerspinne“, gelesen und ausgebaut im
Keller des Weinguts Axel Schäfer Neustadt-Mußbach. „Dieser
Wein hat eine wunderbare Harmonie auf der Zunge und im Gaumen“,
bescheinigte der Ordensmeister der „Weinbruderschaft der Pfalz“,
Oliver Stiess die Auswahl des Cuvées.
 Den Ausschank des Weines am Pfingstmontag übernehmen auch
in diesem Jahr wieder Mitglieder des Verkehrsvereins Speyer e.V.,
die, so ihr Vorsitzender Uwe Wöhlert, es „als eine große
Ehre verstehen, diesen Dienst anlässlich des Bistumsjubiläums
leisten zu dürfen“.
Den Ausschank des Weines am Pfingstmontag übernehmen auch
in diesem Jahr wieder Mitglieder des Verkehrsvereins Speyer e.V.,
die, so ihr Vorsitzender Uwe Wöhlert, es „als eine große
Ehre verstehen, diesen Dienst anlässlich des Bistumsjubiläums
leisten zu dürfen“.
Insgesamt habe das Bistum Speyer auch zu dieser Gelegenheit
wieder 10.000 Gläser produzieren lassen, die mit dem Logo des
Bistumsjubiläums geschmückt, am Pfingstmontag ab 10.30 Uhr an drei
Verkaufsständen auf dem Domplatz zum Preis von 3,00 Euro pro Stück
verkauft werden. Wegen des auch bei dieser Domnapffüllung wieder zu
erwartenden großen Interesses, so der Kanzleidirektor des
Bischöflichen Ordinariats, Wolfgang Jochim, können pro Person
nur maximal 6 Gläser abgegeben werden. Der Erlös aus dem
Glasverkauf wird wieder einem wohltätigen Zweck zugeführt, der in
Kürze bekannt gegeben wird. Der Wein selbst ist kostenlos - für
Kinder und Erwachsene, die keinen Alkohol trinken möchten, gibt es
auch Mineralwasser.
Der Ausschank aus dem Domnapf beginnt nach dem Pontifikalamt um
circa 12 Uhr, sobald der Vorsitzende des Verkehrsvereins Speyer Uwe
Wöhlert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann das erste Glas überreicht
hat. Fotos: gc//Stadtarchiv Speyer
29.04.2017
Der Domnapf wir am Pfingstmontag wieder gefüllt
Papstbesuch jährt sich
 Am 4. Mai
1987 besuchte Papst Johannes Paul II. Speyer – Erinnerung bis heute
lebendig
Am 4. Mai
1987 besuchte Papst Johannes Paul II. Speyer – Erinnerung bis heute
lebendig
Speyer- Vor 30 Jahren besuchte Papst
Johannes Paul II. Speyer. Er folgte damit der Einladung des
damaligen Bischofs von Speyer Dr. Anton Schlembach. Der letzte
Besuch eines Papstes in der Domstadt lag da schon 930 Jahre zurück.
Entsprechend groß war an diesem Tag der Andrang vor dem Dom: ca.
60.000 Menschen feierten zusammen mit dem Papst die Heilige Messe.
Das Messgewand, das er dabei trug, kann zurzeit im Historischen
Museum der Pfalz betrachtet werden. Dort macht eine Ausstellung die
Erinnerung an diesen Tag wieder lebendig.
Anknüpfungspunkt für die Einladung von Papst Johannes Paul II.
war das Wirken der Heiligen Edith Stein in Speyer, denn die Reise
des Papstes war mit deren Seligsprechung verbunden. Diese erfolgte
am 1. Mai 1987 in Köln. Am 4. Mai kam der Papst dann nach Speyer,
wo Edith Stein an den Schulen des Klosters St. Magdalena als
Lehrerin tätig gewesen war.
Nach der Ankunft und Begrüßung auf dem Hubschrauber-Landeplatz
beim Schulzentrum Ost fuhr Papst Johannes Paul II. mit dem
Papamobil ins Stadtzentrum. Bei seiner Fahrt auf der
Maximilianstraße, die direkt auf den Dom zuführt, wurde er
begeistert durch die am Straßenrand stehende Menschenmenge
bejubelt. Danach besuchte der Papst zusammen mit Bischof Anton
Schlembach und den Mitgliedern des Domkapitels den Dom. Dort betete
er vor der Marienstatue, sprach in der Grablege der Kaiser das
kirchliche Totengebet und segnete die Gräber. Anschließend
zelebrierte der Papst auf dem Domplatz zusammen mit 60.000
Gläubigen eine Eucharistiefeier.
Museumsausstellung macht Erinnerung an Papstbesuch
lebendig
 Bei der
Eucharistiefeier in Speyer trug der Papst ein Messgewand, das
eigens zu diesem Zweck in Rom gefertigt worden war. Dieses Gewand
ist derzeit in der Ausstellung „Weltbühne Speyer - Die Ära der
großen Staatsbesuche“ im Historischen Museum in Speyer zu sehen.
Auf die goldfarbene Kasel sind drei rote Kreuze aufgestickt, die
beidseitig auf dem Stab des Gewandes zu sehen sind. Unter den roten
Kreuzen ist auf der Rückenseite das päpstliche Wappen eingestickt.
Im rechten unteren Wappenfeld verweist der Buchstabe M auf die
Gottesmutter Maria. Ihr und dem heiligen Stephanus ist der Speyerer
Dom geweiht. Da Johannes Paul II. am 27. April 2014
heiliggesprochen wurde, ist das Gewand ebenso wie das Messbuch, aus
dem der Papst während der Messe vor dem Kaiserdom las, eine
Berührungsreliquie.
Bei der
Eucharistiefeier in Speyer trug der Papst ein Messgewand, das
eigens zu diesem Zweck in Rom gefertigt worden war. Dieses Gewand
ist derzeit in der Ausstellung „Weltbühne Speyer - Die Ära der
großen Staatsbesuche“ im Historischen Museum in Speyer zu sehen.
Auf die goldfarbene Kasel sind drei rote Kreuze aufgestickt, die
beidseitig auf dem Stab des Gewandes zu sehen sind. Unter den roten
Kreuzen ist auf der Rückenseite das päpstliche Wappen eingestickt.
Im rechten unteren Wappenfeld verweist der Buchstabe M auf die
Gottesmutter Maria. Ihr und dem heiligen Stephanus ist der Speyerer
Dom geweiht. Da Johannes Paul II. am 27. April 2014
heiliggesprochen wurde, ist das Gewand ebenso wie das Messbuch, aus
dem der Papst während der Messe vor dem Kaiserdom las, eine
Berührungsreliquie.
Bei vielen Menschen ist die Erinnerung an den Besuch des Papstes
bis heute lebendig. Die katholischen Kinder des Bistums hatten
eigens schulfrei erhalten, um die Messe vor dem Dom mitfeiern zu
können. In der Ausstellung „Weltbühne Speyer“ wird durch
Fotografien und Filmsequenzen deutlich, wie viele Menschen der
Papstbesuch auf die Straßen und vor den Dom lockte. Neben dem
Gewand des Papstes sind auch das Messbuch sowie das Goldene Buch
des Doms mit der Unterschrift des Papstes ausgestellt. Die
Ausstellung ist noch bis zum 24. September 2017 im Historischen
Museum der Pfalz zu sehen.
www.dom-zu-speyer.de
http://museum.speyer.de/aktuell/weltbuehne-speyer
Text: is; Foto: Bistum Speyer, Betina Deuter
26.04.2017
„Auferstehung ist Sendung in die Welt hinein“
.jpg) Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann predigt am Ostersonntag und in der Osternacht
im Dom zu Speyer
Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann predigt am Ostersonntag und in der Osternacht
im Dom zu Speyer
Speyer- Zahlreiche Gläubige besuchten an den
Ostertagen die festlich gestalteten Ostergottesdienste im Speyerer
Dom. In der Osternacht feierten sie die Auferstehung Jesu als
Höhepunkt des Karwoche und des gesamten Kirchenjahres.
„Ist das Christentum nach zwei Jahrtausenden am Ende? Oder steht
es erst ganz am Anfang?“ Diese Frage stellte Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann an den Anfang seiner Predigt am Ostersonntag. Wegen
Fundamentalismus und Terrorismus werde Religion von vielen als
lebensbedrohend und gewalttätig erlebt. „Doch überdurchschnittlich
häufig sind Christen Opfer dieser Gewalt. Das Christentum ist die
am stärksten verfolgte Religion in der Welt“, betonte der Bischof
im Blick auf die Anschläge in Ägypten am Palmsonntag.
Was die Auferstehung Christi bedeutet, müsse man immer neu
lernen. „Wer sich darauf einlässt und den Glauben wagt, dem wird
die Wahrheit des Auferstandenen aufgehen.“ Das gelte für den
Einzelnen wie auch für die Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit.
Auferstehung sei nicht nur der Rückblick ins leere Grab oder die
Tröstung für die Zukunft: „Auferstehung ist Sendung in die Welt
hinein“. Sie mache nicht weltfremd, sondern weltfähig. „Das
Biedermeier der Selbstbezogenheit ist zu Ende“, so der Bischof. Die
Wahrheit der Auferstehung befreie den Menschen aus seinem kleinen,
selbstbezogenen Horizont und macht ihn fähig zum globalen Denken,
Lieben und Handeln.
.jpg) Die Welt
befinde sich aktuell in einer „gefährlich unvollendeten,
abgebrochenen Globalisierung mit nur gemeinsam und global zu
lösenden, hochexplosiven Problemen wie Terrorismus, nuklearem
Wahnsinn, Korruption, Flüchtlingselend, Ausbeutung der Armen und
Schwachen.“ Diese Situation rufe nach einer „geistigen und
moralischen Kraft, die eine Vision in sich trägt, wie gemeinsames
Leben ohne ständige gegenseitige Verwundung und Demütigung möglich
wäre“. Die Christen hätten zu lernen, „in der Kraft der
Auferstehung ihre Sendung für die Welt gemeinsam zu begreifen und
anzugehen.“
Die Welt
befinde sich aktuell in einer „gefährlich unvollendeten,
abgebrochenen Globalisierung mit nur gemeinsam und global zu
lösenden, hochexplosiven Problemen wie Terrorismus, nuklearem
Wahnsinn, Korruption, Flüchtlingselend, Ausbeutung der Armen und
Schwachen.“ Diese Situation rufe nach einer „geistigen und
moralischen Kraft, die eine Vision in sich trägt, wie gemeinsames
Leben ohne ständige gegenseitige Verwundung und Demütigung möglich
wäre“. Die Christen hätten zu lernen, „in der Kraft der
Auferstehung ihre Sendung für die Welt gemeinsam zu begreifen und
anzugehen.“
Bischof Wiesemann würdigte in seiner Predigt zugleich Papst
Benedikt, der am Ostersonntag seinen 90. Geburtstag feierte. Durch
sein Festhalten an „einer starken Vernunft im Herzen des Glaubens“
habe er wie kaum jemand zuvor den globalen Horizont der
Auferstehung in Erinnerung gerufen. Was das bedeute in einer Welt,
die „mit Fake-News und schamloser Propaganda das Vertrauen in ihre
eigene Vernünftigkeit und Wahrheitsfähigkeit zu verlieren droht“,
könne man nicht hoch genug einschätzen.
Im Rahmen des festlichen Gottesdienstes am Ostersonntag führten
unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller der Mädchenchor, die Domsingknaben, der
Domchor und die Dombläser die „Missa octo vocum“ von Francesco
Bianchiardi und das Regina caeli von Gregor Aichinger auf. An der
Orgel musizierte Domorganist Markus Eichenlaub.
Drei Symbole der Auferstehung: Licht, Wasser und
Jubel
.jpg) In seiner
Predigt in der Osternacht sprach Bischof Wiesemann von „drei
Symbolen, die in die Wirklichkeit der Auferstehung hineintreffen
und in der Feier der Osternacht inszeniert werden: Licht, Wasser
und der Jubel – das Halleluja“. Das Symbol des Lichtes könne gegen
die große Finsternis aufleuchten und sie vertreiben, so Wiesemann.
Dabei bezog er die Dunkelheit auf die Angst der Menschen und
erinnerte an die Attentate auf die koptischen Christen vor wenigen
Tagen in Ägypten. „Wenn sie Osternacht feiern, dann lassen sie sich
dennoch nicht von der Angst bezwingen.“ Die Bedeutung des Wassers
werde bei der Taufe deutlich, sagte der Bischof und zeigte sich
erfreut über eine Erwachsenentaufe im Anschluss an die Predigt. Bei
dem jungen Mann, der getauft wurde, handelte es sich um einen
Erzieher in einem katholischen Kindergarten, dessen Eltern aus
Vietnam stammen.
In seiner
Predigt in der Osternacht sprach Bischof Wiesemann von „drei
Symbolen, die in die Wirklichkeit der Auferstehung hineintreffen
und in der Feier der Osternacht inszeniert werden: Licht, Wasser
und der Jubel – das Halleluja“. Das Symbol des Lichtes könne gegen
die große Finsternis aufleuchten und sie vertreiben, so Wiesemann.
Dabei bezog er die Dunkelheit auf die Angst der Menschen und
erinnerte an die Attentate auf die koptischen Christen vor wenigen
Tagen in Ägypten. „Wenn sie Osternacht feiern, dann lassen sie sich
dennoch nicht von der Angst bezwingen.“ Die Bedeutung des Wassers
werde bei der Taufe deutlich, sagte der Bischof und zeigte sich
erfreut über eine Erwachsenentaufe im Anschluss an die Predigt. Bei
dem jungen Mann, der getauft wurde, handelte es sich um einen
Erzieher in einem katholischen Kindergarten, dessen Eltern aus
Vietnam stammen.
Das letzte Symbol, das Halleluja, bringe die Freude über die
Auferstehung zum Ausdruck. Der Christ sei in seiner Seele ein
singender Mensch, weil in ihm das Leben des Auferstandenen lebe, so
der Bischof.
Begonnen hatte der Gottesdienst in der Osternacht in der
Domvorhalle. Am Osterfeuer entzündete der Bischof die Osterkerze,
anschließend wurde das Licht an alle Gläubigen in der voll
besetzten Kathedrale weitergegeben.
Für die musikalische Gestaltung des Pontifikalamtes in der
Osternacht sorgten unter der Gesamtleitung von Domkapellmeister
Markus Melchiori das Vokalensemble der Dommusik, die Schola
Cantorum Saliensis, die Dombläser Speyer sowie Domorganist Markus
Eichenlaub.
Text: is; Fotos: Klaus Landry
16.04.2017
„Gewalt behält nicht das letzte Wort“
 Kirchenpräsident Christian Schad: Die Ostergeschichte kann
den Blick auf die Welt verändern
Kirchenpräsident Christian Schad: Die Ostergeschichte kann
den Blick auf die Welt verändern
Speyer- Der pfälzische Kirchenpräsident
Christian Schad ruft anlässlich des Osterfestes dazu auf, gegen die
vielfältigen Formen der Ungerechtigkeit Einspruch zu erheben und
sich gegen den Terror in der Welt aufzulehnen. Mit dem Osterfest
verbinde sich die verwegene Hoffnung auf den auferstandenen
Christus. „Mit Ostern ist der Bann des Todes gebrochen, mit dem die
Angst uns belegen möchte“, erklärt der Kirchenpräsident. „Gewalt
behält nicht das letzte Wort, Versöhnung ist möglich.“ Schad hält
die Predigt im Ostergottesdienst in der Speyerer
Gedächtniskirche.
Der Glaube an die Auferstehung sei auch der Beginn eines neuen
Vertrauens, sagt Kirchenpräsident Christian Schad. „Christus ist
für mich da, wenn mein Leben schwer ist und ich nicht weiter weiß.
Wenn die Traurigkeit wie eine dunkle Decke auf mir liegt und das
Atmen schwer fällt.“ In einer Zeit, in der wir konfrontiert seien
mit Ausgrenzung und Populismus, mit pauschalem Schwarz-Weiß-Denken
und nationalistischen Positionierungen, welche die mühsam
erworbenen Freiheiten wieder einschränken wollten, könne das
Vertrauen in die Osterbotschaft den Blick auf die Welt
verändern.
„Wir verstehen Überlegungen nicht, Mauern zu errichten, die nur
Entfremdung und Zwietracht bewirken, statt Brücken der
Verständigung zu bauen. Wir erschrecken über die Gewalt im Nahen
Osten. Die Attentate in Ägypten sind auch ein Angriff gegen das
friedliche Zusammenleben von Christen und Muslimen“, erklärt
Kirchenpräsident Schad. Auch mache der islamistische Terror vor
Europa keinen Halt, wie die jüngsten Anschläge in London, St.
Petersburg und Stockholm zeigten. Dennoch, betont Schad, lohne
jeder einzelne Mensch „alle unsere Bemühungen und jeden Einsatz. Es
gibt keine hoffnungslosen Fälle mehr. Christus ist auferstanden,
der Tod hat sich die Zähne an ihm ausgebissen“. Text und
Foto: lk
15.04.2017
90. Geburtstag von Benedikt XVI.
 Ministerpräsidentin Malu Dreyer dankt Benedikt XVI. für
seinen Dienst in Kirche und Welt
Ministerpräsidentin Malu Dreyer dankt Benedikt XVI. für
seinen Dienst in Kirche und Welt
Mainz- Ministerpräsidentin Malu Dreyer
gratuliert Benedikt XVI. zu seinem 90. Geburtstag am 16. April.
„Dem christlichen Glauben und seinen Werten tief verbunden, hat er
in seinen herausragenden Ämtern die katholische Kirche seit dem
Zweiten Vatikanischen Konzil maßgeblich mit geprägt“, würdigt
Ministerpräsidentin Malu Dreyer seine Heiligkeit. „Sein tiefer
Glaube, seine hohe theologische und philosophische Bildung und
seine menschliche Bescheidenheit haben weltweit nicht nur
Katholiken und Katholikinnen beeindruckt.“
Benedikt XVI. habe in seiner viel beachteten Ansprache am 22.
September 2011 im Deutschen Bundestag die Frage nach den tieferen
Grundlagen des Rechts in den Mittelpunkt gestellt. Bemerkenswert
sei auch gewesen, dass er auf dem Höhepunkt der Finanzkrise in
seiner Sozialenzyklika „Caritas in veritate“ 2009 den
Verantwortlichen in der Finanzbranche, der Politik und der
Wissenschaft ins Gewissen geredet und an ihre Verantwortung für
eine gerechtere Gesellschaft erinnert habe.
„Ich danke Benedikt XVI. für seinen Dienst in Kirche und Welt.
Für das neue Lebensjahr wünsche ich ihm vor allem Gesundheit und
persönliches Wohlergehen, viel Kraft und Gottes Segen“, so die
Ministerpräsidentin. Text: stk-rlp; Foto: is
15.04.2017
Gemisch von Religion und Gewalt muss ein Ende haben
 Beim Karfreitagsgottesdienst in Germersheim (von links): Der Germersheimer Dekan Claus Müller und Kirchenpräsident Christian Schad.
Beim Karfreitagsgottesdienst in Germersheim (von links): Der Germersheimer Dekan Claus Müller und Kirchenpräsident Christian Schad.
"Die humanen Kraftquellen entdecken" sagte
Kirchenpräsident Christian Schad beim Karfreitagsgottesdienst
in Germersheim
Germersheim- Das Kreuz Jesu schärft nach
Auffassung des pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad ein,
dass das „böse Gemisch von Religion und Gewalt“ ein Ende haben
müsse. Wer im Namen einer Religion Terror ausübe, Hass säe und
Gewalt predige, der lästere Gott, erklärte Schad in seiner
Karfreitagspredigt in der Protestantischen Versöhnungskirche
Germersheim. In der Ohnmacht des Gekreuzigten entdeckten die
Christen vielmehr „die humanen, die Frieden stiftenden
Kraftquellen, die alle Menschenfeindlichkeit überwinden
können“.
Die Geschichte vom Kreuz sei nicht deswegen so anziehend, weil
Leiden etwas Schönes wäre, erläuterte der Kirchenpräsident. Sie sei
anziehend, weil sie mitten in die Wirklichkeit hinein spreche und
sich nicht hinter religiösen Wellnessformeln verstecke. Die Bibel
erzähle von einem Gott, der selbst gelitten und Ohnmacht erfahren
habe „und der mich trotzdem – oder gerade deswegen – hält und
trägt, und mich frei machen will von dem, was mich beschwert“.
Wer auf Jesus schaue, der nicht zurückgeschlagen, sondern die
Gewalt der Menschen auf sich genommen habe, verändere sich, sagte
der Kirchenpräsident. Den Weg Jesu mitgehen bedeute, an die Stelle
der Gewalt die Liebe zu setzen, an die Stelle der Habsucht die
Bereitschaft zum Teilen. „Wer Jesus folgt, der findet den Weg aus
dem Gefangensein in sich selbst hinaus in die Freiheit für den
Anderen“, erklärte Schad. Text und Foto: lk
14.04.2017
„Dieser war auch mit dem Jesus von Nazareth“

Heilige Woche am Dom beginnt mit Pontifikalamt am
Palmsonntag
Speyer- Am Palmsonntag, in diesem Jahr der
9. April, beginnt die Karwoche oder Heilige Woche, in der die
Kirche des Leidens, Sterbens und der Auferstehung Jesu gedenkt. Im
voll besetzten Speyerer Dom feierte Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann aus diesem Anlass ein Pontifikalamt. Mit dabei waren auch
die Kommunionkinder der Gemeinde Mariä Himmelfahrt, die bunt
geschmückte Zweige zur Messe mitbrachten.
Der Gottesdienst begann mit einer Statio am Ölberg auf der
südlichen Seite des Doms. Anschließend zog die Gemeinde in einer
feierlichen Prozession durch den Domgarten. In seiner Begrüßung
hatte der Bischof darauf hingewiesen, dass am Palmsonntag die
Gläubigen mit Christus in die Heilige Stadt Jerusalem einziehen und
dass der Dom selbst ein Abbild dieser heiligen Stadt sei.
 Teil der Liturgie am Palmsonntag ist die Lesung der
Matthäus Passion. Diese trug Bischof Wiesemann im Wechsel mit zwei
Lektoren vor.
Teil der Liturgie am Palmsonntag ist die Lesung der
Matthäus Passion. Diese trug Bischof Wiesemann im Wechsel mit zwei
Lektoren vor.
In seiner Predigt erinnerte der Bischof sich an einen Besuch am
Grab von Bundespräsident Johannes Rau in Berlin. Auf dessen
Grabstein stehe geschrieben: „Dieser war auch mit dem Jesus von
Nazareth“ - ein direktes Zitat aus der Passionsgeschichte nach
Matthäus. Diese Worte richten sich indirekt an den Jünger Petrus,
der daraufhin leugnet, Jesus zu kennen. Bischof Wiesemann wies
damit darauf hin, dass der Weg mit Jesus nicht immer leicht sei.
Die Kommunionkinder erinnerte er daran, dass der Gang zur Kommunion
bedeute, mit Jesus eine Gemeinschaft einzugehen.
„Das Leiden der Welt führt uns auch das Leiden Christi vor Augen“,
schloss Bischof Wiesemann seine kurze Predigt. Die Fürbitten
knüpften daran mit dem Wunsch an, dass die weltlichen und
religiösen Führer dieser Welt Respekt für die Würde aller Menschen
empfinden und Toleranz üben mögen.
 Die Dommusik Speyer gestaltete das Pontifikalamt an
Palmsonntag mit Gesang, Bläser- und Orgelklang. Unter der Leitung
von Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori
musizierten der Mädchenchor am Dom zu Speyer, die Speyerer
Domsingknaben und der Domchor Speyer sowie die Dombläser Speyer. An
der Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub. Der Auszug zum
Schluss des Gottesdienstes erfolgte traditionsgemäß in Stille.
Die Dommusik Speyer gestaltete das Pontifikalamt an
Palmsonntag mit Gesang, Bläser- und Orgelklang. Unter der Leitung
von Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori
musizierten der Mädchenchor am Dom zu Speyer, die Speyerer
Domsingknaben und der Domchor Speyer sowie die Dombläser Speyer. An
der Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub. Der Auszug zum
Schluss des Gottesdienstes erfolgte traditionsgemäß in Stille.
Palmzweige auf den Herrschergräbern
Bereits seit dem 15. Jahrhundert werden am Palmsonntag die
Herrschergräber im Speyerer Dom mit Palmzweigen geschmückt. Damit
wird verdeutlicht, dass die Kaiser und Könige ihre Macht von Gott
erhielten und ihr Amt nach ihm ausrichteten. Sie dürfen Christus
daher beim Einzug in die Heilige Stadt Jerusalem begleiten.
Text/Fotos: Friederike Walter; © Foto: Domkapitel
Speyer
10.04.2017
BDKJ-Verantwortliche zu Gast bei Ministerpräsidentin Dreyer
 Fünf Mitglieder
des BDKJ Speyer zu Gast beim Bürgerempfang in Mainz - Dank der
Ministerpräsidentin für Engagement für Demokratie und ein einiges
Europa
Fünf Mitglieder
des BDKJ Speyer zu Gast beim Bürgerempfang in Mainz - Dank der
Ministerpräsidentin für Engagement für Demokratie und ein einiges
Europa
Speyer/Mainz- Viele Helden waren gestern
in Mainz zu Gast bei Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Mit dabei
waren auch fünf Verantwortliche aus den Verbänden des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer. Neben Diözesanpräses
Carsten Leinhäuser waren auf Vorschlag der jeweiligen
Landräte und Oberbürgermeister auch Simon Schwarzmüller
(Katholische junge Gemeinde Hauenstein), Moritz Prause
(Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg), Norina Mutter
(Junge Kirche Mutterstadt) und Rebecca Heinrich
(Jugendverbände der Gemeinschaft Christlichen Lebens) zu Gast in
Mainz.
 Dreyer hatte
zum fünften Bürgerempfang 260 ehrenamtlich engagierte
Rheinland-Pfälzer geladen, die sich in besonderer Weise für
Demokratie und ein einiges Europa einsetzen. Sie seien, so die
Ministerpräsidentin, Heldinnen und Helden des Alltags. „Ich finde
es schön und es ist mir wichtig, so viele interessante Menschen
kennenzulernen, die sich mit großem Einsatz ihrem persönlichen
Herzensprojekt widmen“, sagte Dreyer. „Ohne ihre tatkräftige
Unterstützung würde dieses Land nicht so gut funktionieren.
Deswegen danke ich ihnen von ganzem Herzen“, sagte die
Ministerpräsidentin. BDKJ-Diözesanpräses Carsten Leinhäuser nutzte
gemeinsam mit Verbandlern aus den Bistümern Trier und Mainz die
Gelegenheit, Dreyer die bundesweite BDKJ-Aktion „Zukunftszeit“
vorzustellen. Mit der Aktion sammelt der BDKJ deutschlandweit bis
zur Bundestagswahl 35000 Stunden für Toleranz und Weltoffenheit.
Die Stunden kommen durch Projekte der Ehrenamtlichen in den
BDKJ-Mitgliedsverbänden zusammen und bilden in der Summe die
Stundenzahl der kommenden Legislaturperiode des Bundestages ab. Die
Aktion wirbt für ein weltoffenes Deutschland in den kommenden
Jahren. Carsten Leinhäuser freute sich, Dreyer vom Engagement der
Jugendverbände mit „Zukunftszeit“ berichten zu können. „Besonders
gefreut hat mich, dass die Ministerpräsidentin das politische
Engagement der Jugendverbände und ihren Einsatz gegen
Rechtspopulismus sehr wertschätzt“, sagte er.
Dreyer hatte
zum fünften Bürgerempfang 260 ehrenamtlich engagierte
Rheinland-Pfälzer geladen, die sich in besonderer Weise für
Demokratie und ein einiges Europa einsetzen. Sie seien, so die
Ministerpräsidentin, Heldinnen und Helden des Alltags. „Ich finde
es schön und es ist mir wichtig, so viele interessante Menschen
kennenzulernen, die sich mit großem Einsatz ihrem persönlichen
Herzensprojekt widmen“, sagte Dreyer. „Ohne ihre tatkräftige
Unterstützung würde dieses Land nicht so gut funktionieren.
Deswegen danke ich ihnen von ganzem Herzen“, sagte die
Ministerpräsidentin. BDKJ-Diözesanpräses Carsten Leinhäuser nutzte
gemeinsam mit Verbandlern aus den Bistümern Trier und Mainz die
Gelegenheit, Dreyer die bundesweite BDKJ-Aktion „Zukunftszeit“
vorzustellen. Mit der Aktion sammelt der BDKJ deutschlandweit bis
zur Bundestagswahl 35000 Stunden für Toleranz und Weltoffenheit.
Die Stunden kommen durch Projekte der Ehrenamtlichen in den
BDKJ-Mitgliedsverbänden zusammen und bilden in der Summe die
Stundenzahl der kommenden Legislaturperiode des Bundestages ab. Die
Aktion wirbt für ein weltoffenes Deutschland in den kommenden
Jahren. Carsten Leinhäuser freute sich, Dreyer vom Engagement der
Jugendverbände mit „Zukunftszeit“ berichten zu können. „Besonders
gefreut hat mich, dass die Ministerpräsidentin das politische
Engagement der Jugendverbände und ihren Einsatz gegen
Rechtspopulismus sehr wertschätzt“, sagte er.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer ist
Dachverband von sieben katholischen Kinder- und Jugendverbänden. Er
vertritt die Anliegen von 7.500 Mitgliedern in Kirche, Politik und
Gesellschaft. Mehr: www.bdkj-speyer.de. Folgen Sie uns
gerne auf Facebook, Twitter und Instagram.
Text und Foto: BDKJ Speyer
02.04.2017
Dombauverein Speyer bestätigt einstimmig seine Vorstandschaft um Prof. Dr. Gottfried Jung
 Ein- und Ausblicke in bisherige Arbeit und in Pläne für
das Jahr 2017
Ein- und Ausblicke in bisherige Arbeit und in Pläne für
das Jahr 2017
cr./fw. Speyer- Dass der Speyerer Dom über eine
ganz besondere, außergewöhnliche Anziehungskraft und spirituelle
Ausstrahlung verfügen muss, das wissen nicht nur die Speyerer. Dies
beweisen auch nicht nur die jährlich gut eine Million Besucher, die
sich allein außerhalb der Gottesdienste von der Schönheit der
romanischen Kathedrale gefangen nehmen lassen - nein, das belegt
auch die inzwischen auf 2.653 „Domfans“ angewachsene Schar treuer
Mitglieder einer Vereinigung, die für das Gotteshaus aus voller
Überzeugung „mehr tun“ will: Die Mitglieder des Speyerer
Dombauvereins. 93 von ihnen, zuzüglich der sieben bisherigen
Mitglieder des Vorstands - eine durchaus beachtliche Quote für
einen solchen „Großverein“ - trafen sich jetzt bei strahlendem
Frühlingswetter im Kleinen Saal der Speyerer Stadthalle zur
planmäßigen Mitgliederversammlung mit Neuwahlen - den ersten
übrigens nach den durch Differenzen zwischen dem langjährigen
Vereins-Vorstandes Dr. Wolfgang Hissnauer und dem Vertreter
des Domkapitels im Vorstand der Vereinigung ausgelösten
Irritationen, die mit dem vorzeitigen Rücktritt Dr. Hissnauers von
seinem Amt eskalierten.
 Für den Speyerer Juristen Prof. Dr. Gottfried
Jung, bis zu seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik Ende 2016
Fraktionsvorsitzender der CDU im Speyerer Stadtrat, der bei der
Mitgliederversammlung 2016 außerplanmäßig zum Nachfolger von Dr.
Hissnauer ins Amt des Vorstandes des Dombauvereins gewählt worden
war, bedeutete dies, dass er sich erstmals einer planmäßigen Wahl
stellen musste. Und diese bestand er überzeugend: Nachdem sich die
Versammlung unter der Leitung des früheren Speyerer Bürgermeisters
Hanspeter Brohm einstimmig für eine offene Wahl der
Vorstandschaft ausgesprochen hatte, wurde Prof. Dr. Jung bei einer
Enthaltung – der eigenen – erneut zum Vorstand des Dombauvereins
Speyer e.V. gewählt. Mit ihm wurden auch sämtliche Mitglieder des
bisherigen Geschäftsführenden Vorstands der Vereinigung –
Stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin und Schatzmeister
sowie fünf weitere Beisitzer in ihren Ämtern ohne Gegenstimme
bestätigt. Lediglich für Dr. Roman Raether, der sich nicht erneut
zur Wahl stellte, rückte Carmen Gahmig neu in die
Vorstandschaft ein.
Für den Speyerer Juristen Prof. Dr. Gottfried
Jung, bis zu seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik Ende 2016
Fraktionsvorsitzender der CDU im Speyerer Stadtrat, der bei der
Mitgliederversammlung 2016 außerplanmäßig zum Nachfolger von Dr.
Hissnauer ins Amt des Vorstandes des Dombauvereins gewählt worden
war, bedeutete dies, dass er sich erstmals einer planmäßigen Wahl
stellen musste. Und diese bestand er überzeugend: Nachdem sich die
Versammlung unter der Leitung des früheren Speyerer Bürgermeisters
Hanspeter Brohm einstimmig für eine offene Wahl der
Vorstandschaft ausgesprochen hatte, wurde Prof. Dr. Jung bei einer
Enthaltung – der eigenen – erneut zum Vorstand des Dombauvereins
Speyer e.V. gewählt. Mit ihm wurden auch sämtliche Mitglieder des
bisherigen Geschäftsführenden Vorstands der Vereinigung –
Stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin und Schatzmeister
sowie fünf weitere Beisitzer in ihren Ämtern ohne Gegenstimme
bestätigt. Lediglich für Dr. Roman Raether, der sich nicht erneut
zur Wahl stellte, rückte Carmen Gahmig neu in die
Vorstandschaft ein.
Gleich zu Beginn der Versammlung hatte Prof. Dr. Jung in seiner
Begrüßung sein erstes Jahr als Vorstand als ein „Jahr des Lernens“
charakterisiert und dabei das „sehr positive Miteinander und die
vertrauensvolle Zusammenarbeit im Vorstand“ hervorgehoben. Zu den
besonders schönen Erfahrungen, die er während des vergangenen
Jahres habe machen können, gehöre das hohe Ansehen, der
Dombauverein in der Bevölkerung genieße. Den Dom selbst bezeichnete
er als eine „Mission aus Stein“, die abseits populistischer
Strömungen auf einem festen Fundament ruhe.
 Grußworte entboten danach der Speyerer
Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann sowie der Vorstandsvorsitzende der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer, Prof. Dr. Peter Frankenberg,
der nach dem Ausscheiden von Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs
Anfang des Jahres 2017 neu ins Amt gewählt wurde. Sie alle lobten
die wichtige Arbeit des Dombauvereins und die Verdienste seiner
Mitglieder für den Erhalt der Kathedrale. Ein weiterer gemeinsamer
Punkt aller Ansprachen: die Symbolkraft des Doms, die für ein
gutes, versöhnliches Miteinander stehe.
Grußworte entboten danach der Speyerer
Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann sowie der Vorstandsvorsitzende der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer, Prof. Dr. Peter Frankenberg,
der nach dem Ausscheiden von Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs
Anfang des Jahres 2017 neu ins Amt gewählt wurde. Sie alle lobten
die wichtige Arbeit des Dombauvereins und die Verdienste seiner
Mitglieder für den Erhalt der Kathedrale. Ein weiterer gemeinsamer
Punkt aller Ansprachen: die Symbolkraft des Doms, die für ein
gutes, versöhnliches Miteinander stehe.
Als Hausherr begrüßte Oberbürgermeister Eger die
Anwesenden und lobte die sehr gute Kommunikation und Kooperation
zwischen den Akteuren rund um den Dom. Die Mitglieder des
Dombauvereins würdigte er als wichtige Multiplikatoren für die
Belange der romanischen Kathedrale. Von der Standfestigkeit und
Gelassenheit des Doms zu lernen, empfahl er augenzwinkernd
angesichts der noch immer laufenden Abstimmungsarbeiten an der
neuen Außenbeleuchtung des Doms. Eger dankte hierzu insbesondere
Dombaumeister Mario Colletto für seinen Einsatz bei der
Optimierung der Illumination.
 Der Bischof von Speyer Dr. Karl-Heinz Wiesemann
sprach von seinem Besuch in der Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im
Historischen Museum der Pfalz. Bei der Schau, die der Ära der
großen Staatsbesuche in Speyer gewidmet ist, stehe der Dom im
Mittelpunkt. Er strahle eine große geistige und geistliche Kraft
aus, sei Zeichen für Versöhnung, Friede und Einheit. Den
engagierten Mitgliedern und dem engagierten Vorstand dankte der
Bischof für ihren Beitrag zum Erhalt „einer der schönsten
Kathedralen der Welt“.
Der Bischof von Speyer Dr. Karl-Heinz Wiesemann
sprach von seinem Besuch in der Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im
Historischen Museum der Pfalz. Bei der Schau, die der Ära der
großen Staatsbesuche in Speyer gewidmet ist, stehe der Dom im
Mittelpunkt. Er strahle eine große geistige und geistliche Kraft
aus, sei Zeichen für Versöhnung, Friede und Einheit. Den
engagierten Mitgliedern und dem engagierten Vorstand dankte der
Bischof für ihren Beitrag zum Erhalt „einer der schönsten
Kathedralen der Welt“.
 Der frühere baden-württembergische Staatsminister für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und Rektor der Universität
Heidelberg, Prof. Dr. Peter Frankenberg, betonte die
europäische Dimension des Doms, der ihm selbst dank seiner
familiären Verbindungen nach Speyer von „Kindesbeinen an“ vertraut
sei.
Der frühere baden-württembergische Staatsminister für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und Rektor der Universität
Heidelberg, Prof. Dr. Peter Frankenberg, betonte die
europäische Dimension des Doms, der ihm selbst dank seiner
familiären Verbindungen nach Speyer von „Kindesbeinen an“ vertraut
sei.
Das „Heilige Römische Reich deutscher Nation“, in dessen Zentrum
der Speyerer Kaiser- und Mariendom einst errichtet wurde, sei
seinerzeit „ein europäisches Konstrukt“ gewesen und kein
nationales, so Prof. Dr. Frankenberg. Die Kathedrale sei somit ein
Symbol für ganz Europa. Auch der Vorsitzende des Kuratoriums,
Altbundeskanzler Dr. Helmut Kohl, habe diese Bedeutung
„seines Doms“ erkannt und sie mit seinen zahlreichen, in der zuvor
von Bischof Dr. Wiesemann angesprochenen aktuellen Ausstellung im
Historischen Museum der Pfalz im Rahmen der Besuche zahlreicher
Staatsgäste versinnbildlicht.
Berichte zu den Aktivitäten und der Bilanz des Vereins sowie
den Baumaßnahmen am Dom
 Der nachfolgende Bericht des Vorsitzenden des Vorstands,
Prof. Dr. Jung, bot sodann einen detaillierten Überblick über die
Arbeit des Vereins. Neue Mitglieder zu gewinnen, nannte Dr. Jung
dabei als eines der wichtigsten Ziele. Um diesem näher zu kommen,
habe man eine Auswertung der bisherigen Mitgliederstruktur
vorgenommen. Auch der Flyer des Vereins, mit dem neue Mitglieder
gewonnen werden, werde derzeit neu gestaltet. Um künftig noch mehr
Geld für den Erhalt des Doms zu erwirtschaften, überarbeite man
zudem die als „Dombausteine“ bezeichneten Verkaufsprodukte des
Vereins. Hierzu hob Dr. Jung die Bedeutung des neuen
Dom-Besucherzentrums hervor, das er als „Erfolgsstory“ bezeichnete,
habe es doch zu einer deutlichen Verkaufssteigerung
beigetragen.
Der nachfolgende Bericht des Vorsitzenden des Vorstands,
Prof. Dr. Jung, bot sodann einen detaillierten Überblick über die
Arbeit des Vereins. Neue Mitglieder zu gewinnen, nannte Dr. Jung
dabei als eines der wichtigsten Ziele. Um diesem näher zu kommen,
habe man eine Auswertung der bisherigen Mitgliederstruktur
vorgenommen. Auch der Flyer des Vereins, mit dem neue Mitglieder
gewonnen werden, werde derzeit neu gestaltet. Um künftig noch mehr
Geld für den Erhalt des Doms zu erwirtschaften, überarbeite man
zudem die als „Dombausteine“ bezeichneten Verkaufsprodukte des
Vereins. Hierzu hob Dr. Jung die Bedeutung des neuen
Dom-Besucherzentrums hervor, das er als „Erfolgsstory“ bezeichnete,
habe es doch zu einer deutlichen Verkaufssteigerung
beigetragen.
Ein weiterer Schwerpunkt des Berichts galt der Rück- und
Vorausschau auf die unterschiedlichen Aktivitäten und Angebote des
Vereins wie wissenschaftlichen Vorträge, ein- bzw. mehrtägige
Exkursionen sowie Angebote am „Tag des offenen Denkmals“. In diesem
Jahr wird für die neu eingetretenen Mitglieder des vergangenen
Jahres erstmals eine exklusive Domführung durch den Domkustos,
Domkapitular Peter Schappert, angeboten. Bereits
bewährt und stets von großem Erfolg gekrönt sei auch immer wieder
das alljährlich im Dom stattfindende Konzert „Baden schaut über den
Rhein“ sowie das im Zwei-Jahres-Turnus durchgeführte
Benefiz-Golfturnier.
 Schatzmeister Winfried Szkutnik berichtete von der
zufriedenstellenden Ertragslage des Vereins. Die Einnahmen aus
Mitgliederbeiträgen, den Dombausteinen, Spenden, Veranstaltungen
und Zinserträgen beliefen sich auf stolze 193.000 Euro. Damit lagen
die Einnahmen zwar leicht unter denen des Vorjahres. Da jedoch auch
die Ausgaben geringer ausfielen als im Jahr 2015 habe sich das
Ergebnis insgesamt verbessert, so Szkutnik. In der kommenden
Vorstandssitzung werde der Vorstand über die jährliche
satzungsgemäße Abführung an das Domkapitel abstimmen. Hierfür seien
in diesem Jahr 135.000 vorgesehen. Rechnungsprüfer Martin
Brilla, der dem Schatzmeister eine untadelige Kasssenführung
attestierte, empfahl schließlich, den Vorstand zu entlasten, was
dann auch ohne Gegenstimmen geschah.
Schatzmeister Winfried Szkutnik berichtete von der
zufriedenstellenden Ertragslage des Vereins. Die Einnahmen aus
Mitgliederbeiträgen, den Dombausteinen, Spenden, Veranstaltungen
und Zinserträgen beliefen sich auf stolze 193.000 Euro. Damit lagen
die Einnahmen zwar leicht unter denen des Vorjahres. Da jedoch auch
die Ausgaben geringer ausfielen als im Jahr 2015 habe sich das
Ergebnis insgesamt verbessert, so Szkutnik. In der kommenden
Vorstandssitzung werde der Vorstand über die jährliche
satzungsgemäße Abführung an das Domkapitel abstimmen. Hierfür seien
in diesem Jahr 135.000 vorgesehen. Rechnungsprüfer Martin
Brilla, der dem Schatzmeister eine untadelige Kasssenführung
attestierte, empfahl schließlich, den Vorstand zu entlasten, was
dann auch ohne Gegenstimmen geschah.
In offener Abstimmung unter der Wahlleitung von Hanspeter Brohm
wurden dann zunächst der Vorsitzende des Vorstands, Prof. Dr.
Gottfried Jung und dann die Beisitzer, ebenfalls einstimmig
gewählt. Ebenfalls per Akklamation wurden in Abwesenheit die
stellvertretende Vorsitzende und Schriftführerin Dr. Barbara
Schmidt-Nechl und der anwesende Schatzmeister Winfried
Szkutnik im Amt bestätigt. Daneben gehören dem Vorstand an:
Franz Dudenhöffer, Gabriele Fischer, Helmut Geisert, Dr. Simon
Lang und Hans-Joachim Ritter. Als geborene Mitglieder,
also auf Grund ihres Amtes, sind im Vorstand vertreten: der
Dombaumeister, Mario Colletto, der Dompfarrer Matthias
Bender und Domkustos Peter Schappert.
In dieser Funktion berichtete Schappert darüber, wofür die
Zuwendungen des Vereins verwendet wurden und für welche Maßnahmen
sie auch weiterhin benötigt würden. Dabei dankte er dem
Dombauverein zunächst für seine zuverlässige Unterstützung des
Domerhalts. In seinem Bericht zu den Baumaßnahmen verwies er auf
den Erfolg der großen Instandhaltungsmaßnahmen der Jahre 2015 und
2016, von denen die augenfälligste die Sanierung des Nordwestturms
war. 2017 steht nun die Sanierung der Afrakapelle auf der Agenda.
Voruntersuchungen gebe es in der Krypta und am Südwestturm, der
dafür teilweise eingerüstet werden müsse, so Domkapitular Schappert
abschließend.
Während der gut zwei Stunden dauernden Versammlung war das große
Engagement und die Verbundenheit aller Anwesenden mit dem Dom zu
spüren. Mit insgesamt rund 2.700 Mitgliedern, davon knapp 1.000 aus
Speyer, sei aber immer noch „Luft nach oben“, war man sich einig.
Und wenn Begeisterung wirklich ansteckend wirkt, dann hat der
Verein wohl gute Perspektiven. Foto: gc
31.03.2017
Dombauverein Speyer bestätigt seine Vorstandschaft - Bilderalbum
Von Kapelle zu Kapelle vom Rhein zur Saar pilgern
.jpg) Übergabe der 40 Pilgerstempelboxen an Domkapitular Franz Vogelgesang in der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, Standort Edenkoben.
Übergabe der 40 Pilgerstempelboxen an Domkapitular Franz Vogelgesang in der Berufsbildenden Schule Südliche Weinstraße, Standort Edenkoben.
Berufsschüler bauen für Pilgerweg Metallboxen mit
Stempel
Edenkoben- 40 kleine Boxen aus rostfreiem
Stahl haben Schülerinnen und Schüler der Berufsbildenden Schule
Edenkoben vor kurzem an den Speyerer Domkapitular Franz Vogelgesang
übergeben. In den Boxen mit Klappdeckel befindet sich ein Stempel
und ein Stempelkissen. Die Boxen werden in den nächsten Wochen an
40 Wallfahrtszielen in der Pfalz und der Saarpfalz ausgehängt und
sollen Pilgerinnen und Pilger motivieren, diese Ziele zu
besuchen.
„Im August stellt das Bistum Speyer ein Buch vor, das sämtliche
kleinere Wallfahrtsorte zwischen Rhein und Saar näher beschreibt“,
so Franz Vogelgesang. Die Annakapelle bei Burrweiler zählt genauso
dazu wie die Wallfahrtskirche Maria Schutz in Kaiserslautern oder
die Kolmerbergkapelle bei Dörrenbach. Mit dem Buch ist ein
Pilgerpass erhältlich, in den sich fleißige Pilger an jedem Zielort
ein Logo stempeln können. Den passenden Stempel finden sie dafür in
den kleinen Metallboxen am Ziel. „Wir hoffen, so ein ganzes
Netzwerk von kleinen Pilgerwegen entstehen zu lassen“, sagt
Domkapitular Vogelgesang. Als Hauptabteilungsleiter ist er im
Bischöflichen Ordinariat für die Seelsorge zuständig, unter anderem
auch für das Wallfahrts- und Pilgerwesen. Das neue Buch zu den
kleinen Wallfahrtsstätten soll an Mariä Himmelfahrt, dem
Patronatsfest des Bistums (15. August), in Speyer erscheinen,
informierte Autorin Marianne Backenstraß vom Pilgerbüro Speyer.
„Künftig sollen dann an jedem 15. August im Dom Pilger geehrt
werden, die im Lauf eines Jahres alle Zielorte besucht haben.“
.jpg) Durch
einen Kontakt zwischen Franz Vogelgesang und Karl-Peter Denzer,
Fachlehrer für Metalltechnik an der Berufsbildenden Schule Südliche
Weinstraße, kam das Gemeinschaftsprojekt „Pilgerboxen“ ins Rollen.
Die jungen Erwachsenen, vor allem Geflüchtete, gewannen durch die
handwerkliche Arbeit etwas Abwechslung vom Sprachförderunterricht,
berichtet Fachpraxislehrer Wolfgang Trauthwein, der gemeinsam mit
dem angehenden Lehrer Rüdiger Ullrich die jungen Leute angeleitet
hat. Viele Stunden waren zu sägen, bohren, entgraten, schweißen und
feilen, bis aus einem Vierkantmetallstück, einem Scharnier, einigen
Nieten sowie einem Blechstück eine Stempelbox entstanden war – eine
schöne handwerkliche Arbeit, die wetter- und vandalismusfest
ist.
Durch
einen Kontakt zwischen Franz Vogelgesang und Karl-Peter Denzer,
Fachlehrer für Metalltechnik an der Berufsbildenden Schule Südliche
Weinstraße, kam das Gemeinschaftsprojekt „Pilgerboxen“ ins Rollen.
Die jungen Erwachsenen, vor allem Geflüchtete, gewannen durch die
handwerkliche Arbeit etwas Abwechslung vom Sprachförderunterricht,
berichtet Fachpraxislehrer Wolfgang Trauthwein, der gemeinsam mit
dem angehenden Lehrer Rüdiger Ullrich die jungen Leute angeleitet
hat. Viele Stunden waren zu sägen, bohren, entgraten, schweißen und
feilen, bis aus einem Vierkantmetallstück, einem Scharnier, einigen
Nieten sowie einem Blechstück eine Stempelbox entstanden war – eine
schöne handwerkliche Arbeit, die wetter- und vandalismusfest
ist.
Domkapitular Franz Vogelgesang dankte den jungen Leuten und
ihren Lehrern für ihr besonderes Engagement. Neben einem
Spendenbetrag für die Klassenkasse lud er Schüler und Lehrer zu
einem Besuch Speyers ein und versprach, die jungen Leute
höchstpersönlich durch den Speyerer Dom zu führen. Mit eingeladen
sind zu diesem Ausflug auch Marion Michel, pädagogische Leiterin
der Berufsbildenden Schule, sowie Hans-Joachim Bethge, der Leiter
des Schulstandortes Edenkoben. Mit Domkapitular Vogelgesang sind
sie sich einig, dass von dieser Kooperation alle etwas haben –
Schüler und Pilger gleichermaßen. Text und Foto: Hubert Mathes
(Peregrinus, Speyer)
30.03.2017
Damit der Dom noch lange steht
 Mediengespräch zu den Baumaßnahmen am Dom zu Speyer (v.l.n.r. Prof. Dr. Gottfried Jung, Vorsitzender des Vorstands des Dombauvereins Speyer; Mario Colletto, Dombaumeister; Domkapitular Peter Schappert, Domkustos, Werner Schineller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer,
Mediengespräch zu den Baumaßnahmen am Dom zu Speyer (v.l.n.r. Prof. Dr. Gottfried Jung, Vorsitzender des Vorstands des Dombauvereins Speyer; Mario Colletto, Dombaumeister; Domkapitular Peter Schappert, Domkustos, Werner Schineller, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer,
Einblick in die Instandhaltungsarbeiten am Dom zu
Speyer
Speyer- Auch wenn im Moment keine Gerüste
zu sehen sind: An einer so großen und fast 1000 Jahre alten Kirche
wie dem Speyerer Dom gibt es immer etwas zu tun. Wie die Planung,
Finanzierung und schließlich die Durchführung der
Instandhaltungsmaßnahmen aussieht, dazu gab am Dienstag, 28. März
ein Mediengespräch Einblick.
„Wir freuen uns über das große Interesse, dass die
Öffentlichkeit den Baumaßnahmen am Dom entgegenbringt“, so der
Kustos der Kathedrale, Domkapitular Peter Schappert. „Nachfragen
direkt bei uns, Leserbriefe oder auch Beiträge in den sozialen
Netzwerken zeigen uns, dass der Dom vielen Menschen am Herzen liegt
und sie sich mit diesem Bauwerk identifizieren“, schlussfolgert
Schappert. „Damit der Dom noch lange steht, ergreifen wir jährlich
eine Reihe von Maßnahmen. Routine kommt aber so schnell nicht auf,
da der Dom uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt“,
erklärte der Domkustos.
.jpg) Rahmenbedingungen für die Instandhaltung des Doms
Rahmenbedingungen für die Instandhaltung des Doms
Domkapitular Schappert zeigte während des Gesprächs auf, welchen
Rahmenbedingungen die jährlichen Instandhaltungsmaßnahmen
unterliegen. So bedarf jede Maßnahme einer individuellen Planung
mit teilweise langem Vorlauf. Das Domkapitel entscheidet mit
Verabschiedung des Haushalts darüber, welche Maßnahmen durchgeführt
werden. Grundlage der Entscheidung im Domkapitel sind der Bericht
und die Empfehlungen des Dombaumeisters. Voraussetzungen sind die
denkmalpflegerische Rückbindung sowie die Finanzierbarkeit.
Rund eine Million Euro werden jährlich für den Erhalt des Doms
aufgewandt. Grundsätzlich finanziert das Domkapitel alle am Dom
stattfindenden Maßnahmen. In einem Vertrag mit dem Land
Rheinland-Pfalz wurde 2009 festgelegt, dass das Land sich mit der
Übernahme von 40% der Kosten an den substanzerhaltenden Maßnahmen
beteiligt. Kontinuierliche Unterstützung bietet darüber hinaus der
Dombauverein, dessen Erträge aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und
weiteren Einnahmen in den Domerhalt fließen. Zwischen 100.000 und
200.000 Euro sind dies jährlich. Maßnahmenbezogene Mittel kommen
von der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, die zuletzt die
Erneuerung der Außenbeleuchtung maßgeblich finanzierte.
Bundesmittel und Zuwendungen der Stadt Speyer sind, ebenso wie
Mittel der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, weitere
Geldquellen.
Rückblick und Ausblick auf anstehende Maßnahmen
.jpg) In einer
Rückschau zeigte Domkapitular Schappert zunächst, welche Maßnahmen
zum Domerhalt in den vergangenen Jahren umgesetzt worden waren. Das
Spektrum reichte dabei von der Sanierung der Seitenschiffe bis hin
zur Instandsetzung des Nordwestturms.
In einer
Rückschau zeigte Domkapitular Schappert zunächst, welche Maßnahmen
zum Domerhalt in den vergangenen Jahren umgesetzt worden waren. Das
Spektrum reichte dabei von der Sanierung der Seitenschiffe bis hin
zur Instandsetzung des Nordwestturms.
Wie Dombaumeister Mario Colletto berichtete, wird es 2017
Arbeiten an der Afrakapelle und der Zwerggalerie geben. Daneben
stehen Voruntersuchungen in der Krypta und am Vierungsturm an. Auch
ein Teil der Beleuchtung und der Elektrik im Mittelschiff soll
erneuert werden. Die für die einzelnen Maßnahmen notwendigen
Gerüste sollen erst nach der an Pfingsten stattfindenden Feier zur
Neugründung des Bistums an vor 200 Jahren am und im Dom aufgebaut
werden.
Die Afrakapelle auf der Nordseite des Doms soll innen und außen
in Stand gesetzt werden. Außen wird die Fassade mit den
Dachanschlüssen überarbeitet. Ebenso steht eine Erneuerung der
Fenster an.
Im Innern wurden die Wände in den 80er/90er Jahren mit
Silikatdispersionsfarbe gestrichen – einer Farbe, die für
Außenflächen gedacht ist. Da diese Farbe nur bedingt
dampfdiffusionsoffen ist, ist dieser Anstrich vermutlich ursächlich
für die hohe Feuchte in der Kapelle. Er soll daher entfernt und
durch einen historisch korrekten Kalkanstrich ersetzt werden. Des
Weiteren werden die Sandsteinflächen im Inneren
gesäubert.
Der Zugang zur Afrakapelle im Dominnern soll eine neue Tür
bekommen. Die Planungen hierzu laufen derzeit. Ziel der Maßnahme
ist es, die Funktion der Kapelle als geschützter Ort des stillen
Gebets zu fördern.
Ein weiterer Schwerpunkt der Sanierungsmaßnahmen wird die
Zwerggalerie sein. Im zurückliegenden Jahr 2016 wurden bereits die
Fenster an der Nordseite erneuert. Diese stammten aus den 1850er
Jahren und hatten das Ende ihrer technischen Lebensdauer erreicht.
Die Öffnung der alten Fenster erfolgte über einen
Schiebemechanismus. Die neuen Stahlrahmenkonstruktionen lassen sich
mit einem Klappmechanismus öffnen, was eine Verbesserung der
Lüftungssituation bedeutet. 2017 sollen die restlichen Fenster auf
der Südseite erneuert werden.
In diesem Jahr ist zudem eine Voruntersuchung der Zwerggalerie
geplant. Stützen, Bögen, Mauerwerk und Gehbelag sollen umfassend
untersucht und entsprechend der Befunde restauriert werden.
Begonnen wird auf der Nordseite des Mittelschiffs, dann folgen im
Verlauf der nächsten Jahre die Südseite des Mittelschiffs sowie das
südliche und das nördliche Querhaus. Die Apsis und der Westbau
werden nicht mit einbezogen, da die Zwerggalerie dort bereits in
den zurückliegenden Jahren überarbeitet worden war.
 Auch an der
Elektrik und der Beleuchtung im Mittelschiff wird 2017 weiter
gearbeitet. Die Grundbeleuchtung wurde bereits auf LED umgestellt.
Nun sollen auch die Strahler entsprechend erneuert werden. Die
elektrischen Leitungen im Dom stammen aus den 60er und 80er Jahren.
Zum Teil sind sie noch älter. Im Mittelschiff sollen sie 2017
zusammen mit den Strahlern erneuert werden. Dabei werden die
Leuchten individuell steuerbar. Die neue Technik wird auch dazu
beitragen, den Energieverbrauch auf etwa ein Fünftel der bisherigen
Leistung zu senken. Die in der Apsis 2016 bereits probeweise
installierte Beleuchtung wird 2017 komplett installiert. Hierfür
sind Steinmetz- und Stahlschlosserarbeiten notwendig. Ebenso werden
die Querhauskapellen neu beleuchtet.
Auch an der
Elektrik und der Beleuchtung im Mittelschiff wird 2017 weiter
gearbeitet. Die Grundbeleuchtung wurde bereits auf LED umgestellt.
Nun sollen auch die Strahler entsprechend erneuert werden. Die
elektrischen Leitungen im Dom stammen aus den 60er und 80er Jahren.
Zum Teil sind sie noch älter. Im Mittelschiff sollen sie 2017
zusammen mit den Strahlern erneuert werden. Dabei werden die
Leuchten individuell steuerbar. Die neue Technik wird auch dazu
beitragen, den Energieverbrauch auf etwa ein Fünftel der bisherigen
Leistung zu senken. Die in der Apsis 2016 bereits probeweise
installierte Beleuchtung wird 2017 komplett installiert. Hierfür
sind Steinmetz- und Stahlschlosserarbeiten notwendig. Ebenso werden
die Querhauskapellen neu beleuchtet.
Engagement für den Dom
In dem Pressegespräch kamen auch die Vertreter der beiden
Förderinstitutionen des Doms zu Wort. Prof. Dr. Gottfried Jung gab
als Vorsitzender des Vorstands des Dombauvereins Einblick in die
Anstrengungen des Vereins, für den Domerhalt zu werben und diesen
finanziell zu unterstützen. Werner Schineller berichtete als
stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Europäischen Stiftung
Kaiserdom zu Speyer über die Aktivitäten und wies unter anderem auf
die derzeit noch laufende Mitmach-Aktion „Die Pfalz liest für den
Dom“ hin, welche von der Europäischen Stiftung und der Tageszeitung
„Die Rheinpfalz“ gemeinsam ins Leben gerufen wurde.
„Für die dauerhafte Sicherung des Bauwerks sind unspektakuläre
oder kleine Maßnahmen genauso wichtig wie große und weithin
sichtbare Projekte“, erklärte Domkustos Schappert. „Deshalb sind
wir froh, dass der Dombauverein eine verlässliche Unterstützung
bietet, die uns hilft, eine Kontinuität beim Bestandserhalt zu
erzielen“, formulierte der Kustos seinen Dank. Der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer dankte Schappert für die Förderung
großer Einzelprojekte. „Die Europäische Stiftung hat uns
ermöglicht, mit dem Dom-Besucherzentrum eine zentrale Anlaufstelle
für alle Dom-Besucher zu schaffen. Ebenso hat sie die neue
Außenbeleuchtung finanziert. Mit diesen Maßnahmen unterstützt die
Stiftung die internationale Strahlkraft des Doms.“
Text: is; Foto: © Domkapitel Speyer, Foto: Klaus
Landry
29.03.2017
Umbau des Priesterseminars steht kurz vor dem Abschluss
 Eröffnungsfeier am 6. und 7. Mai – Nutzung für Aus- und
Weiterbildung von Ehrenamtlichen und pastoralen
Mitarbeitern
Eröffnungsfeier am 6. und 7. Mai – Nutzung für Aus- und
Weiterbildung von Ehrenamtlichen und pastoralen
Mitarbeitern
Speyer- Der Umbau des Priesterseminars St.
German in Speyer ist auf der Zielgerade angekommen. Am Samstag, den
6. Mai, wird Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann die Weihe des neuen
Altars in der Seminarkirche vornehmen. Damit findet der Umbau, der
vor zwei Jahren begonnen hat, seinen Abschluss. Das Priesterseminar
trägt künftig den Zusatz „Pastoralseminar für das Bistum Speyer“ im
Untertitel und dient der Aus- und Weiterbildung der verschiedenen
pastoralen Berufsgruppen und der ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern im Bistum Speyer. Zudem wird das Priesterseminar
als Tagungshaus des Bistums genutzt.
Im Zuge der Sanierung wurden die Brandschutzmaßnahmen, die
Heizung und die elektrischen Anlagen auf den heutigen Stand der
Technik gebracht. Durch eine Dämmung des Daches, der Außenwände und
den Einbau neuer Fenster wurde der Wärmeschutz verbessert. Darüber
hinaus wurde das Haus barrierefrei umgebaut. Dazu wurde ein Aufzug
installiert und im Obergeschoss eine direkte Verbindung zwischen
den Übernachtungszimmern, dem Seminar- und dem Verpflegungstrakt
geschaffen. Die beiden Seminarräume wurden zu einem großen Seminar-
und Tagungsraum verbunden. Planung und Umsetzung des Umbauprojekts
lagen in den Händen des Architekturbüros Brünjes aus
Saarbrücken.
Auch die Kirche des Priesterseminars wurde von innen renoviert.
Dabei wurde der Chorraum entsprechend dem Liturgieverständnis des
Zweiten Vatikanischen Konzils umgestaltet. Es wurde unter anderem
ein neuer Altar geschaffen und eine Stelenwand zwischen Altarraum
und Hochaltar eingezogen.
Die Kosten für den Umbau des Priesterseminars St. German
belaufen sich auf rund 12,5 Millionen Euro. Ursprünglich waren sie
mit rund 9,5 Millionen Euro veranschlagt gewesen. Für die
Mehrkosten war unter anderem der Austausch der Grundleitungen auf
dem Gelände ausschlaggebend. Die Notwendigkeit dazu zeigte sich
erst im Verlauf der Bauarbeiten. Auch im Blick auf die Statik des
Gebäudes und die Bodenbeschaffenheit auf dem Grundstück waren
zusätzliche Maßnahmen erforderlich.
Finanziert wurde der Umbau aus verschiedenen Quellen. Das Bistum
hat sich mit einem Zuschuss in Höhe von 5,5 Millionen Euro an den
Umbaukosten beteiligt. Mit 900.000 Euro hat eine noch vorhandene
Finanzrücklage des Bistumshauses St. Ludwig zur Finanzierung
beigetragen. Die übrigen Kosten werden durch die Erlöse aus dem
Verkauf des Bistumshauses St. Ludwig und dem Verkauf eines
Teilgeländes des Priesterseminars für ein Bauprojekt des
Gemeinnützigen Siedlungswerks gedeckt.
Mit der baulichen Erneuerung geht auch eine personelle
Veränderung einher. Anfang Februar hat Thorsten Scheurer seine
Tätigkeit als Verwaltungsleiter des Priesterseminars St. German
aufgenommen. Er wurde im Rahmen des Pressegesprächs zum Umbau des
Priesterseminars vorgestellt.
Altarweihe und Festakt am 6. Mai 2017 - „Tag der offenen
Seminartür“ am 7. Mai
Am Samstag, den 6. Mai, um 10 Uhr wird Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann in der Seminarkirche einen Gottesdienst anlässlich der
Wiedereröffnung feiern und den neu geschaffenen Altar weihen. Der
Gottesdienst wird vom Domchor musikalisch gestaltet. Um 13.30 Uhr
schließt sich im Edith-Stein-Saal des Priesterseminars ein Festakt
für geladene Gäste an, verbunden mit der Segnung der neuen Räume.
Regens Markus Magin wird zu diesem Anlass einen geistlichen Führer
zu den Buntglasfenstern in der Kapelle des Priesterseminars
vorstellen.
Den Gottesdienst am Sonntag, den 7. Mai, um 9.30 Uhr in der
Seminarkirche zelebriert Weihbischof Otto Georgens. Von 10.30 Uhr
bis 16.30 Uhr lädt das Priesterseminar zu einem „Tag der offenen
Seminartür“ ein. Die Leitung, die Dozenten, die
Priesteramtskandidaten und die Mitarbeiter stellen ihre Arbeit vor
und laden zu Führungen durch das Haus aus unterschiedlichen
Perspektiven ein. Kinder können die mobile Kinderkirche
kennenlernen, in Erzählworkshops biblischen Geschichten lauschen,
Stofftaschen bedrucken oder an einer Seminarrallye teilnehmen. Aus
dem benachbarten Karmel werden als Zeichen der Verbundenheit Kerzen
und Karten aus eigener Herstellung zum Verkauf angeboten. Ein
Vespergottesdienst um 17.00 Uhr, der von den Kaplänen des Bistums
musikalisch gestaltet wird, beschließt die Feierlichkeiten zur
abgeschlossenen Renovierung des Priesterseminars.
Hintergrund: Das Priesterseminar St. German
Das Priesterseminar St. German zog im Jahr 1956 vom Bistumshaus
St. Ludwig an den heutigen Standort am Germansberg im Speyerer
Stadtteil Vogelgesang um. Die hohe Zahl von Priesteramtskandidaten
Mitte der 50er-Jahre machte den Neubau am Germansberg
erforderlich.
Der Speyerer Germansberg ist ein geschichtsträchtiger Ort. In
der Antike stand hier ein Tempel zu Ehren des Gottes Merkur. Seit
dem dritten Jahrhundert wurde das Gebiet als römische
Begräbnisstätte genutzt. Im Jahr 632 gründete König Dagobert an
dieser Stelle ein Benediktinerkloster. Da die Bestattung von Toten
innerhalb einer Stadt nach römischem Gesetz verboten war, dürften
auch die Bischöfe hier ihre Ruhestätte gefunden haben. Um das Jahr
1100 wurde das Benediktinerkloster in ein
Augustiner-Chorherren-Stift umgewandelt, das bis zur Mitte des 15.
Jahrhunderts bestand.
Zurzeit werden im Bistum Speyer 13 Kandidaten für das
Priesteramt, 12 Kandidaten für eine Tätigkeit als Diakon, rund 20
Pastoralreferentinnen und – Pastoralreferenten sowie sechs
Gemeindereferentinnen und –referenten ausgebildet. Darüber hinaus
gestaltet das Priesterseminar die mehrjährige
Berufseinführungsphase für diese Berufsgruppen. Hinzu kommen
zahlreiche Fort- und Weiterbildungsangebote für haut- und
ehrenamtliche pastorale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, zum
Beispiel Leitungskurse für Pfarrer, Ausbildungskurse für
Exerzitienbegleiter, Gottesdienst- oder Kommunionhelfer. Darüber
hinaus dient das Priesterseminar als Tagungshaus für
Veranstaltungen des Bischöflichen Ordinariats, kirchlicher
Einrichtungen, Gruppen und Verbände.
Seit dem Jahr 2008 besteht eine enge Kooperation des
Priesterseminars St. German mit den Priesterseminaren der Diözesen
Bamberg, Eichstätt und Würzburg, die ebenfalls zur Kirchenprovinz
Bamberg gehören. Die Priesteramtskandidaten absolvieren in Speyer
im Anschluss an ihr Theologie-Studium gemeinsam den zweijährigen
Pastoralkurs, der sie auf die seelsorglichen Aufgaben in den
Pfarrgemeinden vorbereitet.
Das Priesterseminar St. German wird von Regens Markus Magin
geleitet. Spiritual ist Dekan Markus Horbach aus Rockenhausen. In
der Bildungsarbeit des Priesterseminars sind fünf Dozenten und
zahlreiche Referentinnen und Referenten tätig. Das Haus verfügt
über einen großen Saal, der mittels einer Wand getrennt werden
kann, zwei große und mehrere kleine Gruppenräume sowie 42 Zimmer
mit Übernachtungsmöglichkeit. Text und Foto: is
29.03.2017
Evangelium ist die Schule des Sehens
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann predigte zum Papstsonntag im Speyerer Dom.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann predigte zum Papstsonntag im Speyerer Dom.
Pontifikalamt zum Papstsonntag im Dom zu Speyer: Wieder
Visionen wecken und Blick weiten
Speyer- Das Evangelium ist eine Schule des
Sehens - als Leitwort gab Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann diesen
Satz den Gläubigen mit auf den Weg, die am Papstsonntag zum
Pontifikalamt in den Dom gekommen waren. Zur Erinnerung an die
Amtseinführung von Papst Franziskus im März 2013 wurde die Messe
zelebriert, die entsprechend feierlich vom Domchor begleitet
wurde.
Die politischen Entwicklungen in der Welt legte Bischof
Wiesemann seiner engagierten Predigt zugrunde. Mittendrin in den
aktuellen Problemen der Zeit seien die Menschen, erlebten
hassverblendeten Terrorismus und Rassismus. Konkret nannte
Wiesemann die "unsäglichen Beleidigungen des türkischen
Staatspräsidenten gegen die deutsche Kanzlerin.“ Auch warf der
Bischof einen Blick auf die USA: "Es gibt führende Leute in der
Welt, die sich nicht scheuen, in vollem Bewusstsein falsche
Nachrichten zu verbreiten." In dem Zusammenhang schlug Wiesemann
den Bogen zwischen den in der Lesung genannten Pharisäern und
denjenigen, die in der heutigen Welt im Vollbesitz ihrer Kräfte nur
das sehen, was sie sehen wollen. Das, so Wiesemann, geschehe aber
nicht nur auf der großen politischen Bühne.
Laut war daher der Appell des Bischofs, die diesjährige Misereor
Fastenaktion zu unterstützen, um in einem der ärmsten Länder der
Welt Hilfe Zukunftsperspektiven zu geben. "Natürlich gibt es dort
auch hausgemachte Probleme, aber es gibt auch große Zusammenhänge,
die verhindern, dass diese kleinen Länder auf die Beine kommen,
wenn wir nicht helfen", so Wiesemann, der den Klimawandel als eine
Geißel der Zeit nannte.
Visionen seien wieder notwendig. Nicht die, die sich im Schlafe
auftun, sondern die, die einen nicht mehr schlafen ließen, weil sie
den Menschen leidenschaftlich bewegten. "Das Volk verkommt ohne
Vision", zitierte der Oberhirte des Speyerer Bistums die Bibel aus
dem Buch der Sprüche. Statt nur politischem Pragmatismus sei
Weitblick gefragt.
Jesus öffne den Menschen dafür die Augen und helfe sehen zu
lernen mit den Augen eines Gottes, der sich im Nächsten zeigt.
"Gottes- und Nächstenliebe wird verbunden", stellte Wiesemann
heraus. Nur, wenn die Welt von der anderen Seite gesehen werde,
könne Friede und Gerechtigkeit wieder in sie einziehen. Als großes
Vorbild nannte der Bischof Papst Franziskus, der den Gläubigen
durch seine Mission die Augen vom anderen Ende der Welt öffne.
Dankbar äußerte er sich für die Anstöße, die der Heilige Vater im
Sinne des Evangeliums entsende.
"Wir müssen uns unserer Weltverantwortung bewusst werden und
dürfen uns nicht in unser Schneckenhaus zurückziehen - auch nicht
in das Nationale", hob Wiesemann hervor. Ein letztes Mal lehnte er
sich an die Aussage eines politischen Staatsmannes an, des neu
gewählten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier: "Er sprach von
Menschen, die Mut machen. Genau darauf kommt es an: Sehen lernen,
nicht nur mit den Augen, sondern auch mit dem Herzen."
Mit einem wohlklingenden Kyrie, Sanctus und Agnus Dei aus der
"Missa Papae marcelli", der bis heute bekanntesten Messe von
Giovanni
Pierluigi da Palestrina, sowie dem gesungenen Psalm "Lobe den
Herrn, meine Seele" (Heinrich Schütz) und dem "Ave regina caelorum"
(Philip Stanford) verlieh der Domchor unter Domkapellmeister Markus
Melchiori dem Pontifikalamt zusätzliche Würde. Parallel zur
Amtsaufnahme des Papstes Franziskus wurde darin der Einführung von
Dr. Karl-Heinz Wiesemann als Bischof von Speyer 2008 gedacht.
Text/Foto: Susanne Kühner
27.03.2017
Wollmäuse in der Orgel
 Ausreinigung
der „Königin der Instrumente“ auf dem Königschor im Speyerer
Dom
Ausreinigung
der „Königin der Instrumente“ auf dem Königschor im Speyerer
Dom
Speyer- Die Besucher des Speyerer Doms
bekommen derzeit einen Eindruck davon, was es bedeutet, wenn eine
Orgel gereinigt wird. Pfeifen aus Metall und Holz der
unterschiedlichsten Größen und Formen sind im Chorraum aufgereiht.
In den zweieinhalb Wochen zuvor war noch wenig von den bereits
laufenden Arbeiten zu sehen, nur das monotone Dröhnen eines
Staubsaugers war bereits zu hören.
Um die Orgel im Königschor von Staub und Schmutz zu befreien,
werden nun nach und nach alle beweglichen Teile ausgebaut und
gereinigt. Nach dem Wiedereinbau werden die Register neu intoniert,
das bedeutet im Klang untereinander und auf den Raum abgestimmt.
Das kann wegen der dafür notwendigen Stille allerdings nur
geschehen, wenn der Dom geschlossen ist. Abschließend werden die
Pfeifen auf die richtige Tonhöhe gestimmt.
Vier Männer sind vier Wochen lang bei der Arbeit, bis die Orgel
wieder einsatzbereit ist. 2410 Pfeifen, angeordnet über vier
Etagen, die Mechanik und das umgebende Gehäuse sind dann gereinigt.
„Der jüngste und dünnste Kollege ist für die schwierig zu
erreichenden Ecken zuständig“, bemerkt Bernd Reinartz. Der junge
Mann mit einer Stirnlampe auf dem Kopf, hat selbst an der Orgel
mitgebaut und leitet die Reinigungsarbeiten. Zuletzt hatte er an
der Orgel in der Hamburger Elbphilharmonie gearbeitet. „Wenn der
Klang der Orgel die Menschen anrührt, dann haben wir gute Arbeit
gemacht.“
Die Ausreinigung einer Orgel, so der Fachbegriff, ist
normalerweise alle 15 bis 20 Jahre fällig, erläutert der er Zweite
Domorganist und Orgelsachverständige der Diözese Christoph
Keggenhoff. In Kirchen mit einem hohen Besucheraufkommen – wie dem
Speyerer Dom – kann sich dieser Zeitraum deutlich verkürzen. 2008
wurde die Orgel im Königschor eingeweiht, nun ist die erste
Reinigung fällig.
 Hauptquelle
für die Verschmutzung sind dabei die Textilfasern die von der
Kleidung der Besucher stammen. Durch thermische Bewegungen im
riesigen Raumvolumen der Speyerer Kathedrale gelangen sie auch in
die beiden Orgeln des Doms. Über die Zeit können diese Fasern mit
dem in der Luft befindlichen Kerzenwachs verkleben. Außerdem
besteht die Gefahr von Schimmelbildung. „Wenn die Wollmäuse in der
Orgel dunkler werden, ist es Zeit für eine Ausreinigung“, erklärt
Keggenhoff. Beim Nachstimmen gehen er und Domorganist Markus
Eichenlaub regelmäßig in das Innere der Orgel und können so auch
die Belastung durch Schmutz kontrollieren.
Hauptquelle
für die Verschmutzung sind dabei die Textilfasern die von der
Kleidung der Besucher stammen. Durch thermische Bewegungen im
riesigen Raumvolumen der Speyerer Kathedrale gelangen sie auch in
die beiden Orgeln des Doms. Über die Zeit können diese Fasern mit
dem in der Luft befindlichen Kerzenwachs verkleben. Außerdem
besteht die Gefahr von Schimmelbildung. „Wenn die Wollmäuse in der
Orgel dunkler werden, ist es Zeit für eine Ausreinigung“, erklärt
Keggenhoff. Beim Nachstimmen gehen er und Domorganist Markus
Eichenlaub regelmäßig in das Innere der Orgel und können so auch
die Belastung durch Schmutz kontrollieren.
„Wenn die Kernspalte zudreckt stimmt der Ton nicht mehr“, so
Keggenhoff. Mit seinem Finger zeigt er dabei auf die Öffnung auf
der Pfeifenoberfläche, wie man sie auch vom Kopf einer Blockflöte
kennt. „Auf einer kleinen Pfeife wirkt ein Staubkorn schon wie ein
Felsbrocken“, ergänzt Orgelbauer und Intonör Reinartz. Entsprechend
wichtig sei der behutsame und fachmännische Umgang mit den
Orgelpfeifen. Dabei zeigt er eine kleine eckige Pfeife aus
Kirschholz, nicht länger als ein kleiner Finger. Er vergleicht die
Arbeiten mit der ebenfalls regelmäßig fälligen Wartung eines
Fahrzeugs. Nach der Ausreinigung sei die Orgel in nahezu
neuwertigem Zustand und kann im Idealfall ein paar hundert Jahre
alt werden.
Die Ausreinigung kostet brutto 30.000 Euro, dazu kommen
notwendige Reparaturen in Höhe von 12.000 Euro also zusammen 42.000
Euro.
Text: Friederike Walter/Fotos: Domkapitel Speyer / Klaus
Landry
27.03.2017
Ehrenamtliche sind „der Schatz der Kirche“
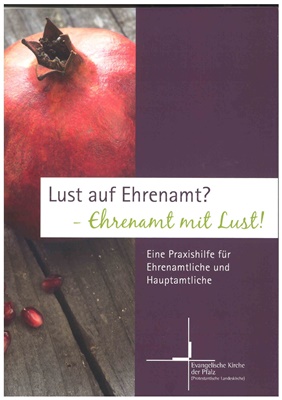 Überarbeitete Praxishilfe möchte Lust auf freiwilliges
Engagement machen
Überarbeitete Praxishilfe möchte Lust auf freiwilliges
Engagement machen
Speyer- Mehr als 21.000 Frauen und Männer
engagieren sich ehrenamtlich in der Evangelischen Kirche der Pfalz.
Ihre Mitarbeit werde angesichts der Herausforderungen, vor denen
die Landeskirche stehe, noch an Bedeutung gewinnen, erklärt
Kirchenpräsident Christian Schad im Vorwort der neu überarbeiteten
Praxishilfe für Ehren- und Hauptamtliche mit dem Titel: „Lust auf
Ehrenamt? Ehrenamt mit Lust!“. Der Begleitung und Förderung der
Ehrenamtlichen misst der Kirchenpräsident einen hohen Stellenwert
bei: „Indem Sie Mitverantwortung tragen, gehören Sie zum Schatz
unserer Kirche.“
Von Aufwendungsersatz bis Versicherungsschutz, von
Freistellungsmöglichkeiten bis Verschwiegenheit und Datenschutz –
die Broschüre bietet auf 68 Seiten Wissenswertes zu rechtlichen
Fragen, nützliche Beispiele aus der Praxis und einen ausführlichen
Adressteil. Zudem regen die Autoren dazu an, die Zusammenarbeit und
Anerkennungskultur zwischen Haupt- und Ehrenamtlichen
weiterzuentwickeln, geben hilfreiche Tipps und liefern „Bausteine“
– beispielsweise für den Aufbau von Checklisten zu bestimmten
Themen. „Freiwilliges Engagement ist bunt und vielfältig. Es zeigt,
wie ideenreich und kreativ sich Menschen für andere einsetzen und
engagieren“, machen die landeskirchliche Ehrenamtsbeauftragte Heike
Baier und die Sprecherin des Runden Tisches Ehrenamt, Regina
Mayer-Oelrich, Lust aufs Ehrenamt.
Dass laut sozialwissenschaftlicher Analysen immer mehr Bürger
bereit seien, sich in ihrer Freizeit für die Gesellschaft
einzubringen, bestätigten auch die Zahlen für die Landeskirche:
1995 engagierten sich hier rund 18.000 Menschen ehrenamtlich, etwa
3.000 weniger als heute. Die Motivation, Begleitung und Fortbildung
der Ehrenamtlichen sei daher zentrale Aufgabe, unterstreicht Schad.
„Viele Talente können noch entdeckt werden, die dazu beitragen,
unsere Kirche weiterhin anziehend und vielfältig zu gestalten“, so
der Kirchenpräsident. lk
Hinweis: Die Praxishilfe „Lust auf Ehrenamt? Ehrenamt mit
Lust!“ kann bezogen werden über den Herausgeber: Evangelische
Kirche der Pfalz, Landeskirchenrat, Domplatz 5, 67346 Speyer,
Telefon: 06232/667-0. Weitere Informationen erteilt die Beauftragte
für freiwilliges Engagement in Diakonie und Kirche, Heike Baier,
E-Mail: heike.baier@diakonie-pfalz.de,
Telefon: 06232/664-159.
Mehr zum Thema: www.evkirchepfalz.de/landeskirche/ehrenamt.html
24.03.2017
Gemeinsam auf akute Notlage reagieren
 Kirchen spenden 45.000 Euro für den von humanitärer
Katastrophe betroffenen Südsudan
Kirchen spenden 45.000 Euro für den von humanitärer
Katastrophe betroffenen Südsudan
Speyer- Das Bistum Speyer und sein
Caritasverband sowie die Evangelische Kirche der Pfalz und ihr
Diakonisches Werk unterstützen die Menschen in dem von einer
humanitären Katastrophe betroffenen Südsudan in Afrika mit 45.000
Euro Soforthilfe. Das Geld werde an die Diakonie Katastrophenhilfe
und an Caritas International gespendet, teilen die Landeskirche und
das Bistum mit. Damit reagieren die Kirchen gemeinsam auf die akute
Notlage. Gleichzeitig rufen sie zu Spenden auf.
Die Not sei im Südsudan besonders groß, erklären der beim Bistum
Speyer für weltkirchliche Aufgaben zuständige Weihbischof Otto
Georgens und der Diakoniedezernent der Landeskirche, Oberkirchenrat
Manfred Sutter. Nach Angaben der Hilfsorganisationen ist das Land
immer wieder von Dürren und Hungersnöten und von bewaffneten
Konflikten betroffen. Der Ausbruch des Bürgerkrieges im Südsudan
2013 habe sich zu einer der weltweit größten humanitären Krisen
entwickelt. Seit Anfang 2017 habe sich die Situation angesichts von
Krieg und Dürre immer weiter zugespitzt. „Den Menschen mangelt es
an allem, Hunger und Leid sind permanente Alltagszustände
geworden“, erklären das Bistum und die Landeskirche.
Hinweis:
Spenden sind möglich bei Caritas international, IBAN:
DE88 6602 0500 0202 0202 02, BIC: FSWDE33KRL, Bank für
Sozialwirtschaft Karlsruhe, Stichwort: Ernährungssicherung
Südsudan, oder online unter www.caritas-international.de
sowie bei der Diakonie Katastrophenhilfe, Evangelische Bank,
IBAN: DE68520604100000502502, BIC: GENODEF1EK1, Stichwort Afrika
Hungerhilfe, oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de.
Text: is(lk; Foto: Caritas International
23.03.2017
Messgewand von Papst Johannes Paul II. wieder im Einsatz
 Das Papstgewand in der Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im Historischen Museum der Pfalz
Das Papstgewand in der Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im Historischen Museum der Pfalz
Das Papstgewand wird der Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im
Historischen Museum entnommen
Speyer- Traditionsgemäß trägt der Speyerer
Bischof am sogenannten Papstsonntag das Messgewand, in dem Papst
Johannes Paul II. bei seinem Besuch in Speyer im Jahr 1987 die
Messe zelebrierte. In diesem Jahr ist das Gewand Teil der
Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im Historischen Museum der Pfalz.
Für das Pontifikalamt, das am 26. März um 10 Uhr im Dom
stattfindet, wird das päpstliche Messgewand kurzzeitig aus der
Ausstellung entnommen und von Bischof Wiesemann während der Messe
getragen.
Änderung: Wir müssen uns leider
korrigieren. Das Messgewand, das Papst Johannes Paul II. bei seinem
Besuch in Speyer im Jahr 1987 getragen hat, wird am Sonntag nicht
eingesetzt. Der Grund ist die liturgische Farbe. Am 4.
Fastensonntag, dem so genannten Sonntag Laetare, wird in
katholischen Gottesdiensten die Farbe Violett oder Rosa verwendet.
Das Messgewand von Papst Johannes Paul II. hat jedoch die Farbe
Weiß.
Im Gedenken an den Jahrestag der Wahl von Papst Franziskus
feiert die Weltkirche am 4. Sonntag in der Osterzeit als
„Papstsonntag“. In der Messe im Dom zu Speyer wird zudem der
Einführung des 96. Speyerer Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 2.
März 2008 gedacht. Der Zelebrant der Messe trägt an diesem Tag das
sogenannte „Papstgewand“, das Papst Johannes Paul II. bei seinem
Besuch in Speyer trug. Das Messgewand ist in der Ausstellung
„Weltbühne Speyer - Die Ära der großen Staatsbesuche“ im
Historischen Museum in Speyer noch bis zum 24. September 2017 zu
sehen. In der Ausstellung werden die Besuche internationaler
Politiker, geistlicher Würdenträger und Monarchen in Speyer
zwischen 1984 und 1999 dokumentiert, in dem Fotografien,
Filmsequenzen und weitere Zeitzeugnisse wie das Gewand Papst
Johannes Paul II. ausgestellt werden. Die Museumsschau
verdeutlicht, wie viele Menschen der Papstbesuch auf die Straßen
und vor den Dom lockte. An der Eucharistiefeier auf dem Domplatz,
dem Höhepunkt des Besuchs, nahmen ca. 60.000 Menschen teil.
Papstbesuch in Speyer 1987
Papst Johannes Paul II. kam am 4. Mai 1987 nach Speyer. Nach der
Ankunft und der Fahrt mit dem Papamobil durch die
Maximiliansstraße, besuchte der Papst zusammen mit dem Bischof und
den Mitgliedern des Domkapitels den Dom. Dabei betete er vor der
Marienstatue, sprach in der Grablege der Kaiser das kirchliche
Totengebet und segnete die Gräber. Anschließend fand vor dem Dom
eine Eucharistiefeier statt. Für diese Messe brachte der Papst ein
Gewand mit, das er danach dem damaligen Bischof von Speyer Dr.
Anton Schlembach schenkte.
Das goldfarbene Messgewand mit den drei roten Kreuzen, die
beidseitig auf dem Stab des Gewands zu sehen sind, wurde damals
eigens für die Messe in Speyer angefertigt und aus Rom mitgebracht.
Unter den roten Kreuzen ist auf der Rückenseite das päpstliche
Wappen eingestickt. Im rechten unteren Wappenfeld verweist der
Buchstabe M auf die Gottesmutter Maria. Ihr und dem heiligen
Stephanus ist der Speyerer Dom geweiht. Da Johannes Paul II. am 27.
April 2014 heiliggesprochen wurde, ist das Gewand ebenso wie das
Messbuch, aus dem der Papst während der Messe vor dem Dom las, eine
Berührungsreliquie. Text: is; © Foto: Historisches Museum
der Pfalz/Carolin Breckle
20.03.2017
Neue Gruppe für Kinder suchtkranker Eltern
 Schatzinsel-Gruppe
will Kinder stärken und unterstützen
Schatzinsel-Gruppe
will Kinder stärken und unterstützen
Speyer- Das Caritas-Zentrum Speyer bietet jedes
Jahr eine Gruppe für Kinder an, die in ihren Familien Sucht und
Alkoholprobleme oder psychische Erkrankungen ihrer Eltern erleben.
Betroffene Väter und Mütter, die sich in Behandlung befinden oder
sich darüber Gedanken machen, wollen in der Regel keinesfalls, dass
ihre Kinder darunter leiden müssen. Sie sind jedoch
krankheitsbedingt manchmal nicht in der Lage, ihnen die
Zuverlässigkeit und Zuwendung zu bieten, die Kinder brauchen.
Betroffene Kinder machen sich oft große Sorgen um ihre Eltern,
verstehen manche Reaktionen nicht und fühlen sich selbst dafür
schuldig. Manche ziehen sich zurück, stellen kindliche Bedürfnisse
zurück oder übernehmen nicht dem Alter angemessene Verantwortung.
Andere werden auch selbst verhaltensauffällig. Das Risiko selbst
einmal psychische Probleme zu entwickeln ist deutlich erhöht.
Neben den bekannten Hilfs-und Behandlungsangeboten für die
Erwachsenen sollen die Kinder nicht vergessen werden. In der
„Schatzinsel“-Gruppe erfahren sie Aufklärung, Unterstützung und
Stärkung. Spiel und Spaß kommen dabei nicht zu kurz.
Die Gruppe richtet sich an Kinder zwischen sieben und zwölf
Jahren und findet demnächst einmal wöchentlich im Haus für
Kinder St. Hedwig in Speyer statt. Sie wird von erfahrenen
Fachkräften des Caritaszentrums geleitet.
Bei Interesse wenden Sie sich für ein Infogespräch an das
Caritas-Zentrum Speyer, Telefon 06232-8725112, oder per Email
elisabeth.segiet@caritas-speyer.de
.Text und Foto: Caritasverband für die Diözese Speyer
e.V.
17.03.2017
Vom Pfarrer in Kerzenheim zum Präsidenten des Kirchenamtes
Kirchenpräsident Christian Schad zum Tode von Hermann
Barth
Speyer- Als großen Brückenbauer zwischen
den Landeskirchen und den Gremien und Institutionen der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) hat der pfälzische
Kirchenpräsident Christian Schad den am Mittwoch verstorbenen
ehemaligen Präsidenten des Kirchenamtes der EKD, Hermann Barth,
bezeichnet. Barth habe es vermocht, intensiv zuzuhören und sich
empathisch auf Menschen einzulassen. Zudem habe der in Ludwigshafen
am Rhein geborene promovierte Theologe die Gabe besessen, klar und
deutlich Position zu beziehen und es dabei niemals an Herzenswärme
fehlen zu lassen, sagte Schad.
Gerade in schwierigen Situationen habe es der Präsident des
EKD-Kirchenamtes verstanden, das Verständnis widerstreitender
Auffassungen füreinander zu öffnen, erklärte der Kirchenpräsident.
So habe Barth das Zusammenwachsen der EKD mit seinen damals 22 sehr
unterschiedlich geprägten Gliedkirchen auf den Weg gebracht. Der in
Hannover lebende Pfälzer habe sich auch stets als „Verteidiger der
pfälzischen Kirche“ verstanden, auch wenn diese im Blick auf den
Reformprozess innerhalb der EKD nicht immer zu seiner Freude agiert
habe. Im Gedächtnis bleibe Barth jedoch nicht nur den Pfälzern als
weiser, präzise formulierender Theologe, als den biblischen Text
akribisch auslegender Prediger und als Seelsorger mit einem
hörenden Herzen, sagte Schad.
Bei seinem letzten offiziellen Besuch als Kirchenamtspräsident
vor der pfälzischen Landessynode räumte Barth 2010 in Speyer ein,
dass er erst am Ende seines beruflichen Weges einen Zugang zur
Aufklärungstheologie gefunden habe, von der die pfälzische
Kirchenunion bestimmt sei. Dies habe ihm erlaubt, „mich nicht mehr
wegzuducken, wenn die geistigen und kulturellen Wurzeln der
pfälzischen Union in den Blick treten“.
Hermann Barth war von 2006 bis 2010 Präsident des Kirchenamtes
der EKD, in dem er seit 1985 in verschiedenen Funktionen arbeitete.
Barth studierte evangelische Theologie in Heidelberg, Edinburgh und
Tübingen und war von 1970 bis 1977 wissenschaftlicher Assistent am
Alttestamentlichen Seminar des Fachbereichs Evangelische Theologie
der Universität Hamburg. Weitere Stationen waren das Vikariat in
der Evangelisch-reformierten Kirche und das Gemeindepfarramt im
pfälzischen Kerzenheim. Von 1993 an leitete er die Hauptabteilung
„Theologie und öffentliche Verantwortung“ des Kirchenamtes. Der
Theologe gehörte lange Jahre dem Nationalen Ethikrat und dem
ZDF-Fernsehrat an. lk
17.03.2017
Restauriertes Rhodter Kirchenbuch zurück in der Pfalz
 Günter Baumann, Godelinde Baumann, Kirchenpräsident Christian Schad, Äbtissin Dorothea Flandera und Christine Lauer (von links).
Günter Baumann, Godelinde Baumann, Kirchenpräsident Christian Schad, Äbtissin Dorothea Flandera und Christine Lauer (von links).
Nach zwei Jahren in der Werkstatt des Klosters St.
Hildegard jetzt wieder im Bestand des Archivs
Speyer/Rhodt- Es hat mehrere hundert Jahre
auf dem Buchrücken, aber sein hohes Alter ist ihm kaum mehr
anzusehen: Ein Kirchenbuch aus Rhodt, mit Eintragungen vom späten
17. Jahrhundert bis Ende des 18. Jahrhunderts, ist jetzt nach
zweijähriger gründlicher Restaurierung in der Werkstatt des
Klosters St. Hildegard bei Rüdesheim in seine pfälzische Heimat
zurückgekehrt.
Im Zentralarchiv der Landeskirche nahmen Kirchenpräsident
Christian Schad, das Ehepaar Günter und Godelinde Baumann aus
Rhodt, Diplom-Archivarin Christine Lauer und Gemeindepfarrer Lothar
Schwarz das wertvolle Stück von Schwester Dorothea Flandera
entgegen. Insgesamt 111 Stunden seien an dem 300 Blätter
umfassenden Buch gearbeitet worden, erklärte die Äbtissin und
Leiterin der Restaurierungswerkstatt bei der Übergabe am
Donnerstag. Der Leder-Einband musste ersetzt, der Buchblock neu
gebunden, Tintenfraß und andere Zersetzungserscheinungen bekämpft
werden.
Für Christine Lauer hat das Rhodter Kirchenbuch einen ganz
besonderen Wert. „Es birgt viele Geschichten, schöne und tragische.
Für mich ist das heute ein großer Tag“, bedankte sich die
stellvertretende Archivleiterin bei der Äbtissin und dem Ehepaar
Baumann, das das Projekt finanziert hat. „Es war uns ein
Herzensanliegen“, sagte Günter Baumann. Er und seine Frau hatten
das Buch entdeckt, als das Pfarrhaus 1980 umgebaut worden war.
Beide sind langjährige Benutzer des landeskirchlichen Archivs, sie
haben das Rhodter Kirchenbuch auch transskribiert. Über die
Rückkehr dieses „Kleinods“ freute sich auch Gemeindepfarrer Lothar
Schwarz.
Das Zentralarchiv ist das „protestantische Gedächtnis der
Pfalz“. Es umfasst rund 300 Pfarrarchive, 20 Dekanatsarchive und
161 Nachlässe. Dazu kommen Kirchenbücher, Bildquellen und Baupläne.
Die Kirchenbücher stellen eine der wichtigsten genealogischen
Quellen dar, erklärt Lauer. In ihnen sind kirchliche
Amtshandlungen, vor allem Taufen, Trauungen und Bestattungen, aber
auch besondere Vorkommnisse, Orts- und Kirchenchroniken, Pfarr- und
Kircheninventare sowie Konfirmandenverzeichnisse aufgeführt. Die
Kirchenbücher können im Lesesaal des Zentralarchivs eingesehen
werden.
Mit der Werkstadt des Klosters St. Hildegard arbeitet das
Speyerer Zentralarchiv seit 2005 zusammen. Das Kloster hat sich auf
die Restaurierung von alten Tauf-, Trau- und Sterberegistern, aber
auch von Handschriften auf Pergament oder Papier wie Protokolle
oder liturgische Texte sowie von Plänen, Urkunden, Akten und
sonstigen archivarischen Besonderheiten spezialisiert. Text:
und Foto: Landeskirche
Mehr zum Thema: www.zentralarchiv-speyer.de;
www.abtei-st-hildegard.de.
13.03.2017
Versöhnen und heilen als gemeinsamer ökumenischer Auftrag
 Bischof Wiesemann warnt in seinem Hirtenwort zur
Fastenzeit vor Erstarken von Eigen- und Nationalinteressen / Absage
an Forderung nach Wende in deutscher Erinnerungskultur
Bischof Wiesemann warnt in seinem Hirtenwort zur
Fastenzeit vor Erstarken von Eigen- und Nationalinteressen / Absage
an Forderung nach Wende in deutscher Erinnerungskultur
Speyer- Das Versöhnen und Heilen als
christlichen Grundauftrag hat Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in
den Mittelpunkt seines Hirtenworts zur Fastenzeit gestellt. Die
Kirche müsse vor allem „Feldlazarett für die Verwundeten dieser
Welt“ sein, schreibt er mit Bezug auf Papst Franziskus.
Entschlossen widerspricht er der Forderung nach einer Wende in der
deutschen Erinnerungskultur: „Kann jemand groß sein, der nicht zu
seiner eigenen Geschichte auch mit ihren dunklen Kapiteln steht?“
Es sei Anlass zur Sorge, wenn der Vorrang der Eigen- oder
Nationalinteressen proklamiert und Angst vor Überfremdung geschürt
werde.
Für Bischof Wiesemann sind Versöhnen und Heilen auch Anspruch an
das Miteinander der christlichen Konfessionen: „Wie können wir ein
Zeichen der Versöhnung des Heiles in der Welt sein, wenn wir
untereinander nicht eins sind?“ Ökumene als der „leidenschaftliche
Einsatz für die Einheit der Christen“ gehöre für ihn zum „innersten
Kern des Christseins“. Er bekräftigt die Verpflichtung, der Welt
nie wieder das „erbärmliche Bild einer zankenden Christenheit“ zu
liefern, sondern in „versöhnter Verschiedenheit mit aller Kraft die
sichtbare Einheit“ zu suchen. Das Reformationsgedenken lade dazu
ein, sich gemeinsam „unter die versöhnende Kraft des Evangeliums“
zu stellen. „Wir müssen uns nicht mehr gegeneinander abgrenzen,
sondern wir wissen, dass wir nur gemeinsam glaubwürdig Zeugnis für
Christus ablegen können“, betont Bischof Wiesemann in seinem
Hirtenwort. Er dankt der Evangelischen Kirche, dass sie die
Erinnerung an 500 Jahre Reformation als Christus-Fest bewusst
ökumenisch ausgerichtet hat.
Bischof Wiesemann wirbt zugleich für eine „neue ökumenische
Leidenschaft“ und fordert die Gläubigen auf, die vielfältigen
Möglichkeiten zur ökumenischen Begegnung wahrzunehmen. „Dabei
können wir uns gegenseitig unsere persönliche ökumenische
Geschichte mit allen Bereicherungen, aber auch mit unseren
Verwundungen erzählen, immer in der Bereitschaft, dass wir auch
selbst unsere Vorurteile und Einseitigkeiten im Dialog mit den
anderen aufbrechen lassen.“ Es sei wichtig, nicht beim Ziel eines
friedlichen Nebeneinanders der Konfessionen stehen zu bleiben.
Vor allem konfessionsverbindende Ehen und Familien hätten häufig
eine von Verurteilungen und Ausschließungen geprägte Geschichte
erfahren. „Dabei verwirklichen sie das, was Ökumene im Wortsinn
bedeutet, auf besonders dichte Weise: das Zusammenwohnen in der
einen Hausgemeinschaft Gottes.“ Bischof Wiesemann unterstreicht:
„Ich nehme die Verpflichtung in unserem ökumenischen Leitfaden sehr
ernst, mich gerade hier für Lösungen einzusetzen, die der
Wirklichkeit dieser gelebten Einheit im Kleinen einer Hauskirche
besser gerecht werden.“
Zugleicht lädt er in seinem Hirtenwort alle Gläubigen zur Feier
des zweihundertjährigen Jubiläum der Neugründung des Bistums Speyer
an Pfingsten nach Speyer ein. An den Anfang der Feier am
Pfingstsonntag sei ganz bewusst eine ökumenische Vesper gestellt
worden: „Wir möchten nicht ohne unsere in der konkreten
Kirchengemeinschaft zwar noch von uns getrennten, durch das Band
der Taufe aber schon mit uns geeinten Brüder und Schwestern im
Glauben feiern und in die Zukunft gehen.“ is
Hirtenwort des Bischofs als Video: https://www.youtube.com/watch?v=UBRy5lG0Li8
11.03.2017
Der Weg nach oben ist wieder frei
 Nach der
Winterpause öffnen Kaisersaal und Aussichtsplattform für Besucher –
Zwerggalerie während der warmen Monate begehbar
Nach der
Winterpause öffnen Kaisersaal und Aussichtsplattform für Besucher –
Zwerggalerie während der warmen Monate begehbar
Speyer- Die Tage werden länger und wärmer. Am
Dom zu Speyer heißt das: ab dem 1. April ist der Aufstieg auf den
60 Meter hohen Südwestturm wieder frei gegeben. Der Weg dorthin
führt durch den über der Vorhalle gelegenen Kaisersaal. Nach
Revisionsarbeiten an den Bodenplatten sind auch die dort
ausgestellten Fresken wieder zugänglich. Ebenfalls nur in der
wärmeren Jahreszeit möglich: ein Rundgang über die Zwerggalerie.
Dieses besondere Angebot richtet sich an Kleingruppen von bis zu 5
Personen mit Interesse an der Baugeschichte des Doms.
Trotz der wärmeren Temperaturen draußen, kann es im und rund um
den Dom auch im Frühling noch recht kalt sein. Die riesigen
Luftmassen im Innern der Kathedrale erwärmen sich nur langsam und
die Sandsteinmauern halten die Kälte des Winters bis weit ins
Frühjahr hinein. Daher sollte man sich für den Besuch eines
Gottesdienstes oder einer Führung im Dom warm anziehen. Auch wer
ein Konzert der Dommusik besucht, ist gut beraten, sich eine Decke
mitzubringen. Die Reihe „Cantate Domino“, die samstags um 18 Uhr
stattfindet, lädt noch bis zum Abend vor Palmsonntag zu
kostenfreien musikalischen Impulsen in den Dom.
 Seit rund einem Jahr
bietet das Dom-Besucherzentrum im südlichen Domgarten Informationen
rund um den Dombesuch. Ebenso sind dort Eintrittskarten und
Audioguides erhältlich. Mit dem Kauf der sogenannten „Dombausteine“
des Dombauvereins lässt sich ein schönes Andenken an den Dom
erwerben und zugleich dem Bauwerk etwas Gutes tun.
Seit rund einem Jahr
bietet das Dom-Besucherzentrum im südlichen Domgarten Informationen
rund um den Dombesuch. Ebenso sind dort Eintrittskarten und
Audioguides erhältlich. Mit dem Kauf der sogenannten „Dombausteine“
des Dombauvereins lässt sich ein schönes Andenken an den Dom
erwerben und zugleich dem Bauwerk etwas Gutes tun.
Besucherinformationen
Öffnungszeiten:
Dom: geöffnet werktags April bis
Oktober 9–19 Uhr, werktags November bis März 9–17 Uhr, sonntags
ganzjährig 12–18 Uhr.
Kaisersaal und Aussichtsplattform: Geöffnet werktags April bis
Oktober 10–17 Uhr, sonntags 12–17 Uhr. Einlass im
20-Minuten-Takt.
Während der Gottesdienste und bei Sonderveranstaltungen ist eine
Besichtigung nicht möglich.
Öffnungszeiten während der Ostertage:
10. April 2017
Besichtigung bis 16 Uhr (17 Uhr Chrisam Messe)
14. April 2017, Karfreitag
Stille Besichtigung nur 12 bis 14 Uhr (10 Uhr Kinderkreuzweg,
danach Beichtgelegenheit bis 13 Uhr. 15 Uhr Karfreitagsliturgie,
anschließend Beichtgelegenheit)
15. April 2017, Karsamstag
Stille Besichtigung 10 bis 18 Uhr (21 Uhr Feier der
Osternacht)
16. April 2017, Ostern
Besichtigung 12.30 bis 16 Uhr (10 Uhr Pontifikalamt, 16.30 Uhr
Pontifikalvesper, 18 Uhr Abendmesse)
17. April 2017, Ostermontag
Besichtigung 12.30 bis 17.30 Uhr (10 Uhr Pontifikalamt, 18 Uhr
Abendmesse)
Domführungen:
Information und Buchung: www.dom-zu-speyer.de/domfuehrungen
E-Mail: domfuehrungen@bistum-speyer.de
Telefon 0 62 32/102-118 (Bürozeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 12
Uhr sowie Montag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr), Fax 0 62
32/102-119
Audioguide:
Hörtouren für Kinder und Erwachsene
werden in Deutsch, Englisch und Französisch angeboten und sind im
Dom-Besucherzentrum erhältlich.
Aktuelle Informationen und Kontakt: www.dom-zu-speyer.de Text:
is; Foto: spk-Archiv
11.03.2017
Gemeinsamer Traum von Solidarität
 Kardinal Philippe Ouédraogo aus Ouagadougou, der Hauptstadt des afrikanischen Staates Burkina Faso
Kardinal Philippe Ouédraogo aus Ouagadougou, der Hauptstadt des afrikanischen Staates Burkina Faso
Pressegespräch mit Kardinal Philippe Ouédraogo aus Burkina
Faso, dem Beispielland der Fastenaktion von „Misereor“, in
Ludwigshafen
Ludwigshafen - Zwei Tage lang ist Kardinal
Philippe Ouédraogo aus Ouagadougou, der Hauptstadt des
afrikanischen Staates Burkina Faso, im Bistum Speyer zu Gast.
Burkina Faso ist eines der ärmsten Länder Afrikas und in diesem
Jahr Beispielland der Fastenaktion des katholischen Hilfswerkes
„Misereor“. Sie steht unter dem Motto „Die Welt ist voller guter
Ideen. Lass sie wachsen“.
Bei einem Pressegespräch in Ludwigshafen erläuterte Kardinal
Ouédraogo, wie passend dieses Motto für sein Land ist: 80 Prozent
der Bevölkerung leben von Landwirtschaft und Viehzucht. Eine große
Herausforderung ist für das Land die junge Bevölkerung: 70 Prozent
sind jünger als 35 Jahre. Zugleich gehen noch immer nur rund 60
Prozent der Kinder zur Schule, die Gesundheitsversorgung des Landes
ist lückenhaft, die Stellung der Frau und die Menschenrechte sind
für den Kardinal ebenso Grund zur Sorge. Zwar ist es der
Bevölkerung gelungen, eine Demokratie zu erkämpfen, aber das war
mit großen Opfern verbunden, berichtet der Kardinal. „Jetzt geht es
außerdem darum, diese Demokratie zu festigen“, sagt er – und dazu
brauche das Land Partner. Die Arbeitslosigkeit müsse bekämpft
werden, damit nicht weiterhin viele junge Menschen Afrika
verlassen.
An vielen Stellen leben die Menschen in Burkina Faso Toleranz:
Neben den Katholiken gibt es eine Mehrheit von Muslimen sowie eine
große Gruppe, die den traditionellen afrikanischen Religionen
angehören. „Blutsbande sind stärker als Glaubensbande“, weiß
Kardinal Ouédraogo, und so gehen die verschiedenen Religionen quer
durch Familien, interreligiöse Hochzeiten sind ebenso möglich wie
der Übertritt in eine andere Glaubenszugehörigkeit. Die religiösen
Oberhäupter besuchen sich gegenseitig an den Feiertagen der jeweils
anderen Religion, und in seiner Bischofsstadt gibt es ein
„Bischofs-Cup“ genanntes Fußballturnier, das ebenfalls dem
interreligiösen Dialog dient.
Die afrikanischen Traditionen, so erzählt er aus dem Alltag,
spielen auch im Glaubensleben eine große Rolle. So nutzt er gerne
afrikanische Sprichwörter und setzt sie in der Katechese um. Sein
Lieblingssprichwort und Lebensmotto lautet: „Man gibt nicht, weil
man hat, man gibt, weil man liebt“ – und schon stellt er die
Verbindung her zum Gleichnis des barmherzigen Samariters.
„Es geht nur in Solidarität“, betont Kardinal Ouédraogo, wenn er
die verschiedenen Herausforderungen in seinem Land – aber auch
weltweit - anspricht. „Wir brauchen die Zusammenarbeit mit anderen
Ländern, mit den Kirchen Europas und mit Institutionen wie
Misereor“, fordert er. Er zitiert Martin Luther King und wünscht
sich, dass „wir alle gemeinsam träumen“, von Solidarität, Brücken
zwischen Ländern, Religionen und Partnern.
Die katholische Kirche sieht der afrikanische Kardinal als eine
einzige große Familie an. Sie ist einheitlich – getragen von Jesus
Christus und dem Evangelium – und sie ist vielfältig in ihren
Herausforderungen. „Die Länder haben unterschiedliche
Entwicklungsstadien, und wenn zum Beispiel in Deutschland das Thema
Ehescheidungen ein großes Problem ist, so ist die Polygamie bei uns
eine Schwierigkeit“, sagt er. Aber er ist überzeugt: „Es wird uns
gelingen, unsere Kirche zu stärken, wenn wir Seite an Seite gehen,
und durch das gemeinsame Gebet, das Zuhören und die Treue zum
Evangelium.“
Kardinal Ouédraogo ist sehr dankbar dafür, dass Burkina Faso
Beispielland für „Misereor“ ist. Seine Reise, die noch bis 22. März
durch Deutschland geht, ist teilweise auch anstrengend. „Aber es
ist ein starkes Zeichen, dass Sie ausgerechnet uns als eines von 54
afrikanischen Ländern ausgewählt haben!“
Kardinal Ouédraogo nimmt heute Abend auch an der
Abschlussveranstaltung der Lebensstil-Kampagne „Gutes Leben. Für
alle!“ im Heinrich Pesch Haus teil, die unter dem Titel
steht: „Jetzt reicht’s!“
Text/Foto: Brigitte Deiters
10.03.2017
Begegnungen mit „Fresh Expressions of Church“
 Letzte
Kundschafterreise des Bistums Speyer führt nach England
Letzte
Kundschafterreise des Bistums Speyer führt nach England
Speyer. Neun Frauen und Männer starten am
Sonntag, 12. März, zur letzten Kundschafterreise des Bistums Speyer
nach England. Bei der einwöchigen Tour unter dem Motto „Lernen von
der Weltkirche“ geht es vor allem um das Kennenlernen der Bewegung
„Fresh Expressions of Church“, die neue Formen von Kirche
ausprobiert und fördert.
Die Reisegruppe setzt sich aus ehren- und hauptamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Pfarreien und Vertretern des
bischöflichen Ordinariates zusammen. An der Spitze der Gruppe steht
Generalvikar Dr. Franz Jung. Er leitet die Reise zusammen mit Dr.
Peter Hundertmark, verantwortlich für das Referat Spirituelle
Bildung im Bistum.
„Es gibt ganz verschiedene Formen von ‚Fresh Expressions of
Church‘ – das reicht von der sogenannten ‚Café-Church‘, in der sich
Menschen in einem Café treffen, der generationenübergreifenden
‚Messy-Church‘ bis zur ‚Cell-Church‘, das sind Hauskreise“, erklärt
Dr. Peter Hundertmark. „Der Grundsatz lautet ‚Go and stay‘, das
bedeutet: Kirche geht an ganz verschiedene Orte, dorthin wo sich
Menschen treffen, wo Platz ist, und bleibt dort.“ Die Bewegung
„Fresh Expressions of Church“ (frische Ausdrucksformen von Kirche),
entstand vor etwa 15 Jahren und ist inzwischen von der
anglikanischen, der methodistischen und anderen kleineren Kirchen
in England als Organisation offiziell anerkannt und gefördert. „Im
Zeitraum zwischen 2008 bis 2016 kamen über 100 000 Menschen über
‚Fresh Ex‘ wieder in Kontakt mit einer Form von christlicher
Kirche“, berichtet Hundertmark von dem Erfolg dieser
missionarischen Bewegung. Neben den vielen Ehrenamtlichen, die sich
dort engagieren, gibt es inzwischen auch hauptamtliche „pioneer
minister“, die im Auftrag der christlichen Kirchen in England für
„Fresh Expressions of Church“ arbeiten.
Vielfältige Erwartungen der Kundschafter
England-Kundschafterin Brigitte Deiters, die ehrenamtlich im
„Lichtpunkt“ in Ludwigshafen mitarbeitet, interessiert die Frage,
welchen Spielraum Ehrenamtliche in den Kirchen haben. Ihr
hauptamtlicher Kollege und Referent für den Lichtpunkt, Joachim
Lauer, möchte „lernen, was es heißt, für diejenigen da zu sein, die
wir nicht mehr erreichen und bei alldem dem eigenen Traum von
Kirche nachgehen.“ Generalvikar Dr. Jung interessieren „die
Aufbrüche der anglikanischen Kirche in einem weitgehend
säkularisierten Umfeld“, von denen er sich Anregungen für das
Bistum Speyer erhofft. Auch Dr. Thomas Kiefer, Leiter der Abteilung
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen, ist gespannt darauf zu
sehen, „wie die anglikanische Kirche an die Ränder geht und wie
missionarisches Handeln und Sozialraumorientierung zusammengehen
können.“ Felix Goldinger, Referent für missionarische Pastoral im
Bistum Speyer, ist begeistert von Fresh Expression Projekten und
hofft, auch im Bistum Speyer neue Formen von Kirche ausprobieren zu
können. Darauf spannende, neue Ansätze „für pastorales Handeln“
kennenzulernen, freut sich auch Dominik Schek aus Bad Dürkheim (Hl.
Theresia vom Kinde Jesu). Gemeindereferentin Silke Stein, Pfarrei
Maria Schutz in Kaiserlautern, interessiert sich dafür „wie andere
anderswo mitgestalten und mit bauen am Reich Gottes“ und ihre
ehrenamtliche Mitarbeiterin Christine Tigges hofft, durch die Fresh
Expressions „Impulse zu erhalten, Menschen für die Kirche zu
begeistern“ – besonders diejenigen, „die sich von der Kirche
distanziert haben“.
Die Reise nach England ist die letzte von insgesamt vier
Kundschafterreisen des Bistums Speyer. Ziele der ersten drei Reisen
waren Nicaragua (Ende 2016), die Philippinen (Februar 2017) und
Südafrika (bis zum 16. März 2017).
Die Kundschaftergruppe in England wird über ihre Erlebnisse,
Erfahrungen und Reflexionen in einem täglichen Reiseblog berichten.
Er kann über die Internetseite des Bistums Speyers von jedem
Interessierten eingesehen, mitgelesen und kommentiert werden.
Weitere Informationen zu den Kundschafterreisen des Bistums
Speyer:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/kundschafterreisen/
Link zum Blog der Kundschafterreise nach England:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/kundschafterreisen/reiseblog-england
/
Es besteht die Möglichkeit, dass Interessierte per E-Mail
automatisch über neue Blog-Einträge informiert werden.
Bistum Speyer
08.03.2017
Buber-Rosenzweig-Medaille - „Kompliment für unsere Arbeit“
 Pfarrer Stefan Meißner ist Mitglied der Konferenz
landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden
Pfarrer Stefan Meißner ist Mitglied der Konferenz
landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden
Speyer/Landau (lk). „Nun gehe hin und
lerne“: Das Motto der diesjährigen Woche der Brüderlichkeit ist für
den Vorsitzenden des landeskirchlichen Arbeitskreises Kirche und
Judentum, Stefan Meißner, auch persönliches Leitmotiv. Der Pfarrer
vertritt die Evangelische Kirche der Pfalz in der kürzlich mit der
Buber-Rosenzweig-Medaille ausgezeichneten Konferenz
landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden (KLAK). „Die
Verleihung ist ein schönes Kompliment für unser Gremium“, sagt
Meißner. Stets seien jüdische Gesprächspartner bei den Tagungen
eingeladen und setzten mit ihren Vorträgen und Gesprächsbeiträgen
wichtige Impulse.
„Mit unserer Arbeit möchten wir nicht nur für den
christlich-jüdischen Dialog werben, sondern darüber hinaus auch ein
deutliches Signal gegen Antisemitismus und Rassismus setzen“,
erklärt Meißner, der auch Mitglied der Gesellschaft für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz ist. Im Rahmen der Feiern
zum 30-jährigen Bestehen der Gesellschaft referiert Meißner am 15.
März um 19 Uhr in der Landauer Katharinen-Kapelle über die KLAK.
Titel: „Nun gehe hin und lerne. 40 Jahre Arbeit für den
christlich-jüdischen Dialog“.
Der gegenseitige Austausch und die Pflege partnerschaftlicher
Kontakte mit Vertretern des Judentums in der KLAK seien für seine
Arbeit im landeskirchlichen Arbeitskreis Kirche und Judentum sehr
hilfreich, so Meißner. Der Arbeitskreis erörtert Grundsatzfragen
des christlich-jüdischen Dialogs und erstellt Konzepte und
Arbeitshilfen zur Auseinandersetzung mit jüdischer Religion und
jüdischem Leben früher und heute. Damit soll das Thema für die
Arbeit in Gemeinde und Unterricht fruchtbar gemacht werden. Der
Arbeitskreis lädt zudem zu Studientagen, Seminaren und Vorträgen
ein und trägt damit zur Meinungsbildung bei. Viele dieser
Veranstaltungen werden in Kooperation mit einzelnen
Kirchengemeinden, der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung und
Gesellschaft, dem Jerusalemverein oder der Gesellschaft für
Christlich-jüdische Zusammenarbeit durchgeführt.
Der Deutsche Koordinierungsrat der Gesellschaften für
Christlich-Jüdische Zusammenarbeit vergibt in der „Woche der
Brüderlichkeit“ vom 5. bis 12. März die Buber-Rosenzweig-Medaille
an Personen oder Institutionen, die sich um die Verständigung
zwischen Christen und Juden verdient gemacht haben. Die
Auszeichnung erinnert an die jüdischen Philosophen und Pädagogen
Martin Buber (1878-1965) und Franz Rosenzweig (1886-1929).
Hinweis: Anlässlich der Feier zum 30-jährigen Bestehen
der Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Pfalz hält
der Herxheimer Autor Michael Bauer am 8. März, 19 Uhr, im
Gemeindezentrum der protestantischen Stiftskirche in Landau den
Festvortrag. Titel: „Auferstehung des Geistes zum Segen der ganzen
Menschheit". Mehr zum Thema: www.klak.org/; www.christen-und-juden.de/.
EVANGELISCHE KIRCHE DER PFALZ
08.03.2017
„Die Taufe ist das individuellste der Sakramente“
 Bischof Wiesemann gibt einer Taufbewerberinnen seine Segenswünsche mit auf den Weg
Bischof Wiesemann gibt einer Taufbewerberinnen seine Segenswünsche mit auf den Weg
Wortgottesdienst mit Bischof Wiesemann in der Krypta des
Domes zur Feier der Zulassung von Erwachsenen zur
Taufe
Speyer. In einem Wortgottesdienst am
Sonntagnachmittag in der Krypta des Speyerer Domes hat Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann 22 Bewerber – zwölf Männer und zehn Frauen –
aus dem ganzen Bistum zur Erwachsenentaufe zugelassen. „Wenn ich
mich umschaue“, so der Bischof bei der Begrüßung, „ist hier ein
Großteil der Weltkirche versammelt: Europa, Afrika, Asien, und
ebenso geben Ihre Biografien einen Querschnitt durch alle
Lebenswelten. Wir freuen uns alle mit Ihnen und begleiten Sie mit
unseren Gebeten.“
In seiner Predigt betonte der Bischof: „Die Taufe ist das
individuellste der Sakramente. Ich habe dich bei deinem Namen
gerufen, sagt Gott. Das ist für mich ein ganz starkes Wort auch in
meinem eigenen Leben geworden. Und jeder Bewerber hat eine ganz
persönliche Entscheidung getroffen, manchmal sogar gegen die
Stimmen seiner Familie, seiner Umgebung. Da wurde nichts
übergestülpt, weil man sich taufen lässt.“
Die einzelnen Taufbewerber waren zusammen mit ihren Paten und
ihren Katechumenenbegleitern gekommen und wurden einzeln
vorgestellt. Jeden hatte die Pfarrei in einem eigenen Schreiben an
den Bischof zur Taufe empfohlen. Stellvertretend für alle wurde die
persönliche Geschichte zweier Bewerber von Walburga Wintergerst,
Referentin Pastorale Dienste – Katechese, vorgelesen: Ellen
Dressing ist eine junge Lehrerin am Katholischen Gymnasium St.
Franziskus in Kaiserslautern. Ihr Wunsch getauft zu werden,
entstand durch ihre Tätigkeit an katholischen Schulen. Der Japaner
Tetsutako Amano kam über ein akademisches Austauschprogramm nach
Ludwigshafen, wo er in der Pfarrei St. Cäcilia eines Tages einen
kleinen abendlichen Vespergottesdienst besuchte, nach und nach ins
Gemeindeleben aufgenommen wurde und so zu seinem Glauben fand.
Alle Bewerber werden das Sakrament der Taufe in ihren
Heimatgemeinden an Ostern, meist in der Osternacht, empfangen.
Gleichzeitig werden sie zur Erstkommunion gehen und gefirmt.
Der Gottesdienst wurde musikalisch gestaltet vom Jugendchor der
Dommusik unter Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller an der Orgel.
Text: Andrea Dölle/Foto: Nicole Fuhr
07.03.2017
"Die österliche Bußzeit will uns die Herzen öffnen für das, was von Gott kommt"
-Asche.jpg) Die Asche steht bereit.
Die Asche steht bereit.
Pontifikalamt mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am
Aschermittwoch im Dom zu Speyer
Speyer. Anstöße zum Nachdenken hat Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann beim Pontifikalamt am Aschermittwoch im
Speyerer Dom gegeben und die Gottesdienstbesucher auf die
vorösterliche Buß- und Fastenzeit eingestimmt. Diese Zeit dient
Gläubigen, ihr Leben zu überprüfen und es neu am Evangelium
auszurichten, um geläutert das Osterfest zu feiern. Das Aschekreuz,
das den Gläubigen auf die Stirn gezeichnet wird, ist das Zeichen
zur Besinnung und des Umkehrwillens. Dem Pontifikalamt ging eine
Pontifikalvesper voraus.
Den Gottesdienst leitete der Bischof mit dem Worten ein: "Mit
dem heutigen Tag beginnen wir die 40 Tage der Umkehr und Buße, wir
bereiten uns auf das Fest der Auferstehung vor und erneuern uns
durch Fasten, Gebet und Werke der Liebe." In der vorösterlichen
Zeit sind in der kirchlichen Tradition neben dem Fasten das Gebet
und das Almosengeben besondere Elemente. Während dieser 40 Tage,
führte Wiesemann aus, sollten sich die Katholiken Gott öffnen, wie
sich eine Pflanze dem Licht zuwendet, und gleichzeitig mit Gott
stärker verwurzeln, um neue Kraft zu schöpfen.
BischofWiesemann.jpg) Der Bischof erläuterte, was im Leben wirklich Wert
besitzt und was es gilt zu erneuern. In seiner Predigt
verdeutlichte Wiesemann das an einer Begebenheit, die ihm auf der
Kundschafterreise im Februar "unter die Haut gegangen ist", wie er
gestand. Die Reise führte auf die Philippinen, ein armes Land, das
immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Besonders hart
traf es das Inselvolk im November 2013. Taifun Yolanda fegte mit
Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometern über
den Pazifik und die Philippinen. Auf dem Inselstaat verursachte der
tropische Wirbelsturm die größten Schäden.
Der Bischof erläuterte, was im Leben wirklich Wert
besitzt und was es gilt zu erneuern. In seiner Predigt
verdeutlichte Wiesemann das an einer Begebenheit, die ihm auf der
Kundschafterreise im Februar "unter die Haut gegangen ist", wie er
gestand. Die Reise führte auf die Philippinen, ein armes Land, das
immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Besonders hart
traf es das Inselvolk im November 2013. Taifun Yolanda fegte mit
Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometern über
den Pazifik und die Philippinen. Auf dem Inselstaat verursachte der
tropische Wirbelsturm die größten Schäden.
Auf die Frage der deutschen Kundschafter, was der Taifun
zerstörte, zählten die Philippiner auf: ihre Fischerboote, ihre
Häuser, die Kirche. "Die Menschen erzählten alles der Reihe nach",
gab Wiesemann wieder und zog das Zwischenfazit: "Es blieb im Grunde
nichts mehr." Auf die Frage, was der Taifun ihnen nicht rauben
konnte, ernteten die Abgesandten zunächst "tiefes Schweigen",
schilderte der Bischof und fuhr fort: "Dann sagte der Erste: Meinen
Glauben hat mir der Taifun nicht zerstört, ich bete noch viel
tiefer."
Andere ergänzten: Würde, Mut, Vertrauen und Hoffnung habe die
Naturkatastrophe Aschekreuz.jpg) ihnen nicht nehmen können. Die Menschen seien lebendig und
sich bewusstgeworden, was der Taifun nicht zerstören konnte, fasste
Wiesemann zusammen und knüpfte an die österliche Bußzeit an: Das
Aschekreuz sei ein Symbol dafür, "dass uns alles genommen werden
kann". Asche zu Asche, Staub zu Staub. Dieser Gedanke sei aber kein
Grund, bedrückt zu sein. Vielmehr gelte es in diesen 40 Tagen das
zu erneuern, was nicht zerstört werden könne, was einem nicht
genommen werden könne. Der Bischof machte den Gläubigen Mut, auf
Gott zu vertrauen. "Die österliche Bußzeit will uns die Herzen
öffnen für das, was von Gott kommt."
ihnen nicht nehmen können. Die Menschen seien lebendig und
sich bewusstgeworden, was der Taifun nicht zerstören konnte, fasste
Wiesemann zusammen und knüpfte an die österliche Bußzeit an: Das
Aschekreuz sei ein Symbol dafür, "dass uns alles genommen werden
kann". Asche zu Asche, Staub zu Staub. Dieser Gedanke sei aber kein
Grund, bedrückt zu sein. Vielmehr gelte es in diesen 40 Tagen das
zu erneuern, was nicht zerstört werden könne, was einem nicht
genommen werden könne. Der Bischof machte den Gläubigen Mut, auf
Gott zu vertrauen. "Die österliche Bußzeit will uns die Herzen
öffnen für das, was von Gott kommt."
Vor der Kommunion zeichneten Bischof Wiesemann, Weihbischof Otto
Georgens sowie Geistliche des Domkapitels den Gottesdienstbesuchern
die Aschekreuze auf die Stirn. Die Fürbitten schlossen ausdrücklich
all jene ein, die einen Neuanfang suchen – insbesondere Menschen,
die aus ihren Heimatländern flüchten mussten. Sie galten unter
anderem auch allen, die ihren Glauben erneuern und vertiefen
wollen.
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahm die
Schola Gregoriana unter Leitung von Domkapellmeister Markus
Melchiori. Sie sang unter anderem gregorianische Gesänge und
deutsche Wechselgesänge.
Text und Fotos: Yvette Wagner
02.03.2017
„der pilger – Magazin für die Reise durchs Leben“
 Ab 2. März im Handel: „der pilger – Magazin für die Reise durchs Leben“ lautet der Titel für das neue Mindstyle-Magazin mit christlichem Fokus.
Ab 2. März im Handel: „der pilger – Magazin für die Reise durchs Leben“ lautet der Titel für das neue Mindstyle-Magazin mit christlichem Fokus.
Ab 2. März im Zeitschriftenhandel erhältlich -
Startauflage 100.000 Exemplare ...
Speyer- „der pilger – Magazin für die Reise
durchs Leben“ ist der Titel einer neuen, vierteljährlich
erscheinenden Zeitschrift. Die Ausgabe 1 ist am 2. März erstmals an
Einzelverkaufsstellen erhältlich. Mit seiner besonderen
Heftkonzeption und prominenten Autoren positioniert sich „der
pilger“ als Mindstyle-Magazin mit christlichem Fokus. „der pilger –
Magazin für die Reise durchs Leben“ ist im gesamten
deutschsprachigen Raum erhältlich und hat einen Umfang von rund 140
Seiten. Die Erstauflage beträgt 100.000 Exemplare.
Wie der Hefttitel anschaulich verdeutlicht, versteht sich „der
pilger“ als Begleiter seiner Leserinnen und Leser. Er greift die
Sehnsucht vieler Menschen nach Stille und Sinnfindung auf.
Dementsprechend lädt jede Ausgabe zu einer persönlichen Auszeit ein
und gibt – im Einklang mit den Jahreszeiten – Impulse für ein
bewusst geführtes Leben, das sich nicht vom Alltagsstress
überrollen lässt.
Die Bereiche Spiritualität und Religion bilden wichtige Themen.
Es werden Pilgerwege und inspirierende Reiseziele vorgestellt,
christliche Feste erklärt, aber auch Impulse gegeben, um die Welt
täglich etwas besser zu machen. Ergänzend dazu werden klassische
Lifestyle-Themen aus den Bereichen Natur und Gesundheit
aufgegriffen und Menschen vorgestellt, die auf besondere Weise
leben oder Außergewöhnliches leisten.
Entwickelt wurde die Zeitschrift von einem erweiterten
Redaktionsteam um Chefredakteur Norbert Rönn. Zum prominenten
Autorenkreis zählen unter anderem der Benediktinerpater Anselm
Grün, die Journalisten Franz Alt und Michael Albus, Beatrix Kruse,
ehemalige Chefredakteurin von Brigitte und Familie&Co sowie der
Bestseller-Autor Manfred Lütz ...
Die erfrischende Kombination aus Unterhaltung, Expertenwissen
und qualitativ hochwertigem Journalismus wird von einer
einfühlsamen Sprache und einem harmonisch-wertigen Layout
unterstrichen. So bietet „der pilger“ Texte, die das Herz berühren
und zum Nachdenken, Zurücklehnen und Durchatmen einladen.
Die Druckauflage für die beiden ersten Ausgaben von „der pilger
- Magazin für die Reise durchs Leben“ liegt bei jeweils 100.000
Exemplaren. Die Startauflage für den „Kioskverkauf“ liegt von
Beginn an bei 80.000
Exemplaren.Die Erstausgabe wird von einer
deutschlandweiten Werbekampagne begleitet, die – ergänzend zu
Anzeigen in Printmedien – mit zielgruppenaffiner Radiowerbung und
Social-Media-Aktivitäten Akzente setzt.
„Der pilger - Magazin für die Reise durchs Leben“ wird bei
Peregrinus GmbH aus Speyer verlegt. In diesem Verlag erscheint
unter anderem auch Deutschlands älteste Bistumszeitung, die
ebenfalls den Titel „der pilger“ trägt.
Das neue Magazin „der pilger“ erscheint vierteljährlich. Auf
rund 140 Seiten präsentiert sich das „Magazin für die Reise durchs
Leben“ mit einer hochwertigen Ausstattung. Der Heftpreis beträgt
4,80 Euro. Das Jahresabo kostet inklusive Zustellung 19,20 Euro.
Zusätzliche Informationen bieten der
Webauftritt (www.der-pilger.de) und die Facebook-Präsenz
(www.facebook.com/pilger.magazin).
Die bundesweite Anzeigenvermarktung leistet die KONPRESS-Medien
eG mit Sitz in Frankfurt/M. Die seit 1970 bestehende Genossenschaft
vermarktet exklusiv das nationale Anzeigen- und Beilagengeschäft
für 39 konfessionelle Wochenzeitungen mit einer Reichweite von rund
3,1 Millionen Lesern. Der Anzeigenschluss für die kommende
Magazinausgabe von „der pilger“ ist der 20. April 2017. Weitere
Informationen sind unter www.konpress.de erhältlich.
Text und Foto: Peregrinus GmbH
01.03.2017
Stets auch für die eigene Seele Sorge tragen
 Treten am 1. März ihren Dienst als Pfarrer an: Die neuernannten Stelleninhaber mit Oberkirchenrätin Marianne Wagner (5.von rechts)
Treten am 1. März ihren Dienst als Pfarrer an: Die neuernannten Stelleninhaber mit Oberkirchenrätin Marianne Wagner (5.von rechts)
Oberkirchenrätin Wagner überreicht neuen Pfarrerinnen
und Pfarrern die Ernennungsurkunden
Speyer- Elf Theologinnen und Theologen
treten ab 1. März ihren Dienst als neue Pfarrerinnen und Pfarrer
der Evangelischen Kirche der Pfalz an. Bei der Urkundenverleihung
im Landeskirchenrat am Freitag hat Oberkirchenrätin Marianne Wagner
den frischgebackenen Seelsorgern mit auf den Weg gegeben, ihren
Dienst mit Zuversicht und Gottvertrauen anzutreten und auf die
Menschen in den Kirchengemeinden mutig zuzugehen. Seelsorge brauche
aber auch die nötige „innere Stärke“, sagte Wagner.
„Versuchen Sie stets auch an die eigene Seele zu denken“,
empfahl die Oberkirchenrätin den neuen Pfarrerinnen und Pfarrern.
Nur wer auch für sich selber Sorge trage, sei den Herausforderungen
und Anfechtungen gewachsen. Die Aufgabe der Pfarrer bestehe darin,
die biblisch-christliche Tradition immer wieder neu zu
vergegenwärtigen. Das Gebet und die Auseinandersetzung mit der
Tageslosung gäben Kraft und Orientierung für die täglichen
Herausforderungen, die der Pfarrberuf stelle, sagte Wagner: „Lassen
Sie sich nicht von der Fülle der bevorstehenden Aufgaben
überwältigen.“
Die neuen Pfarrerinnen und Pfarrer übernehmen folgende
Gemeinden:
Johanna Baum (29) wird Pfarrerin in der Kirchengemeinde Kandel 2
im Kirchenbezirk Germersheim; Robin Braun (31) geht als Pfarrer
nach Herschweiler-Pettersheim im Kirchenbezirk Kusel; Julia Caster
(31) betreut als Pfarrerin die Gemeinde Schwarzenbach im
Kirchenbezirk Homburg; Florentine Grünewald (31) übernimmt das
Stadtjugendpfarramt Ludwigshafen; Holger Müller (29) betreut
künftig Barbelroth-Kapellen-Drusweiler im Kirchenbezirk Bad
Bergzabern; Heike Rauber (33) geht nach Frankenthal-Pilgerpfad 2;
Daniel Seel (46) tritt die Pfarrstelle in Hornbach im Kirchenbezirk
Zweibrücken an; Kira Seel (29) geht nach Wolfstein im Kirchenbezirk
An Alsenz und Lauter.
Pfarrstellen zur Dienstleistung treten an:
Sandra Liermann (28) wird zur Dienstleistung im Kirchenbezirk
Donnersberg eingesetzt, Elisa-Marie Stopp (27) kommt zur
Dienstleistung nach Ludwigshafen und Stefanie Schlenczek (28) zum
Missionarisch-Ökumenischen Dienst (MÖD) in Landau.
In der Evangelischen Kirche der Pfalz sind nach Auskunft von
Oberkirchenrätin Wagner zurzeit 565 Pfarrerinnen und Pfarrer im
Dienst (Stand 1. Januar 2017). Auf der Liste der
Theologiestudierenden befänden sich 59 junge Leute, aktuell seien
18 Vikare in der Ausbildung. Text und Foto: lk
24.02.2017
Bischof aus Ruanda zu Besuch in Speyer
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (links) begrüßte Bischof Jean Damascène Bimenyimana, der von Dorothea Fuchs, der Vorsitzenden des Pfarreirates der Pfarrei Hl. Martin, Kaiserslautern und Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins der Gemeinde St. Martin, begleitet wurde.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (links) begrüßte Bischof Jean Damascène Bimenyimana, der von Dorothea Fuchs, der Vorsitzenden des Pfarreirates der Pfarrei Hl. Martin, Kaiserslautern und Vorsitzenden des Partnerschaftsvereins der Gemeinde St. Martin, begleitet wurde.
Treffen mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im
Bischofshaus
Speyer - Bischof Jean Damascène
Bimenyimana aus der Diözese Cyangugu in Ruanda hat heute seinen
Speyerer Amtsbruder Dr. Karl-Heinz Wiesemann besucht. In dem
Gespräch im Bischofshaus ging es um einen Austausch über die Pflege
der Partnerschaft, die seit 1982 zwischen den Diözesen Cyangugu und
Speyer besteht.
Die Diözese Cyangugu liegt im Südwesten des ostafrikanischen
Staates im Grenzgebiet zum Kongo. Verbände und Pfarreien beider
Bistümer pflegen seit vielen Jahren Kontakte. Zwei junge Erwachsene
aus der Pfalz leisten jährlich einen freiwilligen Sozialdienst in
einer Tagesförderstätte für Kinder und Jugendliche mit Behinderung
in Nkanka im Bistum Cyangugu. Träger dieses Freiwilligendienstes
ist der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ),
Diözesanverband Speyer.
In den vergangenen Tagen war Bischof Bimenyimana im Rahmen
seines einwöchigen Besuches in der Pfalz in der Pfarrei Heiliger
Martin in Kaiserslautern zu Gast, wo er in der Kirche St. Martin
einen Gottesdienst feierte. Die pfälzische Gemeinde unterhält
bereits seit 1983 partnerschaftliche Beziehungen zu den Pfarreien
Shangi und Muyange in Ruanda. In der Katholischen Hochschulgemeinde
Kaiserslautern traf Bischof Bimenyimana mit ruandischen Studenten
zusammen. Er besuchte Vertreter des Kolpingwerkes und sprach mit
den jungen deutschen Freiwilligen, die sich in Ruanda engagieren
werden. Am morgigen Freitag wird Bischof Bimenyimana die Heimreise
antreten.
Weitere Informationen zur Diözese Cyangugu: http://www.diocesecyangugu.com/en/
23.02.2017
„Mit Leib und Seele Bischof von Speyer gewesen“
 Bischöfe aus
Speyer und Würzburg, Allgemeiner Geistlicher Rat, Domkapitel und
zahlreiche Weggefährten feierten den 85. Geburtstag von Bischof em.
Dr. Anton Schlembach
Bischöfe aus
Speyer und Würzburg, Allgemeiner Geistlicher Rat, Domkapitel und
zahlreiche Weggefährten feierten den 85. Geburtstag von Bischof em.
Dr. Anton Schlembach
Speyer- Mit einem Dankgottesdienst im
Caritas-Altenzentrum St. Martha in Speyer feierte Bischof em. Dr.
Anton Schlembach am Dienstag seinen 85. Geburtstag. Mit ihm standen
sein Nachfolger, der amtierende Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann, der Bischof seines Heimatbistums Würzburg Dr. Friedhelm
Hofmann, Monsignore Otto Kern und Diakon Klaus Hilzensauer am
Altar. Am Gottesdienst und der anschließenden Feier nahmen die
aktiven und emeritierten Mitglieder des Allgemeinen Geistlichen
Rats und des Domkapitels sowie mehrere enge Weggefährten von
Bischof Schlembach sowie seine beiden Schwestern teil.
„An einem Geburtstag wird einem besonders deutlich bewusst, was
man im Grund immer weiß und voraussetzt: Letztlich verdanke ich
mich Gott, der die Fülle des Seins ist und mich mit meinem Dasein
beschenkt“, hob Bischof Schlembach in seiner Begrüßung hervor. Wer
sein Leben und Dasein Gott verdankt wisse, der wisse auch, „dass er
nur dann recht lebt, wenn er Gott gegenüber ein dankbarer Mensch
ist, jeden Tag neu“, so Schlembach. Das Dasein als Gabe weise auf
die eigentliche Weihnachtsgabe hin, die Gott der Welt geschenkt
hat: Jesus, den menschgewordenen Gottessohn. „Er lässt uns unser
Dasein umfassend und vorbehaltlos akzeptieren und dankbar
annehmen.“ Wenn der Mensch Jesus Christus gläubig in sein Herz und
sein Leben annehme, werde ihm in der Gottesliebe und in der
Nächstenliebe die Sinnorientierung seines Lebens geschenkt. In der
Verheißung der Auferstehung werde ihm „im Leben und im Sterben
unzerstörbare Hoffnung auf ewige, glückselige Vollendung
gegeben.“
Bischof Wiesemann: „Zeuge des lebendigen Gottes“
 Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann übermittelte dem Jubilar die Glück- und
Segenswünsche des gesamten Bistums und dankte ihm für sein
segensreiches Wirken. „Mit großer Treue hast Du Deinen Dienst
versehen und in uns die Hoffnung gestärkt, dass es für einen
Christen im letzten keinen Grund gibt zu verzagen“, sagte er im
Blick auf die fast 24 Jahre Schlembachs im Amt des Speyerer
Bischofs. „Mit Deinem ganzen Leben bist Du für uns ein Zeuge des
lebendigen Gottes geworden“, so Wiesemann und dankte ihm auch
persönlich: „Du hast es mir einfach gemacht, Dein Nachfolger zu
sein. Von Anfang an bist Du mir mit großer Herzlichkeit begegnet
und warst mit immer ein guter Ratgeber.“
Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann übermittelte dem Jubilar die Glück- und
Segenswünsche des gesamten Bistums und dankte ihm für sein
segensreiches Wirken. „Mit großer Treue hast Du Deinen Dienst
versehen und in uns die Hoffnung gestärkt, dass es für einen
Christen im letzten keinen Grund gibt zu verzagen“, sagte er im
Blick auf die fast 24 Jahre Schlembachs im Amt des Speyerer
Bischofs. „Mit Deinem ganzen Leben bist Du für uns ein Zeuge des
lebendigen Gottes geworden“, so Wiesemann und dankte ihm auch
persönlich: „Du hast es mir einfach gemacht, Dein Nachfolger zu
sein. Von Anfang an bist Du mir mit großer Herzlichkeit begegnet
und warst mit immer ein guter Ratgeber.“
Diakon Klaus Hilzensauer dankte Bischof Schlembach für seine
Mitwirkung in der Seelsorge für das Caritas-Altenzentrums St.
Martha: „Die Bewohnerinnen und Bewohner sind froh, dass Sie
gemeinsam mit ihnen zu Tisch sitzen und mit ihnen leben.“
Heimleiterin Gudrun Wolter sagte Dank für die „Gemeinschaft, die
Sie in diesem Haus täglich mit uns leben“.
„Ich bin mit Leib und Seele Bischof von Speyer
gewesen“
Dass Dr. Friedhelm Hofmann als Bischof seines Heimatsbistums
Würzburg an dem Gottesdienst teilnehmen würde, hatte Bischof
Schlembach erst morgens erfahren: „Es ist mir eine große Freude,
dass Du gekommen bist“, wandte er sich an Bischof Hofmann. „Im
Bistum Würzburg hast Du als Priester, Lehrer, Regens und
Generalvikar bleibende Spuren hinterlassen. Viele erinnern sich an
Deine große Herzlichkeit, Sensibilität und Ausgewogenheit“, brachte
Bischof Hofmann die anhaltende Verbundenheit des Bistums Würzburg
mit Bischof Schlembach zum Ausdruck. „Würzburg ist mein
Heimatbistum und wird es immer bleiben. Doch auch das Bistum Speyer
ist mir ans Herz gewachsen. Ich war mit Leib und Seele Bischof von
Speyer und bin mit beiden Füßen in das Erdreich dieses Bistums
hineingewachsen“, bekannte Bischof Schlembach.
Als Geschenk des Bistums überreichte Bischof Wiesemann dem
Jubilar eine dreibändige Dokumentation ausgewählter Bischofsworte
aus den Jahren 1983 bis 2007. Unter der Überschrift „Im Dienst der
Verkündigung des Evangeliums“ bieten die vom Bistumsarchiv
zusammengestellten Texte einen Querschnitt der Themen, die in
Bischof Schlembachs Pontifikat bedeutsam waren. Die Dokumentation
ist im Internet online einsehbar.
Weitere Informationen zu Bischof em. Dr. Anton
Schlembach:
www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/leitung/bischof-em/
Lebensdaten und Initiativen:
www.bistum-speyer.de/2/bistum-speyer/leitung/bischof-em/lebensdaten/
Online-Präsentation ausgewählter Bischofsworte von Bischof
Schlembach:
www.bistumsarchiv-speyer.de
(Menü „Publikationen“)
oder direkt unter
http://www.bistum-speyer.de/2/erziehung-schule-bildung/bistumsarchiv/publikationen/
Text und Foto: is
08.02.2017
„Ein besonderer Freund der Menschen in Togo“
 Dr. Samuel Husunu vom Verein der Togofreunde Jockgrim überreichte die Auszeichnung an Weihbischof Georgens. Links Siegbert Kemmer, rechts Petra Fahrnbach vom Referat Weltkirche.
Dr. Samuel Husunu vom Verein der Togofreunde Jockgrim überreichte die Auszeichnung an Weihbischof Georgens. Links Siegbert Kemmer, rechts Petra Fahrnbach vom Referat Weltkirche.
Weihbischof Otto Georgens wurde zum Ehrenmitglied des Vereins
der Togofreunde ernannt
Speyer- Weihbischof Otto Georgens, in der
Diözese Speyer für den Bereich Weltkirche verantwortlich, wurde
jetzt zum Ehrenmitglied im „Verein der Togofreunde Jockgrim“
ernannt. Damit würdige man die jahrzehntelange Unterstützung, die
der Verein für seine Arbeit in Togo durch den Speyerer Weihbischof
und das Bistum erfahre, so Siegbert Kemmer und Dr. Samuel Husunu
vom Vorstand des Vereins der Togofreunde bei der Überreichung der
Auszeichnung in Speyer.
Sie verwiesen unter anderem auf das Ausbildungszentrum in
Gbalavé, in dem zur Zeit 90 Lehrlinge eine Ausbildung in
verschiedenen Berufen erhalten. Weihbischof Georgens setze die
Arbeit seines Vorgängers Domkapitular i.R. Gerhard Fischer fort,
der viele Jahre als Leiter des Referats Weltkirche ebenfalls stark
engagiert war für die Menschen in Togo, so Husunu.
In Togo konnte Weihbischof Georgens sich selbst bei Besuchen von
der Qualität der Ausbildung in Gbalavé und deren Notwendigkeit
überzeugen.
Dass der Verein auch die Projekte der ehemals in Togo wirkenden
Priester aus der Diözese Speyer – Anton Klug, Josef Kling und
Günter Lendle – unterstützt und fortführt, sei ein weiterer Grund,
dem Verein Hilfe zukommen zu lassen, so Georgens, der erst im
Oktober des vergangenen Jahres das westafrikanische Lnd besucht
hatte. „Ich bin ein Freund der Menschen in Togo“, unterstrich
Weihbischof Georgens bei der Überreischung der Auszeichnung. Und
Samuel Husunu, der selbst aus Togo stammt, sagte an den Weihbischof
gerichtet: „Sie sind ein besonderer Togofreund, denn Ihr Interesse
und Ihre Unterstützung geben uns Mut und Ansporn, weiter zu
arbeiten zum Wohl der Menschen in dem Land.“
Hinweis:
Kontakt: www.togofreunde-jockgrim.de,
E-Mail: info@togofreunde-jockgrim.de
Der Verein der Togofreunde Jockgrim unterstützt unter anderem
Schul- und Ausbildungsprojekte, Sozialstationen,
landwirtschaftliche Projekte und Leprakranke.
Text und Bild: Norbert Rönn / Pilger
06.02.2017
Gemeinsames Bekenntnis zur Verantwortung aller Christen

Rom-Reise: Kirchenpräsident bei Waldenser Kirche und
Evangelisch-Lutherischer Kirche
Speyer/Rom- Nach Überzeugung des
pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad kommt den Kirchen in
Europa eine zentrale Rolle bei der Einigung der „in Nationalismen
und Isolationismen fliehenden Staaten“ zu. Bei einem Empfang der
Chiesa Evangelica Valdese (Evangelische Waldenser Kirche) am 5.
Februar in Rom hob Schad die heute noch „in Europa und der ganzen
Welt spürbaren Impulse der vielen reformatorischen Kirchen und
Bewegungen“ hervor.
Christen unterschiedlicher Prägung könnten Vorbild im Umgang mit
Differenzen sein, „wenn sie sich mit offenen Augen, Ohren und
Herzen“ begegneten, sagte Kirchenpräsident Schad anlässlich einer
Delegations-Reise der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) vom
4. bis 7. Februar nach Rom. Papst Franziskus hatte die Teilnehmer
im Rahmen des 500. Reformationsjubiläums zu einer Privataudienz
eingeladen. Kirchenpräsident Schad ist evangelischer Vorsitzender
des Kontaktgesprächskreises zwischen der EKD und der deutschen
Bischofskonferenz.
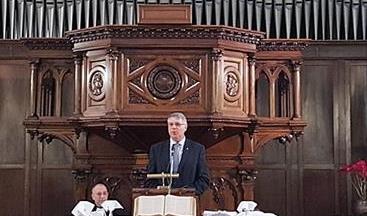 Die
Waldenser seien schon lange vor der Reformation „evangelisch“
gewesen, unterstrich Schad in seinem Grußwort bei dem Empfang der
Chiesa Evangelica Valdese. Dazu gehörten Merkmale wie die Stärkung
der Ehrenamtlichen, das Predigtamt für Frauen, das
Abendmahlsverständnis und die Abkehr von Ablasshandel und
Heiligenverehrung. Mit etwa 100 Gemeinden und fast 30.000
Gemeindemitgliedern seien die Waldenser gut vernetzt und
eingebunden in die weltweite Christenheit. Unter anderem gehören
sie dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖKR), dem Reformierten
Weltbund (RWB) und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE) an.
Die
Waldenser seien schon lange vor der Reformation „evangelisch“
gewesen, unterstrich Schad in seinem Grußwort bei dem Empfang der
Chiesa Evangelica Valdese. Dazu gehörten Merkmale wie die Stärkung
der Ehrenamtlichen, das Predigtamt für Frauen, das
Abendmahlsverständnis und die Abkehr von Ablasshandel und
Heiligenverehrung. Mit etwa 100 Gemeinden und fast 30.000
Gemeindemitgliedern seien die Waldenser gut vernetzt und
eingebunden in die weltweite Christenheit. Unter anderem gehören
sie dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖKR), dem Reformierten
Weltbund (RWB) und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE) an.
Es sei die gemeinsame, ökumenische Aufgabe, das Evangelium in
Wort und Tat klar zu bezeugen, sagte Kirchenpräsident
Schad in seiner Predigt im Abendmahlsgottesdienst in der
Christuskirche der Evangelisch-Lutherischen Gemeinde in Rom am 6.
Februar. Dazu gehöre auch, „Vorurteile und falsche Bilder von der
jeweils anderen Konfession abzubauen und im Rückgang auf das
Zeugnis der Heiligen Schrift für wechselseitige Verständigung zu
werben“. Ziel sei dabei „die versöhnte Gemeinschaft der
Verschiedenen, die zutiefst eins sind in Christus“. Viele Menschen
in Europa, so der Kirchenpräsident, blickten mit Sorge auf
Tendenzen nationaler Abschottung. Vor diesem Hintergrund sei die
Ökumene der Kirchen ein gemeinsames Bekenntnis zur Verantwortung
aller Christen – gerade für die Bedrängten und Bedrohten.
Mehr zum Thema: www.chiesavaldese.org; www.leuenberg.net/de; www.ev-luth-gemeinde-rom.org.
Text und Foto: lk
06.02.2017
Bischof emeritus Dr. Anton Schlembach vollendet sein 85. Lebensjahr
 Am 7.
Februar 1932 wurde er in Großwenkheim in Unterfranken geboren –
Sein bischöflicher Wahlspruch lautet: „Deus salus – Gott ist das
Heil“
Am 7.
Februar 1932 wurde er in Großwenkheim in Unterfranken geboren –
Sein bischöflicher Wahlspruch lautet: „Deus salus – Gott ist das
Heil“
Speyer- Am 7. Februar vollendet Bischof
em. Dr. Anton Schlembach sein 85. Lebensjahr. Sein Lebensweg begann
im Bistum Würzburg, in Großwenkheim, einem Dorf bei Münnerstadt, wo
er am 7. Februar 1932 als ältestes von vier Kindern einer
Landwirtsfamilie geboren wurde. Nach dem Studium in Würzburg und an
der päpstlichen Universität Gregoriana empfing er am 10. Oktober
1956 in Rom die Priesterweihe, drei Jahre später promovierte er zum
Doktor der Theologie. In seiner Heimatdiözese wurde er im Anschluss
an die Kaplansjahre mit einer Reihe verantwortungsvoller Aufgaben
betraut: Jeweils drei Jahre war er Direktor des Studienseminars in
Aschaffenburg und Regens des Priesterseminars in Würzburg. Fast
zwölf Jahre erteilte er hauptamtlich Religionsunterricht am
Gymnasium in Hammelburg, ehe er am 1. Juni 1981 zum Domkapitular
und schon einen Monat später zum Generalvikar des Bistums Würzburg
ernannt wurde.
Es war für die Katholiken des Bistums Speyer eine echte
Überraschung, als am 25. August 1983 der damals 51-jährige Dr.
Anton Schlembach von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Speyer
ernannt wurde. Am 16. Oktober 1983 weihte ihn sein Vorgänger
Erzbischof Friedrich Wetter im Dom zu Speyer zum Bischof. Über 23
Jahre wirkte er in diesem Amt. Nur einer seiner Vorgänger hat in
den letzten 100 Jahren das Bistum länger geleitet, Ludwig
Sebastian, der 1943 nach 26 Bischofsjahren 80-jährig starb.
Die Bemühungen um eine Neuevangelisierung und eine Aktivierung
der Gemeinden waren immer wiederkehrende Grundthemen seiner
Amtszeit. Diesem Anliegen diente auch die Erarbeitung eines
Pastoralplanes, der 1993 in Kraft gesetzt wurde. Eine herausragende
Initiative zur Glaubenserneuerung waren die drei Vorbereitungsjahre
auf das Christus-Jubiläum 2000. Zum ökumenischen "ChristFest" an
Pfingsten 2000 versammelten sich rund 15 000 Christen aus zwölf
Kirchen und Gemeinschaften in Speyer.
Das Christentum am Beispiel moderner Glaubensvorbilder
greifbar gemacht
Große Bedeutung im Hinblick auf eine kirchliche Erneuerung maß
Schlembach auch modernen Glaubensvorbildern bei. So versuchte er
von Beginn seiner Amtszeit an mit starkem persönlichem Engagement,
Botschaft und Lebenszeugnis der heiligen Edith Stein, die neun
Jahre in Speyer wirkte, im Bistum lebendig zu halten. Ihre
Seligsprechung 1987 war ihm Anlass, den Papst nach Speyer
einzuladen. Ihr 100. Geburtstag 1991 und ihre Heiligsprechung 1998
wurden im Bistum jeweils mit einer dreitägigen Feier begangen.
Überdies gab Schlembach den Anstoß zur Gründung einer deutschen
Edith-Stein-Gesellschaft, die ihren Sitz in Speyer hat.
In enger Verbindung steht der Name Schlembachs mit Paul Josef
Nardini, der als erster Pfälzer am 22. Oktober 2006 im Speyerer Dom
selig gesprochen wurde. Dass es zu diesem für das Bistum bislang
einmaligen Ereignis kommen konnte, ist ganz wesentlich ihm zu
verdanken. Der Bischof war auf Nardini erstmals 1987 aufmerksam
geworden. Sofort war er von Leben und Wirken des Pfarrers, der
Mitte des 19. Jahrhunderts in Pirmasens gegen die soziale Not
gekämpft hatte, betroffen und fasziniert. Da auch die
"Mallersdorfer Schwestern", Nardinis Ordensgemeinschaft, diesen
Wunsch teilten, konnte er schon drei Jahre später auf Bistumsebene
das formelle Seligsprechungsverfahren eröffnen.
Schlembach bezog für den Schutz des Lebens entschieden
Position
Denselben Stellenwert wie der Verkündigung und dem Gottesdienst
räumt Bischof em. Schlembach dem sozialen Auftrag der Kirche ein.
"Ohne Caritas ist die Kirche unglaubwürdig", so seine Überzeugung.
Fast 20 caritative Einrichtungen, von Altenheimen über
Behindertenwerkstätten bis hin zum Übernachtungsheim für
Nichtsesshafte, hat er in seiner Amtszeit eingeweiht. Ebenso war er
einer der maßgeblichen Impulsgeber für die ökumenische Hospizhilfe,
die 1991 im Bereich von Bistum und Landeskirche gegründet
wurde.
Gerade wenn es um das menschliche Leben geht, um seinen Schutz
und seine Würde, sieht Schlembach die Christen besonders in Pflicht
genommen. So hat er selbst im Streit um die Abtreibungsgesetzgebung
immer wieder in der Öffentlichkeit eine Verbesserung des
rechtlichen Schutzes für die ungeborenen Kinder gefordert. Nicht
weniger deutlich bezog er Stellung gegen die Einführung der aktiven
Sterbehilfe in einigen europäischen Nachbarländern und die Tötung
embryonaler Menschen im Interesse der Forschung. Die "Klarheit des
kirchlichen Zeugnisses für die Unantastbarkeit jedes menschlichen
Lebens" war auch der entscheidende Grund dafür, dass er im Jahr
2000 als einer der ersten deutschen Bischöfe in den
Schwangerenberatungsstellen der Diözese keine Beratungsscheine mehr
ausstellen ließ, die eine straffreie Abtreibung ermöglichen. Umso
stärker war sein Bemühen, das Beratungsangebot für Schwangere in
Not- und Konfliktsituationen aufrecht zu erhalten und die Hilfe der
Kirche noch auszuweiten. Ein wichtiger Schritt dabei war die
Gründung einer "Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind", die
Politik und Öffentlichkeit für den Lebensschutz sensibilisiert und
Projekte des Caritasverbandes für Mütter in Not finanziert.
Gastgeber für Besuch des Papstes 1987 - ein
„Jahrtausendereignis“ für das Bistum
Am 4. Mai 1987 kam Papst Johannes Paul II. während seines
zweiten Deutschlandbesuches nach Speyer und feierte auf dem
Domplatz mit 60 000 Teilnehmern eine heilige Messe - für die Stadt
und das Bistum ein "Jahrtausendereignis". Auch viele internationale
Staatsgäste empfing Bischof Schlembach im Speyerer Dom. Manchem
Regierungschef, den Bundeskanzler Kohl während seiner Amtszeit in
seinen Heimatdom brachte, hat Bischof Schlembach persönlich die
europäische Bedeutung des Bauwerks erläutert: Michail Gorbatschow
und Boris Jelzin ebenso wie George Bush, Vaclav Havel oder König
Juan Carlos von Spanien. In seiner Kathedrale sieht er aber nicht
nur das einmalige Zeugnis europäischer Baukunst und Geschichte.
Entstanden noch vor den großen Glaubensspaltungen, ist der salische
Kaiserdom für ihn ebenso ein Mahnmal zur Einheit der Kirchen. So
führte Schlembach auch von Anfang an die guten ökumenischen
Beziehungen im Bistum konstruktiv weiter.
Wie die meisten Bischöfe nahm auch der Speyerer Bischof Aufgaben
außerhalb seines Bistums wahr, anfangs in der Publizistischen
Kommission und der Ökumene-Kommission der Deutschen
Bischofskonferenz, später in der "Kommission Weltkirche", deren
Unterkommission für Missionsfragen er leitete, und in der
"Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen", deren
stellvertretender Vorsitzender er zehn Jahre lang war. Von1991 bis
2006 war er Großprior der Deutschen Statthalterei des Ritterordens
vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Fünf Jahre war er Mitglied im
Päpstlichen Rat für den Dialog mit den Nichtglaubenden; als Leiter
des Dialog-Sekretariates für die Bundesrepublik und die
deutschsprachige Schweiz richtete er wissenschaftliche Symposien in
Speyer, Zagreb und Prag aus. Vier Mal organisierte er als
Delegierter der Deutschen Bischofskonferenz das deutschsprachige
Programm der Eucharistischen Weltkongresse: 1989 in Seoul, 1993 in
Sevilla, 1997 in Breslau und 2000 in Rom.
Verabschiedung aus dem Amt des Bischofs im Februar
2007
Im Februar 2007 wurde Schlembach mit einem feierlichen
Gottesdienst im Speyerer Dom aus seinem Amt als 95. Bischof von
Speyer verabschiedet. Wenn er auf seine Amtszeit zurückblickt,
klammert er besorgniserregende und schmerzliche Entwicklungen nicht
aus. So konstatiert er durchaus den zahlenmäßigen Rückgang an
Gläubigen und Gottesdienstbesuchern, den Priestermangel oder den in
seinen Augen viel zu schwachen Einsatz der Christen für eine
"Kultur des Lebens von der natürlichen Empfängnis bis zum
natürlichen Sterben". Aber all dies ist für ihn kein Grund zur
Resignation oder gar zum Pessimismus. Im Gegenteil, er sieht auch
im kirchlichen Leben hierzulande viele Hoffnungszeichen und neue
Aufbrüche. "Vieles spricht dafür, dass sich Atheismus, Säkularismus
und Postmoderne totlaufen", schrieb er in seinem letzten
Bischofswort zur österlichen Bußzeit. Diese Entwicklung sei für
Christen eine Ermutigung, täglich neu und noch entschiedener ihren
Gottesglauben zu leben und zu bezeugen.
Am 10. Oktober 2016 beging Bischof em. Dr. Anton Schlembach sein
diamantenes Priesterjubiläum. Aus gesundheitlichen Gründen war eine
Feier jedoch nicht möglich. Das Bistum Speyer hat seinen
emeritierten Bischof aus diesem Anlass durch die Veröffentlichung
einer Online-Präsentation von ausgewählten Bischofsworten aus den
Jahren 1983 bis 2007 gewürdigt. Unter der Überschrift „Im Dienst
der Verkündigung des Evangeliums“ bieten die vom Bistumsarchiv
zusammengestellten Texte einen Querschnitt der Themen, die in
seinem Pontifikat bedeutsam waren. Auch seinen 85. Geburtstag
begeht Bischof em. Schlembach aus gesundheitlichen Gründen im
engsten Kreis.
Weitere Informationen zu Bischof em. Dr. Anton
Schlembach:
www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/leitung/bischof-em/
Lebensdaten und Initiativen:
www.bistum-speyer.de/2/bistum-speyer/leitung/bischof-em/lebensdaten/
Online-Präsentation der Bischofsworte anlässlich des
60-jährigen Priesterjubiläums:
www.bistumsarchiv-speyer.de
(Menü „Publikationen“)
oder direkt unter
http://www.bistum-speyer.de/2/erziehung-schule-bildung/bistumsarchiv/publikationen/
Text und Foto: is
04.02.2017
Bistum Speyer schickt Kundschafter auf die Philippinen
 Teilnehmer der Kundschaftergruppe um Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann beim Vortreffen mit einem der Gastgeber auf den Philippinen, Joseph Guevarra vom Pastoralinstitut Bukal ng tipan
Teilnehmer der Kundschaftergruppe um Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann beim Vortreffen mit einem der Gastgeber auf den Philippinen, Joseph Guevarra vom Pastoralinstitut Bukal ng tipan
Reisegruppe mit Bischof Wiesemann startet am 8.
Februar
Speyer- Die zweite pastorale
Kundschafterreise des Bistums Speyer unter dem Motto „Lernen von
der Weltkirche“ geht nach Asien. Vierzehn Frauen und Männer aus der
Diözese werden am 8. Februar für zwei Wochen auf die Philippinen
reisen. An der Spitze der Gruppe steht Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann, der zusammen mit Pastoralreferent Dr. Andreas Braun von
der diözesanen Arbeitsgruppe „Lokale Kirchenentwicklung“ die Reise
leiten wird. Weitere Teilnehmer sind fünf hauptamtliche
Seelsorgerinnen und Seelsorger (Priester, Pastoral- und
Gemeindereferenten) sowie sieben ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus unterschiedlichen Pfarreien und der katholischen
Hochschulgemeinde. Gemeinsam wollen sich die sechs Frauen und acht
Männer von der pastoralen und spirituellen Praxis der
philippinischen Ortskirche inspirieren lassen. Sie erhoffen sich
dadurch Anregungen für die eigene Arbeit vor Ort und im Bistum
insgesamt.
Kooperationspartner auf den Philippinen ist das Pastoralinstitut
„Bukal ng Tipan“ (Quelle des Bundes), das nicht nur mit den
dortigen Diözesen, sondern auch mit Teams aus Deutschland
zusammenarbeitet. Mit dem Bischöflichen Hilfswerk missio ist es
darüber hinaus auch weltweit vernetzt. Erst im Oktober war einer
der Mitarbeiter des Instituts, Joseph Guevarra, im Rahmen des
Weltmissionssonntags zu Gast im Bistum Speyer. Die
Kundschaftergruppe hatte so die Möglichkeit, bei einem Vortreffen
in Kaiserslautern einen ersten persönlichen Kontakt zu knüpfen. Die
Begegnung mit Guevarra, die Ausführungen über seine Kirche und die
Arbeit des Pastoralinstituts sowie der anschließende gemeinsame
Gottesdienst in der Wallfahrtskirche Maria Schutz Kaiserslautern:
all das hat Lust auf Mehr gemacht und den Pioniergeist und das
Interesse der Kundschafter geweckt.
Nun steht ein Wiedersehen an – und damit verbunden das
persönliche Entdecken und Erleben einer Ortskirche am anderen Ende
der Welt. Das Team um Guevarra sowie Mitarbeiter der Erzdiözese
Jaro werden die Speyerer Erkundungen ihrer philippinischen Kirche
sowohl theoretisch als auch praktisch begleiten. Dabei werden, auch
wenn es auf den ersten Blick gar nicht so scheinen mag, einige
Anknüpfungspunkte zwischen der Kirche des Inselstaates im
westlichen Pazifischen Ozean und der im Bistum Speyer zutage
treten. Beide kennen eine durchaus ähnliche volkskirchliche
Prägung, beide ringen um die kirchliche Beheimatung auch der
jüngeren Generationen, und beide kämpfen um Gehör und Einfluss
hinsichtlich gesellschaftlicher Herausforderungen im jeweiligen
Heimatland. Die Verschiedenheiten aber, die da sind, versprechen
darüber hinaus besondere Lernimpulse für die Kundschafterinnen und
Kundschafter aus Deutschland.
82 Prozent der gut hundert Millionen Philippinos sind
katholisch, doch es gibt traditionell wenige Priester und eine noch
geringere Anzahl an anderen hauptberuflichen pastoralen Diensten.
Daher sind Pfarreien mit 30.000, 50.000 oder auch 70.000 Katholiken
seit jeher auf den Philippinen üblich. Größere pastorale Einheiten
– wie sie im Bistum Speyer durch die Neugliederung in 70 Pfarreien
entstanden sind – gehören auf den Philippinen zur Alltagserfahrung.
Gleichzeitig zeigt sich eine große Lebendigkeit von Kirche, die
sich durch Partizipation, Dezentralität und lebendiges
Glaubensleben vor Ort auszeichnet.
Am Beginn des Kundschaftens auf den Philippinen stehen
gemeinsame Kurzexerzitien der Gruppe – ein Ausdruck dafür, dass
dieser Wahrnehmungs- und Lernprozess ein zutiefst geistlicher ist.
Dieser spirituelle Einstieg findet im Bukal-Seminarhaus „Maryshore“
auf der Insel Negros in den Visayas statt, den „mittleren Inseln“
der Philippinen. Im gleichen Haus schließt sich eine viertägige
Seminarphase an, in der die pastoralen Grundlagen, Konzeptionen und
Ausrichtungen der Kirche auf den Philippinen sowie die Arbeit des
Pastoralinstituts „Bukal ng Tipan“ vorgestellt werden. Bei einem
anschließenden gut viertägigen „Exposure“ im Erzbistum Jaro auf der
Nachbarinsel Panay wird die Gruppe hautnah in das vielfältige Leben
der Kirche auf den Philippinen eintauchen. Es basiert sehr
ausgeprägt auf dem Bild des Zweiten Vatikanischen Konzils von der
Kirche als dem Volk Gottes auf dem Weg. Nach kurzer Verschnaufpause
und Reflexion des Erlebten noch in den Visayas geht es zum
Abschluss in das Bukal-Zentrum „Maryhill“. Dort wird sich die
Gruppe noch einen Eindruck von der philippinischen Hauptstadt und
Metropole Manila verschaffen, bevor sie ihre Heimreise zurück nach
Deutschland antritt.
Das Bistum Speyer unternimmt im Jahr 2017 noch zwei weitere
Kundschafterreisen. Sie führen nach England und Südafrika. Die
erste Kundschafterreise nach Nicaragua fand Ende 2016 statt.
Die Kundschaftergruppe wird über ihre Erlebnisse, Erfahrungen
und Reflexionen auf den Philippinen in einem täglichen Reiseblog
berichten. Er kann über die Internetseite des Bistums Speyers von
jedem Interessierten eingesehen, mitgelesen und kommentiert
werden.
Weitere Informationen zu den Kundschafterreisen des Bistums
Speyer: http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/kundschafterreisen/
Link zum Blog der Kundschafterreise auf die Philippinen:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/kundschafterreisen/reiseblog-philippinen/
Es besteht die Möglichkeit, dass Interessierte per E-Mail
automatisch über neue Blog-Einträge informiert werden. Text:
is; Foto: Privat
30.01.2017
Barmherzigkeit – im Kontext von Judentum – Christentum – Islam
Trialogveranstaltung im Rahmen von „Erinnern – Gedenken –
Mahnen 2017“
Speyer- Am Mittwoch, 1. Februar, um 19.30
Uhr geht es im Gemeindesaal der Jüdischen Kultusgemeinde der
Rheinpfalz in Speyer (Am Weidenberg 3) um das Thema:
„Barmherzigkeit – Kultur der Liebe“ im Kontext der drei
abrahamitischen Religionen.
Alle drei Religionen bekennen sich zum Einen Gott, dem als
wesentlichste Eigenschaft Barmherzigkeit zugeschrieben wird.
Welche Aussagen finden sich dazu in den Heiligen Schriften der
Bibel und des Korans? Wie haben sich die Grundaussagen in Theologie
und Tradition der drei Religionen niedergeschlagen und entwickelt?
Was bedeutet die erfahrene Barmherzigkeit Gottes für das Leben der
Gläubigen privat und in ihren Gemeinden?
Dazu referieren und stellen sich den Fragen des Publikums Shaul
Friberg, Rabbiner an der Hochschule für Jüdische Studien
Heidelberg, Dr. Tobias Specker, Professor an der
Philosophisch-theologischen Hochschule Sankt Georgen, und Gonül
Yerli, Vizedirektorin des Islamischen Zentrum Penzberg. Die
Moderation liegt in Händen von Erhard Steiger, Bildungsreferent der
Katholischen Erwachsenenbildung Speyer.
Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Jüdischen
Kultusgemeinde der Rheinpfalz und dem Forum Interreligiöser Dialog
Speyer statt. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung ist nicht
erforderlich. Information bei Katholische Erwachsenenbildung
Diözese Speyer, Tel. 06232 7 102 180, email: keb@bistum-speyer.de is
27.01.2017
Optimierung der neuen Dom-Außenbeleuchtung
 Die neue Außenbeleuchtung des Doms bei der ersten Inbetriebnahme Ende Dezember
Die neue Außenbeleuchtung des Doms bei der ersten Inbetriebnahme Ende Dezember
Domkapitel bittet Speyerer Bevölkerung um Mithilfe
Speyer- Rechtzeitig zum Weihnachtsfest war sie
fertig installiert und konnte in Betrieb genommen werden: die neue
Außenbeleuchtung des Doms zu Speyer. Das Beleuchtungskonzept
basiert auf einem System vernetzter LED-Lichtquellen und wurde
zuvor anhand einer 3D-Simulation erstellt. Unter realen Bedingungen
wird die Anlage nun laufend evaluiert und wo nötig verändert. Das
Ergebnis soll optimiert und unerwünschte Effekte sollen reduziert
werden. Diese Arbeiten werden das ganze Jahr andauern, da sich
Lichtstreuung und Lichtbrechung je nach Jahreszeit verändern.
Dombaumeister Mario Colletto erklärt, wo die Herausforderungen
bei der Anpassung der neuen Außenbeleuchtung liegen: „Die
Dimensionen des Doms sind einzigartig. Zudem haben die technischen
Standardparameter bei der flächigen Bauweise nicht voll gegriffen.
Wir haben dann versucht, die Kantenschärfe zu erhöhen um einen
Hell-Dunkel-Kontrast zu gewinnen. Dadurch sind Blend-Effekte
entstanden, die wir selbst von verschiedenen Standpunkten aus
beobachtet haben. Wir haben die Höhenpositionen einiger Strahler
entsprechend verändert und schon eine Verbesserung erzielt.
Feedback aus der Bevölkerung ist wichtig, da diese uns bei der
Arbeit hilft. Je mehr Rückmeldungen wir bekommen, umso besser.“
Das Domkapitel bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe. Durch
möglichst viele Rückmeldungen soll ein vollständigeres Bild davon
entstehen, wo die Beleuchtung für ungewünschte Effekte sorgt und
noch angepasst werden muss. Wichtig ist dabei ein Foto, die Uhrzeit
und der genauen Standort (Adresse, Stockwerk oder GPS Koordinaten).
Adressat ist die Mailadresse dom-kulturmanagement@bistum-speyer.de.
Die Rückmeldungen werden zunächst gesammelt und ausgewertet.
Konkrete Veränderungen sind grundsätzlich möglich, wenn das Wetter
dies zulässt: Bei Regen und Frost sind Arbeiten in den Türmen und
an den Lichtmasten aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
„Nach der Konzepterstellung im Modell kommt nun eine Phase der
empirischen Erarbeitung.“ erklärt Dombaumeister Colletto den
weiteren Prozess. „Das bedeutet für uns, dass jemand losfährt und
sich den Dom von einer bestimmten Position aus anschaut. Ein
zweiter macht sich innerhalb des Doms auf den Weg zu den
entsprechenden Strahlern, was bis zu einer halben Stunde dauert.
Das Ergebnis wird dokumentiert und gegebenenfalls muss auch die
Programmierung verändert werden. Das alles geht nur ab Einbruch der
Dunkelheit und bei gutem Wetter.“ Der Prozess der Anpassung werde
daher noch gut ein Jahr dauern, so Colletto. Acht bis zehn Leuchten
würden zusätzlich benötigt. Dazu kämen Anpassungsarbeiten an den
Türmen und auf der Zwerggalerie. Insgesamt sei die Anlage aber
fertig, stellt der Dombaumeister fest.
Warum eine neue Außenbeleuchtung?
Mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung der Kathedrale und
UNESCO-Welterbestätte Dom zu Speyer werden zugleich mehrere Ziele
verfolgt. Erstens ermöglicht es die neue Beleuchtung, die
plastische Wirkung des romanischen Baukörpers stärker heraus zu
arbeiten. Dies wird durch Bodenstrahler und Flächenleuchten im
Außenbereich und innerhalb der Türme erreicht. Die im Außenbereich
positionierten Strahler enthalten aus Rasterfolien geschnittene
Masken, so dass der Scheinwurf individuell auf den jeweiligen
Bereich des Doms angepasst ist. Der Dom erhält damit eine für ihn
maßgeschneiderte Beleuchtung. Die moderne LED-Beleuchtung und die
Vernetzung der einzelnen Strahler ermöglicht zweitens eine
dynamische, das heißt den Nachtzeiten und Lichtverhältnissen
angepassten Steuerung der Beleuchtung. Dies dient dann auch dem
dritten Ziel des neuen Beleuchtungskonzepts: Durch die Erneuerung
der in die Jahre gekommenen technischen Infrastruktur wird die
Energieeffizienz erhöht und damit der Stromverbrauch verringert.
Erreicht wird dieser Effekt durch den Einsatz moderner LED Technik.
Diese dient zudem dem Tierschutz, da das Lichtspektrum so gestaltet
wird, dass Vögel, wie der Wanderfalke, nicht irritiert werden.
Das LED Licht bewirkt auch eine Veränderung der Lichtfarbe, die
noch ungewohnt anmutet. Dombaumeister Colletto erklärt: „Wir sind
unter den ersten, die diese Technik verwenden. Gewohnt sind wir
noch an das alte, gelbliche Licht. Die Veränderung wird aber auch
andernorts zwangsläufig kommen – aus energetischen Gründen und weil
die alten Leuchten das Ende ihrer technischen Lebensdauer
erreichen.“ Damit der Kontrast in der Übergangszeit nicht so groß
sei, würden einzelne Lampen noch mit gelben Masken versehen, so
Colletto.
Die neue Außenbeleuchtung des Speyerer Doms besteht aus etwa
fünfzig Bodenstrahlern, Lichtmasten an sechs Positionen und
Strahlern auf zwei gegenüberliegenden Gebäuden sowie in den Türmen
positionierten Leuchten. Die letztgenannten hatten zunächst für
erhebliche Blendwirkung gesorgt.
Text: is; Foto:; © Domkapitel Speyer, Klaus
Landry
23.01.2017
25 Jahre: Jubiläum der BDKJ-Musikwerkstatt
 Seit 25 Jahren
Schwerpunktveranstaltung für die Verbreitung Neuer Geistlicher
Lieder im Bistum Speyer
Seit 25 Jahren
Schwerpunktveranstaltung für die Verbreitung Neuer Geistlicher
Lieder im Bistum Speyer
Speyer/Bad Dürkheim- Die Musikwerkstatt
"Neues Geistliches Lied" des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) Speyer feierte am vergangenen Wochenenden ihr
25-jähriges Bestehen. Vom 20. bis 22.1.17 trafen sich rund 100
Sänger im Jugendhaus St. Christophorus in Bad Dürkheim. Thomas
Quast, Komponist und Musiker der Band Ruhama, war im
Jubiläumsjahr Referent der Musikwerkstatt, deren Schwerpunkt das
Singen im großen Chor war. Sein Fazit: „Ich fand das
Hautnah-Konzert am Freitag besonderes und sehr beeindruckend. Meine
Bandkollegen und ich waren da wirklich nah am Publikum dran. Das
war eine ganz besondere Atmosphäre“. Der Kölner Komponist hat es
genossen, mit der Band und den Werkstatt-Teilnehmenden gemeinsam
seine Lieder zu singen: „Alle Lieder- auch neue oder unbekannte-
wurden mitgesungen“, freute er sich. Das Neue Geistliche Lied (NGL)
zeichnet sich durch religiöse Texte, Einflüsse aus der Popularmusik
und die Verwendung im Gottesdienst aus.
Der Arbeitskreis NGL des BDKJ Speyer ist Initiator der
Musikwerkstatt und nutzte die Jubiläumsveranstaltung, um einem
breiten Publikum NGL nahe zu bringen. Ein öffentlicher Gottesdienst
mit 400 Besuchern am Sonntagmorgen in der Kirche St. Ludwig in Bad
Dürkheim bot dazu den passenden Rahmen. Vivien Vossen war
eine der jüngsten Chorteilnehmerinnen: „Das war ein sehr
abwechslungsreicher Gottesdienst. Es war schön, dass wir ihn
mitgestalten konnten. Und es war schön, neue und coole Lieder zu
singen!“, sagte die 15-Jährige aus Limburgerhof. Da fiel
auch der Altersunterschied zwischen den langjährigen
Musikwerkstatt-Teilnehmern und der neuen Generation nicht ins
Gewicht: „Es war trotzdem eine ganz tolle Gemeinschaft!“, freut
sich Denise Funk (16) Jahre aus Wachenheim. Auch für sie war
der Gottesdienst eine besondere Erfahrung: „Ich fand es toll, dass
Thomas Quast als Komponist der Lieder dabei war. Schön war auch die
Mischung der Lieder“. Diese Einschätzung teilt auch Katja Grimm
(34) aus Schotten. Sie ist ein „Musikwerkstatt-Urgestein“ und
bereits zum 23. Mal mit dabei: „Der Gottesdienst war wie immer ein
tolles Erlebnis. Es gab ein schönes Gemeinschaftsgefühl. Die Lieder
haben das toll transportiert und haben sehr gut zum Inhalt des
Gottesdienstes gepasst. Die Leute waren begeistert!“
Die Musikwerkstatt ist fester Bestandteil im jährlichen Kalender
des BDKJ Speyer. Viele NGL sind in den Kinder- und Jugendverbänden
fest verankert. Die Lieder „Da berühren sich Himmel und Erde“,
„Keinen Tag soll es geben“, „Dies Haus aus Stein“, „Flinke Hände,
flinke Füße“, „Lasst uns ziehn zu den Quellen des Lebens“ und viele
andere sind musikalische Highlights der Verbandsgottesdienste. „Sie
erzählen von Gott, der den Menschen auf Augenhöhe begegnet“,
erklärt Christian Knoll die Beliebtheit der NGL. Knoll ist
Referent für Religiöse Bildung und Mitglied im Arbeitskreis NGL und
organisiert jährlich die Musikwerkstatt. Der gebürtige Speyerer,
der in Worms lebt erklärt: „Wir Verbände wollen uns mit Kindern
und Jugendlichen auf den Weg machen und Gott suchen. Als Suchende
wollen wir Gott in den kleinen Dingen, in jedem Menschen vermuten
und entdecken“. Dabei spielten Texte und Melodien der NGL eine
entscheidende Rolle.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer ist
Dachverband von sieben Kinder- und Jugendverbänden im Bistum
Speyer. Er vertritt die Interessen von 7.500 Mitgliedern in Kirche,
Politik und Gesellschaft. Der Arbeitskreis NGL arbeitet eng mit den
Referat Religiöse Bildung der Abteilung Jugendseelsorge zusammen.
Das nächste Projekt wird die Musikwallfahrt im August 2017 sein.
Gemeinsam pilgern junge Menschen dann von Bad Dürkheim nach Speyer
und führen zum Abschluss der musikalischen Wallfahrt am 11.8.17 in
der Friedenskirche St. Bernhard das Oratorium "Psalm 2016" von
Gregor Linßen auf.
Text: BDKJ Speyer; Foto: C. Knoll/ BDKJ
Speyer
23.01.2017
„Lasst euch versöhnen“
.jpg) Ökumenischer
Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen im
Speyerer Dom
Ökumenischer
Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen im
Speyerer Dom
Speyer- Mit einem feierlichen ökumenischen
Gottesdienst im Speyerer Dom haben die Evangelische Kirche der
Pfalz, das Bistum Speyer und weitere, in der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) – Region Südwest zusammengeschlossene
Kirchen die Gebetswoche für die Einheit der Christen eröffnet. Die
Woche steht in diesem Jahr unter dem Zeichen von „500 Jahre
Reformation“ und trägt das Motto „Versöhnung – Die Liebe Christi
drängt uns“ (2 Kor 5).
„Wir haben allen Grund zur Freude, dass nach Jahrhunderten der
Abgrenzung und Feindschaft das Verbindende unser kirchliches
Miteinander prägt“, betonte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in
seiner Begrüßung. In der Einheit der Liebe Christi sei eine
gemeinsame Erinnerung an 500 Jahre Reformation möglich: „Wir
vergewissern uns dankbar der Errungenschaften der Reformation für
alle Kirchen und bestärken uns in unserem gemeinsamen Auftrag,
Zeuginnen und Zeugen der Liebe Christi zu sein.“
Die lange Geschichte der Spaltung der abendländischen
Christenheit habe viele Wunden hervorgebracht, bekannte Wiesemann.
Im Bewusstsein, „dass wir alle aneinander schuldig geworden sind“
sei es jedoch heute möglich, sich gemeinsam dieser Geschichte und
ihrer Folgen zu stellen und „uns bewusst der Gnade Gottes
anzuvertrauen, der allein Vergebung und Versöhnung schenken kann.
Wir leiden unter der Spaltung und wollen sie mit Gottes Hilfe
vollständig überwinden.“
.jpg) Bischof
Wiesemann verwies auf das Motto der Gebetswoche. Das Leitwort
führe in das Zentrum der Frohen Botschaft. Durch seinen Tod und
seine Auferstehung habe Jesus Christus die trennende Wand der
Feindschaft niedergerissen. „Von seinem Geist geführt, können wir
bekennen, dass wir Sünder und aneinander schuldig geworden sind,
dass aber die Gnade Gottes unendlich größer ist und alles Trennende
überwinden kann.“ Angesichts von Hass und Unfrieden, Intoleranz,
Ungerechtigkeit, Hunger und Armut weltweit rief der Bischof die
Christen dazu auf „Diener der Versöhnung für die ganze Welt zu
sein“ und „das Antlitz des liebenden Gottes“ sichtbar werden zu
lassen.
Bischof
Wiesemann verwies auf das Motto der Gebetswoche. Das Leitwort
führe in das Zentrum der Frohen Botschaft. Durch seinen Tod und
seine Auferstehung habe Jesus Christus die trennende Wand der
Feindschaft niedergerissen. „Von seinem Geist geführt, können wir
bekennen, dass wir Sünder und aneinander schuldig geworden sind,
dass aber die Gnade Gottes unendlich größer ist und alles Trennende
überwinden kann.“ Angesichts von Hass und Unfrieden, Intoleranz,
Ungerechtigkeit, Hunger und Armut weltweit rief der Bischof die
Christen dazu auf „Diener der Versöhnung für die ganze Welt zu
sein“ und „das Antlitz des liebenden Gottes“ sichtbar werden zu
lassen.
Kirchenpräsident Christian Schad legte seiner Predigt den
vorgegebenen biblischen Text, das Gleichnis vom verlorenen Sohn,
zugrunde. Schad rief die Christen dazu auf, ehrlich mit der
Geschichte der je eigenen Kirche umzugehen und sich auszurichten
auf Jesus Christus, der das gemeinsame Fundament der Kirche sei.
„Lasst euch versöhnen. All die falschen Bilder vom jeweils anderen,
all die Vorurteile gegen Protestanten, Katholiken, Orthodoxe,
Freikirchler, sie sollen aus unseren Köpfen und Herzen weichen.
Nichts soll sich mehr zwischen uns stellen“, sagte der
Kirchenpräsident. Der reformatorische Ruf zur Umkehr sei immer auch
ein Schritt zur Klarheit: „Das Ende der Selbsttäuschung, ein Blick
in die Tiefe der eigenen Existenz.“
Das ökumenisch gefeierte Jubiläum 500 Jahre Reformation sei ein
Zeichen dafür, dass die jahrhundertealten Mauern zwischen den
Kirchen eingerissen würden, damit es zur versöhnten Vielfalt kommen
könne. Danach habe sich kein anderer als Martin Luther Zeit seines
Lebens gesehnt: „Das Geteilte vereinen und ganz machen, von allem
Zwiespalt lassen, auf dass wir eines Sinnes gerichtet seien auf
Jesus Christus“, so der Reformator. Luthers Ziel sei es gewesen,
seine Kirche „zur Freiheit zu befreien“. Er habe sie nicht trennen
oder eine neue Kirche gründen, sondern sie reformieren wollen.
Die im 16. Jahrhundert entstandene Kirchenspaltung sei zu
beklagen, führte Schad aus. Wie schmerzhaft sie sei, mache die
fehlende Gemeinschaft am Tisch des Herrn offenbar. „Diese
Wirkungsgeschichte darf aber nicht den Blick verstellen auf die
Grundanliegen der Reformation, die als Ruf zur Freiheit, zur
geistlichen Erneuerung heute neu zu hören sind.“ Zur Freiheit eines
Christenmenschen gehöre indes auch die Verantwortung für
Notleidende, mahnte Schad in seiner Predigt: Verantwortung für
Menschen auf der Flucht vor Krieg und Terror, für Asylsuchende, für
die Entwurzelten in den Städten und die Verarmten, die nicht
mithalten könnten mit den Anforderungen dieser Gesellschaft: „Es
ist unsere gemeinsame, ökumenische Aufgabe, das Evangelium offen
und öffentlich zu bezeugen, in Wort und Tat, damit alle etwas
spüren von Gottes Barmherzigkeit, seiner Gerechtigkeit und von
seinem Frieden“, bekräftigte der Kirchenpräsident.
.jpg) Mitwirkende des
Gottesdienstes waren der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) – Region Südwest, Pastor Dr. Jochen
Wagner, Argirios Giannios als Vertreter der Griechisch-Orthodoxen
Kirche, Pastor Jörg-Michael Grassau vom Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), die Speyerer
Ortsgeistlichen, Pfarrerin Christine Gölzer und Dompfarrer Matthias
Bender, sowie der Synodalpräsident der Evangelischen Kirche der
Pfalz, Hermann Lorenz, und die Katholikenratsvorsitzende Luisa
Fischer. In den Gebeten und Fürbitten baten sie um Vergebung für
das Leid, dass sich Christen gegenseitig zugefügt haben und baten
um Versöhnung und Frieden für alle Menschen auf der Erde. Als
sichtbares Zeichen der Versöhnung entzündeten sie ein Licht an der
Osterkerze und reichten es mit kleinen Kerzen an die
Gottesdienstbesucher weiter.
Mitwirkende des
Gottesdienstes waren der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) – Region Südwest, Pastor Dr. Jochen
Wagner, Argirios Giannios als Vertreter der Griechisch-Orthodoxen
Kirche, Pastor Jörg-Michael Grassau vom Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), die Speyerer
Ortsgeistlichen, Pfarrerin Christine Gölzer und Dompfarrer Matthias
Bender, sowie der Synodalpräsident der Evangelischen Kirche der
Pfalz, Hermann Lorenz, und die Katholikenratsvorsitzende Luisa
Fischer. In den Gebeten und Fürbitten baten sie um Vergebung für
das Leid, dass sich Christen gegenseitig zugefügt haben und baten
um Versöhnung und Frieden für alle Menschen auf der Erde. Als
sichtbares Zeichen der Versöhnung entzündeten sie ein Licht an der
Osterkerze und reichten es mit kleinen Kerzen an die
Gottesdienstbesucher weiter.
Musikalisch gestaltet wurde der Gottesdienst von der
Evangelischen Jugendkantorei der Pfalz unter der Leitung von
Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald und von Domorganist
Markus Eichenlaub an der Orgel.
Die Texte und die Liturgie zur Gebetswoche für die Einheit der
Christen wurden im Gedenken an 500 Jahre Reformation von der ACK in
Deutschland erstellt. Seit 2009 findet zur Gebetswoche für die
Einheit der Christen ein zentraler ökumenischer Gottesdienst in
Speyer statt, bei dem abwechselnd die Landeskirche und das Bistum
Gastgeber sind. Daran beteiligt ist außerdem die ACK in
Rheinland-Pfalz und im Saarland. Text:is/lk; Fotos: Klaus
Landry
16.01.2017
Den drängenden Fragen sozialer Gerechtigkeit stellen
Neujahrsempfang: Kirchenpräsident Schad unterstreicht
diakonisches Profil
Speyer- Nach Ansicht des pfälzischen
Kirchenpräsidenten Christian Schad müssen Kirche, Politik und
Gesellschaft die drängenden Fragen sozialer Gerechtigkeit ins
Zentrum der öffentlichen Debatte rücken. Gerade im Jahr der
Reformation sei die pfälzische Landeskirche auch als diakonische
Kirche gefragt, unterstrich Schad beim Neujahrsempfang im
Landeskirchenrat am Donnerstag. Luthers kritische Schrift „Von
Kaufhandlung und Wucher“ sei heute noch so aktuell wie im
Erscheinungsjahr 1524. „Wir müssen die Sorgen und Ängste der
Menschen ernst nehmen.“
Als moralische Lehrmeisterin werde sich die pfälzische
Landeskirche indes nicht aufspielen, sagte der Kirchenpräsident vor
rund hundert Gästen aus Kirche, Politik und Gesellschaft. „Mit
unseren diakonischen Unternehmungen sitzen wir selbst im Glashaus.
Wir mussten erfahren, mit wie vielen Dilemmasituationen gerade der
Bereich der Wirtschaft verbunden ist“, merkte Schad mit Blick auf
den Landesverein für Innere Mission selbstkritisch an. Der
diakonische Träger musste 2016 sein Krankenhaus aus
wirtschaftlichen Gründen schließen. Dies werde die Landeskirche
jedoch nicht daran hindern, „sich selbst und die Politik daran zu
erinnern, dass der Weg gerechter Teilhabe aller an den
wirtschaftlichen und sozialen Prozessen der vom Evangelium
gewiesene Weg ist“.
Zur sozialen Gerechtigkeit gehöre die Gewähr, „dass das Geld zum
Leben reicht und die Menschen im Alter eine auskömmliche Rente
erwarten können“, führte der Kirchenpräsident in seiner Ansprache
aus. Aggressionen würden nicht kleiner und Vertrauen könne nicht
wachsen, „wenn die Menschen den Eindruck haben, dass ihnen niemand
zuhört.“ Die Reformation bezeichnete Schad als „weltoffene
Bewegung“. Sie habe „Städter und Bauern, Gelehrte und Fürsten,
Frauen und Männer dazu aufgerufen, sich einen eigenen Reim auf die
Güte Gottes zu machen“.
Beim Neujahrsempfang begrüßte der Kirchenpräsident unter anderen
Bischof Karl-Heinz Wiesemann, den Beauftragten der Landesregierung
für das Reformationsjubiläum, Gerhard Robbers sowie den Speyerer
Oberbürgermeister Hansjörg Eger. Speyer ist eine der Städte auf dem
Europäischen Stationenweg im Rahmen des Jubiläums „500 Jahre
Reformation“. Die musikalische Umrahmung des Empfangs gestalteten
Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald und der Fagottist
Andreas Groll. Text und Foto: lk
Mehr zum Thema auf der landeskirchlichen
Reformations-Homepage www.reformation2017.evpfalz.de.
12.01.2017
Sternsinger bringen Ministerpräsidentin Malu Dreyer den Segen
 Mainz/Speyer/Meckenheim- „Die Sternsinger
kommen!“ hieß es am 12.Januar in der Staatskanzlei in Mainz. Mit
dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ brachten Kinder und Jugendliche aus
der Pfarrei Hl. Michael in Meckenheim den Segen zu
Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Mainz/Speyer/Meckenheim- „Die Sternsinger
kommen!“ hieß es am 12.Januar in der Staatskanzlei in Mainz. Mit
dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ brachten Kinder und Jugendliche aus
der Pfarrei Hl. Michael in Meckenheim den Segen zu
Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
In den Gewändern der Heiligen Drei Könige sind sie- wie viele
andere Sternsingerinnen im Bistum Speyer und deutschlandweit- in
diesen Tagen unterwegs. „Christus segne dieses Haus“ lautet ihr
Segenswunsch, den sie an die Schwellen der Türen anschreiben. Sie
sammeln für Not leidende Kinder in aller Welt. In Mainz traten
heute- stellvertretend für alle Sternsingergruppen aus
Rheinland-Pfalz- kleine und große Könige über die Schwelle der die
Staatskanzlei.
Aus Meckenheim waren Juliana (10), Jessica (10) und Vincent (13)
und sieben weitere Sternsinger_innen nach Mainz
gekommen.
 Die Mädchen und Jungen warteten gespannt auf
Ministerpräsidentin Dreyer: "Ich erwarte mir von der
Ministerpräsidentin, dass sie mit ihren Kolleg_innen in der Politik
umsetzt, was wir ihr gleich berichten werden, wofür die diesjährige
Sternsingeraktion steht - und ich wünsche mir, dass es der
Ministerpräsidentin gesundheitlich gut geht", sagte Jessica (10)
vor dem Treffen in der Staatskanzlei.
Die Mädchen und Jungen warteten gespannt auf
Ministerpräsidentin Dreyer: "Ich erwarte mir von der
Ministerpräsidentin, dass sie mit ihren Kolleg_innen in der Politik
umsetzt, was wir ihr gleich berichten werden, wofür die diesjährige
Sternsingeraktion steht - und ich wünsche mir, dass es der
Ministerpräsidentin gesundheitlich gut geht", sagte Jessica (10)
vor dem Treffen in der Staatskanzlei.
König Vincent (13) ergänzt nach dem Empfang: "Es war schon toll
eine besondere Person treffen zu können. Ich glaube, dass Malu
Dreyer wirklich eine Frau ist, der man vertrauen kann und ich bin
überzeugt, dass sie unsere Sternsinger-Botschaft ihren Kolleg_innen
weitererzählt."
„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in
Kenia und weltweit!“ heißt das Leitwort der 59. Aktion
Dreikönigssingen, das aktuelle Beispielland ist Kenia. 1959 wurde
die Aktion erstmals gestartet.
 Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte
Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not
engagieren. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die
Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Jährlich können mit den gesammelten Spenden mehr als 1.500 Projekte
für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien
und Osteuropa unterstützt werden.
Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte
Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not
engagieren. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die
Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Jährlich können mit den gesammelten Spenden mehr als 1.500 Projekte
für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien
und Osteuropa unterstützt werden.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist
gemeinsam mit dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" e.V. Träger
der Aktion. Der BDKJ-Diözesanverband Speyer vertritt die Anliegen
von 7.500 Mitgliedern aus acht Kinder- und Jugendverbänden im
Bistum Speyer in Politik, Kirche und Gesellschaft. Mehr: www.bdkj-speyer.de
Lena Schmidt, BDKJ Diözesanvorsitzende / Abteilung
Jugendseelsorge
13.01.2017
Roman Herzog: „Ich bin unendlich dankbar“
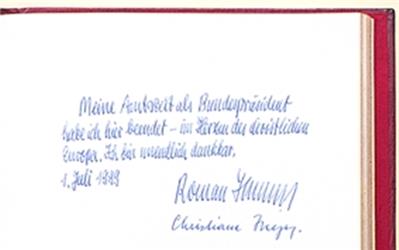 Eintrag von Roman Herzog in das Goldene Buch des Doms zu Speyer am 1. Juni 1999
Eintrag von Roman Herzog in das Goldene Buch des Doms zu Speyer am 1. Juni 1999
Altbundespräsident Roman Herzog statte dem Dom am Tag nach
seinem Abschied aus dem Amt des Bundespräsidenten einen sehr
persönlichen Besuch ab
Speyer- „Roman Herzog war eine prägende
Persönlichkeit und ein überzeugender Bundespräsident, der seine
Werte aus dem christlichen Glauben geschöpft hat. Als engagierter
und couragierter Christ hat er dem Land und den Menschen
Orientierung und Zuversicht vermittelt. Mit Speyer und seinem Dom
verband ihn eine enge Beziehung, die in mehreren offiziellen wie
auch zahlreichen privaten Besuchen ihren Ausdruck fand. Das Bistum
Speyer ist ihm und seiner Familie im Gebet verbunden und wird ihm
ein ehrendes und dankbares Andenken bewahren.“ Mit diesen Worten
würdigte der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den nun
verstorbenen Altbundespräsidenten und vormaligen Präsidenten den
Bundverfassungsgerichts Prof. Dr. Roman Herzog.
Dreimal besuchte Herzog den Dom im Rahmen offizieller Anlässe.
Am 23. November 1993 trug er sich als Präsident des
Bundesverfassungsgerichts in das Goldene Buch des Doms ein. In
derselben Funktion stattete er der romanischen Kathedrale am 15.
April 1994 erneut einen Besuch am, diesmal zusammen mit dem
Österreichischen Verfassungsgerichtshof. Ein drittes Mal besuchte
Herzog am 17. Oktober 1998 den Dom zu Speyer. Anlass war der
Staatsbesuch von Bundeskanzler Helmut Kohl anlässlich seiner
Verabschiedung durch die Bundeswehr.
Der Speyerer Dom hatte für Roman Herzog eine große persönliche
Bedeutung. Davon zeugt neben den offiziellen Besuchen vor allem ein
sehr persönlicher, inoffizieller Besuch, der auf den 1. Juli 1999
datiert. Dies war der erste Tag, an dem Herzog nicht mehr
amtierender Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland war.
Altbischof Dr. Anton Schlembach erinnert sich noch gut an die
damalige Begegnung mit Roman Herzog. Dieser habe ihn angerufen und
darum gebeten, dass der Bischof zusammen mit ihm und seiner Frau
Christiane in den Dom gehen möge. Bewusst sei dieser Besuch Herzogs
inoffiziell gewesen, das heißt ohne Protokoll und ohne öffentliche
Aufmerksamkeit. Herzog habe geraume Zeit in stillem Gebet
verbracht. Zu Bischof Schlembach sagte er: „Ich habe viel zu danken
in meinem Leben“ und deshalb sei es ihm ein Anliegen gewesen, zu
diesem Zeitpunkt in den Dom zu kommen. Auf Bitten von Bischof
Schlembach hat sich Roman Herzog trotz des inoffiziellen Charakters
des Besuchs auch damals in das Goldene Buch des Doms einzutragen.
Er tat dies mit den Worten: „Meine Amtszeit als
Bundespräsident habe ich hier beendet - im Herzen des christlichen
Europa. Ich bin unendlich dankbar.“
Domsakristan Markus Belz erinnert sich daran, dass Roman
Herzog jährlich mehrmals den Dom „inkognito“ und ohne
Vorankündigung besuchte. Sowohl während der Amtszeit als
Bundespräsident als auch danach suchte er den Dom am frühen
Samstagmorgen auf, zu einer Zeit, wenn meist noch wenig Besucher in
der Kathedrale unterwegs sind. Teils sei Herzog alleine gewesen,
teils habe er Gästen mitgebracht, so Belz. Den Personenschutz habe
er draußen warten lassen. Text: is; Foto © Domkapitel
Speyer
11.01.2017
„Ihr seid jung, aber ihr bewegt schon viel!“
 Die Sternsinger Pierre-Alexander (16), Monja (14), Janina (13) und Paula (13) sowie Begleiter Wolfgang Heinrich Justenhoven aus der Gemeinde Hl. Disibod in Feilbingert vertraten das Bistum Speyer am Montagmorgen beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur 59. Aktion Dreikönigssingen. Zum Gruppenfoto mit der Kanzlerin stellten sie sich gemeinsam mit Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, und Pfr. Dirk Bingener, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), im Bundeskanzleramt auf.
Die Sternsinger Pierre-Alexander (16), Monja (14), Janina (13) und Paula (13) sowie Begleiter Wolfgang Heinrich Justenhoven aus der Gemeinde Hl. Disibod in Feilbingert vertraten das Bistum Speyer am Montagmorgen beim Sternsinger-Empfang von Bundeskanzlerin Angela Merkel zur 59. Aktion Dreikönigssingen. Zum Gruppenfoto mit der Kanzlerin stellten sie sich gemeinsam mit Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘, und Pfr. Dirk Bingener, Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ), im Bundeskanzleramt auf.
Sternsinger aus Feilbingert zu Gast bei Bundeskanzlerin
Angela Merkel
Berlin- Es war der erste offizielle Termin
der Bundeskanzlerin Angela Merkel im neuen Jahr und dann
gleich so ein königlicher: Dort, wo sonst ruhige
Arbeitsatmosphäre herrscht, besuchten am Montag
108 Sternsinger das Bundeskanzleramt und brachten ihren Segen
für das neue Jahr. „Wenn ihr da seid, dann verändert sich
die Stimmung hier ein bisschen. Ihr kommt mit euren bunten
Kostümen, mit euren hoffnungsvollen Liedern. Wenn wir euch
sehen und hören, wissen wir wieder, dass das etwas zu tun hat
mit unserer Arbeit. Es geht nämlich darum, dass sich
Hoffnungen erfüllen und wir immer wieder neue Wege in
Angriff nehmen. Und genau das tut ihr auch“, sagte die
Bundeskanzlerin zu den Kindern und Jugendlichen. Je vier
Kinder aus allen 27 deutschen Diözesen besuchten das
Bundeskanzleramt stellvertretend für die mehr als
300.000 Sternsinger, die rund um den Jahreswechsel Spenden für
Gleichaltrige sammeln und den Segen zu den Menschen
bringen.
Bundeskanzlerin Merkel lobte das Engagement der Mädchen und
Jungen. „Als Sternsinger macht ihr klar, dass es nicht nur um euch
geht und nicht nur um die Kinder in Deutschland. Sondern dass
es eine Welt gibt, und dass es genauso um Kinder in anderen
Teilen der Welt geht. Und dass das, was ihr euch
wünscht, auch für die anderen Kinder auf der Welt gilt. Dass
sie in die Schule gehen können, dass sie als Erwachsene Arbeit
finden. Und deshalb kommt ihr fröhlich und hoffnungsvoll hier
her, aber mit einer sehr ernsten und klaren Botschaft“, so
Merkel. Die Bundeskanzlerin dankte den Sternsingern
für ihren Einsatz für notleidende Kinder in aller Welt.
„Ihr seid jung, aber ihr bewegt schon viel, denn ihr erzählt
ja anderen Menschen davon, dass sie auch etwas Gutes tun, wenn sie
euch helfen. Deshalb möchte ich mich stellvertretend für
viele, viele Menschen in Deutschland ganz herzlich bei euch
bedanken.“
„Die Erde muss im Gleichgewicht sein!“
Die 59. Aktion Dreikönigssingen steht unter dem Leitwort
„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung
– in Kenia und weltweit!“ und rückt damit beispielhaft an der
Region Turkana im Norden des Landes die Auswirkungen des
Klimawandels in den Fokus. Charlotte (13) und Jasper (13) aus
der katholischen Pfarrei Salvator in Berlin-Lichtenrade
stellten Angela Merkel dies in einem kurzen Anspiel vor
und hatten gleich eine Forderung an die Bundeskanzlerin mit
dabei: „Die Erde muss im Gleichgewicht sein, damit alle auf
und von ihr leben können. Bitte nehmen Sie das mit zu Ihren
Kollegen in der Weltpolitik“, sagte Charlotte.
Als Erinnerung an diese Bitte überreichten die beiden der
Kanzlerin eine kleine Waage.
Der Bundespräses des Bundes der Deutschen Katholischen (BDKJ),
Pfarrer Dirk Bingener, der die Kinder gemeinsam mit Prälat Dr.
Klaus Krämer, Präsident des Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘,
ins Bundeskanzleramt begleitet hatte, zitierte in seinen
Worten an die Kanzlerin die Aufforderung von Papst
Franziskus, dass alle als Werkzeuge Gottes zur
Bewahrung der Schöpfung beitragen sollen. „Dies nehmen sich
diese Kinder und Jugendlichen zu Herzen, wenn sie Spenden für
Projekte in Kenia und weltweit sammeln. Aber eben auch, wenn
sie selbst überlegen, wie sie durch ihren eigenen
Lebensstil dazu beitragen, die globale Erderwärmung zu
begrenzen und die Folgen zu lindern.“
Die Spende der Bundeskanzlerin nahmen Kinder aus der Gemeinde
St. Anna in Bochum im Bistum Essen entgegen. Marie-Luise
(16), Jost (14), Emma (10) und Sandro (11) trugen der
Kanzlerin auch den Segensspruch vor und schrieben den Segen
„20*C+M+B+17“ für das neue Jahr im Kanzleramt an. Mit ihrer
Spende für das Dreikönigssingen unterstützt die
Bundeskanzlerin eine Vorschule in Kenia.
Jeweils vier Sternsinger aus allen 27 deutschen Bistümern
vertraten in Berlin alle Mädchen und Jungen, die sich rund um
das Dreikönigsfest bundesweit an der 59. Aktion
Dreikönigssingen beteiligen. Seit 1984 bringen die
Sternsinger jedes Jahr ihren Segen „Christus mansionem
benedicat – Christus segne dieses
Haus“ ins Bundeskanzleramt. Bundeskanzlerin Angela Merkel
hieß die kleinen und großen Könige bereits zum zwölften Mal
willkommen.
Rund 994 Millionen Euro, mehr als 70.100 Projekte
Träger der Aktion Dreikönigssingen sind
das Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und der Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ). Seit ihrem Start 1959
hat sich die Aktion zur weltweit größten Solidaritätsaktion
von Kindern für Kinder entwickelt. Rund 994 Millionen
Euro wurden seither gesammelt, mehr als 70.100 Projekte
und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien,
Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Bei der 58. Aktion zum
Jahresbeginn 2016 hatten die Mädchen und Jungen aus
10.282 Pfarrgemeinden, Schulen und Kindergärten mehr als 46,2
Millionen Euro gesammelt. Mit den Mitteln fördert
die Aktion Dreikönigssingen weltweit Projekte in den
Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral, Ernährung,
soziale Integration und Nothilfe. Text: is; Foto:
Ralf Adloff
09.01.2017
Aufruf: Die Gesellschaft im Wahlkampf nicht spalten
 Gemeinsames Wort der Kirchen in Baden, in
Elsass-Lothringen und in der Pfalz zum Wahljahr 2017
Gemeinsames Wort der Kirchen in Baden, in
Elsass-Lothringen und in der Pfalz zum Wahljahr 2017
Kehl/Strasbourg- Anlässlich der in diesem Jahr
bevorstehenden Wahlen in Frankreich und in Deutschland haben die
evangelischen Kirchen in Baden, der Pfalz und in Elsass-Lothringen
heute ein gemeinsames Wort veröffentlicht, in dem sie dazu
aufrufen, die Gesellschaft im Wahlkampf nicht zu spalten und keine
Vorurteile gegen einzelne Menschen oder Gruppen zu säen. Die
Leitenden Geistlichen Jochen Cornelius-Bundschuh (Baden), Christian
Albecker (Elsass-Lothringen) und Christian Schad (Pfalz) verlasen
die Erklärung am heutigen Montag (9. Januar2017) auf der
deutsch-französischen Fußgängerbrücke zwischen Kehl und
Strasbourg.
Im vorangehenden Pressegespräch rief der badische Landesbischof
Jochen Cornelius-Bundschuh dazu auf, wählen zu gehen und bezog sich
dabei auf das Jubiläumsjahr der Reformation 2017. „Die
reformatorische Botschaft betont die Verantwortung für die Welt“,
sagte der Landesbischof. „Anstelle von Angst, Bevormundung und
Engstirnigkeit setzt sie das Vertrauen, das eigenständige Denken
und den weiten Horizont der Gläubigen“. Neun Monate vor der
Bundestagswahl rief der Landesbischof dazu auf, die politische
Debatte nicht von einem einzigen Thema bestimmen zu lassen, sondern
die großen Themen soziale Gerechtigkeit, Rente und Klimawandel mit
zu berücksichtigen.
Der Kirchenpräsident der Union des Églises protestantes d’Alsace
et de Lorraine, Christian Albecker, warnte vor einer
Instrumentalisierung der Religion für eine Politik der Abgrenzung.
„Wir sind zuallererst Franzosen und unterscheiden uns dann erst als
Christen oder Muslime“, sagte Albecker. Er distanzierte sich auch
von einem Verständnis von Religion als Privatsache. „Gerade in der
französischen Öffentlichkeit wird derzeit sehr viel über religiöse
Fragen debattiert“, erklärte der Kirchenpräsident vor den
zahlreichen deutschen und französischen Medienvertretern in der
Kehler Friedenskirche.
Christian Schad, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche), nannte die reformatorische
Botschaft „eine Gegenstimme gegen die Angst und einen Einspruch
gegen alle, die mit der Angst der Menschen spielen, um daraus
Kapital zu schlagen“. Die protestantischen Kirchen wollten ihren
Beitrag dazu leisten, dass Deutschland und Frankreich Motor der
europäischen Integration bleiben. Schad rief zu einem
„gastfreundlichen Europa“ auf und kündigte zugleich an, dass die
Kirchen mithelfen würden, das Thema „soziale Gerechtigkeit wieder
ins Zentrum der gesellschaftlichen Debatte“ zu rücken.
Am 23. April2017 ist die Präsidentschaftswahl in Frankreich, im
September wird der Deutsche Bundestag gewählt. Am 26. März 2017
wird auch der Landtag des Saarlandes gewählt. (ekiba/lk). Foto:
Jana Volk
Lesen Sie auch die Erklärung in Deutsch und Französisch:

09.01.2017
Die Erklärung in Deutsch und Französisch:
Ein neues Jahr beginnt und es ist für uns der Anlass all unseren
Gemeindegliedern, sowie den Bürgerinnen und Bürger der Grenzregion
ein friedvolles und behütetes Neues Jahr zu wünschen.
In diesem Jahr finden in unseren Ländern Wahlen statt, im
Frühjahr ist die Präsidentschaftswahl in Frankreich, im September
die Bundestagswahl in Deutschland.
Wir bitten Sie: Nutzen Sie die demokratische Freiheit in unseren
Ländern! Machen Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch und gehen Sie
wählen!
Als evangelische Christinnen und Christen gedenken wir in diesem
Jahr der Reformationsgeschichte, die vor 500 Jahren auch in unserer
Region am Oberrhein ihren Anfang nahm. Drei Grundelemente unseres
Glaubens sind uns in der politischen Auseinandersetzung besonders
wichtig:
1.
Jeder Mensch besitzt als Ebenbild Gottes eine unverlierbare Würde;
sie hat in den Menschenrechten eine rechtlich fassbare Form
gefunden. Wir widersprechen deshalb allen Versuchen, Menschen in
ihrer Freiheit einzuschränken oder sie auszugrenzen.
2.
Jesus Christus stellt sich an die Seite der Schwachen, der Armen
und der Fremden. Wir wollen ihm auf diesem Weg folgen und setzen
uns deshalb in unseren Ländern und gemeinsam in Europa für
Humanität, Solidarität und Nächstenliebe ein. Wir sehen uns als
Christinnen und Christen in einer besonderen Verantwortung, auch
weltweit für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung
einzutreten.
3.
Jeder Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Wir betrachten die Vielfalt
der regionalen, nationalen, kulturellen und religiösen Traditionen
als Herausforderung und als Reichtum unserer Länder und Europas.
Nach dem zweiten Weltkrieg haben Christinnen und Christen einen
wesentlichen Beitrag zur Versöhnung unserer beiden Länder
geleistet. Das verstehen wir heute angesichts neuer
Herausforderungen zu Versöhnung und Integration als Gabe und
Aufgabe zugleich: Wir suchen den Dialog, gerade auch mit anderen
Religionen und Weltanschauungen, wir tragen bei zu einer Kultur der
Aufmerksamkeit und warnen vor Konzepten der Abgrenzung und vor
nationalen Alleingängen.
Wir bitten alle Bürgerinnen und Bürger, alle Parteien und
Gruppen, die Gesellschaft im Wahlkampf nicht zu spalten, sondern
sachlich und fair miteinander umzugehen. Wir wehren uns gegen alle
Versuche, um politischer Macht willen, Vorurteile und Hass gegen
einzelne Menschen oder Gruppen zu säen.
Wir wachsen nur gemeinsam im Dialog und im gegenseitigen
Respekt. |
Une nouvelle année commence, et c’est pour nous l’occasion
d’adresser nos vœux les plus sincères à tous les membres de nos
communautés et à tous les citoyens de nos régions frontalières pour
une année de paix et de fraternité.
Mais cette année sera aussi une année d’élections dans nos deux
pays : élections présidentielles en France et élections au
Bundestag en Allemagne. Bénéficiant dans nos deux pays du privilège
de la liberté démocratique, notre premier devoir est d’user de
notre droit d’électrice et d’électeur et d’aller voter.
Les chrétiens protestants se souviennent en cette année 2017 de
l’histoire de la Réforme qui a également pris son essor, voilà 500
ans, dans notre région du Rhin supérieur. Trois convictions
résultant de notre foi protestante nous semblent particulièrement
importantes pour le débat politique à venir :
1.
Créé à l’image de Dieu, chaque être humain possède une dignité
inaliénable, dont les Droits de l’homme constituent l’expression
juridique. Nous nous élevons donc contre toutes les tentatives
visant à limiter ou à mettre entre parenthèses ces droits.
2.
Jésus le Christ s’est résolument placé du côté des faibles, des
pauvres et des étrangers. A sa suite, nous nous engageons dans nos
pays respectifs et ensemble en Europe, en faveur de l’humanité, de
la solidarité et de l’amour du prochain. En tant que chrétiens,
nous sommes appelés à nous engager, partout dans le monde, au
service de la paix, de la justice et de la sauvegarde de la
création.
3.
Chaque être humain est une créature de Dieu. Nous considérons la
diversité des cultures et traditions régionales et nationales à la
fois comme un défi et une richesse pour nos pays et pour l’Europe.
Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, les chrétiens ont
apporté une contribution majeure à la réconciliation de nos deux
pays. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis
concernant nos responsabilités et nos devoirs dans le domaine de la
réconciliation et de l’intégration : Nous recherchons le dialogue,
en particulier avec d’autres religions et philosophies, nous
cherchons à encourager une culture de la bienveillance et rendons
attentif au danger que représentent actuellement les dérives
nationalistes et identitaires.
Nous invitons les citoyennes et les citoyens, les partis et les
mouvements de nos pays à veiller à ne pas diviser la société durant
les campagnes électorales et à se traiter mutuellement avec respect
et objectivité. Nous nous élevons contre toutes les tentatives
visant à répandre, en vue d’accéder au pouvoir, un climat de
suspicion et d’exclusion à l’encontre d’individus ou de groupes
d’individus.
Nous ne grandirons qu’ensemble, dans le dialogue et le respect
mutuel. |
09.01.2017
Saarländische Ministerpräsidentin empfängt Sternsinger aus St. Ingbert
 Regionale Sternsingeraussendung mit Weihbischof Georgens
in Landau
Regionale Sternsingeraussendung mit Weihbischof Georgens
in Landau
Speyer/Landau/Saarbrücken/St.
Ingbert- Rund 60 Sternsinger aus den Bistümern Speyer
und Trier waren am 6. Januar zu Besuch in der Staatskanzlei in
Saarbrücken, um der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer den Segen zu überbringen. Mit dabei waren 12
große und kleine Könige aus St. Ingbert, die das Bistum Speyer
vertraten.
„Ich danke Euch ganz herzlich, dass Ihr Euch für Kinder in der
Welt einsetzt und uns den Segen bringt. Mit Eurem Segen zum Beginn
des Jahres können wir gleich viel besser arbeiten.“, freute sich
Kramp-Karrenbauer. Sie bedankte sich ausdrücklich für den Einsatz
der Sternsinger für Kinder in Not.
Die Mädchen und Jungen aus St. Ingbert warteten gespannt auf das
Treffen mit der Ministerpräsidentin: „Ich wollte da auf jeden Fall
dabei sein“ berichtet David (13). Sternsingerin Hannah (16)
ergänzt: „Das war toll. Die Ministerpräsidentin hat sich viel Zeit
für uns genommen und uns gut zugehört. Am Besten war aber, dass ich
den Segen an die Tür schreiben durfte.“
Bereits am Vormittag hatte Weihbischof Otto Georgens Sternsinger
aus Landau und Umgebung ausgesendet. Viele kleine und große
Segensbringer hatten sich dazu auf dem Rathausplatz in Landau
versammelt. „Das Kindermissionswerk und der BDKJ haben Kenia zum
Beispielland der Sternsingeraktion 2017 gewählt. Als ich davon
hörte, habe ich spontan an Landau gedacht. In Landau gibt es zwei
Initiativen, die seit langem Menschen in Kenia unterstützen: Die
Maria-Ward-Schule und der Hungermarschverein. Die Solidarität mit
Kindern und Jugendlichen in Kenia durch die diesjährige Aktion
Dreikönigssingen verbindet uns.“ Sagt Weihbischof Georgens.
 In diesem Jahr fand keine bistumsweite, zentrale
Aussendungsfeier statt. Die Sternsinger werden aber vor Ort in
ihren Pfarreien ausgesendet, Gruppen in und um Landau nutzten die
regionale Veranstaltung dort für eine gemeinsame
Aussendungsfeier.
In diesem Jahr fand keine bistumsweite, zentrale
Aussendungsfeier statt. Die Sternsinger werden aber vor Ort in
ihren Pfarreien ausgesendet, Gruppen in und um Landau nutzten die
regionale Veranstaltung dort für eine gemeinsame
Aussendungsfeier.
„Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung – in
Kenia und weltweit!“ heißt das Leitwort der 59. Aktion
Dreikönigssingen, das aktuelle Beispielland ist Kenia. 1959 wurde
die Aktion erstmals gestartet. Inzwischen ist das Dreikönigssingen
die weltweit größte Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für
Kinder in Not engagieren. Die Aktion wird getragen vom
Kindermissionswerk ‚Die Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen
Katholischen Jugend (BDKJ). Jährlich können mit den gesammelten
Spenden mehr als 1.500 Projekte für Not leidende Kinder in Afrika,
Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt
werden.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist
gemeinsam mit dem Kindermissionswerk "Die Sternsinger" e.V. Träger
der Aktion. Der BDKJ-Diözesanverband Speyer vertritt die Anliegen
von 7.500 Mitgliedern aus acht Kinder- und Jugendverbänden im
Bistum Speyer in Politik, Kirche und Gesellschaft. Mehr: www.bdkj-speyer.de Text
und Foto: BDKJ
07.01.2017
Saarländische Ministerpräsidentin empfängt Sternsinger - Bilderalbum
„Einschnitte sind eine Chance, um daran zu wachsen“
 Pontifikalamt zum Fest Erscheinung des Herrn im Speyerer
Dom – Generalvikar gibt bei Empfang Ausblick unter anderem auf die
Feier des 200-jährigen Jubiläums der Neugründung des
Bistums
Pontifikalamt zum Fest Erscheinung des Herrn im Speyerer
Dom – Generalvikar gibt bei Empfang Ausblick unter anderem auf die
Feier des 200-jährigen Jubiläums der Neugründung des
Bistums
Speyer- Zum Fest Erscheinung des Herrn
feierte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im Speyerer Dom ein
Pontifikalamt, an dem auch zahlreiche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats und des
Diözesancaritasverbandes ebenso wie mehrere Sternsinger der
Dompfarrei teilnahmen. Bischof Wiesemann dankte ihnen
stellvertretend für alle Sternsinger im Bistum für ihren
unermüdlichen Einsatz: „Ihr kleinen und doch so großen Könige
leistet einen großen und wichtigen Dienst. Indem ihr von Haus zu
Haus geht und den Menschen den Segen bringt, gebt Ihr ein Beispiel,
wie es in der Welt anders werden kann.“ Er würdigte die
Sternsingeraktion als „großartiges Zeugnis“ einer Hilfsaktion von
Kindern für Kinder.
In seiner Predigt stellte er die drei Weisen, die sich von einem
Stern zu dem neu geborenen Jesuskind in Bethlehem führen ließen und
ihm huldigten, der Machtzentrale des König Herodes gegenüber. Sie
sei angesichts der Geburt des Messias von Angst, Starrheit und
Heuchelei erfasst worden sei. „Anders die drei Weisen: Sie waren
Suchende und Fragende und wurden von der Sehnsucht nach etwas
Größerem und der Neugier auf das Leben geleitet“, führte der
Bischof aus. Ihre Größe habe sich geäußert in ihrer Beweglichkeit
und ihrer Fähigkeit, die Zeichen der Zeit zu sehen und zu
deuten.
Indem Gott als Kind und nicht als Konkurrent in die Welt
gekommen sei, habe er alle Schemata von Macht und Herrschaft
durchbrochen, so der Bischof weiter. Er habe sich berührbar und
damit - auch im wörtlichen Sinne - „angreifbar“ gemacht. Jesus habe
sich als Dienender verstanden und habe damit die herkömmliche Idee
von Herrschaft auf den Kopf gestellt. „Das führt uns in das Zentrum
unseres Auftrags heute als Kirche: Dass wir Suchende und Fragende
bleiben mit der Bereitschaft, immer wieder neu aufzubrechen und uns
von Gott dorthin führen zu lassen, wo alle Mächtigen der Welt die
Kronen ihrer Selbstherrlichkeit ablegen müssen. Sie tun das im
Angesicht des Kindes, das als einziges den Sinn der Welt
erschließen kann.“ Musikalisch wurde der Gottesdienst von der
Schola gregoriana und Domorganist Markus Eichenlaub gestaltet.
Beim anschließenden Empfang für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats und des
Diözesancaritasverbandes stellte Generalvikar Dr. Franz Jung das
Thema „Wachsen an Einschnitten“ in den Mittelpunkt seiner
Ansprache. Er bezog den Gedanken auf die Reformation vor 500 Jahren
ebenso wie auf die Neugründung des Bistums Speyer vor 200 Jahren.
Mit der Gründung der 70 neuen Pfarreien im Rahmen des Prozesses
„Gemeindepastoral 2015“ sei erneut ein bedeutender Einschnitt in
der Geschichte des Bistums erfolgt. „Einschnitte kosten viel Kraft,
doch sie sind zugleich eine Chance, daran zu wachsen und dem
ursprünglichen Auftrag unter geänderten Bedingungen treu zu
bleiben“, so der Generalvikar.
Das Fest „Erscheinung des Herrn“ – nach dem Griechischen auch
Epiphanie genannt – gehört zu den Hochfesten in der katholischen
Kirche. Es beschließt zusammen mit dem Fest der Taufe des Herrn am
nachfolgenden Sonntag den Weihnachtsfestkreis. Text und Foto:
is
06.01.2017
„Christus segne dieses Haus“
 Sternsinger
sind in den Pfarreien des Bistums Speyer wieder unterwegs – Rund
3.500 Kinder und Jugendliche engagieren sich in der Pfalz und im
Saarpfalzkreis für die Sternsinger-Aktion
Sternsinger
sind in den Pfarreien des Bistums Speyer wieder unterwegs – Rund
3.500 Kinder und Jugendliche engagieren sich in der Pfalz und im
Saarpfalzkreis für die Sternsinger-Aktion
Speyer- In diesen Tagen sind rund 3.500 Kinder
und Jugendliche als Sternsinger im Bistum Speyer unterwegs. Sie
bringen ihren Segen "Christus mansionem benedicat - Christus segne
dieses Haus" in die Häuser.
Das Leitwort der diesjährigen Sternsinger-Aktion lautet: „Segen
bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und
weltweit!" In diesem Jahr geht es um den Klimawandel und was er zum
Beispiel in Afrika für die Lebensbedingungen für Kinder und
Jugendliche bedeutet.
Seit ihrem Start 1959 hat sich die Sternsinger-Aktion zur
weltweit größten Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder
entwickelt. Rund 994 Millionen Euro wurden seither gesammelt und
mehr als 70.100 Projekte und Hilfsprogramme für Kinder in Afrika,
Lateinamerika, Asien, Ozeanien und Osteuropa unterstützt. Gefördert
werden Projekte in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Pastoral,
Ernährung, soziale Integration und Nothilfe. Sternsinger-Gruppen
aus dem Bistum Speyer sind auch bei den Empfängen im
Bundeskanzleramt sowie in den Staatskanzleien von Rheinland-Pfalz
und des Saarlandes beteiligt. Text und Foto: is
Weitere Informationen: www.sternsinger.de
05.01.2017
Bistum Speyer feiert mit „Glaubensfeuer“ das 200-jährige Jubiläum seiner Neugründung
 Präsentation von „Glaubensfeuer“ in der katholischen Kirche St. Cosmas und Damian in Gau-Algesheim im Juni 2016
Präsentation von „Glaubensfeuer“ in der katholischen Kirche St. Cosmas und Damian in Gau-Algesheim im Juni 2016
Multimediale Licht-Klang-Installation wird am Abend des
Pfingstsonntag (4. Juni 2017) im Speyerer Dom gezeigt
Speyer- An Pfingsten 2017 feiert das
Bistum Speyer das 200-jährige Jubiläum seiner Neugründung. Aus
diesem Anlass wird am Abend des Pfingstsonntags (4. Juni 2017) im
Speyerer Dom eine multimediale Licht-Klang-Installation mit dem
Titel „Glaubensfeuer“ gezeigt.
Die Besucherinnen und Besucher werden spektakuläre Lichteffekte,
außergewöhnliche Farbstimmungen und sphärische Klänge in Verbindung
mit biblischen Texten erleben. Entwickelt wurde die multimediale
Licht-Klang-Installation vom Bistum Mainz in Zusammenarbeit mit dem
renommierten Licht- und Mediadesigner Thomas Gerdon. Er hat schon
mehrfach für große Fernsehproduktionen die Lichteffekte gestaltet
und ist auch international tätig. So entwarf er zum Beispiel
Lichtdesigns für Fernsehshows wie „Verstehen Sie Spaß“ oder „Let’s
dance“ und große Rockkonzerte zum Beispiel von „nature one“ und
„mayday“. Bisherige Aufführungen haben zu begeisterten Reaktionen
quer durch alle Generationen und lange Menschenschlangen vor Beginn
der Aufführungen geführt. Imposante Lichteffekte sind dabei auf
eindrucksvolle Musikstücke synchron abgestimmt und erzeugen in
ihrer Farbigkeit ungewöhnliche Stimmungen, neue Einblicke in den
Kirchenraum und ein nicht nur spirituelles Erlebnis für alle
Sinne.
Im Mittelpunkt der knapp einstündigen Präsentation stehen die
Elemente Wasser, Licht und Feuer. „Gerade das Feuer steht in
besonderer Weise für das Pfingstereignis. In der Apostelgeschichte
wird berichtet, dass der Heilige Geist wie mit Feuerzungen auf die
Jünger herabkam“, erklärt Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. „Der
Heilige Geist entzündete in ihnen das innere Feuer, das sie
begeistert die frohe Botschaft verkünden ließ.“
Im „Glaubensfeuer“ werden Wasser, Licht und Feuer effektvoll in
Szene gesetzt und mit biblischen Texten und Bildern in Verbindung
gebracht. Zugleich bieten spezielle Lichteffekte Gelegenheit, den
Raum der romanischen Kathedrale kennenzulernen und neu zu erleben.
So werden zum Beispiel Lichtspots auf einzelne Architekturelemente
oder Objekte und Figuren gerichtet. „Wir wollen die Besucherinnen
und Besucher animieren, den Kirchenraum mit allen Sinnen auf eine
neue, ungewöhnliche und unerwartete Weise zu erfahren“, lädt
Bischof Wiesemann alle Interessierten dazu ein, sich vom
„Glaubensfeuer“ anrühren zu lassen. „Wir blicken an Pfingsten
zurück auf 200 Jahre Geschichte seit der Neugründung. Doch zugleich
wollen wir mit dem ‚Glaubensfeuer‘ die Herzen der Menschen von
heute entzünden und auch in Zukunft die befreiende Botschaft des
Evangeliums in die Welt und zu den Menschen bringen.“
 Die
Präsentation „Glaubensfeuer“ wird am Abend des Pfingstsonntags (4.
Juni 2017) im Speyerer Dom dreimal in Folge gezeigt, jeweils im
Abstand einer vollen Stunde. Die einzelnen Präsentationen beginnen
um 21 Uhr, um 22 Uhr und um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Die
Präsentation „Glaubensfeuer“ wird am Abend des Pfingstsonntags (4.
Juni 2017) im Speyerer Dom dreimal in Folge gezeigt, jeweils im
Abstand einer vollen Stunde. Die einzelnen Präsentationen beginnen
um 21 Uhr, um 22 Uhr und um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Das Bistum feiert auf vielfältige Weise das 200-jährige
Jubiläum seiner Neugründung
Unter dem Leitwort „Seht, ich mache alles neu“ (Off 21,5) begeht
das Bistum Speyer im Jahr 2017 das 200-jährige Jubiläum seiner
Neugründung. Eröffnet wird das Fest mit einer ökumenischen Vesper
und der Präsentation „Glaubensfeuer“ am Pfingstsonntag. Die
zentrale Feier findet am Pfingstmontag (5. Juni 2017) statt, genau
200 Jahre nach der Unterzeichnung des Bayerischen Konkordats, mit
dem das Bistum Speyer 1817 in den Grenzen des bayerischen
„Rheinkreises“ neu errichtet worden war. Im Mittelpunkt steht ein
Festgottesdienst im Dom, zu dem auch zahlreiche hochrangige
Vertreter aus Kirche, Politik und Gesellschaft erwartet werden.
Anschließend wird der Domnapf auf dem Domvorplatz mit Wein gefüllt
und an die Teilnehmer der Jubiläumsfeier ausgeschenkt. Am
Nachmittag lädt das Bistum in den Dienstgebäuden des Bischöflichen
Ordinariats zu einem Tag der offenen Tür ein. „Die Besucherinnen
und Besucher können so auch die gegenwärtigen Arbeitsschwerpunkte
und die Zukunftsvisionen des Bistums kennenlernen“, macht Bischof
Wiesemann deutlich. Gezeigt wird außerdem ein Theaterstück des
Chawwerusch-Theaters aus Herxheim, das den Zuschauern die Anfänge
des neugegründeten Bistums vor Augen stellt. Das Stück wird im Mai
und Juni des kommenden Jahres in allen Dekanaten des Bistums sowie
in mehreren katholischen Schulen aufgeführt.
Bereits am Dienstag, den 16. Mai 2017, hält auf Einladung des
Bistums Professor Klaus Unterburger im Historischen Ratssaal in
Speyer einen wissenschaftlichen Vortrag zum Thema „200 Jahre neues
Bistum Speyer“. Er lehrt Mittlere und Neue Kirchengeschichte an der
Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Regensburg. Seine
Forschungsschwerpunkte sind die Kirchengeschichte des 19. und 20.
Jahrhunderts, die Theologiegeschichte seit dem Spätmittelalter, die
Geschichte der Kirchenverfassung und die Ordensgeschichte. Sein
Vortrag behandelt das Spannungsverhältnis von Restauration und
Innovation in der Entwicklung des Bistums Speyer seit der
Neugründung im Jahr 1817.
Weitere Informationen zum 200-jährigen Jubiläum der
Neugründung des Bistums Speyer:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/bistumsjubilaeum-2017/
Weitere Informationen zur Licht-Klang-Installation
„Glaubensfeuer“: https://aktionen.bistummainz.de/illuminationen/
Text und Foto: is
04.01.2017
"Gott ist stärker als alle anderen Mächte dieser Welt"
 Bischof Wiesemann predigt zum Jahresabschluss im Speyerer
Dom und ruft dazu auf, sich trotz vieler Unsicherheiten nicht von
Angst lähmen zu lassen
Bischof Wiesemann predigt zum Jahresabschluss im Speyerer
Dom und ruft dazu auf, sich trotz vieler Unsicherheiten nicht von
Angst lähmen zu lassen
Speyer- "Wir bitten um ein gesegnetes
neues Jahr – wir wissen nicht, was kommt", sagte Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann bei seiner Begrüßung zum Pontifikalamt zum
Jahresschluss. Im vollbesetzten Dom zu Speyer verabschiedeten die
Gläubigen am Silvester-Nachmittag gemeinsam mit dem Bischof das
alte Jahr und baten um Gottes Beistand für das neue. In Zeiten
politischer Umbrüche und einer ungewissen Zukunft spendete der
Bischof Zuversicht. Er forderte die Menschen auf, sich nicht
vermeintlich vorbestimmten Situationen zu fügen, sondern mit
Gottvertrauen die Zukunft selbst in die Hand zu nehmen.
In seiner bewegenden und nachdenklich machenden Predigt zeigte
der Bischof Verständnis, dass die zahlreichen unberechenbaren
Situationen auf der Welt, die auch unser Leben beeinflussen, Angst
auslösen. "Es gibt berechtigten Grund zur Sorge", stellte er fest.
"2016 hat sich für mich das Wort Kontrollverlust in den Mittelpunkt
geschoben", sagte Wiesemann und sprach vom Kontrollverlust auf der
Weltbühne, von Demokratien, die sich in Diktaturen wandeln oder vom
um sich greifenden Populismus. Bei dem Grundgefühl des
Kontrollverlustes schwinge Angst und Sorge mit – auch Angst um die
eigene Sicherheit. Das könne die Freiheit einschränken, das eigene
Leben zu entfalten. Mehr noch: "Wie geht es mit dem demokratischen
Engagement weiter?", fragte der Bischof.
Wiesemann machte deutlich, dass das Weltgeschehen und das Leben
jedes Einzelnen miteinander verbunden sind, dies aber keine
Einbahnstraße darstellt. Nicht nur das Weltgeschehen beeinflusst
jeden Menschen – auch jeder Mensch kann mit seinem Handeln in der
Gesellschaft wirken und sie verändern. Er rief auf, sich von der
einschleichenden Angst nicht lähmen zu lassen, sich dem Schicksal
nicht einfach zu ergeben, sondern schwierige Situationen anzunehmen
und die Zukunft selbst zu gestalten. Mit Vertrauen auf Gott gelinge
dies. Glauben befähige zum Vertrauen und das Vertrauen in Gott
spende wiederum eine Kraft, die nicht nur von uns selbst komme,
aber die jeden Einzelnen zum Guten motiviere. Er erinnerte daran,
dass Jesus aufruft, sich "für Liebe, für Wahrheit, für
Gerechtigkeit einzusetzen".
 Als
Gegenbeispiel für mangelndes Vertrauen führte er den Ausspruch "Wir
schaffen das" von Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Dieser Satz
"dient nicht zum Moralappell", erklärte Bischof Wiesemann. Merkels
Satz funktioniere nicht ohne ein tiefes Vertrauen. Dagegen könnten
Gläubige auf Gott bauen, der alles zusammenhalte, so dass die Welt
nicht entgleite. "Gott ist da, der Glaube kann tragen, helfen,
verwandeln, Schicksal in Freiheit wandeln." Jeden Tag feiere die
katholische Kirche mit der Eucharistie eine Wandlung, verdeutlichte
der Bischof. Mit Vertrauen in Gott sollten die Gläubigen den
Jahreswechsel begehen, sagte er und bekräftigte zum Schluss seiner
Predigt: "Gott ist stärker als alle anderen Mächte dieser
Welt."
Als
Gegenbeispiel für mangelndes Vertrauen führte er den Ausspruch "Wir
schaffen das" von Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Dieser Satz
"dient nicht zum Moralappell", erklärte Bischof Wiesemann. Merkels
Satz funktioniere nicht ohne ein tiefes Vertrauen. Dagegen könnten
Gläubige auf Gott bauen, der alles zusammenhalte, so dass die Welt
nicht entgleite. "Gott ist da, der Glaube kann tragen, helfen,
verwandeln, Schicksal in Freiheit wandeln." Jeden Tag feiere die
katholische Kirche mit der Eucharistie eine Wandlung, verdeutlichte
der Bischof. Mit Vertrauen in Gott sollten die Gläubigen den
Jahreswechsel begehen, sagte er und bekräftigte zum Schluss seiner
Predigt: "Gott ist stärker als alle anderen Mächte dieser
Welt."
Die Dommusik unter Leitung von Domkantor Joachim Weller und
Domkapellmeister Markus Melchiori bewies bei dem Gottesdienst
wieder ihr Können. Es sangen der Mädchenchor, die Domsingknaben und
der Domchor. Es spielten die Dombläser sowie Domorganist Markus
Eichenlaub. Die Besucher des Pontifikalamtes erlebten unter anderem
die "Missa brevis in B" von Christopher Tambling, "Tantum ergo
B-Dur" von Anton Bruckner und "Ave verum corpus" von Bernhard
Hemmerle. Text und Fotos: Yvette Wagner
01.01.2017
Hoffnung auf Wandel
 Kirchenpräsident Christian Schad zum Jahreswechsel: Wir
müssen nicht auf das Gestern fixiert bleiben
Kirchenpräsident Christian Schad zum Jahreswechsel: Wir
müssen nicht auf das Gestern fixiert bleiben
Speyer- Christen feiern nach Ansicht von
Kirchenpräsident Christian Schad bei jeder Jahreswende auch die
Hoffnung auf persönliche Veränderung und Verwandlung, die sie zu
dem werden ließen, wozu sie bestimmt seien: „zu Menschen mit
aufrechtem Gang und zu freien Geschöpfen unter dem Himmel“. Im
Gottesdienst am Altjahresabend in der Speyerer Gedächtniskirche
betonte Schad, dass zwar die Hoffnung auf Wandel auch den Zweifel
und die Angst kenne und man sich an das, was gewesen sei, klammere,
„aber Gott sei Dank müssen wir nicht auf das Gestern fixiert
bleiben“.
Aus Ängste und Sorgen wachse nichts Gutes, erklärte der
Kirchenpräsident im Blick auf die Flüchtlingsdebatte und die
Diskussionen nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt.
Jegliche Form von Menschenverachtung sei inakzeptabel, betonte
Schad. Rechtsextreme Ideologen und militante Islamisten strahlten
gleichermaßen eine menschliche Kälte aus, die einen frösteln lasse.
„Sie säen Zwietracht und verbreiten Lügen, die für viele Menschen
nicht mehr von echten Fakten zu unterscheiden sind. Regeln des
Anstands, Grundmaßstäbe des menschlichen Umgangs miteinander
geraten ins Wanken“, sagte Schad.
Angesichts der Ereignisse und der vielen Hiobsbotschaften des zu
Ende gehenden Jahres falle es mitunter schwer, an Gottes Begleitung
und Gegenwart zu glauben. Viele Menschen könnten ihn und seine
Beständigkeit dort nicht erkennen, wo unsägliches Leid, wo Krieg
und Hass und Feindschaft, herrschten. Doch Christus herrsche nicht,
indem er „die Strippen zieht, er ist da, indem er der Bruder der
Menschen wird“, erläuterte der Kirchenpräsident.
Während Christus nach den Worten des Hebräerbriefs „gestern und
heute und derselbe auch in Ewigkeit“ sei (Hebräer 13,8), gelte für
den Menschen, „dass wir noch wandlungsfähig sind, so oft wir uns zu
neuen Ufern aufmachen: aus der Ohnmacht in schöpferische Kraft, aus
der Wut in neuen Mut, aus Schuld zu praktizierter Vergebung, aus
der Starre zu neuem Leben“, sagte Schad.
Hinweis:
Kirchenpräsident Christian Schad predigt in den Gottesdiensten
am Altjahresabend, dem 31. Dezember 2016, um 17 Uhr in der
Gedächtniskirche Speyer und um 19 Uhr in der Mutterhauskapelle der
Ev. Diakonissenanstalt Speyer lk
31.12.2016
„Weihnachtsbotschaft hält der tödlichen Macht des Bösen stand“
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ruft in seiner
Weihnachtspredigt dazu auf, sich mit allen Opfern sinnloser Gewalt
zu solidarisieren – Erinnerung an die mehr als 5000 Flüchtlinge,
die in diesem Jahr im Mittelmeer umgekommen sind
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ruft in seiner
Weihnachtspredigt dazu auf, sich mit allen Opfern sinnloser Gewalt
zu solidarisieren – Erinnerung an die mehr als 5000 Flüchtlinge,
die in diesem Jahr im Mittelmeer umgekommen sind
Speyer- Zahlreiche Gläubige besuchten die
Weihnachtsgottesdienste im Bistum Speyer. Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann bezeichnete in seiner Predigt am ersten
Weihnachtsfeiertag die Weihnachtsbotschaft als eine Vision, die
selbst „den Abgründen und der tödlichen Macht des Bösen“ standhält.
Das über viele Jahrzehnte in den westlichen Ländern vorherrschende
Grundgefühl, dass sich die Lebensmöglichkeiten immer weiter
steigern ließen, habe sich grundlegend verändert. „Ausbeutung,
Korruption und jahrzehntelang ungelöste Konflikte haben Menschen
ohne Zukunftsperspektive hinterlassen.“ Sie hätten Formen und
Organisationen der Gewalt und des Terrors hervorgebracht, die
vorsätzlich eine globale Destabilisierung anzielen. „Kein Tabu,
keine letzte humane Hemmschwelle hat mehr Geltung“, sagte er im
Blick auf die Anschläge auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin und an
der koptisch-orthodoxen Kathedrale in Kairo. „Wir solidarisieren
uns mit allen Opfern solcher Gewalt, welcher Herkunft oder Religion
sie auch sein mögen“, erklärte Wiesemann und gedachte der 3800
Menschen, die allein bis Ende Oktober auf der Flucht vor Hunger und
Gewalt im Mittelmeer umgekommen sind.
Noch nie in der Geschichte sei es so wichtig gewesen, dass
Europa sich seiner gemeinsamen Verantwortung in der Welt und für
die Welt bewusst wird. „Ein Zerfall in kleinkarierte,
angstbesessene Nationalismen kann nicht nur keine Lösung sein,
sondern wäre ein weiteres, folgenschweres Versagen – so  wie die
Welt vor Aleppo und den dortigen Gräuel versagt hat“, betonte der
Bischof in Erinnerung an Robert Schumann, der 1950 visionär
gefordert hatte, dass das wirtschaftliche Zusammengehen in Europa
von einem großen Ziel getragen sein müsse, der Hebung des
Lebensstandards in der gesamten Welt und der Förderung des
Friedens. „Das ist nie wirklich eingelöst worden“, stellte
Wiesemann fest. Vieles von solchen Versäumnissen räche sich jetzt.
„Europa war und ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“
wie die
Welt vor Aleppo und den dortigen Gräuel versagt hat“, betonte der
Bischof in Erinnerung an Robert Schumann, der 1950 visionär
gefordert hatte, dass das wirtschaftliche Zusammengehen in Europa
von einem großen Ziel getragen sein müsse, der Hebung des
Lebensstandards in der gesamten Welt und der Förderung des
Friedens. „Das ist nie wirklich eingelöst worden“, stellte
Wiesemann fest. Vieles von solchen Versäumnissen räche sich jetzt.
„Europa war und ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“
Die Weihnachtsbotschaft sei viel politischer, als es die „Idylle
unserer Krippenlandschaften“ vermuten lasse. In dem Kind von
Bethlehem bündele sich die „ganze Vision einer erlösten, humanen
Welt“. Sie öffne einen Horizont, der nicht an Grenzen halt macht,
und habe eine innere Kraft, die „selbst über hoffnungslos
erscheinende Abgründe des Hasses hinweg mutig und geduldig auf die
Möglichkeit für Versöhnung und Frieden, auf die Teilhabe aller an
den Gütern der Erde und die Einheit und Zukunft des
Menschengeschlechtes setzt“. Es sei alles andere als sentimental
und harmlos, wenn Christen in der Weihnachtsnacht in „die
Totenstille dieser Welt“ hineinriefen: „Christ, der Retter ist
da!“
Unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller gestalteten das Vokalensemble der
Dommusik, der Domchor, der Mädchenchor am Dom, die Speyerer
Domsingknaben, die Capella Spirensis und die Dombläser die
festlichen Weihnachtsgottesdienste im Dom zu Speyer. Die Orgel
spielte Domorganist Markus Eichenlaub. Text: is;
Foto: Klaus Landry
Lesen Sie die Predigt von Bischof Wiesemann 
25.12.2016
Predigt von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Speyer
 Weihnachten 2016 (Hochamt)
Weihnachten 2016 (Hochamt)
Liebe Schwestern und Brüder!
In diesen Tagen geht mir immer wieder ein Gedicht von Werner
Bergengruen durch den Kopf. Es klingt in der aktuellen Situation
ziemlich provozierend, denn es heißt „Heile Welt“:
„Wisse, wenn in Schmerzensstunden
dir das Blut vom Herzen spritzt:
Niemand kann die Welt verwunden,
nur die Schale wird geritzt.
Tief im innersten der Ringe
ruht ihr Kern getrost und heil.
Und mit jedem Schöpfungsdinge
Hast du immer an ihm teil.“
Beim ersten Hören wirkt das Gedicht gerade angesichts der
Gräuel, die sich vor unseren Augen täglich in der Welt ereignen,
angesichts der Opfer und des Leids so vieler, denen unser ganzes
Mitgefühl und unsere Solidarität gilt, schrecklich verharmlosend,
peinlich beschwichtigend. Beim genauen Hinsehen allerdings zeigt
sich ein anderes Bild.
Bergengruen hat das Gedicht unmittelbar im Zusammenhang mit dem
Wahnsinn des II. Weltkrieges und der Hitlerdiktatur aufgeschrieben.
Er war selbst betroffen, hatte er doch eine Frau mit jüdischen
Wurzeln, zu der er fest stand. Und er war ein klarer Gegner des
Naziregimes, der unter anderem auch Flugblätter der „Weißen Rose“
verteilte. Also kann das Gedicht kein naiv, frömmelnd oder gar
verharmlosend dahin gesprochenes Wort von der „heilen Welt“ sein!
Für Bergengruen war die Gefährdung und Verwundung des Lebens durch
den Terror der Naziherrschaft und die Unmenschlichkeit des Krieges
unmittelbar gegenwärtig. Hören wir hinein in ein anderes Gedicht
von ihm aus derselben Zeit mit dem Titel „Die letzte
Epiphanie“:
Ich hatte dies Land in mein Herz genommen,
ich habe ihm Boten um Boten gesandt.
In vielen Gestalten bin ich gekommen.
Ihr aber habt mich in keiner erkannt.
Ich klopfte bei Nacht, ein bleicher Hebräer,
ein Flüchtling, gejagt, mit zerrissenen Schuh‘n.
Ihr riefet dem Schergen, ihr winktet dem Späher
und meintet noch, Gott einen Dienst zu tun.
Ich kam als zitternde, geistesgeschwächte
Greisin mit stummen Angstgeschrei.
Ihr aber spracht vom Zukunftsgeschlechte
und nur meine Asche gabt ihr frei.
Verwaister Knabe auf östlichen Flächen,
ich fiel euch zu Füßen und flehte um Brot.
Ihr aber scheutet ein künftiges Rächen,
ihr zucktet die Achseln und gabt mir den Tod.
Ich kam, ein Gefangener, als Tagelöhner,
verschleppt und verkauft, von der Peitsche zerfetzt.
Ihr wandtet den Blick von dem struppigen Fröner.
Nun komm ich als Richter. Erkennt ihr mich jetzt?
Der Dichter beschreibt, wie Gott selbst das Land und die
Menschen in sein Herz nimmt und sich zu ihnen aufmacht. Aber welche
Gestalt er auch annimmt, er wird nicht erkannt, noch schlimmer: Er
ist sich seines Lebens nirgendwo sicher. Es wird nach seinem Leben
gegriffen: als Jude und Flüchtling, als alter Mensch und „unwert“
eingestuftes Leben, als Kind und der politischen Opportunität
Geopferter. Für Bergengruen ist jedoch unzweifelhaft sicher, dass
in all dem Gericht geschieht. Auch wenn der Täter scheinbar davon
kommt und seine Macht zu triumphieren scheint, das letzte Urteil in
allem spricht Gott selbst, der sich mit den Opfern identifiziert
und sich in ihnen zu erkennen gibt. Er setzt die Wahrheit und das
Recht endgültig in Kraft. Seine letzte Frage ist immer neu an uns
alle gerichtet: „Erkennt ihr mich jetzt?“ An der Erkenntnis des
Gottes, der als Kind und Flüchtling zu uns gekommen ist und als
unwertes Leben ans Kreuz geschlagen wurde, kommt niemand vorbei:
„Alle Augen sehen das Heil unseres Gottes.“ (Jes 52,10)
Aus diesem unerschütterlichen Glauben heraus ist das Gedicht von
der heilen Welt zu lesen, nur so kann man es verstehen. In diesen
Zeilen steckt ein gewaltiger, entschlossener Trotz, der sich gegen
die tiefe Verletzung der Welt aufrichtet und der Macht des Bösen
nicht das Recht zubilligt, unsere Lebenswelt im letzten zu
bestimmen. Eine mutige, visionäre Lebenskraft, die dem Mörder nicht
die Macht zugesteht, die Wahrheit auf ewig zu verdrehen, die Angst
und den Krieg zum Vater aller Dinge zu erklären, das Leben bis in
die innerste Wurzel hinein zu tyrannisieren und die Welt aus den
Fugen heben zu können. Ein ungebrochener Wille zur Gerechtigkeit,
den Opfern die Würde zurückzugeben und den Gedemütigten,
Misshandelten, Vertriebenen das Recht. Nein, kein Hass kann mich
zum Hassen zwingen, keine Macht dieser Welt kann die Wahrheit, die
Gerechtigkeit und auch nicht die Liebe außer Kraft setzen. „Niemand
kann die Welt verwunden, nur die Schale wird geritzt.“ Für mich ist
das ein in der Kraft des Glaubens gegründetes Aufstehen gegen die
Macht des Terrors, der Aufruf, jetzt erst recht gemeinsam
aufzustehen zum Leben!
Werner Bergengruen ist 1964 gestorben. Nur wenige Jahre später
waren seine vorher vielgelesenen Werke ähnlich wie die seines
Freundes Reinhold Schneider fast vollständig aus der öffentlichen
Wahrnehmung verschwunden. Er galt nach 1968 als nicht mehr
zeitgemäß wegen seiner ungebrochenen Glaubensüberzeugung, dass Gott
die Welt gut geschaffen habe – und keine Macht dieser Welt sie so
abgründig verwunden könne, dass der Sinn, die Wahrheit und die
Schönheit des Daseins zerstört werden. Das gläubige Grundgefühl der
Dankbarkeit wurde als restaurativ empfunden gegenüber dem
vorherrschenden Ziel, die Gesellschaft modern umzugestalten. Wir,
die wir nach dem Krieg geboren sind, sind aufgewachsen mit einem
Grundgefühl gesicherten Wohlstands und fast grenzenlos scheinender
Freiheit. Es gab – Gott sei Dank – kaum noch gemeinsame Erfahrungen
von Hunger, Not und Überlebensangst, höchstens wenn Oma oder Opa
von früher erzählten. Die Lebensmöglichkeiten und Lebenserwartungen
erschienen immer weiter steigerungsfähig.
Das alles hat sich grundlegend geändert. Die
Flüchtlingsbewegungen zeigen, dass sich die Lebenswelten der
Menschen nicht mehr auseinanderhalten lassen. In diesem Jahr 2016
sind wieder nochmals mehr Menschen im Mittelmeer umgekommen, bis
Ende Oktober waren es allein 3800. Ausbeutung, Korruption und
jahrzehntelang ungelöste Konflikte haben unzählige Menschen ohne
Zukunftsperspektive hinterlassen und Formen und Organisationen der
Gewalt und des Terrors hervorgebracht, die nicht mehr lokal
begrenzt sind, sondern vorsätzlich die globale Destabilisierung
anzielen. Kein Tabu, keine letzte humane Hemmschwelle ist mehr in
Geltung. Brutale Anschläge sollen bewusst unschuldige Menschen
treffen, wie erst kürzlich auf dem Weihnachtsmarkt in Berlin oder
an der koptisch-orthodoxen Kathedrale in Kairo. Wir solidarisieren
uns mit allen Opfern solcher sinnloser Gewalt, welcher Herkunft
oder Religion sie auch sein mögen. Wir fühlen uns zutiefst
verbunden mit den unzähligen Brüdern und Schwestern im Glauben, die
bedrängt und verfolgt werden.
Liebe Schwestern und Brüder, die Probleme lassen sich nur in
gemeinsamer Verantwortung lösen. Schon Robert Schuman, einer der
Gründungsväter des neuen Europa, hatte nach dem Krieg von der
großen Aufgabe Europas im Hinblick auf den vergessenen Kontinent
Afrika gesprochen. In einer historischen Rede vom 9.Mai 1950, die
als Gründungsurkunde des geeinten Europas gilt, sagte er:
„Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne
schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung
entsprechen.“ Und dann führte er visionär aus, dass das
wirtschaftliche Zusammengehen von einem großen Ziel getragen sein
muss: „Diese Produktion wird der gesamten Welt ohne Unterschied und
Ausnahme zur Verfügung gestellt werden, um zur Hebung des
Lebensstandards und zur Förderung der Werke des Friedens
beizutragen. Europa wird dann mit vermehrten Mitteln die
Verwirklichung einer seiner wesentlichsten Aufgaben verfolgen
können: die Entwicklung des afrikanischen Erdteils.“
Das ist nie wirklich eingelöst worden. Vieles von solchen
Versäumnissen rächt sich jetzt. Europa war und ist viel zu sehr mit
sich selbst beschäftigt. Ich bin davon überzeugt, dass es in der
Geschichte noch nie so wichtig war, dass Europa sich seiner
gemeinsamen Verantwortung in der Welt und für die Welt bewusst
wird. Ein Zerfall in kleinkarierte, angstbesessene Nationalismen
kann nicht nur keine Lösung sein, sondern wäre ein weiteres,
folgenschweres Versagen – so wie die Welt vor Aleppo und den
dortigen Gräuel versagt hat.
Dazu braucht es aber eine Vision, wie sie der gläubige Christ
Robert Schuman gehabt hat, eine Vision, die aus einer Kraft lebt,
die der Größe und Macht der Bedrohung nicht nur standhalten kann,
sondern neue hoffnungsvolle Perspektiven aufweist. Das ist in der
verfahrenen Situation der Welt schwer, aber – und hier trifft für
mich einmal das Wort – alternativlos. Was ist das für eine Vision?
Sie muss auf jeden Fall die Kraft haben, Menschen
zusammenzubringen, ihren Zusammenhalt und ihre Verantwortung
füreinander zu stärken, statt zu spalten und sie gegeneinander
aufzuhetzen. Sie braucht einen universalen Geist und Horizont, der
nicht an den Grenzen halt macht. Das allein entspricht dem großen
christlichen und humanistischen Erbe Europas: dass die Freiheit und
die Gleichheit in der Würde für jeden Menschen gilt und wir alle
Brüder und Schwestern sind, Kinder des einen Vaters im Himmel.
Diese Vision braucht schließlich eine innere Kraft, die selbst über
hoffnungslos erscheinende Abgründe des Hasses hinweg mutig und
geduldig auf die Möglichkeit für Versöhnung und Frieden, auf die
Teilhabe aller an den Gütern der Erde und die Einheit und Zukunft
des Menschengeschlechtes setzt.
Das alles aber ist mehr als eine Strategie. Solche Vision
braucht eine innere Kraft, braucht einen Glauben, der Menschen
bewegt, dafür ihre Lebenskraft einzusetzen. Eine solche Vision
finden wir in der Weihnachtsbotschaft. Der Bericht von der Geburt
Jesu ist viel politischer, als wir es von der Idylle unserer
Krippenlandschaften kennen. Er steht im bewussten Kontrast zur
Geburt des römischen Kaisers, des Herrschers über die damals
bekannte Welt. Die ganze Vision einer erlösten, humanen Welt
bündelt sich in diesem Kind von Betlehem. Darin, dass Gott selbst,
der Schöpfer der Welt, einer von uns wird – und sich so mit der
ganzen Menschheit verbindet und uns gegenseitig zu Brüdern und
Schwestern macht. Es ist das Aufstrahlen des Gottes, der sich in
seinem Sohn selbst in die abgründigen Konflikte dieser Welt wagt,
der sich verwundbar macht aus Liebe zu allen Menschen. Der bis ins
Letzte auf Versöhnung und Frieden setzt und dafür nicht nur in der
„Schale“ geritzt wird. Aber das Lamm, das geschlachtet ist – es
lebt! Es ist der Richter der Welt. Solchen Abgründen vermag nur der
Glaube standzuhalten. Er eröffnet die Vision, die der tödlichen
Macht des Bösen nicht das letzte Wort lässt. Darum legten unsere
Vorfahren das Geburtsfest Jesu auf den Tag des „Sol invictus“, des
unbesiegbaren Sonnengottes, dessen Licht auch von der größten
Finsternis nicht verschluckt werden kann.
Wenn wir „Stille Nacht, heilige Nacht“ singen, dann mag das
sentimental und recht harmlos klingen. Es erhält aber eine ganz
andere Dimension, wenn wir uns bewusst werden, was wir in die
Totenstille dieser Welt hineinrufen: „Christ, der Retter ist
da!“
25.12.2016
Weihnachten als Trost und Ermutigung zur Zivilcourage

Schad und Gärtner rufen dazu auf, die Spirale von Gewalt
und Gegengewalt zu durchbrechen
Speyer/Herschweiler-Pettersheim- Kirchenpräsident
Christian Schad hat im Weihnachtsgottesdienst dazu ermutigt, mit
Zivilcourage gegen Größenwahn und die verführerischen Parolen von
Populisten und Nationalisten aufzustehen. Die Geburt Jesu in einem
Stall in Bethlehem, „ganz unten bei den Habenichtsen und
Vergessenen, bei den Opfern von Terror und Gewalt“, sei ein Symbol
dafür, dass die Spirale von Gewalt und Gegengewalt in der Welt
durchbrochen werden könne, sagte Schad in seiner Predigt am ersten
Weihnachtsfeiertag in der Speyerer Gedächtniskirche. Oberkirchenrat
Gärtner, der am 26. Dezember in Herschweiler-Pettersheim predigt,
ruft anlässlich des Weihnachtsfestes dazu auf, im Vertrauen auf
Gottes Liebe auf Gewalt mit Verzeihen zu antworten.
„Wir geben dem Terror nicht dadurch Recht, dass wir uns
entzweien lassen, nur weil wir aus unterschiedlichen Kulturen
stammen oder auf verschiedene Weise unseren Glauben leben.“ Mit
diesen Worten ging Kirchenpräsident Schad auf den jüngsten Anschlag
in Berlin ein: „Nein, wir lassen uns nicht zur Unmenschlichkeit
verführen. Die Kraft der Versöhnung ist stärker als der Hass. Diese
Botschaft ist unser Trost. Mit ihr“, so ermutigte Christian Schad,
„können wir leben und werden wir leben und die Gewalt
überwinden.“
Die biblische Geschichte von Bethlehem könne den Menschen auch
Mut machen, die Angst vor der eigenen Schwäche zu überwinden. Die
Gesellschaft sei aufgerufen, denjenigen zu widerstehen, die ein
Bollwerk gegen Vielfalt, gegen alles Fremde und Bedrohliche
errichten und sich zu Führern eines neues Nationalismus erheben
wollten, führte der Kirchenpräsident weiter aus.
Das Geschehen von Bethlehem, dem „unscheinbaren Ort in der
Provinz“, aus dem der Retter der Welt kam, schärfe das Gewissen:
„Hier bekommen wir ein Gefühl für Gerechtigkeit, da entwickeln wir
den Mut und die Kraft, dem Ungeist des Vereinfachens und Spaltens
zu widerstehen“, bekräftigte der Kirchenpräsident. Die Geburt Jesu
in einer Krippe fordere die Christen dazu auf, hinabzusteigen –
dorthin, wo es an allem fehle, wo Armut und Krankheiten wohnten
„und die Angst lauert“. Bethlehem sei daher auch ein Symbol für die
Flüchtlingslager und Elendsviertel dieser Erde. Hier zeige sich
nicht ein diffuser Gott, sondern der Herr der Welt: „Gottes Macht,
die den geschlossenen Zeithorizont zerbricht ‚von Anfang an und von
Ewigkeit her‘.“
Gerade angesichts allgegenwärtiger Angst und Gewalt sei das
Vertrauen auf Gottes Liebe umso wichtiger, sagte Oberkirchenrat
Michael Gärtner vor dem Hintergrund des jüngsten Terroranschlages.
„Wir werden unsere gewohnten Wege weiter gehen im Vertrauen darauf,
dass uns nichts von ihr scheiden kann. Menschen, die hassen und
töten sind Gottes Kinder wie wir – verirrte Kinder, aber seine
Kinder.“ Es gehe um das, was die Bibel Bewährung nenne: „Wir beten
immer zugleich für die Opfer und die Täter, für die Leidenden und
die Getriebenen.“ Text und Foto: lk
25.12.2016
Helmut Kohl zum vorweihnachtlichen Besuch im Dom zu Speyer
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Domkustos Peter
Schappert bereiten Altkanzler Kohl und seiner Frau einen warmen
Empfang mit Orgelmusik
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Domkustos Peter
Schappert bereiten Altkanzler Kohl und seiner Frau einen warmen
Empfang mit Orgelmusik
Speyer- Manches ändert sich nie und sind
die Zeiten noch so turbulent - und vielleicht ist dies auch deshalb
so eindringlich: Mit Freude und bewegt empfingen in den frühen
Abendstunden des 20. Dezember der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann und, als Vertreter des Domkapitels, Domkustos Peter
Schappert Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl und seine Ehefrau Dr.
Maike Kohl-Richter zu einem vorweihnachtlichen Besuch in der mit
Krippe und Kerzen und Tannenbäumen adventlich geschmückten und
weihnachtlich erstrahlenden Kathedrale. Vor fast genau einem Jahr
war der Altkanzler, der gesundheitlich angeschlagen und selten in
der Öffentlichkeit zu sehen ist, zuletzt im Dom gewesen. Auch in
diesem Jahr wollte er darauf keinesfalls verzichten, zumal es ihm
nach eigenem Bekunden wieder besser geht. Sein erster Weg führte
ihn, wie immer, vor den Altar und das Marienbildnis. Gemeinsam mit
dem Bischof betete das Ehepaar Kohl hier das „Vater unser“ und das
„Gegrüßet seist Du Maria“. Sie besichtigten die Weihnachtskrippe,
die im südlichen Seitenschiff gerade aufgebaut wird, und zündeten
gemeinsam in Stille eine Kerze an - eine Kerze für den Frieden in
der Welt.
Anschließend lauschten sie den Klängen der großen Domorgel.
Domorganist Markus Eichenlaub intonierte Choralbearbeitungen des
englischen Komponisten Robert Jones und spielte klassische Advents-
und Weihnachtslieder, darunter „Stille Nacht, Heilige Nacht“, das
traditionell auch in der Christmette erklingt. Zur sichtlichen
Freude des Altkanzlers ließ er zudem die berühmte Toccata in d-Moll
von Johann Sebastian Bach erklingen. Das Werk ist bei früheren
Besuchen Helmut Kohls mit Staatsgästen im Speyerer Dom regelmäßig
gespielt worden.
Der ehemalige Bundeskanzler ist der romanischen Kathedrale seit
seiner Kindheit eng verbunden. In seiner Amtszeit als
Regierungschef hat Helmut Kohl zahlreiche ausländische Staatsgäste
nach Speyer und in den Dom geführt, darunter Margaret Thatcher,
Michael Gorbatschow, George Bush, Vaclav Havel, Boris Jelzin und
König Juan Carlos. In der Ausstellung "Weltbühne Speyer" im
Historischen Museum der Pfalz in Speyer sind Fotos dieser Besuche
bis Herbst 2017 zu sehen. Am Beispiel des europäischen Kaiserdoms
hat Helmut Kohl seit jeher die Bedeutung des christlichen Glaubens
für ein Zusammenleben in Frieden und Freiheit in Deutschland,
Europa und der Welt verdeutlicht und dabei klar gemacht, dass
Europa nicht nur in Brüssel und Straßburg, sondern überall in
Europa stattfindet. Für Helmut Kohl ist der Dom Sinnbild des
geeinten Europas und seiner christlichen Wurzeln. Mit seinem
Engagement für die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer, dessen
Kuratoriumsvorsitzender er bis heute ist, hat er zugleich
entscheidend dazu beigetragen, dass das zentrale Bauwerk dauerhaft
erhalten werden kann. Und so war bei seinem Adventsbesuch vor allem
wieder eines spürbar: Für Helmut Kohl ist der Dom eine
Herzensangelegenheit. Seinen Besuch hatte er mit dem Bischof schon
vor Wochen vereinbart. Text: is; Foto: Bistum Speyer / Klaus
Landry
21.12.2016
Helmut Kohl zum vorweihnachtlichen Besuch im Dom zu Speyer - Bilderalbum
 v.l.: Domkustos Peter Schappert, Dr. Maike Kohl-Richter, Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Domorganist Markus Eichenlaub.
v.l.: Domkustos Peter Schappert, Dr. Maike Kohl-Richter, Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Domorganist Markus Eichenlaub.
|
 v.l.: Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl, Dr. Maike Kohl-Richter und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
v.l.: Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl, Dr. Maike Kohl-Richter und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
|
 v.l.: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut und Kohl und Dr. Maike Kohl-Richter an der Weihnachtskrippe im südlichen Seitenschiff des Speyerer Doms
v.l.: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut und Kohl und Dr. Maike Kohl-Richter an der Weihnachtskrippe im südlichen Seitenschiff des Speyerer Doms
|
Kirchen rufen zu „Beten für Berlin“ und Schweigeminute auf

Speyer/Darmstadt- Evangelische Kirchen
und katholische Bistümer in Hessen und Rheinland-Pfalz haben nach
dem Anschlag in Berlin für Dienstagabend um 18 Uhr dazu aufgerufen,
sich an der bundesweiten Schweigeminute auf den Weihnachtsmärkten
zu beteiligen. Dort sollen für drei Minuten die Lichter erlöschen.
Zudem regten sie unter dem Titel „Beten für Berlin“ Gemeinden an,
um 18 Uhr ihre Kirchen für Andachten zu öffnen. Parallel dazu
findet in Berlin ein Gedenkgottesdienst statt.
Bisher beteiligen sich an der Aktion die Evangelische Kirche in
Hessen und Nassau, die Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck,
die Evangelische Kirche der Pfalz sowie das Bistum Limburg. Die
Idee ging von der Schaustellerseelsorge aus. Im Internet werden für
die Andachten Materialien wie Gebetstexte bereitgestellt, die das
Zentrum Verkündigung in Frankfurt entworfen hat: www.ekhn.de.
Kirchenpräsident Christian Schad hatte bereits am Vormittag dazu
aufgerufen, für die Anschlagsopfer von Berlin zu beten. „Lass nicht
zu, dass wir uns vom Hass spalten lassen, sondern lass uns für den
Frieden zusammenstehen", schrieb der Kirchenpräsident in einer
Fürbitte. Schad zeigte sich zutiefst erschüttert darüber, dass
friedlich feiernde Menschen auf dem Weihnachtsmarkt vor der Ruine
der Berliner Gedächtniskirche, einem Mahnmal des Friedens,
attackiert worden seien.
Der Rundfunkbeauftragte beim Saarländischen Rundfunk (SR),
Pfarrer Dejan Vilov, hatte am Morgen im „Zwischenruf“ bei SR 3
erklärt, dass trotz des schrecklichen Geschehens Weihnachten
gefeiert werden solle, „indem wir genau auf das hören, was der
Engel in der Weihnachtsgeschichte den Hirten gesagt hat: Fürchtet
Euch nicht. Habt keine Angst“. Die Hirten hätten die Angst
überwunden und seien zum Stall gegangen „und haben sich da anrühren
lassen von diesem für sie fremden Kind“, sagte Vilov. Gerade in der
aktuellen Situation „müssen auch wir uns anrühren lassen von diesem
Jesuskind. Und mit ihm von anderen Menschen und ihren Schicksalen,
egal woher sie kommen und wo sie leben“. Der Rundfunkpfarrer ist
heute von 20 bis 23 Uhr Gesprächspartner für Hörer auf SR 3 in
einer Sondersendung des Saarländischen Rundfunks zu den Berliner
Ereignissen. Text und Foto: lk /ekhn
20.12.2016
Kirchenpräsident ruft zum Gebet für die Anschlagsopfer von Berlin auf
Gott ist im Dunkel an unserer Seite – die Botschaft der
Weihnachtsengel gilt uns: „Fürchtet euch nicht!“
Speyer- Der Anschlag in Berlin erschüttert mich
zutiefst. Menschen freuen sich auf das Weihnachtsfest. Sie kommen
zusammen auf dem Weihnachtsmarkt vor der Berliner Gedächtniskirche
– der Kirche, die als Ruine Mahnmal des Friedens ist und in der
täglich um die Mittagszeit ein Friedensgebet gehalten wird.
Menschen in weihnachtlicher Stimmung wurden Opfer einer gnadenlosen
Tat in gnadenbringender Zeit. Nicht auszudenken das Dunkel, das die
Familien nun umfasst, die ihre Liebsten verloren haben oder um sie
bangen. Als Christinnen und Christen tragen wir unsere Klage vor
Gott. Wir sind mit den Opfern und ihren Angehörigen im Gebet und in
der Trauer vereint.
Jochen Kleppers Adventslied drückt aus, was ich empfinde: „Noch
manche Nacht wird fallen auf Menschenleid und -schuld. Doch wandert
nun mit allen der Stern der Gotteshuld. Beglänzt von seinem Lichte,
hält euch kein Dunkel mehr, von Gottes Angesichte kam euch die
Rettung her.“ Kommen wir zusammen und beten wir für die Opfer und
ihre Angehörigen.
Fürbitte:
Kein Wort, das das Entsetzen ausdrücken könnte.
Ein Dutzend ermordete Menschen, mehrere Dutzend Verletzte in
Berlin.
Tiefstes Dunkel inmitten weihnachtlicher Stimmung.
Ewiger Gott,
wir beten für die Getöteten.
Lass sie geborgen sein in deinem Licht.
Sei bei den Opfern, den Angehörigen und Verzweifelten.
Schenke ihnen Trost, Kraft und Liebe.
Stelle ihnen Menschen zur Seite, die in ihrem Schmerz und in
ihrer Trauer bei ihnen sind.
Wir bitten um Stärke für die Krankenschwestern, die Ärztinnen
und Ärzte und alle Helfer, die sich um sie kümmern.
Lass nicht zu, dass wir uns vom Hass spalten lassen,
sondern lass uns für den Frieden zusammen stehen.
Schenke den Politikern und Verantwortlichen
die Behutsamkeit, die Weisheit und Besonnenheit,
dem Frieden und dem Leben der Menschen zu dienen.
Gott, wir haben Angst.
Du aber kennst das Dunkel dieser Welt –
Du selbst willst darin wohnen
und hast es dadurch erhellt.
Lass uns dies spüren, denn der Terror hört nicht auf.
Wir sind davon nicht ausgenommen,
sondern im Dunkel des Todes
mit vielen Menschen weltweit vereint.
In das Schweigen der Angst rufen uns deine Weihnachtsengel
zu:
„Fürchtet euch nicht! … denn euch ist heute der Heiland
geboren,
welcher ist Christus, der Herr.“
Wir bitten dich, Gott:
Stell deine Engel um uns.
Lass das Dunkel nicht Macht über uns gewinnen.
Lass uns zu Lichtträgern deiner Weihnachtsbotschaft werden
für alle Verängstigten und Geplagten.
Stellvertretend für alle Opfer der Gewalt denken wir
in dieser Stunde ganz besonders
an die Kinder, Frauen und Männer in Aleppo.
Gott, wir bitten dich für die, deren Herz vom Hass verfinstert
ist:
Trage dein Licht in die dunklen Herzen der Menschen ein,
die verlernt haben, zu lieben,
die verlernt haben, die Würde der Menschen zu achten,
die verlernt haben, dem Leben zu dienen.
Schenke ihnen ein neues Herz und einen neuen Geist.
Gott des Friedens und der Liebe, bleibe du bei uns,
bleibe bei denen, die deinen Trost in ihrer Trauer jetzt ganz
besonders nötig haben.
Amen.
20.12.2016
Großzügiges Weihnachtsgeschenk von Gudrun und Töns Wellensiek
Bilderverkauf aus dem Nachlass Barbig dank einer
Einzelspende erfolgreich abgeschlossen
Speyer- Nach dem erfolgreichen Start am ersten
Advent, an dem 1250 Euro durch den Verkauf von Bildern aus dem
Nachlass der Malerin Ilse Barbig erlöst wurden, war das Interesse
an den folgenden Adventssonntagen leider deutlich geringer.
Ziel war es, 5000 Euro zu sammeln, um ein Emporenbild der
Dreifaltigkeitskirche zu sanieren. Hierfür hatte die
Kunsthistorikerin Cornelia Vagt-Beck auf Anregung von
Alt-Oberbürgermeister Werner Schineller Bilder aus dem Nachlass von
Ilse Barbig zu günstigen Preisen zur Verfügung gestellt.
Letztlich waren kurz vor Ende der Verkaufszeit 1860 Euro
beisammen, ein stolzer Betrag, wenn auch noch nicht ausreichend für
den angestrebten Zweck.
„Wir hatten kurz vor 16 Uhr schon begonnen zusammen zu packen
und uns Gedanken zu machen, wann und mit welcher Aktion wir weiter
Bilder verkaufen, um den fehlenden Restbetrag zu erwirtschaften“,
erklärte der Vorsitzende des Bauvereins Dreifaltigkeitskirche,
Henri Franck. „Da kam das Ehepaar Gudrun und Töns Wellensiek und
spendete spontan die fehlenden 3140 Euro. So verhalfen sie der
Aktion in letzter Minute zum Erfolg und bedankt sich ganz herzlich
für dieses großzügige Weihnachtsgeschenk.“. Henri
Franck
19.12.2016
Modernste LED-Technik macht's möglich
 Neue Beleuchtung für den Dom zu Speyer -
Gotteshaus und UNESCO-Welterbestätte erstrahlt in neuem
Licht
Neue Beleuchtung für den Dom zu Speyer -
Gotteshaus und UNESCO-Welterbestätte erstrahlt in neuem
Licht
spk. Speyer- Rechtzeitig zum Weihnachtsfest erhält
der Speyerer Dom ein neues Lichtkleid: Die alte Beleuchtungsanlage,
die noch aus den 1960er Jahren stammte, ist abgebaut, die neue
Anlage installiert und weitgehend justiert. Erstmals zum 4. Advent
am kommenden Sonntag wird sich die Kathedrale in einem neuen, eher
dezent gehaltenen Beleuchtungsgewand für die Fastenzeit darstellen
- die große Festbeleuchtung wird dann am „Heiligen Abend“
erstrahlen und den altehrwürdigen Kaiser-und Mariendom wie eine
„Festung des Glaubens“ weithin in die Pfalz und ins Badische hinein
erglänzen wird.“ Ich freue mich sehr“, bekannte Domkustos Peter
Schappert, „dass der Dom noch vor Weihnachten eine für ihn
maßgeschneiderte Außenbeleuchtung erhält, die ästhetisch und
technisch auf dem neuesten Stand ist“
 Zu verdanken sei dies zum einen der finanziellen
Unterstützung durch die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer
und den beiden großzügigen Einzelspendern Isolde
Laukien-Kleiner und Dr. Manfred Fuchs, zum anderen der
Stadt Speyer und ihren Stadtwerken SWS, bei der Präsentation der
neuen Beleuchtungsanlage im „Blauen Salon“ des Bischöflichen
Ordinariats, vertreten durch Oberbürgermeisters Hansjörg
Eger und SWS-Geschäftsführer Wolfgang
Bühring, dem Schappert insbesondere für das gute Einvernehmen
über die Kosten des Unterhalts der Anlage sowie für die
Unterstützung bei der technischen Realisierung des Projekts
dankte.
Zu verdanken sei dies zum einen der finanziellen
Unterstützung durch die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer
und den beiden großzügigen Einzelspendern Isolde
Laukien-Kleiner und Dr. Manfred Fuchs, zum anderen der
Stadt Speyer und ihren Stadtwerken SWS, bei der Präsentation der
neuen Beleuchtungsanlage im „Blauen Salon“ des Bischöflichen
Ordinariats, vertreten durch Oberbürgermeisters Hansjörg
Eger und SWS-Geschäftsführer Wolfgang
Bühring, dem Schappert insbesondere für das gute Einvernehmen
über die Kosten des Unterhalts der Anlage sowie für die
Unterstützung bei der technischen Realisierung des Projekts
dankte.
Schon seit dem Jahr 2011 habe es Pläne gegeben, die
Illumination der romanischen Kathedrale zu erneuern, um sie auf
einen aktuellen technischen Stand zu bringen und die ästhetische
Wirkung der Inszenierung des Bauwerks zu verbessern, erinnerte
Domkustos Schappert. Den im Jahre 2011 ausgeschriebenen Wettbewerb
zur Neugestaltung der Außenillumination habe das Ingenieurbüro
Bamberger aus Pfünz bei Eichstätt für sich entscheiden können - der
wissenschaftliche Beirat der Stiftung agierte als Fachjury.
 Die Gesamtkosten für Anschaffung und Aufbau der Anlage
lägen bei 380.000 Euro, so der Domkustos weiter. Die Initiative zu
Anschaffung und Aufbau der Anlage sei ein Förderprojekt der
„Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ gewesen, welche die
neue Außenbeleuchtung mit einer Zuwendung in Höhe von 300.000 Euro
ermöglicht habe. Diese Summe setze sich aus zwei Einzelspenden aus
den Reihen der Stifter und aus Stiftungserträgen zusammen. „Das
Domkapitel ist den beiden Spendern, Isolde Laukien-Kleiner und dem
Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Dr. Manfred
Fuchs, für ihre finanzielle Unterstützung zu großem Dank
verpflichtet“, so Domkustos Peter Schappert bei der Vorstellung des
neuen Beleuchtungskonzepts weiter. Die Stadt Speyer schließlich
gewähre für die Maßnahme eine Zuwendung in Höhe von 80.000
Euro.
Die Gesamtkosten für Anschaffung und Aufbau der Anlage
lägen bei 380.000 Euro, so der Domkustos weiter. Die Initiative zu
Anschaffung und Aufbau der Anlage sei ein Förderprojekt der
„Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ gewesen, welche die
neue Außenbeleuchtung mit einer Zuwendung in Höhe von 300.000 Euro
ermöglicht habe. Diese Summe setze sich aus zwei Einzelspenden aus
den Reihen der Stifter und aus Stiftungserträgen zusammen. „Das
Domkapitel ist den beiden Spendern, Isolde Laukien-Kleiner und dem
Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Dr. Manfred
Fuchs, für ihre finanzielle Unterstützung zu großem Dank
verpflichtet“, so Domkustos Peter Schappert bei der Vorstellung des
neuen Beleuchtungskonzepts weiter. Die Stadt Speyer schließlich
gewähre für die Maßnahme eine Zuwendung in Höhe von 80.000
Euro.
Zwischen der Stadt Speyer und dem Domkapitel Speyer bestehe seit
dem 11.11.2015 ein Vertrag, der die Finanzierung für Aufbau und
Unterhalt der neuen Außenbeleuchtung des Doms regele. In der
Vergangenheit sei die Beleuchtung mit Unterstützung der Stadt und
den Stadtwerken Speyer betrieben worden. Mit der Unterzeichnung der
neuen Vereinbarung teilen sich Domkapitel und Stadt weiterhin die
Unterhaltskosten und die Verantwortung für die Außenbeleuchtung der
Kathedralkirche.
 Mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung der Kathedrale
und „UNESCO-Welterbestätte Dom zu Speyer“ würden zugleich mehrere
Ziele erreicht, so der Geschäftsführer der bauausführender Firma
Bamberger, Diplom-Ingenieur Werner Bamberger in seiner
Vorstellung des Projekts. Zum einen ermögliche es die neue
Beleuchtung, die plastische Wirkung des romanischen Baukörpers
stärker heraus zu arbeiten. Dies werde durch Bodenstrahler und
Flächenleuchten im Außenbereich und innerhalb der Türme erreicht.
Die im Außenbereich positionierten Strahler haben aus Rasterfolien
geschnittene Masken erhalten, so dass der Scheinwurf individuell
auf den jeweiligen Bereich des Doms angepasst ist. „Der Dom erhält
damit eine für ihn maßgeschneiderte Beleuchtung“, so Bamberger. Die
moderne LED-Beleuchtung und die Vernetzung der einzelnen Strahler
ermögliche zum anderen eine dynamische, das heißt
den Nachtzeiten und Lichtverhältnissen angepassten Steuerung
der Beleuchtung. Dies diene dann auch dem dritten Ziel des neuen
Beleuchtungskonzepts: Durch die Erneuerung der in die Jahre
gekommenen technischen Infrastruktur werde die Energieeffizienz
erhöht und damit der Stromverbrauch verringert.
Mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung der Kathedrale
und „UNESCO-Welterbestätte Dom zu Speyer“ würden zugleich mehrere
Ziele erreicht, so der Geschäftsführer der bauausführender Firma
Bamberger, Diplom-Ingenieur Werner Bamberger in seiner
Vorstellung des Projekts. Zum einen ermögliche es die neue
Beleuchtung, die plastische Wirkung des romanischen Baukörpers
stärker heraus zu arbeiten. Dies werde durch Bodenstrahler und
Flächenleuchten im Außenbereich und innerhalb der Türme erreicht.
Die im Außenbereich positionierten Strahler haben aus Rasterfolien
geschnittene Masken erhalten, so dass der Scheinwurf individuell
auf den jeweiligen Bereich des Doms angepasst ist. „Der Dom erhält
damit eine für ihn maßgeschneiderte Beleuchtung“, so Bamberger. Die
moderne LED-Beleuchtung und die Vernetzung der einzelnen Strahler
ermögliche zum anderen eine dynamische, das heißt
den Nachtzeiten und Lichtverhältnissen angepassten Steuerung
der Beleuchtung. Dies diene dann auch dem dritten Ziel des neuen
Beleuchtungskonzepts: Durch die Erneuerung der in die Jahre
gekommenen technischen Infrastruktur werde die Energieeffizienz
erhöht und damit der Stromverbrauch verringert.
Letzteres sehe das Domkapitel auch als wichtige Maßnahme im
Sinne einer ökologischen Verantwortung, wie sie Papst Franziskus in
seiner Enzyklika „Laudato si“ fordere, so Domkapitular Peter
Schapppert. Erreicht werde dieser Effekt durch den Einsatz
modernster LED Technik. Diese diene zudem dem Tierschutz, da das
Lichtspektrum so gestaltet wird, dass Vögel, wie der Wanderfalke,
nicht irritiert werden.
Die neue Außenbeleuchtung bestehe aus etwa 40 Bodenstrahlern,
85 Strahlern an Lichtmasten, sowie 43 in den Türmen
positionierten Leuchten, so Werner Bamberger weiter. Aus Gründen
der Nachhaltigkeit seien dazu die bereits bestehenden Lichtmasten
weiter verwendet worden. Die Bodenstrahler und die Leuchten in den
Türmen seien neu hinzugekommen, um von einer vormals flächigen
Anstrahlung zu einer Beleuchtungssituation zu kommen, welche die
Plastizität und Besonderheiten des Baus erkennen lässt. Der
Vierungsturm, unter dem sich der Hauptaltar befindet, erfahre dabei
durch Leuchten in der Zwerggalerie eine besondere Betonung.
 Dank der neuen LED-Lampen liege der Stromverbrauch heute
nur noch bei einem Drittel der vorherigen Energiemenge, obwohl die
Anzahl der Strahler um das Fünffache erhöht worden sei, berichtete
Dombaumeister Mario Coletto. Die neue Beleuchtung solle
damit sowohl dem Gotteshaus als auch dem Denkmal besser gerecht
werden, indem markante Bauteile und theologisch wichtige
Gestaltungselemente wie die Heiligenfiguren über dem Hauptportal
stärker betont werden.
Dank der neuen LED-Lampen liege der Stromverbrauch heute
nur noch bei einem Drittel der vorherigen Energiemenge, obwohl die
Anzahl der Strahler um das Fünffache erhöht worden sei, berichtete
Dombaumeister Mario Coletto. Die neue Beleuchtung solle
damit sowohl dem Gotteshaus als auch dem Denkmal besser gerecht
werden, indem markante Bauteile und theologisch wichtige
Gestaltungselemente wie die Heiligenfiguren über dem Hauptportal
stärker betont werden.
Zu den technischen Voraussetzungen für die neue Illumination des
Doms habe auch das Herstellen neuer Leitungen und einer
Glasfaserverkabelung im Außenbereich des Doms gezählt. Ziel sei
dabei die Gesamtvernetzung der Anlage mit der Möglichkeit einer
zentralen Beleuchtungssteuerung gewesen. Für die Vernetzung hätten
im Mai des Jahres 2015 Voruntersuchungen stattgefunden. Im Frühjahr
des Jahres 2016 wurde die Maßnahme ausgeschrieben. Im Oktober 2016
begannen die Bodenarbeiten.
Mit Stand vom 15. November schließlich seien alle Strahler
soweit installiert gewesen, dass eine Probebeleuchtung des gesamten
Baus möglich war. Im Rahmen der Jahrestagung der „Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ schalteten die beiden Einzelspender
Dr. Manfred Fuchs und Horst Kleiner in Vertretung seiner Frau
Isolde Laukien-Kleiner diese erstmals vollständig an (Der
SPEYER-KURIER berichtete darüber).
In den folgenden vier Wochen seien die Leuchten in den Türmen
ausgerichtet und mit sogen. Tuben versehen worden, welche das Licht
bündelten und zugleich die zuvor bestehende Blendung abstellten.
Die Bodenstrahler hätten individuell angepasste Masken erhalten In
dieser Zeit war außerhalb der Arbeiten eine gedimmte Beleuchtung
eingeschaltet. Ferner wurden zwei Lichtszenarien ausgearbeitet: die
gedämpfte Beleuchtung für die Fastenzeit und die weihnachtliche
Festbeleuchtung.
Von beidem konnten sich die Teilnehmer des Pressegesprächs bei
einer ersten Inaugenscheinnahme überzeugen. „Großartig! Einfach
überwältigend!“, so lautete ihr einhelliges Urteil. Und ein
zufällig aus Richtung Heidelberg über die Salierbrücke angekommener
Autofahrer war überwältigt von dem Glanz der Festbeleuchtung, die
sich ihm schon von Ferne offenbarte. Foto: cr
17.12.2016
UNESCO-Welterbestätte erstrahlt in neuem Licht - Bilderalbum
Bischof dankt den Mitgliedern des Diözesansteuerrats

Amtsperiode von 2011 bis 2016 brachte zahlreiche
Herausforderungen mit sich – Neuwahl des Diözesansteuerrats im
ersten Quartal 2017
Speyer. Zum Abschluss der laufenden Amtsperiode
dankte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Mitgliedern des
Diözesansteuerrats. „Sie haben in den vergangen fünf Jahren
wichtige Weichenstellungen im Bistum mitgetragen“, würdigte der
Bischof die „konstruktive Mitarbeit und die hohe Sachkompetenz“ der
Mitglieder.
Bei der letzten Sitzung des Diözesansteuerrats im Jahr 2016
blickte Diözesanökonom Peter Schappert im Speyerer Priesterseminar
auf die Schwerpunkte der zu Ende gehenden Amtsperiode. „Wir haben
im Blick auf die Transparenz der Bistumsfinanzen einen großen
Schritt nach vorne getan“, so Schappert. Alle fünf großen
Diözesanhaushalte seien mit Haushaltsplänen und Jahresabschlüssen
im Internet für jedermann einsehbar. Die Umsetzung des Prozesses
„Gemeindepastoral 2015“ habe auch den Diözesansteuerrat vor große
Aufgaben gestellt.
Neben der Änderung der Kirchensteuerordnung nannte Schappert die
Umstellung von der Kameralistik auf die doppelte Buchhaltung für
alle Körperschaften, die Bündelung der Kapitalanlagen in einem
Masterfonds sowie die Einführung eines Risikomanagements und einer
Vollprüfung der Jahresrechnungen nach den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches mit Bestätigungsvermerk als Schwerpunkte. Auch
große Immobilienprojekte wie der Verkauf des Bistumshauses St.
Ludwig, die Gründung des Hauses der Kirchenmusik, der Umbau des
Priesterseminars St. German sowie des ehemaligen Altenheims in der
Engelsgasse zu einer Flüchtlingsunterkunft seien durch den
Diözesansteuerrat kompetent begleitet worden.
Jedes Mitglied des Diözesansteuerrats hat eine Stimme – auch
der Bischof
Der Diözesansteuerrat ist insbesondere für die Beschlussfassung
über den Haushaltsplan sowie für die Jahresrechnung der Diözese
zuständig. Zu seinen Aufgaben zählt zudem die Beratung der
Diözesanverwaltung in Vermögensangelegenheiten. Neben den zehn
gewählten Laienmitgliedern aus den Pfarreien gehören dem
Diözesansteuerrat drei gewählte, im aktiven Dienst stehende
Diözesanpriester, zwei vom Bischof berufene Personen sowie ein
Vertreter des Diözesanpastoralrates an. Den Vorsitz des
Diözesansteuerrats hat Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Jedes der
19 Mitglieder des Diözesansteuerrats hat eine Stimme - auch der
Bischof. Beratend nehmen der Generalvikar, der Leiter der
Hauptabteilung Finanzen und Immobilien und die Leiterin der
Bischöflichen Finanzkammer an den Sitzungen teil. Die
Geschäftsführung des Diözesansteuerrates wird von der Bischöflichen
Finanzkammer wahrgenommen.
Neuwahl des Diözesansteuerrats im ersten Quartal 2017
Im ersten Quartal des Jahres 2017 wird in einem mehrstufigen
Verfahren der Diözesansteuerrat des Bistums Speyer neu gewählt. Das
Bischöfliche Ordinariat hat in einem Schreiben die Verwaltungsräte
der 70 Pfarreien in der Pfalz und im Saarpfalzkreis jetzt dazu
aufgerufen, jeweils zwei Wahlmänner oder -frauen aus ihrer Mitte zu
wählen. Sie werden bei Wahlversammlungen in den Dekanaten jeweils
ein Mitglied und ein Ersatzmitglied pro Dekanat in den
Diözesansteuerrat wählen.
Weitere Informationen zum Diözesansteuerrat:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/raete-und-kommissionen/dioezesansteuerrat/
Weitere Informationen zur Neuwahl des
Diözesansteuerrats:
http://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=3070&cHash=ef68c8fa5af636210955d5e3dc6b2a5616.12.2016
Für junge Flüchtlinge deutsche Sprache kein Hindernis
 Kirchenpräsident besucht Wohngruppe unbegleiteter
Jugendlicher in Pirmasens
Kirchenpräsident besucht Wohngruppe unbegleiteter
Jugendlicher in Pirmasens
Pirmasens (lk). Beim Besuch einer
Wohngruppe für unbegleitete Jugendliche aus Kriegs- und
Krisengebieten im Diakoniezentrum Pirmasens hat Kirchenpräsident
Christian Schad das Projekt als gelungenes Beispiel für Integration
und als Erfolg bezeichnet.
„Einerseits ist das mediale Interesse an den Flüchtlingen
zurückgegangen, weil zurzeit nur noch wenige kommen. Andererseits
sind nach der schrecklichen Tat in Freiburg ganze Gruppen unter
Generalverdacht geraten“, sagte Schad. Das Beispiel Pirmasens
zeige, dass sich die Gesellschaft intensiv dem Einzelnen zuwenden
müsse.
Für ihre Sprachkenntnisse, die sie in kurzer Zeit erworben
haben, zollte der Kirchenpräsident den jungen Leuten Respekt. Neun
muslimische Jungen aus Somalia, Syrien und Afghanistan leben seit
April 2016 in der Stadt und werden von einem Team von Erziehern
betreut, erklärte Dietmar Bäuerle, der die Geschäftsbereichsleitung
der Jugendhilfe inne hat. Seinen Dank richtete er vor allem an die
engagierten Mitarbeiter. Indem sie den Jugendlichen neben der
notwendigen Hilfe auch klare Orientierung gäben und Pflichten
auferlegten, könne die soziale und berufliche Integration gelingen,
so Bäuerle. Die gezielte pädagogische, psychologische und
medizinische Betreuung der Gruppe und des Einzelnen – das zeige
diese Maßnahme – helfe durch eine Balance aus Fördern und Fordern
bei der Integration. Mit einem klar strukturierten Tagesablauf und
Regeln des Zusammenlebens werden die Jugendlichen auf den weiteren
Schritt in eine Wohntrainingsgruppe vorbereitet.
Kirchenpräsident Schad lobte die Initiative. Sie zeige, dass
Nationen, Kulturen und Religionen friedlich miteinander leben
könnten. Sunniten und Schiiten teilen sich ein Zimmer; Somalier,
Syrer und Afghanen unterhalten sich auf Deutsch – das mache Mut.
Die Ehrfurcht vor Gott und die Liebe zu den Menschen verbinde alle
Religionen. Diese geistlichen, friedenstiftenden Quellen gelte es
stark zu machen, sagte der Kirchenpräsident.
Norbert Becker, Theologischer Vorstand der Diakonie Pirmasens,
erinnerte daran, dass „wir über der großen Zahl von weltweit 28
Millionen Flüchtlingskindern den Einzelnen nicht aus den Augen
verlieren dürfen“. Hinter jedem Namen verberge sich ein
individuelles Schicksal, „und jeder verdient es, dass wir ihm eine
nachhaltige Zukunft ermöglichen“. Dazu sei es gut, selbst aus
christlicher Motivation Vorbild für die Jugendlichen zu sein, denen
es zu helfen gelte.
16.12.2016
Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs mit eindrucksvoller Feierstunde verabschiedet
 Mit hoher moralischer Integrität und eigenem Stil
„Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ geprägt
Mit hoher moralischer Integrität und eigenem Stil
„Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ geprägt
spk Speyer- Es war eine höchst emotionale Feier im
kleinsten Kreise, mit der sich jetzt die „Europäische Stiftung
Kaiserdom zu Speyer“ von ihrem langjährigen, verdienstvollen
Vorstandsvorsitzenden Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs
verabschiedete.
Sein Stellvertreter in diesem Amt, Staatsminister a. D.
Dr. Georg Gölter konnte dazu neben dem Speyerer Bischof
Dr. Karlheinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens
u.a. den früheren rheinland-pfälzischen und thüringischen
Ministerpräsidenten a. D. Prof. Dr. Bernhard Vogel, den
Speyerer Oberbürgermeister Hansjörg Eger, dessen Vorgänger
im Amt, Oberbürgermeister i.R. Werner Schineller,
Domkapitular Peter Schappert sowie Mitglieder der Organe der
Stiftung begrüßen.
 Dr. Gölter erinnerte sich bei diesem Anlass noch einmal
daran, wie er 2007 bei einer musikalischen Veranstaltung im Dom
zufällig neben Dr. Fuchs zu sitzen kam und diesen dann vorsichtig
anfragte, ob er sich vorstellen könne, die Nachfolge des damals
schon so schwer erkrankten Dr. Theo Spettmann anzutreten,
der zu diesem Zeitpunkt krankheitsbedingt bereits seinen Rückzug
vom Amt des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung angekündigt hatte.
Spontan, und für ihn unerwartet, habe ihm Dr. Fuchs eine Absage mit
der Begründung erteilt, er habe seiner Frau versprochen, kein
Ehrenamt mehr anzunehmen, das ihn zeitlich zu sehr in Anspruch
nehme. Um so überraschter sei er aber dann gewesen, als sich Dr.
Fuchs schon kurz darauf telefonisch bei ihm gemeldet habe, um ihm
mitzuteilen, 'dass ihn seine Frau von diesem Versprechen entbunden
habe' „Damit muss unser erster Dank heute eigentlich Ihnen,
verehrte Frau Fuchs gelten“, so Dr. Gölter, der diesen Dank in ein
prachtvolles Blumengebinde kleidete.
Dr. Gölter erinnerte sich bei diesem Anlass noch einmal
daran, wie er 2007 bei einer musikalischen Veranstaltung im Dom
zufällig neben Dr. Fuchs zu sitzen kam und diesen dann vorsichtig
anfragte, ob er sich vorstellen könne, die Nachfolge des damals
schon so schwer erkrankten Dr. Theo Spettmann anzutreten,
der zu diesem Zeitpunkt krankheitsbedingt bereits seinen Rückzug
vom Amt des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung angekündigt hatte.
Spontan, und für ihn unerwartet, habe ihm Dr. Fuchs eine Absage mit
der Begründung erteilt, er habe seiner Frau versprochen, kein
Ehrenamt mehr anzunehmen, das ihn zeitlich zu sehr in Anspruch
nehme. Um so überraschter sei er aber dann gewesen, als sich Dr.
Fuchs schon kurz darauf telefonisch bei ihm gemeldet habe, um ihm
mitzuteilen, 'dass ihn seine Frau von diesem Versprechen entbunden
habe' „Damit muss unser erster Dank heute eigentlich Ihnen,
verehrte Frau Fuchs gelten“, so Dr. Gölter, der diesen Dank in ein
prachtvolles Blumengebinde kleidete.
Dank sagen wollte dann aber auch Bischof Dr. Wiesemann, der Dr.
Fuchs als einen höchst erfolgreichen Unternehmer charakterisierte,
der ein heute weltweit operierendes Unternehmen aufgebaut habe, an
dessen Erfolg er - aus sozialer Verantwortung - immer auch seine
Mitarbeiter habe teilhaben lassen. Darüber hinaus habe er diesen
Erfolg aber immer auch für unterschiedliche soziale und
wissenschaftliche Zwecke eingesetzt.
 Der Bischof würdigte Dr. Fuchs damit als eine
Persönlichkeit, welche die wirtschaftlichen Qualitäten eines
hervorragenden Unternehmers ebenso in sich trage, wie hohe
künstlerische Qualitäten: „Da kommen zwei Gehirnhälften zusammen,
was überaus selten ist“, so der Bischof. Daraus erkläre sich
womöglich auch die Faszination, mit der der Speyerer Dom mit seinen
unterschiedlichen Dimensionen – kunsthistorische, historische
ebenso wie politische – Dr. Fuchs erfasst habe und die ihn bis
heute antreibe, mit außergewöhnlichem persönlichen Engagement als
Vorstandsvorsitzender für die Sache des Domes einzutreten. Als
Beispiel für die soziale Gesinnung Dr. Fuchs' nannte der Bischof
die von dem Laureat initiierte Einwerbung von Einzelspenden für die
Einrichtung eines barrierefreien Eingangs-Portals für die
Kathedrale, vor allem aber auch seinen Beitrag zur Erneuerung der
Außenbeleuchtung des Doms. „Ich danke ihnen für all das, was sie
getan haben und wie sie es getan haben“, so Bischof Dr. Wiesemann,
der dem auch noch „eine persönliche Dankbarkeit“ hinzufügen wollte
- „ Dankbarkeit für eine Begegnung, aus der auch ich als Bischof
noch habe lernen können“. Und der Bischof weiter: „Die hohe
moralische Integrität von Herrn Dr. Fuchs hat die Stiftung geprägt
und so einen bleibenden Stil geschaffen“.
Der Bischof würdigte Dr. Fuchs damit als eine
Persönlichkeit, welche die wirtschaftlichen Qualitäten eines
hervorragenden Unternehmers ebenso in sich trage, wie hohe
künstlerische Qualitäten: „Da kommen zwei Gehirnhälften zusammen,
was überaus selten ist“, so der Bischof. Daraus erkläre sich
womöglich auch die Faszination, mit der der Speyerer Dom mit seinen
unterschiedlichen Dimensionen – kunsthistorische, historische
ebenso wie politische – Dr. Fuchs erfasst habe und die ihn bis
heute antreibe, mit außergewöhnlichem persönlichen Engagement als
Vorstandsvorsitzender für die Sache des Domes einzutreten. Als
Beispiel für die soziale Gesinnung Dr. Fuchs' nannte der Bischof
die von dem Laureat initiierte Einwerbung von Einzelspenden für die
Einrichtung eines barrierefreien Eingangs-Portals für die
Kathedrale, vor allem aber auch seinen Beitrag zur Erneuerung der
Außenbeleuchtung des Doms. „Ich danke ihnen für all das, was sie
getan haben und wie sie es getan haben“, so Bischof Dr. Wiesemann,
der dem auch noch „eine persönliche Dankbarkeit“ hinzufügen wollte
- „ Dankbarkeit für eine Begegnung, aus der auch ich als Bischof
noch habe lernen können“. Und der Bischof weiter: „Die hohe
moralische Integrität von Herrn Dr. Fuchs hat die Stiftung geprägt
und so einen bleibenden Stil geschaffen“.
 Der so Geehrte dankte seinerseits dem Bischof für „seine
berührenden Worte“. „Wir haben mit unserem Dom einen Schatz, dem zu
dienen Spaß macht“, - Dieses Zitat des Bischofs habe er sich zu
Eigen gemacht, so Dr. Fuchs, der versprach, der Kathedrale auch
weiterhin verbunden zu bleiben. Neben dem Bischof bedankte sich der
scheidende Vorstandsvorsitzende, der bei dieser Gelegenheit auch
seines verstorbenen Vorgängers Dr. Theo Spettmann gedachte, auch
bei den „Hausherren des Doms“, Weihbischof und Dompropst Otto
Georgens und Domkustos Peter Schappert für die reibungslose
Zusammenarbeit und fügte, als kleine Episode, die bleibende
Erinnerung an einen Rundgang an, den er unter der Führung von
Domkustos Peter Schappert über die Zwerggalerie gemacht habe.
Der so Geehrte dankte seinerseits dem Bischof für „seine
berührenden Worte“. „Wir haben mit unserem Dom einen Schatz, dem zu
dienen Spaß macht“, - Dieses Zitat des Bischofs habe er sich zu
Eigen gemacht, so Dr. Fuchs, der versprach, der Kathedrale auch
weiterhin verbunden zu bleiben. Neben dem Bischof bedankte sich der
scheidende Vorstandsvorsitzende, der bei dieser Gelegenheit auch
seines verstorbenen Vorgängers Dr. Theo Spettmann gedachte, auch
bei den „Hausherren des Doms“, Weihbischof und Dompropst Otto
Georgens und Domkustos Peter Schappert für die reibungslose
Zusammenarbeit und fügte, als kleine Episode, die bleibende
Erinnerung an einen Rundgang an, den er unter der Führung von
Domkustos Peter Schappert über die Zwerggalerie gemacht habe.
 Einen besonderen Dank entbot Dr. Fuchs schließlich auch
dem anwesenden Kuratoriumsmitglied, Chefredakteur Michael
Garthe. Mit den Aktionen seiner Zeitung, z.B. der zurzeit
laufenden Aktion „Die Pfalz liest für den Dom“, habe er
Bemerkenswertes für den Dom geleistet. Zuletzt richtete Dr. Fuchs
seinen Dank an seine Kollegen des Vorstandes der Stiftung und an
das Team des Stifterbüros, von denen er zum Abschied eine
Lithographie des Doms aus dem Jahr 1829 entgegennehmen durfte.
Einen besonderen Dank entbot Dr. Fuchs schließlich auch
dem anwesenden Kuratoriumsmitglied, Chefredakteur Michael
Garthe. Mit den Aktionen seiner Zeitung, z.B. der zurzeit
laufenden Aktion „Die Pfalz liest für den Dom“, habe er
Bemerkenswertes für den Dom geleistet. Zuletzt richtete Dr. Fuchs
seinen Dank an seine Kollegen des Vorstandes der Stiftung und an
das Team des Stifterbüros, von denen er zum Abschied eine
Lithographie des Doms aus dem Jahr 1829 entgegennehmen durfte.
Zu Ehren des scheidenden Vorstandsvorsitzenden der „Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ und ausgewiesenen Kenner aller Künste
umrahmte die Sopranistin Anabelle Hund, am Piano begleitet
von Domkapellmeister Markus Melchiori, die Feierstunde mit
drei Liedern aus dem „Schemelli – Gesangbuch“ von Johann Sebastian
Bach. Fotos: cr
15.12.2016
Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs verabschiedet - Bilderalbum
Intensive Fragen von Leben, Tod und Auferstehen im Kinosaal
 Die Kinotalk-Runde zum Film "Auferstanden" (v.l.): Moderator Uwe Burkert, Nicolas Kühn, Pflegedienstleiter und stellvertretender Leiter des Hospiz' Elias in Ludwigshafen, Prof. Dr. Martin Mittwede, Religionswissenschaftler an der Universität Frankfurt und Experte für asiatischen Religionen sowie Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
Die Kinotalk-Runde zum Film "Auferstanden" (v.l.): Moderator Uwe Burkert, Nicolas Kühn, Pflegedienstleiter und stellvertretender Leiter des Hospiz' Elias in Ludwigshafen, Prof. Dr. Martin Mittwede, Religionswissenschaftler an der Universität Frankfurt und Experte für asiatischen Religionen sowie Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
300 Beteiligte bei Filmtalk mit Bischof Wiesemann
Frankenthal- Mehr als 300 Zuschauer haben
gestern Abend, 17. März, in Frankenthal den US-Kinofilm
"Auferstanden" gesehen, der jetzt bundesweit angelaufen ist.
Eingeladen zur Kinovorstellung in die Lux Kinos hatten das Bistum
Speyer, der Radiosender RPR 1. sowie die Kirchenzeitung "der
pilger".
Einer der Kinobesucher war der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann, der im Anschluss an die Filmvorführung für eine
Diskussion mit dem Publikum zur Verfügung stand. Mit auf dem Podium
saßen auch der Frankfurter Religionswissenschaftler Professor Dr.
Martin Mittwede sowie Nicolas Kühn, stellvertretender Leiter des
Hopiz Elias in Ludwigshafen. Die drei diskutierten untereinander
und mit dem Kinopublikum "Fragen von Leben, Tod und Auferstehung",
wie Uwe Burkert, Radiomoderator und Theologe, sagte, der als
Moderator des Gesprächs fungierte.
Der Film "Auferstanden" (freigegeben ab zwölf Jahren) stellt das
Geschehen um die Kreuzigung und Auferstehung von Jesus von Nazareth
dar. Der römische Militärtribun Clavius wird vom Jerusalemer
Statthalter Pilatus beauftragt, die verschwundene Leiche "des
Nazaräers" zu suchen, den die Römer drei Tage zuvor hingerichtet
hatten. Clavius' Ermittlungen führen zu einem überraschenden
Ergebnis und zu Erfahrungen, die den Tribun verändern werden.
Besonders diese Veränderung eines Menschen, wie es der Film
erzählt, haben den Speyerer Bischof beeindruckt. "Es bleibt zwar
offen, wie das Leben des Soldaten weitergeht, aber das es sich
völlig wandelt, das wird deutlich", so Dr. Wiesemann. Auferstehung
verändere, sie führe nicht ins alte Leben zurück. Die Auferstehung
Jesu habe Menschen verändert, und sie wirke nach. Für den
Hollywood-Streifen fand der Bischof sowohl Kritik als auch Lob.
Letzteres gab es dafür, dass auch das Kreuz nicht ausgespart blieb.
Die grausige Szene des Kreuzigens bleibt dem Zuschauer zwar
erspart, doch der Tod Jesu bzw. die Kreuzabnahme ist dargestellt.
"Kreuzestod und Auferstehung sind zwei Seiten derselben Medaille,
man kann das nicht trennen, das macht der Film auch nicht."
Kritisch sieht der Theologe Wiesemann die Szenen mit dem
auferstandenen Jesus. Hier werde ins Bild gebracht, was eigentlich
nicht ins Bild zu bringen sei. "Das Medium Film kommt hier an seine
Grenzen." Zumal der Film die verschiedenen Auferstehungserzählungen
der Bibel aneinanderreiht, als seien sie nacheinander passiert.
"Auferstehung - kann man an sowas überhaupt glauben?", diese
provokante Frage stellte Moderator Uwe Burkert gleich zu Beginn der
Diskussion. Tatsächlich, ein Kino-Besucher, der sich selbst als
"christlich geprägt und kirchlich engagiert" bezeichnete, sagte:
"Ich habe meine Zweifel, ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich
kann das nur schwer glauben"
Professor Mittwede führte aus, dass es zu allen Zeiten, in allen
Kulturen und allen Religionen Vorstellungen von einem Weiterleben
oder einem neuen Leben nach dem Tod gegeben habe. Wie auch die
Nahtoderlebnisse, von denen klinisch Tote nach ihrer Wiederbelebung
berichten, scheinen diese ganz tief im Menschen verankert zu sein.
"Unsere moderne Kultur verdrängt allerdings den Tod, damit auch das
Wissen um ein gelingendes Sterben." Buddhisten etwa sähen in der
Vorbereitung auf den Tod einen wesentlichen Teil des
Glaubenslebens. Dies gehöre auch zum Christentum, sei aber seit der
Aufklärung ein Stück weit verloren gegangen.
Hospizmitarbeiter Nicolas Kühn berichtete aus seinen Erfahrungen
mit Sterbenden, wobei er eine persönliche Entwicklung beschrieb.
Aus der anfänglichen Überlegung, selbst mehr über den Tod zu
erfahren, habe sich die Erkenntnis entwickelt, dass jeder
Sterbeprozess und jeder Tod so individuell wie das Leben zuvor sei.
"Seit ich aufgehört habe, nach Antworten zum Tod zu suchen, werde
ich von ihnen gefunden."
 "Das war ein rundum
gelungener Abend", fasst Katja Stunz, die Theaterleiterin der
Frankenthaler Lux Kinos, nach der Diskussion ihren Eindruck
zusammen. Spontan wurde der Film auch noch in einem zweiten
Kinosaal gezeigt, nachdem der erste Saal ausverkauft war. "Das
Publikum war zufrieden, gerührt und bewegt, gerade auch von dem
anschließenden Gespräch." Beeindruckt hat die Kinofrau, wie
gemischt das Publikum war: "Alt und Jung, Frauen und Männer,
darunter auch viele, die sicher nicht oft ins Kino gehen." Zum
Kinopublikum zählten neben dem Frankenthaler OB Theo Wieder auch
mehrere Seelsorger sowie Firm- und Jugendgruppen.
"Das war ein rundum
gelungener Abend", fasst Katja Stunz, die Theaterleiterin der
Frankenthaler Lux Kinos, nach der Diskussion ihren Eindruck
zusammen. Spontan wurde der Film auch noch in einem zweiten
Kinosaal gezeigt, nachdem der erste Saal ausverkauft war. "Das
Publikum war zufrieden, gerührt und bewegt, gerade auch von dem
anschließenden Gespräch." Beeindruckt hat die Kinofrau, wie
gemischt das Publikum war: "Alt und Jung, Frauen und Männer,
darunter auch viele, die sicher nicht oft ins Kino gehen." Zum
Kinopublikum zählten neben dem Frankenthaler OB Theo Wieder auch
mehrere Seelsorger sowie Firm- und Jugendgruppen.
Gesprächsleiter Uwe Burkert dankte dem Publikum und den drei
Podiums-Fachleuten für Offenheit. "Es ging darum, einen Raum zu
öffnen, in dem man sich über die wenig alltäglichen Fragen zu
Leben, Sterben und Tod austauschen kann. Ich glaube, das ist heute
gelungen."
Ein Kinogast hat den Film jetzt, so kurz vor dem Osterfest, als
gute Ermutigung verstanden. "Ich möchte mich weiterhin mit diesem
Thema auseinandersetzen, dazu bietet der Film viele Anregungen."
Auch Schwester Hildegard Elster vom Speyerer Institut St. Dominikus
beschäftigt "Auferstanden" noch stark. Besonders die Szenen, in
denen Soldat Clavius den Jüngern Jesu oder der Maria von Magdala
begegnet. "Mich berührt die Ausstrahlungskraft der Maria von
Magdala, und bin mir sicher, dass dies der Beginn des
,Umkehr-Prozesses' des Clavius gewesen sein könnte." Das, so die
Ordensfrau, mag eine Anfrage an Christen heute sein: "Erfahren die
Menschen in unserem Umfeld in der Begegnung durch uns etwas von der
Wirkkraft des Auferstandenen? Durch unser Sein und weniger durch
große Worte?"
Text und Foto: Hubert Mathes
18.03.2016
Erklärung von Kirchenpräsident Christian Schad zum Ausgang der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz
 Speyer- Ich freue mich, dass die ersten Gewinner
dieser Wahl die Wähler selbst sind. Die deutliche Erhöhung der
Wahlbeteiligung zeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger durch den
politischen Wettbewerb in der Sache und im fairen Wettstreit der
Kandidatinnen und Kandidaten motivieren lassen, zur Wahl zu
gehen.
Speyer- Ich freue mich, dass die ersten Gewinner
dieser Wahl die Wähler selbst sind. Die deutliche Erhöhung der
Wahlbeteiligung zeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger durch den
politischen Wettbewerb in der Sache und im fairen Wettstreit der
Kandidatinnen und Kandidaten motivieren lassen, zur Wahl zu
gehen.
Ich danke allen parteiübergreifenden Initiativen, die
erfolgreich zur aktiven Teilnahme an der Landtagswahl aufgerufen
haben.
Dass 85 Prozent der Stimmen auf die bewährten demokratischen
Kräfte gesetzt haben, tröstet mich beim Blick auf das Ergebnis der
AfD. Diese muss nun beweisen, dass Parolen und Protest nicht
Parlament und Argument ersetzen können.
Ich danke allen Kräften, die menschenfeindlichen, rassistischen
und diskriminierenden Äußerungen widersprochen und hier eine klare
Haltung gezeigt haben - und weiterhin zeigen werden.
Die Wählerinnen und Wähler haben mit ihrer differenzierten
Abstimmung den bewährten demokratischen Parteien den Auftrag
erteilt, auf Konsenssuche zu gehen, um eine Regierung zu bilden.
Ihre Aufgabe wird es sein, die politischen Herausforderungen
gemeinsam zu meistern. Rheinland-Pfalz, im Herzen Europas gelegen,
hat hierbei landes-, bundes- und europapolitische Zusammenhänge zu
beachten.
Ich danke allen, die sich dabei für eine sozial gerechte,
friedliche und weltoffene Gesellschaft einsetzen, damit die
Lebensbedingungen, Chancen und Möglichkeiten für alle Menschen, die
bei uns leben, weitestgehend gleich sein können.
Text und Foto: is
14.03.2016
ACK: Mitgliederversammlung bestätigt Bischof Wiesemann als Vorsitzenden
 Vorstand ACK in Deutschland
Vorstand ACK in Deutschland
Erklärung "Für ein weltoffenes
Deutschland"
Bergisch Gladbach/Speyer- Auf ihrer Sitzung
am 9. und 10. März 2016 im Kardinal Schulte Haus in Bergisch
Gladbach haben die 50 Delegierten den Vorstand der ACK in
Deutschland für die nächsten drei Jahre gewählt. Als Vorsitzender
wurde Bischof KarlHeinz Wiesemann (Speyer) im Amt bestätigt. Zudem
wurde der Ökumenepreis der ACK 2017 ausgerufen, um den sich
ökumenische Initiativen und Projekte bewerben können. Er wird im
Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen am 22. Januar
2017 in Wittenberg verliehen. Mit einer Erklärung „Für ein
weltoffenes Deutschland“ hat sich die ACK der „Allianz für
Weltoffenheit“ angeschlossen.
Die ACK sei eine wichtige Plattform für das
ökumenische Miteinander, sagte Bischof Wiesemann. Er appellierte an
die Mitgliedskirchen der ACK, sich auch weiterhin intensiv dem
ökumenischen Dialog zu verpflichten und die ACK als ökumenische
Stimme auf ihren verschiedenen Ebenen zu stärken. „Das Ziel der
ökumenischen Bewegung ist es, die Kirchen im gemeinsamen Zeugnis
und Dienst zu vereinen“, so Bischof Wiesemann. Eine Gelegenheit für
dieses Zeugnis für Jesus Christus sei das Gedenken an 500 Jahre
Reformation im Jahr 2017. Das Gedenken sei eine große Chance, das
gemeinsame Bekenntnis zu Jesus Christus und die einende Grundlage
der Bibel zu stärken und mehr ins Bewusstsein der Kirchen und der
Gesellschaft zu rücken. Neben ihrem Einsatz für Gerechtigkeit,
Frieden und die Bewahrung der Schöpfung, zum Beispiel mit dem
jährlichen ökumenischen Tag der Schöpfung, fördere die ACK das
friedliche und respektvolle Miteinander und den Dialog der
Konfessionen, aber auch der Kulturen und Religionen. Ihre
Mitgliedskirchen hätten eine langjährige Erfahrung bei der
Integration. „Diese Erfahrungen wollen wir bei den aktuellen
gesellschaftlichen Herausforderungen einbringen“, umriss Bischof
Wiesemann die Vorhaben der nächsten Jahre. “In der ACK erfahren wir
die Vielfalt des christlichen Zeugnisses als großen Reichtum und
zugleich als Ansporn, die Einheit in Vielfalt zu leben”, sagte der
Bischof. Das Miteinander in der ACK stärke das Vertrauen, und das
Handeln gebe dem gemeinsamen christlichen Zeugnis in der Welt
sichtbaren Ausdruck, so der Bischof.
Vorstand hat fünf Mitglieder und fünf ständige
Stellvertreter
Alle drei Jahre wählt die Mitgliederversammlung der ACK in
Deutschland einen Vorstand, der sich aus einem Vorsitzenden, zwei
Stellvertretungen sowie zwei weiteren Vorstandsmitgliedern
zusammensetzt. Bei der Besetzung werden die Kirchenfamilien
entsprechend berücksichtigt. Außerdem wählt die
Mitgliederversammlung fünf ständige stellvertretende
Vorstandsmitglieder auf die Dauer von drei Jahren. Eine Wiederwahl
ist zulässig. Zuletzt wurde der Vorstand im März 2013 gewählt, die
meisten der gewählten Vorstandsmitglieder traten daher erneut zur
Wahl an. Neu in den Vorstand wurde Pfarrer Christopher Easthill von
der anglikanischen Kirche gewählt. Er folgt auf Pastor Heinrich
Lüchtenborg, der nach seinem Eintritt in den Ruhestand nicht mehr
zur Wahl angetreten war.
Der 1948 gegründeten Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen
(ACK) in Deutschland gehören 17 Kirchen an. Sechs Kirchen sind
Gastmitglieder, vier ökumenische Organisationen haben
Beobachterstatus. Die ACK repräsentiert ca. 50 Mio. Christen in
Deutschland. Die Mitglieder, Gastmitglieder und Beobachter
entsenden Delegierte in die ACK, die zweimal im Jahr zur
Mitgliederversammlung zusammenkommen. Alle drei Jahre wählt die
Mitgliederversammlung den Vorstand der ACK. Derzeit ist der
Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann Vorsitzender. Die
Geschäftsstelle der ACK in Deutschland, genannt „Ökumenische
Centrale“, hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Schwerpunkte der
Arbeit der ACK in Deutschland sind das gemeinsame Gebet, die
theologische Reflexion, das Engagement für Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung der Schöpfung sowie der Kontakt zu anderen
ökumenischen Einrichtungen.
Dem Vorstand gehören nun an: Bischof Karl-Heinz Wiesemann
(römisch-katholische Kirche) als Vorsitzender, Bischöfin Rosemarie
Wenner (Evangelisch-methodistische Kirche) und Bischof Martin Hein
(Evangelische Kirche in Deutschland) als Stellvertretungen sowie
Erzpriester Radu Constantin Miron (Orthodoxe Kirche) und Pfarrer
Christopher Easthill (Anglikanische Kirche). Als ständige
stellvertretende Vorstandsmitglieder wurden gewählt: Weihbischof
Nikolaus Schwerdtfeger (römisch-katholische Kirche),
Generalsekretär Christoph Stiba (Bund Evangelisch-freikirchlicher
Gemeinden), Bischöfin Petra Bosse-Huber (Evangelische Kirche in
Deutschland), Erzpriester Merawi Tebege (Äthiopisch-orthodoxe
Kirche) und Bischof Hans-Jörg Voigt (Selbstständig
evangelisch-lutherische Kirche). Ökumenepreis der ACK
2017
Die Mitgliederversammlung hat den Ökumenepreis 2017
ausgeschrieben. Alle zwei Jahre zeichnet die ACK in Deutschland mit
ihrem Ökumenepreis Projekte und Initiativen aus, die zur Einheit
der Christen beitragen und ein gemeinsames Engagement von
Christinnen und Christen verschiedener Konfession fördern. Der
Preis ist mit 3.000 Euro datiert. Das Preisgeld wird durch die
Evangelische Bank und die Bank für Kirche und Caritas zur Verfügung
gestellt. Schirmherr ist Bundestagspräsident Norbert Lammert.
Verliehen wird der Preis im Anschluss an den zentralen Gottesdienst
der ACK zur Gebetswoche für die Einheit der Christen am 22. Januar
2017 in Wittenberg. Bewerbungen sind online möglich unter www.oekumenepreis-derack.de.
Dort finden sich auch weitere Informationen.
Wort der ACK zu 500 Jahre Reformation
In einer ersten Lesung hat sich die Mitgliederversammlung mit
einem Wort der ACK zu 500 Jahre Reformation beschäftigt. Mit dem
Wort will die Mitgliederversammlung die ökumenische Dimension der
Feierlichkeiten im Jahr 2017 stärken. Die ACK will dazu ermutigen,
die Reformation und ihre Folgen gemeinsam zu reflektieren und
Impulse aufzunehmen. Gleichzeitig mahnt sie dazu, die
Kirchenspaltung und ihre Folgen gemeinsam zu bedenken und an einer
„Heilung der leidvollen Erinnerungen“ zu arbeiten. Das Wort soll
zusammen mit einer Arbeitshilfe auf der Mitgliederversammlung im
Herbst 2016 veröffentlicht werden.
Erklärung zu Allianz für Weltoffenheit
Mit einer Erklärung „Für ein weltoffenes Deutschland“ hat sich
die Mitgliederversammlung der „Allianz für Weltoffenheit,
Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat – gegen Intoleranz,
Menschenfeindlichkeit und Gewalt
(www.allianz-fuer-weltoffenheit.de)“ angeschlossen. Diese war in
Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in Deutschland und in
Europa von zehn Organisationen ins Leben gerufen worden. Die ACK in
Deutschland begrüßt diese Initiative ausdrücklich. Mit dem
Anschluss an die Initiative bringe sie das Anliegen aller in der
ACK verbundenen Kirchen zum Ausdruck, sich gemeinsam für die
Menschenwürde in Deutschland, in Europa und weltweit einzusetzen,
heißt es in der Erklärung. Die Mitgliedskirchen der ACK plädieren
nachdrücklich zusammen mit den Partnern der „Allianz für
Weltoffenheit“ für ein weltoffenes, solidarisches, demokratisches
und rechtsstaatliches Deutschland. Die Mitgliedskirchen
distanzieren sich von allen, die Intoleranz, Menschenfeindlichkeit
und Gewalt schüren, heißt es in der Erklärung.
Für ein weltoffenes Deutschland
Erklärung der Mitgliederversammlung der
Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland zur
„Allianz für Weltoffenheit“
In Sorge um den gesellschaftlichen Zusammenhalt in
unserem Land und in Europa haben zehn Organisationen aus der Mitte
unserer Gesellschaft die „Allianz für Weltoffenheit, Solidarität,
Demokratie und Rechtsstaat – gegen Intoleranz,
Menschenfeindlichkeit und Gewalt
(www.allianz-fuer-weltoffenheit.de)“ ins Leben gerufen.
Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Deutschland
begrüßt diese Initiative ausdrücklich und schließt sich der
„Allianz für Weltoffenheit“ an. Damit bringt sie das Anliegen aller
in der ACK verbundenen Kirchen zum Ausdruck, sich gemeinsam für die
Menschenwürde in unserem Land, in Europa und weltweit einzusetzen.
Die Mitgliedskirchen der ACK tun dies aus der Überzeugung, dass
alle Menschen Gottes Geschöpfe sind und die Würde der
Gottebenbildlichkeit unverlierbar in sich tragen.
Die Mitgliedskirchen der ACK plädieren nachdrücklich zusammen
mit den Partnern der „Allianz für Weltoffenheit“ für ein
weltoffenes, solidarisches, demokratisches und rechtsstaatliches
Deutschland. Sie distanzieren sich von allen, die Intoleranz,
Menschenfeindlichkeit und Gewalt schüren. Rassismus und Gewalt in
jeglicher Form dürfen nicht sein und sind mit dem Willen Gottes
nicht vereinbar. Daher engagieren sich die christlichen Kirchen
seit vielen Jahren gegen Rassismus und
Fremdenfeindlichkeit.
Für das friedliche und respektvolle Miteinander fördert die ACK
in Deutschland den Dialog der Kulturen und Religionen. Ein Beispiel
dafür ist das gemeinsam mit muslimischen Verbänden und dem
Zentralrat der Juden gestartete Projekt „Weißt du, wer ich bin?“,
das im Jahr 2016 insbesondere die interreligiöse Kooperation in der
Flüchtlingshilfe und die politisch-interreligiöse Bildung
verstärken will. Dabei bringt die ACK in Deutschland die
langjährige Erfahrung ihrer Mitgliedskirchen bei der Integration
und im interreligiösen Dialog ein.
Zur Info:
Die „Allianz für Weltoffenheit“ wird getragen von der
Deutschen Bischofskonferenz, dem Rat der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) – beide sind Mitgliedskirchen der ACK, dem
Zentralrat der Juden, dem Koordinationsrat der Muslime, der
Bundesarbeitsgemeinschaft für Freie Wohlfahrtspflege (BAGFW), dem
Deutschen Kulturrat, dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB),
dem Deutschen Naturschutzring (DNR), dem Deutschen
Gewerkschaftsbund (DGB) und der Bundesvereinigung der Deutschen
Arbeitgeberverbände (BDA).
Die Mitgliederversammlung ist das oberste, beschlussfassende
Leitungsorgan der ACK. Sie besteht aus den rund 50 Delegierten der
Mitglieder, Gastmitglieder sowie ständigen Beobachter, die für die
Dauer von fünf Jahren benannt werden. Die Mitgliederversammlung der
ACK tagt in der Regel zweimal jährlich, im Frühjahr und im
Herbst.
Der 1948 gegründeten Arbeitsgemeinschaft
christlicher Kirchen (ACK) in Deutschland gehören 17 Kirchen
an. Sechs Kirchen sind Gastmitglieder, vier ökumenische
Organisationen haben Beobachterstatus. Die ACK repräsentiert ca. 50
Mio. Christen in Deutschland. Die Mitglieder, Gastmitglieder und
Beobachter entsenden Delegierte in die ACK, die zweimal im Jahr zur
Mitgliederversammlung zusammenkommen. Alle drei Jahre wählt die
Mitgliederversammlung den Vorstand der ACK. Derzeit ist der
Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann Vorsitzender. Die
Geschäftsstelle der ACK in Deutschland, genannt „Ökumenische
Centrale“, hat ihren Sitz in Frankfurt am Main. Schwerpunkte der
Arbeit der ACK in Deutschland sind das gemeinsame Gebet, die
theologische Reflexion, das Engagement für Gerechtigkeit, Frieden
und die Bewahrung der Schöpfung sowie der Kontakt zu anderen
ökumenischen Einrichtungen.
12.03.2016
Bischof Wiesemann bestätigt Wahlen der Dekane und Prodekane
Speyer- Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
hat die Wahlen der zehn Dekanatsversammlungen im Bistum Speyer, die
im Februar stattgefunden haben, bestätigt und die Gewählten mit
Wirkung zum 1. Juni 2016 zum Dekan bzw. Prodekan ernannt. Die
Amtszeit beträgt jeweils sechs Jahre. Gewählt und ernannt
wurden:
Dekanat Bad Dürkheim
Dekan:
Pfarrer Michael Janson (Neustadt)
Prodekan: Pfarrer Norbert
Leiner (Bad Dürkheim)
Dekanat Donnersberg
Dekan:
Pfarrer Markus Horbach (Rockenhausen)
Prodekan: Pfarrer Stefan
Haag (Kirchheimbolanden)
Dekanat Germersheim
Dekan:
Pfarrer Jörg Rubeck (Germersheim)
Prodekan: Pfarrer Stanislaus
Mach (Kandel)
Dekanat Kaiserslautern
Dekan:
PfarrerSteffen Kühn (Queidersbach)
Prodekan: Pfarrer Bernhard
Spieß (Ramstein-Miesenbach)
Dekanat Kusel
Dekan:
Pfarrer Rudolf Schlenkrich (Kusel)
Prodekan: Pfarrer Stefan
Czepl (Schönenberg-Kübelberg)
Dekanat Ludwigshafen
Dekan:
Pfarrer Alban Meißner (Ludwigshafen, Pfarrei Hll. Petrus und
Paulus)
Prodekan: Pfarrer Josef
Steiger (Ludwigshafen, Pfarrei Hl. Katharina von Siena)
Dekanat Landau
Dekan:
Pfarrer Axel Brecht (Landau)
Prodekan: Pfarrer Arno Vogt
(Herxheim)
Dekanat Pirmasens
Dekan:
PfarrerJohannes Pioth (Pirmasens)
Prodekan: PfarrerBernhard
Selinger (Martinshöhe)
Dekanat Saarpfalz
Dekan:
Pfarrer Andreas Sturm (St. Inbert)
Prodekan: Pfarrer Eric Klein
(Blieskastel-Lautzkirchen)
Dekanat Speyer
Dekan:
Pfarrer Peter Nirmaier (Schifferstadt)
Prodekan: Pfarrer Andreas
Rubel (Bobenheim-Roxheim)
is
11.03.2016
Buchdruck und Universitäten sorgen für Verbreitung der Ideen

Kirchenhistorikerin Irene Dingel über die Auswirkungen
der Reformation in Europa
Speyer- Europa ist nach Ansicht der
Direktorin des Instituts für Europäische Geschichte, Irene Dingel,
schon früh von der Reformation erfasst worden. Auch wenn der
entscheidende Impuls von Wittenberg ausgegangen sei, so habe es in
anderen Städten und Regionen Europas wie zum Beispiel Straßburg,
Zürich und Genf gleichfalls eigene reformatorische Bewegungen
gegeben. Dabei habe das reformatorische Gedankengut meist auf der
Grundlage bereits vorhandener reformerischer Strömungen oder auf
einer humanistisch-kirchenkritischen Basis aufbauen können, sagte
Dingel bei einem Vortrag in der Bibliothek und Medienzentrale der
Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer.
Der moderne Buchdruck habe der raschen Verbreitung der
reformatorischen Lehre geholfen, sagte Dingel. Dies zeige ein Brief
des Baseler Buchdruckers Johannes Froben aus dem Jahr 1519, den
dieser an Martin Luther geschrieben habe: „Außerdem haben wir deine
Bücher nach Brabant und England geschickt.“ Der Brief belege, dass
bereits vor 1520 eine europäische Rezeption der von Luther und
Wittenberg ausgehenden Reformation begonnen habe. Multiplikatoren
der reformatorischen Ideen seien dabei neben der Buchdruckerkunst
vor allem die Hohen Schulen, Akademien und Universitäten in den
reformatorischen Zentren Zentraleuropas gewesen.
Auch die Mobilität von Kaufleuten und Studenten hat nach
Auffassung Dingels für die Verbreitung der Ideen gesorgt, auch wenn
dies durch die Reaktion der Kurie und der politischen
Entscheidungsträger zeitweise gebremst worden sei. „Die Verfolgung
und Ausmerzung dessen, was man als Bedrohung der herrschenden
Ordnung ansah und vor dem Hintergrund der überkommenen kirchlichen
Lehre als Häresie qualifizierte, war dort an der Tagesordnung, wo
sich keine schützenden politischen Gewalten vor die Reformation und
ihre Akteure stellen konnten“, sagte die Historikerin. Ein Blick
auf die verschiedenen europäischen Regionen mache deutlich, wie
sehr der Erfolg der Reformation einerseits von einer bereits
vorhandenen reformerischen Stimmung und andererseits von den
politischen Bedingungen abhängig gewesen sei.
Kirchenpräsident Christian Schad erinnerte daran, in welch hohem
Maße die Menschen im 16. Jahrhundert miteinander vernetzt
gewesen waren, „auch wenn wir zuweilen glauben, die Mobilität sei
erst eine Erfindung der Moderne“. Die Auseinandersetzung mit der
Reformationsgeschichte zeige, wie durch offene Ländergrenzen und
weitgehende Reisefreiheit der Gedankenaustausch der Gelehrten weit
über die Sprachbarrieren hinaus ermöglicht worden sei. Dies werde
im Blick auf den ersten evangelischen Pfarrer der Pfalz, Martin
Bucer, deutlich. Diesen in Schlettstadt geborenen Elsässer habe
seine Laufbahn unter anderem nach Heidelberg und Köln geführt. Er
sei zum Reformator Straßburgs geworden und habe am Ende seines
Lebens in Cambridge/England gewirkt. 2017 werde das reformatorische
Erbe Europas unter anderem beim „Stationenweg“ deutlich, der 68
Städte in 19 europäischen Ländern umfasse und auch in Straßburg und
Speyer Halt machen werde, betonte der Kirchenpräsident.
Text und Foto: lk
10.03.2016
Pfingsten gemeinsam feiern
 v.l.: Dr. Thomas Stubenrauch, Pfarrer Thomas Borchers, Clemens Schirmer, Oberkirchenrat Manfred Sutter und Domkapitular Franz Vogelgesang.
v.l.: Dr. Thomas Stubenrauch, Pfarrer Thomas Borchers, Clemens Schirmer, Oberkirchenrat Manfred Sutter und Domkapitular Franz Vogelgesang.
Bistum und Landeskirche veröffentlichen Arbeitshilfe zu
ökumenischen Gottesdiensten
Speyer- In den vergangenen Jahrzehnten wurde
immer öfter der Wunsch laut, an Pfingsten ökumenische Gottesdienste
zu feiern. Dies war für die Verantwortlichen im Bistum Speyer und
in der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische
Landeskirche) Anlass, eine Arbeitshilfe für ökumenische
Gottesdienste rund um das Pfingstfest zu erstellen. Die circa
80seitige Broschüre mit dem Titel „Pfingsten gemeinsam feiern“ will
helfen, den Ökumenischen Leitfaden mit Leben zu erfüllen. Dieser
war an Pfingsten 2015 von beiden Kirchen in Kraft gesetzt
worden.
Die ökumenische Dimension des Pfingstfestes entdecken
„Der Heilige Geist und die Einheit der Kirche, Pfingsten und die
Ökumene sind untrennbar miteinander verbunden. Zu Pfingsten gehört
das Gebet um die Herabkunft des Geistes Gottes, der uns die volle,
sichtbare Einheit der Kirche schenkt“, so Oberkirchenrat Manfred
Sutter und Domkapitular Franz Vogelgesang in ihrem Vorwort. Beide
verweisen zugleich auf die positiven Erfahrungen des Ökumenischen
Kirchentags in Speyer: „Die Begeisterung und das intensive
Miteinander, das wir an Pfingsten 2015 in Speyer erlebt und
gefeiert haben, soll durch die Feier der vorgestellten
pfingstlichen Gottesdienste erneuert und vertieft werden“.
Vorlagen für verschiedene Anlässe und Zielgruppen
Die Arbeitshilfe enthält 18 fertig ausgearbeitete
Gottesdienstmodelle. Darunter sind klassische Feierformen wie ein
Wortgottesdienst oder eine Vesper, aber auch Vorlagen für freiere
Liturgieformen wie eine Nacht der Kirchen oder einen Stationenweg.
Im Blick ist die ganze pfingstlich geprägte Zeit. Deshalb sind auch
Texte für eine Pfingstnovene in den Tagen zwischen Christi
Himmelfahrt und Pfingsten sowie für eine Pfingstvigil am Vorabend
des Pfingstfestes enthalten. Ein KiTa-, ein Jugend- und ein
Familiengottesdienst nehmen unterschiedliche Altersstufen in den
Blick. Darüber hinaus finden sich sechs Lesepredigten und Impulse
für die Verkündigung. Weitere liturgische Texte und
Gestaltungselemente wollen dazu anregen, neue Feierformen für
andere Zielgruppen, an ungewohnten Orten und mit niederschwelligem
Charakter zu entwickeln.
Die Buntheit der unterschiedlichen liturgischen Traditionen
entdecken
Für Vogelgesang besteht ein wichtiges Anliegen der Broschüre
darin, hauptamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger möglichst zu
entlasten: „Alle Gottesdienstmodelle sind so angelegt, dass sie
auch ohne Pfarrerinnen und Pfarrer gefeiert werden können. Damit
nehmen wir zugleich die Geistbegabung aller Gläubigen ernst“.
Wichtig ist den Herausgebern zu betonen, dass die Gottesdienste
auch offen sind für die Beteiligung weiterer Kirchen. Neben dem
Redaktionsteam, bestehend aus Pfarrer Thomas Borchers
(Theologischer Referent im Landeskirchenrat), Clemens Schirmer
(Liturgiereferent des Bistums) und Dr. Thomas Stubenrauch
(Ökumenereferent des Bistums), und weiteren Autoren aus Bistum und
Landeskirche haben deshalb auch Mitglieder anderer ACK-Kirchen
Texte verfasst. Damit, so Sutter, werde die „Vielfalt der
verschiedenen liturgischen Traditionen und Verkündigungsformen
erlebbar“ und das „gottesdienstliche Leben der Gemeinden
bunter“.
Alle Pfarreien und Kirchengemeinden in Bistum und Landeskirche
erhalten demnächst kostenfrei Ansichtsexemplare zugesandt.
Weitere Exemplare können für 3,50 Euro (ab 10 Exemplaren: 3,00
Euro) zzgl. Porto erworben werden.
Bezugsadressen sind:
· Bischöfliches
Ordinariat
HA I – Seelsorge / Stabsstelle Ökumene
Webergasse 11 – 67346 Speyer
06232/102249 – oekumene@bistum-speyer.de
· Landeskirchenrat
Dezernat 3
Domplatz 5 – 67346 Speyer
06232/667116 – Dezernat.3@evkirchepfalz.de
Text und Foto: is
08.03.2016
Zusammenarbeit der Gemeinden stärken
Landeskirche legt Leitfaden für Kooperationen und
regionale Vernetzungen vor
Speyer- Unter dem Titel „Gemeinde geht
weiter“ will die Evangelische Kirche der Pfalz die Zusammenarbeit
der Kirchengemeinden und die Vernetzung unterschiedlicher
Arbeitsbereiche stärker profilieren. In einem Leitfaden stellt das
Institut für kirchliche Fort- und Weiterbildung Schritte für
Projekte vor, die von kooperierenden Gemeinden in den zentralen
Handlungsfeldern Verkündigung, Bildung und Diakonie durchgeführt
werden können. „Regionale Kooperation ist nicht das Ende der
Kirchengemeinde, sondern stärkt sie“, sagte Oberkirchenrat
Gottfried Müller bei der Vorstellung des Leitfadens. Regionale
Vernetzung und menschennahe Angebote vor Ort seien unersetzlich,
erklärte Müller.
Ziel sei es zum Beispiel, Pfarrerinnen und Pfarrer im
Verwaltungsbereich zu entlasten und von der Alleinzuständigkeit zur
arbeitsteiligen Kooperation zu ermutigen. Zugleich bestehe die
Chance, das geistliche Profil zu stärken und die eigenen Gaben in
die Arbeit besser einzubringen, erklärte der für Planungsfragen
zuständige Oberkirchenrat. Zur Entlastung sollen zum Beispiel in
Projekten sogenannte „Standardassistenzen“ erprobt werden. Dabei
teilen sich die Gemeinden in einer regionalen Kooperationszone
fachlich ausgebildete Sekretärinnen, die Verwaltungsaufgaben
übernehmen.
Weitere Projekte, die von April 2016 bis Oktober 2018 umgesetzt
werden sollen, sind nach Auskunft Müllers neben dem Aufbau eines
Freiwilligenmanagements und eines Gottesdienstkonzepts für die
Region auch die Jugend- und Konfirmandenarbeit sowie der Bereich
von Musik, Theater, Kunst und Kultur. Dabei gelte es bei der
Umsetzung mit Bedacht und Konzept vorzugehen und als Gemeinden in
der Kooperation mit externen Partnern neue Möglichkeiten zu
entdecken. Die Projekte, so zeigt sich der Oberkirchenrat gewiss,
führten zu der Einsicht, dass „vieles künftig besser möglich sein
wird, wenn wir zusammenarbeiten. Und wenn wir zusammenarbeiten,
wird vieles möglich sein, was bisher nicht ging“.
Mit dem Leitfaden wird nach den Worten von Oberkirchenrat Müller
der Auftrag der Landessynode umgesetzt, der im Zusammenhang mit dem
im Mai 2014 in Homburg beschlossenen Perspektivpapier die Bildung
von Kooperationszonen vorgesehen habe. Die von diesen nun neu zu
entwickelnden Konzepte und Projekte orientierten sich an Christi
Auftrag und der Lebenswelt der Menschen. Bei allen Veränderungen
von Kirchengemeinde und Gemeindepfarrdienst bleibe nach
evangelischem Verständnis die Kirche zuerst Gemeinde, in der das
Evangelium in Wort und Tat verkündigt werde, betonte Müller. Die
pfälzische Kirchenverfassung bezeichne die Gemeinde als
„Pflanzstätte des Glaubens“.
Der Leitfaden „Gemeinde geht weiter! Konzepte entwickeln in
regionaler Vernetzung“ ist in der Reihe Butenschoen Campus des
Instituts für kirchliche Fortbildung in Landau erschienen.
Eine Übersicht und aktuelle Informationen gibt es unter www.gemeinde-geht-weiter.de.
lk
08.03.2016
Religionsunterricht spielt eine zentrale Rolle
 27 Lehrer
zum Fach „Evangelische Religion“ bevollmächtigt
27 Lehrer
zum Fach „Evangelische Religion“ bevollmächtigt
Speyer/Ebernburg- Kirchenpräsident
Christian Schad hat 27 Religionslehrerinnen und -lehrern die
Urkunden zur Bevollmächtigung für den evangelischen
Religionsunterricht überreicht. Religionsunterricht habe die
doppelte Aufgabe, die eigene religiöse Tradition verständlich zu
machen und zugleich dazu zu befähigen, sich mit anderen Religionen
und Kulturen zu verständigen, sagte Schad bei der
Urkundenverleihung in der protestantischen Kirche in Ebernburg.
Voraussetzung für den Erwerb der Bevollmächtigung ist die Teilnahme
an einer vorbereitenden Tagung, dem Vokationskurs. Zugleich
verpflichtet sich die evangelische Kirche, Religionslehrer bei
ihrer Arbeit durch Beratung, Fortbildung und geistliche Begleitung
zu unterstützen.
Bei der Vermittlung einer toleranten Gesinnung in einer religiös
und weltanschaulich pluralen Gesellschaft spiele
Religionsunterricht eine zentrale Rolle, sagte Kirchenpräsident
Schad. „Toleranz setzt voraus, dass Menschen zu dem stehen, was sie
im Innersten bindet – und deshalb auch achtungsvoll mit dem
umgehen, was Anderen wichtig ist.“ Aufgabe des
Religionsunterrichtes sei es aber auch, die Grenzen der Toleranz zu
markieren, sagte Schad. „Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit,
fundamentalistische Überlegenheitsbehauptungen oder die
Rechtfertigung von Gewalt sind Haltungen, die keine Toleranz
verdienen.“
Kirchenrat Thomas Niederberger, Leiter des landeskirchlichen
Amtes für Religionsunterricht, gratulierte den Religionslehrerinnen
und Religionslehrern zu ihrem wichtigen Dienst. Die Bedeutung
religiöser Bildung könne zurzeit kaum überschätzt werden, und die
Lehrenden seien als Vertrauenspersonen und Spezialisten für Lebens-
und Orientierungsfragen auch persönlich zunehmend gefragt, so
Niederberger. Der Religionsunterricht ist in Deutschland laut
Grundgesetz (Artikel 7.3) ordentliches Lehrfach und damit
staatliche Aufgabe. Zugleich gehört er in den Verantwortungsbereich
der Kirchen, die nach Maßgabe ihrer Grundsätze über die Ziele und
Inhalte des Unterrichtsfachs Religion entscheiden. So beteiligt
sich nach dem Willen des Grundgesetzes die Kirche in der
Gesellschaft an der Gestaltung von Schule und Bildung. Text und
Foto: Landeskirche
07.03.2016
Neuer Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde
Speyer- Ab 01. Mai ist Herr Pfarrer Uwe
Weinerth neuer Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde in Speyer.
Diese Ernennung wurde durch die Kirchenregierung der Ev. Kirche der
Pfalz (Prot. Landeskirche) beschlossen.
Prot. Dekanat Speyer, Presse
03.03.2016
Katrin Göring-Eckardt lobt Katholikentag
 Die
Politikerin im Interview mit 100 Tage, 100 Menschen
Die
Politikerin im Interview mit 100 Tage, 100 Menschen
Leipzig- Die Fraktionsvorsitzende von Bündnis
90/Die Grünen Katrin Göring-Eckardt begrüßt die Entscheidung des
Katholikentags, die AfD von seinen Podien und Diskussionen
auszuladen: "Der Katholikentag macht klar, dass ihm der
gesellschaftliche Zusammenhalt am Herzen liegt", sagt
Göring-Eckardt in einem Interview, das für die Seite www.100tage100menschen.de
geführt worden ist und als exklusiver Vorabdruck am 25.2. in der
ZEIT-Beilage "Christ & Welt" erscheint.
"Seine Entscheidung zeugt von Selbstbewusstsein. Er zeigt
Haltung und macht deutlich, dass Hetze, Rechtspopulismus und
Rassismus nicht mit seinen Werten vereinbar ist und keinen Platz
auf dem Katholikentag haben."
Göring-Eckardt spricht sich außerdem für die Bezuschussung von
Kirchen- und Katholikentagen durch Länder und Kommunen aus und lobt
die Impulse, die von den Treffen ausgehen: "Es sind keine
innerkirchlichen Debatten, sondern daran sind viele Menschen aus
der Gesellschaft beteiligt."
Mit Blick auf die Ökumene - ein wichtiges Thema beim Leipziger
Katholikentag - sagt Göring-Eckhardt: "Ich glaube, dass uns in den
Konfessionen viel mehr verbindet als uns trennt. Und dass wir
einander kritisieren, wie es Freunde untereinander tun, das bringt
uns gemeinsam vorwärts."
Am 13. März erscheint das Interview mit Katrin Göring-Eckhardt
online unter www.100tage100menschen.de.
Wie alle Beiträge auf der Seite steht es unter der Creative Commons
Attribution CC BY-ND 4.0 und darf somit auch von anderen Medien
publiziert werden.
Das Porträt ist ist Teil eines Multimediaprojekts des Deutschen
Katholikentags, das seit 16. Februar 100 Tage lang Geschichten von
Menschen erzählt, die mit dem Katholikentag in Leipzig in
Verbindung stehen oder in Berührung kommen werden.
Der 100. Deutsche Katholikentag ist eine christliche
Großveranstaltung. Er findet vom 25. bis 29. Mai 2016 in Leipzig
statt. Erwartet werden mehrere Zehntausend Gäste aus dem gesamten
Bundesgebiet sowie der Region. Katholikentage werden vom
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle
zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 99. Deutsche
Katholikentag fand 2014 in Regensburg statt.
Text: 100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016 e.V. ,
Presse
25.02.2016
Flüchtlinge auf dem Dorf willkommen heißen
 Initiative stellt Arbeitshilfe vor – Ländliche Region
bietet gute Voraussetzungen für Integration
Initiative stellt Arbeitshilfe vor – Ländliche Region
bietet gute Voraussetzungen für Integration
Mainz/Speyer- (ekhn/lk). Diakonie und
evangelische Kirche haben in Mainz eine Broschüre vorgestellt, die
beim Aufbau von ehrenamtlicher Hilfe für Flüchtlinge auf dem Land
helfen will. Unter dem Titel „Willkommen im Dorf“ bietet das Heft
auf 48 Seiten Tipps, wie auch ohne professionelle Strukturen vor
Ort mit Freiwilligen dennoch eine sinnvolle Unterstützung für
Hilfesuchende aufgebaut werden kann. Unterstützt wird die
Veröffentlichung von der Diakonie Hessen, der Evangelischen Kirche
in Hessen und Nassau, der Evangelischen Kirche im Rheinland und der
Evangelischen Kirche der Pfalz.
Das Heft basiert auf den Erfahrungen der Initiative „Willkommen
im Dorf“ aus dem rund 1600 Einwohner zählenden Jugenheim in
Rheinhessen. Demnach biete sich gerade im ländlichen Raum eine
besondere Chance zur Integration. Eine Schlüsselrolle könnten dabei
unter anderem die örtlichen Vereine übernehmen. Die Broschüre
enthält einen Mix aus Sachinformationen zum Thema Flucht und
Integration, praxisnahen Tipps mit Checklisten, gelungenen
Beispielen, Erzählungen von Erlebnissen sowie persönlichen
Statements.
Nach Worten des evangelischen Propstes für Rheinhessen,
Klaus-Volker Schütz, ist die Unterbringung von Flüchtlingen in
ländlichen Regionen wegen fehlender Infrastruktur wie etwa nahe
gelegenen Geschäften oder Arztpraxen oft eine Herausforderung.
Zugleich gebe es aber „im Dorf weniger Anonymität, jeder kennt
jeden und man kümmert sich um die Nachbarn“, so Schütz. Dies seien
gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Integration, die auf dem
Land besser gelingen könne als in städtischen Ballungsräumen. Die
neue Broschüre wolle diese positive Erfahrung vermitteln.
Die Jugenheimer Pfarrerin Sarah Kirchhoff hebt hervor, dass es
auf dem Land oft leichter sei, Netzwerke zu bilden. So seien in
ihrem Ort „alle Vereine, politische Parteien und interessierte
Bürgerinnen und Bürger“ in das Engagement für Flüchtlinge von
Anfang an eingebunden worden. Daraus sei ein spezielles
„Patensystem“ entstanden, „damit sich Beziehungen besser entwickeln
können“, so Kirchhoff. Neben den Patenschaften für einzelne
Familien seien auch Patenschaften für ein Haus oder eine Wohnung
mit Flüchtlingen entstanden. Nach Kirchhoff haben vor allem die
Vereine eine wichtige Funktion: „Wenn ein Flüchtlingsmädchen singen
will, eine Flüchtlingsfrau zur Gymnastik möchte oder ein Junge
Fußball spielen will, dann wenden sich die Patinnen und Paten an
den entsprechenden Verein. Die sorgen dafür, dass die geflüchteten
dazu in der Wohnung abgeholt und auch wieder zurückgebracht
werden.“
Uli Röhm, Mitbegründer von „Willkommen im Dorf“ weist darauf
hin, dass das Jugenheimer Patenmodell inzwischen bundesweit für
Aufmerksamkeit sorgt. Dies habe zuletzt immer wieder zu Anfragen
geführt. Dies sei der Anstoß für die Initiative gewesen, „die
praktischen Erfahrungen aufzuschreiben“. Material zur Unterstützung
bei der späteren Betreuungsarbeit von Geflüchteten habe es genügend
gegeben. Dagegen habe Hilfe, wie eine Initiative schnell aufgebaut
werden könne, bisher gefehlt.
Hinweis: Information zum Thema gibt es auch über das
Webportal www.menschen-wie-wir.de. Die
Arbeitshilfe „Willkommen im Dorf“ kann als gedrucktes Exemplar
kostenlos angefordert werden bei der Diakonie Hessen, Meike Haas,
Ederstraße 12, 60486 Frankfurt am Main, E-Mail: meike.haas@diakonie-hessen.de.
24.02.2016
Kirche St. Ludwig in Speyer wurde profaniert
 Speyer- Die Kirche St. Ludwig in Speyer wurde Anfang
Februar profaniert. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat in einem
Profanierungsdekret festgelegt, dass die Kirche ihre Weihe verliert
und auf Dauer einem profanen Gebrauch zugeführt wird. Anfang des
Jahres hatte sich das Bistum Speyer entschieden, das Bistumshaus
und die Kirche St. Ludwig in der Speyerer Innenstadt an das
Mannheimer Unternehmen „Diringer & Scheidel Wohn- und
Gewerbebau GmbH“ zu verkaufen.
Speyer- Die Kirche St. Ludwig in Speyer wurde Anfang
Februar profaniert. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat in einem
Profanierungsdekret festgelegt, dass die Kirche ihre Weihe verliert
und auf Dauer einem profanen Gebrauch zugeführt wird. Anfang des
Jahres hatte sich das Bistum Speyer entschieden, das Bistumshaus
und die Kirche St. Ludwig in der Speyerer Innenstadt an das
Mannheimer Unternehmen „Diringer & Scheidel Wohn- und
Gewerbebau GmbH“ zu verkaufen.
Die Kirche des ehemaligen Dominikanerklosters stammt aus dem 13.
Jahrhundert. 1689 wurde sie mit einem Großteil der alten
Reichsstadt von den Truppen Ludwigs XIV. zerstört. Im Zug der
Wiederbesiedlung der verödeten Stadt kam es 1698 zum Wiederaufbau
des Dominikanerklosters, von der Kirche wurde allerdings nur der
Chor wiederhergestellt.
Schon 1794 erlitt die Kirche durch die französischen
Revolutionstruppen erneut Verwüstungen. 1802 nach dem Untergang des
alten Bistums Speyer wurde das Kloster schließlich versteigert.
1830 konnte das Gebäude zurückgekauft und in der Folgezeit mit der
von August von Voit umgestalteten Kirche zu einem Konvikt, einem
Studienseminar für künftige Priesterkandidaten, ausgebaut werden.
1935 baute der Architekt Albert Boßlet nach Westen hin ein
zusätzliches Joch an die Kirche.
Text: Bistum Speyer, Presse
22.02.2016
Beruf des Gemeindediakons für Einsteiger attraktiv gestalten
 Papier zum Berufsbild und Umfrage bestätigen
Handlungsbedarf – Synode greift Thema auf
Papier zum Berufsbild und Umfrage bestätigen
Handlungsbedarf – Synode greift Thema auf
Speyer- (lk). Gesellschaft und Kirche
befinden sich im Umbruch – das stellt auch ihre Berufsgruppen, wie
beispielsweise Pfarrer und Gemeindepädagogen, vor neue
Herausforderungen. In Folge des Strategiepapiers „Mutig
voranschreiten“ der Landeskirche hat deren Gleichstellungsstelle
eine Umfrage unter 111 Mitarbeitern in den gemeindenahen Diensten
zur „Life-Work-Balance“ – der Ausgewogenheit von Arbeits- und
Lebensverhältnissen – gestartet. Die Ergebnisse liegen jetzt ebenso
vor wie ein vom „Arbeitskreis Berufsprofil der Gemeindediakone“
erarbeitetes Positionspapier mit dem Titel „Den Weg mutig
weitergehen“. Demnach ist es „dringend notwendig“, den Beruf des
Gemeindediakons und des Jugendreferenten weiterzuentwickeln, sagt
Paul Neuberger, landeskirchlicher Beauftragter für gemeindenahe
Dienste.
Mit dem Berufsprofil von Gemeindediakonen und Jugendreferenten
wird sich auch die Frühjahrssynode der Evangelischen Kirche der
Pfalz befassen. Das Positionspapier sei die konsequente Fortführung
der gemeinsamen Bemühungen um eine Profilierung der Berufsgruppen
und ihrer Berufsfelder, erklärt der für Gemeindediakone und
Jugendreferenten zuständige Dezernent, Oberkirchenrat Gottfried
Müller. Gemeindediakone beraten, begleiten und qualifizieren
Ehrenamtliche, sind für religionspädagogische und
gesellschaftspolitische Bildungsangebote zuständig und arbeiten
auch im Bereich Seelsorge und Verkündigung. Arbeitsschwerpunkt der
Jugendreferenten ist es, Jugendarbeit vor Ort zu initiieren und
Ehrenamtliche für die Jugendarbeit zu gewinnen und sie zu
begleiten.
Zunehmende Arbeitsverdichtung haben nach den Worten der
Gleichstellungsbeauftragten der Landeskirche, Pfarrerin Belinda
Spitz-Jöst, Fragen nach einem ausgewogenen Verhältnis von Arbeits-
und Privatleben herausgefordert. Viele Umfrageergebnisse dieser
Life-Work-Balance-Studie stimmen mit den Erkenntnissen des von dem
Arbeitskreis erarbeiteten Positionspapiers überein, so Neuberger.
Beispiel: Zwei Drittel der befragten Mitarbeiter in den
gemeindenahen Diensten sind älter als 50. Daher sei es eine der vom
Arbeitskreis formulierten Forderungen, den Beruf des
Gemeindepädagogen und des Jugendreferenten für junge Menschen
attraktiv zu gestalten.
Kinder-, Jugend- und Familienarbeit, Erwachsenenbildung und
Seniorenarbeit: Aus vielen Bereichen der Gemeindearbeit und
weiteren kirchlichen Arbeitsfeldern sei Gemeindediakonie nicht mehr
wegzudenken, sagt Paul Neuberger. „Gemeindediakone versehen ihren
Dienst als pädagogische Fachleute im partnerschaftlichen
Miteinander mit den Pfarrerinnen und Pfarrern und müssen ständig
auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren.“ Neuberger,
Jugendreferent der Protestantischen Jugendzentrale Speyer, nennt
Personalentwicklung, Fort- und Weiterbildung, die Vernetzung der
Dienste untereinander und die Begleitung von Berufseinsteigern als
Schwerpunkte. Dafür bedürfe es eines „langfristig angelegten
landeskirchlichen Konzeptes“.
Belinda Spitz-Jöst verweist in diesem Zusammenhang auf eine
Life-Work-Balance-Umfrage unter Pfarrerinnen und Pfarrern vor fünf
Jahren: Solche Erhebungen seien „absolut notwendig“. Letztlich gehe
es nicht nur um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben,
sondern auch um die Gesundheit derer, die in der Kirche ihren
Dienst tun.
Hintergrund: Nach dem Modell der Jugendzentralen entstand
in den 1990er Jahren die Idee, Einrichtungen zu schaffen, die die
Gemeindearbeit im Kirchenbezirk stärken sollten. 2002 beschloss die
Landessynode die Einführung Gemeindepädagogischer Dienste. Dem
vorausgegangen waren Modellprojekte in Ludwigshafen und
Obermoschel. Heute gibt es in elf Kirchenbezirken
Gemeindepädagogische Dienste: Bad Bergzabern, Bad Dürkheim,
Donnersberg, Frankenthal, Germersheim, Homburg, Kaiserslautern,
Landau, Ludwigshafen, Pirmasens und Zweibrücken. Landeskirchliche
Beauftragte für gemeindenahe Dienste sind Paul Neuberger und Thomas
Klein.
22.02.2016
Mega-Staudamm bedroht Mensch und Natur
 Bischof Wilmar Santin mit Weihbischof Otto Georgens
Bischof Wilmar Santin mit Weihbischof Otto Georgens
Bischof Wilmar Santin berichtet über den Kampf für
Menschenrechte in Brasilien
Speyer / Tapajòs (Brasilien)- Die
Misereor-Fastenaktion steht in diesem Jahr unter dem Motto „Das
Recht ströme wie Wasser“ und macht damit auf die schwierige
Rechtssituation von Millionen Menschen in Brasilien aufmerksam.
Über den Kampf der Menschen gegen den Bau eines weiteren Staudamms
in der brasilianischen Region Pará informierte der brasilianische
Bischof Wilmar Santin bei einem Pressegespräch im
Karmelitinnenkloster in Speyer. Santin ist selbst Karmelit und seit
2011 Bischof der Prälatur Itaituba im Amazonas-Bundesstaat Pará in
Brasilien. Er teilt die Sorgen der Menschen um die Sicherung ihrer
Lebensgrundlagen und unterstützt den Kampf gegen den Staudammbau am
Tapajós und damit auch die Arbeit der Kommission für Landpastoral
in seiner Prälatur.
Die indigene Bevölkerung lebt unmittelbar am und mit dem Fluss
Tapajós. „Sollte die Regierung den Bau des Staudamms verwirklichen,
wird das Wohngebiet dieser Menschen überflutet und sie wären
gezwungen umzusiedeln“, machte Bischof Santin im Gespräch mit
Weihbischof Otto Georgens, dem Bischofsvikar für weltkirchliche
Aufgaben im Bistum Speyer, deutlich. Misereor unterstützt vor Ort
Gruppen und Organisationen, die die Menschen über ihre Rechte
aufklären und sie bei Behördengängen und Rechtsstreitigkeiten
begleiten.
„Das Problem Amazoniens ist ein Problem aller. Wir alle haben
darüber nachzudenken und gemeinsame Lösungen zu suchen“, sagt
Bischof Wilmar Santin. Ihn treibt die Frage um, wie der geplante
Studamm bei Itaituba das Leben der Menschen am Tapajos-Fluss
verändern wird. Ein Großteil der Bewohner lebt am und vom Fluss.
Die „Ribeirinhos“ (Ufermenschen) würden Heimat und Lebensgrundlage
verlieren. Zudem ist dem Bischof klar, dass mit dem riesigen
Staudammprojekt – Schleusen zur Schiffbarmachung eingeschlossen –
ein weiterer gravierender Eingriff in das für die gesamte
Menschheit so wichtige Ökosystem Amazoniens verbunden sein
würde.
Itaituba steht seit Jahrzehnten für die problematischen
Veränderungen in Amazonien. Die 100000-Einwohnerstadt liegt an der
Transamazonica, die Straße, die das Amazonasgebiet wirtschaftlich
erschließen soll. Vor einem Vierteljahrhundert stand bei Itaituba
noch dichter Dschungel. Er war gefürchtet – wegen der Jaguare,
wegen der Riesenschlangen, wegen der kriegerischen Stämme von
Ureinwohnern. Heute muss man von der Stadt aus lange fahren, um
überhaupt noch zusammenhängende Urwaldstücke zu sehen.
Satellitenbilder zeigen, dass das Ausmaß der Abholzung im
brasilianischen Amazonaswald seit einigen Jahren wieder deutlich
zunimmt, signifikant in der Region rings um Itaituba, wie Experten
festgestellt haben. Die Sägewerke der Stadt liefern großteils
direkt ins Ausland – an Kunden in China, Deutschland und Kanada,
legal und auch illegal.
Auf den gerodeten Flächen weiden Rinderherden, und es werden
gigantische Monokulturen aus Sojafeldern angelegt. Die Ernte wird
per Schiff an die Küste transportiert und von dort aus als
Viehfutter exportiert – vor allem nach Europa. Die Abholzung ist in
jedem Fall hoch profitabel – auf Kosten der Natur und der
Menschen.
Eine neue Bedrohung von Natur und Mensch ist das geplante
Staudammprojekt. Insgesamt 726 Quadratkilometer misst der geplante
Stausee am Tapajos, so groß wie die drei größten Seen Deutschlands
– Bodensee, Chiemsee und Mü̈ritzsee – zusammen. Er soll 10
Milliarden Euro kosten. 53 Meter hoch ragt dann eine gewaltige, 7,5
Kilometer lange Staumauer auf, die den Tapajos stauen und das Land
ü̈berfluten wird.
Kirche kämpft mit den Menschen
Noch ist hier die Heimat von Tausenden Kleinbauern und Fischern
sowie dem Volk der Munduruku, denen das Land ihrer Väter heilig
ist. Wo sie bleiben sollen, ist ungewiss und auch, wovon sie dann
leben werden. Die CPT, die Landpastoral des Bistums Itaituba,
kämpft mit den Menschen der Region gegen den Staudammbau und berät
die Kleinbauern und Munduruku ü̈ber ihre Rechte auf Wohnen und auf
kulturelle Selbstbestimmung. Die CPT wird dabei von Misereor aus
Deutschland unterstü̈tzt.
Laut Informationen der Tageszeitung „Estado de São Paulo“ plant
die Regierung in Brasilia, beim geplanten Staudamm in Itaituba die
bisher gültigen Vorschriften im offiziellen Genehmigungsverfahren
zu ändern, was die Kritiker des Projektes zusätzlich aufhorchen
lässt. Dem Zeitungsbericht zufolge sollen aus dem
Genehmigungsverfahren die soziale Faktoren betreffenden Punkte, wie
beispielsweise Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung,
Gesundheit, öffentliche Sicherheit und Bildung, aus dem bisherigen
Umweltgenehmigungsverfahren ausgegliedert und in einer neu zu
schaffenden Institution behandelt werden. Das Verfahren soll damit
beschleunigt werden. Das hätte zur Konsequenz, dass für Einsprüche
so gut wie keine Zeit mehr bleiben würde. Kritiker sehen darin
einen weiteren Angriff auf die in der Verfassung garantierten
Rechte der vom Staudammprojekt betroffenen Bevölkerung. Der
Staudamm São Luiz do Tapajos ist der zweitgrößte der derzeit in
Planung beziehungsweise in Bau befindlichen Staudämme in
Brasilien.
„Eine starke Zeit der Umkehr“
Die jährliche Misereor-Aktion fällt in die Fastenzeit. Für
Bischof Santin sind diese Wochen „eine starke Zeit der Umkehr“.
Eine Zeit, „intensiv die Barmherzigkeit, die Geschwisterlichkeit,
die Solidarität und die Vergebung zu leben“. All dies könnten wir
nicht für uns allein, unterstreicht er in seinen Predigten und
Ansprachen. „Wir müssen uns öffnen und die Wirklichkeit weit und
global betrachten“, ist er überzeugt und nennt als Beispiel die
Thematik der Flüchtlinge und Einwanderer, die verzweifelt ihr Leben
riskieren, um in Europa Sicherheit zu finden.
Als eine weitere „komplizierte Wirklichkeit“, die nach
„Aufmerksamkeit und einer Positionierung aller Menschen guten
Willens“ verlangt, nennt er die „Wirklichkeit“ in Amazonien. „Die
Probleme sind vielfältig: Abholzung, sklavenähnliche Arbeit,
Zerstörung der Natur durch Ausbeutung der Erze unter völliger
Missachtung der Umwelt.“ Das jetzt geplante Stadudammprojekt am
Tapajos sei ein schwerer Angriff auf die Umwelt und die Rechte der
indigenen Völker und Flussanrainer. „Dieser Fall der geplanten
Staudämme erfordert von uns allen eine gemeinsame internationale
Hilfs- und Solidaritätsaktion“, appelliert der Bischof.
Weitere Informationen zur Misereor-Fastenaktion: www.misereor.de
Text: Kirchenzeitung „Der Pilger“ / Foto: is
21.02.2016
Rohrbach tut dem Hospiz für Landau und die Südliche Weinstraße gut!
 Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang (l.) und Marc Sellmann, Leiter des Bereichs Altenhilfe (r.), nehmen die Spende von Christine Krieg und Claudia Westermann (v. l.) entgegen.
Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang (l.) und Marc Sellmann, Leiter des Bereichs Altenhilfe (r.), nehmen die Spende von Christine Krieg und Claudia Westermann (v. l.) entgegen.
4.518 Euro hat der Verein Rohrbach tut gut! für das
geplante Hospiz für Landau und die Südliche Weinstraße
gespendet.
SÜW/Landau- Es handelt sich bei der Summe, die
Vereinsvorsitzende Christine Krieg und die zweite Vorsitzende
Claudia Westermann am 18. Februar überreichten, um die Hälfte des
Erlöses von „Zimt und Zauber“. Unter diesem Titel organisiert der
Verein seit 2009 am zweiten Adventswochenende einen etwas anderen
Weihnachtsmarkt, auf dem in persönlicher Atmosphäre vor allem
Vereine des Ortes Speisen, Getränke und vieles mehr für den guten
Zweck verkaufen. „Bei uns kann sich jeder im Rahmen seiner
Möglichkeiten einbringen“, so Christine Krieg.
Von dem besonderen Zauber des Marktes hat sich
Bethesda-Geschäftsführer Dieter Lang, der als Vertreter des
Fördervereins Hospiz LD-SÜW die Spende entgegennahm, im Dezember
selbst überzeugt. Er hat dort die Pläne für das Hospiz vorgestellt,
das am Gelände von Diakonissen Bethesda Landau entstehen soll: Die
Einrichtung mit acht Plätzen soll eine Versorgungslücke in Stadt
und Region schließen und die bewährte ambulante Hospizhilfe
ergänzen, um schwerstkranken und sterbenden Menschen eine
umfassende medizinische, pflegerische und psychosoziale Begleitung
zu ermöglichen. „Kranken- und Pflegeversicherungen decken die
Investitionskosten von geschätzten zwei Millionen Euro nur zu einem
geringen Teil, daher freuen wir uns, dass sich viele Privatleute,
Firmen und Vereine für unser Projekt interessieren und es mit
Spenden finanziell unterstützen“, freute sich Dieter Lang über die
Spende des Rohrbacher Vereins.
Spendenkonten:
VR Bank Südliche Weinstraße, IBAN DE93 5489 1300 0000 4414 06,
BIC GENODE61BZA
VR Bank Südpfalz, IBAN DE55 5486 2500 0002 7300 73, BIC
GENODE61SUW
Sparkasse Südliche Weinstraße, IBAN DE31 5485 0010 1700 8080 80,
BIC SOLADES1SUW
Informationen zum Hospiz für Landau und die Südliche Weinstraße
bzw. den Förderverein Hospiz LD-SÜW e. V. unter www.diakonissen.de
Informationen zum Verein Rohrbach tut gut! e. V. unter www.rohrbach-tut-gut-de.
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim, Presse
20.02.2016
Till Strang wird neuer Vorsitzender des Kirchentagsausschusses
 Till Strang
Till Strang
Nach 18 Jahren scheidet Gert Langkafel aus dem Amt –
Wechsel auch in der Geschäftsführung
Speyer- (lk). Till Strang wird neuer
Vorsitzender des Landesauschusses Pfalz des Deutschen Evangelischen
Kirchentags (DEKT). Dies hat das Gremium einstimmig beschlossen.
Der 28-jährige Sozialversicherungsfachangestelle aus Neustadt tritt
die Nachfolge von Gert Langkafel an, der am 1. April 2016 nach 18
Jahren den Vorsitz aus Altersgründen aufgibt. Der Landessauschuss
ist mitverantwortlich für die Vorbereitung und Nacharbeit der
Kirchentage und ist unter anderem beteiligt bei der Auswahl der
Mitwirkenden. Zudem unterstützt er die Teilnehmerwerbung im Bereich
der Landeskirche. Der nächste DEKT, zu dem bis zu 200.000
Teilnehmer erwartet werden, findet vom 24. bis 28. Mai 2017 in
Berlin und Wittenberg statt.
Der neue Vorsitzende bringt Erfahrung in der Kirchentagsarbeit
mit. Als Pfadfinder gehört er bereits dem „ständigen Ausschuss
Helferdienste“ des DEKT an, der mit der Geschäftsstelle des
Kirchentages die Arbeit der rund 5.000 ehrenamtlichen Helfer
koordiniert. Seinen ersten Kirchentag erlebte der neue
Landesausschussvorsitzende als Teilnehmer 2003 in Berlin. Till
Strang ist Presbyter der Kirchengemeinde Neustadt-Hambach und seit
2015 Mitglied der Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz.
Im Landesvorstand Rheinland-Pfalz / Saar des Verbandes Christlicher
Pfadfinder war Strang als jugendpolitischer Sprecher aktiv.
Seit dem Kirchentag 1983 in Hannover nimmt Gert Langkafel aus
Ludwigshafen-Edigheim an dem alle zwei Jahre stattfindenden
Großereignis teil. 18 Jahre war der gelernte Chemotechniker
Vorsitzender des pfälzischen Landesausschusses und in dieser
Funktion als Mitglied der Präsidialversammlung an der Planung und
Durchführung von zwölf Kirchentagen beteiligt. Außerdem
organisierte der 78-Jährige zwei regionale Kirchentage in
Ludwigshafen und Mannheim und gehörte zum Organisationsteam der
Protestationsfeiern 2004 und des Ökumenischen Kirchentages 2015 in
Speyer. Langkafel war u-.a. Vorsitzender der Bezirkssynode
Ludwigshafen.
Mit dem Wechsel im Vorsitz hat zudem die bisherige
Geschäftsführerin des Landessausschusses, Andrea Keßler ihre
Tätigkeit aufgegeben. Sie war seit 2003 im Amt. Ihr folgt Beate
Stein aus Speyer.
Seit seiner Gründung 1949 versteht sich der Kirchentag als
einflussreiche Laienbewegung im Protestantismus und als
„evangelische Zeitansage“. Sein erster Präsident war der spätere
Bundespräsident Gustav Heinemann. Im Mittelpunkt des jeweils
viertägigen Treffens stehen Bibelarbeiten und Diskussionsforen,
kulturelle Veranstaltungen und Begegnungen.
18.02.2016
Das Schaf gewinnt!
 Bremer
Musikprojekt erhält Preis der deutschen Katholikentage
Bremer
Musikprojekt erhält Preis der deutschen Katholikentage
Leipzig/Bremen- Das Musikprojekt "Das Schaf
gewinnt" der Bremer Kinder- und Jugendkantorei erhält den
diesjährigen Preis der Deutschen Katholikentage, den
Aggiornamento-Preis. Außerdem ausgezeichnet werden der Arbeitskreis
Asyl Maintal sowie das Nachtcafé Dresden, eine Initiative für
Wohnungslose. Dies gab die Jury des Preises in Leipzig bekannt.
"Das Schaf gewinnt" ist ein Musiktheaterstück, an dem Bremer
Kinder und Jugendliche unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen
beteiligt sind. Im Mittelpunkt steht dabei ein Schaf, das mit
Phänomenen wie Flucht, Krieg und Gewalt konfrontiert wird.
Musikalisch anspruchsvolle Arbeit wird in dem Projekt mit der
Erziehung zu sozialer Verantwortung wie Hausaufgabenbetreuung oder
Chorferienfreizeiten verbunden. Damit trägt der von Eltern
gegründete Verein wesentlich zu einer gelingenden Integration bei,
gerade in benachteiligten Stadtteilen mit einem hohen Anteil an
jungen Menschen mit Migrationshintergrund, so die Jury. Auch die
modellhafte ökumenische Zusammenarbeit wurde gewürdigt. Das Projekt
wird mit 5.000 Euro Preisgeld bedacht. Das Stück "Das Schaf
gewinnt" wird zudem auf dem Katholikentag im Mai in Leipzig
aufgeführt.
Mit 3.000 Euro ausgezeichnet wird der Arbeitskreis Asyl Maintal,
der Flüchtlinge in verschiedenen Lebensbereichen unterstützt. Neben
Beratungsangeboten und Sprachkursen werden Sportaktivitäten und
Ausflüge angeboten. Eine eigene Fahrradwerkstatt fördert die
Zusammengehörigkeit und den Spracherwerb der Flüchtlinge. Der
Arbeitskreis setzt sich komplett aus Ehrenamtlichen verschiedener
Konfessionen und Konfessionslosen zusammen.
Das in Ökumene betriebene Nachtcafé Dresden wird mit 2.000 Euro
Preisgeld unterstützt. Es stellt Bedürftigen Betten und sanitäre
Einrichtungen über Nacht zur Verfügung, wäscht unterdessen die
Tageskleidung und versorgt mit warmen Mahlzeiten und Lunchpaketen
für den Tag. Mit der Auszeichnung dieses Angebots für Wohnungslose
soll der Blick auf eine soziale Gruppe gelenkt werden, die derzeit
im Zuge der Flüchtlingskrise wenig im Mittelpunkt steht. Das
ehrenamtliche Engagement dieser Einrichtung hat inzwischen
modellhaft in viele Diözesen hineingewirkt.
ZdK-Generalsekretär Stefan Vesper lobte die Bandbreite der
Bewerbungen: "Alle eingesandten Projekte zeigen die Bedeutung
christlicher Initiativen für die gesellschaftspolitische
Entwicklung in Deutschland. "Ob der Einsatz für Integration oder
Resozialisierung - die Preisträger seien beispielhaft in ihrer Art,
wie sie innovativ und kreativ Herausforderungen der Zeit angingen.
"Dieses Engagement zeichnen wir gern aus."
Der vom Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) gestiftete
Preis wird während des 100. Deutschen Katholikentags im Mai dieses
Jahres zum dritten Mal verliehen. Der Preis zeichnet Initiativen
aus, die einen Bezug zum Leitwort des jeweils nächsten
Katholikentags aufweisen oder sich mit drängenden
gesellschaftspolitischen Fragen beschäftigen.
Der 100. Deutsche Katholikentag ist eine christliche
Großveranstaltung. Er findet vom 25. bis 29. Mai 2016 in Leipzig
statt. Erwartet werden mehrere Zehntausend Gäste aus dem gesamten
Bundesgebiet sowie der Region. Katholikentage werden vom
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle
zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 99. Deutsche
Katholikentag fand 2014 in Regensburg statt.
Text: 100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016 e.V., Presse
13.02.2016
Der Segen zur Konfirmation gewinnt für die Jugendlichen an Bedeutung
 In
der pfälzischen Landeskirche werden in diesem Jahr rund 5.000
Jugendliche konfirmiert
In
der pfälzischen Landeskirche werden in diesem Jahr rund 5.000
Jugendliche konfirmiert
Speyer- (lk). Dieses Jahr lassen sich
in der Evangelischen Kirche der Pfalz rund 5.000 Jungen und Mädchen
konfirmieren. Dass es zehn Jahre zuvor noch etwa 7.000 Jugendliche
waren, liegt vor allem an der sinkenden Geburtenrate, erklärt
Pfarrer Andreas Große von der Konfirmandenarbeitsstelle der
Landeskirche. In der Pfalz und der Saarpfalz ließen sich etwa 94
Prozent aller Getauften eines Jahrganges konfirmieren. „Damit
stehen wir innerhalb der Evangelischen Kirche in Deutschland gut
da“, sagt Große.
Wie dieser Wert von Gemeinde zu Gemeinde variiert, zeigen im
Vergleich Zahlen aus ländlichen und städtischen Gebieten. So lassen
sich laut Gemeindepfarrer Christopher Markutzik in
Sausenheim-Neuleiningen dieses Jahr zwölf der 14 getauften
Jugendlichen konfirmieren, in der Martin-Luther-Gemeinde in
Neustadt seien es dagegen von 43 getauften Jugendlichen nur 25
Konfirmanden, so Pfarrer Frank Schuster.
Die Kirche sehe sich einem größer werdenden Wettbewerb mit
anderen Angeboten für Jugendliche ausgesetzt, sagt Christopher
Markutzik und räumt ein, dass jungen Leuten am Ende der
zweijährigen Konfirmationszeit ein Fest und Geschenke winke. Die
Beobachtungen des Pfarrers werden von einer Studie der
Konfirmandenarbeitsstelle bestätigt: Demnach sind für rund zwei
Drittel der Konfirmanden die Feier und die Geschenke eine der
Hauptmotivationen, sich konfirmieren zu lassen. Knapp die Hälfte
der Konfirmanden besucht der Studie zufolge zudem den
Konfirmationsunterricht, „weil es in der Familie so Brauch
ist“.
Doch je näher die Konfirmation rückt, desto mehr tritt der
Inhalt der Konfirmation in den Vordergrund, sagt Andreas Große.
„Der Segen zur Konfirmation gewinnt für die Jugendlichen immer mehr
an Bedeutung. Offensichtlich spüren sie, dass sie hier etwas ganz
Besonderes und Stärkendes mit auf den Weg bekommen“, sagt der
Pfarrer. Der Neustadter Pfarrer Frank Schuster bestätigt dies:
„Jugendliche fühlen sich in ihrer bewusst getroffenen Entscheidung
zur Konfirmation nicht ernst genommen, wenn man ihnen nur
materielle Motive unterstellt.“
Das meint auch Jürgen Dunst, zuständiger Referent der Basler
Mission Pfalz, die wieder zur Konfirmandendankspende aufruft. Mit
dem Geld sollen in diesem Jahr Stipendien für die Schul- und
Berufsausbildung von Jugendlichen in Papua ermöglicht werden. Die
GKI-Kirche in Papua (Gereja Kristen Injili di Tanah
Papua/Evangelische Kirche im Land Papua) ist eine Partnerkirche der
Evangelischen Kirche der Pfalz. Die Tradition, sozial- und
entwicklungspolitische Projekte von Partnerkirchen zu unterstützen,
gibt es seit 1973. Jährlich kämen bei der Konfirmandendankspende
bis zu 15.000 Euro zusammen, erklärt Dunst. Der Aufruf zur
Dankspende appelliere an die Konfirmanden, über das eigene
Beschenktwerden hinaus auch an andere zu denken.
Pfarrer Andreas Große sieht die Chancen der Kirche in der Arbeit
mit Konfirmanden. Diese bräuchten Ansprechpartner, die sie ernst
nähmen, ihnen Lebens- und Glaubensentwürfe vorlebten und mit ihnen
den Glauben entdeckten. „Die Jugendlichen brauchen in der Pubertät
Menschen, die bereit sind, sich ihren Fragen in dieser schwierigen
Lebensphase zu stellen und sie zu begleiten.“ Es sei nicht immer
einfach, mit einer Gruppe von 25 Pubertierenden aus allen Sozial-
und Bildungsschichten zu arbeiten, bestätigt Schuster. „Aber es
lohnt sich und ist wichtig, in diesem Alter ein Übergangsritual ins
Erwachsenenleben anzubieten und den Jugendlichen bei ihren Fragen
und Problemen zur Seite zu stehen“.
Die Konfirmationen finden in der pfälzischen Landeskirche
traditionell zwischen dem Sonntag nach Aschermittwoch und Pfingsten
statt. Mit der Konfirmation wird unter anderem das Recht
zugesprochen, Pate zu werden und ab dem 14. Lebensjahr an
kirchlichen Wahlen teilzunehmen.
Hinweis: Ein Informationsheft zur Konfirmandendankspende
kann beim Missionarisch-Ökumenischen Dienst/Basler Mission Pfalz in
Landau unter Telefon 06341/9289-11, E-Mail: schoelch@moed-pfalz.de
angefordert werden. Mehr zum Thema unter www.moed-pfalz.de und www.mission-21.org.
12.02.2016
Minister Robbers "Integration braucht Zeit und langen Atem"
 Kirchliche Gerichte befassen sich mit theologischen und
rechtlichen Aspekten
Kirchliche Gerichte befassen sich mit theologischen und
rechtlichen Aspekten
Ebernburg- (lk). Die Integration von
Muslimen in die deutsche Verfassungsordnung und Gesellschaft
braucht nach Auffassung des rheinland-pfälzischen Justizministers
Gerhard Robbers Zeit und langen Atem. Wer im Angesicht der
aktuellen Flüchtlingssituation vom Scheitern der Integration
spreche, wisse nicht, wovon er rede. Gerade die Kirchen leisteten
vielfältige Unterstützung, von Sprachkursen über Kindertagesstätten
bis zu Krankenhäusern, erklärte Robbers bei der Tagung der
Mitglieder kirchlicher Gerichte in Bad-Münster am Stein-Ebernburg.
Freilich bleibe die Integration eine Mammutaufgabe.
Seit der ersten Zuwanderung in den 60er Jahren des 20.
Jahrhunderts habe sich viel getan. So seien Muslime kaum sichtbar
gewesen, hätten ihren Glauben im Privaten gelebt. Es habe kaum
Moscheen oder Beträume gegeben. Doch die Ausübung von Religion
erfordere auch Strukturen und Räume. Religionsfreiheit bedeute,
„dass die gleichen Rechte für alle gelten“. Das deutsche
Religionsverfassungsrecht sei flexibel genug, um die Bedürfnisse
der Muslime mit aufzunehmen, ohne dass grundsätzliche Veränderungen
notwendig seien, erklärte Robbers.
Dies gelte auch für den Religionsunterricht an öffentlichen
Schulen, wie er durch das Grundgesetz garantiert werde. Es müsse
geklärt werden, wer die Grundsätze eines muslimischen
Religionsunterrichts bestimme, sagte der Minister. Ein
verbindliches Lehramt, das zeige der Blick in evangelische
Verhältnisse, sei nicht erforderlich. Hier seien Parallelitäten
protestantischer und islamischer Theologie erkennbar, „es gibt bei
beiden ein unmittelbares Verhältnis des Einzelnen zu Gott; es gibt
bei beiden keinen heilsverbindlichen Klerus“.
Der Tübinger Theologieprofessor Christoph Schwöbel verwies in
seinem Beitrag darauf, dass pluralistische Gesellschaften die
Herausforderungen des Zusammenlebens nicht im Blick auf die
Vergangenheit oder auf eine gemeinsame Grundlage bewältigen können,
sondern nur auf gemeinsame Zielsetzungen hin. Die Religionen
müssten ihre je eigenen Ressourcen nutzen, um Möglichkeiten des
Zusammenlebens zu erkunden. „Es gibt kein Esperanto des Dialogs und
kein Weltethos“, sagte Schwöbel. Es könne keine Einheit auf Kosten
der Vielfalt geben. Wer eine Leitkultur fordere, zündele mit einem
Kulturkampf.
 Für Kirchenpräsident Christian Schad muss sich in den
Kirchen und Religionsgemeinschaften die Verwurzelung im eigenen
Glauben und die Befähigung zur Toleranz, die den Anderen als
Anderen respektiert, zugleich vollziehen. „Die für das Miteinander
der Religionen notwendige, überzeugte Toleranz entsteht nicht durch
Relativierung oder Zurücknahme der jeweiligen religiösen Identität,
sondern durch Vergewisserung im Eigenen“, sagte Schad. Kirchliche
Kindergärten und der Religionsunterricht gewönnen daher als Orte
der Identitätsbildung und der Begegnung von Menschen
unterschiedlicher religiöser Überzeugungen immer mehr an
Bedeutung.
Für Kirchenpräsident Christian Schad muss sich in den
Kirchen und Religionsgemeinschaften die Verwurzelung im eigenen
Glauben und die Befähigung zur Toleranz, die den Anderen als
Anderen respektiert, zugleich vollziehen. „Die für das Miteinander
der Religionen notwendige, überzeugte Toleranz entsteht nicht durch
Relativierung oder Zurücknahme der jeweiligen religiösen Identität,
sondern durch Vergewisserung im Eigenen“, sagte Schad. Kirchliche
Kindergärten und der Religionsunterricht gewönnen daher als Orte
der Identitätsbildung und der Begegnung von Menschen
unterschiedlicher religiöser Überzeugungen immer mehr an
Bedeutung.
An der Tagung der Mitglieder der kirchlichen Gerichte nahmen
Vertreter des Verfassungs- und Verwaltungsgerichts, der
Disziplinarkammer und der Schlichtungsstellen der Landeskirche und
des Diakonischen Werkes teil. Das Grundgesetz der Bundesrepublik
gibt den Kirchen das Recht, zur Entscheidung von Streitfällen im
Bereich ihrer eigenen Angelegenheiten kirchliche Gerichte zu
bilden. Diese sind wie staatliche Gerichte mit richterlicher
Unabhängigkeit ausgestattet.
11.02.2016
„Fastenzeit ist kein individuelles Abstinenzprogramm“
 Pontifikalamt
mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am Aschermittwoch im Dom zu
Speyer
Pontifikalamt
mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am Aschermittwoch im Dom zu
Speyer
Speyer- Mit einem Pontifikalamt hat Bischof
Karl-Heinz Wiesemann am Aschermittwoch die Fastenzeit eingeläutet.
Im Speyerer Dom stimmte er die Gläubigen auf die bewusste
Vorbereitung auf das Osterfest ein. Er rief dazu auf, sich auf den
wahren Kern des Fastens zu besinnen. Dem Pontifikalamt war eine
Pontifikalvesper vorausgegangen.
„Fastenzeit ist kein individuelles Abstinenzprogramm“, das es zu
absolvieren gelte, betonte der Bischof. Der Sinn des Fastens liege
nicht im „Abspecken“, sondern in einer tiefen Erfahrung, die in der
Gemeinschaft erlebt wird. Die Fastenzeit ist der gemeinsame Weg der
Kirche, auf dem man entdeckt, man ist nicht allein, betonte er.
„Gott will uns in dieser Zeit füreinander öffnen.“
Beim Fasten werde die Auferstehung eingeübt, führte der Bischof
weiter aus. Der Leib werde erhoben, die Auferstehung dringe in den
Geist, damit Freiheit neu entdeckt werden kann. Im Fasten sieht
Wiesemann eine „Gegenkraft zur Schwerkraft des Lebens“. Er verglich
die 40 Tage der österlichen Bußzeit mit der Wüstenwanderung des
Volkes Israel - einer entbehrungsreichen Zeit und der
bevorstehenden Begegnung mit der ersten Liebe, dem Einzug ins
gelobte Land. Es sei eine Zeit, in der Vertrauen auf den Herrn neu
geschöpft werde. Es gelte, „Gott im eigenen Leben wieder neu zu
entdecken, den Glaube als lebendige Kraft des Lebens neu zu
entfachen“.
 Wiesemann stellte heraus, dass die Bußzeit ihre Wurzeln
in der Vorbereitung auf die Taufe hat. Das sei nicht nur für die
Taufbewerber wichtig, sondern für jeden: „Christ-Sein bedeutet auch
immer wieder Christ-Werden“, sich immer wieder neu mit Gott und der
Kirche zu verbinden. In diesen 40 Tagen vor Ostern erneuere sich
die Kirche stets aufs Neue.
Wiesemann stellte heraus, dass die Bußzeit ihre Wurzeln
in der Vorbereitung auf die Taufe hat. Das sei nicht nur für die
Taufbewerber wichtig, sondern für jeden: „Christ-Sein bedeutet auch
immer wieder Christ-Werden“, sich immer wieder neu mit Gott und der
Kirche zu verbinden. In diesen 40 Tagen vor Ostern erneuere sich
die Kirche stets aufs Neue.
Bevor Wiesemann und Mitglieder des Domkapitels den Gläubigen die
Aschekreuze auf die Stirn zeichneten, bat er den Herrn um Beistand.
„Hilf uns, die 40 Tage der Buße in rechter Gesinnung zu
verbringen.“ Zu Beginn des Gottesdienstes hatte er Gott um Kraft
gebeten und die Gläubigen aufgefordert, den Herrn zu bitten, „dass
es eine Zeit der Gnade wird“.
Die musikalische Gestaltung war dem Aschermittwoch angemessen
zurückhaltend. Die Schola des Domchores unter Leitung von
Domkapellmeister Markus Melchiori ließ unter anderem gregorianische
Gesänge und deutsche Wechselgesänge erklingen. An der Orgel spielte
Domorganist Markus Eichenlaub.
Text und Foto: Yvette Wagner
11.02.2016
Bistum Speyer distanziert sich von Wahlplakat der „Linken“
Speyer- Die Partei „Die Linke“ verwendet
zurzeit ein Foto und eine Aussage von Papst Franziskus für ihren
Wahlkampf zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz.
Das geschieht ohne vorherige Anfrage und ohne Zustimmung der
katholischen Kirche. Das Bistum Speyer kritisiert dieses Vorgehen
und distanziert sich von der Wahlkampagne der „Linken“. Sie stellt
aus Sicht des Bistums Speyer eine unzulässige Vereinnahmung des
Papstes für den Wahlkampf dar. Mit seiner Stellungnahme reagiert
das Bistum auf Irritationen, die durch das Plakat ausgelöst
wurden.
Text: Bistum Speyer, Presse
10.02.2016
„Zusammenleben verschiedener Religionen kann bereichernd sein“
 Frater Matthias Rugel (links) und Pater Gangolf Schüßler (rechts).
Frater Matthias Rugel (links) und Pater Gangolf Schüßler (rechts).
Der Islam-Beauftragte des Bistums Speyer Pater Gangolf
Schüßler fordert für christliche Flüchtlinge ein „Recht auf
Beheimatung in christlichen Gemeinden“
Speyer- Seit vergangenem Herbst arbeitet Frater
Matthias Rugel SJ im Heinrich Pesch Haus. Seine Aufgabe: die
Koordination von Angeboten für Flüchtlinge und die Vernetzung mit
dem Arbeitskreis Flüchtlinge im Ludwigshafener Stadtteil
Oggersheim. Auch der Bildungsreferent Pater Gangolf Schüßler SJ ist
mit dem Thema „Kirche und Flüchtlinge“ befasst: Er ist
Islambeauftragter der Diözese Speyer und einer von vier
Koordinatoren des Christlich-Islamischen Gesprächskreises, der im
vergangenen Jahr sein 20jähriges Bestehen feierte. Mit beiden
sprach Brigitte Deiters, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit in
den katholischen Einrichtungen in Ludwigshafen.
Wie groß ist der Anteil an Flüchtlingen, die sich zum
Islam bekennen?
Rugel SJ: Das kann ich nur aus dem kleinen Ausschnitt heraus
beantworten, mit dem ich zusammenkomme. Und da sind schon 70 bis 80
Prozent der Flüchtlinge Muslime.
Welche Rolle spielt die Religionszugehörigkeit für
sie?
Rugel SJ: Auch das ist sehr unterschiedlich. Aber für
diejenigen, denen ihre Religion wichtig ist, gibt es auch
Schwierigkeiten, zum Beispiel wenn sie Wert darauf legen, ihre
Gebetszeiten einzuhalten. Das kann für Außenstehende schon
irritierend sein, wenn sie am Nachmittag in einer Schule zu beten
anfangen.
Schüßler SJ: Die Schwierigkeit besteht ja auch darin, dass der
Islam in keinster Weise einheitlich ist – zum großen Teil ist er
viel uneinheitlicher als das Christentum. Viele Muslime fühlen sich
keinem Verband oder einer Moschee zugehörig. Gleichzeitig muss man
bedenken, dass die Religion im alltäglichen Leben eines Muslims oft
eine größere Rolle spielt als für viele Christen.
Sehen Sie die Religion als Hindernis bei der
Integration?
Schüßler SJ: Historisch gibt es nichts, was einem Zusammenleben
verschiedener Religionen im Weg stünde, im Gegenteil, das kann sehr
bereichernd sein. Allerdings wissen viele Muslime, dass der Islam
sich modernisieren muss. Man ist sich aber nicht einig, was genau
dafür notwendig ist.
Das bedeutet konkret?
Schüßler SJ: Ob es Hindernisse in der Integration gibt, ist
nicht in erster Linie eine Frage der Religionszugehörigkeit,
sondern der kulturellen Prägung. Wenn sie aus einer hoch
patriarchalen Gesellschaft kommen, dann ist ihre Einstellung zum
Beispiel zur Rolle der Frau höchst wahrscheinlich eine andere als
wir sie in unserer modernen Gesellschaft pflegen; und darauf müssen
die Muslime in Deutschland eine Antwort finden.
Ich sehe eine andere große Gefahr, nämlich dass der Islam immer
stärker in eine radikale Ecke gestellt wird, wo er aber auf gar
keinen Fall hin gehört. Gleichzeitig behaupten einige der größten
Kritiker des Islams, sich auf unsere christliche Kultur berufen zu
können, obwohl sie, wenn man manche ihrer Äußerungen anschaut, vom
Christentum weit entfernt sind.
Was wäre aus Ihrer Sicht eine gute Haltung, in der
Christinnen und Christen den muslimischen Flüchtlingen begegnen
können?
Rugel SJ: Bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, mit denen ich
zu tun habe, sehe ich ein großes christliches Engagement: Menschen
zu helfen, die in Not sind und solidarisch zu handeln.
Schüßler SJ: Ich finde, die Kirchen machen das vorbildlich. Es
ist christlich zu sagen: Wenn es eine Notsituation gibt, dann hilft
man. Das ist übrigens auch eine Grundtendenz des Islams: Auch
Muslime sind sehr hilfsbereit.
Wie sollten die Kirchen auf die kleine Gruppe der
christlichen Flüchtlinge zugehen? Anders als auf die muslimischen
Flüchtlinge?
Schüßler SJ: Christen haben in vielen Ländern eine besondere
Verfolgungssituation, das führt zu einer besonderen Solidarität
untereinander. Sie haben ein Recht auf Beheimatung in christlichen
Gemeinden, ohne die anderen damit auszugrenzen. Man muss auf die
Not der Menschen sehen, wenn die Kapazitäten begrenzt sind – nicht
auf die Religionszugehörigkeit. Text und Bild: Brigitte
Deiters
06.02.2016
Fortbildungen und mehr für Engagierte in der Seelsorge
Neuauflage der Broschüre der Hauptabteilung Seelsorge im
Bischöflichen Ordinariat Speyer enthält breitgefächertes
Veranstaltungsangebot
Speyer- Über hundert Seiten dick ist das
neue Fortbildungsheft, das die Hauptabteilung Seelsorge im
Bischöflichen Ordinariat Speyer für das Jahr 2016 herausgibt.
Sowohl ehrenamtlich Engagierte als auch Mitglieder der
Pastoralteams in den Pfarreien finden in der Broschüre ein
breitgefächertes Angebot von Weiterbildungskursen und
Veranstaltungen aus allen Bereichen der Seelsorge, der
Büchereiarbeit sowie der Kirchenmusik. Ergänzend dazu bietet das
Heft auch einen Überblick über die Angebote des Bistums Speyer zum
Heiligen Jahr der Barmherzigkeit.
Nach den Pfarrgremienwahlen im vergangenen Oktober und der
Errichtung der 70 neuen Pfarreien beginne jetzt die Arbeit auf
allen Ebenen mit vielen Herausforderungen und auch eine Lernzeit,
so der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge, Domkapitular Franz
Vogelgesang im Vorwort der Broschüre. „Das Heft, das Sie in den
Händen halten, gibt allen eine Menge Hilfen an die Hand, die in den
verschiedenen Bereichen ihres Engagements Unterstützung, Fort- und
Weiterbildung benötigen. Schmökern Sie darin! Auch wenn Sie nicht
alle Kurse und Angebote wahrnehmen können, allein schon das Lesen
bringt Sie vielleicht auf ganz neue Ideen.“
Das Fortbildungsheft „Seelsorge“ erhalten im Bistum Speyer alle
Pfarrämter, alle katholischen öffentlichen Büchereien sowie alle
ehrenamtlich Engagierten, die schon Veranstaltungen der Abteilung
besucht haben. is
Nachbestellungen sind möglich bei:
Bischöfliches Ordinariat
HA I, Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen
Webergasse 11
67346 Speyer
Tel. 0 62 32 102 314
Mail: pfarrei-lebensraeume@bistum-speyer.de
04.02.2016
„Dritter Weg“ an Rechtsprechung angepasst
 Bistum Speyer lädt Gewerkschaften zur Beteiligung in
Arbeitsrechtkommission ein
Bistum Speyer lädt Gewerkschaften zur Beteiligung in
Arbeitsrechtkommission ein
Speyer- Erstmals können die Gewerkschaften
eigene Vertreter in die Kommission zur Ordnung des Diözesanen
Arbeitsvertragsrechtes (Bistums-KODA) entsenden. Nach dem Ende der
laufenden Amtszeit wird sie im Dezember 2016 neu gebildet. Im
aktuellen Amtsblatt der Diözese Speyer heißt es dazu: „Berechtigt
zur Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern sind
Gewerkschaften, die nach ihrer Satzung für Regelungsbereiche der
Bistums-KODA Speyer örtlich und sachlich zuständig sind.“ Innerhalb
von zwei Monaten nach Bekanntmachung im Amtsblatt des Bistums
Speyer können die Gewerkschaften Vertreterinnen und Vertreter
benennen, die sie in die Bistums-KODA entsenden möchten. Dabei
richtet sich die Anzahl der Gewerkschaftsvertreter nach der
Organisationsstärke der kirchlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Den Gewerkschaften ist insgesamt mindestens einer von
insgesamt neun Sitzen vorbehalten.
„Dritter Weg“: Dienstgemeinschaft regelt Arbeitsrecht
Die Neuerung der Ordnung für die Bistums-KODA ist Ergebnis eines
Urteils des Bundesarbeitsgerichts vom 20. November 2012 zum Thema
„Arbeitskampf in kirchlichen Einrichtungen – Dritter Weg“. Das
Bundesarbeitsgericht hatte entschieden, dass der Verzicht auf eine
Streikmöglichkeit im so genannten „Dritten Weg“ dann rechtmäßig
ist, wenn Gewerkschaften in das Verfahren der Arbeitsrechtsregelung
organisatorisch mit eingebunden werden. Diese Vorgabe des
Bundesarbeitsgerichts wird nunmehr umgesetzt.
Das Grundgesetz räumt den Kirchen das Recht ein, ihre
Angelegenheiten und somit auch das Arbeitsrecht selbst zu regeln
(„Dritter Weg“). Die Arbeitsrechtsregelungen kommen also nicht
durch den Abschluss von Tarifverträgen zustande, sondern durch
paritätisch besetzte Kommissionen. Im Bereich des Bistums Speyer
wird diese Aufgabe von der Kommission zur Ordnung des Diözesanen
Arbeitsvertragsrechtes (Bistums-KODA) wahrgenommen. Damit die
Interessen der Dienstnehmer- wie der Dienstgeberseite in der KODA
gleichermaßen vertreten sind, ist diese mit jeweils neun
Dienstnehmer- und neun Dienstgebervertreten besetzt. Mit dem System
des „Dritten Weges“ ist gewährleistet, dass Dienstnehmer- und
Dienstgebervertreter gemeinsam Regelungen aushandeln, die dann auf
breiter Basis beschlossen werden. So gibt es keinen tariffreien
Raum: Im Bistum Speyer sind alle Dienstgeber an die gesetzlichen
Regelungen gebunden.
Weitere Informationen zur Entsendung von Gewerkschaftsvertretern
in die Bistums-KODA sind im Oberhirtlichen Verordnungsblatt 8/2015
nachzulesen:
http://www.bistum-speyer.de/unterstuetzung-fuer-aktive/oberhirtliches-verordnungsblatt/
is
04.02.2016
Katholische Krankenhäuser engagieren sich für Flüchtlinge
 Gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Kreis- und
Stadtverwaltungen
Gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Kreis- und
Stadtverwaltungen
Speyer- Nach einem unsicheren Leben in
Kriegsgebieten und oft wochenlanger Flucht unter sehr schwierigen
Bedingungen sind die in Deutschland Asylsuchenden erschöpft und
manchmal auch krank. Die katholischen Krankenhäuser in Neustadt,
Speyer, Ludwigshafen, Landau, Rodalben, Zweibrücken und Landstuhl
und deren engagierte Mitarbeiter spielen auch eine wichtige Rolle
in der medizinischen Versorgung von Flüchtlingen, bieten aber auch
weitere Hilfen an.
 „Wir haben eine humanitäre Verantwortung für Menschen in
Not. Der Bedarf ist da und deshalb müssen wir tätig werden“, betont
Dr. Klaus Peter-Wresch, Ärztlicher Direktor im Speyerer Sankt
Vincentius Krankenhaus. Im vergangenen Jahr wurden hier 107
Flüchtlinge ambulant und 68 stationär versorgt. Seit der Eröffnung
der Speyerer Erstaufnahmeeinrichtung im Oktober seien die Zahlen
stark angestiegen. Oft handele es sich um Menschen, die hier das
erste Mal überhaupt versorgt werden, schildert der Chefarzt der
Anästhesie. Das Engagement der Einrichtung geht aber weit darüber
hinaus. Noch 2015 haben Mediziner, Pflegende und
Verwaltungsmitarbeiter des Speyerer Krankenhauses eine regelmäßige
medizinische Betreuung der Menschen in der neuen
Erstaufnahmeeinrichtung durch eine mehrmals in der Woche
stattfindende Sprechstunde aufgebaut – ehrenamtlich. Eine richtige
Praxis haben sie organisiert. Inzwischen wurde diese an die
niedergelassenen Mediziner übergeben. Doch das ist noch nicht
alles: Immer wenn neue Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung
ankommen, macht sich ein Team aus dem Vincentius Krankenhaus auf
den Weg. Sie nehmen die Flüchtlinge in Empfang und leisten eine
erste medizinische Untersuchung, sie erfassen akute Erkrankungen,
beraten bei chronischen Krankheiten und überprüfen die Hygiene.
Auch dies geschieht ehrenamtlich und wird durch die Kollegen, die
dann die Dienste übernehmen, und den Träger der Klinik
ermöglicht.
„Wir haben eine humanitäre Verantwortung für Menschen in
Not. Der Bedarf ist da und deshalb müssen wir tätig werden“, betont
Dr. Klaus Peter-Wresch, Ärztlicher Direktor im Speyerer Sankt
Vincentius Krankenhaus. Im vergangenen Jahr wurden hier 107
Flüchtlinge ambulant und 68 stationär versorgt. Seit der Eröffnung
der Speyerer Erstaufnahmeeinrichtung im Oktober seien die Zahlen
stark angestiegen. Oft handele es sich um Menschen, die hier das
erste Mal überhaupt versorgt werden, schildert der Chefarzt der
Anästhesie. Das Engagement der Einrichtung geht aber weit darüber
hinaus. Noch 2015 haben Mediziner, Pflegende und
Verwaltungsmitarbeiter des Speyerer Krankenhauses eine regelmäßige
medizinische Betreuung der Menschen in der neuen
Erstaufnahmeeinrichtung durch eine mehrmals in der Woche
stattfindende Sprechstunde aufgebaut – ehrenamtlich. Eine richtige
Praxis haben sie organisiert. Inzwischen wurde diese an die
niedergelassenen Mediziner übergeben. Doch das ist noch nicht
alles: Immer wenn neue Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung
ankommen, macht sich ein Team aus dem Vincentius Krankenhaus auf
den Weg. Sie nehmen die Flüchtlinge in Empfang und leisten eine
erste medizinische Untersuchung, sie erfassen akute Erkrankungen,
beraten bei chronischen Krankheiten und überprüfen die Hygiene.
Auch dies geschieht ehrenamtlich und wird durch die Kollegen, die
dann die Dienste übernehmen, und den Träger der Klinik
ermöglicht.
 Auch die Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie
Dr. med. Cornelia Leszinski ist mit aktiv. „Es
geht darum, dass aus Einzelerkrankungen keine Epidemie wird“,
berichtet sie. Durch engstes Zusammenleben auf der Flucht leiden
viele an Krätze, Läusen oder Durchfallerkrankungen. Aktuell gebe es
sehr viele fieberhafte und schwer Erkrankte. Die Medizinerin ist
aber auch an den Feiertagen vor Ort, wenn die eigentliche
Sprechstunde pausiert. „Die Pause ist sonst einfach zu lang“,
begründet sie den ehrenamtlichen Dienst an Weihnachten und Neujahr.
Die oft rein weiblichen Teams im Einsatz haben noch keine negativen
Erfahrungen gemacht, ist ihr wichtig. Im Gegenteil: „Wir erfahren
sehr sehr viel Dankbarkeit.“
Auch die Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie
Dr. med. Cornelia Leszinski ist mit aktiv. „Es
geht darum, dass aus Einzelerkrankungen keine Epidemie wird“,
berichtet sie. Durch engstes Zusammenleben auf der Flucht leiden
viele an Krätze, Läusen oder Durchfallerkrankungen. Aktuell gebe es
sehr viele fieberhafte und schwer Erkrankte. Die Medizinerin ist
aber auch an den Feiertagen vor Ort, wenn die eigentliche
Sprechstunde pausiert. „Die Pause ist sonst einfach zu lang“,
begründet sie den ehrenamtlichen Dienst an Weihnachten und Neujahr.
Die oft rein weiblichen Teams im Einsatz haben noch keine negativen
Erfahrungen gemacht, ist ihr wichtig. Im Gegenteil: „Wir erfahren
sehr sehr viel Dankbarkeit.“
Im Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt werden Flüchtlinge in der
Notaufnahme und verschiedenen Fachbereichen versorgt, berichtet
Krankenhausoberin Maria Heine, auch mehrere Geburten gab es
bereits. Darüber hinaus engagiert sich die Einrichtung auf
besondere Weise für die Integration. Bestes Beispiel ist Desbele
Tesfamhret, der hier am 1. Oktober die Ausbildung zum Gesundheits-
und Krankenpfleger begonnen hat. Davor hatte sich der 29-jährige
Flüchtling aus Eritrea, der vor der Flucht aus seinem Heimatland
als Englischlehrer arbeitete, als Ein-Euro-Jobber im Hetzelstift
bewährt und auch kräftig Deutsch gelernt. Bisher hat das Neustadter
Krankenhaus neun Flüchtlingen und Asylsuchenden über einen
1-Euro-Job Starthilfe gegeben. Einer von ihnen studiert, ein
weiterer junger Mann hat gerade das Freiwillige Soziales Jahr
begonnen. „Der Aufwand ist groß“, bewertet Claudia Reh von der
Krankenhauskommunikation, selbst ehrenamtlich aktiv für die
Integration von Flüchtlingen und Initiatorin dieser besonderen
Initiative in Neustadt. Aber die Mühe lohnt sich. Die Ein-Euro-Jobs
helfen den Asylbewerbern bei der Integration: Sie lernen die
Sprache schneller, ihr Tag ist strukturiert und sie erleben, wie
das Leben und die Arbeit in Deutschland funktionieren. Manchmal
gebe es leider auch Geschichten, die nicht funktionieren, so die
Verantwortliche. Dann wenn die Menschen wegen Erlebnissen in ihrer
Heimat oder auf der Flucht zu stark traumatisiert seien.
Im letzten Jahr wurden im Vinzentius-Krankenhaus Landau 283
Menschen mit einem Flüchtlingshintergrund behandelt, berichtet der
für die Öffentlichkeitsarbeit zuständige Heiko Ries. Alleine 105
Behandlungen gab es im Bereich Geburtshilfe, darunter auch mehrere
Geburten, und 64 in der Kinderheilkunde, schwerpunktmäßig bei
Magen-Darm-Erkrankungen, darüber hinaus im Feld der Inneren Medizin
und mit Erkrankungen aus der Bauchchirurgie, Unfallchirurgie und
der Harnorgane. „Die Sprache ist in vielen Fällen die erste Hürde.
Darüber hinaus erschweren zunehmend auch interkulturelle
Missverständnisse die Behandlung. Diese Entwicklung resultiert aus
den veränderten Herkunftsländern der Flüchtlinge. Es sind nun
arabische und afrikanische Migrationshintergründe, die ganz andere
Sozialisationen erfahren haben und auch in anderen oder keinen
vergleichbaren Gesundheitssystemen groß geworden sind“, schildert
Ries die Herausforderungen. Bereits seit vielen Jahren fühle sich
das Landauer Krankenhaus der Integration ausländischer
Mitbürgerinnen und Mitbürger verpflichtet.
Im St. Elisabeth-Krankenhaus in Landstuhl wurden im vergangenen
Jahr 33 Flüchtlinge behandelt, zwei davon zweimal, teilt der
Kaufmännische Direktor Rainer Kropp mit. Eine Herausforderung sei
auch hier die Verständigung, was unter anderem oftmals dazu führe,
dass keine Unterschrift durch den Patienten geleistet werde. Eigene
aus Syrien, Palästina und Jordanien stammende Ärzte helfen als
Dolmetscher.
 An den beiden Standorten des Nardini Klinikums St.
Elisabeth in Zweibrücken und St. Johannis in Landstuhl wurden 2015
rund 100 Flüchtlinge stationär und eine Vielzahl in den
Notfallambulanzen behandelt, erklärt Pflegedirektor Thomas Frank,
viele von ihnen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in Kusel und
Zweibrücken. Versorgt wurden Infektionen der Lunge und des
Magen-Darm-Traktes, schlecht heilende und chronische Wunden und
gynäkologische Erkrankungen. Hinzu kam die Versorgung von
Schwangeren, auch drei Kinder wurden geboren. „Die Behandlung von
Flüchtlingen stellte für uns eine große Herausforderung dar. Um uns
möglichst gut vorzubereiten, haben wir im Vorfeld Kontakt zu
Krankenhäusern aufgenommen, die bereits Erfahrungen mit dieser
Versorgungssituation hatten. Auf Grundlage dieser Gespräche haben
wir eine Organisationsrichtlinie mit medizinischen, pflegerischen,
hygienischen und administrativen Aspekten erstellt und diese in
kurzfristig organisierten Schulungen mit unseren Mitarbeitern
besprochen“, so Frank. Wegen der Sprachschwierigkeiten werden unter
anderem durch die Gesellschaft für Armut und Gesundheit in 14
Sprachen entwickelte Anamnesebögen verwendet, mit denen die
Mitarbeiter einen besseren Zugang zu den Menschen finden können.
Auch ein Zeigewörterbuch mache die Verständigung einfacher. Zudem
habe die interne Dolmetscherliste von Mitarbeitern mit besonderen
Sprachkenntnissen sehr geholfen. Vor allem mit den
Hilfsorganisationen, die vor Ort in Zweibrücken und Kusel die
Aufnahmeeinrichtungen koordinieren, und den niedergelassenen Ärzten
gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit, lobt der Pflegedirektor.
An den beiden Standorten des Nardini Klinikums St.
Elisabeth in Zweibrücken und St. Johannis in Landstuhl wurden 2015
rund 100 Flüchtlinge stationär und eine Vielzahl in den
Notfallambulanzen behandelt, erklärt Pflegedirektor Thomas Frank,
viele von ihnen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in Kusel und
Zweibrücken. Versorgt wurden Infektionen der Lunge und des
Magen-Darm-Traktes, schlecht heilende und chronische Wunden und
gynäkologische Erkrankungen. Hinzu kam die Versorgung von
Schwangeren, auch drei Kinder wurden geboren. „Die Behandlung von
Flüchtlingen stellte für uns eine große Herausforderung dar. Um uns
möglichst gut vorzubereiten, haben wir im Vorfeld Kontakt zu
Krankenhäusern aufgenommen, die bereits Erfahrungen mit dieser
Versorgungssituation hatten. Auf Grundlage dieser Gespräche haben
wir eine Organisationsrichtlinie mit medizinischen, pflegerischen,
hygienischen und administrativen Aspekten erstellt und diese in
kurzfristig organisierten Schulungen mit unseren Mitarbeitern
besprochen“, so Frank. Wegen der Sprachschwierigkeiten werden unter
anderem durch die Gesellschaft für Armut und Gesundheit in 14
Sprachen entwickelte Anamnesebögen verwendet, mit denen die
Mitarbeiter einen besseren Zugang zu den Menschen finden können.
Auch ein Zeigewörterbuch mache die Verständigung einfacher. Zudem
habe die interne Dolmetscherliste von Mitarbeitern mit besonderen
Sprachkenntnissen sehr geholfen. Vor allem mit den
Hilfsorganisationen, die vor Ort in Zweibrücken und Kusel die
Aufnahmeeinrichtungen koordinieren, und den niedergelassenen Ärzten
gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit, lobt der Pflegedirektor.
Im St. Marien- und St. Annastiftskrankenhaus Ludwigshafen werden
jede Woche etwa sieben Flüchtlinge in der zentralen Notaufnahme
versorgt und bei Bedarf auch stationär betreut, beschreibt Chefarzt
Thomas Borgmann. Vielleicht als Resultat der guten Zusammenarbeit
mit den Flüchtlingsunterkünften in der Stadt, vermutet ein
Verantwortlicher. Ein Teil der Mitarbeitenden ist hier ehrenamtlich
aktiv. Doch das ist noch nicht alles, auch zwei Ärztinnen der
Geburtshilfe waren bereits zur Hilfe vor Ort. Im Geburtszentrum der
Klinik haben ebenfalls mehrere Flüchtlingsfrauen entbunden. „Die
Hilfe ist uns und unseren Mitarbeitern ein wichtiges Anliegen.
Unser Vorteil bei der Betreuung ist unser multikulturelles Team,
unter anderem sind uns zwei aus Syrien stammende Ärzte beim
Dolmetschen behilflich und auch mehrere andere Mitarbeiter sprechen
arabisch oder kurdisch“, weist die Sprecherin des Ludwigshafener
Krankenhauses hin. Die Familienhebammen und Verantwortlichen im
Programm „Guter Start ins Kinderleben“ der Klinik setzen sich nach
der Geburt für die Familien mit Neugeborenen ein. Ein anderer Fokus
liegt auf der Versorgung von Kindern und Jugendlichen. Eine
besondere Herausforderung sei die Versorgung von unbegleiteten
minderjährigen Flüchtlingen. „Sie haben Überfälle erlebt, wurden
ausgeraubt, bedroht, geschlagen und noch viel Schlimmeres“,
schildert sie. In der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie
wurden schon mehrere Flüchtlinge behandelt. Die Fälle seien extrem
unterschiedlich und reichten vom syrischen Gymnasiasten bis zum
traumatisierten Jungen aus dem Irak, so die Sprecherin. Der
zuständige Chefarzt arbeite aktuell an einer Handreichung zum Thema
minderjährige unbegleitete Flüchtlinge für die Landeregierung.
Alle befragten katholischen Krankenhäuser der Diözese loben die
gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Kreis- und
Stadtverwaltungen, die unter anderem auch für die Vergütung der
Leistungen zuständig sind. Bei nichtregistrierten Flüchtlingen sei
die Abrechnung problematischer. Nicht in allen Fällen können die
Behandlungen vergütet werden, ist zu erfahren, dann springen die
verschiedenen Träger ein. „Wir stehen als konfessionelle
Einrichtungen in der Verpflichtung. Es ist selbstverständlich dort
zu helfen, wo wir die Möglichkeit dazu haben“, fasst
Krankenhausoberin Maria Heine aus dem Hetzelstift stellvertretend
für alle Befragten zusammen. Text und Bilder: Katja Hein
02.02.2016
„Beispielhafter Einsatz zugunsten von Menschen am Rande der Gesellschaft“
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann gratuliert Norbert Thines
zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Kaiserslautern –
Bereits im Dezember Auszeichnung mit Ehrenkreuz der Caritas
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann gratuliert Norbert Thines
zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Kaiserslautern –
Bereits im Dezember Auszeichnung mit Ehrenkreuz der Caritas
Speyer- Als „soziales Gesicht der Stadt
Kaiserslautern“ und „engagierten Kämpfer für Menschen in Not“ hat
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den früheren FCK-Präsidenten
Norbert Thines gewürdigt. Anlässlich der Verleihung der
Ehrenbürgerwürde der Stadt Kaiserslautern an Thines dankte Bischof
Wiesemann ihm in einem persönlichen Schreiben für sein langjähriges
kirchliches und soziales Engagement.
Norbert Thines ist der Pfarrei St. Maria und besonders der
Kolpingfamilie Kaiserslautern stark verbunden. Bereits in der
Kolping-Jugend aktiv, hat er die Kolpingfamilie rund drei
Jahrzehnte geleitet und gehört ihr heute als Ehrenvorsitzender an.
Das Leitwort des Seligen Adolph Kolping „Verantwortlich leben,
solidarisch handeln“ kennzeichnet aus Sicht des Bischofs auch das
vielfältige Engagement von Norbert Thines. Mit der Aktion
„alt-arm-allein“ habe er eine Organisation mitbegründet, die
älteren Menschen in Stadt und Landkreis Kaiserslautern engagiert
unter die Arme greift – menschlich, unbürokratisch und direkt. Auch
sein Einsatz für die Aktion „Bruderhilfe“, sein Mitwirken im
Sozialausschuss des Stadtrats von Kaiserslautern sowie sein
öffentliches Eintreten für die Integration von Flüchtlingen stünden
beispielhaft für eine christlich geprägte Grundhaltung, in der sich
Mitgefühl, Hilfsbereitschaft und soziale Verantwortung eng
miteinander verbinden.
„Als Christen sind wir gerufen, von unserem Glauben in Wort und
Tat Zeugnis zu geben. Das haben Sie in Ihrem Leben auf vielerlei
Weise immer wieder getan, in Familie, Beruf und Arbeitswelt, durch
die Übernahme von Verantwortung in Staat und Gesellschaft“,
würdigte der Bischof das Engagement von Norbert Thines, für das ihm
im Dezember des vergangenen Jahres bereits das Goldene Ehrenzeichen
des Caritasverband verliehen wurde.
Foto: 1 FCK Fanclub Fairplay e.V., Presse Text: Bistum
Speyer, Presse
29.01.2016
Sozialbestattungen 2016
Speyer- Lesen Sie hierzu den gemeinsamen Brief
der Katholischen Dompfarrei Pax Christi und der
Protestantischen Gesamtkirchengemeinde an die Bestatter als PDF.

PDF: Katholische Dompfarrei Pax Christi und Protestantische
Gesamtkirchengemeinde, Presse
29.01.2016
Zweite Hälfte 2016 bezugsfertig: 150 neue Flüchtlings-Wohnheimplätze in der Engelsgasse
 Bistum Speyer überlässt ehemaliges kirchliches Altenheim
kostenfrei für zehn Jahre (plus...) der Stadt Speyer
Bistum Speyer überlässt ehemaliges kirchliches Altenheim
kostenfrei für zehn Jahre (plus...) der Stadt Speyer
cr. Speyer- Mit der notariellen Beurkundung
eines Vertrages über die Nutzung des traditionsreichen ehemaligen
Altenheimes in kirchlicher Trägerschaft in der Speyerer Engelsgasse
sowie mit der symbolischen Übergabe der „Schlüsselgewalt“ für das
seit Jahren ungenutzt stehende Haus im Schatten des Kaiserdomes an
Oberbürgermeister Hansjörg Eger haben jetzt Stadt
und Bistum Speyer einen weiteren, gemeinsamen Schritt zur
Bereitstellung von Wohnraum für Flüchtlinge getan und damit
zugleich ein weiteres, starkes Zeichen ihrer Entschlossenheit
gesetzt, sich gemeinsam in dieser derzeit wohl vordringlichsten
Problemstellung unserer Gesellschaft zu engagieren.
 Bei einem Pressegespräch im „Blauen Salon“ der
Bischöflichen Finanzkammer, an dem neben dem Speyerer
Stadtoberhaupt und Generalvikar Dr. Franz Jung,
dem Leiter der Bistumsverwaltung und „alter Ego“ des Speyerer
Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann auch die verantwortlichen
Domkapitulare Peter Schappert - in der
Bistumsverwaltung zuständig für Finanzen und Immobilien – und
Karl-Ludwig Hundemer, Leiter des
Diözesan-Caritasverbandes, mit ihren Mitarbeitern teilnahmen,
erläuterten die Gesprächspartner das Konzept dieser Maßnahme, mit
der bis zur zweiten Jahreshälfte 2016 mit einem Aufwand von ca. 1,2
Mio. Euro Wohnraum für weitere rund 150 AsylbewerberInnen in Speyer
geschaffen werden solle. Über eine Subventionierung dieser Maßnahme
durch übergeordnete Institutionen auf Bundes- und Landesebene seien
erste Verhandlungen bereits aufgenommen worden.
Bei einem Pressegespräch im „Blauen Salon“ der
Bischöflichen Finanzkammer, an dem neben dem Speyerer
Stadtoberhaupt und Generalvikar Dr. Franz Jung,
dem Leiter der Bistumsverwaltung und „alter Ego“ des Speyerer
Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann auch die verantwortlichen
Domkapitulare Peter Schappert - in der
Bistumsverwaltung zuständig für Finanzen und Immobilien – und
Karl-Ludwig Hundemer, Leiter des
Diözesan-Caritasverbandes, mit ihren Mitarbeitern teilnahmen,
erläuterten die Gesprächspartner das Konzept dieser Maßnahme, mit
der bis zur zweiten Jahreshälfte 2016 mit einem Aufwand von ca. 1,2
Mio. Euro Wohnraum für weitere rund 150 AsylbewerberInnen in Speyer
geschaffen werden solle. Über eine Subventionierung dieser Maßnahme
durch übergeordnete Institutionen auf Bundes- und Landesebene seien
erste Verhandlungen bereits aufgenommen worden.
Mit diesen vom Stadtrat bereits beschlossenen Finanzmitteln, so
erläuterte Eger die geplante Maßnahme weiter, solle „die zur Zeit
leere Hülle des alten Gebäudes“ mit einer komplett neuen
technischen Infrastruktur zur Ver- und Entsorgung der rund 2.800 qm
großen Wohnfläche auf dem gut 1.300 qm messenden Grundstück
ausgestattet werden und das Gebäude selbst komplett barrierefrei
ausgerüstet werden“. Die künftigen Wohnräume für die Flüchtlinge
selbst - bis zuletzt noch als Depot für alte Kirchenarchivalien
genutzt, die im Zuge der Strukturreform des Bistums nach Speyer
überstellt werden mussten - würden mit Ausnahme kleiner,
verbessernder Änderungen - in ihrem bisherigen Zuschnitt
erhalten.
 Schließlich solle mit einem Kostenaufwand von rund 125.000
Euro durch die Niederlegung der in den 1960er Jahren errichteten
Kapelle – zuletzt nur noch für Kindergottesdienste und Meßfeiern
der kroatischen Gemeinde der Vorderpfalz genutzt – sowie durch die
Beseitigung einer bestehenden Doppelgarage die Zufahrt für
Rettungsfahrzeuge erleichtert und die Verkehrssicherheit in der von
Kindern und Schülern stark genutzten Engelsgasse erhöht und
zugleich eine völlig neue Eingangssituation für die
Flüchtlingsunterkunft geschaffen werden. Außerdem solle durch den
Einbau einer zweiten Fluchttreppe der Gewährleistung der wachsenden
Bedeutung des Brandschutzes Rechnung getragen werden.
Schließlich solle mit einem Kostenaufwand von rund 125.000
Euro durch die Niederlegung der in den 1960er Jahren errichteten
Kapelle – zuletzt nur noch für Kindergottesdienste und Meßfeiern
der kroatischen Gemeinde der Vorderpfalz genutzt – sowie durch die
Beseitigung einer bestehenden Doppelgarage die Zufahrt für
Rettungsfahrzeuge erleichtert und die Verkehrssicherheit in der von
Kindern und Schülern stark genutzten Engelsgasse erhöht und
zugleich eine völlig neue Eingangssituation für die
Flüchtlingsunterkunft geschaffen werden. Außerdem solle durch den
Einbau einer zweiten Fluchttreppe der Gewährleistung der wachsenden
Bedeutung des Brandschutzes Rechnung getragen werden.
Gemäß der oben genannten, jetzt geschlossenen Vereinbarung, wird
das Bistum Speyer das dann so sanierte und auf einen zeitgemäßen
baulichen Zustand gebrachte Flüchtlingswohnheim der Stadt Speyer
für zehn Jahre kostenfrei zur Nutzung überlassen - „und ich gehe
davon aus, dass wir das Haus auch noch das eine oder andere Jahr
länger nutzen können, sollte sich dies nach den zehn Jahren als
notwendig erweisen“, so der Oberbürgermeister zum Generalvikar.
Eger zeigte sich auch höchst erfreut darüber, dass sich der
Diözesan-Caritasverband darüber hinaus dankenswerterweise dazu
bereit erklärt habe, mit der Hälfte der anfallenden Personalkosten
– die andere Hälfte übernimmt die Stadt Speyer - eine von vier
derzeit noch unbesetzte Positionen aus einem Pool von zwanzig neu
geschaffenen Stellen für Sozialarbeiter zur Betreuung der
Flüchtlinge dem neuen Flüchtlingsheim in der Engelsgasse
zuzuweisen. „Damit wollen wir zugleich auch unserer grundsätzlichen
Überzeugung entsprechen und möglichst allen Unterkünften über 60
BewohnerInnen einen eigenen Betreuer zuordnen“, so Domkapitular
Hundemer dazu. Damit solle, wie bei anderen Objekten auch, eine
möglichst enge Betreuungs-Bindung zu den BewohnerInnen erreicht
werden.
 Dieser Grundsatz gelte aber fast noch mehr für ein
zweites, derzeit in der Entstehung befindliches Objekt am
Königsplatz, das die Stadt Speyer zur Unterbringung von rund 50
„unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen“ nutzen wolle und das
sie jetzt durch einen langfristigen Mietvertrag habe „sichern“
können. „Denn gerade solche Einrichtungen benötigen eine möglichst
dichte sozialpädagogische Begleitung“, erklärte der Domkapitular
dazu.
Dieser Grundsatz gelte aber fast noch mehr für ein
zweites, derzeit in der Entstehung befindliches Objekt am
Königsplatz, das die Stadt Speyer zur Unterbringung von rund 50
„unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen“ nutzen wolle und das
sie jetzt durch einen langfristigen Mietvertrag habe „sichern“
können. „Denn gerade solche Einrichtungen benötigen eine möglichst
dichte sozialpädagogische Begleitung“, erklärte der Domkapitular
dazu.
695 Flüchtlinge seien aktuell der Stadt Speyer neben den rund
480 in der Erstaufnahmestelle in der Kurpfalzkaserne
untergebrachten Asylbewerbern zugewiesen, so berichtete der
Oberbürgermeister bei dieser Gelegenheit weiter – und das alles
dank häufiger Wechsel bei sich fast täglich ändernden Fallzahlen.
All diese Flüchtlinge seien derzeit im besten Sinne „dezentral“ in
38 verschiedenen Einrichtungen quer über die Stadt verteilt
untergebracht – Einrichtungen, von denen die eine oder andere schon
lange vor ihrem Bezug schon vor dem Abriß gestanden habe, so Eger.
Um so mehr hoffe er nun darauf, dass es mit den beiden neuen,
„großen“ Einrichtungen im Herzen der Stadt möglich werde, an
bestehenden Gebäuden dringend notwendige Renovierungen vorzunehmen
oder sie gar durch längst anstehende Ersatzbauten ganz zu
kompensieren.
 Den Vertretern der Diözese Speyer dankte der
Oberbürgermeister schließlich für ihre „vom ersten Augenblick an
uneingeschränkte Bereitschaft, uns bei dieser gewaltigen
Herausforderung nachhaltig zu unterstützen“. Auch wenn die
Verhandlungen darüber - von außen betrachtet - mitunter durchaus
lang zu sein schienen, so müsse doch bedacht werden, dass viele
Probleme zu lösen gewesen seien, „die keiner von uns noch wenige
Monaten zuvor so auf seinem „Bildschirm“ gehabt hätte“.
Den Vertretern der Diözese Speyer dankte der
Oberbürgermeister schließlich für ihre „vom ersten Augenblick an
uneingeschränkte Bereitschaft, uns bei dieser gewaltigen
Herausforderung nachhaltig zu unterstützen“. Auch wenn die
Verhandlungen darüber - von außen betrachtet - mitunter durchaus
lang zu sein schienen, so müsse doch bedacht werden, dass viele
Probleme zu lösen gewesen seien, „die keiner von uns noch wenige
Monaten zuvor so auf seinem „Bildschirm“ gehabt hätte“.
Mit den beiden neuen Projekten jedenfalls hoffen Stadt und
Bistum darauf, ihren „bewährten Kurs“ bei der Flüchtlingsbetreuung
nach den gleichen Grundsätzen fortsetzen zu können wie schon
bisher: Kraftvoll, unaufgeregt - und inmitten des für die
Integration der Flüchtlinge besonders wichtigen „Herzen der Stadt“
- getragen von einem von selbstverständlicher Hilfsbereitschaft
getragenen christlichen Menschenbild, das sich letztlich Ausdruck
schafft in einer „gelingenden Willkommenskultur“. Foto:
gc
28.01.2016
Projekte für das neue Schulhalbjahr
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulabteilung des Bistums Speyer mit dem neuen Kalender (v.l.n.r.): Stefan Schwarzmüller, Birgitta Greif, Dr. Irina Kreusch, Monika Schuster und Petra Hildebrand-Hofmann.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Schulabteilung des Bistums Speyer mit dem neuen Kalender (v.l.n.r.): Stefan Schwarzmüller, Birgitta Greif, Dr. Irina Kreusch, Monika Schuster und Petra Hildebrand-Hofmann.
Das Bistum Speyer bietet Schulen Fortbildungen und Projekte
zu aktuellen Themen an - Neuer Kalender „Schule und Kirche.
Fortbildungen und mehr“
Speyer- Flucht und Migration sowie Fragen
zu Religionen, Krieg und Frieden sind Schwerpunkte im neuen
Kalender „Schule und Kirche. Fortbildungen und mehr“, den die
Hauptabteilung Schulen, Hochschulen und Bildung des Bistums Speyer
herausgibt. Schulen und Lehrerkollegien finden hier rund 60
Angebote und Termine für Unterricht und Projekte zum zweiten
Schulhalbjahr. Bereiche sind Religionspädagogik, Globales Lernen,
Erziehung und Prävention sowie Schulpastoral und Medien.
Die Veranstaltungen finden regional im gesamten Bistumsgebiet
statt.
Ein diözesanweites Projekt ist der Missio-Truck „Flucht.
weltweit“, der an elf Standorten im Bistum im Juni und Juli Halt
machen wird, als Kooperation von Caritasverband und diözesanen
Stellen. Lehrerfortbildungen im Vorfeld gehen mit Expertenteams die
Frage an, wie die komplexe Thematik an Schülerinnen und Schüler im
Unterricht herangetragen werden kann. Auch Besuche von
internationalen Gästen an Schulen werden vermittelt.
Den neue Kalender bestellen, online suchen und sich anmelden
kann man bei:
HA II Schulen, Hochschulen und Bildung
Gr. Pfaffengasse 13
67346 Speyer
Tel. 06232- 102-121
E-Mail: ru-fortbildungqbistum-speyer.de
www.bistum-speyer.de
Erziehung Schule Bildung
Text und Foto: is
28.01.2016
Bischof und sein Leitungsteam erläutern Schwerpunkte ihrer Arbeit im Jahr 2016
 Neue Pfarreienstruktur, Flüchtlingshilfe, Finanzstruktur
und „Heiliges Jahr der Barmherzigkeit“- „2016: Jahr vieler
Entscheidungen“
Neue Pfarreienstruktur, Flüchtlingshilfe, Finanzstruktur
und „Heiliges Jahr der Barmherzigkeit“- „2016: Jahr vieler
Entscheidungen“
cr./spk. Speyer- Irgendwie hängt halt
doch immer wieder alles mit allem zusammen. Das gilt „im wirklichen
Leben“ nicht anders als bei Großinstitutionen wie der Katholischen
Kirche, die jetzt erstmals seit Menschengedenken in einem
Pressegespräch in „ganz großer Besetzung“ im „Blauen Salon“ der
Bischöflichen Finanzkammer ihre Pläne für 2016 - das „Jahr Eins
nach der Einführung der neuen Pfarreienstruktur“ vorstellte. Dabei
ging es um ganz unterschiedliche Fragen von den Folgen eben dieser
neuen Pfarreienstruktur über allgemeine Baumaßnahmen bis hin zu dem
von Papst Franziskus ausgerufene „außerordentliche heilige Jahr der
Barmherzigkeit“ - alles zusammengehalten durch das Bemühen, den
auch weiterhin in großer Zahl ins Land strömenden Flüchtlingen aus
dem vorder- und mittelasiatischen Raum zu einer einer raschen und
gelingenden Integration zu verhelfen.
 Die weltweite Zunahme der kriegerischen
Auseinandersetzungen und der politischen Konflikte sowie das immer
weitere Umsichgreifen terroristischer Anschläge mache deutlich,
dass die Welt von einem Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit
sowie von einem verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung
derzeit so weit entfernt sei, wie lange nicht mehr, hob der
Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in
seinem Eingangsstatement hervor. In der Flüchtlingspolitik
polarisiere sich die Gesellschaft derzeit immer stärker. „Damit
aber geht in Teilen unserer Gesellschaft eine Verrohung in der
Kommunikation einher, die erschreckend ist“, so der Speyerer
Oberhirte. Immer öfter schlage dann die verbale in tatsächliche
Gewalt um, etwa wenn Flüchtlingsunterkünfte in Flammen aufgehen
oder, wie in der Silvesternacht in Köln, feierfreudige Passantinnen
zu Opfern sexueller Übergriffe werden. Für den Bischof stellen
diese Entwicklungen die nur Oberfläche einer tiefgreifenden
Verunsicherung und zunehmender Verlustängste in weiten Teilen der
Gesellschaft dar. In dieser Situation gelte es, das
Friedenspotential im Christentum, aber auch in anderen Religionen
neu zu entdecken. „Das Evangelium kann uns lehren, die Scheuklappen
des Egoismus und der Angst abzulegen und in allen Menschen gleich
welcher Nationalität und Herkunft unsere Brüder und Schwester zu
sehen und uns gemeinsam mit ihnen als Kinder des einen Gottes zu
begreifen, so Bischof Dr. Wiesemann.
Die weltweite Zunahme der kriegerischen
Auseinandersetzungen und der politischen Konflikte sowie das immer
weitere Umsichgreifen terroristischer Anschläge mache deutlich,
dass die Welt von einem Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit
sowie von einem verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung
derzeit so weit entfernt sei, wie lange nicht mehr, hob der
Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in
seinem Eingangsstatement hervor. In der Flüchtlingspolitik
polarisiere sich die Gesellschaft derzeit immer stärker. „Damit
aber geht in Teilen unserer Gesellschaft eine Verrohung in der
Kommunikation einher, die erschreckend ist“, so der Speyerer
Oberhirte. Immer öfter schlage dann die verbale in tatsächliche
Gewalt um, etwa wenn Flüchtlingsunterkünfte in Flammen aufgehen
oder, wie in der Silvesternacht in Köln, feierfreudige Passantinnen
zu Opfern sexueller Übergriffe werden. Für den Bischof stellen
diese Entwicklungen die nur Oberfläche einer tiefgreifenden
Verunsicherung und zunehmender Verlustängste in weiten Teilen der
Gesellschaft dar. In dieser Situation gelte es, das
Friedenspotential im Christentum, aber auch in anderen Religionen
neu zu entdecken. „Das Evangelium kann uns lehren, die Scheuklappen
des Egoismus und der Angst abzulegen und in allen Menschen gleich
welcher Nationalität und Herkunft unsere Brüder und Schwester zu
sehen und uns gemeinsam mit ihnen als Kinder des einen Gottes zu
begreifen, so Bischof Dr. Wiesemann.
Generalvikar Dr. Franz Jung: „Gemeindepastoral 2015 mit
Leben erfüllen“.
 Die inhaltlichen Schwerpunkte in der Arbeit des Bistums im
Jahr 2016 erläuterte sodann Generalvikar Dr. Franz
Jung. „Nach den Vorbereitungen der vergangenen sechs Jahre
und dem Abschluss des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“ im
vergangenen Jahr geht es jetzt um die Umsetzung des neuen
Seelsorgekonzeptes“, zeigte er als Linie auf. Die Pfarreien stünden
jetzt vor der Aufgabe, in den neu gewählten Pfarrgremien die
inhaltliche Arbeit aufzunehmen und ein pastorales Konzept für ihre
jeweilige Pfarrei zu entwickeln.
Die inhaltlichen Schwerpunkte in der Arbeit des Bistums im
Jahr 2016 erläuterte sodann Generalvikar Dr. Franz
Jung. „Nach den Vorbereitungen der vergangenen sechs Jahre
und dem Abschluss des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“ im
vergangenen Jahr geht es jetzt um die Umsetzung des neuen
Seelsorgekonzeptes“, zeigte er als Linie auf. Die Pfarreien stünden
jetzt vor der Aufgabe, in den neu gewählten Pfarrgremien die
inhaltliche Arbeit aufzunehmen und ein pastorales Konzept für ihre
jeweilige Pfarrei zu entwickeln.
Auf Bistumsebene nannte der Generalvikar die Konstituierung der
diözesanen Beratungsgremien als einen Schwerpunkt. Dazu würden im
Jahr 2016 zehn neue Dekane gewählt und eine Dekanekonferenz als
neues Beratungsgremium für die Diözese eingerichtet. Daneben werde
der Priesterrat, der Katholikenrat und der Diözesanpastoralrat
gewählt.
Auch das Qualitätsmanagement in den katholischen
Kindertageseinrichtungen solle im laufenden Jahr mit Nachdruck
fortgeführt werden. Dazu sei die Projektphase bereits erfolgreich
abgeschlossen worden. Zudem starte in diesem Jahr eine erste
Staffel von 38 Kindertageseinrichtungen mit der Umsetzung des
Qualitätsmanagements
in den jeweiligen Einrichtungen.
Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer: „Bisher schon 41
Immobilien für Flüchtlinge und Asylberechtigte im Bistum
bereitgestellt“.
 Über den aktuellen Stand der diözesanen Hilfsaktion
„Teile und helfe“ für die Flüchtlinge informierte sodann, der
Vorsitzende des Caritasverbandes für die Diözese Speyer.
Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer. Dabei konnte er
mitteilen, dass der Flüchtlingshilfefonds der Diözese Speyer, der
vom Bistum ursprünglich mit rund 1,5 Millionen Euro ausgestattet
worden war, durch Spenden und Kollekten mittlerweile um weitere
rund 300.000 Euro angewachsen sei. Der Caritasverband richte dazu
derzeit 20 zusätzliche Vollzeitstellen für die Flüchtlingshilfe
ein, unter anderen für die Sozialberatung in den
Landesaufnahmestellen sowie für die Migrationsberatung und die
Ehrenamtskoordination in den acht Caritas-Zentren. „Unsere Kurse
zur Qualifizierung Ehrenamtlicher sind stets stark nachgefragt
immer voll ausgebucht“, berichtete Domkapitular Hundemer.
Über den aktuellen Stand der diözesanen Hilfsaktion
„Teile und helfe“ für die Flüchtlinge informierte sodann, der
Vorsitzende des Caritasverbandes für die Diözese Speyer.
Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer. Dabei konnte er
mitteilen, dass der Flüchtlingshilfefonds der Diözese Speyer, der
vom Bistum ursprünglich mit rund 1,5 Millionen Euro ausgestattet
worden war, durch Spenden und Kollekten mittlerweile um weitere
rund 300.000 Euro angewachsen sei. Der Caritasverband richte dazu
derzeit 20 zusätzliche Vollzeitstellen für die Flüchtlingshilfe
ein, unter anderen für die Sozialberatung in den
Landesaufnahmestellen sowie für die Migrationsberatung und die
Ehrenamtskoordination in den acht Caritas-Zentren. „Unsere Kurse
zur Qualifizierung Ehrenamtlicher sind stets stark nachgefragt
immer voll ausgebucht“, berichtete Domkapitular Hundemer.
Der Caritasverband lege einen Schwerpunkt seiner Arbeit auf die
Hilfe für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge; auch der Malteser
Hilfsdienst MHD sei in mehreren Flüchtlingsunterkünften präsent.
„In allen Flüchtlingsunterkünften, die von uns betreut werden, sind
auch Informationen über Gottesdienste und Adressen von Kirchen und
Moschen verfügbar“, so
so der Domkapitular. Im Bistum Speyer seien bislang 41 Immobilien
für Flüchtlinge und Asylberechtigte bereitgestellt worden. Dadurch
hätten inzwischen 189 Menschen eine Unterbringung erhalten. Weitere
368 Plätze sind in Vorbereitung.
Domkapitular Vogelgesang: „Barmherzigkeit als Geheimnis des
Glaubens erkennen“
 Auf die Angebote des Bistums zum „Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit“ ging schließlich der Leiter der Hauptabteilung
Seelsorge des Bischöflichen, Domkapitular Franz
Vogelgesang, ein. Mit der Aktion „Mission Misericordia“
setze das Bistum Speyer einen Impuls, Türen im privaten,
öffentlichen oder kirchlichen Raum mit einem eigens für die Aktion
entwickelten Aufkleber zu bekleben und damit deutlich zu machen:
„Tritt ein, ich bin da für Dich!“. Im Speyerer Dom lade zudem ein
„Weg der Barmherzigkeit“ die Besucherinnen und Besucher dazu ein,
sich eingehender mit der Barmherzigkeit Gottes zu befassen. Deshalb
werde auch das Domweihefest 2016 am 2. Oktober seine besondere
Prägung durch das Heilige Jahr erfahren.
Auf die Angebote des Bistums zum „Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit“ ging schließlich der Leiter der Hauptabteilung
Seelsorge des Bischöflichen, Domkapitular Franz
Vogelgesang, ein. Mit der Aktion „Mission Misericordia“
setze das Bistum Speyer einen Impuls, Türen im privaten,
öffentlichen oder kirchlichen Raum mit einem eigens für die Aktion
entwickelten Aufkleber zu bekleben und damit deutlich zu machen:
„Tritt ein, ich bin da für Dich!“. Im Speyerer Dom lade zudem ein
„Weg der Barmherzigkeit“ die Besucherinnen und Besucher dazu ein,
sich eingehender mit der Barmherzigkeit Gottes zu befassen. Deshalb
werde auch das Domweihefest 2016 am 2. Oktober seine besondere
Prägung durch das Heilige Jahr erfahren.
Wie Domkapitular Vogelgesang weiter mitteilte, sei zudem auch
eine „Nacht der Barmherzigkeit“ vom 1. auf den 2. Oktober mit
Taizégebet, eucharistischer Anbetung und der durchgängigen
Möglichkeit zu Gespräch, Segnung und Beichte geplant. „Die Brüder
aus Taizé haben ihre Teilnahme bereits zugesagt“, weckt Vogelgesang
Vorfreude und Erwartung auf dieses Ereignis.
Das vom Papst für dieses Heilige Jahr ausgewählte Motto der
Barmherzigkeit passe in außergewöhnlicher Weise zu der gegenwärtig
schwierigen Situation in Deutschland und in der Welt, wo die
Menschen in besonderem Maße zu Hilfe und Barmherzigkeit gegenüber
Flüchtlingen und Vertriebenen aufgerufen seien, so der Domkapitular
– es gehört auch hier halt alles mit allem zusammen.
Domkapitular Schappert: „Höhere Kirchensteuer kommt
Kirchengemeinden, Caritas und Domkapitel
zugute“
 „Das Bistum Speyer befindet sich weiterhin auf
Konsolidierungskurs. Die gute konjunkturelle Entwicklung in
Deutschland hilft uns dabei, so dass wir für das Jahr 2016 ein
leicht positives Ergebnis erwarten“. So fasste der Leiter der
Hauptabteilung Finanzen und Immobilien des Bischöflichen
Ordinariats, Domkapitular Peter Schappert, die
aktuelle wirtschaftliche Lage des Bistums zusammen. Das Bistum
plane deshalb für das Jahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von rund 150
Millionen Euro, wobei sich die erwartete Kirchensteuer auf rund 128
Millionen Euro belaufe. Hauptursache für diese positive
Entwicklung, so Domkapitular Schappert, sei das sogenannte
Clearing-Verfahren, durch das dem Haushalt der Diözese mit
zeitlichem Verzug Erstattungen von bereits abgeführten
Kirchensteuereinnahmen zufließen, die sich im laufenden
Haushaltsjahr auf 13,6 Mio. Euro belaufen, während die
tatsächlichen Kirchensteuermehreinnahmen nur um 2,18 Prozent
ansteigen würden.
„Das Bistum Speyer befindet sich weiterhin auf
Konsolidierungskurs. Die gute konjunkturelle Entwicklung in
Deutschland hilft uns dabei, so dass wir für das Jahr 2016 ein
leicht positives Ergebnis erwarten“. So fasste der Leiter der
Hauptabteilung Finanzen und Immobilien des Bischöflichen
Ordinariats, Domkapitular Peter Schappert, die
aktuelle wirtschaftliche Lage des Bistums zusammen. Das Bistum
plane deshalb für das Jahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von rund 150
Millionen Euro, wobei sich die erwartete Kirchensteuer auf rund 128
Millionen Euro belaufe. Hauptursache für diese positive
Entwicklung, so Domkapitular Schappert, sei das sogenannte
Clearing-Verfahren, durch das dem Haushalt der Diözese mit
zeitlichem Verzug Erstattungen von bereits abgeführten
Kirchensteuereinnahmen zufließen, die sich im laufenden
Haushaltsjahr auf 13,6 Mio. Euro belaufen, während die
tatsächlichen Kirchensteuermehreinnahmen nur um 2,18 Prozent
ansteigen würden.
Rund 56 Prozent der geplanten Ausgaben würden 2016 in die
Kirchengemeinden fließen - rund 9 Prozent der Finanzierung der
Caritasarbeit dienen. Der Anteil der Ausgaben für den
Religionsunterricht und die katholischen Schulen liege 2016 bei
rund sieben Prozent, der Anteil für die übergemeindliche Seelsorge
bei rund sechs Prozent.
 Beim Haushalt für den Bischöflichen Stuhl erwartet
Finanzdirektorin Tatjana
Mast aufgrund der derzeit extrem niedrigen Zinssätze
einen Rückgang der Erträge.
Beim Haushalt für den Bischöflichen Stuhl erwartet
Finanzdirektorin Tatjana
Mast aufgrund der derzeit extrem niedrigen Zinssätze
einen Rückgang der Erträge.
Der Haushaltsplan des Domkapitels weist Aufwendungen in Höhe von
rund 6,2 Millionen Euro auf, im Haushaltsplan der
Pfarrpfründestiftung sind Ausgaben in Höhe von rund 1,7 Millionen
Euro eingeplant.
Nach Darstellung von Domkapitular Schappert liegt der Fehlbetrag
in der Emeritenanstalt zur Altersversorgung der Priester im
Ruhestand derzeit bei rund 31 Millionen Euro.
Details über die einzelnen Haushaltspläne können ebenso wie
weitere Informationen ab sofort auf der Internetseite des Bistums
Speyer unter www.bistum-speyer.de eingesehen
werden.
 Fast schon nach Abschluß des eigentlichen Pressegesprächs
ergriff dann Bischof Sr. Wiesemann noch einmal das Wort, um seinem
„Finanzchef“, Domkapitular Peter Schappert und seinen
MitarbeiterInnen seinen ausdrücklichen Dank und sein
uneingeschränktes Vertrauen auszusprechen. Als er vor acht Jahren,
von außen nach Speyer kommend, hier das Amt des Bischofs übernommen
habe, sei er auf eine finanzielle „prekäre Situation“ gestoßen, die
durch die öffentliche Diskussion über die Finanzen anderer großer
Einrichtungen wie die im Bistum Limburg noch zusätzlich verschärft
worden sei.
Fast schon nach Abschluß des eigentlichen Pressegesprächs
ergriff dann Bischof Sr. Wiesemann noch einmal das Wort, um seinem
„Finanzchef“, Domkapitular Peter Schappert und seinen
MitarbeiterInnen seinen ausdrücklichen Dank und sein
uneingeschränktes Vertrauen auszusprechen. Als er vor acht Jahren,
von außen nach Speyer kommend, hier das Amt des Bischofs übernommen
habe, sei er auf eine finanzielle „prekäre Situation“ gestoßen, die
durch die öffentliche Diskussion über die Finanzen anderer großer
Einrichtungen wie die im Bistum Limburg noch zusätzlich verschärft
worden sei.
Unter Berücksichtigung dieser Umstände seien es für das
Domkapitel wie für ihn selbst „bewegende Entscheidungen“ gewesen,
die geplante künftige Nutzung des Priesterseminars St. German
reduzieren und sich vom Bistumshaus St. Ludwig im Herzen der Stadt
gar ganz trennen zu müssen. „Die Erhaltung des Bistumshauses St.
Ludwig wäre kostenmäßig ebenso unverantwortlich gewesen wie die
Fortführung des Priesterseminars in seiner bisherigen Größe und
Nutzungsform“, betonte der Bischof, der noch einmal die Gelegenheit
nutzte, um den verantwortlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu danken, die ihn und das Domkapitel auf diesem Weg begleitet
hätten. Foto: gc
26.01.2016
Nächstes Bauprojekt am Dom gestartet
 Nordwestturm der
Kathedrale wird saniert
Nordwestturm der
Kathedrale wird saniert
Speyer- Das nächste große Bauprojekt am
Speyerer Dom wurde begonnen. Vor drei Jahren war sein „Zwilling“ im
Süden dran, jetzt werden am Nordwestturm Gerüste aufgebaut. Obwohl
der Turm im Vergleich zu anderen Teilen des Doms mit seinen 160
Jahren ein Jungspund ist, steht nun eine komplette Innen- und
Außensanierung an. 10 bis 15 Arbeiter werden in den kommenden
Tagen, Wochen und Monaten durchgängig verschiedene Maßnahmen an dem
65 Meter hohen Flankenturm durchführen. Sofern alles nach Plan
verläuft, werden die Gerüste dann vor dem nächsten Weihnachtsfest
wieder abgebaut sein. Rund ein Jahr wird die Überprüfung, Sanierung
und Reinigung der Innen- und Außenflächen dauern.
„Die Turmwände bestehen aus einem dreischaligen Mauerwerk, was
bedeutet, dass sich zwischen den äußeren und inneren
Sandsteinflächen eine Füllschicht befindet. Da fortwährend Wasser
außen ein- und mit einiger zeitlicher Verzögerung innen wieder
austritt, verliert der Turm fortlaufend an Masse“, erklärt
Dombaumeister Mario Colletto. „Diese wird jetzt in Form von
hydraulischem Kalkmörtel nachverfüllt.“ Um künftig das Ausmaß an
Schäden zu reduzieren, werden kontrollierte Wasserführungsebenen
hergestellt. Dies geschieht unter anderem über eine Nachverfugung
der Wandflächen.
Die Stützen in den Biforien und Triforien wurden bei der
Erbauung des Turms im 19. Jahrhundert mit Eisen verklammert. Mit
Ultraschall werden diese auf Korrosion untersucht. Ist eine starke
Schädigung zu erkennen, werden sie durch Edelstahlanker ersetzt.
Die Fensterbänke werden überarbeitet und gegebenenfalls mit
Sandsteinvierungen ergänzt. Die Fugen in den Fensterbrüstungen
werden ausgebleit. Diese historische Bautechnik wird wie früher
vollkommen in Handarbeit ausgeführt. Die Arbeiten werden von Firmen
durchgeführt, die auf historische Gebäude spezialisiert sind.
 Zu den
substanzerhaltenden Maßnahmen gehören weiter: eine Kontrolle des
Turmhelms und eine Erneuerung des Taubenschutzes. Im Turminnern
wird die Elektrik erneuert. Die Holztreppe wird überprüft und
soweit überarbeitet, dass sie den aktuellen Sicherheitsbestimmungen
genügt. Diese dient allerdings ausschließlich Revisionszwecken,
betont Dombaumeister Colletto. Die Treppe im gegenüberliegenden
Südwestturm, die für den Besucherbetrieb eingerichtet wurde, musste
weitaus höheren Sicherheitsanforderungen genügen.
Zu den
substanzerhaltenden Maßnahmen gehören weiter: eine Kontrolle des
Turmhelms und eine Erneuerung des Taubenschutzes. Im Turminnern
wird die Elektrik erneuert. Die Holztreppe wird überprüft und
soweit überarbeitet, dass sie den aktuellen Sicherheitsbestimmungen
genügt. Diese dient allerdings ausschließlich Revisionszwecken,
betont Dombaumeister Colletto. Die Treppe im gegenüberliegenden
Südwestturm, die für den Besucherbetrieb eingerichtet wurde, musste
weitaus höheren Sicherheitsanforderungen genügen.
Während die Sanierung des Südwestturms zur Hälfte mit Mitteln
des Bundes aus dem Konjunkturpaket II für UNESCO-Welterbestätten
finanziert wurde, wird die aktuelle Baumaßnahme wie folgt
geschultert: 40 Prozent steuert das Land Rheinland-Pfalz bei, der
Rest wird aus Mitteln des Domkapitels finanziert. Unterstützung
bekommt das Domkapitel vom Dombauverein, der den Domerhalt jährlich
mit 100.000 bis 200.000 Euro unterstützt. Für die Sanierung des
Nordwestturms sind 900.000 Euro veranschlagt. Text und Foto:
is
21.01.2016
Katholische Jugend wirbt für ressortübergreifende Jugendpolitik
 v.l.: Heike Vogt, Barbara Schleicher-Rothmund, Lena Schmidt
v.l.: Heike Vogt, Barbara Schleicher-Rothmund, Lena Schmidt
Gespräch mit der Vizepräsidentin des
Landtages
Speyer- Gestern traf der Vorstand des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer die
Vizepräsidentin der rheinland-pfälzischen Landtages Barbara
Schleicher-Rothmund (SPD). Im Zentrum des Gespräches standen die
Forderungen des Dachverbandes der katholischen Jugend nach mehr
Jugendbeteiligung und einer ressortübergreifenden
Jugendpolitik.
Heike Vogt, BDKJ-Diözesanvorsitzende, machte im Gespräch die
Haltung des BDKJ deutlich: "Wir sind davon überzeugt, dass
Jugendliche die Expertinnen und Experten ihrer Generation sind. Sie
sind in der Lage, ihre Positionen und Meinungen zu vertreten. Wir
fordern mehr echte Beteiligungsmöglichkeiten für junge Menschen.
Dazu gehört für uns auch eine Absenkung des Wahlalters.“
Auch Schleicher-Rothmund warb aus ihrer persönlichen Erfahrung
für stärkere Beteiligungsmöglichkeiten. „Ich nehme ein großes
Interesse bei den Jugendlichen wahr. Das spüre ich immer wieder,
wenn ich in Schulen mit jungen Menschen ins Gespräch komme." Gerade
auf der kommunalen Ebene sieht Schleicher-Rothmund
Anknüpfungspunkte, beispielsweise bei Dorferneuerungen. „Gerade bei
der Dorfplanung ist es wichtig, dass die Bedürfnisse aller
Generationen berücksichtigt werden. Das funktioniert am besten,
wenn alle in den Prozess eingebunden sind. Zuvor muss allerdings
geklärt sein, wie sich die beteiligten Jugendlichen legitimieren.
Entscheidungen müssen von gewählten Jugendlichen getroffen werden.“
Lena Schmidt, BDKJ Diözesanvorsitzende, schloss sich dieser
Einschätzung an und betonte, das Beteiligungsmöglichkeiten
jugendgerecht transportiert werden müssen und die Beteiligung
junger Menschen eine frühestmögliche politische Bildung
erfordert.“
Das Gespräch in Speyer fand im Rahmen der Strategie des BDKJ
"U28- Die Zukunft lacht!" statt. Für einen vereinbarten
Projektzeitraum erklären sich Politikerinnen und Politiker bereit,
ihre Entscheidungen im politischen Alltag durch die Brille von
Kindern und Jugendlichen zu betrachten. Ihre Statements
veröffentlicht der BDKJ in regelmäßigen Abständen auf u28.bdkj-speyer.de.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer ist
Dachverband von acht Kinder- und Jugendverbänden in Rheinland-Pfalz
und im Saarland. Er vertritt die Interessen von 8.500 Mitgliedern
in Kirche, Politik und Gesellschaft. Mit der Strategie "U28- Die
Zukunft lacht!" wirbt der BDKJ derzeit deutschlandweit für eine
stärkere Vernetzung von Jugendpolitik und Kirche und fordert
bessere Beteiligungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche.
Weitere Informationen: www.bdkj-speyer.de |
Facebook.de/BDKJ_Speyer | u28.bdkj-speyer.de
Text und Foto: BDKJ Speyer
19.01.2016
Kirchenpräsident wirbt für Zusammenhalt in der Gesellschaft
 Aktuelle
Ereignisse und Reformationsjubiläum im Mittelpunkt des
Neujahrsempfangs
Aktuelle
Ereignisse und Reformationsjubiläum im Mittelpunkt des
Neujahrsempfangs
Speyer- Angesichts der jüngsten Anschläge
und gewalttätigen Übergriffe hat der pfälzische Kirchenpräsident
Christian Schad für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft
geworben. Beim Neujahrsempfang im Landeskirchenrat am Donnerstag
betonte Schad, dass in einer Demokratie versöhnte Vielfalt als
Reichtum und als Ergänzung nicht nur des sozialen Friedens zu
verstehen sei. Mit Blick auf die Not von Millionen Menschen
weltweit und die durch die Flüchtlingsströme ausgelösten
gesellschaftlichen Herausforderungen appellierte der
Kirchenpräsident an die Christen, sich nachhaltig zu Humanität und
Nächstenliebe zu bekennen. „Zeigen wir ganz praktisch, dass auch
bei hohen Zahlen von Flüchtlingen und bei divergierenden religiösen
und kulturellen Hintergründen Integration gelingen kann“, sagte
Schad.
Kritisch betrachtete Schad in seiner Ansprache das Eingreifen
deutscher Tornado-Flugzeuge in den syrischen Bürgerkrieg: Es sei
fraglich, ob damit dem Terror Einhalt geboten oder nur weitere
Gewalt herausgefordert werde. „Aber ich vertraue darauf, dass
Gottes Gnade, die allen Menschen erschienen ist, nicht folgenlos
bleibt. Sie überlässt uns nicht uns selbst. Sie findet sich nicht
damit ab, dass die Welt aus den Fugen gerät.“ In diesem
Zusammenhang dankte Kirchenpräsident Schad den vielen
Ehrenamtlichen, die mit ihrem Einsatz dem Land ein menschliches
Antlitz und humanitäre Würde geben. Sein Respekt gelte auch den
Mitarbeitern der kommunalen und staatlichen Verwaltungen, der
Hilfsorganisationen und der Polizei, die mit viel Anteilnahme ihren
Dienst täten, sagte Schad. Rechtspopulismus und Rechtsradikalismus
in der Gesellschaft erteilte der Kirchenpräsident eine deutliche
Absage: Diese heizten nur Ängste an und sabotierten das Mitgefühl,
anstatt es zu stärken. „Mit Christentum hat das jedenfalls nichts
zu tun“, erklärte Schad.
Als weiteren Schwerpunkt seiner Ansprache stellte der
Kirchenpräsident auch das diesjährige Thema der Reformationsdekade:
„Reformation und die Eine Welt“ ins Zentrum. „Über 400 Millionen
Menschen weltweit verbinden ihren Glauben mit der Reformation. Als
evangelische Christinnen und Christen sind wir Teil der einen
weltweiten Kirche Jesu Christi“, sagte Kirchenpräsident Schad vor
rund hundert Gästen aus Kirche, Kultur, Politik und Wissenschaft,
unter ihnen auch der rheinland-pfälzische Justizminister Gerhard
Robbers, der zugleich Beauftragter der Landesregierung für das
Reformationsjubiläum ist. Kirche und Politik seien gleichermaßen
herausgefordert, das reformatorische Erbe zu vergegenwärtigen,
sagte Schad.
Im Jahr 2016 ist die Evangelische Kirche der Pfalz mit vielen
Projekten und Veranstaltungen zum Thema „Reformation und die Eine
Welt“ beteiligt. Unter anderem wird die landeskirchliche Bibliothek
und Medienzentrale den Blick auf das Thema „Die Reformation in
Europa – Ausbreitung, Verfolgung, Etablierung“ lenken. Dazu hält
die Kirchenhistorikerin und Direktorin des Leibniz-Instituts für
Europäische Geschichte in Mainz, Professorin Irene Dingel, am 8.
März um 19 Uhr einen Vortrag. Zu einem Empfang für in der
Eine-Welt-Arbeit engagierte Haupt- und Ehrenamtliche lädt
Kirchenpräsident Schad am 8. Juli um 18 Uhr in die Friedenskirche
Ludwigshafen ein. Der ehemalige Synodalsenior der Evangelischen
Kirche der Böhmischen Brüder in Tschechien, Kirchenpräsident Joel
Ruml, steht 2016 als internationaler Gast Gemeinden und Gruppen für
Vorträge, Gespräche und Gottesdienste zur Verfügung.
lk
14.01.2016
„Gemischtes Doppel“ in der Polizeiseelsorge
 Amtseinführung von Pfarrerin Anne Henning und
Gemeindereferent Patrick Stöbener
Amtseinführung von Pfarrerin Anne Henning und
Gemeindereferent Patrick Stöbener
Frankenthal- Ein sehr ansprechend
gestalteter Gottesdienst und ein geselliger Neujahrsempfang des
ökumenischen Polizeiseelsorgebeirates bildeten am 13. Januar in
Frankenthal den äußeren Rahmen für die Einführung des katholischen
Gemeindereferenten Patrick Stöbener und der evangelischen Pfarrerin
Anne Henning als neue Polizeiseelsorger im Bistum Speyer und der
Evangelischen Kirche der Pfalz.
In der überwiegend mit Polizeibeamten gut gefüllten St.
Jakobuskirche – sie ist Teil des Ökumenischen Gemeindezentrums
Pilgerpfad – bezeichnete Susanne Laun, Abteilungsleiterin für
besondere Seelsorgebereiche im Bischöflichen Ordinariat Speyer, die
Zusammenarbeit der Konfessionen in der Polizeiseelsorge als eine
Selbstverständlichkeit. Gerade die Vielfalt der liturgischen
Sprache mache den Reichtum von Ökumene aus. Laun verwies auf den an
Pfingsten 2015 verabschiedeten Leitfaden, mit dem für das
ökumenische Miteinander Zeichen gesetzt worden seien. „Dieser Weg
ist nicht mehr umkehrbar und eine bleibende Herausforderung für die
nächsten Jahre.“ Die Beweislast liege nun auf Seiten derer, die der
Ökumene skeptisch gegenüberstünden.
Oberkirchenrat Gottfried Müller bezog sich auf den zum Unwort
des Jahres gewählten Begriff „Gutmensch“, häufig als Bezeichnung
für die in der Flüchtlingshilfe ehrenamtlich Tätigen gewählt. Es
sei ein großes Missverständnis, anzunehmen, dass dieses Wort dem
biblischen Menschenbild entspreche. „Die Bibel spricht eine andere
Sprache“, sagte Müller. Der jüngste Terroranschlag auf deutsche
Touristen in Istanbul zeige die Präsenz des Bösen in der Welt.
Eindeutig bekannte sich der Oberkirchenrat zum Gewaltenmonopol.
„Nur der Staat darf Gewalt einsetzen und ausüben.“ Die Kirche sehe
es als ihre Aufgabe an, die Polizeibeamten in ihrem schweren Dienst
zu begleiten. Daher sei er glücklich, dass aus der lange Zeit
ehrenamtlichen Funktion des Polizeiseelsorgers nun eine Planstelle
geworden sei, hob Gottfried Müller hervor.
Als „gemischtes Doppel“ wurden die beiden Neuen vorgestellt und
auf ihr verantwortungsvolles Amt verpflichtet. Pfarrerin Anne
Henning (Jahrgang 1970) stammt aus Ludwigshafen und war zwölf Jahre
evangelische Oberpfarrerin bei der Bundespolizei in St. Augustin
bei Bonn. Seit Dezember leitet die Theologin – sie ist verheiratet
und hat zwei Kinder – das neu geschaffene Pfarramt für Polizei- und
Notfallseelsorge.
Ihr katholischer Amtskollege, der 46-jährige Gemeindereferent
Patrick Stöbener, steht seit 1993 im Dienst der Diözese Speyer, war
beim Bischöflichen Ordinariat für religiöse Bildung zuständig und
bekleidete von 2004 bis 2009 das Amt des BDKJ-Diözesanvorsitzenden.
In seiner Heimatgemeinde Hauenstein ist er bei der Freiwilligen
Feuerwehr aktiv. Seine neue Stelle als Polizeiseelsorger trat er am
1. September 2015 an.
Als thematischen Einstieg für ihre gemeinsame Predigt wählten
Henning und Stöbener den Film „Das Beste kommt zum Schluss.“ Der
Grundgedanke der „Schicksalsgemeinschaft“ sei eng mit ihrer Arbeit
als Polizeiseelsorger verbunden. Oft seien Ängste zu überwinden,
jeder müsse sich auf den anderen verlassen können. „Wir sind
Weggefährten geworden mit guter Diagnose, bei uns stimmt die
Chemie“, betonten sie.
Den Polizeibeamten sprachen die beiden Seelsorger Mut zu, auch
in schwierigen Zeiten eine positive Lebenshaltung zu bewahren und
die Wut einfach herunterzuschlucken. „Gott ist Sonne und Schild“
zitierten sie aus dem Psalm 84. Das Leben könne auch trostlose
Zeiten haben, etwa bei belastenden Einsätzen oder der Begegnung mit
Elend und Not. „Wir wollen Ihnen zur Seite stehen und helfen, den
Quellgrund des Lebens zu entdecken“, versicherten die Seelsorger
und verwiesen auf ihre Angebote, die sich nicht in Gottesdiensten,
Konzerten oder Wallfahrten erschöpften. Anne Henning und Patrick
Stöbener wollen auch den Blick auf Meditationen und Praktiken für
den Alltag lenken und die Aufmerksamkeit für all das wecken „was
gut tut.“
Musikalisch bereichert wurde der ökumenische Gottesdienst von
einem Bläserquintett des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz,
das unter Leitung von Bernd Schneider Werke von Ference Farkas,
Franz Danzi, Gioachino Rossini und Joseph Haydn
spielte. Text: Alois Ecker/ Foto:
Bernhard Christian Erfort
14.01.2016
Ehemaliges Bistumshaus St. Ludwig
 Bistum
entscheidet sich für „Diringer & Scheidel“ als Investor
Bistum
entscheidet sich für „Diringer & Scheidel“ als Investor
Speyer- Das Bistum Speyer hat sich für die
„Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau GmbH“ als Investor
für die Nachnutzung des ehemaligen Bistumshauses St. Ludwig in
Speyer entschieden. Dem Beschluss war ein Planungs- und
Investorenwettbewerb vorausgegangen, bei dem aus neun Konzepten
zwei Favoriten ermittelt wurden. Die anschließenden Verhandlungen
des Bistums mit beiden Interessenten haben jetzt zum Zuschlag für
das Mannheimer Unternehmen geführt.
Die „Diringer & Scheidel Wohn- und Gewerbebau GmbH“ möchte
auf dem rund 7.000 Quadratmeter großen Areal zwischen Korngasse,
Johannesstraße und Großer Greifengasse einen Entwurf des
Stuttgarter und Mannheimer Architekturbüros „Blocher Blocher
Partners“ realisieren. Er sieht ein gemeinschaftliches Wohnen für
mehrere Generationen vor. Herzstück des Entwurfs sind rund 40
barrierefreie und altersgerechte Wohnungen für Seniorinnen und
Senioren. Die ursprüngliche Idee eines Pflegeheims wurde
zwischenzeitlich aufgegeben. Hinzu kommen rund 50 Wohneinheiten
unterschiedlicher Größe, auch für Familien, und mehrere
gemeinschaftlich genutzte Räume. Der ehemalige Kirchenraum soll
künftig als Versammlungsraum dienen, verbunden mit einer
gastronomischen Nutzung. In einer Tiefgarage unter dem Gebäude sind
PKW-Stellplätze für die Bewohner eingeplant.
 Aus Sicht des Bistums
Speyer überzeugte an dem Konzept von „Diringer & Scheidel“ vor
allem, dass ältere Menschen die Möglichkeit erhalten, weiterhin im
Zentrum der Stadt Speyer zu wohnen und damit kurze Wege zu
Geschäften und Veranstaltungen haben. Die Teilhabe älterer Menschen
am Leben in der Stadt wird dadurch deutlich verbessert. Der Bedarf
an barrierefreien und altersgerechten Wohnungen in der Speyerer
Innenstadt war mehrfach festgestellt worden. Positiv wurde die
gelungene Einbindung des ehemaligen Kreuzgangs im Innenhof als
architektonischer Hinweis auf die kirchliche Tradition des Ortes
bewertet. Der Erhalt der Optik der Außenfassaden und die
durchgängig dreigeschossige Bauweise sorgen aus Sicht des Bistums
für ein stimmiges Gesamtbild und fügen das Gebäude harmonisch in
das bauliche Umfeld ein. Weitere Pluspunkte wurden in der
Wiederherstellung des früheren Haupteingangs zur Großen
Greifengasse sowie in der Schaffung eines Durchgangs für Fußgänger
von der Korngasse über das Wormser Gässchen hin zur Johannesstraße
und zur Großen Greifengasse gesehen. Geplant ist, dass der Investor
das Projekt demnächst im Bauausschuss und im Stadtrat vorstellen
wird. Text und Foto: is
Aus Sicht des Bistums
Speyer überzeugte an dem Konzept von „Diringer & Scheidel“ vor
allem, dass ältere Menschen die Möglichkeit erhalten, weiterhin im
Zentrum der Stadt Speyer zu wohnen und damit kurze Wege zu
Geschäften und Veranstaltungen haben. Die Teilhabe älterer Menschen
am Leben in der Stadt wird dadurch deutlich verbessert. Der Bedarf
an barrierefreien und altersgerechten Wohnungen in der Speyerer
Innenstadt war mehrfach festgestellt worden. Positiv wurde die
gelungene Einbindung des ehemaligen Kreuzgangs im Innenhof als
architektonischer Hinweis auf die kirchliche Tradition des Ortes
bewertet. Der Erhalt der Optik der Außenfassaden und die
durchgängig dreigeschossige Bauweise sorgen aus Sicht des Bistums
für ein stimmiges Gesamtbild und fügen das Gebäude harmonisch in
das bauliche Umfeld ein. Weitere Pluspunkte wurden in der
Wiederherstellung des früheren Haupteingangs zur Großen
Greifengasse sowie in der Schaffung eines Durchgangs für Fußgänger
von der Korngasse über das Wormser Gässchen hin zur Johannesstraße
und zur Großen Greifengasse gesehen. Geplant ist, dass der Investor
das Projekt demnächst im Bauausschuss und im Stadtrat vorstellen
wird. Text und Foto: is
13.01.2016
Auftakt der Schülertage im Bistum Speyer
 Eine Woche lang informieren sich über 400 Schülerinnen und
Schüler aus 14 Schulen über „ihre Diözese“
Eine Woche lang informieren sich über 400 Schülerinnen und
Schüler aus 14 Schulen über „ihre Diözese“
Speyer- „Meine Diözese“ – unter diesem
Motto starteten heute die Schülertage im Bistum Speyer. Rund 110
Schülerinnen und Schüler des Edith-Stein Gymnasiums Speyer, des BBS
Wirtschaftsgymnasiums und des Carl-Bosch-Gymnasiums aus
Ludwigshafen waren die Ersten, die die Chance nutzten, mehr über
das Bistum Speyer zu erfahren.
Ein erster Programmpunkt: die Begegnung mit dem Dom. Unter der
fachkundigen Führung von Schulrat Thomas Mann, Domkapitular Franz
Vogelgesang, dem stellvertretenden Domorganisten Christoph
Keggenhoff, Domdekan Christoph Kohl und Bastian Hoffmann vom
Dom-Besuchermanagement, lernten die Jugendlichen unter anderem die
Krypta, die Orgel, die Katharinenkapelle und die Sakristei mit dem
Codex Aureus kennen.
Im Festsaal des Diakonissenstift Mutterhauses präsentierte
anschließend Pressesprecher Markus Herr Informationen über die
Diözese. Mitarbeiter der Caritas gaben einen Einblick in die Arbeit
ihres Verbandes und stellten stellvertretend für das
breitgefächerte Beratungs- und Hilfsangebot der Caritas den Bereich
Young Caritas sowie die Schwangerschafts- und Suchtberatung
vor.
Am Nachmittag hatten die Schülerinnen und Schüler die
Möglichkeit, jeweils an zwei Workshops ihrer Wahl teilzunehmen. Das
Angebot reichte von der Recherche im Bistumsarchiv, einem Gespräch
mit Gefängnisseelsorge Johannes Finck zum Thema „Wie spreche ich
mit einem Mörder, Workshops zum Thema Ökumene und Berufung bis hin
zu Informationen über die Möglichkeiten eines
Freiwilligendienstes.
 Auf großes Interesse stieß der zum ersten Mal angebotene
Workshop zur Frage „Wie ist ein gutes Leben für alle Menschen auf
der Welt möglich?“ unter der Leitung von Christoph Fuhrbach,
Referent für Weltkirche. Neben einer kurzen Darstellung von
Informationen und Fakten zum Verbrauch von Ressourcen auf der Erde,
ging es dabei vor allem um Ideen, was jeder einzelne tun kann, um
seinen Lebensstil nachhaltig zu verändern und den ökologischen und
sozialen Fußabdruck zu verringern. Konzentriert und engagiert
trugen die Schülerinnen und Schüler Vorschläge zusammen – von der
verstärkten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, der
Müllvermeidung, dem Energie sparen oder dem Kauf regionaler und
fairer Produkte bis zum Konsumverzicht. „Es war sehr interessant
die Fakten zu hören und der Workshop hat das Bewusstsein dafür
gestärkt, dass jeder etwas zur Veränderung beitragen kann“,
bewertete die 17-jährige Jennifer, Schülerin des Edith-Stein
Gymnasiums, das Angebot und auch ihre 18-jährigen Mitschülerin
Karla fand die vielen Ideen „was man konkret machen kann“ gut. Dem
stimmte auch Till, 17 Jahre und Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums
zu: „Der Workshop hat gezeigt, dass man ein paar Dinge umsetzen
kann und dass wir nicht einfach so weiterleben können wie bisher.“
Auf großes Interesse stieß der zum ersten Mal angebotene
Workshop zur Frage „Wie ist ein gutes Leben für alle Menschen auf
der Welt möglich?“ unter der Leitung von Christoph Fuhrbach,
Referent für Weltkirche. Neben einer kurzen Darstellung von
Informationen und Fakten zum Verbrauch von Ressourcen auf der Erde,
ging es dabei vor allem um Ideen, was jeder einzelne tun kann, um
seinen Lebensstil nachhaltig zu verändern und den ökologischen und
sozialen Fußabdruck zu verringern. Konzentriert und engagiert
trugen die Schülerinnen und Schüler Vorschläge zusammen – von der
verstärkten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, der
Müllvermeidung, dem Energie sparen oder dem Kauf regionaler und
fairer Produkte bis zum Konsumverzicht. „Es war sehr interessant
die Fakten zu hören und der Workshop hat das Bewusstsein dafür
gestärkt, dass jeder etwas zur Veränderung beitragen kann“,
bewertete die 17-jährige Jennifer, Schülerin des Edith-Stein
Gymnasiums, das Angebot und auch ihre 18-jährigen Mitschülerin
Karla fand die vielen Ideen „was man konkret machen kann“ gut. Dem
stimmte auch Till, 17 Jahre und Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums
zu: „Der Workshop hat gezeigt, dass man ein paar Dinge umsetzen
kann und dass wir nicht einfach so weiterleben können wie bisher.“
 Zum Abschluss des Tages stellte sich Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der Jugendlichen und stand ihnen
auch zu kontroversen Themen wie die Haltung der Kirche zur
Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder zum
Thema Scheidung und Priesteramt für Frauen in der katholischen
Kirche Rede und Antwort. „Es gibt keinen anderen Weg, als wieder
mehr über unseren Glauben zu reden“, ermunterte der Bischof die
Schülerinnen und Schüler bei der Frage, wie man der Entwicklung
gegensteuern könne, dass immer mehr Menschen die Kirche verlassen.
„Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir zeigen, dass der Glaube für
das Leben eine positive Qualität hat.“ Und zur Frage, wie man
Menschen begegnen kann, die eine schwere Schuld auf sich geladen
haben, gab Bischof Wiesemann am Ende des Gesprächs den Jugendlichen
mit auf den Weg: „Barmherzigkeit bedeutet die grundlegende
Bereitschaft, dem Menschen eine zweite Chance zu geben.“
Zum Abschluss des Tages stellte sich Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der Jugendlichen und stand ihnen
auch zu kontroversen Themen wie die Haltung der Kirche zur
Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder zum
Thema Scheidung und Priesteramt für Frauen in der katholischen
Kirche Rede und Antwort. „Es gibt keinen anderen Weg, als wieder
mehr über unseren Glauben zu reden“, ermunterte der Bischof die
Schülerinnen und Schüler bei der Frage, wie man der Entwicklung
gegensteuern könne, dass immer mehr Menschen die Kirche verlassen.
„Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir zeigen, dass der Glaube für
das Leben eine positive Qualität hat.“ Und zur Frage, wie man
Menschen begegnen kann, die eine schwere Schuld auf sich geladen
haben, gab Bischof Wiesemann am Ende des Gesprächs den Jugendlichen
mit auf den Weg: „Barmherzigkeit bedeutet die grundlegende
Bereitschaft, dem Menschen eine zweite Chance zu geben.“
Die Schülertage finden in diesem Jahr zum vierten Mal statt.
Über 400 Schülerinnen und Schüler aus 14 Schulen nehmen bis zum 15.
Januar daran teil. „Der Tag hat mir gezeigt, dass Kirche
weltoffener ist als ich gedacht hat“, zog der 17-jährige Hannes,
Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums, am ersten Tag sein Fazit.
Teilnehmende Schulen:
Edith-Stein Gymnasium, Speyer (Montag)
BBS Wirtschaftsgymnasium, Ludwigshafen (Montag)
Carl-Bosch-Gymnasium, Ludwigshafen (Montag)
Wilhelm-v.-Humboldt-Gymnasium, Ludwigshafen (Dienstag)
IGS Bertha v. Suttner, Kaiserslautern (Dienstag)
Hannah-Arendt-Gymnasium, Haßloch (Dienstag)
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium, Neustadt (Mittwoch)
IGS Am Nanstein, Landstuhl (Mittwoch)
Goethe-Gymnasium, Germersheim; (Mittwoch)
Lise-Meitner-Gymnasium, Maxdorf; (Donnerstag)
Bettina von Arnim IGS, Otterberg (Donnerstag)
Maria-Ward-Schule, Landau (Donnerstag)
Karolinen-Gymnasium, Frankenthal (Freitag)
Albert-Einstein-Gymnasium, Frankenthal (Freitag)
Ansprechpartnerin:
Dr. Irina Kreusch, Schulrätin i.K.
Hauptabteilung Schulen, Hochschulen, Bildung
Bischöfliches Ordinariat Speyer
Große Pfaffengasse 13
Tel. 0 62 32/ 102-217
Mail: irina.kreusch@bistum-speyer.de
Informationen zu den Schülertagen findet man unter:
www.bistum-speyer.de/Erziehung-Schule-Bildung/Religionsunterricht/Schuelertage
Text: is; Fotos Klaus Landry
12.01.2016
Pfarrer i.R. Hans Seiler verstorben
Speyer- Am 10. Januar ist Pfarrer im
Ruhestand Hans Seiler im Alter von 70 Jahren verstorben.
Der gebürtige Speyerer wurde 1973 zum Priester geweiht. Er wirkte
als Kaplan in Neustadt St. Marien und in Ludwigshafen St.
Sebastian. Im September 1979 wechselte er als Pfarrer nach Heßheim.
Pfarrer Seiler war seit September 2002 im Ruhestand.
Die Beisetzung des Verstorbenen findet am Donnerstag, 14.
Januar, um 14 Uhr auf dem Hauptfriedhof in Speyer statt.
Anschließend wird in der Kirche St. Otto in Speyer das Requiem
gefeiert. is
12.01.2016
Auf der Suche nach dem „Frieden in den eigenen Herzen“
 Gründung der neuen Dompfarrei „Pax Christi“ will „Orte der
Ruhe“ schaffen
Gründung der neuen Dompfarrei „Pax Christi“ will „Orte der
Ruhe“ schaffen
cr. Speyer- Mit der Verlesung der Urkunden über
die Auflösung der bisherigen Speyerer katholischen Pfarrgemeinden
„Mariä Himmelfahrt“ - der „alten“ Dompfarrei, den Gemeinden „St.
Joseph“ im Herzen der Stadt, „St. Konrad“ in Speyer-Nord sowie „St.
Otto“ und „St. Hedwig“ im Stadtteil Speyer-West durch den Speyerer
Weihbischof Otto Georgens ging heute im Rahmen
eines festlichen Gottesdienstes in der Kirche St. Joseph eine mehr
als ein Jahrhundert währende Ära Speyerer Kirchen- und
Stadtgeschichte zu Ende. Gleichzeitig damit wurde mit der
offiziellen Deklaration der neuen Dompfarrei „Pax Christi“, in der
sich künftig alle Katholiken im Stadtgebiet von Speyer vereinigt
finden sollen, heute früh auch der bereits seit dem 1. Januar 2016
rechtsförmlich gültige Akt der Zusammenführung aller Speyerer
Pfarreien nun auch liturgisch bestätigt.
 Grund genug, dass der zukünftige Leiter der neuen
Großpfarrei, Dompfarrer und Domkapitular Matthias
Bender neben den in großer Zahl aus allen bisherigen
Speyerer Kirchengemeinden zusammengekommenen Pfarrkindern auch
zahlreiche Ehrengäste in der doppeltürmigen Kirche in der
Gilgenstraße begrüßen konnte, an ihrer Spitze
Oberbürgermeister Hansjörg Eger,
Bürgermeisterin Monika Kabs sowie als Vertreter
der Evangelischen Christen in der Stadt, Dekan Markus
Jäckle. Im Verlaufe des Gottesdienstes ließ es sich dann
auch der emeritierte Speyerer Bischof Dr. Anton
Schlembach nicht nehmen, aus seinem Altersruhesitz im
benachbarten St. Marthaheim in die „St. Josephs-Kirche“
herüberzukommen.
Grund genug, dass der zukünftige Leiter der neuen
Großpfarrei, Dompfarrer und Domkapitular Matthias
Bender neben den in großer Zahl aus allen bisherigen
Speyerer Kirchengemeinden zusammengekommenen Pfarrkindern auch
zahlreiche Ehrengäste in der doppeltürmigen Kirche in der
Gilgenstraße begrüßen konnte, an ihrer Spitze
Oberbürgermeister Hansjörg Eger,
Bürgermeisterin Monika Kabs sowie als Vertreter
der Evangelischen Christen in der Stadt, Dekan Markus
Jäckle. Im Verlaufe des Gottesdienstes ließ es sich dann
auch der emeritierte Speyerer Bischof Dr. Anton
Schlembach nicht nehmen, aus seinem Altersruhesitz im
benachbarten St. Marthaheim in die „St. Josephs-Kirche“
herüberzukommen.
Dort hatte es Dompfarrer Matthias Bender
übernommen, der Gemeinde Verse aus dem Lukas-Evangelium auszulegen,
die sich mit dem an diesem Tage auf der Festtagsagenda stehenden
Fest der „Taufe Christi“ unter einem „weit geöffneten Himmel“
auseinandersetzen. „Gott selbst schaut auch heute mit Wohlgefallen
auf uns“, betonte Pfarrer Bender dabei. „Und unter seinem
wohlwollenden Blick wollen wir heute auch unser Abenteuer mit der
neuen Pfarrei „Pax Christi“ beginnen“.
 Denn Jesus selbst stelle sich an diesem Tag in die Mitte
der Gläubigen und zugleich in die Reihe all jener, die wüssten,
dass sich auch in unserem Leben etwas ändern müsse. „Denn wir
Christen können nicht allein gut zueinander sein und Gutes
füreinander tun, sondern wir können ebenso auch furchtbare Kriege
gegeneinander führen und Menschen in die Flucht treiben - ganz so,
wie wir es gerade in diesen Wochen in vielen Regionen der Welt
erleben müssen“, so der Geistliche.
Denn Jesus selbst stelle sich an diesem Tag in die Mitte
der Gläubigen und zugleich in die Reihe all jener, die wüssten,
dass sich auch in unserem Leben etwas ändern müsse. „Denn wir
Christen können nicht allein gut zueinander sein und Gutes
füreinander tun, sondern wir können ebenso auch furchtbare Kriege
gegeneinander führen und Menschen in die Flucht treiben - ganz so,
wie wir es gerade in diesen Wochen in vielen Regionen der Welt
erleben müssen“, so der Geistliche.
Jesus selbst stelle sich deshalb gerade in solchen Situationen
in die Mitte der Menschen, um mit ihnen gemeinsam Antworten auf die
Frage zu suchen, was Kirche heute eigentlich ausmache und was sie
bewegen könne: „Sind es allein die Gottesdienste oder sind es auch
die Orte, an denen wir Gemeinschaft miteinander leben können?“
 Nein, das Geheimnis von Kirche sei auch heute Jesus
selbst, unterstrich der Dompfarrer, der daran erinnerte, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg in der neu errichteten Friedenskirche St.
Bernhard als erstes eine „Pax-Christi-Kapelle“ errichtet worden
sei, die der Förderung der Freundschaft und des Friedens zwischen
Deutschen und Franzosen, danach auch dem Frieden mit Polen und
inzwischen durch das „Interreligiöse Forum“ der Überwindung aller
religiösen und ethnischen Grenzen dienen solle. Dazu aber sei es
nicht nur notwendig, um Frieden in der Welt bemüht zu sein – zuvor
müsse „Friede in unsere Herzen herrschen“, so Pfarrer
Bender.
Nein, das Geheimnis von Kirche sei auch heute Jesus
selbst, unterstrich der Dompfarrer, der daran erinnerte, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg in der neu errichteten Friedenskirche St.
Bernhard als erstes eine „Pax-Christi-Kapelle“ errichtet worden
sei, die der Förderung der Freundschaft und des Friedens zwischen
Deutschen und Franzosen, danach auch dem Frieden mit Polen und
inzwischen durch das „Interreligiöse Forum“ der Überwindung aller
religiösen und ethnischen Grenzen dienen solle. Dazu aber sei es
nicht nur notwendig, um Frieden in der Welt bemüht zu sein – zuvor
müsse „Friede in unsere Herzen herrschen“, so Pfarrer
Bender.
Viele Menschen empfänden heute Zweifel am Sinn ihres Lebens und
würden deshalb zunehmend in Depressionen verfallen, fuhr der
Prediger fort. Kirche müsse deshalb Orte und Gelegenheiten
schaffen, wo die Menschen zur Ruhe  kommen und „Frieden in ihrem Herzen“ finden könnten. „Pax
Christi“ meine deshalb auch „Friede mit Gott“, so der Dompfarrer.
Diesen Frieden aber könnten sich die Menschen nur gegenseitig
schenken, so wie einst die Engel bei der Geburt Christi den Frieden
verkündeten. „Machen wir uns also mutig an diese Aufgabe“, rief der
Pfarrer der neuen Gemeinde „Pax Christi“ seinen Gemeindemitgliedern
zu - „der Himmel ist weit geöffnet – der Friede mit Gott ist da! -
Möge dieser Friede Christi der ganzen Stadt Speyer und der Welt
auch weiterhin zum Heil gedeihen!“.
kommen und „Frieden in ihrem Herzen“ finden könnten. „Pax
Christi“ meine deshalb auch „Friede mit Gott“, so der Dompfarrer.
Diesen Frieden aber könnten sich die Menschen nur gegenseitig
schenken, so wie einst die Engel bei der Geburt Christi den Frieden
verkündeten. „Machen wir uns also mutig an diese Aufgabe“, rief der
Pfarrer der neuen Gemeinde „Pax Christi“ seinen Gemeindemitgliedern
zu - „der Himmel ist weit geöffnet – der Friede mit Gott ist da! -
Möge dieser Friede Christi der ganzen Stadt Speyer und der Welt
auch weiterhin zum Heil gedeihen!“.
Mit einem sich durch die Ablösung von fünf Puzzleteilen Schritt
für Schritt zu einer Einheit formenden Kreis wurde schließlich
symbolhaft das Wesen der neuen Großgemeinde deutlich, von der in
den anschließenden Fürbitten die Hoffnung verbalisiert wurde, dass
auch diejenigen Gemeindemitglieder in der neuen Gemeindeform
Erfüllung finden mögen, die den Veränderungen heute noch skeptisch
gegenüberstünden. Foto: gc
10.01.2016
Aus fünf mach eins - Gründungsveranstaltung mit Festgottesdienst in St. Joseph
 Speyerer Katholiken starten als Stadtpfarrei „Pax Christi“
neuen gemeinsamen Glaubensweg
Speyerer Katholiken starten als Stadtpfarrei „Pax Christi“
neuen gemeinsamen Glaubensweg
cr. Speyer. Zwar rein formal bereits seit dem
Neujahrstag, dem 01. Januar 2016, rechtsgültig, beginnt auch für
die Katholiken in Speyer wie im gesamten Wirkungsgebiet des Bistums
am kommenden Sonntag, dem 10. Januar 2016, mit
festlichen Gottesdiensten – in Speyer um 10.30 Uhr in der Kirche
St. Joseph - eine neue Zeitrechnung: Dann nämlich wird die in den
zurückliegenden drei Jahren unter Mitwirkung der unterschiedlichen
haupt- und ehrenamtlichen Ebenen der Diözese erarbeitete
Pastoralreform Wirklichkeit – dann wird die Zahl der eigenständigen
Kirchengemeinden im Bistum Speyer von bisher 316 auf dann nur noch
70 reduziert werden.
Für die Katholiken in der Domstadt Speyer selbst bedeutet dies,
dass die bisher fünf eigenständigen Pfarrgemeinden – die
Dompfarrei, die Pfarrei St. Joseph sowie die Pfarreien St. Konrad
in Speyer-Nord und St. Hedwig und St. Otto in Speyer-West künftig
unter dem gemeinsamen Dach der neuen Dompfarrei „Pax Christi“
geführt und geistlich betreut werden.
 Bei einem Pressegespräch im Gemeindezentrum „Ägidienhaus“
im Schatten der Kirche St. Joseph erläuterte jetzt der Leiter der
neu gegründeten Pfarrei „Pax Christi“ zu Speyer, Dompfarrer
und Domkapitular Matthias Bender, gemeinsam mit seinem
Stellvertreter in der Leitung der neuen Pfarrei und Trägervertreter
der katholischen Kindertageseinrichtungen, Diakon Paul
Nowicki, sowie zusammen mit dem Vorsitzenden
des gerade erst neu gewählten Pfarreirates,
Bernhard Kaas, und dem stellvertretenden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Hubert Kapp, die sich
aus dieser Umstrukturierung ergebenden Neuerungen: Dazu nannte er
vor allem das neu gegründete Pastoralteam aus sieben hauptamtlichen
theologischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - zunächst noch
unterstützt durch die emeritierten Priester Pfarrer Bernhard
Linvers, Pfarrer Wetzel und Pfarrer Sonntag, denen künftig ein in
den bisherigen Räumen des Dompfarramtes am Edith-Stein-Platz 6
untergebrachtes zentrales Pfarrbüro unterstützend zur Seite stehen
wird. Doch auch an den Standorten der bisherigen fünf
Pfarrgemeinden werden auch zukünftig zeitweise geöffnete Pfarrbüros
bestehen bleiben, um so zumindest ansatzweise die bisherigen
Verwaltungs- und Betreuungsstrukturen aufrecht zu
erhalten.
Bei einem Pressegespräch im Gemeindezentrum „Ägidienhaus“
im Schatten der Kirche St. Joseph erläuterte jetzt der Leiter der
neu gegründeten Pfarrei „Pax Christi“ zu Speyer, Dompfarrer
und Domkapitular Matthias Bender, gemeinsam mit seinem
Stellvertreter in der Leitung der neuen Pfarrei und Trägervertreter
der katholischen Kindertageseinrichtungen, Diakon Paul
Nowicki, sowie zusammen mit dem Vorsitzenden
des gerade erst neu gewählten Pfarreirates,
Bernhard Kaas, und dem stellvertretenden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Hubert Kapp, die sich
aus dieser Umstrukturierung ergebenden Neuerungen: Dazu nannte er
vor allem das neu gegründete Pastoralteam aus sieben hauptamtlichen
theologischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - zunächst noch
unterstützt durch die emeritierten Priester Pfarrer Bernhard
Linvers, Pfarrer Wetzel und Pfarrer Sonntag, denen künftig ein in
den bisherigen Räumen des Dompfarramtes am Edith-Stein-Platz 6
untergebrachtes zentrales Pfarrbüro unterstützend zur Seite stehen
wird. Doch auch an den Standorten der bisherigen fünf
Pfarrgemeinden werden auch zukünftig zeitweise geöffnete Pfarrbüros
bestehen bleiben, um so zumindest ansatzweise die bisherigen
Verwaltungs- und Betreuungsstrukturen aufrecht zu
erhalten.
 Für die Gemeindemitglieder auch künftig besonders wichtig:
Die Gottesdienstordnung der neuen Pfarrei „Pax Christi“ mit ihren
regelmäßig zu versorgenden fünf Kirchen. Neben den regelmäßigen
Gottesdiensten im Speyerer Dom wird es deshalb auch in St. Joseph
an den Wochenenden „verlässliche Gottesdienste“ geben, so
Dompfarrer Bender. Daneben werden aber auch in den Kirchen St.
Konrad und St. Hedwig nach einem Terminplan, der sich von den
Beginnzeiten her in den kommenden zwei Jahren anhand der
Bedürfnisse und Wünsche der Gläubigen noch klarer strukturieren
muss, Sonntagsgottesdienste abgehalten. Lediglich bei St. Otto
steht schon heute fest: Hier sollen die bewährten und beliebten
Vorabend-Gottesdienste auch weiterhin fester Bestandteil der
allwöchentlichen Agenda sein. Eine ganz besondere Funktion
schließlich soll künftig der Kirche St. Hedwig zukommen: Hier
sollen nämlich neue Gottesdienstformen erprobt und auf ihre
Umsetzbarkeit im Alltag hin „getestet“ werden.
Für die Gemeindemitglieder auch künftig besonders wichtig:
Die Gottesdienstordnung der neuen Pfarrei „Pax Christi“ mit ihren
regelmäßig zu versorgenden fünf Kirchen. Neben den regelmäßigen
Gottesdiensten im Speyerer Dom wird es deshalb auch in St. Joseph
an den Wochenenden „verlässliche Gottesdienste“ geben, so
Dompfarrer Bender. Daneben werden aber auch in den Kirchen St.
Konrad und St. Hedwig nach einem Terminplan, der sich von den
Beginnzeiten her in den kommenden zwei Jahren anhand der
Bedürfnisse und Wünsche der Gläubigen noch klarer strukturieren
muss, Sonntagsgottesdienste abgehalten. Lediglich bei St. Otto
steht schon heute fest: Hier sollen die bewährten und beliebten
Vorabend-Gottesdienste auch weiterhin fester Bestandteil der
allwöchentlichen Agenda sein. Eine ganz besondere Funktion
schließlich soll künftig der Kirche St. Hedwig zukommen: Hier
sollen nämlich neue Gottesdienstformen erprobt und auf ihre
Umsetzbarkeit im Alltag hin „getestet“ werden.
Große Herausforderungen insbesondere für die theologischen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden aber wohl auch zukünftig
Festtage wie Ostern oder Weihnachten sein, an denen alle Teile der
neuen Gemeinde ihre Wünsche nach einer entsprechenden Versorgung
mit Gottesdiensten und Feiern anmelden werden. „An Heilig Abend
oder in der Osternacht herrscht in allen Kirchen großer Andrang“,
so Dompfarrer Bender, der darauf hofft, schon für das Osterfest
2016 in wenigen Wochen ein Konzept präsentieren zu können, das den
Wünschen möglichst aller Gemeindemitglieder gerecht wird.
 Um hier möglichst rasch mehr Klarheit zu erlangen, wollen
sich am letzten Wochenende im Januar die neu gewählten Pfarreiräte
zu einer Klausur-Tagung in „Maria Rosenberg“ treffen, um diese und
andere noch offene Fragen zu besprechen.
Um hier möglichst rasch mehr Klarheit zu erlangen, wollen
sich am letzten Wochenende im Januar die neu gewählten Pfarreiräte
zu einer Klausur-Tagung in „Maria Rosenberg“ treffen, um diese und
andere noch offene Fragen zu besprechen.
„Gerade wir Ehrenamtliche erleben diese Umstrukturierung als
Ermutigung und als eine echte Chance, neue Potentiale in unserer
Gemeinde zu erschließen“, zeigten sich auch die „Ehrenamtler“ aus
dem Kreis der Führungsebene der Speyerer Katholiken, Bernhard Kaas
und Hubert Kapp, von der Zukunftsfähigkeit des neuen
Pastoralkonzeptes überzeugt.
Festgottesdienst mit Gründungsakt am kommenden Sonntag
in St. Joseph
Der eigentliche Gründungsakt für die neue Pfarrei „Pax Christi“
wird aber schon am kommenden Sonntag, dem 10. Januar 2016,
um 10.30 Uhr mit einem vom Speyerer Weihbischof,
Domprobst Otto Georgens, geleiteten Festgottesdienst in
der Kirche St. Joseph stattfinden, zu der nicht nur alle Katholiken
aus der Stadt Speyer eingeladen sind. Die Predigt dabei wird
Dompfarrer Matthias Bender halten – die
musikalische Gestaltung übernehmen die verschiedenen Chöre der
bisherigen fünf Pfarreien.
Wie Dompfarrer Bender bei dieser Gelegenheit abschließend einmal
mehr unterstrich, solle der neue Pfarrei-Name „Pax Christi“ die
innere Haltung verdeutlichen, mit der die Katholiken in der Stadt
„als Christen in Speyer“ wirken wollten - „für Frieden in den
Herzen und für Frieden in der Welt“.
„Nomen est omen“ also – ein Name, der ganz im Sinne von Papst
Franziskus für ein ganzes, künftiges Programm stehen soll. Foto:
gc
08.01.2016
Vertrauen auf die Gottesmutter Maria
 Pontifikalamt Jahresschluss 4: Bischof Karl-Heinz Wiesemann bei der Predigt.
Pontifikalamt Jahresschluss 4: Bischof Karl-Heinz Wiesemann bei der Predigt.
Bischof Wiesemann zelebriert Pontifikalamt zum
Jahresabschluss im Speyerer Dom
Speyer- Mit Vertrauen auf Gott, Jesus und
Maria ins neue Jahr: Diesem Gedanken folgte das Pontifikalamt zum
Jahresschluss. Der besinnliche Gottesdienst am
Silvester-Nachmittag, den Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am
Hochaltar zelebrierte, zog wieder hunderte Gläubige in den Speyerer
Dom, dessen Sitzplätze nicht ausreichten. Der Bischof stellte
Maria, Gottesmutter und Patronin des Doms, in den Mittelpunkt.
"Wir haben sehr viel erlebt auf der weltweiten Bühne", sagte der
Bischof zum aufwühlenden Jahr 2015 und fügte bei der Begrüßung
hinzu: "Gott ist das Leben, die Kraft des Lebens." Der Herr gehe
die Wege gemeinsam mit den Menschen, betonte Wiesemann, "er trägt
uns ins kommende Jahr. Wir bitten um sein Erbarmen."
In seiner Predigt blickte der Bischof zurück auf die Ereignisse,
die in den letzten zwölf Monaten bewegt und erschüttert haben: den
tragischen Flugzeugabsturz der Germanwings-Maschine, bei dem im
Frühjahr in den französischen Alpen über 150 Menschen starben, die
Terroranschläge von Paris oder die Flüchtlingsströme. Ebenso ging
er auf kirchliche Höhepunkte ein wie die Weltbischofssynode oder
das vor kurzem ausgerufene "Heilige Jahr der Barmherzigkeit".
Wiesemann sah nach vorn, auf die große pastorale Reform im Bistum
mit dem Neuzuschnitt der Pfarreien, die seinen Worten zufolge in
die Geschichte der Diözese eingehen wird. "Hier kommt es letztlich
auf die Menschen an", die den Prozess gestalten, betonte er und
dankte allen Haupt- und Ehrenamtlichen, "die sich mit großem
Einsatz engagieren".
"Ich will es dabei belassen", erklärte Bischof Wiesemann,
nachdem er diese Streiflichter gesetzt hatte. Er wolle etwas
Schlichtes tun, sagte er, und "all das, was uns am Ende dieses
Jahres bewegt, der Gottesmutter Maria anvertrauen". Er huldigte der
Namenspatronin des Speyerer Doms, die selbst keine Frau der großen
Worte war, sondern Gottes Wort Raum gab und durch ihre Taten
überzeugte. "Maria führt uns zum ewigen Schoß des Vaters", führte
Wiesemann aus. Sie weise den Weg zum Herzen, verbinde Kopf und
Bauch. Glauben könne man nicht allein mit dem Verstand ergründen –
wie auch andere, weltliche Dinge. "Wo kommen wir zur Ruhe?", fragte
er vor dem Hintergrund der Nachrichtenflut, die tagtäglich und in
hohem Tempo auf die Menschen einprasselt. Wie können wir das
verdauen? Wo kommen hier Kopf und Herz zusammen?
"Salve Regina, sei gegrüßt o Königin! Wende deine barmherzigen
Augen uns zu", rief der Bischof der Muttergottes zu, ehe das Credo
folgte.
 Die Fürbitten galten der Diözese, der Kirche und der
Welt. Die Gebete bezogen sich sowohl auf die, die neu in die
katholische Gemeinschaft aufgenommen wurden, als auch jene, die die
Verbindung zur Kirche gelöst haben. Sie richteten sich auf den
Glauben, die Hoffnung und Liebe, galten einsamen, verbitterten und
vereinsamten, versehrten Menschen, Verstorbenen sowie Politikern,
verbunden mit der Hoffnung, dass die Verantwortlichen Einsicht und
Tatkraft erlangen, damit alle in Frieden und Freiheit leben können.
Sie richteten sich an Gott mit der Bitte um Schutz, Einsicht und
den Mut zur Veränderung.
Die Fürbitten galten der Diözese, der Kirche und der
Welt. Die Gebete bezogen sich sowohl auf die, die neu in die
katholische Gemeinschaft aufgenommen wurden, als auch jene, die die
Verbindung zur Kirche gelöst haben. Sie richteten sich auf den
Glauben, die Hoffnung und Liebe, galten einsamen, verbitterten und
vereinsamten, versehrten Menschen, Verstorbenen sowie Politikern,
verbunden mit der Hoffnung, dass die Verantwortlichen Einsicht und
Tatkraft erlangen, damit alle in Frieden und Freiheit leben können.
Sie richteten sich an Gott mit der Bitte um Schutz, Einsicht und
den Mut zur Veränderung.
Die musikalische Gestaltung war ein wahrer Hörgenuss. Er sangen
der Mädchenchor am Dom, die Domsingknaben sowie der Domchor. Es
spielten Domorganist Markus Eichenlaub und die Dombläser. Die
musikalische Leitung hatten Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller inne. Es erklangen unter anderem die Missa
brevis in B von Christopher Tambling und das Tantum ergo B-Dur von
Anton Bruckner.
Text und Fotos: Yvette Wagner
01.01.2016
An der Jahreswende die Hoffnung auf Wandel feiern
 Kirchenpräsident Schad: Gott eröffnet auch in Situationen
des Leids einen neuen Weg
Kirchenpräsident Schad: Gott eröffnet auch in Situationen
des Leids einen neuen Weg
Landau / Speyer- Bei jeder Jahreswende
wird nach Auffassung des pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian
Schad die Hoffnung auf Wandel gefeiert. Menschen, die die Kraft der
Verwandlung spürten, machten sich zu neuen Ufern auf und bemerkten,
wozu sie bestimmt seien, „zu Menschen mit aufrechtem Gang, zu
freien Geschöpfen unter dem Himmel“, sagte Schad im Gottesdienst am
Silvesterabend in der Landauer Stiftskirche.
Zwar kenne die Hoffnung auf Wandel auch den Zweifel und die
Angst, dies dürfe aber keinen daran hindern, auf das Gestern
fixiert zu bleiben, erklärte Schad. Ängste ernst zu nehmen, bedeute
nicht, ihnen nachzugeben, „denn aus ihnen wächst nichts Gutes“. Es
dürfe keinen Zweifel geben, dass jegliche Form von
Menschenfeindlichkeit inakzeptabel sei „und ganz bestimmt
unvereinbar ist mit dem christlichen Glauben“. Gerade, wer vom
„Abendland“ spreche, müsse sich seiner jüdisch-christlichen Wurzeln
bewusst sein.
Wie schwer es falle, an Gottes Begleitung zu glauben, zeigten
nicht nur Kriege und Unglücke wie der tragische Flugzeugabsturz in
den Alpen im zu Ende gehenden Jahr. Auch persönliche Erfahrungen
von Krankheit und Sterben, Arbeitslosigkeit und Familienstreit
ließen Menschen an Gottes Gegenwart zweifeln und verzweifeln, sagte
der Kirchenpräsident. In diese Situationen des Leids hinein
erinnere die Bibel daran, dass Gott sich nicht abwende, sondern da
sei und einen neuen Weg eröffne. Gottes Gegenwart werde erlebbar
„in einem entschiedenen Wort, in einem prägenden Bild, einer
anrührenden Melodie, in einer liebevollen Geste, in unserem
gemeinsamen Beten, zuweilen auch in unserem miteinander Schweigen“.
Text und Foto: lk
31.12.2015
Kirche St.Ludwig: Initiativgruppe kämpft weiter gegen Profanierung
 Ort der Ruhe
und Stille in der Innenstadt
Ort der Ruhe
und Stille in der Innenstadt
Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Sie haben ihren Kampf gegen eine
sich abzeichnende Profanierung der Kirche St.Ludwig nicht
aufgegeben. Auch wenn nach dem Planungs- und
Investorenwettbewerb alles danach aussieht, als solle das
Kirchengebäude in einen Veranstaltungsraum umgewandelt
werden, und das Bischöfliche Ordinariat sich bislang
keinerlei Gedanken über eine Nutzung als
Kasualien-Kirche gemacht zu haben scheint, so sind viele
Speyerer - an deren Spitze der einstige
Landrat Dr. Paul Schädler und dessen Frau Helga,
Pfarrer i.R. Bernhard Linvers, Theologe und Pädagoge Klaus Pfeifer
sowie Anna Altinger, Leiterin des Katholischen Frauenbundes in
St.Joseph – fest entschlossen, sich weiterhin für den Erhalt
von St.Ludwig als Gotteshaus einzusetzen. Dass der wertvolle
spätgotische Boßweiler-Altar bereits aus der Kirche herausgenommen
wurde und jetzt an einem anderen Ort verwahrt wird, muss nicht
zwangsläufig die Entweihung des Gotteshauses nach sich
ziehen.
Von neun zu dem Wettbewerb eingereichten Konzepten waren
im November vier ausgezeichnet worden. Ausschlaggebend
für die Preisvergabe waren die städtebauliche und die
architektonische Qualität der Entwürfe. Hinzu kamen die
Angemessenheit der Nachnutzung und ihre soziale und kulturelle
Einbindung ins Stadtgefüge. Das Bistum Speyer führt mit den
zwei favorisierten Interessenten jetzt Gespräche zur
Feinabstimmung. Danach entscheidet die Bistumsleitung und
kann der ausgewählte Investor einen Bauantrag an die
Stadtverwaltung stellen.
 Diesem Investor möchte die aus vielen Katholiken und auch
einigen Protestanten bestehenden St.Ludwig-Initiativgruppe
ihr Konzept unterbreiten. „Das kennt er wahrscheinlich gar
nicht“, meint Pfarrer Linvers und weist darauf hin, dass sehr
viele Speyerer den geplanten Verkauf nicht verstehen und ihr
Veto auch mit über 1600 Unterschriften bekundet hatten.
Linvers und die anderen Mitglieder der Führungsgruppe werden
nichts unversucht lassen, um die weitere Nutzung der
Innenstadt-Kirche für Trauungen, Taufen und Bestattungen zu
ermöglichen. Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident
Christian Schad könnten den von ihnen erarbeiteten
„Ökumenischen Leitfaden“ auf diese Weise gemeinsam
wirkungsvoll mit Taten füllen und dieser Kasualien-Kirche ihren
Segen geben.
Diesem Investor möchte die aus vielen Katholiken und auch
einigen Protestanten bestehenden St.Ludwig-Initiativgruppe
ihr Konzept unterbreiten. „Das kennt er wahrscheinlich gar
nicht“, meint Pfarrer Linvers und weist darauf hin, dass sehr
viele Speyerer den geplanten Verkauf nicht verstehen und ihr
Veto auch mit über 1600 Unterschriften bekundet hatten.
Linvers und die anderen Mitglieder der Führungsgruppe werden
nichts unversucht lassen, um die weitere Nutzung der
Innenstadt-Kirche für Trauungen, Taufen und Bestattungen zu
ermöglichen. Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident
Christian Schad könnten den von ihnen erarbeiteten
„Ökumenischen Leitfaden“ auf diese Weise gemeinsam
wirkungsvoll mit Taten füllen und dieser Kasualien-Kirche ihren
Segen geben.
Auch Oberbürgermeister Hansjörg Eger ist gut braten dazu
beizutragen, dass im ehemaligen Rosengarten der
St.Ludwigskirche in naher Zukunft Bestattungen erfolgen
können. Denn in einigen Städten wird verstärkt darüber
nachgedacht, innerstädtisch Stätten der Ruhe und Stille
einzurichten. Ein Kirchhof St.Ludwig kann nach Überzeugung
von Klaus Pfeifer mit verhindern, dass sich noch mehr
Speyerer im Friedwald Dudenhofen ihre Bestattungsmöglichkeit
einkaufen. Hierfür muss freilich gesichert sein, dass
in der Kirche St.Ludwig sakrale Gedenkfeiern abgehalten werden
können. Denkbar ist die Bildung eines Trägervereins. „An
Geldgebern wird dies sicher nicht scheitern“, betonen Helga
Schädler und Klaus Pfeifer. Foto: spk-Archiv
26.12.2015
„Freiheit kann nur durch Freiheit bewahrt werden“
 Bischof Wiesemann nimmt in seiner Weihnachtspredigt
Bezug auf die Terroranschläge in Paris und die weltweit 60
Millionen Flüchtlinge
Bischof Wiesemann nimmt in seiner Weihnachtspredigt
Bezug auf die Terroranschläge in Paris und die weltweit 60
Millionen Flüchtlinge
Speyer- Zahlreiche Gläubige besuchten die
Weihnachtsgottesdienste im Bistum Speyer. Beim Pontifikalamt am
ersten Weihnachtsfeiertag rief Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann die
Gläubigen dazu auf, sich nicht von der Angst bestimmen zu lassen,
sondern „Tag für Tag die Liebe zu wagen“. Dabei bezog er sich auch
auf die Terroranschläge in Paris: „Sie zielten in den offenen,
freiheitlichen Kern unserer Lebenswelt und wollten uns bewusst dort
verunsichern, erschüttern, verletzen, wo unser Lebensnerv, unsere
demokratischen Werte liegen.“ Er lenkte den Blick zugleich auf die
mehr als 60 Millionen Menschen, die weltweit auf der Flucht sind.
„Viele von ihnen fliehen vor Terror und Krieg, aus
lebensbedrohlichen und hoffnungslos erscheinenden Situationen. Sie
kommen nicht selten unter unsäglichen Strapazen zu uns mit der
Hoffnung, hier der Todesangst entfliehen und ein menschenwürdiges
Leben führen zu können.“
Die Globalisierung sei immer mehr auch eine Globalisierung der
Nöte, Ängste und Konflikte auf der Welt. „Keine noch so hohen
Grenzzäune, Sicherheitsmaßnahmen und Schutzwälle können uns aus
dieser weltweiten Schicksalsgemeinschaft herausnehmen. Wir müssen
mit dem Fremden unser Leben teilen“, betonte Bischof Wiesemann.
In dieser Situation bedeute die Weihnachtsbotschaft, das Denken,
Urteilen und Handeln nicht durch Angst entstellen zu lassen.
„Freiheit kann nur durch Freiheit bewahrt werden, Menschlichkeit
niemals durch Unmenschlichkeit erhalten bleiben“, warnte Bischof
Wiesemann davor, dass die Angst vor Überfremdung das humanitäre
Angesicht der Gesellschaft raubt. „Keine Bedrohung oder gar
Verletzung unserer Sicherheit darf uns in unserer Liebe zur
Freiheit und unserem Einsatz für die Unantastbarkeit der
Menschenwürde eines jeden, wer und wie er auch sein mag,
einschüchtern.“
Die Spiralen von Hass und Gewalt an vielen Orten der Welt zeigen
aus Sicht des Bischofs: „Hass sät neuen Hass, Gewalt neue Gewalt,
Misstrauen neues Misstrauen.“ Aus diesem Dilemma gebe es keinen
anderen Weg als den der Menschlichkeit. „Wir brauchen Gott als
Schöpfer und Grund des Lebens als letzten und entscheidenden
Garanten für diesen Weg, damit wir ihn immer wieder neu wagen
können.“ Die Angst sei ein wichtiges Warnsignal im Leben, aber als
Ratgeber tauge sie nichts.
Der Zuspruch „Fürchtet euch nicht!“ durchziehe die Heilige
Schrift wie ein roter Faden. „Gott weiß, welche zerstörerische
Macht die Angst im Leben der Menschen haben kann.“ Verletzungen im
Großen wie im Kleinen verleiteten immer wieder dazu, sich in das
„Schneckenhaus der Angst, Enttäuschungen und Verwundungen“
zurückzuziehen, so der Bischof. „Und doch können wir in dieser
Höhle höchstens überwintern, niemals aber die Frühlingsluft des
Lebens, den Atem der Liebe spüren.“ Er sprach den Gläubigen Mut zu,
sich neu hinauszuwagen und sich dem Leben auszusetzen: „Wir müssen
das Leben miteinander teilen, Versöhnung wagen, Menschlichkeit
bewahren, auch wenn wir Gefahr laufen, missverstanden und abgelehnt
zu werden.“ Gott selbst nehme alle Verletzungen auf sich, damit
„wir neu die Segel unseres Lebens setzen können und wir das
Zutrauen gewinnen, die Gefährdungen des Lebens mit ihm meistern zu
können.“
Christmette mit Weihbischof Otto Georgens
Am Heiligen Abend feierte Weihbischof Otto Georgens die
Christmette mit den Gläubigen. In seiner Predigt rief er dazu auf,
sich darauf zu besinnen, was Weihnachten wirklich bedeute. Viele
Menschen fühlten sich durch das Fest unter Druck gesetzt, feierten
Weihnachten nur, weil es im Kalender stehe und wünschten sich eher,
dass ihnen das Fest erspart bliebe. Anderen, die gerade eine
schlechte Diagnosen bekommen hätten, in einer Notlage steckten oder
den Verlust eines Menschen beklagten, komme es so vor, als „werde
Gott für alle Mensch - nur halt für sie nicht“.
Jesus sei aber in der Heiligen Nacht nicht Mensch geworden „um
uns noch ein weiteres Päckchen an Erwartungen und Leistungsdruck
aufzuladen“, so Georgens. Weihnachten bedeute vielmehr, dass Gott
Achtung und Ehrfurcht vor dem oft mühevollen Lebensweg jedes
Menschen habe. Weihnachten feiern heiße nicht das Glück, die
Stimmung oder Festtagsfreude von außen zu erwarten, „sondern das
Dunkel des Lebens mit dem Licht der Weihnacht zu beleuchten suchen
- so zaghaft und klein die Flamme auch sein mag.“
Wer sich vor dem Kind in der Krippe klein mache, der beuge auch
vor dem Wunder Mensch die Knie. „Den Menschen mit all seinen
Schwächen, seinen Fehlern, seiner Schuld ernst zu nehmen, ihn zu
lieben, wie er ist– und nicht wie er sein sollte: Das ist der
wirkliche und wahre Gottesdienst an Weihnachten“, erklärte der
Weihbischof. Weihnachten ändere die Verhältnisse: „Der große Gott
wird klein, der kleine Mensch groß.“
Für die musikalische Gestaltung der Christmette sorgten unter
der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und Domkantor
Joachim Weller Mitglieder des Domchores Speyer, Instrumentalisten
des Domorchesters und Domorganist Markus Eichenlaub. Beim
Pontifikalamt am ersten Weihnachtsfeiertag sangen und musizierten
der Mädchenchor, die Domsingknaben, der Domchor und die
Dombläser.
Link zur Predigt von Bischof Wiesemann am ersten
Weihnachtsfeiertag:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/leitung/bischof/ansprachen/
Link zur Predigt von Weihbischof Georgens zur
Christmette
http://www.bistum-speyer.de/1/bistum-speyer/leitung/weihbischofbischofsvikar/ansprachen/
Text und Foto: is
25.12.2015
Speyerer Militärpfarrer Ulrich Kronenberg würdigt Leistung von Bundeswehr-Soldaten bei der Rettung von Flüchtlingen aus dem Mittelmeer
 cr. Speyer. Fast an jedem Tag, so auch heute
wieder, gehen Nachrichten durch die Agenturen, dass deutsche
Soldaten im Rahmen der Operation „Sophia“ Flüchtlinge vor dem
qualvollen Ertrinken im Mittelmeer bewahren. Der Speyerer
Militärpfarrer Ulrich Kronenberg, zu dessen
Verantwortungsbereich neben den „Resten“ des
„Spezialpionierbataillons 464“ in der Speyerer Kurpfalzkaserne auch
die Garnisonen in Germersheim und Bruchsal gehören und der in der
Vergangenheit auch selbst wiederholt in Auslandseinsätzen unterwegs
war, wollte jetzt die Weihnachtszeit nutzen, um die humanitären
Leistungen seiner Kameradinnen und Kameraden vor Ort in der
Öffentlichkeit zu würdigen.
cr. Speyer. Fast an jedem Tag, so auch heute
wieder, gehen Nachrichten durch die Agenturen, dass deutsche
Soldaten im Rahmen der Operation „Sophia“ Flüchtlinge vor dem
qualvollen Ertrinken im Mittelmeer bewahren. Der Speyerer
Militärpfarrer Ulrich Kronenberg, zu dessen
Verantwortungsbereich neben den „Resten“ des
„Spezialpionierbataillons 464“ in der Speyerer Kurpfalzkaserne auch
die Garnisonen in Germersheim und Bruchsal gehören und der in der
Vergangenheit auch selbst wiederholt in Auslandseinsätzen unterwegs
war, wollte jetzt die Weihnachtszeit nutzen, um die humanitären
Leistungen seiner Kameradinnen und Kameraden vor Ort in der
Öffentlichkeit zu würdigen.
Er hat dem SPEYER-KURIER deshalb eine
Zusammenstellung von Presseberichten zukommen lassen, in denen die
zahlreichen besonderen lebensrettenden Einsätze von
Bundeswehrsoldaten gegen gewissenlose Schlepper ebenso wie gegen
die Gewalten von Sturm und Wetter dargestellt werden, durch die
inzwischen wohl schon mehr als 10.000 Menschenleben gerettet werden
konnten.
Der SPEYER-KURIER druckt diese Zusammenstellung
ganz besonders gerne ab, betrachtet er sie doch zugleich auch als
ein Zeichen der Verbundenheit der Bürgerinnen und Bürger der alten
Garnisonsstadt Speyer mit allen Soldatinnen und Soldaten an ihren
Einsatzorten von Mali bis zum Kosovo – von Afghanistan bis zur
Türkei.
Pfarrer Kronenberg schreibt:
„EUCH ist heute der Heiland geboren“
(Lukasevangelium Kapitel 2 Vers 11)
Heiland heißt, aus dem Griechischen übersetzt, nichts anderes als
„Retter: σωτὴρ“ - lateinisch „salvator“
und widmet seine Ausführungen „mit herzlichem Dank an alle
unsere tüchtigen und tapferen Soldaten der Bundeswehr in aller
Welt!“
http://www.br.de/nachrichten/fluechtlinge-gerettet-mittelmeer-bundesmarine-100.html
Rettung aus Seenot Deutsches Schiff nimmt 212 Flüchtlinge auf
Das deutsche Schiff "Berlin" hat im Rahmen der Operation "Sophia"
im Mittelmeer mehr als 200 Menschen aus Schlauchbooten gerettet.
Sie wurden der italienischen Küstenwache übergeben.
Stand: 23.12.2015
Flüchtlinge auf einem Boot auf dem Mittelmeer | Bild:
picture-alliance/dpa
Deutsche Marinesoldaten haben bei ihrem Einsatz im Mittelmeer mehr
als 200 Flüchtlinge aus zwei Schlauchbooten gerettet. Sie wurden
nach Angaben des Verteidigungsministeriums am Mittwoch vor der
libyschen Küste an Bord des Einsatzgruppenversorgers "Berlin"
genommen. Inzwischen kümmert sich die italienischen Küstenwache um
die Geretteten.
Fast 10.000 Flüchtlinge seit Mai gerettet
Unter den insgesamt 212 Geretteten waren acht Kinder und fünf
Schwangere. Die Bundeswehr beteiligt sich mit zwei Schiffen an der
Mission EUNAVFOR MED, die auch Operation "Sophia" genannt wird.
Seit Beginn des Einsatzes im Mai haben deutsche Soldaten zwischen
Libyen und Italien insgesamt 9.753 Flüchtlinge aus Seenot
gerettet.
Operation "Sophia"
<http://www.br.de/nachrichten/bundeswehr-mittelmeer-fluechtlinge-100~_v-img__16__9__xl_-d31c35f8186ebeb80b0cd843a7c267a0e0c81647.jpg?version=d86c2>
Deutsche Marine-Soldaten halten an Bord der Fregatte "Karlsruhe" am
23.12.2008 in Dschibuti an einem Maschinengewehr Wache. | Bild:
dpa/Gero Breloer
Marine-Soldaten beim Einsatz im Mittelmeer
Die Schiffe, Flugzeuge und Hubschrauber der Operation "Sophia"
werden auf hoher See und im internationalen Luftraum zwischen der
italienischen und libyschen Küste eingesetzt. Sie überwachen das
Seegebiet und beobachten die Aktivitäten von Schleusern.
Die Schiffe des Verbands dürfen in internationalen Gewässern Boote
anhalten und durchsuchen, bei denen der Verdacht besteht, dass sie
von Schleusern genutzt werden. Diese können beschlagnahmt und
umgeleitet, Schleusereiverdächtige an Bord eines Kriegsschiffs
genommen und an einen EU-Mitgliedsstaat übergeben werden.
Die Schiffe sind nach dem Völkerrecht, dem Mandat und den
Einsatzregeln berechtigt, militärische Gewalt zur Durchsetzung
ihres Auftrags einzusetzen. Insgesamt beteiligen sich 22
europäische Nationen mit rund 2.100 Soldaten und Zivilpersonal an
der Operation "Sophia".
Außerdem haben die Teilnehmer der Operation "Sophia" die Aufgabe
der Seenotrettung: Wenn die Schiffe auf mit Flüchtlingen besetzte
Boote treffen, einen Notruf empfangen oder von der Seenotleitstelle
informiert werden, sind sie zur Hilfeleistung verpflichtet. Die
Seenotleitstelle Rom koordiniert die Rettungseinsätze. Die
Seenotleitstelle informiert Schiffe über Seenotfälle in einem
Einsatzgebiet von der Größe Deutschlands.
Weltsicherheitsrat billigt militärisches Vorgehen gegen
Schleuser
Seit Oktober dürfen die Schiffe der Operation "Sophia" militärisch
gegen die Schleuser vorgehen. Der UN-Sicherheitsrat hat diesen
EU-Militäreinsätzen zugestimmt. Aufgebrachte Schlepperboote können
beschlagnahmt oder zerstört werden.
25.12.2015
Gute Planung vermeidet Streitigkeiten
Gerade für Patchworkfamilien bedeutet Weihnachten Stress
– Tipps der Erziehungsberatung
Neustadt- Weihnachten ist das Fest der
Liebe. Wenn aber die Familienverhältnisse kompliziert sind,
verschiedene Teile der Familie bedacht werden wollen, oder gar die
Erwachsenen der Familie zerstritten sind, spürt man eher Stress als
Liebe. Christina Weisbrod und Kaja Harenberg arbeiten in der
Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werls Pfalz in Neustadt
und kennen die Problematik ihrer Gesprächspartner. Die beiden
Beraterinnen empfehlen Erwachsenen und Kindern im Vorfeld des
Festes gut zu planen, um Stress und Streitigkeiten zu vermeiden.
Dann könne Weihnachten auch in getrennt lebenden Familien und in
Patchworkfamilien zu einem gelungenen Fest der Liebe werden.
„Wenn die Erwachsenen im Clinch sind, dann ist Stress auch für
die Kinder vorprogrammiert“, sagt Weisbrod. Um das zu
vermeiden, müsse man sich austauschen, darüber reden, was passieren
kann, und Kompromisse finden, mit denen alle leben können. Die
beiden Erziehungsberaterinnen raten davon ab, die Kinder
entscheiden zu lassen, wo und bei wem sie wann feiern wollen.
„Dabei geraten die Kinder zwischen die Fronten. Egal wie sie sich
entscheiden, ein Elternteil ist meistens enttäuscht. Und das spüren
die Kinder“, erklärt Kaja Harenberg. Sollte man dennoch die Kinder
entscheiden lassen, dann habe man die Entscheidung unbedingt zu
akzeptieren.
Ein weiteres Konfliktpotential bestehe auch in
Patchworkfamilien, in denen ein Elternteil Kinder aus einer
früheren Beziehung in die neue Familie mit eingebracht habe. Hier
könnten Streitigkeiten vermieden werden, „wenn zuvor alle zusammen
besprechen, welche Traditionen übernommen und wie sie integriert
werden“, empfehlen die Erziehungsberaterinnen. Allerdings sollten
Themen wie die jeweiligen Ex-Partner an Weihnachten tabu sein.
Dass alle zusammen feiern, klänge zwar nach einer sehr schönen
Idee. Und da jeder wolle, dass Weihnachten ein guter Tag werde,
müsse man die Festtage möglichst entspannt gestalten, erklärt
Erziehungsberaterin Weisbrod. Das könne gelingen, in dem die
getrennten Elternpaare ihren Kindern zuliebe einen toleranten
Umgang pflegten. Bei der Planung gelte es keine Forderungen
aufzustellen, sondern Wünsche zu äußern, die dann verhandelt werden
können, sagen Weisbrod und Harenberg. Planung und Absprache seien
das A und O für stressfreie frohe Weihnachten in Patchworkfamilien.
lk
22.12.2015
Anonym. Kompetent. Rund um die Uhr.
 Ökumenische
Telefonseelsorge: Einsamkeit ist nicht nur an Weihnachten ein
Thema
Ökumenische
Telefonseelsorge: Einsamkeit ist nicht nur an Weihnachten ein
Thema
Kaiserslautern- Weihnachten mit der
Familie zu feiern, gehört für die meisten Menschen einfach dazu.
Wenn aber niemand da ist, mit dem man feiern kann, macht sich
gerade an den Feiertagen Einsamkeit bemerkbar. Einsamkeit – das ist
auch eines der Themen, die bei der Telefonseelsorge am häufigsten
angesprochen werden, meint der evangelische Leiter der Ökumenischen
Telefonseelsorge Pfalz, Peter Annweiler.
„Neben Themen wie Gesundheit, Beziehung und Suizidgedanken ist
Einsamkeit ein großes Thema – das aber nicht nur an Weihnachten“,
sagte Annweiler. „Vor den Feiertagen häufen sich eher Fälle, in
denen gestresste Anrufer Entlastung suchen.“ Darüber zu reden,
biete oftmals Hilfe. Auch bei einsamen Menschen könne man im
Gespräch nach Möglichkeiten der Alltagsgestaltung suchen, die das
Gefühl des Alleinseins lindern.
„Natürlich wird aber vielen gerade an Weihnachten bewusst, wen
sie vermissen, egal ob sie in Trauer sind oder der Kontakt einfach
nur abgerissen ist“, erklärt der Seelsorger. Jedoch steige die
Anruferzahl an Heiligabend kaum an, eher an den Tagen davor und
danach. Die Themen der Anrufe unterscheiden sich nicht sehr von
denen anderer Jahreszeiten, doch sie erhalten eine weihnachtliche
„Färbung“, meint Annweiler. „Vielfach rufen uns Menschen mit
psychischen Erkrankungen an, für die wir außerhalb von
Behandlungszeiten wichtige Gesprächspartner sind.“
Die Gespräche bei der Ökumenischen Telefonseelsorge sind
beidseitig anonym. Das soll die Hemmschwelle senken und ein Gefühl
der Sicherheit geben. „Dennoch gibt es da eine unglaubliche Nähe
und Direktheit“, schildert der Pfarrer. „Der Telefonhörer liegt
direkt auf dem Ohr, und das Ohr geht sehr weit nach innen.“ Durch
diese Direktheit und Anonymität seien die Dialoge bei der
Telefonseelsorge meist sehr intensiv. Aber man müsse sich auch als
Seelsorger von den Problemen abgrenzen können.
„Die Gespräche sind so unterschiedlich wie die Menschen,
mit denen sie geführt werden“, sagt Annweiler. Gesprächskompetenz
sei ebenso wichtig wie die Fähigkeit, die Unterhaltung zu steuern
und zu klären, was der Anrufer möchte, ihn wertzuschätzen und
Empathie zu zeigen. Für ihn seien die vier Grundsäulen der
Telefonseelsorge Dasein, Standhalten, Trösten und Stärken.
In der Ökumenischen Telefonseelsorge Pfalz arbeiten rund 80
Ehrenamtliche, die dreimal im Monat für je fünf Stunden an den
Apparaten sitzen. Die Telefonseelsorge ist 24 Stunden am Tag,
sieben Tage in der Woche besetzt. Die Telefonseelsorge Pfalz führt
pro Jahr etwa 10.000 Seelsorge- und Beratungsgespräche. Die
durchschnittliche Gesprächsdauer liegt bei 25 Minuten, erklärt
Annweiler, der die Telefonseelsorge mit seinen katholischen
Kolleginnen Astrid Martin und Ursula Adam leitet.
Um ehrenamtlicher Telefonseelsorger zu werden, muss eine
Ausbildung absolviert werden, die eineinhalb Jahre dauert und in
denen 200 Unterrichtsstunden besucht werden müssen. Darin werden
Themen behandelt wie beispielsweise Selbsterfahrung,
Gesprächsführung und Fragen, die häufig bei der Telefonseelsorge
zur Sprache kommen. Nach der Hospitation erfolgt schließlich die
Zulassung als Telefonseelsorger.
„Wünschenswert ist es, wenn unsere Bewerber Lebenserfahrung und
Offenheit mitbringen, sagt Annweiler. Im Bewerbungsgespräch werde
auch geprüft, ob der Bewerber oder die Bewerberin sich gut in
andere Menschen einfühlen könne. Der Ausbildungskurs wird alle zwei
Jahre durchgeführt, der nächste Kurs startet voraussichtlich
2017.
Hinweis: Die Telefonseelsorge ist bundesweit unter den
Rufnummern 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222 erreichbar sowie
online zur Chat- und Email-Beratung unter www.telefonseelsorge-pfalz.de.
Text und Foto: lk
21.12.2015
„Die Welt braucht eine Demonstration der Barmherzigkeit“
 Kirchenpräsident Christian Schad ruft dazu auf, Fremde und
Schwache nicht auszugrenzen
Kirchenpräsident Christian Schad ruft dazu auf, Fremde und
Schwache nicht auszugrenzen
Speyer- Der pfälzische Kirchenpräsident
Christian Schad ruft anlässlich des Weihnachtsfestes die Christen
dazu auf, Fremde nicht auszugrenzen und sich den Armen und
Schwachen, Vertriebenen und Verzweifelten zuzuwenden. Jesus selbst
sei ein Flüchtling gewesen, hinein geboren in die Familie armer
Leute, erklärt der Kirchenpräsident. Die Geburt Jesu habe Glaube,
Liebe und Hoffnung in die Welt gebracht. „Um Gottes und der
Menschen willen brauchen wir dieses Fest. Gott ist heruntergekommen
und hineingeraten in den Tumult des wirklichen Lebens. In ihm, dem
Flüchtlingskind, ist Gott da, mitten unter uns.“
Kirchenpräsident Schad warnt davor, sich von Ängsten vor
Überfremdung, von fremdenfeindlichen oder rassistischen Parolen
leiten zu lassen. „Da werden Fremde verurteilt und bedroht, die man
so wenig kennt, wie ihre Kultur und ihre Religion. Ich habe kein
Verständnis für diese Art der Demonstration.“ Die Welt brauche eine
„friedliche Revolution, eine Demonstration der Barmherzigkeit“. Die
Weihnachtsbotschaft rufe dazu auf, für die Würde und das Recht
jedes Einzelnen einzustehen. „Ich war ein Fremder, und ihr habt
mich aufgenommen“ – so habe Jesus als Erwachsener beschrieben, wie
ein Leben in seiner Nachfolge aussehen könne. Es gebe eine große
Sehnsucht nach Liebe und Hoffnung für das Leben und diese Welt, in
der Völker nicht mit Gewalt beherrscht und Menschen nicht in die
Flucht geschlagen werden.
„Trotz mancher Verzweiflung über Andere und uns selbst, trotz
Gewalt und Terror, Kriegen und Bürgerkriegen sind wir Beschenkte“,
erklärt Kirchenpräsident Christian Schad. „Wir sind begabt mit
Fähigkeiten – mit Händen, die teilen können, mit Mündern, die sich
öffnen, um die Stimme für die Schwachen und Elenden zu
erheben.“
Hinweis: Kirchenpräsident Christian Schad predigt im
Gottesdienst am Ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr in der Speyerer
Gedächtniskirche. Die Liturgie gestaltet Dekan Markus Jäckle, die
Kantorei Speyer führt unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor
Robert Sattelberger weihnachtliche Chormusik auf. Im Gottesdienst
feiert die Gemeinde das Heilige Abendmahl. Text und Foto:
lk
21.12.2015
Bundeskanzler a. D. Dr. Helmut Kohl zu Besuch im Dom zu Speyer
 Erster Ausflug nach Klinikaufenthalt – Begleitung durch
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Bischof em. Dr. Anton
Schlembach
Erster Ausflug nach Klinikaufenthalt – Begleitung durch
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Bischof em. Dr. Anton
Schlembach
Speyer- Am Samstag hat Bundeskanzler a.D.
Dr. Helmut Kohl in Begleitung seiner Ehefrau Dr. Maike Kohl-Richter
den Speyerer Dom besucht. Es war der erste Ausflug nach dem
längeren Klinikaufenthalt in diesem Jahr. Helmut Kohl war es ein
Herzensanliegen, noch vor Weihnachten in den Speyerer Dom zu
kommen. Gerne hätte er am Weihnachtsgottesdienst in der Kathedrale
teilgenommen. Doch obwohl es ihm offenkundig sehr viel besser geht,
wird er gesundheitlich dazu noch nicht in der Lage sein.
Begrüßt und bei ihrem Besuch im Dom begleitet wurden
Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl und seine Ehefrau Dr. Maike
Kohl-Richter von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und dem
emeritierten Bischof Dr. Anton Schlembach. Domorganist Markus
Eichenlaub spielte auf der großen Domorgel die Toccata in d-Moll
von Johann Sebastian Bach - ein Werk, das auch zu früheren Besuchen
mit bedeutenden Staatsgästen wie Margaret Thatcher, Michael
Gorbatschow, George Bush, Václav Havel, Boris Jelzin und König Juan
Carlos erklungen war. Am Beispiel des Gotteshauses hatte Helmut
Kohl den prominenten Gästen die Bedeutung des christlichen Glaubens
für ein Zusammenleben in Gerechtigkeit und Frieden in Deutschland,
Europa und der Welt verdeutlicht.
 Vor dem Marienbildnis zündeten die Bischöfe gemeinsam mit
dem Ehepaar Kohl eine Kerze an und beteten gemeinsam das „Vater
unser“ und das „Gegrüßet seist Du Maria“. Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann brachte seine Freude über den Besuch des Ehepaars Kohl
zum Ausdruck und übergab dem Bundeskanzler, der bis heute dem
Kuratorium der „Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“
vorsteht, das jüngst erschienene Buch „Himmlische Klänge –
Grandioses Raumerlebnis“ über die Orgeln im Dom zu Speyer. Er
verband damit seinen Dank für das große Engagement Helmut Kohls für
die romanische Kathedrale, die seit 1981 zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählt. „Sie haben sich in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt des
Doms verdient gemacht und entscheidend dazu beigetragen, Menschen
für dieses eindrucksvolle Sinnbild der christlichen Wurzeln eines
geeinten Europas zu begeistern“, dankte er Helmut Kohl, der von dem
Besuch tief berührt war. Der Besuch der Speyerer Kathedrale, der er
seit seiner Kindheit eng verbunden ist, bedeutete für ihn eine
große Freude. Bereits Ende September war er vom Speyer Domkapitel
für seine Verdienste für den Speyer Dom öffentlich geehrt worden.
Die Begegnung klang aus mit adventlichen und weihnachtlichen
Werken, dargeboten an der großen Domorgel von Domorganist Markus
Eichenlaub. Text: is; Fotos: Klaus Landry
Vor dem Marienbildnis zündeten die Bischöfe gemeinsam mit
dem Ehepaar Kohl eine Kerze an und beteten gemeinsam das „Vater
unser“ und das „Gegrüßet seist Du Maria“. Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann brachte seine Freude über den Besuch des Ehepaars Kohl
zum Ausdruck und übergab dem Bundeskanzler, der bis heute dem
Kuratorium der „Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“
vorsteht, das jüngst erschienene Buch „Himmlische Klänge –
Grandioses Raumerlebnis“ über die Orgeln im Dom zu Speyer. Er
verband damit seinen Dank für das große Engagement Helmut Kohls für
die romanische Kathedrale, die seit 1981 zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählt. „Sie haben sich in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt des
Doms verdient gemacht und entscheidend dazu beigetragen, Menschen
für dieses eindrucksvolle Sinnbild der christlichen Wurzeln eines
geeinten Europas zu begeistern“, dankte er Helmut Kohl, der von dem
Besuch tief berührt war. Der Besuch der Speyerer Kathedrale, der er
seit seiner Kindheit eng verbunden ist, bedeutete für ihn eine
große Freude. Bereits Ende September war er vom Speyer Domkapitel
für seine Verdienste für den Speyer Dom öffentlich geehrt worden.
Die Begegnung klang aus mit adventlichen und weihnachtlichen
Werken, dargeboten an der großen Domorgel von Domorganist Markus
Eichenlaub. Text: is; Fotos: Klaus Landry
20.12.2015
Weihnachten mit Flüchtlingen feiern
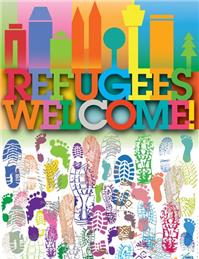 Bistum
Speyer hat Anregungen für Feiern mit Menschen unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen zusammengestellt
Bistum
Speyer hat Anregungen für Feiern mit Menschen unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen zusammengestellt
Speyer- Anregungen und Ideen, wie
Gemeinden mit Flüchtlingen Weihnachten feiern können, bietet eine
„Baustein-Sammlung“, die das Bistum Speyer, angeregt durch eine
Arbeitshilfe des Michaelisklosters in Hildesheim, angefertigt hat.
Mit der Zusammenstellung von Texten und Liedern in verschiedenen
Sprachen wollen die Verfasser Pfarreien dazu ermutigen, Flüchtlinge
– je nach Herkunft und Religionszugehörigkeit - zu Gottesdiensten
oder weihnachtlichen Feiern einzuladen.
Durch die Ereignisse der letzten Monate höre man die so
vertraute Weihnachtsgeschichte „mit ganz anderen Ohren“, schreibt
Domkapitular Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung Seelsorge
des Bischöflichen Ordinariats im Vorwort zu der Arbeitshilfe. „Der
Sohn Gottes ist Kind einer Flüchtlingsfamilie und darauf
angewiesen, dass er als Fremder aufgenommen wird.“
Christen seien aufgefordert, Menschen auf der Flucht aufzunehmen
und sich ihrer Sorgen und Nöte anzunehmen. „Gerade jetzt zum
Weihnachtsfest können wir Zeugnis geben von Gott, der sich den
Menschen zuwendet, wenn wir wie Jesus alle an der Freude teilhaben
lassen und auch die einladen, die am Rand der Gesellschaft
stehen.“
Die Arbeitshilfe beinhaltet eine Begrüßung, Gebete, Bibeltexte
und Lieder in Deutsch, Englisch und Arabisch. Dadurch können
Flüchtlinge nicht nur leichter das Gesprochene nachvollziehen,
sondern auch selbst Gebete und Texte vortragen. Die Texte stammen
zum Großteil aus einer umfangreichen Arbeitshilfe des Evangelischen
Zentrums für Gottesdienst und Kirchenmusik in Hildesheim (www.michaeliskloster.de) und
wurden so überarbeitet, dass sie ohne weiteres in katholischen
Gottesdiensten eingesetzt werden können.
Die Materialien sind auf der Homepage des Bistums Speyer
www.bistum-speyer.de zu
finden. Text und Bild: is
18.12.2015
Leser des “pilger"spenden 10 000 Euro für Caritas-Flüchtlingshilfe
 Chefredakteur Norbert Rönn sagt weitere Unterstützung
durch Aktion Silbermöwe zu
Chefredakteur Norbert Rönn sagt weitere Unterstützung
durch Aktion Silbermöwe zu
Speyer- Mehr als 10 000 Euro haben in den
zurückliegenden Wochen die Leserinnen und Leser des „pilger“ über
dessen Aktion Silbermöwe für die Flüchtlingshilfe des
Diözesan-Caritasverbandes gespendet. Norbert Rönn, Chefredakteur
der Bistumszeitung, übergab den Betrag von 10 100 Euro am 14.
Dezember bei einer vorweihnachtlichen Feier des diözesanen
Wohlfahrstverbandes in Speyer.
Sowohl Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wie auch Domkapitular
Karl-Ludwig Hundemer, Vorsitzender des Caritasverbandes für die
Diözese Speyer, und Caritasdirektor Vinzenz du Bellier dankten der
Aktion Silbermöwe für dieses „beeindruckende Zeichen der
Solidarität mit den Flüchtlingen“.
Norbert Rönn verwies auf die große „Schnittmenge“ in der Arbeit von
Caritasverband und Aktion Silbermöwe, die mit Solidarität,
Nächstenliebe und Hinwendung zu den Menschen am Rande umschrieben
werden könne. Die Arbeit des Speyerer Diözesan-Caritasverbandes in
der Flüchtlingshilfe nannte er „leuchtturmhaft“. Sie beinhalte
wirksame Unterstützung für die große Zahl von Menschen, die
teilweise nach schrecklichen Fluchterlebnissen Aufnahme bei uns in
der Pfalz und Saarpfalz suchten, und nehme gleichzeitig die sich
verschärfende Lage in deren Herkunftsländern in den Blick. Die
Situation in den Flüchtlingslagern im Nordirak und in den
Nachbarländern Syrien nannte der Chefredakteur „skandalös“. „Die
Flüchtlinge hungern, haben keinerlei Perspektive. Die
Völkergemeinschaft versagt völlig.“ Caritas international und
andere Hilfswerke leisteten einen Beitrag, „dass die Menschen nicht
ganz ohne Hoffnung sind“, so Rönn.
Als Zeitung beleuchte der „pilger“ zudem immer wieder die Situation
vor allem in den Kriegsregionen im Nahen und Mittleren Osten sowie
die weltweiten Fluchtursachen, die viel mit machtpolitischen und
wirtschaftlichen Interessen der Länder Europas und der
Industrienationen insgesamt zu tun hätten, betonte Rönn, der eine
weitere Unterstützung der Caritas-Flüchtlingshilfe durch die Aktion
Silbermöwe zusagte.
Die Aktion Silbermöwe ist eine einmalige Initiative in der
deutschen Presselandschaft und in den deutschen Bistümern. Seit
mehr als 50 Jahren leisten die Leserinnen und Leser der Speyerer
Bistumszeitung „der pilger“ über die Aktion Silbermöwe Hilfe für
notleidende Menschen – vor allem in den Ländern des armen Südens.
Allein in den zurückliegenden zehn Jahren konnten über das
Leser-Hilfswerk Projekte in mehr als 40 Ländern der Erde mit fast
zehn Millionen Euro gefördert werden.
Text und Bild: Bistum Speyer, Presse
16.12.2015
„Domkiosk“ im südlichen Domgarten wird neues Besucherzentrum
 Angebot soll spirituelle Bedeutung der Kathedrale ebenso
vermitteln wie kunstgeschichtliche Besonderheiten der
Weltkulturerbestätte
Angebot soll spirituelle Bedeutung der Kathedrale ebenso
vermitteln wie kunstgeschichtliche Besonderheiten der
Weltkulturerbestätte
spk. Speyer- Im Vorfeld der 2000-Jahr-Feier der
Stadt Speyer im Jahr 1990 als Siegerentwurf nach einem breit
angelegten, international ausgeschriebenen Wettbewerb gemeinsam mit
den Domplätzen von dem international renommierten
Stararchitekten Oswald Mathias Ungers geplant und
realisiert, wird jetzt der zwischenzeitlich auch als Café genutzte
Dompavillion nun wieder seiner ursprünglichen Nutzung als
Besucherzentrum der Weltkulturerbestätte zugeführt. Das teilte
jetzt der „summus custos“ der  Kathedrale und Baudezernent des Bistums Speyer,
Domkapitular Peter Schappert, gemeinsam mit
Friederike Walter, der Verantwortlichen für das
„Dom-Kulturmanagement“ und Bastian Hoffmann vom
„Dom-Besuchermanagment“, im Rahmen eines Pressegespräches im
„Blauen Salon“ der Bischöflichen Finanzkammer mit. Damit sind jetzt
auch frühere Pläne vom Tisch, die vorsahen, das Besucherzentrum in
den 'Vikarienhöfen' direkt am Domplatz gegenüber der Kathedrale
einzurichten.
Kathedrale und Baudezernent des Bistums Speyer,
Domkapitular Peter Schappert, gemeinsam mit
Friederike Walter, der Verantwortlichen für das
„Dom-Kulturmanagement“ und Bastian Hoffmann vom
„Dom-Besuchermanagment“, im Rahmen eines Pressegespräches im
„Blauen Salon“ der Bischöflichen Finanzkammer mit. Damit sind jetzt
auch frühere Pläne vom Tisch, die vorsahen, das Besucherzentrum in
den 'Vikarienhöfen' direkt am Domplatz gegenüber der Kathedrale
einzurichten.
 Entsprechende Pläne, so erklärte Schappert dazu, hätten
sich angesichts der vorhandenen Bausubstanz als zu aufwändig und
damit als zu teuer erwiesen. So hätte allein die Schaffung eines
für Rollstuhlfahrer geeigneten, barrierefreien Zugangs zum
Hochparterre des denkmalgeschützten Gebäudes einen nur schwer zu
vertretenden Eingriff dargestellt, ohne dass aus einem solchen
Eingriff die gewünschten Vorteile in seiner funktionellen Nutzung
hätten erreicht werden können.
Entsprechende Pläne, so erklärte Schappert dazu, hätten
sich angesichts der vorhandenen Bausubstanz als zu aufwändig und
damit als zu teuer erwiesen. So hätte allein die Schaffung eines
für Rollstuhlfahrer geeigneten, barrierefreien Zugangs zum
Hochparterre des denkmalgeschützten Gebäudes einen nur schwer zu
vertretenden Eingriff dargestellt, ohne dass aus einem solchen
Eingriff die gewünschten Vorteile in seiner funktionellen Nutzung
hätten erreicht werden können.
Jetzt soll das Ziel, dass sich Besucher der Kathedrale
„Willkommen und informiert“ fühlen sollen, künftig wieder in dem
würfelförmigen Gebäude im südlichen Domgarten umgesetzt werden, so
Schappert. Erste Schritte dazu seien bereits getan - Mitte 2016
soll es eröffnet werden und dann als zentrale Anlaufstelle für die
zahlreichen Dombesucher aus aller Welt dienen und so „den Dombesuch
positiv verstärken“, so der Domkustos.
Mit Hilfe des Besucherzentrums solle vorrangig die Bestimmung
des Doms als Kirche und seine Bedeutung als Denkmal vermittelt
werden. Damit sollen zugleich Verkaufs- und Informationsangebote
soweit möglich aus dem Dom ausgelagert werden - sämtliche
seelsorglichen Angebote dagegen in der Kirche selbst verortet
bleiben, umriss Friederike Walter die Aufgabenstellung - und ihr
Kollege Bastian Höffmann ergänzte, dass sich daraus dann letztlich
auch das Raumprogramm sowie die Bedarfsschilderung abgeleitet
habe.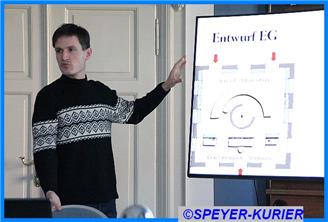
Anhand von Beispielen erläuterte Bastian Hoffmann, wie diese
Zielsetzung konkret in die Raumgestaltung umgesetzt werden wird. So
finde sich der Wunsch nach Schaffung einer Willkommenssituation
beispielsweise in der großen runden Empfangstheke wieder, an der
neben Informationen über Gottesdienste und Veranstaltungen wie
Konzerten in der Kathedrale auch deren Termine und Anfangszeiten
sowie die Zugangswege dazu dargestellt werden. Auch Eintrittskarten
zu den Konzerten im Dom würden dort ebenso zum Kauf angeboten wie
Tickets für den Besuch der Krypta, des Kaisersaales und der
Aussichtsplattform auf dem Westturm der Kathedrale. Schließlich
würden dort auch die Audioguides für den Dom an die Besucher
ausgegeben.
Die Bestimmung des Doms als Kirche werde darüber hinaus auch in
dem zentral angebrachten, gut sichtbaren Kreuz verdeutlicht. Die
Planung und Durchführung der Baumaßnahme hat der Speyerer
Dombaumeister Mario Colletto gemeinsam mit dem
Oftersheimer Planungsbüro „s-quadrate“
übernommen.
Wie der Domkustos weiter erläuterte, beinhalten die Planungen
für das Dom-Besucherzentrum nicht nur rein bauliche Aspekte. Als
Schnittstelle soll es vielmehr darüber hinaus Menschen mit einem
seelsorglichen Anliegen passende Ansprechpartner vermitteln.
Angebote der Dompfarrei und der Dommusik sollen deshalb dort ebenso
kommuniziert werden, wie Informationen zu Partnern wie der Stadt
Speyer und dem Historischen Museum der Pfalz. Nicht zuletzt soll
Besuchern auch die Möglichkeit aufgezeigt werden, sich für den
Erhalt des Doms einzusetzen, sei es ganz direkt oder über den
„Dombauverein Speyer“ oder über die „Europäische Stiftung Kaiserdom
zu Speyer“.
 Um dem internationalen Rang des Domes gerecht zu werden,
soll das im Dom-Besucherzentrum eingesetzte Personal mehrsprachig
Auskunft geben können. Die kulturhistorische Bedeutung des Domes
solle darüber hinaus in dem Produktangebot, insbesondere in Form
von entsprechender Literatur ihren Platz finden. Für Touristen wird
es zudem eine kleine Auswahl an Souvenirs und Postkarten geben. Ob
im Außenbereich auch noch ein gastronomisches Minimalangebot
realisiert werden könne, werde derzeit noch geprüft.
Um dem internationalen Rang des Domes gerecht zu werden,
soll das im Dom-Besucherzentrum eingesetzte Personal mehrsprachig
Auskunft geben können. Die kulturhistorische Bedeutung des Domes
solle darüber hinaus in dem Produktangebot, insbesondere in Form
von entsprechender Literatur ihren Platz finden. Für Touristen wird
es zudem eine kleine Auswahl an Souvenirs und Postkarten geben. Ob
im Außenbereich auch noch ein gastronomisches Minimalangebot
realisiert werden könne, werde derzeit noch geprüft.
Als zentrale Anlaufstelle werde auch die Sicherheit der Besucher
im Dom bei den Planungen in den Blick genommen und in dem
Besucherzentrum einen festen Platz finden. Neben einer
Erste-Hilfe-Ausstattung und entsprechend geschulten Mitarbeitern
werden deshalb auch die Überwachungstechnik des Südwestturms im
Besucherzentrum untergebracht.
Nach Auskunft von Domkapitular Schappert beträgt die Grundfläche
des quaderförmigen Gebäudes 80qm. Im Erdgeschoss wird es neben dem
Bereich für die Besucher auch einen kleinen Arbeitsbereich geben,
wo beispielsweise die Domführer zukünftig die
Gruppenführungssysteme abholen können. Das Obergeschoss wird als
Bürofläche dienen. Um mit der räumlich „überschaubaren“ Fläche
sinnvoll umzugehen, soll auch der Außenbereich in die Planung mit
einbezogen werden. So sollen in dem neuen Dom-Besucherzentrum
Informationsdisplays installiert werden, die auch von außen
sichtbar sein werden. Weitere Informationsangebote stehen natürlich
auch zukünftig extern in Form der „Dom-Website“, der „Dom-App“ oder
im benachbarten Dom- und Diözesanmuseum innerhalb des „Historischen
Museums der Pfalz“ zur Verfügung.
 Nach der Übergabe des Gebäudes durch die Pächterin Ende
November 2015 sei inzwischen mit dem Rückbau des bisherigen
Innenausbaus begonnen worden. Aktuell würden Elektroarbeiten
durchgeführt, im Neuen Jahr gehe es dann mit Trockenbau, Boden und
Malerarbeiten weiter, ehe zuletzt die neue Möblierung aus Pfälzer
Eichenholz und einem Verbundwerkstoff eingebaut wird. Die Eröffnung
des neuen Besucherzentrums soll Mitte des Jahres 2016 erfolgen.
Nach der Übergabe des Gebäudes durch die Pächterin Ende
November 2015 sei inzwischen mit dem Rückbau des bisherigen
Innenausbaus begonnen worden. Aktuell würden Elektroarbeiten
durchgeführt, im Neuen Jahr gehe es dann mit Trockenbau, Boden und
Malerarbeiten weiter, ehe zuletzt die neue Möblierung aus Pfälzer
Eichenholz und einem Verbundwerkstoff eingebaut wird. Die Eröffnung
des neuen Besucherzentrums soll Mitte des Jahres 2016 erfolgen.
Die Kosten für die Maßnahme sollen sich wie folgt
zusammensetzen: 188.000 Euro sind für den Umbau des Innenraums,
40.000 für den Außenbereich - hier in erster Linie für den
Bodenbelag. Dazu kommen noch variable Kosten für das Inventar, in
erster Linie für Mobiliar und Haustechnik.
Das Dom-Besucherzentrum soll ganzjährig während der regulären
Domöffnungszeiten geöffnet sein. Das bedeutet, dass es den
Besuchern auch dann offensteht, wenn der Dom wegen eines besonderen
Gottesdienstes oder einer Veranstaltung nicht besichtig werden
kann.
Und schließlich noch ein letztes: mit der Fertigstellung des
neuen Besucherzentrums wird auch der weiße Container an der
Nordseite des Domes, der auch nach Meinung des Domkustos nicht
unbedingt „eine Zierde“ darstellt, verschwinden.
Foto: gc
15.12.2015
Ein leuchtendes Willkommenszeichen
-01.jpg) Friedenslichtaktion der Pfadfinder
Friedenslichtaktion der Pfadfinder
Speyer- Ein Licht setzt Zeichen. Mit der
Friedenslichtaktion am vergangenen Sonntag in der Speyerer
Gedächtniskirche möchten die Pfadfinderinnen und Pfadfinder für
eine gelebte Willkommenskultur werben.
Angesichts der vielen Flüchtlinge in Deutschland hatten die
Verbände VCP (Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder),
BDP (Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder) und DPSG (Deutsche
Pfadfinderschaft St. Georg) die diesjährige Aktion unter das Motto
"Hoffnung schenken- Frieden finden" gestellt.
-01.jpg) Der ökumenische Gottesdienst stand so auch ganz im
Zeichen des Hoffnungslichtes, das die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus Bethlehem nach Wien und von dort aus in viele
europäische Länder gebracht hatten. Im Rahmen des Gottesdienstes
kam Maria Lajin zu Wort, eine junge Christin, die mit ihren Eltern
und Geschwistern im Kleinkindalter aus dem Irak nach Deutschland
geflohen war. Die 18-jährige Ludwigshafenerin berichtete von der
Angst der Christen in ihrer alten Heimat, von der Flucht der Eltern
nach Deutschland und vom Heimisch-werden in einer neuen Umgebung.
Maria erzählte von ihrer Taufpatin, einer Frau, die der Familie
damals das Ankommen erleichterte. Marias Mutter hilft heute
ihrerseits Menschen, die auf ihrer Flucht in Deutschland gestrandet
sind und unterstützt sie bei Behördengängen.
Der ökumenische Gottesdienst stand so auch ganz im
Zeichen des Hoffnungslichtes, das die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus Bethlehem nach Wien und von dort aus in viele
europäische Länder gebracht hatten. Im Rahmen des Gottesdienstes
kam Maria Lajin zu Wort, eine junge Christin, die mit ihren Eltern
und Geschwistern im Kleinkindalter aus dem Irak nach Deutschland
geflohen war. Die 18-jährige Ludwigshafenerin berichtete von der
Angst der Christen in ihrer alten Heimat, von der Flucht der Eltern
nach Deutschland und vom Heimisch-werden in einer neuen Umgebung.
Maria erzählte von ihrer Taufpatin, einer Frau, die der Familie
damals das Ankommen erleichterte. Marias Mutter hilft heute
ihrerseits Menschen, die auf ihrer Flucht in Deutschland gestrandet
sind und unterstützt sie bei Behördengängen.
Marias Geschichte brachte den Pfadfinderinnen und Pfadfindern
und den mitfeiernden Gästen das oft so abstrakte Thema Flucht und
Vertreibung sehr nah. Die Geschichte von Familie Lajin zeigt: Ein
freundliches Willkommen ist weit mehr als ein kurzfristiges
Hoffnungszeichen. Es ist ein großer Schritt hin zu einer
gelingenden Integration.
-01.jpg) Für die Hoffnung auf eine dauerhaft friedliches
Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen und
Religionen steht das Friedenslicht in diesem Jahr. Von Speyer aus
wird es nun in die Gemeinden des Bistums weitergegeben. Die
Kollekte des Gottesdienstes erbrachte ein Spendensumme von rund
1.000 Euro. Der Betrag wird der Flüchtlingshilfe zur Verfügung
gestellt.
Für die Hoffnung auf eine dauerhaft friedliches
Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen und
Religionen steht das Friedenslicht in diesem Jahr. Von Speyer aus
wird es nun in die Gemeinden des Bistums weitergegeben. Die
Kollekte des Gottesdienstes erbrachte ein Spendensumme von rund
1.000 Euro. Der Betrag wird der Flüchtlingshilfe zur Verfügung
gestellt.
Zur Info: Die Friedenslichtaktion wird auf dem
gesamten europäischen Kontinent durchgeführt und ist in vielen
Ländern zu einer pfadfinderischen Tradition geworden. Jedes Jahr
entzündet ein Kind ein kleines Licht in der Geburtsgrotte Jesu in
Bethlehem. Dieses wird dann nach Wien gebracht, wo es von
Pfadfinderdelegationen aus vielen europäischen Ländern in Empfang
genommen und danach im Heimatland weiterverteilt wird. Seit über 20
Jahren beteiligen sich Pfadfinderinnen und Pfadfinder aus
Deutschland an der Aktion. Die Idee stammt vom ORF, der diese
Aktion initiierte. Das Licht von Bethlehem ist ein Symbol des
Friedens, es soll uns alle und jeden, der es sieht, daran erinnern,
sich für den Frieden einzusetzen, besonders auch in seiner direkten
Umgebung.
Das Friedenslicht brennt das ganze Jahr hindurch in der
Klosterkirche St. Magdalena in Speyer.
Text: BDKJ Speyer; Foto: (c) DPSG DV Speyer |
L. Ziffer bzw. N. Uhl.
14.12.2015
„Heiliges Jahr der Barmherzigkeit“ im Bistum Speyer eröffnet
 Bischof Wiesemann durchschreitet „Heilige Pforte“ am Dom
zu Speyer– Domweihfest im Oktober geht eine „Nacht der
Barmherzigkeit“ mit Brüdern aus Taizé voraus
Bischof Wiesemann durchschreitet „Heilige Pforte“ am Dom
zu Speyer– Domweihfest im Oktober geht eine „Nacht der
Barmherzigkeit“ mit Brüdern aus Taizé voraus
Speyer- Mit einem Pontifikalamt hat
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann das „Heilige Jahr der
Barmherzigkeit“ im Bistum Speyer eröffnet. Mit den Worten „Das ist
das Tor zum Herrn: Durch dieses Tor treten wir ein, um
Barmherzigkeit und Vergebung zu erlangen“ öffnete der Bischof das
Otto-Portal auf der Südseite des Domes als „Heilige Pforte“.
Zum ersten Mal in einem Heiligen Jahr gibt es „Heilige Pforten“
auch außerhalb Roms. Die Heilige Pforte soll in den Herzen der
Menschen eine Tür der Barmherzigkeit aufstoßen. Jeder Mensch könne
durch sein Lebens- und Glaubenszeugnis eine lebendige Tür für
andere sein, erklärte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, bevor er
mit einem Evangeliar in den Händen die Heilige Pforte durchschritt,
gefolgt von den Geistlichen, den Rittern vom Heiligen Grab zu
Jerusalem, den Sängern der Dom-Schola und der Gottesdienstgemeinde.
Das Otto-Portal am Speyerer Dom ist dem heiligen Bischof Otto von
Bamberg gewidmet, der beim Dombau mitgewirkt hat.
In seiner Predigt im voll besetzten Dom bezeichnete Bischof
Wiesemann die Barmherzigkeit als die „tiefste Offenbarung dessen,
was Gott in seinem Innersten antreibt.“ Das Heilige Jahr sei ein
Impuls, sich vom Geheimnis der Barmherzigkeit Gottes neu ausrichten
zu lassen. Barmherzigkeit bedeute nicht, sich wie die Herrscher der
Antike von oben herabzulassen und durch Mildtätigkeit zu besonderen
Anlässen die eigene Macht zu inszenieren. In der Barmherzigkeit
Gottes offenbare sich vielmehr eine Liebe, die die Konsequenzen des
Unrechts mitträgt. „So wie Eltern, die die Wege ihrer Kinder
vielleicht auch nicht immer gutheißen können, aber doch die
Konsequenzen in Liebe mittragen“, verdeutlichte Bischof Wiesemann.
Er rief die Gläubigen dazu auf, sich in das Erbarmen Gottes
hineinnehmen zu lassen. „Wir wollen eine Kirche sein, die nah bei
den Menschen ist und ihnen die Liebe Gottes zuwendet.“ Christen,
die sich mit Gott versöhnen lassen, könnten so zum lebendigen
Zeichen werden. „In ihnen strahlen das Licht und die Liebe Gottes
auf für alle, die in Dunkelheit sind.“
 Auch in den Wallfahrtsorten Maria Rosenberg, Blieskastel
und Oggersheim werden am vierten Adventssonntag „Heilige Pforten“
eröffnet. Darüber setzt das Bistum Speyer mit der Aktion „Mission
Misericordia“ einen Impuls, Türen im privaten, öffentlichen oder
kirchlichen Raum mit einem eigens für die Aktion entwickelten
Aufkleber zu bekleben und damit deutlich zu machen: Tritt ein, ich
bin da für Dich.
Auch in den Wallfahrtsorten Maria Rosenberg, Blieskastel
und Oggersheim werden am vierten Adventssonntag „Heilige Pforten“
eröffnet. Darüber setzt das Bistum Speyer mit der Aktion „Mission
Misericordia“ einen Impuls, Türen im privaten, öffentlichen oder
kirchlichen Raum mit einem eigens für die Aktion entwickelten
Aufkleber zu bekleben und damit deutlich zu machen: Tritt ein, ich
bin da für Dich.
Im Speyerer Dom lädt ein „Weg der Barmherzigkeit“ die
Besucherinnen und Besucher dazu ein, sich eingehender mit der
Barmherzigkeit Gottes zu befassen. An vier Stationen – dem
Otto-Portal, der Taufkapelle, dem Hauptportal und vor dem
Marienbild – erhalten die Gläubigen spirituelle Impulse, um die
Barmherzigkeit als „das Geheimnis des christlichen Glaubens“ (Papst
Franziskus) zu entdecken und zu betrachten. Im Seitenschiff findet
der „Weg der Barmherzigkeit“ seinen Abschluss. Dort besteht die
Möglichkeit zum Gespräch mit einer Seelsorgerin oder einem
Seelsorger sowie zum Empfang der Beichte. Es liegen Blöcke und
Stifte bereit, um eigene Eindrücke und Gedanken zu notieren oder an
einer Pinnwand für andere Besucher zu hinterlassen. Für den „Weg
der Barmherzigkeit“ sollte man sich etwa eine halbe Stunde Zeit
nehmen.
Auch das Domweihfest am 2. Oktober 2016 soll durch das Heilige
Jahr eine besondere Prägung erfahren. Geplant ist eine „Nacht der
Barmherzigkeit“ vom 1. auf den 2. Oktober mit Taizégebet,
eucharistischer Anbetung und der durchgängigen Möglichkeit zu
Gespräch, Segnung und Beichte. Die Brüder aus Taizé haben ihre
Teilnahme bereits zugesagt.
-01.jpg) Das außerordentliche Heilige Jahr der Barmherzigkeit ist
von Papst Franziskus am 8. Dezember eröffnet worden, genau 50 Jahre
nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965).
Es soll dazu beitragen, „das Zeugnis der Gläubigen stärker und
wirkungsvoller zu machen", heißt es in der Verkündigungsbulle mit
dem Titel „Antlitz der Barmherzigkeit“. Der Papst fordert die
Kirche darin auf, verstärkt auf das Wesentliche zu schauen und
„Zeichen und Werkzeug von Gottes Barmherzigkeit“ zu sein. Die
Barmherzigkeit sei der letzte und endgültige Akt, mit dem Gott den
Menschen entgegentritt, und zugleich „das grundlegende Gesetz, das
im Herzen eines jeden Menschen ruht und den Blick bestimmt, wenn er
aufrichtig auf den Bruder und die Schwester schaut, die ihm auf dem
Weg des Lebens begegnen.“ Barmherzigkeit öffne das Herz für die
Hoffnung, dass „wir trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer
Schuld für immer geliebt sind“, so Papst Franziskus. Traditionell
werden zu Beginn eines Heiligen Jahres die Heiligen Pforten des
Petersdoms und der drei weiteren päpstlichen Basiliken in Rom
geöffnet.
Das außerordentliche Heilige Jahr der Barmherzigkeit ist
von Papst Franziskus am 8. Dezember eröffnet worden, genau 50 Jahre
nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965).
Es soll dazu beitragen, „das Zeugnis der Gläubigen stärker und
wirkungsvoller zu machen", heißt es in der Verkündigungsbulle mit
dem Titel „Antlitz der Barmherzigkeit“. Der Papst fordert die
Kirche darin auf, verstärkt auf das Wesentliche zu schauen und
„Zeichen und Werkzeug von Gottes Barmherzigkeit“ zu sein. Die
Barmherzigkeit sei der letzte und endgültige Akt, mit dem Gott den
Menschen entgegentritt, und zugleich „das grundlegende Gesetz, das
im Herzen eines jeden Menschen ruht und den Blick bestimmt, wenn er
aufrichtig auf den Bruder und die Schwester schaut, die ihm auf dem
Weg des Lebens begegnen.“ Barmherzigkeit öffne das Herz für die
Hoffnung, dass „wir trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer
Schuld für immer geliebt sind“, so Papst Franziskus. Traditionell
werden zu Beginn eines Heiligen Jahres die Heiligen Pforten des
Petersdoms und der drei weiteren päpstlichen Basiliken in Rom
geöffnet.
Der Eröffnungs-Gottesdienst im Speyerer Dom wurde von
Domorganist Markus Eichenlaub und der Schola Cantorum Saliensis
unter Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori musikalisch
gestaltet. Sie brachten unter anderem die „Messe brève no. 5 aux
seminaires“ von Charles Gounod zu Gehör.
Weitere Informationen zum Jahr der Barmherzigkeit:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/heiliges-jahr-der-barmherzigkeit/
www.dbk.de/heiliges-jahr/home/
www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/de.html
 Öffnungszeiten des „Wegs der Barmherzigkeit“ im Dom zu
Speyer:
Öffnungszeiten des „Wegs der Barmherzigkeit“ im Dom zu
Speyer:
werktags November bis März 9 – 17 Uhr
werktags April bis Oktober 9 – 19 Uhr
sonntags ganzjährig 12 – 18 Uhr
Text und Foto: is
13.12.2015
Ein Brückenbauer zur arabischsprachigen Gemeinde
 Pastor Danial betreut aus Ägypten, Syrien und dem Irak
stammende Christen in Ludwigshafen
Pastor Danial betreut aus Ägypten, Syrien und dem Irak
stammende Christen in Ludwigshafen
Ludwigshafen /Eisenberg- Er ist ein
evangelischer Pontifex, ein Brückenbauer: Danial Danial, Pastor der
koptisch-evangelischen Kirche in Ägypten und seit diesem Jahr
hauptamtlicher Seelsorger der evangelisch-arabischsprachigen
Gemeinde in Ludwigshafen. Der 50-Jährige betreut gemeinsam mit
seiner Frau Kenous Shammas die rund 150 Personen, die in der Pfalz
und Kurpfalz leben. Zusammen kommen die aus Ägypten, Syrien und dem
Irak stammenden Christen in den Räumen der Stadtmission
Ludwigshafen. Die Evangelische Kirche der Pfalz trägt gemeinsam mit
dem Evangelischen Gemeinschaftsverband das Projekt.
Mit einem fest angestellten Pastor, der selbst aus einer
Migrantengemeinde kommt, erwachsen nach Ansicht des
Kirchenpräsidenten und des Beauftragten der Landeskirche für
Christen anderer Sprache und Herkunft, Pfarrer Arne Dembek, neue
Möglichkeiten für die Integration. Dies gelte nicht nur für die
Eingliederung in die deutsche Gesellschaft; die durch die
gemeinsame arabische Muttersprache verbundenen Evangelischen übten
auch praktische Ökumene. So feierten altorientalische, orthodoxe
und koptische Christen gemeinsam Gottesdienst, besuchten die
Bibelstunden und kämen zu Jugendgruppentreffen zusammen.
Aber auch für die landeskirchlichen Gemeinden und die
Stadtmission trage das „Modell“ des Brückenbauers zur
Horizonterweiterung bei, erklärten Schad und Dembek bei einem
Gespräch mit Danial und Vertretern des Gemeinschaftsverbandes sowie
des Kirchenbezirks Ludwigshafen. Für die Landeskirche biete das
zunächst auf drei Jahre angelegte Projekt die Möglichkeit, das
interkulturelle Profil zu stärken. „Als Volkskirche verstehen wir
uns als Kirche für alle Christenmenschen, unabhängig von ihrer
Nationalität, Tradition oder Prägung“, sagte Dembek.
Kirchenpräsident Schad betonte, dass die Landeskirche nicht nur mit
guten Worten, sondern auch mit weiteren Flüchtlingsberatungsstellen
und der Qualifizierung Ehrenamtlicher zur Integration beitragen
wolle. Der Blick in die jüngere deutsche Geschichte zeige, dass die
bis zu 14 Millionen Vertriebenen nach 1945 und die rund 2,5
Millionen (Spät-) Aussiedler zu Beginn der 1990er Jahre „auch dank
der Aufnahme in unseren Kirchengemeinden hier ein neues Zuhause
gefunden haben.“
Zurzeit feiert die arabischsprechende Gemeinde zweimal im Monat
in Ludwigshafen ihre Gottesdienste. Die Hausbesuche führen Pastor
Danial von Ludwigshafen bis nach Kaiserslautern, von Göllheim bis
Kandel. Der vor 15 Jahren nach Deutschland gekommene ägyptische
Pastor sieht seine Aufgabe aber nicht nur in der seelsorgerlichen
Betreuung und gottesdienstlichen Begleitung seiner
Gemeindemitglieder. „Wir dürfen mit den pfälzischen
Kirchengemeinden nicht getrennt oder nebeneinander her leben, wir
müssen zusammenwachsen“, sagte der mit seiner Familie in Eisenberg
wohnende Danial, der von der Ludwigshafener Dekanin Barbara
Kohlstruck in den Pfarrkonvent eingeladen wurde. Pfarrer Tilo
Brach, Vorsitzender des Evangelischen Gemeinschaftverbandes Pfalz,
und Missionsinspektor Otto-Erich Juhler unterstrichen die Bedeutung
der direkten Begegnungen.
So hoffen alle Beteiligten, bis spätestens zum Projektende 2018
ein Gemeindefest und einen Gottesdienst feiern zu können, bei dem
arabisch- und deutschsprachige Gemeindeglieder zusammen singen und
beten, essen und trinken und zu dem Schluss kommen, dass
Vorbereitung und Durchführung selten so problemlos waren wie in
jenem Jahr. Text und Foto: lk
12.12.2015
„Tat verletzt alle, die sich für Integration einsetzen“
 Herxheim/Speyer- Kirchenpräsident Christian Schad
zum mutmaßlichen Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in
Herxheim und die im selben Gebäude verortete Kleiderkammer für
Asylbewerber
Herxheim/Speyer- Kirchenpräsident Christian Schad
zum mutmaßlichen Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in
Herxheim und die im selben Gebäude verortete Kleiderkammer für
Asylbewerber
„Die Nachricht vom mutmaßlichen Brandanschlag auf eine
Flüchtlingsunterkunft in Herxheim sowie die im selben Gebäude
verortete Kleiderkammer für Asylbewerber hat mich tief erschreckt.
Den bei den Löscharbeiten verletzten Angehörigen der Feuerwehr
gelten meine besten Genesungswünsche.
Diese Tat verletzt zugleich alle, die sich für eine
Willkommenskultur und die Integration von Flüchtlingen und
Asylsuchenden vor Ort und in unserem Land einsetzen. Gerade in
Herxheim engagieren sich inner- und außerhalb der Kirche viele
Menschen, die für die Rechte und Würde der Flüchtlinge und
Asylsuchenden eintreten. Hier und an zahlreichen anderen Orten
spüre ich in dieser Stunde die Entschlossenheit, sich umso mehr
dafür einzusetzen, dass Flüchtlinge und Asylsuchende bei uns würdig
empfangen und aufgenommen werden. Die in der Flüchtlingshilfe
Engagierten sind für mich Vorbilder in Sachen Humanität, die wir
gerade jetzt ganz besonders brauchen.
Deshalb habe ich mich dazu entschlossen, noch heute Abend die
Flüchtlingsunterkunft zu besuchen und damit mit denen solidarisch
zu sein, die unmittelbare Opfer des Brandanschlags sind, und mit
denen, die dem Hass gegenüber Fremden in unserem Land entschlossen
widerstehen. Uns bleibt, nach diesem Anschlag den oft mühsamen Weg
der Hilfe und des Dialogs konsequent weiterzugehen. Das Gebot zum
Schutz der Fremden im eigenen Land zieht sich durch die ganze Bibel
und ist für uns Christen die Richtschnur unseres Handelns: ‚Wenn
ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht
bedrücken. Er soll bei euch wohnen, wie ein Einheimischer unter
euch, und du sollst ihn lieben wie dich selbst‘ (3. Mose 19,33
f.).“ lk
10.12.2015
Bischof Wiesemann verurteilt Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte in Herxheim
 Zweites
Feuer innerhalb weniger Tage – Justiz ermittelt wegen versuchten
Mordes und schwerer Brandstiftung – BDKJ und Jugendkirche LUMEN
laden zu Friedengebet ein
Zweites
Feuer innerhalb weniger Tage – Justiz ermittelt wegen versuchten
Mordes und schwerer Brandstiftung – BDKJ und Jugendkirche LUMEN
laden zu Friedengebet ein
Speyer- Als „abscheuliche Tat“ verurteilt
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann die Brandanschläge auf zwei
Flüchtlingsunterkünfte in Herxheim. „Die Menschen, die vor dem
Krieg und dem Terror in ihren Heimatländern geflohen sind und bei
uns Schutz suchen, werden hier erneut Opfer von Vorurteilen und
Gewalt. Wer einen solch niederträchtigen Anschlag auf schutzlose
Menschen verübt, tritt die christlichen und die demokratischen
Grundwerte mit Füßen.“
Ende vergangener Woche hatten die Täter drei mit einer
unbekannten Flüssigkeit gefüllte Kanister über ein Oberlicht in das
Gebäude einer geplanten Flüchtlingsunterkunft geworfen. Die
Kanister waren in Flammen aufgegangen, Decke und Böden wurden
verschmort. In das Haus sollten bis zu 800 Asylsuchende
einziehen.
In der Nacht zum heutigen Donnerstag hat es erneut in einer
Einrichtung für Flüchtlinge gebrannt. Das Feuer ist in einer
Kleiderkammer im obersten Stock einer ehemaligen Gaststätte am
Herxheimer Waldstadion ausgebrochen. Im Stockwerk unterhalb der
Kleiderkammer wohnen neun Flüchtlinge in ehemaligen Fremdenzimmern.
Sie konnten sich in Sicherheit bringen und blieben glücklicherweise
unverletzt. Integrationsministerin Irene Alt sagte auf einer
Pressekonferenz, man müsse damit rechnen, dass der neue Brand einen
fremdenfeindlichen Hintergrund habe, auch wenn es noch keine
konkreten Hinweise darauf gebe. Die Staatsanwaltschaft hat
Ermittlungen wegen versuchten Mordes und schwerer Brandstiftung
aufgenommen.
Der Diözesanverband Speyer des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) und die Jugendkirche LUMEN laden aus aktuellem Anlass
für Freitag (11. Dezember) um 19 Uhr zu einem Friedensgebet die
Jugendkirche LUMEN in Ludwigshafen ein. Sie befindet sich in der
Unterkirche der Herz-Jesu-Kirche in der Mundenheimer Straße 216 und
ist vom Berliner Platz und S-Bahnhof Ludwigshafen-Mitte in nur fünf
Minuten Fußweg erreichbar. Das ursprünglich geplante Angebot
„eat.share.pray“ wurde aufgrund der Brandanschläge in Herxheim
durch ein Friedensgebet ersetzt. is
10.12.2015
24.000 Euro Bauhilfe für das Bistum Speyer
 Bonifatiuswerk beschließt Fördermittel für 2016
Bonifatiuswerk beschließt Fördermittel für 2016
Paderborn/Speyer- Das Bonifatiuswerk der
deutschen Katholiken fördert im Jahr 2016 Bau- und
Sanierungsmaßnahmen im Bistum Speyer mit 24.000 Euro. Das hat der
Generalvorstand des Diaspora-Hilfswerkes in Paderborn mitgeteilt.
Insgesamt fördert das Bonifatiuswerk im kommenden Jahr Projekte in
der deutschen, nordeuropäischen und baltischen Diaspora mit
insgesamt 14 Millionen Euro.
Im Bistum Speyer wird die Kirchenstiftung St. Josef in Bayerfeld
mit 24.000 Euro unterstützt. Bei der fast 250 Jahre alten
Pfarrkirche ist es dringend notwendig das Dach zu sanieren. Die
Dachfläche weist starke Verformungen auf, die Ziegel sind alt und
defekt, die Dichte der Dacheindeckung ist so an mehreren Stellen
nicht mehr gewährleistet.
„Wir möchten, dass der christliche Glaube in Deutschland eine
Zukunft hat. Daher unterstützen wir Katholiken dort, wo sie in
ihrem direkten Umfeld nur selten eine Glaubensgemeinschaft erleben.
Gerade in der Diaspora ist es schwierig, den Glauben an die
kommende Generation weiterzugeben“, sagte der Präsident des
Bonifatiuswerkes, Heinz Paus.
Die gesamten Fördermittel in Höhe von 14 Millionen Euro
verteilen sich auf die vier Hilfsarten des Bonifatiuswerkes: die
Bau-, die Verkehrs-, die Glaubens- sowie die Kinder- und
Jugendhilfe.
Im Bereich der Bauhilfe werden 58 Projekte mit insgesamt
3,43 Millionen Euro gefördert. Davon sind 350.000 Euro für
eilbedürftige Baumaßnahmen vorgesehen. In Deutschland werden 36
Bauprojekte mit 1,775 Millionen Euro, in Nordeuropa elf Bauprojekte
mit 750.000 Euro und in Estland und Lettland elf Bauprojekte mit
550.000 Euro gefördert.
Projekte der Kinder- und Jugendhilfe und der
Glaubenshilfe werden unterstützt mit 2,85 Millionen Euro. In
Deutschland fließen 1,69 Millionen Euro in die Kinder- und
Jugendhilfe, in Nordeuropa 270.000 Euro und in Estland und Lettland
60.000 Euro. Auf die Glaubenshilfe entfallen 680.000 Euro, 150.000
Euro werden den Diözesan-Bonifatiuswerken zur Verfügung gestellt.
Schwerpunktmäßig werden Tageseinrichtungen für Kinder in
Ostdeutschland, Religiöse Kinderwochen, Projekte in der Kinder- und
Jugendpastoral und Projektstellen gefördert.
Die Verkehrshilfe investiert 900.000 Euro in neue
BONI-Busse. Seit der Gründung der Verkehrshilfe 1949 wurden bereits
mehr als 3.400 Fahrzeuge gefördert, jährlich kommen 40 bis 45
BONI-Busse dazu.
Ähnlich wie im Vorjahr (2,1 Millionen Euro) werden 2016
missionarische Projekte und Initiativen zur Neuevangelisierung
sowie die religiöse Bildungsarbeit gefördert. Hierzu gehören u.a.
die Erstkommunionaktion, die Firminitiative und die Förderung
christlichen Brauchtums durch Kampagnen. Zudem leitet das
Bonifatiuswerk zweckgebundene Fördergelder des
Diaspora-Kommissariats in Höhe von 4,74 Millionen Euro für Projekte
in Nordeuropa weiter.
„Mit unserer Unterstützung als Hilfe zur Selbsthilfe möchten wir
eine Zukunft mitgestalten, in der unser Glaube und unsere Werte
erfahren und erlebt werden. Wir sind aufgefordert, auf aktuelle
Herausforderungen in der Pastoral zu reagieren, gerade in einer
Zeit, in der Millionen von Menschen aus Angst vor Krieg und Terror
ihre Heimat verlassen und Schutz suchen“, sagte der Generalsekretär
des Bonifatiuswerkes, Monsignore Georg Austen. Daher werden
verstärkt Personalstellen in Gemeinden der Diaspora unterstützt,
die eine gelebte Willkommenskultur fördern und die Integration vor
Ort erleichtern sollen.
Information zum Bonifatiuswerk
 Das
Bonifatiuswerk unterstützt Katholiken überall dort, wo sie als
Minderheit ihren Glauben leben und fördert Projekte in Deutschland,
Nordeuropa und dem Baltikum. Von der Deutschen Bischofskonferenz
mit der Förderung der Diaspora-Seelsorge beauftragt, sammelt das
Werk Spenden und stellt diese u.a. für den Bau von Kirchen und
Gemeindezentren, für die Kinder- und Jugendseelsorge und für
sozialkaritative Projekte als Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung.
Gefördert werden so die Weitergabe des Glaubens, Orte der Begegnung
und der Gemeinschaft sowie die pastorale Begleitung.
Das
Bonifatiuswerk unterstützt Katholiken überall dort, wo sie als
Minderheit ihren Glauben leben und fördert Projekte in Deutschland,
Nordeuropa und dem Baltikum. Von der Deutschen Bischofskonferenz
mit der Förderung der Diaspora-Seelsorge beauftragt, sammelt das
Werk Spenden und stellt diese u.a. für den Bau von Kirchen und
Gemeindezentren, für die Kinder- und Jugendseelsorge und für
sozialkaritative Projekte als Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung.
Gefördert werden so die Weitergabe des Glaubens, Orte der Begegnung
und der Gemeinschaft sowie die pastorale Begleitung.
Bildunterzeile: Der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes,
Monsignore Georg Austen, und Präsident Heinz Paus haben in
Paderborn mitgeteilt, dass das Bonifatiuswerk im kommenden Jahr
Projekte in der deutschen, nordeuropäischen und baltischen Diaspora
mit 14 Millionen Euro unterstützt. Text und Foto:
Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken
10.12.2015
Im Kampf gegen den Terror gibt es keinen ethischen Königsweg
 Plädoyer
des Kirchenpräsidenten für Gewaltfreiheit – „Flüchtlingskrise ist
ein Weckruf“
Plädoyer
des Kirchenpräsidenten für Gewaltfreiheit – „Flüchtlingskrise ist
ein Weckruf“
Speyer/Bad Dürkheim- Mit einem Plädoyer
für den „Vorrang des Zivilen, des Politischen und der
Gewaltfreiheit“ hat sich der pfälzische Kirchenpräsident Christian
Schad gegen militärische Aktionen im Syrien-Konflikt und im Kampf
gegen den so genannten „Islamischen Staat“ ausgesprochen.
Militäreinsätze würden keine Konflikte lösen. „Im Gegenteil. Sie
beschleunigen die Eskalation, potenzieren den Hass und verursachen
vor allem Opfer unter der Zivilbevölkerung“, sagte Schad mit Blick
auf den vom Bundestag beschlossenen Bundeswehr-Einsatz in
Syrien.
„Es geht um ein Kernthema des christlichen Glaubens“, sagte
Schad beim traditionellen „Pressetee“ der Evangelischen Kirche der
Pfalz am Dienstag in Bad Dürkheim. Der Terror stelle Politik,
Kirche und Gesellschaft vor Optionen „jenseits eines ethischen
Königsweges. Man kann hier eigentlich nicht nicht schuldig
werden“. Auf Kirche und Diakonie komme angesichts der durch Armut,
Klimawandel und Kriege ausgelösten „beispiellosen
Massenvertreibungen“ eine wichtige Rolle zu. In seiner Ansprache
vor rund dreißig Medienvertretern bezeichnete Kirchenpräsident
Schad die Flüchtlingskrise als epochale Herausforderung und
erteilte gleichzeitig einer Politik der „Abschottung ins
vermeintliche Schneckenhaus des Nationalstaates“ eine Absage. „Es
gibt Probleme, die machen vor Staatsgrenzen keinen Halt.“
Gerade im Hinblick auf das Schwerpunktthema 2016 der
Reformationsdekade, „Reformation – und die Eine Welt“, bekomme der
Begriff „Globalisierung“ eine besondere Bedeutung. „Die ‚Eine Welt‘
bringt es mit sich, dass Menschen sich auf den Weg machen, weil sie
in ihrem eigenen Land keine Zukunft mehr sehen. Das fordert uns
heraus.“ Die Flüchtlingskrise sei ein „Weckruf“, sagte Schad und
forderte zum gewaltfreien Kampf gegen die Hauptursachen für Flucht
und Vertreibung auf. Dazu zählen nach seinen Worten auch
Rüstungsexporte u.a. in Länder, die die Menschenrechte verletzten.
„Wir dürfen nicht aufhören, für solche Zusammenhänge ein
Bewusstsein zu schaffen.“
„Als Christen nehmen wir die Herausforderung an, unsere
zunehmend multiethnische, multireligiöse und multikulturelle
Gesellschaft mit zu gestalten. Unser ur-evangelisches Modell von
Einheit, von Gemeinschaft in versöhnter Verschiedenheit kann und
soll uns dabei leiten“, führte Kirchenpräsident Schad aus. Er
forderte eine solidarische Verteilung der Zuflucht Suchenden auf
viele Länder, in denen den Flüchtlingen ein würdiges Leben und die
Integration in die Gesellschaft ermöglicht werden solle.
Die Landeskirche sei bereit, nicht nur mit guten Worten, sondern
handfest Hilfe zu leisten, erklärte der Kirchenpräsident und
verwies auf das von der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz
verabschiedete Konzept zur Hilfe bei der Eingliederung von
Flüchtlingen und Migranten. Gleichzeitig schlössen Rechte immer
auch Pflichten ein. „Wer von unserer freiheitlichen Ordnung
Gebrauch machen will, muss sie bejahen“, sagte Schad in seiner
Ansprache beim „Pressetee“. Dieser bietet Kirchenleitung und
Journalisten Gelegenheit, gegen Ende des Jahres intensiv
miteinander ins Gespräch zu kommen. lk
09.12.2015
Nikolaus ist Schutzpatron der Binnenschiffer
 Eintreten wo Hilfe gebraucht wird
Eintreten wo Hilfe gebraucht wird
Assmannshausen- Die Verehrung des heiligen Nikolaus
hat in Assmannshausen lange Tradition und so hat auch in diesem
Jahr der örtliche St. Nikolaus Schifferverein wieder eine
Schiffsprozession zum Binger Riff ausgerichtet. In Höhe der
dortigen Nikolauskapelle bitten die Prozessionsteilnehmer den
Schutzpatron der Binnenschiffer um seinen Schutz und schließen die
Wasserbauer, Feuerwehrleute und Schutzpolizisten mit ein.
Der St. Nikolaus-Schiffertag beginnt mit einem festlichen
Gottesdienst am Morgen in der Pfarrkirche Hl. Kreuz Assmannshausen,
unter der Mitgestaltung des Gesangvereins Cäcilia. Als Zelebranten
konnte Friedrich Bauer vom Ortsausschuss Pfarrer Kurt Weigel, den
Bezirkspräses Mittelrhein, Pfarrer Hans Jörg und Diakon Waldemar
Eichholz begrüßen.
In seiner Predigt zitierte Pfarrer Weigel auch den erkrankten
Diakon Günter Johannes Barth von der Schifferseelsorge
Mannheim-Ludwigshafen. Nikolaus sei einer der meist verehrten
Heiligen der Ost- und Westkirche. Als Bischof von Myra begleiten
ihn zahlreiche Legenden und er sei als einer der 14 Nothelfer Trost
und Stärke für Menschen in Not, für Kinder und Schwache. Keines der
Kinder solle verloren gehen, so Nikolaus, sonst gehe die Welt
verloren. Wie Pfarrer Weigel betonte, haben die Menschen durch
Nikolaus wieder zu Menschenfreundlichkeit und Güte zurückgefunden.
Und der St. Nikolaus Schifferverein in Assmannshausen könne darauf
Stolz sein, einen solchen Schutzpatron zu haben.
 Bei der abschließenden Andacht an der St. Nikolauskapelle
in der Rheinuferstraße sagte der Weihbischof von Speyer, Otto
Georgens, vor einer großen Anzahl von Prozessionsteilnehmern, dass
der heilige Nikolaus gerade in unserer heutigen Zeit fälschlich als
Weihnachtsmann dargestellt werden. „Kein Weihnachtsmann taugt zum
Schutzpatron der Binnenschiffer“, so der Weihbischof, der auch
darüber sprach, dass der Bischof von Myra meist unerkannt große
Hilfe gegenüber den Armen geleistet habe. Und er zeige sich auch
noch heute als ein großer Helfer in der Not. Armut habe viele
Gesichter, auch in unserer Zeit. Für die Christen sei es daher
gerade in der Advents- und Weihnachtszeit angesagt, dort
einzutreten, wo Hilfe gebraucht wird.
Bei der abschließenden Andacht an der St. Nikolauskapelle
in der Rheinuferstraße sagte der Weihbischof von Speyer, Otto
Georgens, vor einer großen Anzahl von Prozessionsteilnehmern, dass
der heilige Nikolaus gerade in unserer heutigen Zeit fälschlich als
Weihnachtsmann dargestellt werden. „Kein Weihnachtsmann taugt zum
Schutzpatron der Binnenschiffer“, so der Weihbischof, der auch
darüber sprach, dass der Bischof von Myra meist unerkannt große
Hilfe gegenüber den Armen geleistet habe. Und er zeige sich auch
noch heute als ein großer Helfer in der Not. Armut habe viele
Gesichter, auch in unserer Zeit. Für die Christen sei es daher
gerade in der Advents- und Weihnachtszeit angesagt, dort
einzutreten, wo Hilfe gebraucht wird.
Die St. Nikolaus Schiffsprozession wurde von der Winzerkapelle
Rüdesheim musikalisch gestaltet. Beamten der Wasserschutzpolizei,
Feuerwehrleute des Binger Feuerlöschschiffes, Vertreter des
Wasserbaus und der Stadt Rüdesheim sowie Schiffervereine aus Bingen
und Kamp-Bornhofen befanden sich unter den Prozessionsteilnehmern,
die auf den Schiffen der Bingen-Rüdesheimer Personenschifffahrt und
des Charterliners van de Lücht zum Binger Riff fuhren. Text und
Foto: ASS Verlag
08.12.2015
Viel mehr als nur Gottesdienst
 Erhebung
zur Ministranten-Arbeit in der Diözese Speyer
Erhebung
zur Ministranten-Arbeit in der Diözese Speyer
Speyer- Im Bistum Speyer gibt es derzeit etwa
7.000 Messdienerinnen und Messdiener. Viele von ihnen treffen sich
nicht nur zum Gottesdienst, sondern sind darüber hinaus als
Jugendgruppen in der Pfarrei organisiert. Eine aktueller Erhebung
der Ministrantenreferate der südwestdeutschen Bistümer zeigt: Die
Zahlen gehen etwas zurück, das Engagement der Mädchen und Jungen
ist aber nach wie vor sehr groß.
Die Ministrantenarbeit hat sich verändert. Das machen die
Ergebnisse der Studie deutlich. Immer weniger
Ministrantengemeinschaften bieten regelmäßige, altersspezifische
Gruppenstunden an. Die Zahl sank auf knapp 20% der Pfarreien.
Dennoch blieb die Zahl der Mädchen und Jungen, die Altardienst tun
unter Berücksichtigung des demografischen Wandels stabil. Viele
Gruppen treffen sich regelmäßig (86,4%). Im Vordergrund stehen dann
Freizeiten, Bildungsveranstaltungen, soziale Aktionen oder Gebet
und Besinnung. Fast alle Ministrantengruppen (91%) gaben an, sich
im Rahmen der jährlichen Sternsingeraktion zu engagieren.
Die Gruppen werden oftmals durch hauptamtliche Leitungskräfte
organisiert (64%) . Hierzu zählen Pfarrer, Diakone und Pastoral-
oder Gemeindereferenten, aber auch Pfarrsekretärinnen und Küster.
In etwa einem Drittel der Fälle leiten Jugendliche oder Erwachsene
ehrenamtlich die Ministrantenarbeit in den Gemeinden.
An der von Mai bis September 2015 durchgeführten Umfrage nahmen
im Bistum Speyer 65 von 70 Pfarreiengemeinschaften teil. Die
Auswertung dient auch der zukünftigen Schwerpunktsetzung der
Abteilung Jugendseelsorge im Bereich der Ministranten-Seelsorge. So
wurde etwa deutlich, dass die Kooperation einzelnen
Ministrantengemeinschaften auf Dekanatsebene noch deutlich
verstärkt werden kann. Derzeit liegt sie bei etwas 11%. Im Zuge der
Umstrukturierung der Pfarreien wird ein tragfähiges
Kooperationsnetzwerk aber immer wichtiger werden. Ralf Feix,
Referent für Ministrantenpastoral, plant zur Stärkung der
Dekanatsebene in Kooperation mit den Jugendzentralen verstärkt
Ministrantentage. Ihm ist es auch ein wichtiges Anliegen, für die
Schulungsangebote vor Ort in den Pfarreien zu werben. Im direkten
Austausch mit den Messdienerinnen und Messdienern ist es Feix
besonders wichtig, Dank für den Dienst zum Ausdruck zu bringen:
"Ich habe großen Respekt vor jeder und jedem Einzelnen, der mit
Freude und Überzeugung seinen Dienst tut. Es ist einfach schön zu
erleben, dass Messdiener-Sein nicht allein auf den Dienst am Altar
beschränkt ist, sondern viele gemeinsame Aktionen darüber hinaus
stattfinden, so das Miteinander gestärkt wird und Freundschaften
entstehen. Das zu sehen erfüllt mich mit großer Dankbarkeit."
Alle Umfrageergebnisse finden sie grafisch aufbereitet auf
der Homepage der Abteilung Jugendseelsorge www.jugend-bistum-speyer.de.
Text: BDKJ Speyer; Foto: © Abteilung
Jugendseelsorge
08.12.2015
Caritasverband bekommt eine neue Zentrale
 Umzug in die Nikolaus-von-Weis-Straße für Anfang
2017 geplant
Umzug in die Nikolaus-von-Weis-Straße für Anfang
2017 geplant
Speyer- Der Caritasverband für die Diözese
Speyer bekommt eine neue Zentrale. Nach langer Suche steht nun
fest: Ein Neubau wird es werden, und zwar auf dem Gelände des
Institutes St. Dominikus in der Nikolaus-von-Weis-Straße.
Wie der Caritasverband mitteilt, baut die „Gewo Wohnen GmbH
Speyer“ das neue Haus und vermietet es an den Caritasverband. Dem
hat der Aufsichtsrat der Gewo bei seiner letzten Sitzung
zugestimmt.
Voraussichtlicher Baubeginn ist Anfang 2016. Der Umzug der rund
140 Mitarbeiter der Zentrale soll Ende 2016 erfolgen. „Für uns ist
das ein idealer Standort“, so der Vorsitzende des Caritasverbandes
für die Diözese Speyer, Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer, „er
eröffnet uns alle Möglichkeiten. Der Neubau wird komplett
barrierefrei sein und hat eine sehr gute Verkehrsanbindung.“
„Wir veräußern das Areal, da die Arbeit des Caritasverbandes dem
Grundauftrag unseres Ordens entspricht und auch dem Anliegen
unseres Gründers Bischof Nikolaus von Weis“, äußerte sich die
Generalpriorin des Instituts St. Dominikus, Schwester Gertrud Dahl,
über die Pläne.
Alfred Böhmer, der Geschäftsführer der Gewo, sagte zu dem neuen
Projekt: „Es freut uns, dass wir als Investor vom Caritasverband
angesprochen wurden.“
Für den Vorsitzenden des Caritasrates und früheren
Oberbürgermeister von Speyer, Werner Schineller, geht mit dieser
Entscheidung ein lange gehegter Wunsch in Erfüllung. „Es war mir
ein großes Anliegen, den Umzug des Caritasverbandes in ein
ausreichend großes, funktionales und nachhaltiges Gebäude auf den
Weg zu bringen“, so Schineller.
Nachdem der ursprüngliche Plan nicht verwirklicht werden konnte,
gemeinsam mit dem Priesterseminar in das Bistumshaus St. Ludwig zu
ziehen, geht mit der Entscheidung für den Neubau an der
Nikolaus-von-Weis-Straße für den Caritasverband eine lange Suche zu
Ende. Der aktuelle Standort in der Oberen Langgasse, der so
genannte „Seppelskasten“, ist für die 140 Mitarbeiter schon länger
zu klein, und es müsste dort sehr viel Geld in die Hand genommen
werden, um das Gebäude, das arg in die Jahre gekommen ist, von
Grund auf zu sanieren.
Die Nachbarschaft mit dem Caritas-Zentrum, der Beratungsstelle
in der Bahnhofstraße, endet schon Anfang 2016. Das Beratungszentrum
zieht um in die Ludwigstraße 13a.
Stichwort Caritas-Zentrale
In der Zentrale des Caritasverbandes für die Diözese Speyer
(DiCV) sitzt der Spitzenverband als Berater und Vertreter der
Interessen aller kirchlich-caritativen Träger der Diözese. Die
Referenten der so genannten „Abteilung Soziales“ verantworten die
politische Lobbyarbeit in den Bereichen Jugendhilfe,
Behindertenhilfe, Altenhilfe, Hospiz- und
Palliativberatungsdienste, Wohnungslosenhilfe, Suchthilfe,
Schwangerenberatung, Migration- und Integration, Schuldnerberatung
und soziale Sicherung und die Fachberatung der katholischen
Kindertagesstätten. Als Träger ist der DiCV verantwortlich für zwei
Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe und vier
Warenkorb-Sozialkaufhäuser sowie für die acht Caritaszentren für
die Dekanate im Bistum Speyer. Die 100prozentige Tochter des DiCV,
die CBS Caritas Betriebsträgergesellschaft Speyer, ist Träger von
15 Altenhilfe- und sieben Behindertenhilfe-Einrichtungen sowie
einer Einrichtung der Jugendhilfe.
In der Caritas-Zentrale in Speyer befindet sich außerdem das
Personal-Servicezentrum, das für nahezu 3000 Mitarbeiter des DiCV
und der CBS und anderer caritativer Träger zuständig ist.
Auch die Immobilien und Finanzen des Verbandes werden von Speyer
aus verwaltet und betreut. Text und Foto: Caritasverband der
Diözese Speyer
07.12.2015
Gebetskette erstreckte sich über das gesamte Kirchenjahr
 Bischof Wiesemann dankt allen Teilnehmern der Gebetskette,
die den Prozess „Gemeindepastoral 2015“ mit ihrem Gebet begleitet
haben – Fortsetzung der Gebetskette im Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit
Bischof Wiesemann dankt allen Teilnehmern der Gebetskette,
die den Prozess „Gemeindepastoral 2015“ mit ihrem Gebet begleitet
haben – Fortsetzung der Gebetskette im Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit
Speyer- Vom ersten Advent 2014 bis zum ersten
Advent 2015 haben Gruppen und Personen aus dem Bistum Speyer
durchgängig für die Anliegen des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“
gebetet. Die Gebetskette des Bistums erstreckte sich über alle Tage
des vergangenen Kirchenjahrs.
„Es ist beeindruckend zu sehen, dass das Anliegen einer
geistlichen, inhaltlichen und strukturellen Erneuerung des Bistums
an jedem einzelnen Tag vor Gott gebracht wurde“, bringt Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann seinen Dank an die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer der Gebetskette zum Ausdruck.
„Ganz unterschiedliche Menschen, Gruppen, Gebetskreise und
Pfarreien unseres Bistums haben sich im Gebet miteinander verbunden
und haben den Weg zur Neugründung der Pfarreien begleitet“, würdigt
er den Gebetseifer der Gläubigen. Er verbindet damit den Wunsch,
dass „der Heilige Geist uns auch weiterhin zu einer starken
Gemeinschaft verbindet und uns erfüllt, damit wir froh und mutig
als Christen den Herausforderungen unserer Zeit begegnen
können.“
Ein positives Resümee zieht auch Liturgie-Referent Clemens
Schirmer, der die Gebetskette organisiert hat. Im Online-Kalender
zur Gebetskette wurden über 500 Eintragungen vorgenommen. Die
Karmelitinnen aus Hauenstein haben täglich für den Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ gebet. Zehn Gruppen haben sich während des
gesamten Jahres einmal oder mehrmals in der Woche zum Gebet
getroffen. Clemens Schirmer weiß, dass viele die Gebetskette
zusätzlich unterstützt haben, ohne sich in den Online-Kalender auf
der Internetseite des Bistums einzutragen. Für den
Liturgie-Referenten hat die Gebetskette ein Stück weit sichtbar
gemacht, dass in vielen Pfarreien Gruppen und Gebetskreise
bestehen, die sich regelmäßig zum gemeinsamen Beten treffen.
Clemens Schirmer sieht darin ein positives Zeichen, dass die
Spiritualität als eine von vier leitenden Perspektiven im neuen
Seelsorgekonzept des Bistums eine tragfähige und weiter
ausbaufähige Grundlage in den Pfarreien und Gemeinden hat.
Das Bistum hat entschieden, die Gebetskette im Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit fortzusetzen. Es wird am dritten Adventssonntag mit
einem Pontifikalamt im Dom zu Speyer eröffnet.
04.12.2015
Verdienstorden des Landes für Kirchenpräsident i.R. Eberhard Cherdron
-01.jpg) Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Einsatz für Gemeinwohl
ist gelebte Solidarität
Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Einsatz für Gemeinwohl
ist gelebte Solidarität
spk. Speyer. Die rheinland-pfälzische
Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat jetzt im
Rahmen einer Feierstunde im Stresemannsaal der Mainzer
Staatskanzlei den früheren Kirchenpräsidenten
der Evangelischen Landeskirche der Pfalz, Eberhard
Cherdron, mit dem Landesverdienstorden ausgezeichnet. Wie
Dreyer bei dieser Gelegenheit hervorhob, habe sich Cherdron in all
seinen beruflichen Herausforderungen mit großem Engagement für den
Dialog zwischen den Kirchen und der Gesellschaft eingesetzt. Ein
wichtiger Schwerpunkt seiner Arbeit sei dabei der Aufbau und die
Pflege von Kontakten mit der evangelischen Jugendarbeit in der
früheren DDR gewesen, für die er vielfältige Begegnungen initiiert
habe. Im „Vereinigungsjahr“ 1990 habe Cherdron dann den Prozess der
Zusammenführung der kirchlichen Jugendarbeit in Ost und West mit
wertvollen Impulsen begleiten und zum Erfolg führen
können.-01.jpg)
„Eine Gesellschaft braucht engagierte Menschen wie Sie, die sich
für das Gemeinwohl einsetzen und etwas verändern wollen - Menschen,
die mitgestalten, bewegen und andere inspirieren können“, betonte
die Ministerpräsidentin in ihrer Laudatio auf den verdienten
Kirchenmann. Engagement sei ein unverzichtbarer Bestandteil jeder
bürgerschaftlichen Gemeinschaft. Demokratie lebe davon, dass es
immer wieder Menschen gebe, die ihre Zeit und Tatkraft einsetzten,
um sich einem gemeinnützigen „Herzensprojekt“ zu widmen. „Über
viele Jahre hinweg haben Sie so dieses Land und seine Zukunft
nachhaltig mitgestaltet und sind darüber zum Vorbild geworden.
Dafür gebührt Ihnen heute unser besonderer Dank“, so die
Ministerpräsidentin.
Der 1943 in Speyer als Sohn eines Pfarrers geborene Theologe
wuchs gemeinsam mit drei Geschwistern in Hochstadt/Pfalz und Kandel
auf und studierte nach dem Abitur von 1963 bis 1967 Theologie an
den Universitäten in Tübingen, Heidelberg, Göttingen und Mainz.
Sein anschließendes Vikariat und seine erste Pfarrstelle waren in
den saarpfälzischen Kirchengemeinden in Bexbach und Homburg/Saar.
Ab 1970 studierte Eberhard Cherdron in Mannheim zusätzlich zur
Theologie Volkswirtschaftslehre und schloss dieses Studium im Jahr
1974 als Diplom-Volkswirt ab.
-01.jpg) Von 1974 bis 1977 hatte Cherdron dann die Pfarrstelle in
Neuhofen/Pfalz inne, ehe er zum Landesjugendpfarrer der Pfälzischen
Landeskirche nach Kaiserslautern berufen wurde.
Von 1974 bis 1977 hatte Cherdron dann die Pfarrstelle in
Neuhofen/Pfalz inne, ehe er zum Landesjugendpfarrer der Pfälzischen
Landeskirche nach Kaiserslautern berufen wurde.
Ab 1984 leitete er dann das „Diakonische Werk der Pfalz“ in
Speyer, bis ihn die Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz
1989 zum Oberkirchenrat in Speyer wählte, wo er die Funktion des
Personaldezernenten übernahm. Neun Jahre später, im Jahr 1998,
wurde Cherdron dann von der Landessynode zum Kirchenpräsidenten der
Evangelischen Kirche der Pfalz gewählt und trat damit die Nachfolge
von Werner Schramm an, der damals aus Altersgründen in den
Ruhestand wechselte.
Nach Beendigung seiner ersten, zunächst siebenjährigen Amtszeit
wählte ihn die Landessynode 2005 mit 55 von 64 Stimmen erneut zum
Kirchenpräsidenten. Damit konnte er im September 2005 seine zweite
Amtsperiode antreten, die er bis zum 30. November 2008 ausfüllte,
als er im Alter von 65 Jahren in den Ruhestand wechselte. Zu seinem
Nachfolger wählte die Landessynode im Mai 2008 Cherdrons damaligen
Stellvertreter, Oberkirchenrat Christian Schad.
Heute lebt Eberhard Cherdron, der in seiner Freizeit Klavier,
Blockflöte und Gambe spielt und u.a. auch in der „Kantorei an der
Gedächtniskirche“ als Chorsänger mitwirkt, zusammen mit seiner Frau
Dorothea, mit der er vier Kinder hat, wieder in Speyer. Ein
profiliertes Pfarrerleben rundet sich also....
-01.jpg) Gemeinsam mit Eberhard Cherdron zeichnete die
Ministerpräsidentin übrigens an diesem Tag noch elf weitere
verdiente Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens mit dem Verdienstorden des Landes
Rheinland-Pfalz aus, die sich durch ganz unterschiedliche
Engagements verdient gemacht hätten - von der Förderung kultureller
und geschichtlicher Projekte über die Forschungsförderung und
soziale Hilfsprojekte bis hin zum Natur- und Umweltschutz. „All
dies spiegelt die Pluralität und den Reichtum des kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens wider, für die Rheinland-Pfalz steht.
Ihre Leistungen sind deshalb eine große Bereicherung für unser
Zusammenleben“, so die Ministerpräsidentin abschließend.
Gemeinsam mit Eberhard Cherdron zeichnete die
Ministerpräsidentin übrigens an diesem Tag noch elf weitere
verdiente Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens mit dem Verdienstorden des Landes
Rheinland-Pfalz aus, die sich durch ganz unterschiedliche
Engagements verdient gemacht hätten - von der Förderung kultureller
und geschichtlicher Projekte über die Forschungsförderung und
soziale Hilfsprojekte bis hin zum Natur- und Umweltschutz. „All
dies spiegelt die Pluralität und den Reichtum des kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens wider, für die Rheinland-Pfalz steht.
Ihre Leistungen sind deshalb eine große Bereicherung für unser
Zusammenleben“, so die Ministerpräsidentin abschließend.
Wie die Staatskanzlei weiter mitteilte, engagieren sich derzeit
in Rheinland-Pfalz mehr als 1,5 Millionen Bürgerinnen und Bürger ab
einem Alter von 14 Jahren im Ehrenamt. Das seien 42 Prozent aller
Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer - so viele, wie in
fast keinem anderen Bundesland. „Ich bin deshalb stolz darauf, in
einem Land zu leben, in dem die Menschen zusammenhalten“, so die
Malu Dreyer. Die Förderung des Ehrenamtes sei deshalb auch eines
der vorrangigen Politikfelder der Landesregierung.
-01.jpg) Was ehrenamtliches Engagement zu erreichen vermöge, habe
sich gerade erst wieder in diesem Jahr gezeigt, in dem das Land den
größten Zuzug von Flüchtlingen seit dem Zweiten Weltkrieg erlebe.
„Hier leisten die zum großen Teil ehrenamtlich tätigen Helfer und
Helferinnen Herausragendes für unsere Gesellschaft und für
diejenigen Menschen, die aus Not zu uns geflüchtet sind“, betonte
die Ministerpräsidentin anerkennend.
Was ehrenamtliches Engagement zu erreichen vermöge, habe
sich gerade erst wieder in diesem Jahr gezeigt, in dem das Land den
größten Zuzug von Flüchtlingen seit dem Zweiten Weltkrieg erlebe.
„Hier leisten die zum großen Teil ehrenamtlich tätigen Helfer und
Helferinnen Herausragendes für unsere Gesellschaft und für
diejenigen Menschen, die aus Not zu uns geflüchtet sind“, betonte
die Ministerpräsidentin anerkennend.
Der Landesverdienstorden wurde in diesem Jahr bereits zum 34.
Mal verliehen. Er wird seit 1982 vergeben und ist die höchste
rheinland-pfälzische Auszeichnung, mit der herausragende Verdienste
um das Land Rheinland-Pfalz und seine Bürgerinnen und Bürger
gewürdigt werden. Seit 1982 wurde er 1.086 Mal verliehen. Foto:
stk-rlp
03.12.2015
Vorlesespaß in der Prot. Kita Arche Noah in Speyer
 Speyer-
Der bundesweite Vorlesetag am 20. November war für die Prot. Kita
Arche Noah in Speyer Anlass, in der Kita-eigenen Bücherei drei Tage
lang fast rund um die Uhr vorzulesen.
Speyer-
Der bundesweite Vorlesetag am 20. November war für die Prot. Kita
Arche Noah in Speyer Anlass, in der Kita-eigenen Bücherei drei Tage
lang fast rund um die Uhr vorzulesen.
In gemütlicher Atmosphäre lasen Eltern und Erzieherinnen den
Kindern Bilderbücher und Geschichten zum Thema „Alle Kinder dieser
Welt“ vor. Die Buchauswahl stellte der Spei’rer Buchladen zur
Verfügung. So konnten die Kinder andere Kulturen und Feste
kennenlernen.
Die Bücherei der Prot. Kita Arche Noah wird in den wöchentlichen
Ausleihzeiten von Eltern betreut. Im Alltag ist sie für die Kinder
und Erzieherinnen eine Bereicherung. Dank des großen Engagements
der Eltern z.B. beim weihnachtlichen Plätzchenverkauf können
kontinuierlich neue Bücher angeschafft werden.
Text und Foto: Protestantische Kindertagesstätte Arche
Noah
02.12.2015
Rund 500 Teilnehmer bei Klimapilgerweg durch die Pfalz unterwegs
 Gemeinsames Eintreten der Weltreligionen entfacht Dynamik
im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Paris –
Weltkirchen-Referent Christoph Fuhrbach bei
Abschlussveranstaltungen der verschiedenen internationalen
Klima-Pilgerwege in Paris
Gemeinsames Eintreten der Weltreligionen entfacht Dynamik
im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Paris –
Weltkirchen-Referent Christoph Fuhrbach bei
Abschlussveranstaltungen der verschiedenen internationalen
Klima-Pilgerwege in Paris
Speyer- Mit einem starken Zeichen haben
Vertreter/innen der Weltreligionen kurz vor dem Start der 21.
Weltklimakonferenz in Paris (COP 21) den Druck auf die politisch
Handelnden erhöht: sie übergaben 1.780.528
Unterschriften für ein verbindliches Klimaschutzabkommen
an Christiana Figueres, der Leiterin des UN-Klimasekretariats.
Als Vertreter des ökumenischen Klima-Pilgerweg-Abschnitts
“Ludwigshafen – Metz” und des gesamten deutsch-französischen
Klima-Pilgerweges „Geht doch!“ von Flensburg über 1470km nach Paris
nahm Christoph Fuhrbach vom Referat Weltkirche des Bistums Speyer
an den Abschlussveranstaltungen der verschiedenen internationalen
Klima-Pilgerwege in Paris teil. „Frau Figueres zeigte sich
emotional gerührt, weil alle Weltreligionen erstmals in dieser
existentiellen Frage einheitliche und zudem klare sowie
verbindliche Forderungen an die Politik erhoben“, berichtet
Fuhrbach. Figueres bezeichnete den Klimawandel als die „zentrale
Herausforderung dieser Generation“, die nun entschieden angegangen
werden müsse.
 Die Attentate in Paris vor zwei Wochen hatten
Auswirkungen auf den Abschluss der internationalen Klima-Pilgerwege
vor dem Start der COP 21 in Paris: Einige Veranstaltungen wie eine
große Demonstration für ein verbindliches Klimaschutzabkommen
wurden aufgrund der angespannten Sicherheitslage in Paris abgesagt.
Viele weitere Events mussten verlegt oder verkürzt und einige
Sicherheitskontrollen eingehalten werden. Banner und Fahnen durften
aufgrund des Demonstrationsverbots nicht ausgerollt werden, Gesang
war nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Zudem hatten sich etliche
Pilgernde in den vergangenen zwei Wochen für das Finale in Paris
abgemeldet. Gleichzeitig freuten sich die Menschen in Paris, dass
dennoch so viele Klima-Pilgernde in ihre Stadt kamen, was sie auch
als Solidaritätsbekundung in ihrer aktuell nicht einfachen
Situation deuteten.
Die Attentate in Paris vor zwei Wochen hatten
Auswirkungen auf den Abschluss der internationalen Klima-Pilgerwege
vor dem Start der COP 21 in Paris: Einige Veranstaltungen wie eine
große Demonstration für ein verbindliches Klimaschutzabkommen
wurden aufgrund der angespannten Sicherheitslage in Paris abgesagt.
Viele weitere Events mussten verlegt oder verkürzt und einige
Sicherheitskontrollen eingehalten werden. Banner und Fahnen durften
aufgrund des Demonstrationsverbots nicht ausgerollt werden, Gesang
war nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Zudem hatten sich etliche
Pilgernde in den vergangenen zwei Wochen für das Finale in Paris
abgemeldet. Gleichzeitig freuten sich die Menschen in Paris, dass
dennoch so viele Klima-Pilgernde in ihre Stadt kamen, was sie auch
als Solidaritätsbekundung in ihrer aktuell nicht einfachen
Situation deuteten.
Die verschiedenen internationalen Klimapilgerwege aus Norwegen,
Schweden, Dänemark, Deutschland, Schottland, England, Niederlande,
Ukraine, Ungarn, Österreich und Italien sowie aus den Philippinen
und von Ostafrika kamen alle am Freitag in Paris an. Selbst in
vielen Metro-Stationen wurde auf die Ankunft der Klimapilgernden
mit Plakaten hingewiesen. Aufgrund dieses Anlasses gab es diverse
Empfänge, Gebetszeiten und thematische Veranstaltungen in der
ganzen Stadt.
 Aus dem Veranstaltungsreigen ragte ein interreligiöses
Gebet in der Kathedrale von St. Denis mit muslimischen, jüdischen,
buddhistischen und christlichen Gläubigen heraus. Direkt im
Anschluss gab es ein Treffen von Vertreter/innen aller
Klimapilgerwege und der Weltreligionen mit bei der COP 21
zentralen Persönlichkeiten: Pilger/innen berichteten mit Hilfe von
mitgebrachten Symbolen über ihre im Laufe der Pilgerwege gemachten
Erfahrungen und Einsichten. Religiöse Würdenträger/innen stellten
klare Forderungen an die bei der Weltklimakonferenz politisch
Handelnden. Dabei wurde klar, dass es hier keine religiösen Grenzen
gibt, sondern dass – zum ersten Mal - alle großen Weltreligionen
sich einig sind, dass der Klimawandel und ein an Klimagerechtigkeit
ausgerichtetes Handeln eine der wesentlichen Herausforderungen der
gesamten Menschheit im 21. Jahrhundert sein wird. Erzbischof Thabo
Makgoba rief daher alle Gläubigen und alle politisch Handelnden
auf: „Wir können, wir müssen, wir werden handeln“, um den
Klimawandel zu begrenzen und Klimagerechtigkeit zu schaffen.
Aus dem Veranstaltungsreigen ragte ein interreligiöses
Gebet in der Kathedrale von St. Denis mit muslimischen, jüdischen,
buddhistischen und christlichen Gläubigen heraus. Direkt im
Anschluss gab es ein Treffen von Vertreter/innen aller
Klimapilgerwege und der Weltreligionen mit bei der COP 21
zentralen Persönlichkeiten: Pilger/innen berichteten mit Hilfe von
mitgebrachten Symbolen über ihre im Laufe der Pilgerwege gemachten
Erfahrungen und Einsichten. Religiöse Würdenträger/innen stellten
klare Forderungen an die bei der Weltklimakonferenz politisch
Handelnden. Dabei wurde klar, dass es hier keine religiösen Grenzen
gibt, sondern dass – zum ersten Mal - alle großen Weltreligionen
sich einig sind, dass der Klimawandel und ein an Klimagerechtigkeit
ausgerichtetes Handeln eine der wesentlichen Herausforderungen der
gesamten Menschheit im 21. Jahrhundert sein wird. Erzbischof Thabo
Makgoba rief daher alle Gläubigen und alle politisch Handelnden
auf: „Wir können, wir müssen, wir werden handeln“, um den
Klimawandel zu begrenzen und Klimagerechtigkeit zu schaffen.
 Viele weitere religiöse Würdenträger/innen wie z.B. der
EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, seine Stellvertreterin
Annette Kurschus (Präses der Evangelischen Landeskirche von
Westfalen), Erzbischof Ludwig Schick (Erzbistum Bamberg.
Vorsitzender der Kommission Weltkirche bei der Deutschen
Bischofskonferenz) und Bischof Bernabe Sagastume (Guatemala) als
„Stimme der Menschen im globalen Süden“, waren vor Ort in Paris. Er
hat in den vergangenen Tagen auch im Bistum Speyer sowohl über
seinen Einsatz gegen große Bergbauprojekte mit massiven negativen
Auswirkungen auf Mensch und Natur, über die Auswirkungen des
Klimawandels in Mittelamerika als auch über seine Hoffnungen auf
ein verbindliches Klimaschutzabkommen in Paris berichtet.
Viele weitere religiöse Würdenträger/innen wie z.B. der
EKD-Ratsvorsitzende Heinrich Bedford-Strohm, seine Stellvertreterin
Annette Kurschus (Präses der Evangelischen Landeskirche von
Westfalen), Erzbischof Ludwig Schick (Erzbistum Bamberg.
Vorsitzender der Kommission Weltkirche bei der Deutschen
Bischofskonferenz) und Bischof Bernabe Sagastume (Guatemala) als
„Stimme der Menschen im globalen Süden“, waren vor Ort in Paris. Er
hat in den vergangenen Tagen auch im Bistum Speyer sowohl über
seinen Einsatz gegen große Bergbauprojekte mit massiven negativen
Auswirkungen auf Mensch und Natur, über die Auswirkungen des
Klimawandels in Mittelamerika als auch über seine Hoffnungen auf
ein verbindliches Klimaschutzabkommen in Paris berichtet.
Etliche Zehntausende Klima-Pilgernde waren auf dem Weg nach
Paris unterwegs, allein zwischen Ludwigshafen und Metz waren es gut
500. Zusätzlich wurden viele weitere Menschen auf dem
Klima-Pilgerweg durch die Pfalz und das Saarland mit öffentlichen
Veranstaltungen in Kirchen, Gemeindehäusern, Fußgängerzonen
erreicht. Die Evangelische Landeskirche der Pfalz als auch das
Bistum Speyer haben damit einen Beitrag geleistet, dass der Druck
auf die Politisch Handelnden, bei der COP 21 ein verbindliches
Klimaschutzabkommen zu erreichen, erhöht wurde. Text: is; Foto:
Evangelische Kirche von Westfalen
01.12.2015
Segnung und Aussendung für den Dienst in den neuen Pfarreien
 Delegationen aus den Pfarreien bekamen beim Pontifikalamt
im Speyerer Dom am 28. November die Errichtungsurkunden der neuen
Pfarreien und das künftige Pfarrsiegel überreicht
Delegationen aus den Pfarreien bekamen beim Pontifikalamt
im Speyerer Dom am 28. November die Errichtungsurkunden der neuen
Pfarreien und das künftige Pfarrsiegel überreicht
Speyer- Dieser Tag geht in die Geschichte
des Bistums Speyer ein: Zu einem Segnungs- und Sendungsgottesdienst
kamen am Samstag, den 28. November, Delegationen aus allen
Pfarreien des Bistums Speyer zusammen. Beim Pontifikalamt im Speyer
Dom wurde das Bistum als eine große Gemeinschaft aus allen Teilen
der Pfalz und des Saarpfalzkreises erfahrbar, als eine Gemeinschaft
von Gläubigen, die mit „Herzblut, Leidenschaft und großer Liebe zu
ihrer Kirche stehen“, wie Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in
seiner Begrüßung der rund 1.200 Gottesdienstteilnehmer betonte.
 In seiner Predigt wandte sich der Bischof dem Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ unter dem Leitwort „Der Geist ist es, der
lebendig macht“ zu. „Es geht dabei nicht zuerst um eine Veränderung
der Strukturen, sondern um eine geistliche Erneuerung, mit der wir
auf die Herausforderungen der Zeit Antwort geben“, so der Bischof.
Das Leitwort sei ein Appell, „nicht das Tote zu hüten, sondern das
Lebendige zu fördern“. Im Blick auf die Bedrohung durch den Terror
rief er die Gläubigen dazu auf, mit Mut für die christlichen Werte
und die Würde des Menschen einzutreten. Zugleich warb er für eine
offene und solidarische Haltung gegenüber den Menschen, die auf der
Flucht vor Krieg und Terror in Europa Schutz suchen. „Es ist das
Kennzeichen, gleichsam die Signatur des Christlichen, dass wir uns
dem Notleidenden öffnen und ihm Anteil an unserem Leben geben, als
wäre es Christus selbst.“
In seiner Predigt wandte sich der Bischof dem Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ unter dem Leitwort „Der Geist ist es, der
lebendig macht“ zu. „Es geht dabei nicht zuerst um eine Veränderung
der Strukturen, sondern um eine geistliche Erneuerung, mit der wir
auf die Herausforderungen der Zeit Antwort geben“, so der Bischof.
Das Leitwort sei ein Appell, „nicht das Tote zu hüten, sondern das
Lebendige zu fördern“. Im Blick auf die Bedrohung durch den Terror
rief er die Gläubigen dazu auf, mit Mut für die christlichen Werte
und die Würde des Menschen einzutreten. Zugleich warb er für eine
offene und solidarische Haltung gegenüber den Menschen, die auf der
Flucht vor Krieg und Terror in Europa Schutz suchen. „Es ist das
Kennzeichen, gleichsam die Signatur des Christlichen, dass wir uns
dem Notleidenden öffnen und ihm Anteil an unserem Leben geben, als
wäre es Christus selbst.“
Die Kirche sei heute vor die Aufgabe gestellt, das Dienen neu zu
lernen. Nur im Dienst und in der Hingabe zeige sich die Kraft des
Glaubens. Die erste Frage bei der Erstellung eines pastoralen
Konzepts in den neuen Pfarreien dürfe nicht lauten „Welchen
Besitzstand wollen wir wahren?“, sondern „Wem wollen wir dienen?“
Der Bischof ermutigte zu einem Wechsel vom Versorgungsdenken zur
Eigeninitiative. Der Blick der Seelsorge müsse darauf gerichtet
sein, wo die Charismen und Begabungen wachsen - und das „über die
Grenzen der Kirche hinaus im ökumenischen Schulterschluss und im
Schulterschluss mit all denen in der Gesellschaft, die sich
ebenfalls von der Not der Menschen anrühren lassen“. Notwendig sei
ein Umdenken von der Institution zur Jüngerschaft. „Fragen wir uns
vor allem: Wo wächst das Reich Gottes? Denn Kirche ist nicht um
ihrer selbst willen eingesetzt, sondern als Hinweis auf das Reich
Gottes“, hob Bischof Wiesemann hervor und zeigte sich davon
überzeugt, dass der Funke Jesu niemals klein zu kriegen sei. „Im
Gegenteil, seine Kraft ist größer als alles, was wir planen
können.“
 Die leitenden Pfarrer, die gemeinsam mit dem Bischof, den
Mitgliedern des Domkapitels und den Dekanen um den Hochaltar
versammelt waren, sprachen das Glaubensbekenntnis und legten ihren
Amtseid als Pfarrer der neuen Pfarreien ab. Darin versprachen sie
unter anderem, die Gemeinschaft mit der Kirche zu bewahren und den
Bischöfen in Treue zur Seite zu stehen. Nach dem Schlussgebet
wurden die Delegationen aus den Pfarreien von Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann, Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar
Dr. Franz Jung für ihren Dienst in den neuen Pfarreien gesegnet und
ausgesandt. Den Delegationen aus den Pfarreien gehörten die
hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger und die Vertreter der
neu gewählten Pfarrgremien an. Sie erhielten zugleich die
Errichtungsurkunde der neuen Pfarrei und das neue Pfarrsiegel.
Die leitenden Pfarrer, die gemeinsam mit dem Bischof, den
Mitgliedern des Domkapitels und den Dekanen um den Hochaltar
versammelt waren, sprachen das Glaubensbekenntnis und legten ihren
Amtseid als Pfarrer der neuen Pfarreien ab. Darin versprachen sie
unter anderem, die Gemeinschaft mit der Kirche zu bewahren und den
Bischöfen in Treue zur Seite zu stehen. Nach dem Schlussgebet
wurden die Delegationen aus den Pfarreien von Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann, Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar
Dr. Franz Jung für ihren Dienst in den neuen Pfarreien gesegnet und
ausgesandt. Den Delegationen aus den Pfarreien gehörten die
hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger und die Vertreter der
neu gewählten Pfarrgremien an. Sie erhielten zugleich die
Errichtungsurkunde der neuen Pfarrei und das neue Pfarrsiegel.
Dem Gottesdienst wohnten mehrere Ehrengäste bei, darunter der
emeritierte Speyerer Bischof Dr. Anton Schlembach, die
rheinland-pfälzische Kultusministerin Vera Reiß sowie die Leiter
der katholischen Büros von Rheinland-Pfalz und des Saarlandes
Dieter Skala und Prälat Dr. Peter Prassel. Der evangelische
Kirchenpräsident Christian Schad musste krankheitsbedingt
absagen.
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes hatten der
Mädchenchor der Dommusik und die Sängerinnen des Domchors unter
Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori übernommen.
Aufgeführt werden die „Messe brève“ von Leo Delibes und John
Rutters „The peace of God“. Die Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub. Im Anschluss an den Gottesdienst trafen sich die
Delegationen in der Event-Halle des Speyerer Technik-Museums zu
Gesprächen, Begegnung und zur Stärkung mit einem Mittagessen.
Text: is; Foto: Klaus Landry
29.11.2015
Weltweite Verschwendung von Lebensmitteln stoppen
 Pfalzweite
Eröffnung von „Brot für die Welt“ – Kirchenpräsident prangert
Ungerechtigkeiten an
Pfalzweite
Eröffnung von „Brot für die Welt“ – Kirchenpräsident prangert
Ungerechtigkeiten an
Speyer/Kirchheimbolanden- Zum Auftakt der
Spendenaktion „Brot für die Welt“ für die Pfalz und Saarpfalz
appellierten der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad und
Wolfgang Seibel von der Arbeitsgemeinschaft Südwestdeutscher
Mennonitengemeinden an die Christen, das eigene Konsumverhalten zu
überdenken. „Viel zu viel wird produziert für den vermeintlichen
Bedarf in den Industrienationen. Und dabei werden weltweit mehr
Lebensmittel verschwendet, als nötig wären, alle Hungernden dieser
Erde zu ernähren, sagte Schad im Gottesdienst am ersten Advent in
der Peterskirche in Kirchheimbolanden. Die 57. evangelische
Spendenaktion hat das Motto „Satt ist nicht genug! Zukunft braucht
gesunde Ernährung“.
Kirchenpräsident Schad bezeichnete es in seiner Predigt als
„schreiende Ungerechtigkeit“, dass die einen „ein leichtes Leben
voller Annehmlichkeiten führen“, während in anderen Weltgegenden
die Menschen ausgeschlossen seien von Bildung und Brot, vom Zugang
zu Land und zu sauberem Wasser. „Wer die Welt in Ehrfurcht bewahrt,
wer sie allen Menschen zugute kommen lässt, erkennt: Wir leben in
der einen Schöpfung Gottes“, sagte Schad in dem von der
Landeskirche und den südwestdeutschen Mennonitengemeinden gemeinsam
gestalteten Gottesdienst.
Die Spendenaktion stellt in diesem Jahr das Thema
Mangelernährung und deren Folgen in den Mittelpunkt. Brot für die
Welt unterstützt Partnerorganisationen, die die Bevölkerung über
die Bedeutung einer vielfältigen, gesunden und bezahlbaren
Ernährung aufklären. Die Spenden aus der Pfalz und der Saarpfalz
kommen dabei zwei Projekten in Indien und in dem afrikanischen Land
Burkina Faso zugute. Kirchenpräsident Schad betonte, dass die
Brot-für-die Welt-Projekte eine der Ursachen für weltweite
Fluchtbewegungen – nämlich den Klimawandel und seine Folgen – in
den Blick nehme und Menschen dabei helfe, ihren Lebensraum zu
erhalten und ein Leben in Würde zu führen. So würden Kleinbauern in
Burkina Faso beispielsweise dabei unterstützt, Brunnen und
Regenwassertanks zu bauen, damit das in der Sahelzone gelegene Land
auch in der Dürreperiode genügend sauberes Wasser zur Verfügung
hat.
Das Motto „Satt ist nicht genug“ wurde im Gottesdienst nicht nur
durch das Wort thematisiert, sondern auch visuell und tänzerisch
umgesetzt, um den Besuchern möglichst viele Zugänge zu bieten. So
machten etwa kleine Säckchen, die die Evangelische Jugend mit Reis
und Getreidekörnern gefüllt hatte, deutlich, mit wie wenig Nahrung
ein Mensch in den armen Regionen unserer Erde täglich auskommen
muss. Die Säckchen trugen die Aufschrift „Weniger ist leer“. An dem
erstmals von den südwestdeutschen Mennonitengemeinden
mitgestalteten Gottesdienst zur Eröffnung von Brot für die Welt
wirkten u.a. auch Dekan Stefan Dominke, Asylbewerber und der
syrische Künstler Nadal Alawar mit. Die musikalische Leitung hatte
Bezirkskantor Martin Reitzig. dwp/lk.
Hintergrund: Im vergangenen Jahr haben die Menschen in
der Pfalz und der Saarpfalz 1.037.445 Euro für Brot für die Welt
gespendet. Das weltweit tätige Hilfswerk der evangelischen Landes-
und Freikirchen in Deutschland wurde 1959 gegründet. Wirkliche
Hilfe muss dem Armen helfen, sich selbst zu helfen, lautete ein
entscheidender Grundsatz, der bis heute gilt.
29.11.2015
Aus der spirituellen Begegnung mit Papst Johannes Paul II. Kraft schöpfen
 Gedanken von Gerhard Cantzler
Gedanken von Gerhard Cantzler
Speyer- Wer damals, am 4. Mai 1987, persönlich
mit dabei war auf der Speyerer Maximilianstraße oder auf den
Domplätzen, als der bei Alt und Jung so sehr geliebte Papst
Johannes Paul II. der Stadt und dem Bistum die Ehre gab, für den
hat sich dieser so gar nicht frühlingshafte, nasskalte Tag tief in
das Gedächtnis eingegraben. Denn wer sich heute noch bewusst an
dieses Ereignis erinnern kann, das damals für einige wenige Stunden
die Domstadt Speyer schlaglichtartig in den Blickpunkt des
Weltgeschehens rückte, der muss inzwischen bereits mehr als 40
Jahre alt sein.
Von daher war wohl auch die Frage von Gesprächsleiterin
Rebecca Blum an ihre beiden Gäste, Bischof emerit.
Dr. Anton Schlembach und Oberbürgermeister a.D.
Werner Schineller an diesem denkwürdigen Abend nur zu
verständlich, ob sie sich denn heute eine stärkere Verankerung
dieses Ereignisses im Bewußtsein der Menschen in Speyer und in der
Diözese wünschen würden.
Denn erinnern wir uns: An diesem 4. Mai 1987 war die Welt noch
strikt in Ost und West aufgeteilt - stand in Berlin noch eine
schier undurchdringliche Mauer - waren die ersten Anzeichen eines
Ausgleichs zwischen den monolithisch aufgestellten, politischen
Systemen nur andeutungsweise zu erkennen.
 Einer, der damals durch sein Wort und sein Gebet
maßgeblich dazu beigetragen hat, dass schon wenige Monate nach
diesem Besuch in der Pfalz die Mauer in Berlin fallen, die Grenzen
zwischen Ost und West ihren Wert verlieren und die Menschen auf
beiden Seiten des so überflüssig gewordenen „Eisernen Vorhangs“
glückselig ihre Wiedervereinigung feiern konnten, war er: Papst
Johannes Paul II., der unter anderem mit seiner Unterstützung der
christlich geprägten Gewerkschaft „Solidarnosc“ in seiner
polnischen Heimat den ersten Stein aus der bis dahin
undurchdringlichen Mauer zwischen Ost und West brach und mit seinem
Ruf „Habt keine Angst!“ alle Menschen guten Willens in der Welt
dazu ermutigen wollte, diesen Weg in eine bessere Zukunft mit ihm
gemeinsam zu gehen.
Einer, der damals durch sein Wort und sein Gebet
maßgeblich dazu beigetragen hat, dass schon wenige Monate nach
diesem Besuch in der Pfalz die Mauer in Berlin fallen, die Grenzen
zwischen Ost und West ihren Wert verlieren und die Menschen auf
beiden Seiten des so überflüssig gewordenen „Eisernen Vorhangs“
glückselig ihre Wiedervereinigung feiern konnten, war er: Papst
Johannes Paul II., der unter anderem mit seiner Unterstützung der
christlich geprägten Gewerkschaft „Solidarnosc“ in seiner
polnischen Heimat den ersten Stein aus der bis dahin
undurchdringlichen Mauer zwischen Ost und West brach und mit seinem
Ruf „Habt keine Angst!“ alle Menschen guten Willens in der Welt
dazu ermutigen wollte, diesen Weg in eine bessere Zukunft mit ihm
gemeinsam zu gehen.
Doch haben sich diese politischen Hoffnungen des inzwischen zu
Recht heilig gesprochenen Papstes erfüllt?
Seit 1987 haben sich Art und Umfang des Terrors in der Welt mit
geradezu besorgniserregender Geschwindigkeit weiter gesteigert.
Denken wir nur an den 11. September 2001, als erstmals eine neue
Eskalationsstufe der Gewalt überschritten und ein seit Anbeginn der
Welt gültiges Tabu gebrochen wurde, indem drei mit unschuldigen
Menschen vollbesetzte Flugzeuge in die „Twin-Towers“ von New York
und in das amerikanische Verteidigungsministerium bei Washington
gestürzt wurden. Und denken wir im weiteren an die in kurzer Folge
durchgeführten, brutalen Anschläge von Paris, die die Welt mit
neuen Formen des Schreckens überzogen. Dazwischen gab es unzählige
Kriege und Gewalttaten in der Welt und in ihrer Folge immer größere
Wellen von -zig Millionen Flüchtlingen.
Ein vermeintlich undurchbrechbarer Teufelskreis scheint sich in
Gang gesetzt zu haben und sich immer schneller zu drehen.
 Als Johannes Paul II. 1987 in Deutschlandund in Speyer
weilte, da galt sein Besuch in erster Linie der von ihm so
hochverehrten, zwischenzeitlich gleichfalls heilig gesprochenen
jüdisch-deutschen Wissenschaftlerin und Karmelitin Edith Stein, die
im Bistum Speyer vom Judentum zum Katholizismus konvertiert war und
deren Seligsprechung Papst Johannes Paul II. 1987 bei seinem
Aufenthalt in Köln vornahm.
Als Johannes Paul II. 1987 in Deutschlandund in Speyer
weilte, da galt sein Besuch in erster Linie der von ihm so
hochverehrten, zwischenzeitlich gleichfalls heilig gesprochenen
jüdisch-deutschen Wissenschaftlerin und Karmelitin Edith Stein, die
im Bistum Speyer vom Judentum zum Katholizismus konvertiert war und
deren Seligsprechung Papst Johannes Paul II. 1987 bei seinem
Aufenthalt in Köln vornahm.
Diese Heilige – „Benedicta vom Kreuz“, Edith Stein - hat durch
ihr Leben ein Zeugnis dafür gegeben, wie Menschen auch mit
scheinbar ausweglosen Situationen umgehen und leben können – so wie
sie im KZ Auschwitz mit einer finalen Situation umgehen musste, wo
sie schon kurz nach der Ankunft ihres Transports aus Holland
gemeinsam mit ihrer Schwester im Gas starb.
Terror und Gewalt beherrschen auch heute wieder oder noch immer
und vielleicht sogar noch mehr, die Welt. Damit umgehen und leben
zu können, erfordert Mut und große Vorbilder. Der heilige Papst
Johannes Paul II und die Heilige Edith Stein taugen bestens als
solche Vorbilder.
 Sie beide hatten Kontakte zu Speyer – die eine über
mehrere Jahre hinweg als Lehrerin im Kloster St. Magdalena, der
andere nur wenige Stunden. „Können wir es überhaupt zureichend
einschätzen, gemeinsam mit einem Heiligen am Altar gestanden zu
haben – ihm die Hand gereicht zu haben?“, fragte jetzt Bischof Dr.
Anton Schlembach nachdenklich und voller Ehrerbietung seine
bewegten Zuhörer im dicht besetzten Speyerer Ratssaal.
Sie beide hatten Kontakte zu Speyer – die eine über
mehrere Jahre hinweg als Lehrerin im Kloster St. Magdalena, der
andere nur wenige Stunden. „Können wir es überhaupt zureichend
einschätzen, gemeinsam mit einem Heiligen am Altar gestanden zu
haben – ihm die Hand gereicht zu haben?“, fragte jetzt Bischof Dr.
Anton Schlembach nachdenklich und voller Ehrerbietung seine
bewegten Zuhörer im dicht besetzten Speyerer Ratssaal.
Deshalb: So wie es sie schon mit der in Speyer seßhaften
„Edith-Stein-Gesellschaft“ gibt, wäre wohl auch eine
institutionalisierte Form des Gedenkens an Papst Johannes Paul II.
und an seinen Besuch in Speyer eine gute Idee, weil ihm dort die
ihn verehrenden Menschen, wie 1987 der Speyerer Bischof in
Realität, zumindest im Geiste die Hand reichen und so aus der
spirituellen Begegnung mit ihm Kraft und Hoffnung schöpfen können –
trotz allem. Fotos: gc
28.11.2015
Auf dem Weg zu einer „neuen Art von Pfarrei“
 Bischof
Karl-Heinz Wiesemann ermutigt in seinem Hirtenbrief zum ersten
Advent die Gläubigen dazu, sich auf den Weg des Lebens in den neuen
Pfarreien einzulassen
Bischof
Karl-Heinz Wiesemann ermutigt in seinem Hirtenbrief zum ersten
Advent die Gläubigen dazu, sich auf den Weg des Lebens in den neuen
Pfarreien einzulassen
Speyer- Die Einführung des neuen
Seelsorgekonzepts „Gemeindepastoral 2015“ steht im Mittelpunkt des
Hirtenbriefs von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zum ersten
Advent. „Soll die Reform gelingen, müssen wir das wirklich Neue an
den nun umschriebenen pfarrlichen Lebensräumen erkennen“, schreibt
Bischof Wiesemann im Blick auf die 70 neuen Pfarreien. „Wir wollen
uns auf den Weg zu einer neuen Art von Pfarrei machen: Sie lebt in
unterschiedlichen Gemeinden, die fest miteinander verbunden sind,
so dass sie sich gegenseitig ergänzen in der Vielfalt der
Charismen, die ihnen gegeben sind.“ Es komme nicht darauf an, an
jedem Ort alles anzubieten, sondern miteinander den Reichtum der
Vielfalt zu entdecken. Keiner schafft das allein. „Wir brauchen
einander, um den ganzen Christus in der Welt sichtbar werden zu
lassen.“ Das erfordert aus Sicht des Bischofs Offenheit,
aufeinander zuzugehen, Bereitschaft, miteinander Schwerpunkte zu
setzen, und Freude daran, sich Neuem und Unerwartetem zu
öffnen.“
Die Neuwahlen der pfarrlichen Gremien im Oktober hätten
vielerorts einen Generationenwechsel hervorgebracht. Manch einer,
der sich über lange Jahre mit Leidenschaft für seine Pfarrgemeinde
vor Ort eingesetzt habe, wolle sich diese grundlegende Veränderung
in seinem ehrenamtlichen Engagement nicht mehr zumuten. Andere
seien neu angezogen worden von der Unterschiedlichkeit der
Mitwirkungsmöglichkeiten, die die neuen Räte auf der Pfarrei- wie
konkret auf der Gemeindeebene bieten. Der Bischof ermutigt die
Gläubigen, „sich mit dem Wagemut und der Zusage des Evangeliums auf
den Weg des gemeinsamen Lebens und Wirkens in unseren neuen
Pfarreien einlassen.“
Die Einführung des neuen Seelsorgekonzepts im Bistum Speyer
treffe mit zwei herausragenden Ereignissen zusammen. Bischof
Wiesemann bezieht sich einerseits auf den Beginn des
außerordentlichen Heiligen Jahres, das Papst Franziskus als Jahr
der Barmherzigkeit ausgerufen hat und mit dem er die Kirche von
innen her erneuern möchte. Zum anderen richtet er seinen Blick auf
die Flüchtlinge, die aus Angst vor Terror und Krieg, aus
Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit an unserer Tür anklopfen. Hier
werde der innerste Kern von Barmherzigkeit, von „misericordia“,
angefragt: „Das eigene Herz für die Elenden zu öffnen und das Leben
mit ihnen zu teilen.“ Die Aufnahme und Integration der Flüchtlinge
betrachtet er als eine Bewährungsprobe für das Zeugnis der
Christen. „Was wir aktuell erleben, ist bei allen berechtigten
Sorgen nicht der Untergang des christlichen Abendlandes. Das könnte
nur geschehen, wenn wir ihm nicht mehr das Angesicht unseres
menschenfreundlichen Gottes geben würden.“ So werde das Jahr der
Barmherzigkeit zum konkreten Auftrag und zur Sendung in die
Welt.
Der Hirtenbrief des Bischofs wird in den Gottesdiensten zum
ersten Advent in allen Pfarreien des Bistums verlesen. Erstmals
steht er auch in Form eines Videobeitrags auf der Internetseite des
Bistums Speyer zur Verfügung. Bischof Wiesemann wendet sich darin
aus der Kapelle des Bischofshauses direkt an die Gläubigen im
Bistum. is
Das Hirtenwort als Video:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/leitung/bischof/hirtenwort-zum-ersten-advent/
28.11.2015
Reparatur der Orgel der Heiliggeistkirche geht voran
Bereits 1.000 Euro gespendet
Speyer- Pünktlich zum Advent und rechtzeitig,
vor Weihnachten, erklingt das Trompetenregister der Orgel in der
Heiliggeistkirche wieder. Damit bekommt die Advents- und
Weihnachtszeit den nötigen festlichen Klang.
Möglich ist das durch die Spenden der Speyerer geworden. Bereits
1 000 Euro von den benötigten 10 000 Euro sind beisammen.
Auch bei der Andacht am Sonntagabend wird wieder Gelegenheit
sein, für die Reparatur der Orgel zu Spenden. An der Orgel spielt
dieses Mal Gerhard Nußbaum festliche Orgelmusik zum Advent.
Henri Franck
26.11.2015
Erinnerungen an den Papstbesuch 1987 in Speyer
 Werner Schineller, der frühere Speyerer Bürgermeister und Oberbürgermeister, hatte Erinnerungsstücke mitgebracht. Rechts neben ihm Bischof em. Anton Schlembach.
Werner Schineller, der frühere Speyerer Bürgermeister und Oberbürgermeister, hatte Erinnerungsstücke mitgebracht. Rechts neben ihm Bischof em. Anton Schlembach.
Bischof em. Schlembach und Oberbürgermeister a.D. Schineller
berichten in der Reihe „Lebendige Erinnerung“ über einen
denkwürdigen Tag
Speyer- Der 4. Mai 1987 war ein großer Tag
für Speyer, als Papst Johannes Paul II. das Bistum und die Stadt
besuchte. Bischof em. Anton Schlembach hatte das Oberhaupt der
katholischen Kirche in die Domstadt eingeladen. Werner Schineller,
damals Bürgermeister, zeichnete von städtischer Seite für die
Organisation des Großereignisses verantwortlich. Am Dienstag
blickten beide Zeitzeugen in der Reihe "Lebendige Erinnerung" im
historischen Ratssaal in Speyer zurück und ließen den denkwürdigen
Tag vor 28 Jahren und die ganzen Vorbereitungen Revue passieren.
Wie lädt man einen Papst überhaupt ein, fragte Rebecca Blum,
Schülerin des Speyerer Edith-Stein-Gymnasiums, die die Moderation
übernahm. Schlembach berichtete ausführlich, wie die Idee geboren
wurde, er einen Brief an den Sekretär des Papstes schickte, über
die Zeit, in der er und das Domkapitel auf eine Zusage hofften, an
die sie eigentlich gar nicht glaubten. Schlembachs Grundgedanke:
Wenn der Papst Edith Stein in Köln selig sprechen wird, passt
Speyer, wo sie gewirkt hat, dazu. Am 26. Juni 1986 kam die Zusage
in Speyer an – rund sechs Wochen, nachdem Schlembach die Einladung
gesandt hatte. Der Bischof berichtete, wie der damalige
Oberbürgermeister Christian Roßkopf alles andere als begeistert
war: "Er ist erschrocken", rief Schlembach den rund 70 Zuhörern zu.
Der Rathauschef hatte Bedenken, die Stadt könne solch einen Ansturm
von Menschen nicht verkraften.
An diesem 4. Mai war die Stadt Speyer wahrlich im Papst-Fieber.
Rebecca Blum lieferte die Zahlen: 1000 Polizisten, über 1000
ehrenamtliche Helfer, mehr als 300 Journalisten und nicht zuletzt
60.000 Gläubige waren auf den Beinen. Aber bis zu dem historischen
Tag hatten Ordinariat und Stadt viel zu tun. Wo landet der
Hubschrauber des Papstes? Welche Route nimmt der Papst in die
Stadt? Es gab eine Vielzahl von Arbeitsgemeinschaften, die sich von
Parkplatzfragen bis hin zur Liturgie beschäftigen, zeigte Werner
Schineller die Spanne auf. Der frühere Bürgermeister hatte einige
Erinnerungsstücke mitgebracht, etwa Schriften und Medaillen, die
anlässlich des Papstbesuches herausgegeben wurden. Lacher erntete
er, als er das "saukalte Wetter" an diesem 4. Mai in Erinnerung
rief.
Bischof em. Anton Schlembach gab detailreiche Einblicke in den
Tagesablauf. Alles lief nach Protokoll, angefangen von der
Begrüßung am Landeplatz beim heutigen Kolb-Schulzentrum. Er sprach
von der eindrucksvollen Fahrt von Johannes Paul II. über die
Maximilianstraße. Das Bistumsarchiv, das die beiden Zeitzeugen
gemeinsam mit dem Forum Katholische Akademie zu der Veranstaltung
eingeladen hat, lieferte einen Zusammenschnitt der
Fernsehberichterstattung.
Einig waren sich Schlembach und Schineller, dass der Papstbesuch
bis heute nachwirkt und das Andenken in der Stadt gepflegt wird.
Mit Unverständnis reagierten sie auf die gegenwärtige Situation in
Europa, bemängelten die fehlende Solidarität der Staaten. "Ich habe
mir das Europa anders vorgestellt", erklärte Schineller. Ende der
80er Jahre habe Europa einen großen Aufschwung erfahren, heute
würden die Grenzen wieder geschlossen. "Die Grundwerte sind heute
nicht weniger gefährdet als damals beim Papstbesuch", fügte Anton
Schlembach hinzu, der Johannes Paul II. als begeisterten Europäer
bezeichnete und auf dessen Beitrag bei der friedlichen Lösung des
Ost-West-Konfliktes hinwies.
Musikalisch umrahmt wurde die Veranstaltung von Sängerinnen des
Mädchenchors am Dom unter Leitung von Domkapellmeister Markus
Melchiori. Bei der Reihe "Lebendige Erinnerung" arbeiten das
Bistumsarchiv, das Speyerer Stadtarchiv, das Zentralarchiv der
Evangelischen Kirche der Pfalz, das Historische Museum der Pfalz,
der Historische Verein der Pfalz sowie das Speyerer Seniorenbüro
zusammen. Text/Foto: Yvette Wagner
26.11.2015
Diözesane Eröffnung des „Heiligen Jahres der Barmherzigkeit“
 Pontifikalamt im Speyerer Dom am dritten
Adventssonntag
Pontifikalamt im Speyerer Dom am dritten
Adventssonntag
Speyer- Mit einem Pontifikalamt am dritten
Advent (Sonntag, 13. Dezember) um 10 Uhr im Speyerer Dom eröffnet
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann das „Heilige Jahr der
Barmherzigkeit“ im Bistum Speyer.
Das von Papst Franziskus ausgerufene Heilige Jahr soll dazu
beitragen, „das Zeugnis der Gläubigen stärker und wirkungsvoller zu
machen", heißt es in der Verkündigungsbulle mit dem Titel „Antlitz
der Barmherzigkeit“. Der Papst fordert die Kirche darin auf,
verstärkt auf das Wesentliche zu schauen und „Zeichen und Werkzeug
von Gottes Barmherzigkeit“ zu sein. Die Barmherzigkeit sei der
letzte und endgültige Akt, mit dem Gott den Menschen entgegentritt,
und zugleich „das grundlegende Gesetz, das im Herzen eines jeden
Menschen ruht und den Blick bestimmt, wenn er aufrichtig auf den
Bruder und die Schwester schaut, die ihm auf dem Weg des Lebens
begegnen.“ Barmherzigkeit öffne das Herz für die Hoffnung, dass
„wir trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer Schuld für immer
geliebt sind“, so Papst Franziskus. Traditionell werden zu Beginn
eines Heiligen Jahres die Heiligen Pforten des Petersdoms und der
drei weiteren päpstlichen Basiliken in Rom geöffnet.
Öffnung des Otto-Portals als „Heilige Pforte der
Barmherzigkeit“
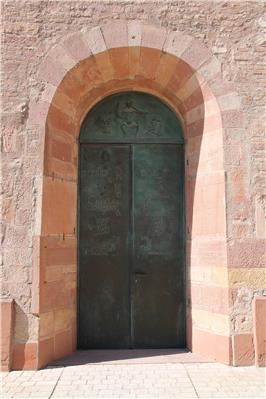 Zum ersten
Mal in einem Heiligen Jahr gibt es in jeder Bischofskirche eine
„Heilige Pforte“. Einen Höhepunkt des Gottesdienstes im Speyerer
Dom am dritten Adventssonntag stellt die Öffnung des Otto-Portals
im Südosten des Domes als „Heilige Pforte“ dar. Es ist dem heiligen
Bischof Otto von Bamberg gewidmet, der beim Dombau mitgewirkt
hat.
Zum ersten
Mal in einem Heiligen Jahr gibt es in jeder Bischofskirche eine
„Heilige Pforte“. Einen Höhepunkt des Gottesdienstes im Speyerer
Dom am dritten Adventssonntag stellt die Öffnung des Otto-Portals
im Südosten des Domes als „Heilige Pforte“ dar. Es ist dem heiligen
Bischof Otto von Bamberg gewidmet, der beim Dombau mitgewirkt
hat.
Zu Beginn des Gottesdienstes wird Bischof Wiesemann Ausschnitte
aus der Verkündigungsbulle „Misericordiae vultus“ (Antlitz der
Barmherzigkeit) von Papst Franziskus zum außerordentlichen Jubiläum
der Barmherzigkeit verlesen. Mit den Worten „Das ist das Tor zum
Herrn: Durch dieses Tor treten wir ein, um Barmherzigkeit und
Vergebung zu erlangen“ wird er das Portal öffnen und dann mit den
Konzelebranten in die Kathedrale einziehen.
Domorganist Markus Eichenlaub und die Schola Cantorum Saliensis
unter Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori werden den
Gottesdienst musikalisch gestalten. Unter anderem wird die „Messe
brève no. 5 aux seminaires“ von Charles Gounod zu hören sein.
„Weg der Barmherzigkeit“ im Dom zu Speyer
Im Heiligen Jahr lädt ein „Weg der Barmherzigkeit“ in der
romanischen Kathedrale die Besucherinnen und Besucher dazu ein,
sich eingehender mit der Barmherzigkeit Gottes zu befassen. An vier
Stationen – dem Otto-Portal, der Taufkapelle, dem Hauptportal und
vor dem Marienbild – erhalten die Gläubigen spirituelle Impulse, um
die Barmherzigkeit als „das Geheimnis des christlichen Glaubens“
(Papst Franziskus) zu entdecken und zu betrachten. Im Seitenschiff
findet der „Weg der Barmherzigkeit“ seinen Abschluss. Dort besteht
die Möglichkeit zum Gespräch mit einer Seelsorgerin oder einem
Seelsorger sowie zum Empfang der Beichte. Es liegen Blöcke und
Stifte bereit, um eigene Eindrücke und Gedanken zu notieren oder an
einer Pinnwand für andere Besucher zu hinterlassen.
Für den „Weg der Barmherzigkeit“ sollte man sich etwa eine halbe
Stunde Zeit nehmen. Infotafeln vor dem Dom und im Inneren des Domes
machen auf das „Heilige Jahr“ und den „Weg der Barmherzigkeit“
aufmerksam. An den Eingängen liegen Faltblätter bereit, die auch
von der Internetseite des Domes heruntergeladen werden können.
Geplant ist, auch die Audioguide-Führung durch den Speyerer Dom
durch Hinweise auf das „Heilige Jahr“ und den „Weg der
Barmherzigkeit“ zu erweitern.
Zahlreiche Angebote im Bistum Speyer zum Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit
Im Bistum Speyer wird das „Außerordentliche Heilige Jahr der
Barmherzigkeit“ mit mehreren Aktionen, Anregungen und Initiativen
begangen. Sie verstehen sich als Einladung an alle, das Heilige
Jahr für den eigenen Weg als Christin, als Christ persönlich oder
in der Gemeinschaft von Pfarrei, Gemeinde, Verband oder Gruppe
fruchtbar zu machen.
Heilige Pforten in mehreren Wallfahrtskirchen des Bistums Speyer
dienen als Anstoß, die Barmherzigkeit Gottes im eigenen Leben
konkret zu erfahren. Für Pfarreien, Verbände, Gruppen und
Einzelpilger bietet das Pilgerbüro Speyer eine große diözesane
Romwallfahrt vom 8. bis zum 15. Oktober 2016 mit Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann an. Auch das Domweihfest am 2. Oktober 2016
wird durch das Heilige Jahr eine besondere Prägung erfahren.
Geplant ist eine „Nacht der Barmherzigkeit“ vom 1. auf den 2.
Oktober mit Taizégebet, eucharistischer Anbetung und der
durchgängigen Möglichkeit zu Gespräch, Segnung und Beichte. Die
Brüder aus Taizé haben ihre Teilnahme bereits zugesagt.
Weitere Informationen zum „Jahr der Barmherzigkeit“:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/heiliges-jahr-der-barmherzigkeit/
www.dbk.de/heiliges-jahr/home/
www.iubilaeummisericordiae.va/content/gdm/de.html
Öffnungszeiten des „Wegs der Barmherzigkeit“ im Dom zu
Speyer:
werktags November bis März 9 – 17 Uhr
werktags April bis Oktober 9 – 19 Uhr
sonntags ganzjährig 12 – 18 Uhr
Text und Foto: is
25.11.2015
Alte Mauern in neuem Licht
 Stadt und Domkapitel
unterzeichnen Vertrag zur Erneuerung der Außenbeleuchtung des
Doms
Stadt und Domkapitel
unterzeichnen Vertrag zur Erneuerung der Außenbeleuchtung des
Doms
Speyer- Die Stadt Speyer und das
Domkapitel Speyer haben am 11.11.2015 einen Vertrag unterzeichnet,
der die Finanzierung für Aufbau und Unterhalt der neuen
Außenbeleuchtung des Doms regelt. Die Anschaffung und der Aufbau
der Anlage wird bestritten aus einem Zuschuss der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer in Höhe von 300.000 Euro und einem
Zuschuss der Stadt Speyer in Höhe von 80.000 Euro. Bislang wurde
die Beleuchtung mit Unterstützung der Stadt und der Stadtwerke
Speyer betrieben. Mit Unterzeichnung dieser Vereinbarung teilen
sich Domkapitel und Stadt weiterhin Kosten und Verantwortung für
die Außenbeleuchtung der Kathedralkirche.
Seit 2011 gab es Pläne, die Illumination der romanischen
Kathedrale zu erneuern, um sie auf einen aktuellen technischen
Stand zu bringen und die ästhetische Wirkung zu verbessern. Was
fehlte, war das Geld zur Finanzierung der neuen Anlage. Zwei große
Einzelspenden aus den Reihen der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu
Speyer sowie Mittel aus den Stiftungserträgen in einem Volumen von
je 100.000 Euro ermöglichen nun die Realisierung des neuen
Lichtkonzepts. Spender sind der Vorstandsvorsitzende der Stiftung
Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs und Isolde Laukien-Kleiner, deren Mann
Horst Kleiner als ehemaliger Vorsitzender des Vorstandes der
Bausparkasse Schwäbisch Hall AG Mitglied im Kuratorium der Stiftung
ist. Die Stadt Speyer beteiligt sich mit 80.000 Euro. Die Kosten
für Energie, Instandhaltung und Wartung werden auf 10.000 Euro
geschätzt und unter Stadt und Domkapitel aufgeteilt.
2011 gewann das Ingenieurbüro Bamberger einen Wettbewerb zur
Neukonzeption der Außenbeleuchtung. Ausgeschrieben wurde der
Wettbewerb vom Domkapitel Speyer. Der wissenschaftliche Beirat
fungierte als Jury, so dass die Belange des Denkmalschutzes von
Anfang an Berücksichtigung fanden. Ziel war es, die plastische
Wirkung des romanischen Baukörpers stärker heraus zu arbeiten und
verschiedene Beleuchtungsszenarien zu ermöglichen. Gleichzeitig
soll die in die Jahre gekommene technische Infrastruktur erneuert
sowie die Energieeffizienz erhöht und damit der Stromverbrauch um
bis zu achtzig Prozent verringert werden. Letzteres sieht das
Domkapitel auch als wichtige Maßnahme im Sinne einer ökologischen
Verantwortung, wie sie Papst Franziskus in seiner Enzyklika
„Laudato si“ fordert. Erreicht wird dieser Effekt durch den Einsatz
moderne LED Technik und einer dynamischen, das heißt den
Nachtzeiten und Lichtverhältnissen angepassten Steuerung der
Beleuchtung. Das Lichtspektrum wird so gestaltet, dass Insekten und
Vögel nicht irritiert werden.
Die Beleuchtung erfolgt durch etwa fünfzig Bodenstrahler,
Lichtmasten an sechs bereits bestehenden Positionen, neu
anzubringenden Strahlern auf zwei gegenüberliegenden Gebäuden sowie
einigen wenigen in den Türmen positionierten Leuchten. Die
geplanten Maßnahmen erfordern umfangreiche Bodenarbeiten rund um
den Dom. Die Bauplanung hierfür läuft derzeit. Text: is; Foto:
spk
25.11.2015
Nachhaltig predigen zum Thema „Heimat-los“
Predigtanregungen greifen im Kirchenjahr 2015/16 ein
hochaktuelles Thema auf
Speyer- Im zehnten Jahr ihres Erscheinens
hat die ökumenische Predigthilfe „nachhaltig predigen“ ein
aktuelles Schwerpunktthema: „Heimat-los“ – unter diesem Motto sind
die Predigtanregungen unter www.nachhaltig-predigen.de
rechtzeitig zum Beginn des neuen Kirchenjahres 2015/16 am 1. Advent
online.
„Indem wir die Ursachen für Flucht und Vertreibung aufgreifen,
weisen wir auch auf den Zusammenhang von Frieden, Gerechtigkeit und
Bewahrung der Schöpfung hin“, erklärt die Umweltbeauftragte der
pfälzischen Landeskirche, Bärbel Schäfer. Das ökumenische
Kooperationsprojekt wird von rund 20 Landeskirchen und Bistümern in
Deutschland und der Schweiz getragen, darunter die Evangelische
Kirche der Pfalz. Mehrere Pfälzer Autoren haben an den
Predigthilfen mitgearbeitet.
Bei der Auswahl der Bibelstellen orientieren sich die Autoren an
der evangelischen Perikopenordnung und an der katholischen
Leseordnung für die Sonntage. „Im neuen Kirchenjahr werden die
Herausgeber von ‚nachhaltig predigen‘ versuchen, Zusammenhänge,
Ursachen und christliche Perspektiven in ihrem Schwerpunktthema
„Heimat-los“ zusammenzubringen“, erklären die Initiatoren. Dazu
gebe es auf ökumenischer Grundlage Anregungen und Impulse, um die
Bibeltexte des jeweiligen Sonntags in den globalen Zusammenhang
nachhaltigen Lebens und Handelns einzuordnen.
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung seien Anliegen, die in
der biblischen Überlieferung tief verwurzelt seien und heute eher
noch an Aktualität gewonnen hätten, erklärt Kirchenpräsident
Christian Schad in seinem Grußwort. In diesem Sinn unterstütze
‚nachhaltig predigen‘ die Kirche auch dabei, ihr Wächteramt
wahrzunehmen, „wie im Blick auf eine globalisierte Wirtschaft
soziale und ökologische Maßstäbe zu beachten sind“.
„Nachhaltig predigen“ wird gefördert von Brot für die Welt und
dem Katholischen Fonds.
Mehr zum Thema: www.nachhaltig-predigen.de.
lk
25.11.2015
„Es hilft uns vor allem Berührungsängste zu nehmen"
.jpg) Das Schulsozialarbeiter-Team Speyer mit Thomas Stephan (4. v. rechts)
Das Schulsozialarbeiter-Team Speyer mit Thomas Stephan (4. v. rechts)
Schulsozialarbeiter würdigen diözesanes Angebot zur
Trauerarbeit
Speyer- 12 Schulsozialarbeiterinnen und
-arbeiter Speyerer Schulen haben Mitte November die Fortbildung des
Bistums Speyer zu „Trauerarbeit an der Schule“ in Speyer besucht.
Koordinatorin Bettina Baldauf, Abteilung Jugendförderung der Stadt
Speyer, hatte das Angebot gebucht: „Ich habe davon durch Lehrer
erfahren, die mir erzählt haben wie hilfreich es für sie war, auch
im konkreten Fall als ein Kind an der Schule gestorben ist.“
Dipl.-Sozialpädagogin Baldauf und ihr Team erhielten bei der
Fortbildung „ein gewisses Handwerkszeug“, Professionalität für ein
schwieriges und sehr persönliches Thema oder wie die Koordinatorin
sagt: „Es hilft uns vor allem Berührungsängste zu nehmen.“ Referent
Thomas Stephan schätzt die Zusammenarbeit mit den
Schulsozialarbeitern sehr. Sie seien durch ihre hohe Präsenz vor
Ort wichtige Ansprechpartnerinnen und -partner.
„Trauerarbeit an der Schule“ ist ein Angebot der Schulpastoral
der Hauptabteilung Schulen, Hochschulen, Bildung des Bistums
Speyer. Referent Thomas Stephan ist Notfallseelsorger und als
Trauerbegleiter qualifiziert in der Trauerarbeit mit Kindern und
Jugendlichen.
Kontakt für Fortbildungen und aktuelle Anfragen im Trauerfall an
Schulen im Bistum Speyer:
Thomas Stephan, thomas.stephan@bistum-speyer.de,
Tel: 0160 94791037
Text: is; Foto © Schulabteilung
des Bistums Speyer
24.11.2015
Preisträger im Wettbewerb „Bistumshaus St. Ludwig“ vorgestellt
 Erste Entscheidung für weitere bauliche Entwicklung auf
echtem „Filet-Stück“ der Speyerer Innenstadt
Erste Entscheidung für weitere bauliche Entwicklung auf
echtem „Filet-Stück“ der Speyerer Innenstadt
spk. Speyer- In dem Entwicklungsprozess
über die zukünftige Nutzung eines der absoluten „Filet-Stücke“ in
der Speyerer Innenstadt ist eine wesentliche Vorentscheidung
gefallen: Im Planungs- und Investorenwettbewerb zum ehemaligen
Bistumshaus St. Ludwig hat jetzt die vielköpfige Jury ihr Votum
abgegeben und vier der insgesamt neun eingereichten Konzepte als
„preiswürdig“ erachtet, die im Rahmen eines Pressegespräches in den
Räumen des „Gemeinnützigen Siedlungswerkes“, das auch die fachliche
Begleitung des Entwicklungsprozesses übernommen hat, der
Öffentlichkeit vorgestellt.
Wie Architekt Andreas Kaupp, der mit seinem Mannheimer
Architekturbüro den Wettbewerb betreut hat, bei dieser Gelegenheit
mitteilte, hätten in dem Wettbewerb neben der städtebaulichen und
der architektonischen Qualität der Entwürfe insbesondere auch „ihre
Angemessenheit in der Nachnutzung sowie ihre soziale und kulturelle
Einbindung ins Stadtgefüge“ Beachtung gefunden.
-01.jpg) Der Jury selbst hätten sieben Preisrichter und sechs
Stellvertreter angehört, die von zehn ausgewiesenen Fachleuten aus
unterschiedlichen Fachdisziplinen - von der Architektur über die
Denkmalpflege bis zur Stadtentwicklung - beraten wurden. Auch
Vertreter der vier „großen“ Fraktionen im Speyerer Stadtrat – von
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SWG - seien mit jeweils einem
Vertreter in der Jury vertreten gewesen.
Der Jury selbst hätten sieben Preisrichter und sechs
Stellvertreter angehört, die von zehn ausgewiesenen Fachleuten aus
unterschiedlichen Fachdisziplinen - von der Architektur über die
Denkmalpflege bis zur Stadtentwicklung - beraten wurden. Auch
Vertreter der vier „großen“ Fraktionen im Speyerer Stadtrat – von
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SWG - seien mit jeweils einem
Vertreter in der Jury vertreten gewesen.
Von der frühzeitigen Mitwirkung der wesentlichen politischen
Kräfte in der Stadt sowie der Einbeziehung der Stadtplanung von
Speyer versprechen sich die Verantwortlichen zudem eine
nennenswerte Verkürzung des späteren Genehmigungsverfahrens.
Wie Andreas Kaupp sodann bekanntgeben konnte, habe die Jury nach
eingehender Beratung den ersten Platz, verbunden mit einem
Preisgeld von 8.000 Euro, den Stuttgarter Architekten Dieter
Blocher und Wolfgang Mairinger zuerkannt. Ihr Entwurf sieht eine
Nutzung des Areals mit
Wohnungen für mehrere Generationen vor, in die auch ein Stützpunkt
für Pflege und betreutes Wohnen eingeplant sei.
Der ehemalige Kirchenraum schließlich solle nach diesem Konzept
künftig als Veranstaltungsraum genutzt werden.
Durch eine Angleichung der Gebäudehöhen – dazu sollen übrigens
auch die bestehenden Fassaden in ihrer Höhe und Formensprache
erhalten bleiben - solle zudem ein klares Erscheinungsbild des
baulichen Ensembles erreicht werden.
 Hinter diesem Planungsentwurf steht als Investor die
„Diringer und Scheidel Wohn-Gebewerbebau GmbH“ aus Mannheim, die
als international agierender Familienkonzern weltweit unterwegs
ist..
Hinter diesem Planungsentwurf steht als Investor die
„Diringer und Scheidel Wohn-Gebewerbebau GmbH“ aus Mannheim, die
als international agierender Familienkonzern weltweit unterwegs
ist..
Wohnbebauung soll auch im Mittelpunkt des zweitplatzierten, mit
einem Preisgeld von 6.000 Euro prämierten Entwurfs der Mannheimer
Architektengemeinschaft „Motorlab Architekten“, „United
Architecture GmbH“ und „Wewer Landschaftsarchitektur“,
Frankfurt/Main stehen. Sie möchten diese Entwicklung allerdings mit
einem Hotel und einem Gastronomiebetrieb verbinden.
Für die denkmalgeschützte Kirche St. Ludwig sieht auch ihr
Konzept eine Nutzung als Zentrum für kulturelle Begegnungen vor.
Dazu solle durch die Schaffung eines neuen Zugangs von der Großen
Greifengasse aus ein besonderer Akzent durch einen öffentlichen
Vorplatz mit Sitzstufenanlage gesetzt werden. Der so entstehende
Innenhof solle durch die Rekonstruktion des historischen Kreuzgangs
als „Ort der Ruhe“ genutzt werden können. Dieser Teil des
Planungsentwurfes wurde übrigens von der „Bock Baukunst Development
GmbH“ aus Frankfurt/Main ergänzend zu der Planung
beigesteuert.
 Den dritten Platz, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe
von 4.000 Euro, konnte der Entwurf der „Arbeitsgemeinschaft
Bistumshaus“ aus den Saarbrücker Architekten Oliver Brünjes und der
„Khp Ingenieure GmbH“ aus Steinfeld gewinnen. Ihr Entwurf sieht
ebenfalls Wohnungen vor, ebenso kombiniert mit einem Hotel.
Den dritten Platz, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe
von 4.000 Euro, konnte der Entwurf der „Arbeitsgemeinschaft
Bistumshaus“ aus den Saarbrücker Architekten Oliver Brünjes und der
„Khp Ingenieure GmbH“ aus Steinfeld gewinnen. Ihr Entwurf sieht
ebenfalls Wohnungen vor, ebenso kombiniert mit einem Hotel.
In dem bisherigen Kirchenraum würde diesem Konzept zufolge ein
Restaurant eingerichtet. Dieser Planungsentwurf wurde von der „SÜBA
Bauen und Wohnen GmbH“ aus Karlsruhe eingereicht.
Den vierten Platz und ein Preisgeld in Höhe von 2.000 Euro vergab
die Jury schließlich für den Entwurf des Mannheimer Architekten
Andreas Schmucker, der ebenfalls eine Wohnnutzung vorsieht, jedoch
zur künftigen Nutzung des Kirchenraumes keine Aussage macht. Hier
tritt als Investor die „Quadriga Projektentwicklung GmbH und Co.
KG“ aus Speyer auf.
Das Bistum wird Gespräche mit den zwei Erstplatzierten führen und
rechnet noch im Dezember auf endgültige Entscheidung.
-01.jpg) Nachdem die Entwürfe auf den Plätzen eins und zwei nach
Meinung der Jury sehr dicht beieinander lägen, seien sie von der
Jury intensiv weiterdiskutiert und dabei auch Ideen und
Ansatzpunkte für mögliche Verbesserungen aufgezeigt worden. Das
berichtete der Leiter der Hauptabteilung Finanzen und Immobilien
des Bistums Speyer, Domkapitular Peter Schappert. Das Domkapitel
wolle deshalb jetzt mit den beiden favorisierten Planverfassern in
weitergehende Gespräche zur Feinabstimmung ihrer Entwürfe
eintreten. „Danach treffen wir dann unsere endgültige Entscheidung
und der ausgewählte Investor kann dann seinen Bauantrag an die
Stadtverwaltung stellen“, erläuterte Schappert die nächsten
Verfahrensschritte.
Nachdem die Entwürfe auf den Plätzen eins und zwei nach
Meinung der Jury sehr dicht beieinander lägen, seien sie von der
Jury intensiv weiterdiskutiert und dabei auch Ideen und
Ansatzpunkte für mögliche Verbesserungen aufgezeigt worden. Das
berichtete der Leiter der Hauptabteilung Finanzen und Immobilien
des Bistums Speyer, Domkapitular Peter Schappert. Das Domkapitel
wolle deshalb jetzt mit den beiden favorisierten Planverfassern in
weitergehende Gespräche zur Feinabstimmung ihrer Entwürfe
eintreten. „Danach treffen wir dann unsere endgültige Entscheidung
und der ausgewählte Investor kann dann seinen Bauantrag an die
Stadtverwaltung stellen“, erläuterte Schappert die nächsten
Verfahrensschritte.
Die neun Nutzungskonzepte, die der Jury zur Bewertung vorgelegt
worden waren, sind vom 23. November bis zum 4. Dezember in den
Geschäftsräumen des Gemeinnützigen Siedlungswerks in der Oberen
Langgasse 18 in Speyer öffentlich ausgestellt. Die Öffnungszeiten
sind werktags (ohne Mittwoch) von 9 bis 12 Uhr und von 14 bis 16
Uhr, Freitags ist der Besuch nur vormittags möglich.
Mitglieder der Jury im Planungs- und Investorenwettbewerb
zum Bistumshaus St. Ludwig waren:
Ordentliche Mitglieder im Preisgericht:
·Professor Dipl. Ing. Dietrich Gekeler, Architekt, Karlsruhe
(Vorsitzender)
·Professor Dipl. Ing. Bernhard Hort, Heidelberg
·Bernd Reif, Leiter Stadtentwicklung und Bauwesen, Stadt
Speyer
·Domkapitular Peter Schappert, Leiter der Hauptabteilung Finanzen
und Immobilien, Bistum Speyer
·Baudirektor Dipl. Ing. Stephan Tschepella, Bistum Speyer
·Dompfarrer Matthias Bender, Bistum Speyer
·Gerhard Müller, Geschäftsführer Gemeinnütziges Siedlungswerk
Speyer GmbH
Stellvertretende Mitglieder des
Preisgerichts
·Dipl. Ing. Alexandra Ruffing, Bischöfliches Bauamt, Bistum
Speyer
·Daniela Welter, Stadtplanungsamt Speyer
·Architekt Dipl. Ing. Joachim Becker, Neustadt
·Finanzdirektorin Tatjana Mast, Bistum Speyer
·Kanzleidirektor Wolfgang Jochim, Bistum Speyer
·Prokurist Gerhard Löchel, Gemeinnütziges Siedlungswerk Speyer
GmbH
Sachverständige Beraterinnen und Berater
·Dipl. Ing. Willi Hildebrandt, Landschaftsarchitekt,
Karlsruhe
·Diözesankonservator Dipl. Ing. Wolfgang Franz, Bistum Speyer
·Dr. Ulrich Himmelmann/Helmut Stickl , Bodendenkmale,
Generaldirektion Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
·Dr. Ulrike Weber, Landesdenkmalpflege, Generaldirektion
Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz
·Benjamin Schmitt, Leiter der Abteilung Liegenschaften, Bistum
Speyer
·Sabrina Platz, Sachbearbeiterin Abteilung Liegenschaften, Bistum
Speyer
·Dipl. Ing. Kerstin Trojan, Stadtentwicklung und Bauwesen, Stadt
Speyer
·Dipl. Ing. Architekt Jürgen Alshuth, Denkmal- und Stadtbildpflege,
Stadt Speyer
·Steffen Schwendy, Grünflächenamt, Stadt Speyer
·Dipl. Ing. Architekt Thomas Andres, Gemeinnütziges Siedlungswerk
Speyer GmbH
Vertreter der vier großen Fraktionen im Speyerer
Stadtrat
·Dirk Theobald, Mitglied im Bau- und Planungsausschuss,
CDU-Fraktion
·Klaus Seither, Mitglied im Bau- und Planungsausschuss,
SPD-Fraktion
·Irmgard Münch-Weinmann, Stadträtin, Fraktion Grüne
·Michael Neugebauer, Mitglied im Bau- und Planungsausschuss,
Fraktion SWG
Foto: gc/ Bistum Speyer
23.11.2015
25 Jahre Kinderschutzdienste in Rheinland-Pfalz
 Caritas-Kinderschutzdienst feiert sein 25-jähriges
gemeinsam mit Kindern der Kindertagesstätte St. Elisabeth und dem
Haus für Kinder St. Hedwig mit einer Luftballon-Aktion
Caritas-Kinderschutzdienst feiert sein 25-jähriges
gemeinsam mit Kindern der Kindertagesstätte St. Elisabeth und dem
Haus für Kinder St. Hedwig mit einer Luftballon-Aktion
Speyer- „Vor was müssen Kinder denn beschützt
werden?“, ließ Ulrike Dietz-Frübis, Mitarbeiterin der
Kinderschutzdienste des Caritasverbandes für die Diözese Speyer,
die Handpuppe Max fragen. „Wenn sie geschlagen werden“, meinte ein
Junge, „oder wenn man sich streitet“, sagte ein Mädchen, die sich
in einer kleinen Gruppe in der Kita St. Elisabeth zusammengefunden
hatten. „Stimmt, aber auch, wenn ich nicht mitspielen darf und wenn
andere sagen, dass ich doof bin“, warf Handpuppe Lisa ein, gespielt
von Naomi Hettich vom Kinderschutzdienst. „Man darf sich Hilfe
holen, wenn man ausgegrenzt wird,“ findet Puppe Lisa.
Die beiden Expertinnen in Sachen Kinderschutz machten Mut: „Ihr
dürft ‚Nein‛ sagen, zum Beispiel wenn Euch Eure Tanten mit
Schlabberküssen begrüßen und Ihr das nicht wollt.“ Manchmal werde
ein ‚Nein‛ aber leider nicht gehört, bemerkte Naomi Hettich in der
Rolle von Lisa. „Dann üben wir das jetzt mal alle gemeinsam“,
schlug Max alias Dietz-Frübis vor und forderte die Kinder auf,
gemeinsam laut und deutlich „Nein, das will ich nicht!“ zu
sprechen.
Um auf die Rechte von Kindern auch außerhalb der Kita aufmerksam
zu machen, ließen die Kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen und im
Beisein der Mitarbeiter der Kinderschutzdienste um 11 Uhr gelbe
Luftballons in den Himmel über dem Kita-Garten in der
Langensteinstraße steigen.
 Der Einsatz
von Handpuppen sei eine Möglichkeit, insbesondere die kleineren
Kinder für ihre eigenen Grenzen, aber auch für die anderer Kinder
und im Umgang mit Erwachsenen zu sensibilisieren, so Sabrina
Wöhlert, Leitern der Kita St. Elisabeth. Sie war Gastgeberin für
die Jubiläumsfeier der Kinderschutzdienste. „Für unsere Erzieher
sind die Kinderschutzdienste eine wertvolle Unterstützung, wenn wir
Auffälligkeiten im Verhalten unserer Kinder entdecken“, sagt
sie.
Der Einsatz
von Handpuppen sei eine Möglichkeit, insbesondere die kleineren
Kinder für ihre eigenen Grenzen, aber auch für die anderer Kinder
und im Umgang mit Erwachsenen zu sensibilisieren, so Sabrina
Wöhlert, Leitern der Kita St. Elisabeth. Sie war Gastgeberin für
die Jubiläumsfeier der Kinderschutzdienste. „Für unsere Erzieher
sind die Kinderschutzdienste eine wertvolle Unterstützung, wenn wir
Auffälligkeiten im Verhalten unserer Kinder entdecken“, sagt
sie.
Auf Anfrage etwa von Kitas oder Sportvereinen würden Fachkräfte
der Kinderschutzdienste eingeschaltet, führt Pascal Thümling,
Leiter des Caritas-Zentrums Speyer, weiter aus. „Unsere Mitarbeiter
beobachten die Kinder zunächst neutral. Wenn sich der Verdachtsfall
erhärtet, bieten wir den Kindern und Jugendlichen Beratung an, auch
– insbesondere bei den älteren Kindern – ohne das Wissen der
Eltern“, sagt er. Dabei gehe es darum, den Kindern und Jugendlichen
auf Augenhöhe zu begegnen und ihnen in ihrer jeweiligen Situation
Handlungsoptionen vorzuschlagen. „Wir besprechen zum Beispiel,
wohin ein Kind oder ein Jugendlicher sich wenden kann, wenn es zu
Hause zu Konfliktsituationen am Wochenende kommt und
Beratungsdienste nicht erreichbar sind“, erläutert er eine
Möglichkeit des individuellen ‚Notfallkoffers‛. Grundsätzliches
Anliegen sei, neben der Beratung der Kinder ein
niederschwelliges Angebot an Familien zu machen, um Eltern in ihrer
Erziehungskompetenz zu fördern.
„Oft merken wir, wenn es zu Überforderungen in den Familien
kommt, etwa durch Scheidung der Eltern oder der Schwierigkeit, als
alleinerziehendes Elternteil Beruf und Familie miteinander in
Einklang zu bringen. Wir Erzieher versuchen präventiv
gegenzusteuern, bevor eine Situation eskaliert, und zeigen
Unterstützungsangebote auf“, sagt Kita-Leiterin Wöhlert. „Im
Multifamilientraining zum Beispiel, das von der Caritas
Ludwigshafen angeboten wird, lernen Eltern, sich gegenseitig zu
beraten“, fügt Thümling hinzu.
„Auch der Zuzug von Flüchtlingsfamilien und Kindern ohne
Elternbegleitung stellt die Kinderschutzdienste in Zukunft vor neue
Herausforderungen“, sagt der Caritas-Zentrums-Leiter. Ziel sei es
in jedem Fall, betroffene Kinder und Jugendliche so zu stärken,
dass aus ihnen widerstands- und handlungsfähige Erwachsene werden.
Dazu diene auch die Qualitätssicherung, die ein interdisziplinäres
Team von qualifizierten Fachkräften garantiere. Die
Kinderschutzmitarbeiter würden unter anderem durch Supervision und
Fortbildungen in ihrer Arbeit unterstützt. Text und Fotos:
Monika Stumpf
23.11.2015
Erklärung zum Buß- und Bettag 2015 von Kirchenpräsident Christian Schad
 Speyer- „60 Millionen Menschen sind
gegenwärtig auf der Flucht. Not und Perspektivlosigkeit zwingen
sie, ihre Heimat zu verlassen. Sie suchen Schutz und Beistand auch
bei uns. Indem wir für sie beten, bitten wir Gott um Hilfe.
Gleichzeitig ist unser Gebet ein Protest gegen das Vergessen. Es
stellt uns auch die Fluchtursachen vor Augen.
Speyer- „60 Millionen Menschen sind
gegenwärtig auf der Flucht. Not und Perspektivlosigkeit zwingen
sie, ihre Heimat zu verlassen. Sie suchen Schutz und Beistand auch
bei uns. Indem wir für sie beten, bitten wir Gott um Hilfe.
Gleichzeitig ist unser Gebet ein Protest gegen das Vergessen. Es
stellt uns auch die Fluchtursachen vor Augen.
Ursachen der Flucht sind Kriege, Verfolgung und der
Zusammenbruch staatlicher Ordnungen sowie Auswirkungen des
Klimawandels. Durch unfaire globale Handelsbedingungen, die
Nichtbeachtung von Menschenrechts- und Umweltstandards,
Waffenlieferungen in Spannungsgebiete sowie einen rücksichtslosen
Ressourcen- und Energieverbrauch tragen auch wir, trägt auch unser
Lebensstil, zu den Ursachen von Flucht bei.
Buße, Umkehr heißt in dieser Situation konkret: die
Fluchtursachen zu bekämpfen. Wir müssen umsteuern! Deutschland ist
einer der größten Waffenexporteure der Welt. Adressaten sind auch
Länder, die die Menschenrechte verletzen. Dabei führt der Hinweis
auf die wirtschaftliche Bedeutung von Waffenproduktion in unserem
Land in die Irre. Die Arbeitskraft der in der Rüstungsindustrie
beschäftigten Menschen wird vielmehr in Wirtschaftsfeldern
gebraucht, die dem Leben dienen. Wir brauchen gewaltfreie Lösungen
der internationalen Konflikte. Wir müssen Hilfe leisten beim Aufbau
stabiler demokratischer Strukturen. Je erkennbarer wir Christen als
globale Friedenskraft werden, desto deutlicher wird der Ruf, dass
Krieg und Terror nicht siegen dürfen.
Eine weitere Fluchtursache ist der anhaltende Klimawandel. Wir
Menschen in den wohlhabenden Ländern des Nordens zerstören
Lebensraum, den Gott der Menschheit als Ganzer geschenkt hat. Die
Folgen tragen zu allererst die Länder des Südens. Aber es gibt
keinen Grund dafür, dass Menschen in anderen Teilen der Welt
weniger Recht auf Nutzung der Ressourcen dieser Erde haben sollten
als wir selbst. Wie extrem unterschiedlich die Anteile gegenwärtig
sind, zeigt die jährliche Pro-Kopf-Emission von CO₂. In Deutschland
sind es zehn Tonnen, in Ruanda 0,05. Um diese Situation zu
verändern, braucht es eine große Transformation bei
Produktionsprozessen, Regulierungssysteme und eine Umkehr im Blick
auf unseren ganz persönlichen Lebensstil: Welche Produkte
konsumieren wir? Wie leben wir, ohne die Umwelt zu zerstören? Wie
nehmen wir unsere ökologische Verantwortung wahr?
Wir bekennen Gott als den Schöpfer der Welt. Daraus folgt das
Engagement für die natürlichen Lebensgrundlagen, damit die, mit
denen wir diese Welt teilen und auch zukünftige Generationen die
Möglichkeit zu einem guten Leben haben.“ lk
18.11.2015
„Gewalt ist niemals religiös zu rechtfertigen“
 Bischof Wiesemann bringt in einem Brief an Bischof Pansard
die Verbundenheit mit dem französischen Partnerbistum angesichts
der Terroranschläge von Paris zum Ausdruck
Bischof Wiesemann bringt in einem Brief an Bischof Pansard
die Verbundenheit mit dem französischen Partnerbistum angesichts
der Terroranschläge von Paris zum Ausdruck
Speyer- Nach den Terroranschlägen in Paris
hat der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in einem Brief an
Bischof Michel Pansard von Chartres das Mitgefühl und die
Verbundenheit der Katholiken des Bistums Speyer mit den Menschen in
dem französischen Partnerbistum zum Ausdruck gebracht.
„Die barbarischen, unmenschlichen Terroranschläge von Paris
haben die Menschen auch im Bistum Speyer tief erschüttert. Unser
Mitgefühl gilt besonders den Opfern und ihren Angehörigen. Wir
trauern mit ihnen und allen Menschen, die unter diesem so
menschenverachtenden und brutalen Terror leiden.“
Die Anschläge richteten sich gegen die freiheitliche Kultur, die
Menschlichkeit, die Freiheit und die Grundwerte unserer
Gesellschaft. Die Täter missbrauchten die Religion um ihren Hass
und ihre Zerstörung zu begründen. „Aber Gewalt ist niemals religiös
zu rechtfertigen“, betont Bischof Wiesemann in dem Schreiben.
„Wir treten für ein friedliches Zusammenleben von Menschen
unterschiedlicher Religionen ein - überall.“ Es sei falsch, sich
durch die Terroristen in einen Kampf der Kulturen oder einen
Religionskrieg treiben zu lassen. Stattdessen gehe es darum sich
darauf zu besinnen, „dass Haltungen der Friedfertigkeit, des
Gewaltverzichts und der Dialogbereitschaft für alle Religionen eine
grundlegende Bedeutung haben.“
Weltweit zeigten Menschen als Reaktion auf den Terror Courage,
Solidarität und Mitmenschlichkeit und setzten so ein Zeichen dafür,
dass sie sich nicht dem Terror beugen wollen. „Das bestärkt auch
uns im Vertrauen auf Gott diesen Weg weiterzugehen.“
Weiter schriebt Wiesemann an seinen französischen Amtsbruder:
„Wir beten mit Ihnen für die Opfer und ihre Angehörigen. Wir beten
darum, dass der Geist Christi, der Geist der Versöhnung und Liebe
sich durchsetzt und den Hass vertreibt.“
Text und Foto: is
16.11.2015
Begleiter des Bistums in historischer Zeit
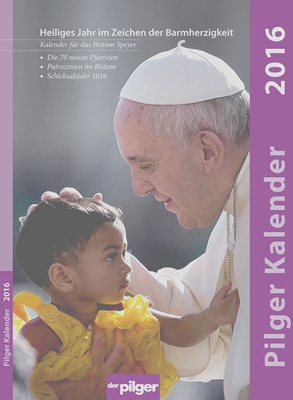 Bereits im 95.
Jahrgang: Pilger-Kalender 2016 liegt vor
Bereits im 95.
Jahrgang: Pilger-Kalender 2016 liegt vor
Speyer- Der Pilger-Kalender 2016 liegt
vor. Er erscheint bereits im 95. Jahrgang und gehört damit zu den
traditionsreichsten Veröffentlichungen in der Pfalz und Saarpfalz.
Breiten Raum im aktuellen Kalender nimmt das Heilige Jahr ein, das
Papst Franziskus für 2016 ausgerufen und unter das Leitwort
Barmherzigkeit gestellt hat. Beiträge ermöglichen einen Blick in
die Geschichte des Heiligen Jahres, beleuchten seine Bedeutung für
die Katholiken in der Welt und stellen die Angebote im Bistum
Speyer vor. Denn auf Wunsch von Papst Franziskus findet das Heilige
Jahr nicht nur in Rom, sondern in allen Diözesen der Weltkirche
statt. Besonders einbezogen sind dabei die diözesanen
Wallfahrtsorte.
Als weiteren inhaltlichen Schwerpunkt stellt der Pilger-Kalender
2016 alle Patrozinien der 70 neuen Pfarreien des Bistums Speyer
vor, die im Rahmen der historischen Neuordnung der Seelsorge
gebildet werden. Ein informativer Grundsatzbeitrag über Geschichte
und Bedeutung von Patrozinien sowie eine Bistumskarte mit allen 70
neuen Pfarreien und Pfarrsitzen komplettieren diesen Teil des
Kalenders. Der Pilger-Kalender beinhaltet wie immer eine breite
Themenpalette von interessanten religiösen, historischen und
hintergründigen Beiträgen.
Der traditionsreiche Bistums- und Heimatkalender für die Pfalz
und Saarpfalz erscheint ab der aktuellen Ausgabe 2016 wieder
vollständig unter dem Dach der Peregrinus GmbH in Speyer, die auch
die Bistumszeitung „der pilger“ herausgibt. Text und Foto:
is
Bestellungen:
Peregrinus GmbH – „der pilger“, Hasenpfuhlstraße 33, 67346 Speyer,
Telefon 06232/31830, Fax 06232/ 318399, Mail: info@pilger-speyer.de. Der
Pilger-Kalender 2016 hat 132 Seiten und kostet 4,80 Euro (zzgl.
1,65 Euro Porto und Verpackung).
16.11.2015
Gegen das Vergessen protestieren
 Christen
rufen am Buß- und Bettag zu Solidarität und Umkehr auf
Christen
rufen am Buß- und Bettag zu Solidarität und Umkehr auf
Kaiserslautern/Speyer- Der pfälzische
Kirchenpräsident Christian Schad fordert die
Christen dazu auf, am Buß- und Bettag ihre Stimme gegen weltweite
Kriege, Verfolgungen und die Auswirkungen des Klimawandels zu
erheben. „Wir müssen umkehren und die Fluchtursachen bekämpfen“,
erklärt Schad. „Unser Gebet ist ein Protest gegen das Vergessen.“
Der Buß- und Bettag ist in der evangelischen Kirche ein Tag der
Besinnung und Neuorientierung. In der Kaiserslauterer Stiftskirche
findet am 18. November um 17 Uhr ein ökumenischer
Solidaritätsgottesdienst zum Thema „Wer ist denn mein Nächster?“
statt.
„Umkehr heißt konkret, die Fluchtursachen zu bekämpfen “,
erklärt Kirchenpräsident Christian Schad anlässlich des Buß- und
Bettages. „Durch unfaire globale Handelsbedingungen, die
Nichtbeachtung von Menschenrechts- und Umweltstandards,
Waffenlieferungen in Spannungsgebiete sowie einen rücksichtslosen
Ressourcen- und Energieverbrauch trägt unser Lebensstil zu den
Ursachen von Flucht bei.“ Wer sich zu Gott als den Schöpfer der
Welt bekenne, müsse sich für die natürlichen Lebensgrundlagen
engagieren, „damit die, mit denen wir diese Welt teilen und auch
zukünftige Generationen die Möglichkeit zu einem guten Leben
haben“.
Für die Vizepräsidentin des rheinland-pfälzischen Landtages,
Barbara Schleicher-Rothmund (Rheinzabern), ist der Buß- und Bettag
„ein Tag, der Raum für Besinnung, Hinterfragen, aber auch für
Dankbarkeit“ gibt. Das Anliegen des Feiertages, zu Umkehr und Gebet
aufzurufen, müsse immer und unabhängig von politischen oder
gesellschaftlichen Ereignissen gelten, meint Schleicher-Rothmund.
Die Rolle der Kirche sei es, zu handeln, zu raten und zu mahnen und
die Richtung vorzugeben, erklärt die SPD-Politikerin, die der
letzten Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz als berufenes
Mitglied angehörte.
Den Vorsteher der Diakonissen Speyer-Mannheim, Günter
Geisthardt, erinnert der Buß- und Bettag „an die Notwendigkeit,
persönliche Fragen und aktuelle Probleme im Zusammenhang des
Glaubens zu bedenken und zu fragen, wo wir unter Umständen
persönlich oder gesellschaftlich auf einem falschen Weg sind – auch
im Gebet“. Die konkreten Anlässe und Herausforderungen wandelten
sich, doch das ursprüngliche Anliegen des Buß- und Bettages bleibe
aktuell, erklärt der Theologe, „gerade wenn Herausforderungen wie
der globale Klimawandel oder die Flüchtlingsströme zum Beten,
Umdenken und Handeln nötigen“. Dabei habe die Kirche der Politik
keine konkreten Problemlösungen vorzuschreiben. „Aber sie hat die
Chance, unter Rückgriff auf die biblischen Überlieferungen andere
Perspektiven und Erfahrungen in öffentliche Debatten einzubringen
als andere Akteure. Dies gilt aktuell ganz besonders für den Umgang
mit Flüchtlingen, der schon im Alten Testament ein wichtiges Thema
ist.“
Am Buß- und Bettag, dem 18. November, feiern die evangelische
und die katholische Kirche zusammen mit dem Deutschen
Gewerkschaftsbund in Kaiserslautern zum zehnten Mal einen
ökumenischen Solidaritätsgottesdienst. Im Mittelpunkt der Feier,
die um 17 Uhr in der Stiftskirche beginnt, steht die Frage „Wer ist
denn mein Nächster?“. Kanzelredner ist Jörg Köhlinger, Leiter des
IG-Metall-Bezirks Mitte. Der Gottesdienst wird mitgestaltet von
Pfarrer Sascha Müller, Pastoralreferent Thomas Eschbach, Dekanin
Dorothee Wüst und DGB-Regionalvorsitzendem Michael Detjen. Claudia
Botzner sorgt an Orgel, Saxofon und Klarinette für den
musikalischen Rahmen.
Der Buß- und Bettag wurde 1532 erstmals in Straßburg eingeführt
und in der Bundesrepublik 1995 zur Finanzierung der
Pflegeversicherung in allen Bundesländern außer in Sachsen als
gesetzlicher Feiertag abgeschafft. In diesem Jahr wird der Buß- und
Bettag am 18. November begangen. Damit endet auch die
Friedensdekade 2015. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto
„Grenzerfahrungen“.lk
14.11.2015
Karl Gerhard Wien wird 80
 Am 14.
November feiert Pfarrer Karl Gerhard Wien, langjähriger Leitender
Direktor der Diakonissen Speyer-Mannheim, seinen 80.
Geburtstag.
Am 14.
November feiert Pfarrer Karl Gerhard Wien, langjähriger Leitender
Direktor der Diakonissen Speyer-Mannheim, seinen 80.
Geburtstag.
Speyer- Der Theologe stand dem
sozialdiakonischen Unternehmen von 1972 bis 2001 vor, begleitete in
seiner Amtszeit zahlreiche Erweiterungsbauten im
Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus Speyer, die Einrichtung des
Hospizes im Wilhelminenstift als erstes stationäres Hospiz in
Rheinland-Pfalz, die Neugestaltung von Bethesda Landau, die
Einweihung der Werkstatt für Menschen mit Behinderung in
Ludwigshafen sowie die Einweihung von Seniorenzentren in Speyer,
Kirchheimbolanden und Homburg. Wien führte außerdem erste
richtungsweisende Gespräche, die drei Jahre nach dem Ende seiner
Amtszeit zur Fusion des Evangelischen Diakonissenkrankenhauses mit
dem städtischen Stiftungskrankenhaus führten. Der gebürtige
Speyerer arbeitete zunächst mit Oberin Diakonisse Hildegard
Kalthoff im Vorstand, ab 1976 mit Sr. Ilse Wendel, anschließend mit
ihrer Nachfolgerin Sr. Elfriede Brassat.
Der Jubilar hat außerdem in verschiedenen Gremien und
Gesellschaften mitgewirkt. Er hatte beispielsweise den Vorsitz im
Hauptausschuss des Diakonischen Werks Pfalz, war Mitglied im
Vorstand und Präsident der Generalkonferenz des Kaiserswerther
Verbandes, Vorsitzender der Krankenhausgesellschaft Rheinland-Pfalz
und Mitglied im Vorstand der Deutschen Krankenhausgesellschaft.
Bis heute ist Karl Gerhard Wien dem Mutterhaus eng verbunden. Er
singt im Chor, pflegt Kontakte zu den Diakonissen und feiert seinen
Geburtstag mit einem Benefizkonzert im Mutterhaus. Text und
Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
12.11.2015
900 000 Euro für zusätzliches Personal in der Flüchtlingshilfe des Bistums Speyer

Caritasverband richtet 15 neue Stellen in der
Beratungsarbeit und Ehrenamtskoordination ein
Speyer- Der Caritasverband für die Diözese Speyer plant 15
neue Personalstellen in der Flüchtlingsarbeit und investiert dafür
rund 900.000 Euro. Das Geld stammt aus dem 1,5 Millionen Euro-Topf
des Bischofs, mit dem dieser die diözesane Hilfsaktion „Teile und
helfe“ im September ausgestattet hatte. Die Aktion ist die Antwort
des Bistums Speyer und seines Caritasverbandes auf die aktuellen
Herausforderungen in der Flüchtlingsarbeit.
Damit steigt der Verband zum einen in die
Asyl-Verfahrensberatung in den Erstaufnahmestellen Speyer, Kusel
und Zweibrücken ein. Zum anderen wird in den acht Caritas-Zentren
die Flüchtlingsberatung in den Bereichen Schwangerschaft und
Migrations- und Sozialberatung erweitert. Auch die Gemeindecaritas
für den Bereich Ehrenamtskoordination wird verstärkt.
Für die Begleitung von Flüchtlingen in einem Stadtteil von
Kaiserslautern, in Landstuhl und im nördlichen Rhein-Pfalz-Kreis
stellt der Verband eigene Sozialarbeiterinnen ein. Auch in den
Warenkorb-Kaufhäusern, wo sowohl die Menge der Sachspenden als auch
deren Nachfrage stark angestiegen sind, wird es personelle
Verstärkung geben.
Über die vom Caritasverband selbst eingebrachte Summe hinaus
werden diese Stellen teilweise durch die Kommunen oder Landkreise
und über Fördermittel des Deutschen Caritasverbandes, des Bundes
und der Europäischen Union gefördert.
Text und Foto: Caritasverband für die Diözese
Speyer
11.11.2015
Broschüre zu neuem Seelsorgekonzept des Bistums Speyer
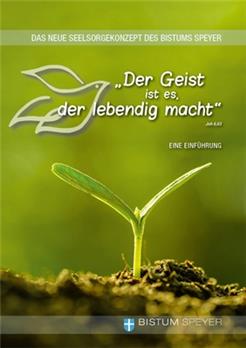 25-seitige
Publikation macht Grundlinien des neuen Seelsorgekonzepts deutlich
– Anregungen für die bisherigen Pfarrgemeinden zum Zusammenwachsen
in der neuen Pfarrei
25-seitige
Publikation macht Grundlinien des neuen Seelsorgekonzepts deutlich
– Anregungen für die bisherigen Pfarrgemeinden zum Zusammenwachsen
in der neuen Pfarrei
Speyer- Das Bistum Speyer hat eine
Broschüre zur Einführung in sein neues Seelsorgekonzept
veröffentlicht. Auf 25 Seiten werden die wesentlichen Inhalte des
Konzepts mit dem Titel „Der Geist ist es, der lebendig macht“
dargestellt. „Die Broschüre ist eine Einladung, die frischen
Impulse im neuen Seelsorgekonzept zu entdecken und daraus neue
Freude am Evangelium zu schöpfen“, empfiehlt Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann die Lektüre.
Das Heft beinhaltet eine Einführung in die Grundlagen, die
verschiedenen Dimensionen und die leitenden Perspektiven der
Seelsorge im Bistum Speyer. Es erläutert das neue Modell der
„Pfarrei in Gemeinden“ und liefert eine Übersicht zu den 70 neuen
Pfarreien, die zu Beginn des Jahres 2016 anstelle der bisher 346
Pfarrgemeinden im Bistum Speyer errichtet werden. Beschrieben
werden unter anderem die Zusammensetzung und die Aufgaben der
Gremien in den neuen Pfarreien. „Durch die Vereinbarung von
Standards für die Seelsorge haben die Pfarreien eine verlässliche
Hilfe und Orientierung bei der Entwicklung ihrer eigenen pastoralen
Konzepte“, erklärt Bischof Wiesemann. Neben Informationen zur
Vermögensverwaltung und den zentralen Pfarrbüros wird auch die
Funktion der neuen Regionalverwaltungen dargestellt. Sie sollen die
Pfarreien künftig von Verwaltungsaufgaben entlasten.
Außerdem vermittelt das Heft Anregungen, wie die bisherigen
Pfarrgemeinden in der neuen Pfarrei zusammenwachsen können. „Wir
geben Impulse, wie die Gemeinden über den eigenen Kirchturm hinaus
Kontakte knüpfen und als größere Gemeinschaft in der neuen Pfarrei
zusammenfinden können“, erläutert Domkapitular Franz Vogelgesang,
der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge des Bischöflichen
Ordinariats. Mehrere Vorschläge und Aktionsideen, zum Beispiel zum
Bibel-Teilen, sollen eine Begegnung und vertiefte
Auseinandersetzung mit den theologischen Schwerpunkten des neuen
Seelsorgekonzepts ermöglichen. is
Die Broschüre „Einführung in das neue Seelsorgekonzept“ ist
erhältlich bei:
Bischöfliches Ordinariat
Kleine Pfaffengasse 16
67346 Speyer
Telefon 06232 / 102-209
info@bistum-speyer.de
10.11.2015
"Unsere geschundene Schöpfung braucht Klimapilger"
 v.l.: Weihbischof Otto Georgens (Bistum Speyer), Dekan Alban Meißner (Katholisches Dekanat Ludwigshafen), Oberkirchenrat Dr. Michael Gärtner (Evangelische Kirche der Pfalz), Dekanin Barbara Kohlstruck (Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen), Hr. Sawatzki (Mennonitengemeinde Ludwigshafen).
v.l.: Weihbischof Otto Georgens (Bistum Speyer), Dekan Alban Meißner (Katholisches Dekanat Ludwigshafen), Oberkirchenrat Dr. Michael Gärtner (Evangelische Kirche der Pfalz), Dekanin Barbara Kohlstruck (Protestantischer Kirchenbezirk Ludwigshafen), Hr. Sawatzki (Mennonitengemeinde Ludwigshafen).
Ökumenischer Gottesdienst zum Auftakt des Klimapilgerweges
von Ludwigshafen nach Metz vom 8. bis 14. November
Ludwigshafen- „Geht doch!“ ist das Motto der
Aktion "Ökumenischer Pilgerweg für Klimagerechtigkeit" und es war
der Titel des ökumenischen Gottesdienstes am Samstagabend in der
Kirche St. Ludwig in Ludwigshafen. Hier feierten Vertreter der
katholischen und protestantischen Kirche sowie der
Mennonitengemeinde gemeinsam einen facettenreichen Auftakt für die
Etappe von Ludwigshafen ins französische Metz, die am heutigen
Sonntagmorgen startete. Für die katholische Kirche wirkten
Weihbischof Otto Georgens und Dekan Alban Meißner mit, für die
Evangelische Kirche der Pfalz Oberkirchenrat Dr. Michael Gärtner
und Dekanin Barbara Kohlstruck.
Mit dem Klimapilgern soll ein Zeichen für die Bewahrung der
Schöpfung, für den Klimaschutz und für mehr globale Gerechtigkeit
gesetzt werden. Auf ihrem Weg machen die Pilger an geistlichen
Orten halt und bei vorbildlichen Klimaschutz-Projekten, stoppen
aber auch an ökologischen "Schmerzpunkten", die zeigen, dass sich
die Menschen weiter intensiv um Klimaschutz kümmern müssen. Mitte
September starteten Pilger in Flensburg in Richtung Paris. Dort
beginnt am 30. November die UN-Klimakonferenz, wo ein neues
internationales Klimaabkommen beschlossen werden soll. Die Etappe
von Ludwigshafen nach Metz ist der südliche Zulauf des
Klimapilgerwegs. Die Aktion Klimapilgern wird von einem breiten
Bündnis aus Landeskirchen, Diözesen, christlichen
Entwicklungsdiensten, Missionswerken und (Jugend-)Verbänden,
einzelnen Personen, Gruppen und Jugendgruppen getragen.
 Weihbischof
Otto Georgens und Oberkirchenrat Michael Gärtner, die die Predigt
in Dialogform hielten, spannten einen weiten Bogen von Jesus bis in
die Gegenwart. Sie erinnerten daran, dass Jesus selbst zum Handeln
aufrief. Seine Jünger folgten der Aufforderung und bewegten Großes:
Durch Worte und Taten schufen sie eine weltumspannende
Gemeinschaft. Der Missionsbefehl, das Evangelium allen Geschöpfen
zu verkünden, gilt nach wie vor, betonte Gärtner. Um das zu
verdeutlichen, beriefen sich der Oberkirchenrat und der Weihbischof
auf Franz von Assisi, der zu allen Geschöpfen – auch Blumen und
Tieren – gepredigt habe. Sie nannten ihn ein Vorbild. "Das
Evangelium verkünden – das geht nur ganzheitlich, mit Blick auf die
Einmaligkeit und Würde eines jeden Geschöpfes", brachte es Otto
Georgens auf den Punkt. "Gottes Heil betrifft nicht nur meine
Seele, sondern die ganze von Gott geschaffene Welt." Gärtner
knüpfte an: Franz von Assisi habe die Menschen nicht aufs Jenseits
vertröstet, sondern im Jetzt gehandelt, weil er an Gott glaubte.
Beide machten deutlich, dass das Klimapilgern als Antwort auf Jesu
Missionsbefehl zu sehen ist. Der Weg der Klimapilger "ist ein
echter Pilgerweg: religiös motiviert und missionarisch
ausgerichtet", betonte der Weihbischof. Gärtner fuhr fort: "Wer als
Klimapilger unterwegs ist, macht ernst mit dem Wort Jesu: 'Geht und
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.'"
Weihbischof
Otto Georgens und Oberkirchenrat Michael Gärtner, die die Predigt
in Dialogform hielten, spannten einen weiten Bogen von Jesus bis in
die Gegenwart. Sie erinnerten daran, dass Jesus selbst zum Handeln
aufrief. Seine Jünger folgten der Aufforderung und bewegten Großes:
Durch Worte und Taten schufen sie eine weltumspannende
Gemeinschaft. Der Missionsbefehl, das Evangelium allen Geschöpfen
zu verkünden, gilt nach wie vor, betonte Gärtner. Um das zu
verdeutlichen, beriefen sich der Oberkirchenrat und der Weihbischof
auf Franz von Assisi, der zu allen Geschöpfen – auch Blumen und
Tieren – gepredigt habe. Sie nannten ihn ein Vorbild. "Das
Evangelium verkünden – das geht nur ganzheitlich, mit Blick auf die
Einmaligkeit und Würde eines jeden Geschöpfes", brachte es Otto
Georgens auf den Punkt. "Gottes Heil betrifft nicht nur meine
Seele, sondern die ganze von Gott geschaffene Welt." Gärtner
knüpfte an: Franz von Assisi habe die Menschen nicht aufs Jenseits
vertröstet, sondern im Jetzt gehandelt, weil er an Gott glaubte.
Beide machten deutlich, dass das Klimapilgern als Antwort auf Jesu
Missionsbefehl zu sehen ist. Der Weg der Klimapilger "ist ein
echter Pilgerweg: religiös motiviert und missionarisch
ausgerichtet", betonte der Weihbischof. Gärtner fuhr fort: "Wer als
Klimapilger unterwegs ist, macht ernst mit dem Wort Jesu: 'Geht und
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.'"
 Georgens und
Gärtner wünschten sich zahlreiche Klimapilger. "Unsere geschundene
Schöpfung braucht Klimapilger", sagte der Weihbischof. Die Welt
brauche Menschen, die auf den Zusammenhang von gravierenden Umwelt-
und gesellschaftlichen Probleme aufmerksam machen und die die
Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zum
Umdenken aufrufen.
Georgens und
Gärtner wünschten sich zahlreiche Klimapilger. "Unsere geschundene
Schöpfung braucht Klimapilger", sagte der Weihbischof. Die Welt
brauche Menschen, die auf den Zusammenhang von gravierenden Umwelt-
und gesellschaftlichen Probleme aufmerksam machen und die die
Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zum
Umdenken aufrufen.
Anschließend sprach ein Klimapilger aus dem Rhein-Main-Gebiet
über seine Erlebnisse und gab symbolisch den Staffelstab an die
Ludwigshafener weiter. Vertreterinnen der evangelischen Jugend
Hessen und Nassau berichteten von ihrer Jugend-Klimakonferenz.
Gemeinsam mit jungen Leuten aus vielen verschiedenen Ländern hatten
sie sich über nachhaltige Projekte informiert. Die Ideen, die sie
sammelten, packten sie symbolisch durch verschiedene Dinge in einen
kleinen Karton und übergaben ihn den Pfälzern mit dem Auftrag, ihn
mit nach Paris zu nehmen.
Was Georgens und Gärtner in ihrer Predigt darlegten, spiegelte
sich in den Fürbitten wider, so der Wunsch, Gott gebe den Menschen
den ernsthaften Willen, die Schöpfung zu bewahren und dass er die
Menschen erkennen lässt, welche Verantwortung sie tragen. Auch in
den Fürbitten kamen die Gäste aus dem Rhein-Main-Gebiet und Hessen
zu Wort.
Dekanin Barbara Kohlstruck vom Protestantischen Kirchenbezirk
Ludwigshafen lobte ausdrücklich die Band "Sanctos & Frieds" für
die musikalische Gestaltung. Text und Fotos: Yvette
Wagner
08.11.2015
Erklärung von Kirchenpräsident Christian Schad zur Entscheidung des Deutschen Bundestages über die Sterbehilfe
 Bremen/Speyer
(lk). Ich begrüße die Entscheidung des Bundestages, die
ein Verbot organisierter Hilfe bei der Selbsttötung ausspricht –
und so Sterbehilfevereinen die Grundlage ihres Handelns entzieht.
Damit wird der geschäftsmäßigen Werbung für den Suizid und den auf
Wiederholung angelegten Angeboten ein Riegel vorgeschoben. Niemand
darf Geschäfte mir der Not von Menschen machen.
Bremen/Speyer
(lk). Ich begrüße die Entscheidung des Bundestages, die
ein Verbot organisierter Hilfe bei der Selbsttötung ausspricht –
und so Sterbehilfevereinen die Grundlage ihres Handelns entzieht.
Damit wird der geschäftsmäßigen Werbung für den Suizid und den auf
Wiederholung angelegten Angeboten ein Riegel vorgeschoben. Niemand
darf Geschäfte mir der Not von Menschen machen.
Anders würde der oft verzweifelte und ambivalente Todeswunsch
nicht mehr als Hilferuf verstanden, sondern es gäbe eine generelle
Norm, ihm zu entsprechen. Der Weg zur Tötung auf Verlangen wäre,
wie die Niederlande und Belgien zeigen, geebnet.
Ich heiße die Entscheidung des Bundestages auch deshalb der
Situation sterbender Menschen angemessen, weil sich damit die
Rechtslage für Ärzte, die in tragischen Ausnahmefällen
Suizidassistenz leisten, nicht verschärft hat. Somit ist die
Differenz zwischen einer generellen Norm bzw. einem verbrieften
Anspruch auf Suizidassistenz einerseits und einer individuellen
Einzelentscheidung andererseits gewahrt.
Auch ist es ein entscheidender Unterschied, ob der behandelnde
Arzt, der ein Vertrauensverhältnis zum Patienten aufgebaut hat,
eine solche Entscheidung trifft, oder ob eine Organisation durch
unbekannte Dritte in bewusst anonymer Atmosphäre Suizidassistenz
leistet.
Dieses Urteil leitet auch dazu an, die Beweggründe, die zum Ruf
nach assistiertem Suizid führen, ernst zu nehmen. Also die Angst,
vor langem, einsamen Sterben bzw. die Angst vor einer medizinischen
Maximalversorgung, die das Sterben unnötig verlängert. Statt
Beihilfe zum Suizid ist vielmehr Hilfe und Nähe beim Sterben
gefordert; auch der situationsgerechte Übergang von einer Therapie
zum palliativen Beistand im Sterben.
Insofern plädiere ich für eine Intensivierung der
Palliativmedizin und eine flächendeckende Versorgung durch
ambulante Hospizdienste bzw. stationäre Hospizhilfe.
06.11.2015
Restaurierungsmaßnahmen am Dom erfolgreich beendet
 Sakristei-Außenwand
und Fenster des Mittelschiffs gereinigt und ausgebessert
Sakristei-Außenwand
und Fenster des Mittelschiffs gereinigt und ausgebessert
Speyer- Während der Sommermonate waren die
Gerüste an den Dom zurückgekehrt. Rechtzeitig vor dem Winter sind
die Arbeiten im Außenbereich nun abgeschlossen und der Dom ist
außen „gerüstfrei“. Ausgebessert und gereinigt wurden die Fenstern
des Obergadens und die Südseite der Sakristei.
An der Außenwand der Sakristei erfolgte die Instandsetzung von
Sandsteinen und Metallteilen, wobei auf die Verwendung historischer
Materialien wie etwa Bleiwolle für Fugen wertgelegt wurde.
An der Südseite wurde geschädigter Sandstein ersetzt und Fugen
neu verbleit. Witterung oder Rostsprengung hatten dem Sandstein
hier zugesetzt. Auch Schäden, die durch Baumaßnahmen früherer
Jahrhunderte entstanden waren, wurden gemildert:Bei den jüngsten
Arbeiten war an Hand von Resten deutlich geworden, dass die
Außenfassade der Sakristei vormals reich mit Gesimsen verziert
gewesen sein muss. Durch das Abschlagen dieser Gesimse wurde die
Wasserableitung gestört. Mittels neuer Solbänke und nach innen
verlegten Fenstergittern wurde der Versuch gemacht, die Situation
zu verbessern. Am Türmchen der Sakristei wurde der zum Teil hohl
liegende Zementputz abgenommen und durch einen Kalkputz
ersetzt.
 So wie die Fenster
eines Wohnhauses dann und wann der Sanierung bedürfen, ist dies
auch bei einer Kathedrale notwendig. Die Obergadenfenster des
Speyerer Doms wurden zuletzt im 19. Jahrhundert komplett erneuert
und nun von Grund auf überarbeitet: gebrochene Glasscheiben wurden
erneuert, die Fenster gereinigt, lose Scheiben fixiert und die
Scheiben im Anschlussbereich der Gewände neu eingeputzt, wobei der
Farbton dem der umliegenden Mauersteine angepasst wurde. Bei den
Arbeiten an den Metallelementen wurden die nach 1960 ergänzten
unteren Bereiche der Fenster in Form und Verbleiung den oberen,
älteren Bereichen angeglichen um ein einheitliches Erscheinungsbild
zu erreichen. Im Rahmen der Restaurierung wurden auch alle Fenster
gereinigt, was bei Wintersonne besonders gut zur Geltung kommt.
So wie die Fenster
eines Wohnhauses dann und wann der Sanierung bedürfen, ist dies
auch bei einer Kathedrale notwendig. Die Obergadenfenster des
Speyerer Doms wurden zuletzt im 19. Jahrhundert komplett erneuert
und nun von Grund auf überarbeitet: gebrochene Glasscheiben wurden
erneuert, die Fenster gereinigt, lose Scheiben fixiert und die
Scheiben im Anschlussbereich der Gewände neu eingeputzt, wobei der
Farbton dem der umliegenden Mauersteine angepasst wurde. Bei den
Arbeiten an den Metallelementen wurden die nach 1960 ergänzten
unteren Bereiche der Fenster in Form und Verbleiung den oberen,
älteren Bereichen angeglichen um ein einheitliches Erscheinungsbild
zu erreichen. Im Rahmen der Restaurierung wurden auch alle Fenster
gereinigt, was bei Wintersonne besonders gut zur Geltung kommt.
 Beide Maßnahmen, die
an der Sakristei und an den Fenstern des Mittelschiffs, gehören zu
immer wiederkehrenden Bauaufgaben am Dom. „Turnusmäßig und ohne
große Überraschungen“ sind die Arbeiten, laut Dombaumeister Mario
Colletto, verlaufen. „Dabei weisen die neuesten Maßnahmen, nämlich
die der Restaurierungen der 1960er Jahre, heute die meisten Schäden
auf. Etwa der Zementputz des Sakristeiturms oder die Verfugungen
aus dieser Zeit“ berichtet der Dombaumeister.
Beide Maßnahmen, die
an der Sakristei und an den Fenstern des Mittelschiffs, gehören zu
immer wiederkehrenden Bauaufgaben am Dom. „Turnusmäßig und ohne
große Überraschungen“ sind die Arbeiten, laut Dombaumeister Mario
Colletto, verlaufen. „Dabei weisen die neuesten Maßnahmen, nämlich
die der Restaurierungen der 1960er Jahre, heute die meisten Schäden
auf. Etwa der Zementputz des Sakristeiturms oder die Verfugungen
aus dieser Zeit“ berichtet der Dombaumeister.
Bedingt durch die Größe der Fläche, aufwendiger
Bauuntersuchungen, der Verwendung historischer Techniken und der
Notwendigkeit, große Gerüste zu errichten, sind Baumaßnahmen am Dom
mit hohen Kosten verbunden. Finanziert wurden Maßnahmen des Jahres
2015 durch das Domkapitel Speyer und die Diözese Speyer, wobei die
im Dom erhobenen Eintrittsgelder in diese Mittel einfließen.
Unterstützung gewährte das Land Rheinland-Pfalz und der
Dombauverein Speyer. „Besonders wertvoll ist für uns das Engagement
des Dombauvereins, der uns regelmäßig und zuverlässig unterstützt“,
so Domkustos Peter Schappert. „Die verlässliche finanzielle
Zuwendung des Vereins hilft uns, auch außerhalb großer
Einzelprojekte eine wichtige Kontinuität beim Bestandserhalt zu
erzielen“.
Foto: Domkapitel Speyer
06.11.2015
3.297 Jahre gelebte Diakonie
 Jubilare mit Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt (l.)
Jubilare mit Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt (l.)
Speyer- 115 Mitarbeitende verschiedener
Einrichtungen der Diakonissen Speyer-Mannheim feiern in diesem Jahr
ihr mindestens 25jähriges rundes Mitarbeiterjubiläum. Viele von
ihnen ließen sich am 4. November im Speyerer Mutterhaus für ihre
25-, 30-, 35-, 40- oder gar 45jährige Betriebszugehörigkeit ehren.
Zusammen bringen sie es auf 3.297 Jahre in dem sozialdiakonischen
Unternehmen.
Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt zollte den Jubilaren
Anerkennung dafür, dass sie ihre Arbeit in den jeweiligen Berufen
„mit Sachverstand, Empathie und Freundlichkeit“ ausfüllen – auch im
Angesicht äußerer Einflüsse, die den Arbeitsalltag belasten
könnten. „Auch diakonische Unternehmen müssen sich auf dem Markt
behaupten“, erklärte Geisthardt bei der Ehrung der langjährig
Mitarbeitenden, brachte aber gleichzeitig Beispiele für das
besondere Miteinander gerade in diakonischen Unternehmen an.
„Stolz, dass es die Diakonissen Speyer-Mannheim mit ihren
vielfältigen Mitarbeitenden gibt“ sei das Diakonische Werk, betonte
Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr, der den Jubilaren Kronenkreuze
in Gold als höchste Anerkennung der Diakonie Deutschland
überreichte. „Sie leben das, was gepredigt wird: Das Vertrauen in
Kirche lebt von diakonischer Arbeit“, sagte Bähr, bevor Michael
Hemmerich die Glückwünsche der Mitarbeitervertretungen der
Diakonissen Speyer-Mannheim und ihrer Gesellschaften überbrachte
und der Abend zu Klängen des Saxofonquartetts „Sax4Fun“
ausklang. Text und Foto: Diakonissen
Speyer-Mannheim
06.11.2015
Gisela Büttner verstorben
 Trauer um ehemalige Beiratsvorsitzende der „Bischöflichen
Stiftung für Mutter und Kind“
Trauer um ehemalige Beiratsvorsitzende der „Bischöflichen
Stiftung für Mutter und Kind“
Speyer/Kaiserslautern-. Im Alter von 88 Jahren
verstarb am 3. November Gisela Büttner, ehemalige
Beiratsvorsitzende der „Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind“
im Bistum Speyer. Die frühere Vizepräsidentin des
rheinland-pfälzischen Landtages und CDU-Landtagsabgeordnete aus
Kaiserslautern war jahrzehntelang nicht nur politisch und
gesellschaftlich sondern auch kirchlich engagiert. Sie setzte sich
besonders für die Förderung von Ehe und Familie und den Schutz
ungeborener Kinder ein. Im Zuge der Neuordnung der kirchlichen
Schwangerenberatung im Jahr 2000 übernahm sie den Vorsitz der
damals neu gegründeten „Bischöflichen Stiftung für Mutter und
Kind“, den sie bis 2010 inne hatte.
In einem Nachruf würdigt Marlies Kohnle-Gros, Vorsitzende des
Beirates der „Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind“, das
Engagement von Gisela Büttner:
„Sie hat diese Aufgabe sehr ernsthaft wahrgenommen und alle
Sitzungen des Beirats akribisch vorbereitet und selbst geleitet.
Bei der Themenauswahl lag ihr ganz besonders der Lebensschutz von
Anfang an am Herzen. Politische Entscheidungen, die den
Lebensschutz aufweichen sollten, hat sie stets kritisch, fachlich
fundiert aber bestimmt kommentiert, in den Beiratssitzungen, in der
Presse und auch durch Briefe an die politischen
Entscheidungsträger. Damit hat sie dem Lebensschutz eine Stimme
verliehen.
Die Beiratsmitglieder hat sie immer wieder damit überrascht,
dass sie an persönlichen Ereignissen wertschätzend Anteil nahm und
den Beirat anlässlich der turnusmäßigen Dezembersitzung in
Kaiserslautern im Anschluss mit ausgesuchten Köstlichkeiten
bewirtete.
Der Beirat der Bischöflichen Stiftung ist tief betroffen und
dankbar für zehn Jahre intensive Zusammenarbeit und das gemeinsame
Ringen um Positionen und Stellungnahmen, die der Würde und den
Rechten der schwangeren Frauen und der Würde und dem Recht des
ungeboren Lebens dienten.“
Für ihr kirchliches Engagement erhielt Gisela Büttner 1996 den
päpstlichen Silvesterorden. 2002 wurde sie von Papst Johannes Paul
II mit dem päpstlichen Gregoriusorden geehrt. Sie war im
Diözesansteuerrat und im Diözesanpastoralrat aktiv. Anlässlich
ihres 80. Geburtstages überreichte Weihbischof Otto Georgens
Büttner das „Ehrenzeichen des Deutschen Caritasverbandes in Gold“.
Sie war außerdem Trägerin der Pirminiusplakette. is
05.11.2015
Kirchengerichtshof verwirft Beschwerde
Rechtsstreit: Landauer Mitglieder können an Sitzungen
der Landessynode teilnehmen
Speyer- Die Beschwerde des Landauer
Pfarrers Friedhelm Hans gegen die Eilentscheidung des Verfassungs-
und Verwaltungsgerichts der Evangelischen Kirche der Pfalz
(Protestantische Landeskirche) ist vom Kirchengerichtshof der EKD
verworfen worden. Somit können die Synodalen des Kirchenbezirks
Landau, Volker Janke, Eberhard Rau und Ulrich Sarcinelli, bis zu
einer endgültigen Entscheidung im laufenden Klageverfahren
weiterhin an den Sitzungen der Landessynode teilnehmen. Der
Kirchengerichtshof habe sich für nicht zuständig erklärt, teilte
Oberkirchenrätin Karin Kessel am Dienstag mit.
In dem Rechtsstreit geht es um die drei von der Bezirkssynode
Landau in die Landessynode gewählten Vertreter – den Landauer Dekan
Volker Janke, Chefarzt Eberhard Rau und Politikwissenschaftler
Ulrich Sarcinelli. Die Wahlen waren von Hans u.a. mit der
Begründung angefochten worden, die beiden weltlichen Vertreter
gehörten keinem Presbyterium an und dies sei in der Wahlsitzung
nicht bekannt gewesen. Dies entspreche nicht dem Wesen der
pfälzischen Landeskirche.
Sowohl Landeskirchenrat als auch Kirchenregierung hatten den
Einspruch des Landauer Pfarrers als unbegründet zurückgewiesen.
Eine Entscheidung über die hiergegen erhobene Klage steht noch aus.
Die neu gewählten Landauer Landessynodalen sollten jedoch erst in
ihre Ämter eingeführt werden, wenn das Verfahren vor dem
Verfassungs- und Verwaltungsgericht der Landeskirche abgeschlossen
sei. Dagegen wiederum hatten die drei Betroffenen mit einem
Eilantrag vor dem Verfassungs- und Verwaltungsgericht um
einstweiligen Rechtsschutz nachgesucht. Das Gericht hatte ihrem
Begehren antragsgemäß stattgegeben und die drei Synodalen vorläufig
zur Landessynode zugelassen. lk
03.11.2015
Schad: Vorbehalte gegenüber Flüchtlingen und Migranten abbauen
 Dekan Peter Butz (links) und Kirchenpräsident Christian Schad gestalteten den Reformationsgottesdienst in der Alexanderskirche in Zweibrücken
Dekan Peter Butz (links) und Kirchenpräsident Christian Schad gestalteten den Reformationsgottesdienst in der Alexanderskirche in Zweibrücken
In seiner Predigt am Reformationstag ruft der pfälzische
Kirchenpräsident zur Nächstenliebe auf
Zweibrücken- Anlässlich des
Reformationsfestes hat der pfälzische Kirchenpräsident Christian
Schad die Protestanten dazu aufgerufen, Mauern und Vorbehalte
abzubauen und den Kontakt zu Flüchtlingen und Migranten zu suchen.
„Laden wir die neuen Bürger in unsere Gemeindehäuser ein. Feiern
wir miteinander und beten wir für sie“, sagte Schad laut
Redemanuskript in seiner Predigt im Reformationsgottesdienst in der
Zweibrücker Alexanderskirche. Im Anschluss an den Gottesdienst
besuchte Schad die Flüchtlingsaufnahme-Einrichtung auf dem
Zweibrücker Flughafen.
Das Reformationsfest sei ein Fest der Freiheit, sagte der
Kirchenpräsident. Christus befreie dazu, andere mit den Augen der
Liebe zu sehen. Freiheit bedeute auch Einsatz für den Nächsten in
Not. Schad appellierte daher an die Gläubigen, den Flüchtlingen
hier Lebenschancen zu ermöglichen. „Die herrliche Freiheit der
Kinder Gottes ist keine Ellbogenfreiheit. Wer von Freiheit redet
und sich damit die soziale Verpflichtung vom Leib halten will, kann
sich ganz bestimmt nicht auf den christlichen Glauben berufen“,
sagte Schad.
Die Freiheitsbotschaft des Evangeliums gelte auch für jene, die
ihrem Glauben und Gewissen folgen wollten, aber daran gehindert
würden; die auf der Flucht seien und an Leib und Seele bedroht
würden, sagte Kirchenpräsident Schad. Zu lange hätten auch Christen
zugeschaut, wie sich in vielen Regionen der Welt Kriege
ausbreiteten und Menschen zur Flucht gezwungen worden seien. Der
Kirchenpräsident sprach denjenigen seinen Dank aus, die den
Flüchtlingen Hilfe leisteten und ihnen ihre Herzen und Türen
öffneten: „So können wir für diese Menschen Heimat werden, damit
sie bei uns neue Wurzeln schlagen.“ Text und Foto: lk
31.10.2015
Gemeinsames Wort der Kirchen zum 75. Jahrestag der Deportation nach Gurs am 22. Oktober 1940
 Wenn wir in diesem Jahr der Deportation jüdischer
Mitmenschen nach Gurs vor 75 Jahren gedenken, dann tun wir dies
nicht nur, um die Erinnerung an diese schrecklichen Geschehnisse
wach zu halten, sondern auch um dafür zu sensibilisieren, dass
solche Gräueltaten nie wieder geschehen dürfen. Gerade auch die
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Blick in andere
Länder fordern uns heraus, uns zu Wort zu melden, wenn die Würde
des Menschen angetastet oder gar mit Füßen getreten wird.
Wenn wir in diesem Jahr der Deportation jüdischer
Mitmenschen nach Gurs vor 75 Jahren gedenken, dann tun wir dies
nicht nur, um die Erinnerung an diese schrecklichen Geschehnisse
wach zu halten, sondern auch um dafür zu sensibilisieren, dass
solche Gräueltaten nie wieder geschehen dürfen. Gerade auch die
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Blick in andere
Länder fordern uns heraus, uns zu Wort zu melden, wenn die Würde
des Menschen angetastet oder gar mit Füßen getreten wird.
Am frühen Morgen des 22. und 23.Oktober 1940 wurden über 6.500
badische, pfälzische und saarländische Juden und Christen jüdischer
Abstammung von den Nazis festgenommen, in Züge verfrachtet und in
das Internierungslager Gurs am Fuße der südfranzösischen Pyrenäen
verschleppt. Dieser Ort wurde so für die jüdischen Mitmenschen aus
unseren Städten und Gemeinden für Alte, Kranke, Männer, Frauen,
Kinder und Babys zum Ort des Verderbens.
Mit dieser verbrecherischen Aktion wurde das jüdische Leben in
Baden, der Pfalz und im Saarland langfristig und grundlegend
zerstört, Mitbürgerinnen und Mitbürger ihrer Heimat beraubt.
Was damals geschah, vollzog sich vor aller Augen. Als die
Gauleiter Badens und der Saarpfalz ihre Gaue stolz als „judenrein“
meldeten, erhoben sich kein Sturm der Entrüstung und kein
wahrnehmbarer Protest. „Der Abtransport ging in aller Ordnung vor
sich“, so notierte lapidar der Freiburger Polizeibericht. Längst
hatte sich angebahnt, was dann bei der berüchtigten
Wannsee-Konferenz 1942 auf den Begriff der Endlösung gebracht
wurde. Für Tausende jüdischer Menschen endete ihr Leidensweg nach
Gurs schließlich in Zügen in die Vernichtungslager von Majdanek,
Sobibor oder Auschwitz.
Die Schwestern und Brüder des jüdischen Gottesvolkes feierten in
jenen Tagen, in denen sie die Deportation erleiden mussten, das
Laubhüttenfest: die Bewahrung des Volkes Israels auf seinem Zug
durch die Wüste, aus der Knechtschaft ins Land der Verheißung. Doch
die Oktobertage des Jahres 1940 verkehrten diesen jüdischen
Freiheitszug in einen Trauermarsch der Diffamierten und
Entrechteten.
Anlässlich des diesjährigen Jahrestages der Deportation erkennen
und bekennen wir: Kirchen und Christenmenschen haben zur Bedrohung
und Vernichtung jüdischen Lebens in der deutschen Geschichte allzu
oft geschwiegen oder sie gar befördert. Auch vor 75 Jahren war das
nicht anders. Tatenlos standen die Kirchen dem Geschehen gegenüber,
wo entschlossenes Handeln gefragt gewesen wäre; sprachlos dort, wo
der Aufschrei der Kirchen hätte hörbar werden müssen.
Im Gedenken an die Opfer bekennen wir heute ohne Wenn und Aber
unsere Schuld.
In ökumenischer Verbundenheit suchen wir heute Wege, um unsere
Beziehung zu Israel und zum Judentum zu erneuern. Dabei trägt uns
die Einsicht in die unverbrüchliche Geltung des Bundes Gottes mit
seinem Volk. Die Kirchen, die zu „Gurs“ geschwiegen haben, erheben
heute ihre Stimme gegen Antisemitismus und Rassismus, treten ein
für die Rechte anderer und rufen auf zu politischer Wachsamkeit und
Zivilcourage.
Unsere Kirchen in der Pfalz und in Baden begrüßen und fördern
nach Kräften Initiativen und Einrichtungen, die sich der
Neugestaltung des Verhältnisses von Judentum und Christentum widmen
und Begegnungen zwischen jüdischen und christlichen Menschen
ermöglichen.
Sie unterstützen die Bemühungen aller Menschen guten Willens,
das menschenverachtende Geschehen von Gurs nicht dem Vergessen zu
überlassen. Hoffnungsvoll blicken wir auf die Bereitschaft vieler
junger Menschen, das Wahrnehmen und Aufarbeiten der Schuld in der
Vergangenheit mit einem Erinnern zu verbinden, das auch die
Gegenwart und die Zukunft Israels und des Judentums im Blick hat.
Dafür steht als Beispiel das Ökumenische Jugendprojekt Mahnmal in
Neckarzimmern.
Möge das Gedenken an „Gurs“ im Jahre 2015 ein weiterer
Meilenstein auf dem Weg zu gegenseitiger Achtung, zu Respekt und
Geschwisterlichkeit zwischen jüdischen und christlichen Menschen
werden. Möge der Wunsch aus Psalm 122 in Erfüllung gehen: Friede
wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit.
Landesbischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh
Evangelische Landeskirche in Baden
Erzbischof Stephan Burger Erzdiözese Freiburg
Kirchenpräsident Christian Schad Evangelische Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche)
Bischof Dr.Karl-Heinz Wiesemann Diözese Speyer
24.10.2015
Joachim Weller wird neuer Domkantor am Speyerer Dom
 Auf den
Nachfolger von Alexander Lauer warten vielfältige musikalische
Aufgaben
Auf den
Nachfolger von Alexander Lauer warten vielfältige musikalische
Aufgaben
Speyer- Jochim Weller wird zum 1. September
neuer Domkantor am Speyerer Dom. Das hat das Domkapitel
beschlossen. Joachim Weller tritt die Nachfolge von Alexander Lauer
an, der zum Domkapellmeister am St.-Paulus-Dom in Münster berufen
wurde.
Joachim Weller (26) stammt aus Steinebach/Sieg im Westerwald. Ab
1998 erhielt er Klavierunterricht bei Prof. Natalie Zinzadse in
Aachen. Mit zwölf Jahren nahm er den ersten Orgelunterricht.
Im Dezember 2004 wurde er mit dem „Förderpreis für junge
Musiker“ der „Arndt-Adorf-Stiftung“ in Betzdorf/Sieg ausgezeichnet.
Von 2005 bis 2009 war Joachim Weller Jungstudent an der Hochschule
für Musik und Tanz Köln bei Prof. Johannes Geffert im Fach Orgel.
Zudem ist er mehrfacher Preisträger auf Landes- und Bundesebene des
Wettbewerbs „Jugend musiziert“ in den Kategorien Orgel Solo,
Duowertung und Klavierbegleitung.
Nach dem Abitur absolvierte Joachim Weller ein Freiwilliges
Soziales Jahr an der Kölner Dommusik/Musikschule des Kölner
Domchores. Außerdem ist er Stipendiat des Richard-Wagner-Verbandes
Siegen. Derzeit studiert er im Masterstudiengang Kirchenmusik sowie
Lehramt Musik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln in der
Orgelklasse von Prof. Johannes Geffert und Domorganist Prof. Dr.
Winfried Bönig, sowie in der Chorleitungsklasse von Prof. Robert
Göstl und Prof. Reiner Schuhenn.
Regelmäßige Orgelkonzerte - unter anderem als Solist gemeinsam
mit dem Heidelberger Kantatenorchester und im Rahmen des
Kultursommers Rheinland-Pfalz - ergänzen seine musikalische
Ausbildung. Von 2010 bis 2014 wirkte er als Organist und Chorleiter
in der Pfarrei „Sankt Marien“ in Hachenburg im Westerwald. Seit
Januar 2014 leitet Joachim Weller den Kammerchor Essen-Kettwig und
arbeitet seit Februar 2014 als musikalischer Assistent des
Domkapellmeisters Prof. Eberhard Metternich am Hohen Dom zu
Köln.
Als Domkantor gehört Joachim Weller dem Team der Dommusik unter
Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori an. Zu seinen
Aufgaben zählen unter anderem die Organisation der Kantorendienste
in der Domliturgie, die Unterstützung der Probenarbeit im Domchor,
die Mitarbeit in der Domsingschule und bei der Stimmbildung der
Chöre, die Betreuung von Gastchören und -ensembles und die
Stellvertretung des Domkapellmeisters. Text und Foto:
is
22.07.2015
Mit Handwerk und Herzwerk Menschen stark machen
 Die frisch examinierten Erzieherinnen und Erzieher mit Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter (rechts) und Michael Wendelken, Leiter des Diakonissen Ausbildungszentrums Gesundheit und Soziales (links)
Die frisch examinierten Erzieherinnen und Erzieher mit Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter (rechts) und Michael Wendelken, Leiter des Diakonissen Ausbildungszentrums Gesundheit und Soziales (links)
Speyer- 107 Schülerinnen und Schüler der
Diakonissen Fachschule für Sozialwesen haben in dieser Woche ihre
Abschlüsse in den Bereichen Erziehung und Sozialassistenz
gefeiert.
82 Erzieherinnen und Erzieher haben am 21. Juli ihre Examen an
der Diakonissen Fachschule für Sozialwesen gefeiert, darunter
erstmals auch Schülerinnen und Schüler der berufsbegleitenden
Ausbildung. Bereits einen Tag zuvor erhielten 25
Sozialassistentinnen und –assistenten ihre Zeugnisse.
Die Sozialassistenten hätten in ihrer zweijährigen Ausbildung an
einer evangelischen Schule gelernt, den ganzen Menschen mit Körper,
Geist und Seele wahrzunehmen, betonte Schulleiter Pfarrer Matthias
Kreiter anlässlich der Zeugnisvergabe im Mutterhaus der Diakonissen
Speyer-Mannheim. Den Erziehern gab er nach dreijähriger Ausbildung
mit auf den Weg: „Sie beherrschen Ihr Handwerk und Ihr Herzwerk.
Mit Ihrem Können machen Sie Menschen stark, Sie fördern die
Eigenständigkeit, das Selbstbewusstsein, die Freude am Leben und an
der Gemeinschaft mit anderen Menschen.“ Stellvertretend für den
Vorstand der Diakonissen Speyer-Mannheim hob auch Oberin Sr.
Isabelle Wien das Engagement der Absolventinnen und Absolventen für
die Fragen des Lebens von Kindern und Jugendlichen hervor. Sie
verlieh ihrer Freude darüber Ausdruck, „dass in unserer Schule
neben allem Fachlichen auch das Diakonische lebt.“
Sechs Schülerinnen und Schüler wurden vom Förderverein der
Fachschule, vertreten durch Vorsitzende Hannelore Heidelberger, für
herausragende Noten oder besonderes soziales Verhalten
ausgezeichnet, bevor die frisch Examinierten mit Familie, Freunden,
Lehrern und Praxisanleiterinnen ihren Schulabschluss feierten.
Informationen zur Ausbildung: www.diakonissen.de Text
und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
22.07.2015
Flüchtlingshilfefonds des Bistums stark nachgefragt
 Mit Mitteln aus dem Flüchtlingshilfefonds des Bistums werden auch Ehrenamtsprojekte, wie Sprachpatenschaften für Kinder finanziert.
Mit Mitteln aus dem Flüchtlingshilfefonds des Bistums werden auch Ehrenamtsprojekte, wie Sprachpatenschaften für Kinder finanziert.
Finanzierung von Sprachkursen mit 42.000 Euro
Speyer- Vor einem Jahr hat der Bischof von Speyer,
Karl-Heinz Wiesemann, einen Hilfefonds für Flüchtlinge aufgelegt
und zunächst mit 50 000 Euro ausgestattet. Mittlerweile sind rund
143 000 Euro in den Fonds gespendet worden. Derzeit sind noch rund
72 000 Euro im Topf und weitere Anträge auf Unterstützung sind
gestellt. „Der Topf darf niemals leer werden“, hatte Wiesemann sich
bei der Einrichtung des Fonds gewünscht.
„Da Flüchtlinge ohne Aufenthaltstitel kein Anspruch auf
Sprachförderung haben, entfällt der größte Teil der finanziellen
Unterstützung auf Sprachkurse“, erklärt der Vorsitzende des
Caritasverbandes, Karl-Ludwig Hundemer. Der Caritasverband
verwaltet den Fonds und entscheidet über die Vergabe der
Mittel.
„Bisher haben wir mit rund 42 000 Euro 30 Sprachkurse anbieten
können und so rund 500 Flüchtlingen die ersten Schritte in die
deutsche Sprache möglich gemacht.“ Ein weiterer großer Posten
entfalle auf Familienzusammenführungen. „Mit etwa 14 000 Euro
konnten wir elf Familien helfen, wieder zusammenzuleben. Da fallen
dann auch Reisekosten und Anwaltskosten drunter“, so der
Caritasvorsitzende. Rund 10 000 Euro entfielen auf
Rechtsanwaltskosten im Zusammenhang mit Asylrechtsfragen.
Einzelfallhilfen, wie zum Beispiel die Überführung eines Leichnams
in die Heimat kosteten rund 8500 Euro und Projekte Ehrenamtlicher
zur Unterstützung der Flüchtlingsarbeit schlugen mit rund 8000 Euro
zu Buche.
„Die Mittel in dem Fonds kommen aus ganz unterschiedlichen
Quellen“, freut sich der Bischof. So spendete der Katholische
Krankenpflegeverein Friesenheim 5000 Euro, aus der Kollekte der
Katholikentags kamen 4600 Euro rund 2800 Euro spendeten alleine in
diesem Jahr Leser der Kirchenzeitung „Der Pilger“ über die Aktion
Silbermöwe. „Und natürlich kommen auch immer wieder kleinere
Spenden von Einzelpersonen, über die ich mich auch sehr freue“,
sagt Wiesemann. „Denn für manchen sind die zehn Euro, die er gibt,
viel Geld.“
„Für den Fonds gibt es Vergaberichtlinien, nicht allen Anträgen
können wir stattgeben“, beschreibt der Caritasvorsitzende Hundemer.
„Partizipieren können alle bei uns lebenden Flüchtlinge. Es werden
Gruppenangebote, Ehrenamtshilfen und Einzelfallhilfen gewährt.“ Vor
einer Antragstellung an den Fonds müssten aber alle anderen
Rechtsansprüche und daraus resultierende finanzielle Hilfen
ausgeschöpft werden. „Sind staatliche Sozialleistungen beantragt,
aber noch nicht gewährt, können Mittel aus dem Fonds ausbezahlt
werden. Diese sind aber nach Erhalt des Geldes
zurückzuzahlen“, erklärt Hundemer. Und: Anträge müssen von
katholischen Initiativen in der Diözese Speyer, die sich um
Flüchtlinge kümmern, sowie von Mitarbeitern der Caritas-Zentren
kommen.
Die Flüchtlingshilfe ist mittlerweile auch in den Pfarreien des
Bistums angekommen. In allen Dekanaten sind Ehrenamtliche in der
Flüchtlingsarbeit engagiert. Von ärztlicher Betreuung von
Flüchtlingen über einen kostenlosen Friseur, Hilfe bei
Wohnungsrenovierung, Sprachpatenschaften für Kinder, Begleitung zu
Ärzten und Ämtern, bis hin zu Hochschulberatung für
zugewanderte Akademiker, internationale Kochfeste und
Fahrradwerkstätten reicht das ehrenamtliche Engagement, für das
auch Mittel aus dem Flüchtlingshilfefonds zum Einsatz kommen.
Text und Bild: Caritasverband f. d. Diözese Speyer,
CariNet
20.07.2015
Neue Synode bestätigt mit „überwältigender Mehrheit“ Impulspapier des Vorgängergremiums
 „Ermutigende und
wichtige Signale gesetzt“
„Ermutigende und
wichtige Signale gesetzt“
Speyer- (lk). Zum Abschluss der
konstituierenden Sitzung der in Speyer tagenden 12. Landessynode
der Evangelischen Kirche der Pfalz haben Synodalpräsident Hermann
Lorenz und Kirchenpräsident Christian Schad es als „ermutigend“
bezeichnet, dass die Synode das von dem Vorgängergremium
erarbeitete Impulspapier „Mutig voranschreiten“ mit überwältigender
Mehrheit bestätigt habe.
Damit greife die neue Synode auch die Impulse zur
Weiterentwicklung des Dekans- und des Pfarramtes auf und bringe den
Umwandlungsprozess in der Landeskirche voran, sagten Lorenz und
Schad. „Die Synode hat wichtige Signale gesetzt und es ist spürbar,
dass wir jetzt zur Tat schreiten können“, sagte Schad. Das Konzept
des Papiers, von bisher nebeneinender stehenden „Säulen“ zu einer
Vernetzung der kirchlichen Arbeitsfelder zu kommen, finde seine
uneingeschränkte Unterstützung, erläuterte Lorenz.
Der am zweiten Verhandlungstag zum neuen Synodalpräsidenten
gewählte 67-jährige Jurist Hermann Lorenz fühlt sich durch das
Abstimmungsergebnis getragen „auf einer Welle des Vertrauens“. „Ich
strebe nicht nach persönlichen Ehren. Ich möchte dem Ganzen
dienen“, sagte der 67-jährige Rechtsanwalt im Ruhestand aus
Kaiserslautern.
Die 12. Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz nach
1945 hatte von Donnerstag bis Samstag in Speyer getagt. In der
konstituierenden Sitzung waren u.a. das Präsidium mit dem
Synodalpräsidenten sowie die synodalen Mitglieder der
Kirchenregierung gewählt sowie die Ausschüsse besetzt worden,
die für besondere Sachgebiete zuständig sind. Bild und Text:
Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche),
Presse
19.07.2015
Zahl der Gläubigen im Bistum geht um rund 7.000 zurück – Austritte auf neuem Höchststand
 Statistische Angaben für das Jahr 2014 liegen vor
Statistische Angaben für das Jahr 2014 liegen vor
Speyer- (is). Das Sekretariat der
Deutschen Bischofskonferenz hat die aktuelle Statistik für das Jahr
2014 veröffentlicht. Die Zahl der Gläubigen im Bistum Speyer lag
der Statistik zufolge bei rund 550.000 Katholikinnen und
Katholiken. Das sind rund 7.000 Gläubige weniger als im Jahr zuvor.
Der Anteil der Gottesdienstbesucher hat sich von 8,9 Prozent im
Jahr 2013 auf 9,3 Prozent im Jahr 2014 leicht erhöht.
Bei den Taufen, Erstkommunionkindern, Firmungen, Trauungen und
Bestattungen bewegen sich die Zahlen in etwa auf Vorjahresniveau.
Auch die Zahl der Eintritte und Wiederaufnahmen sind auf niedrigem
Niveau stabil geblieben. Dagegen erreicht die Zahl der Austritte
mit rund 5.400 ausgetretenen Gläubigen einen neuen Höchstwert, der
die Zahl des Vorjahres um rund 1.000 übersteigt. „Die Entwicklung
im Bistum Speyer spiegelt den bundesweiten Trend wider“, erklärt
Pressesprecher Markus Herr. Das Bistum bedauere die hohe Zahl von
Menschen, die im Jahr 2004 aus der Kirche ausgetreten sind, „weil
sie sich offenbar nicht mehr ausreichend angesprochen und
beheimatet gefühlt haben“. In der hohen Zahl der Austritte zeigt
sich nach seiner Einschätzung eine rückläufige Kirchenbindung, aber
auch die kumulierte Wirkung der Debatten, die zu den Themen
Missbrauch und kirchliches Vermögen in den vergangenen Jahren
geführt wurden. „Wir gehen davon aus, dass der Trend durch das neue
Erhebungsverfahren der Kirchensteuer auf Kapitalerträge zusätzlich
verstärkt wurde“, so Markus Herr.
Als Konsequenz will das Bistum Speyer die Evangelisierung und
die Öffnung über die Kerngemeinden hinaus, wie sie im neuen
Seelsorgekonzept des Bistums vorgedacht sind, weiter vorantreiben.
„Mit dem Modell der ‚Pfarrei in Gemeinden‘ haben wir als Bistum
einen Weg gewählt, der die Kräfte auf der Ebene der Pfarreien
bündelt und gleichzeitig ein aktives kirchliches Leben vor Ort in
den Gemeinden ermöglicht“, so der Bistumssprecher.
Lesen Sie auch hier den Flyer als PDF  PDF und Text: Bistum Speyer, Presse
PDF und Text: Bistum Speyer, Presse
19.07.2015
Alessa Holighaus und Dominic Blauth als Jugendvertreter in die Landessynode berufen
 Studenten vertreten Belange der Jugend
Studenten vertreten Belange der Jugend
Speyer- (lk). Die 24–jährige Studentin
Alessa Holighaus aus Kaiserslautern und der 26-jährige Student
Dominic Blauth aus Ludwigshafen sind am Freitag von der Synode der
Evangelischen Kirche der Pfalz als Jugendvertreter in das
Kirchenparlament berufen worden.
Holighaus und Blauth waren dafür von der Evangelischen
Landesjugendvertretung vorgeschlagen worden. Die Synode folgte den
Berufungen der beiden Jugendvertreter einstimmig. Holighaus
studiert Theologie in Mainz, Blauth Physik und Theologie in
Heidelberg. Beide gehören u.a. dem Landessprecherkreis der
evangelischen Jugend an.
Alessa Holighaus ist seit 2004 in der Evangelischen Jugend auf
Pfalz- und auf  Landesebene aktiv. Als berufene Jugendvertreterin freue
sie sich darauf, die Interessen der Evangelischen Jugend in der
Landessynode vertreten zu können, so Holighaus.
Landesebene aktiv. Als berufene Jugendvertreterin freue
sie sich darauf, die Interessen der Evangelischen Jugend in der
Landessynode vertreten zu können, so Holighaus.
Dominic Blauth ist über seine Mitarbeit in der evangelischen
Jugend Ludwigshafen in den Landessprecherkreis gekommen. Auch er
will in der Landessynode die Belange junger Menschen einbringen.
Dies sei eine „spannende Aufgabe“, findet der Student.
Zu den Stellvertretern von Alessa Holighaus und Dominic Blauth
in der Synode wurden Caroline Theobald (21) aus Schifferstadt,
Isabelle Werz (24) aus Gommersheim, Katharina Hoffmann (19) aus
Kaiserslautern und Stefan Behrens (24) aus Ludwigshafen bestimmt.
Bild und Text: Evangelische Kirche der Pfalz (Protestantische
Landeskirche), Presse
19.07.2015
Sehnsucht nach der Einheit der Christen immer stärker gewachsen
 Domkapitular
Franz Vogelgesang spricht Grußwort zur Landessynode der
Evangelischen Kirche der Pfalz / Bischof Wiesemann sendet
persönliche Glückwünsche an neu gewählten
Synodalpräsidenten
Domkapitular
Franz Vogelgesang spricht Grußwort zur Landessynode der
Evangelischen Kirche der Pfalz / Bischof Wiesemann sendet
persönliche Glückwünsche an neu gewählten
Synodalpräsidenten
Speyer- (is). Die ökumenische Bewegung
ist nach den Worten von Domkapitular Franz Vogelgesang mit der
sichtbaren Einheit der Kirchen noch nicht abgeschlossen. „Das ist
nicht das letzte Ziel“, sagte Vogelgesang in einem Grußwort
anlässlich der konstituierenden Sitzung der 12. ordentlichen
Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz, die derzeit in der
Evangelischen Diakonissenanstalt in Speyer stattfindet. Die Sorge
um das gemeinsame Haus der Schöpfung und der Einsatz für Frieden
und Gerechtigkeit seien die Orte, „an denen Kirche ihre wahre
Bestimmung findet und sich bewähren muss“. Das Reformationsjubiläum
2017 als gemeinsames Christusfest werde „ökumenische
Hoffnungszeichen“ setzen, sagte Vogelgesang. „Noch vor zwei
Generationen waren wir wie Gefangene in Vorurteilen gegenüber den
anderen Konfessionen.“ Seitdem sei die Sehnsucht nach der Einheit
der Christen immer stärker gewachsen. „Mag uns der ökumenische Weg
bisweilen wie eine Steilwand erscheinen – wir sind entschlossen,
ihn gemeinsamen zu gehen“, so Vogelgesang.
 Zum neuen Präsident
der Synode wurde der Jurist Hermann Lorenz aus Kaiserslautern
gewählt. Er tritt die Nachfolge von Henri Franck an, der nach zwei
Legislaturperioden in diesem Amt nicht mehr kandidiert hatte.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann gratulierte dem neu gewählten
Synodalpräsident in einem persönlichen Schreiben und wünschte ihm
„persönlich wie auch im Namen aller katholischen Schwestern und
Brüder im Bistum Speyer Gottes reichen Segen für seine neue,
verantwortungsvolle Aufgabe“. Im Verlauf der letzten Landessynode
haben Landeskirche und Bistum aus Sicht des Bischofs „wichtige
ökumenische Schritte auf dem Weg hin zur sichtbaren Einheit aller,
die in Christus glauben, zurückgelegt“. Mit dem Ökumenischen
Kirchentag 2015 in Speyer sei ein „begeisterndes Zeugnis unserer
Auferstehungshoffnung und unseres Glaubens an den Leben spendenden
Gott“ gegeben worden. Der „Leitfaden für das ökumenische
Miteinander“, der im Rahmen des Ökumenischen Kirchentags
unterzeichnet wurde, habe der Ökumene auf Ebene der
Kirchengemeinden und Pfarreien eine höhere Verbindlichkeit und neue
Impulse verliehen. „Auf diesem Weg wollen wir auch in den kommenden
Jahren weiter vorangehen, getragen von der Überzeugung: Der Weg
unserer Kirchen in die Zukunft muss durch und durch ökumenisch
geprägt sein. Nur so können wir als Christen in unserer Welt
glaubwürdig bleiben“, so der Bischof, der in seinem Schreiben an
Synodalpräsident Hermann Lorenz den Wunsch des Bistums Speyer nach
einer weiteren „Förderung und Vertiefung der guten ökumenischen
Beziehungen“ unterstreicht.
Zum neuen Präsident
der Synode wurde der Jurist Hermann Lorenz aus Kaiserslautern
gewählt. Er tritt die Nachfolge von Henri Franck an, der nach zwei
Legislaturperioden in diesem Amt nicht mehr kandidiert hatte.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann gratulierte dem neu gewählten
Synodalpräsident in einem persönlichen Schreiben und wünschte ihm
„persönlich wie auch im Namen aller katholischen Schwestern und
Brüder im Bistum Speyer Gottes reichen Segen für seine neue,
verantwortungsvolle Aufgabe“. Im Verlauf der letzten Landessynode
haben Landeskirche und Bistum aus Sicht des Bischofs „wichtige
ökumenische Schritte auf dem Weg hin zur sichtbaren Einheit aller,
die in Christus glauben, zurückgelegt“. Mit dem Ökumenischen
Kirchentag 2015 in Speyer sei ein „begeisterndes Zeugnis unserer
Auferstehungshoffnung und unseres Glaubens an den Leben spendenden
Gott“ gegeben worden. Der „Leitfaden für das ökumenische
Miteinander“, der im Rahmen des Ökumenischen Kirchentags
unterzeichnet wurde, habe der Ökumene auf Ebene der
Kirchengemeinden und Pfarreien eine höhere Verbindlichkeit und neue
Impulse verliehen. „Auf diesem Weg wollen wir auch in den kommenden
Jahren weiter vorangehen, getragen von der Überzeugung: Der Weg
unserer Kirchen in die Zukunft muss durch und durch ökumenisch
geprägt sein. Nur so können wir als Christen in unserer Welt
glaubwürdig bleiben“, so der Bischof, der in seinem Schreiben an
Synodalpräsident Hermann Lorenz den Wunsch des Bistums Speyer nach
einer weiteren „Förderung und Vertiefung der guten ökumenischen
Beziehungen“ unterstreicht.
Bild und Text: Bistum Speyer, Presse
18.07.2015
Hermann Lorenz ist neuer Synodalpräsident
 Jurist aus
Kaiserslautern tritt die Nachfolge von Henri Franck an – Präsidium
gewählt
Jurist aus
Kaiserslautern tritt die Nachfolge von Henri Franck an – Präsidium
gewählt
Speyer- (lk). Hermann Lorenz aus
Kaiserslautern ist neuer Präsident der Synode der Evangelischen
Kirche der Pfalz. Der 67-jährige Jurist ist am Freitag mit 50 von
61 abgegebenen Stimmen gewählt worden. Vier Stimmen waren ungültig,
sieben Synodale haben mit Nein gestimmt. Lorenz war einziger
Kandidat. Er tritt damit die Nachfolge von Henri Franck an, der
nach zwei Legislaturperioden in diesem Amt nicht mehr kandidiert
hat. Lorenz versteht das Amt des Synodalpräsidenten als Dienst an
der Kirche, die ihm „sehr am Herzen“ liege. Diese Aufgabe werde er
gewissenhaft erfüllen.
Hermann Lorenz ist seit 2003 Mitglied der Landessynode, 2013
wurde er zum Vizepräsidenten gewählt. In den letzten beiden
Legislaturperioden gehörte er dem Ausschuss für Recht,
Kirchenordnung und Gleichstellung an, seit 2009 war er
stellvertretendes Mitglied der Kirchenregierung.
Als Vorsitzender der Bezirkssynode Kaiserslautern und als
Prädikant ist Lorenz in kirchlichen Ehrenämtern aktiv. Er stehe
voll hinter dem presbyterial-synodalen System der Landeskirche, so
Lorenz anlässlich seiner Wahl. „Ich bin aus der Mitte der Synode
heraus gewählt worden und bleibe Synodaler – nur mit besonderer
Funktion. Nicht mehr und nicht weniger.“ Neben seinen kirchlichen
Ehrenämtern ist der Rechtsanwalt im Ruhestand auch begeisterter
Sänger: Im ökumenischen Kirchenchor Kindsbach, der von seiner Frau
Gisela Glas-Lorenz geleitet wird, und im Vokalensemble
Kaiserslautern.
Fünfköpfiges Präsidium gewählt
Als Synodalpräsident leitet Lorenz das fünfköpfige Präsidium,
dessen Mitglieder für die Amtsperiode 2015 bis 2020 ebenfalls
gewählt wurden. Neuer erster Vizepräsident ist der Otterbacher
Dekan Matthias Schwarz. Der 50-Jährige erhielt 54 Ja-Stimmen, sechs
Synodale votierten gegen ihn, es gab eine Enthaltung. Zum zweiten
Vizepräsidenten wählte die Synode den 59-jährigen Juristen und
Ministerialbeamten Joachim Schäfer aus Birkenheide im Kirchenbezirk
Bad Dürkheim. Auf Schäfer entfielen 46 Ja- und 13 Nein-Stimmen,
eine Stimme war ungültig, es gab eine Enthaltung. Als
Beisitzerinnen fungieren Daniela Freyer aus Homburg und Rommi
Keller-Hilgert aus Finkenbach-Gersweiler im Kirchenbezirk
Donnersberg.
Nach der Verfassung der Landeskirche leitet der Präsident oder
einer der Vizepräsidenten die Verhandlungen der Synode Das
Präsidium beschließt den Arbeitsplan und sorgt für den
ordnungsgemäßen Ablauf der Synodaltagung.
Der 12. ordentlichen Landessynode der Evangelischen Kirche der
Pfalz nach 1945 gehören 62 Mitglieder an, davon 22 Geistliche. Ihre
Amtszeit beträgt sechs Jahre. Als Volksvertretung der Landeskirche
trifft sie Entscheidungen in den geistlichen, rechtlichen und
finanziellen Bereichen der Landeskirche. Unter anderem genehmigt
sie den Haushalt der Landeskirche und wählt den Kirchenpräsidenten
sowie die fünf Oberkirchenräte. Zu Beginn ihrer Amtszeit bestimmt
sie aus ihrer Mitte ein Präsidium und die synodalen Mitglieder der
Kirchenregierung.
Hinweis: Die Landessynode der Evangelischen Kirche der
Pfalz tagt bis Samstag, 18. Juli, in der Evangelischen
Diakonissenanstalt in Speyer, Hilgardstraße 26. Die öffentliche
Plenarsitzung am Samstag beginnt um 11 Uhr. Mehr zum Thema auf
www.evkirchepfalz.de.
Bild und Text: EVANGELISCHE KIRCHE DER PFALZ,
Presse
18.07.2015
Synode eröffnet: „Sich mit Gottvertrauen den Herausforderungen stellen“

Ansprache des Kirchenpräsidenten – Flüchtlingsfrage als
epochale Herausforderung benannt
Speyer- Der Umgang mit Flüchtlingen ist
nach den Worten von Kirchenpräsident Christian Schad nicht nur eine
„epochale Herausforderung“ für Europa, sondern auch eine zentrale
humanitäre Aufgabe für die evangelische Kirche. In seiner Ansprache
zur konstituierenden Sitzung der zwölften Landessynode der
Evangelischen Kirche der Pfalz und in seiner Predigt im
Eröffnungsgottesdienst sagte Schad am Donnerstag, es sei Aufgabe
der Kirche, „an die ethischen Grundorientierungen zu erinnern, die
unser Zusammenleben ausmachen“. Der Kirchenpräsident ging vor der
in Speyer tagenden Synode auch auf die zwei Höhepunkte dieser
Legislaturperiode ein: das Reformationsjubiläum 2017 und das
Unionsjubiläum 2018. Den Ehren- und Hauptamtlichen in den
Presbyterien und den Bezirkssynoden sowie in der Landessynode
sprach er seinen Dank dafür aus, dass sie bereit seien,
Leitungsverantwortung zu übernehmen. „Ihr Engagement ist
beispielhaft und ermutigend!“
Die pfälzische Landeskirche müsse sich nüchtern den anstehenden
Veränderungen stellen, führte Kirchenpräsident Schad aus. Auch
diese Synode werde sich mit der Frage beschäftigen, wie die Kirche
trotz zurückgehender Mitgliederzahlen ihre äußere
Handlungsfähigkeit behalten und ihre Ausstrahlungskraft verstärken
könne. „Wir müssen nicht zu den Gewinnern zählen, wir müssen nicht
mit allen Trends mithalten können, wir unterliegen auch nicht einer
Wachstumsideologie“, sagte Schad. Der Synode empfahl er
„Gottvertrauen zum Aufbruch“: Wichtig sei es deshalb, den
Transformationsprozess innerhalb der Landeskirche auch als
geistliche Aufgabe zu begreifen, so der Kirchenpräsident. Den
Mitgliedern der neuen Synode empfahl er, zu getroffenen
Entscheidungen zu stehen und sie vor Ort auch zu vermitteln.
„Nur wer seine Wurzeln kennt, wer weiß, woher er kommt und was
die eigene Sicht prägt, kann Vorstellungen für die Zukunft
entwickeln“, sagte der Kirchenpräsident mit Blick auf das
Reformationsjubiläum 2017 und die Feier zum 200-jährigen Bestehen
der Pfälzischen Kirchenunion 2018. Dies seien Anlässe, kritisch auf
sich selbst und die eigene Geschichte zu blicken, aber auch, sich
über die Wiederentdeckung des Evangeliums zu freuen. Die beiden
Jubiläen seien herausragende Gelegenheiten, darüber nachzudenken,
„wie die Kraft des christlichen Glaubens die Welt verändern kann,
und wie wir aus dem reformatorischen Erbe leben und glauben
können“, sagte Kirchenpräsident Christian Schad.
Der zwölften Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz
gehören 62 Mitglieder an, drei weniger als der vorigen. Dies liegt
an der zurückgegangenen Zahl der Kirchenbezirke von 20 auf 19, da
die Bezirkssynoden die Mitglieder der Landessynode wählen. Auch der
Frauenanteil ist zurückgegangen: Waren in der Legislaturperiode
2009 bis 2014 noch rund die Hälfte (47,7 Prozent) der Mitglieder
Frauen, beträgt deren Anteil jetzt mit 32,3 Prozent nur noch ein
Drittel. Zum Vergleich: 2003 hatten die Frauen in der Landessynode
einen Anteil von 35,71 Prozent, 1997 lag die Quote bei 37, 93
Prozent. Etwa ein Drittel der Mitglieder ist neu in dem
Gremium.
Das Durchschnittsalter der Mitglieder der Landessynode beträgt
53 Jahre. Jüngstes Mitglied dieser Landessynode ist der 19-jährige
Student Felix Matthias Stutz aus Homburg. Senior ist mit 74 Jahren
Hans Höh aus Höhmühlbach im Kirchenbezirk Pirmasens. Für Höh, der
seit 1981 den Presbyterien seiner Heimatgemeinde angehört, ist dies
die dritte Amtszeit als Landessynodaler.
Die Amtszeit der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz
beträgt sechs Jahre. Als kirchliche Volksvertretung ist sie
Inhaberin der Kirchengewalt. Sie trifft wesentliche Entscheidungen
in den geistlichen, rechtlichen und finanziellen Bereichen der
Landeskirche. Unter anderem genehmigt sie den Haushalt der
Landeskirche und wählt den Kirchenpräsidenten sowie die fünf
Oberkirchenräte. Zudem wählt die Landessynode zu Beginn der
Amtszeit aus ihrer Mitte ein Präsidium und die synodalen Mitglieder
der Kirchenregierung. Die Entscheidungen der Landessynode werden in
Ausschüssen vorberaten, die für besondere Sachgebiete zuständig
sind: Recht, Kirchenordnung und Gleichstellung; Theologie,
Seelsorge, Liturgie und Kirchenmusik; Finanzen; Jugend, Schule und
Bildung; Diakonie, Mission und Verantwortung in der Welt;
Öffentliche Verantwortung. Daneben gibt es einen
Nominierungsausschuss.
Hinweis: Die konstituierende Sitzung der 12. ordentlichen
Landessynode der Evangelischen Kirche der Pfalz nach 1945 findet
vom 16. bis 18. Juli 2015 in der Evangelischen Diakonissenanstalt
in Speyer, Hilgardstraße 26, statt. Am Freitag wählt die Synode
u.a. das Präsidium und den Synodalpräsidenten sowie die synodalen
Mitglieder der Kirchenregierung und ihre Ersatzleute. Die
öffentlichen Plenarsitzungen beginnen am Freitag und Samstag
jeweils um 9 Uhr. Mehr zum Thema auf www.evkirchepfalz.de.
Mehr zum Thema auf www.evkirchepfalz.de, www.twitter.com/evkirchepfalz
und www.facebook.com/evkirchepfalz.
Text und Foto: lk
16.07.2015
Speyerer Dom ab sofort auch im Internet daheim
 Mehrsprachiges, umfassendes Online-Angebot mit vielen
aktuellen Informationen für Touristen und Domfreunde
freigeschaltet
Mehrsprachiges, umfassendes Online-Angebot mit vielen
aktuellen Informationen für Touristen und Domfreunde
freigeschaltet
cr./is. Speyer- Der altehrwürdige, bereits
vor mehr als 950 Jahre geweihte Speyerer Kaiser- und Mariendom – er
präsentiert sich jetzt seinen zahllosen gegenwärtigen und
zukünftigen Besuchern unter der Adresse www.dom-zu-speyer.de in
moderner und zeitgemäßer Form mit einem eigenen, gut gemachten
Internetauftritt im weltweiten Netz. Bei einem Pressegespräch im
„Blauen Salon“ der Bischöflichen Finanzkammer stellten dazu jetzt
der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und
sein Weihbischof, Dompropst Otto Georgens,
gemeinsam mit dem für die Liturgie und die Dommusik zuständigen
Domdekan Dr. Christoph Kohl und dem „summos
custos“ der Kathedrale, Domkustos Peter Schappert
das von Friederike Walter, der Leiterin
des Kulturmanagements am Dom zu Speyer koordinierte
Internet-Portal vor.
In seinem Eingangsstatement bezeichnete Bischof Dr.
Wiesemann dabei den neuen Internet-Auftritt als
„zeitgemäßen Zugang zu einem Ort der Begegnung mit Gott“ und als
„ein Signal des Willkommens“ an alle Menschen, die jetzt wirksam
über das weltweite Netz erreicht werden könnten. Dass sich der
Kaiserdom dabei in insgesamt acht Sprachen, darunter in Deutsch,
Englisch, Französisch, Spanisch und sogar in Chinesisch
präsentiere, werde den Kreis der Freunde der Kathedrale weltweit
sicher noch weiter erhöhen.
 Weihbischof Otto Georgens, als Dompropst zugleich
Vorsitzender des Domkapitels, betonte, dass der Dom keine „stille
Gedenkstätte“ sei, sondern ein Ort, in dem sich „das ganze
Kirchenjahr über das Leben in seiner ganzen Fülle“ zeige. Dazu
zählten deshalb z.B. auch Berichte über den erst kürzlich wieder
überbrachten „Weinzehnt“ und die Freude der Menschen darüber. „Die
Dom-Homepage will den Dom in all seinen Facetten darstellen und
zeigen, dass dies ein wahrhaft lebendiger Ort ist“, so der
Weihbischof. „Dabei lässt sie erkennen, dass es das Anliegen des
Domkapitels und seiner Mitarbeiter ist, Menschen mit Augen, Ohren,
Herz und Verstand für den Dom zu begeistern.“
Weihbischof Otto Georgens, als Dompropst zugleich
Vorsitzender des Domkapitels, betonte, dass der Dom keine „stille
Gedenkstätte“ sei, sondern ein Ort, in dem sich „das ganze
Kirchenjahr über das Leben in seiner ganzen Fülle“ zeige. Dazu
zählten deshalb z.B. auch Berichte über den erst kürzlich wieder
überbrachten „Weinzehnt“ und die Freude der Menschen darüber. „Die
Dom-Homepage will den Dom in all seinen Facetten darstellen und
zeigen, dass dies ein wahrhaft lebendiger Ort ist“, so der
Weihbischof. „Dabei lässt sie erkennen, dass es das Anliegen des
Domkapitels und seiner Mitarbeiter ist, Menschen mit Augen, Ohren,
Herz und Verstand für den Dom zu begeistern.“
 Domdekan Dr. Christoph Kohl erinnerte daran,
dass es in diesem Gotteshaus seit seiner Weihe Gottesdienste gebe
und dass seitdem auch festliche Kirchenmusik darin erklinge. „Wir
werden deshalb für das Internet sicher nichts „Neues“ erfinden,
sondern nur all das in neuer, übersichtlicherer Form präsentieren,
was auch heute schon - z.T. an ganz unterschiedlichen Stellen -
veröffentlicht wird und deshalb für so manchen Nutzer auch nur
schwer zu finden ist“. Informiert werden solle deshalb über alles,
was im Dom stattfindet. Dazu zählten vor allem Gottesdienste und
Wallfahrten, aber - aktuell – auch das Patroziniums Fest am 15.
August.
Domdekan Dr. Christoph Kohl erinnerte daran,
dass es in diesem Gotteshaus seit seiner Weihe Gottesdienste gebe
und dass seitdem auch festliche Kirchenmusik darin erklinge. „Wir
werden deshalb für das Internet sicher nichts „Neues“ erfinden,
sondern nur all das in neuer, übersichtlicherer Form präsentieren,
was auch heute schon - z.T. an ganz unterschiedlichen Stellen -
veröffentlicht wird und deshalb für so manchen Nutzer auch nur
schwer zu finden ist“. Informiert werden solle deshalb über alles,
was im Dom stattfindet. Dazu zählten vor allem Gottesdienste und
Wallfahrten, aber - aktuell – auch das Patroziniums Fest am 15.
August.
In einem eigenen Konzertkalender würden daneben aber auch -
datums- und uhrzeitgenau – alle Chor- und Orgelkonzerte
veröffentlicht. Die betreffenden Seiten möchten aber auch einladen
zum Mitmachen in Domchor und Dommusikschule, so der Domdekan, wo
Kurse bereits für Kinder im Vorschulalter angeboten würden. Und
selbst der „Förderverein für die Dommusik“ habe hier seine eigenen
Seiten.
„Wir laden deshalb alle Menschen dazu ein, in Gottesdienst und
Konzert zu sich selbst zu kommen und die Nähe Gottes zu spüren“,
resummierte Dr. Kohl die Ziele von Liturgie und Dommusik.
 Abschließend in dieser ersten Runde der Statements
erinnerte Domkustos Peter Schappert,
verantwortlich für die Erhaltung des UNESCO-Welterbes „Kaiserdom zu
Speyer“, daran, dass heute schon jährlich viele 100.000 Menschen
den Speyerer Dom besuchten. „Die Stadt Speyer geht davon aus, dass
jährlich über zwei Millionen Menschen in die Stadt kommen, von
denen wohl jeder zweite auch den Dom besucht“, machte er eine
Rechnung auf. Für diese Gäste sei es wichtig, vorab schon
Informationen über Gottesdienste, Öffnungszeiten und besondere
Angebote wie den Turmaufstieg zu erhalten, erläuterte der
Domkustos, der die konzeptionelle und redaktionelle Verantwortung
für den Internetauftritt trägt. Die Website biete einige
Basisinformationen zur Geschichte und zur baulichen Gestaltung des
Domes. Darüber hinaus würde sie den Besucher aber auch zum Gebet
einladen und dazu, den Dom in seiner geistlichen Bestimmung
wahrzunehmen.
Abschließend in dieser ersten Runde der Statements
erinnerte Domkustos Peter Schappert,
verantwortlich für die Erhaltung des UNESCO-Welterbes „Kaiserdom zu
Speyer“, daran, dass heute schon jährlich viele 100.000 Menschen
den Speyerer Dom besuchten. „Die Stadt Speyer geht davon aus, dass
jährlich über zwei Millionen Menschen in die Stadt kommen, von
denen wohl jeder zweite auch den Dom besucht“, machte er eine
Rechnung auf. Für diese Gäste sei es wichtig, vorab schon
Informationen über Gottesdienste, Öffnungszeiten und besondere
Angebote wie den Turmaufstieg zu erhalten, erläuterte der
Domkustos, der die konzeptionelle und redaktionelle Verantwortung
für den Internetauftritt trägt. Die Website biete einige
Basisinformationen zur Geschichte und zur baulichen Gestaltung des
Domes. Darüber hinaus würde sie den Besucher aber auch zum Gebet
einladen und dazu, den Dom in seiner geistlichen Bestimmung
wahrzunehmen.
Wichtig sei es deshalb auch gewesen, entsprechende
Bildergalerien in das derzeit 99 Seiten umfassende Kompendium
aufzunehmen und die „Dom-Homepage“ in zwei unterschiedlichen
Fassungen – einer „kurzen“ für den Kurzzeitbesucher, der sich rasch
informieren wolle, und einer „langen“ für all jene, die sich
intensiver mit dem Bauwerk auseinandersetzen und der ihm
innewohnenden Spiritualität begegnen wollten. Wichtig sei zudem
gewesen, dass die Kurzfassung auch auf mobilen Geräten wie
Smartphones oder Tablets abgespielt werden könne, ohne dass diese
vor den gewaltigen Datenmengen „kapitulieren“ müssten.
 Übrigens: Ein „W-Lan-Hotspot“ befindet sich
derzeit schon in der Vorhalle des Domes – um weitere bemühe sich
das Domkapitel derzeit gemeinsam mit der Stadt Speyer.
Übrigens: Ein „W-Lan-Hotspot“ befindet sich
derzeit schon in der Vorhalle des Domes – um weitere bemühe sich
das Domkapitel derzeit gemeinsam mit der Stadt Speyer.
Zu der Konzeption der Homepage luden die Gesprächspartner sodann
zu einem kleinen Rundgang durch die Seiten ein. Auf der Startseite
finden sich dabei verschiedene Teaser-Menüs mit Nachrichten rund um
den Dom, Nachrichten aus dem Bistum mit einem Link auf das aktuelle
Wetter in Speyer sowie mit Ausschnitten aus der Bistumszeitung „der
Pilger“. Hierdurch solle der Vernetzungsgedanke zum Tragen kommen,
der möglichst viele Informationsangebote auf dieser Seite
zusammenführen will.
Neben Daten und Fakten beinhaltet die Website auch einen
Rundgang durch den Dom in Form einer Bildergalerie - dazu einige
Hörbeispiele, etwa mit Sequenzen aus dem Audioguide. In einem
speziellen Downloadbereich können neben Infobroschüren auch eine
mp3 Datei mit dem Glockengeläut des Domes herunter geladen und,
falls gewünscht, auch als Klingelton installiert werden.
 In den nächsten Wochen und Monaten soll die Nutzung der
Seite intensiv begleitet, ausgewertet und weiter optimiert werden.
Federführend für die Umsetzung der Website ist die Speyerer
„Peregrinus GmbH“.
In den nächsten Wochen und Monaten soll die Nutzung der
Seite intensiv begleitet, ausgewertet und weiter optimiert werden.
Federführend für die Umsetzung der Website ist die Speyerer
„Peregrinus GmbH“.
Die konzeptionelle Idee, die sich die offizielle Dom-Webseite
zunutze mache, sei mit einem „Baukasten-System“ vergleichbar,
erläuterte Friederike Walter abschließend, denn
Technik und Grundstruktur der neuen Internetpräsenz basierten auf
der „Webseiten-Familie“ des Bistums Speyer. Mit diesem integrativen
Konzeptansatz werde derzeit in der Diözese Speyer die
Onlinekommunikation – angefangen von der Pfarrei- über die
Dekanats- bis hin zur Bistumsebene – strategisch völlig neu
ausgerichtet.
Besucher würden so von einer einfachen Orientierung profitieren
- wechselseitige Verlinkungen zu einer besseren Vernetzung und
damit zu mehr Reichweite führen. Durch die gemeinsame Nutzung von
Nachrichten und Datenbankinformationen entstünden zudem weitere
Synergien, beispielsweise bei der fortlaufenden Aktualisierung.
 Die Konzeptentwicklung für die neue Dom-Webseite und die
Webseiten-Familie im Bistum Speyer hat die „Peregrinus GmbH“
geleistet, in deren Verlag auch die Bistumszeitung „der Pilger“ und
das neue „Pilger Magazin“ erscheinen. Als Dienstleister für Medien
und Kommunikation im Bistum Speyer kann „Peregrinus“ im Bereich
Internetkommunikation auf vielfältige Erfahrungen und
Referenzprojekte verweisen.
Die Konzeptentwicklung für die neue Dom-Webseite und die
Webseiten-Familie im Bistum Speyer hat die „Peregrinus GmbH“
geleistet, in deren Verlag auch die Bistumszeitung „der Pilger“ und
das neue „Pilger Magazin“ erscheinen. Als Dienstleister für Medien
und Kommunikation im Bistum Speyer kann „Peregrinus“ im Bereich
Internetkommunikation auf vielfältige Erfahrungen und
Referenzprojekte verweisen.
Sehen Sie mehr unter www.dom-zu-speyer.de
Ergänzend zur Konzeption der Webseiten-Familie für das Bistum
Speyer und der neuen Dom-Webseite zählen hierzu z.B: www.kaiserdom-virtuell.de, www.pilgerreisen-speyer.de und www.gutesleben-fueralle.de.
Fotos: gc/ Domkapitel
15.07.2015
Ehemalige Oberin Diakonisse Ilse Wendel gestorben
 Nur wenige Wochen nach ihrem 89. Geburtstag ist Oberin i.
R. Diakonisse Ilse Wendel am 7. Juli in Speyer
gestorben
Nur wenige Wochen nach ihrem 89. Geburtstag ist Oberin i.
R. Diakonisse Ilse Wendel am 7. Juli in Speyer
gestorben
Speyer- 1954 als Diakonisse eingesegnet, war
Sr. Ilse von 1976 bis 1997 als Oberin im Vorstand der Diakonissen
Speyer-Mannheim wesentlich an der Entwicklung der
Diakonissenanstalt zu einem diakonischen Unternehmen beteiligt. In
diese Zeit fielen unter anderem der Bau des Schwesternwohnheims in
Speyer und die Einweihung des Hospizes, außerdem etwa die
Inbetriebnahme von Seniorenzentren in Landau, Kirchheimbolanden und
Homburg.
Vor ihrer Zeit als Oberin begleitete die gebürtige Landauerin
junge Probeschwestern, hielt Diakonische Kurse ab, unterrichtete an
der Krankenpflegeschule und war bereits seit 1956 als
Stellvertreterin von Oberschwester Else Krieg in die
Anstaltsleitung einbezogen.
Über das Speyerer Mutterhaus hinaus engagierte sich Sr. Ilse für
die Kaiserswerther Tradition im In- und Ausland und pflegte
Kontakte zu anderen Mutterhäusern. Auch im Ruhestand bemühte sie
sich um die Wahrung der schwesternschaftlichen Tradition und nahm
regen Anteil an der Weiterentwicklung des Unternehmens. „Den
Rückgang der Zahl der Schwesternschaft nahm sie bedauernd wahr,
freute sich aber, dass Mitarbeitende die Arbeit weitertrugen. Ihr
war außerdem sehr an der Fortentwicklung der Diakonischen
Gemeinschaft gelegen“, sagt Oberin Diakonisse Isabelle Wien.
Vorsteher Pfarrer Dr. Werner Schwartz betont: „Sr. Ilse war eine
gebildete Frau, die bis ins hohe Alter regen Anteil am kulturellen
und gesellschaftlichen Leben nahm. Sie sah sich auch in den letzten
Jahren ein bisschen als Garant und Sachverwalter der Identität des
Mutterhauses und der Diakonissen-Tradition in allen notwendigen
Veränderungen, die sie wahrnahm und begleitete.“
Die Trauerfeier für Diakonisse Ilse Wendel findet am 14.
Juli um 9.45 Uhr in der Mutterhauskapelle mit
anschließender Beisetzung auf dem Speyerer Hauptfriedhof statt.
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
10.07.2015
Dom rüstet sich wieder für die Zukunft
 Die „gerüstfreie“
Zeit ist zu Ende – Arbeiten an der Außenwand der Sakristei und im
nördlichen Seitenschiff
Die „gerüstfreie“
Zeit ist zu Ende – Arbeiten an der Außenwand der Sakristei und im
nördlichen Seitenschiff
Speyer- Zwei Jahre lang war der Speyerer
Dom nach allen Seiten in seiner vollen Schönheit sichtbar. Kein
Gerüst oder Bauzaun verstellte den Blick. Um die Schönheit des Doms
weiterhin zu bewahren, sind allerdings seit einigen Tagen wieder
Gerüste am und im Dom nötig.
An der Außenwand der gotischen Sakristei werden
Sandsteinarbeiten durchgeführt und Putzschäden beseitigt. „Diese
Arbeiten haben längst nicht nur kosmetischen Charakter“, erläutert
Dombaumeister Mario Colletto, „sondern sind notwendig, um die
Bausubstanz dauerhaft zu erhalten.“
 Im nördlichen
Seitenschiff wird derzeit ein weiteres Gerüst aufgestellt.
Malerarbeiten, die vor etwa 10 Jahren unterbrochen wurden, sollen
nun abgeschlossen und Putzrisse beseitigt werden. „Geeignete Putze
sind unverzichtbar“, erklärt Dombaumeister Colletto, „sie sorgen
für eine Pufferung der Feuchte, insbesondere in den
Übergangszeiten, in denen die Luftfeuchte im Rauminneren ansteigen
kann, oft bis zu 90 Prozent. Dies ist eine wichtige Maßnahme zum
Bauerhalt.“
Im nördlichen
Seitenschiff wird derzeit ein weiteres Gerüst aufgestellt.
Malerarbeiten, die vor etwa 10 Jahren unterbrochen wurden, sollen
nun abgeschlossen und Putzrisse beseitigt werden. „Geeignete Putze
sind unverzichtbar“, erklärt Dombaumeister Colletto, „sie sorgen
für eine Pufferung der Feuchte, insbesondere in den
Übergangszeiten, in denen die Luftfeuchte im Rauminneren ansteigen
kann, oft bis zu 90 Prozent. Dies ist eine wichtige Maßnahme zum
Bauerhalt.“
Die Maßnahmen sind in ein Revisionskonzept eingebunden, das
fortlaufend Renovierungs-, Reinigungs- und Kontrollarbeiten
beinhaltet. Das Außengerüst wird noch bis Ende September 2015
benötigt, die Arbeiten im Innenraum sollen bis voraussichtlich
April 2016 abgeschlossen werden. Text und Fotos: Friederike
Walter
08.07.2015
Religion ist mehr als Wissen
 Bischof
Wiesemann hat „Missio Canonica“ an 51 Religionslehrerinnen und
Religionslehrer verliehen
Bischof
Wiesemann hat „Missio Canonica“ an 51 Religionslehrerinnen und
Religionslehrer verliehen
Speyer- Am Freitag hat Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann 51 Männern und Frauen aus der gesamten Diözese
in der Kirche St. Joseph in Speyer die „Missio Canonica“, die
kirchliche Lehrerlaubnis für das Schulfach katholische Religion,
verliehen. Zwei von ihnen sind die Grundschulpädagogin Isabelle
Schreiner und der Hauptschullehrer Christian
Jochem. Beide sind sich einig: Das Fach ist ein besonderer
Unterricht.
Anders als in „Wissensfächern“ geht es nicht um Noten, sondern um
Fragen, die das Leben betreffen oder wie Schreiner sagt, um
„Herzens- und Gewissensangelegenheiten“. „Man lernt die Schüler
noch einmal von einer ganz anderen Seiten kennen“, ist ihre
Erfahrung. Zurzeit unterrichtet die 25-Jährige an der Grundschule
in Hördt (Kreis Germersheim) und wird ab dem neuen Schuljahr in der
Speyerer Klosterschule eine dritte Klasse übernehmen.
 Der
Religionsunterricht beschert den Lehrern immer wieder
Überraschungen: Beim Thema Gottesbilder fragte eine Erstklässlerin
Isabelle Schreiner, ob Gott auch
ein Mädchen sein könnte. „Es ist toll, dass Schüler darüber
nachdenken“, freut sich die Lehrerin und ist immer wieder
beeindruckt, wie sehr die Kinder mitfühlen und mitdenken. „Manchmal
stellen sie tief greifende Fragen, die große theologische Themen
berühren“, hat sie erlebt. Ihre Grundschüler staunten zum Beispiel,
warum die Menschen traurig waren, als Jesus gestorben ist – obwohl
sie wussten, dass er weiterlebt. Schreiner ist begeistert: „Das
sind Momente, die nur der Religionsunterricht bietet.“ Religion ist
ihr Lieblingsfach. Sie wählte es im Studium als Schwerpunkt. In
ihrem Heimatort Edesheim ist die fröhliche junge Frau in der
Gemeinde fest verwurzelt und engagiert.
Der
Religionsunterricht beschert den Lehrern immer wieder
Überraschungen: Beim Thema Gottesbilder fragte eine Erstklässlerin
Isabelle Schreiner, ob Gott auch
ein Mädchen sein könnte. „Es ist toll, dass Schüler darüber
nachdenken“, freut sich die Lehrerin und ist immer wieder
beeindruckt, wie sehr die Kinder mitfühlen und mitdenken. „Manchmal
stellen sie tief greifende Fragen, die große theologische Themen
berühren“, hat sie erlebt. Ihre Grundschüler staunten zum Beispiel,
warum die Menschen traurig waren, als Jesus gestorben ist – obwohl
sie wussten, dass er weiterlebt. Schreiner ist begeistert: „Das
sind Momente, die nur der Religionsunterricht bietet.“ Religion ist
ihr Lieblingsfach. Sie wählte es im Studium als Schwerpunkt. In
ihrem Heimatort Edesheim ist die fröhliche junge Frau in der
Gemeinde fest verwurzelt und engagiert.
Isabelle Schreiner gestaltet den Religionsunterricht mit
verschiedenen Methoden. Ihre Schüler sitzen nicht nur auf den
Stühlen. Sie spricht mit den Mädchen und Jungen über Bilder und
pflegt gerne Rituale, etwa indem sie eine angezündete Kerze im
Kreis herumgibt. Dabei sollen die Kinder sagen, was ihnen gut tut
oder sie anderen wünschen.
Von bewegenden Momenten berichtet auch Christian
Jochem. Sein Ziel: Religionsunterricht soll Menschen etwas
mit auf den Weg geben. Er selbst hat auf dem Speyerer
Nikolaus-von-Weis-Gymnasium einen Religionsunterricht erfahren,
„der mich geprägt hat“. Nach dem Lehramtsstudium für Hauptschulen
in Landau mit der Fächerkombination Deutsch, Geschichte und
Religion absolvierte der heute 36-Jährige in Dudenhofen sein
Referendariat und arbeitete sieben Jahre an einer Wormser Schule.
Im vergangenen Jahr kam er zurück ins Bistum Speyer und ist seither
an der Burgfeld-Realschule plus in Speyer tätig. Hier teilt er sich
den Religionsunterricht mit einer Kollegin.
In Religion werden Themen diskutiert, „die den Menschen im Kern
betreffen“, erklärt der Lehrer. Mit einer neunten Klasse sprach er
über den Tod und spürte das Interesse – auch, wenn sich manche
Schüler nicht aus der Deckung trauten, weil es uncool wirken
könnte. Religionsunterricht fordert Christian Jochem. „Es ist ein
Fach, in dem die Schüler sehr viel von sich preisgeben und bei dem
man als Lehrer authentisch wirken muss.“ In anderen Fächern seien
Lehrkräfte weniger emotional eingebunden. Er erhalte Einblicke in
Familien, die in schwierigen Situationen stecken. „Ich glaube,
oftmals ist es besser, Verständnis zu zeigen und nicht den
moralischen Zeigefinger zu heben.“ Jochem hat beobachtet, dass
Schüler Halt suchen, gerne seine Meinung wissen wollen. Deshalb
könne man sich im Religionsunterricht nicht vor eine Klasse
stellen, „wenn man nicht überzeugt ist.“ Text und Foto:
Yvette Wagner
06.07.2015
„Sie waren das Gesicht der Polizeiseelsorge im Bistum Speyer“
 Diakon Hartmut van Ehr als Beauftragten der
Polizeiseelsorge verabschiedet
Diakon Hartmut van Ehr als Beauftragten der
Polizeiseelsorge verabschiedet
Von Franz Gabath
Böhl-Iggelheim- Würdig und in großem Rahmen wurde
der Beauftragte für die Polizeiseelsorge im Bistum Speyer,
Diakon Hartmut von Ehr, in der Katholischen Pfarrkirche St.
Simon und Judas Thaddäus in Iggelheim, verabschiedet. Schier endlos
war die Liste der geladenen Gäste, welche die Leiterin der
Abteilung Besondere Seelsorgebereiche beim Ordinariat, Susanne
Laun, abarbeiten musste. Beginnend beim Hausherren, Pfarrer
Thomas Pfundstein, über Bürgermeister Peter Christ aus
Böhl-Iggelheim, über hohe und höchste Repräsentanten aus den
Rheinland-Pfälzischen Polizeidienststellen, so wie dem Ministerium
des Innern, für Sport und Infrastruktur, bis zu Domkapitular,
Franz Vogelgesang - alle drückten mit ihrem Kommen die
große Wertschätzung aus, die Hartmut von Ehr, während seiner Zeit
in der Polizeiseelsorge genossen hat.
 „Sie waren das Gesicht der Polizeiseelsorge im Bistum
Speyer. Sein Herz schlägt für die Polizei!“ In sehr persönlichen
Worten zeichnete Domkapitular Franz Vogelgesang den Weg von
Hartmut von Ehr nach, der seit 1979 in der Diözese Speyer in
mehrere Stationen im seelsorgerischen Bereich tätig war. Nach dem
Theologiestudium waren die erste Station in Harthausen. Danach
schnupperte er, als Pastoralreferent der deutschen Gemeinde in
Tokio, Auslandsluft. Nach der Rückkehr in die Heimat führte sein
Weg direkt in die Polizeiseelsorge, welche Domkapitular Vogelgesang
als eine Herzensangelegenheit von von Ehr bezeichnete. „Steht auch
seine Familie immer an 1. Stelle, so gibt es keinen großen
Zwischenraum zur Polizeiseelsorge“ betonte Vogelgesang. Als
Beispiel nannte der Domkapitular die Besuche, welche von Ehr
bei den verschiedensten Revieren gerade am Hl. Abend und
Weihnachten durchführte.
„Sie waren das Gesicht der Polizeiseelsorge im Bistum
Speyer. Sein Herz schlägt für die Polizei!“ In sehr persönlichen
Worten zeichnete Domkapitular Franz Vogelgesang den Weg von
Hartmut von Ehr nach, der seit 1979 in der Diözese Speyer in
mehrere Stationen im seelsorgerischen Bereich tätig war. Nach dem
Theologiestudium waren die erste Station in Harthausen. Danach
schnupperte er, als Pastoralreferent der deutschen Gemeinde in
Tokio, Auslandsluft. Nach der Rückkehr in die Heimat führte sein
Weg direkt in die Polizeiseelsorge, welche Domkapitular Vogelgesang
als eine Herzensangelegenheit von von Ehr bezeichnete. „Steht auch
seine Familie immer an 1. Stelle, so gibt es keinen großen
Zwischenraum zur Polizeiseelsorge“ betonte Vogelgesang. Als
Beispiel nannte der Domkapitular die Besuche, welche von Ehr
bei den verschiedensten Revieren gerade am Hl. Abend und
Weihnachten durchführte.
Hartmut von Ehr war maßgeblich am Aufbau der Polizeiseelsorge
beteiligt, gründete mit die ökumenische Bundesarbeitsgemeinschaft
und die Landesarbeitsgemeinschaft. Nach dem verheerenden
Flugzeugunglück in Ramstein 1988 war von Ehr einer der Gründer und
Initiatoren des so genannten Kriseninterventionsteams das
sich schon bei vielen regionalen und nationalen Einsätzen beßtens
bewährt hat und große Wertschätzung genießt. Diese Team, dem
Psychologen und Seelsorger angehören, steht Beamten offen, die nach
kritischen Einsätzen Hilfe und verständnisvolle Gesprächspartner
brauchen.
Die Arbeitsgruppe „Post-Shooting, für Beamte, die von der
Schusswaffe Gebrauch machen mussten, ist ein „Kind von Hartmut von
Ehr.
 Supervision – eine Hilfe für Beamtinnen und Beamte in
Krisensituationen – dies hat Diakon von Ehr noch als letztes
Projekt und Aufgabe auf den Weg gebracht und wird, nach den Worten
vieler im Polizeidienst Verantwortlicher, weiter intensiv
verfolgt werden. Nicht zu vergessen den Krankenbesuchsdienst, der
auf Anregung von Diakon von Ehr eingeführt wurde und der bei vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer offene Ohren und Herzen
gefunden hat. Ein Dienst, den die oder der sehr zu schätzen weis,
wenn er denn bei Krankheit freundschaftliche Unterstützung
erfährt.
Supervision – eine Hilfe für Beamtinnen und Beamte in
Krisensituationen – dies hat Diakon von Ehr noch als letztes
Projekt und Aufgabe auf den Weg gebracht und wird, nach den Worten
vieler im Polizeidienst Verantwortlicher, weiter intensiv
verfolgt werden. Nicht zu vergessen den Krankenbesuchsdienst, der
auf Anregung von Diakon von Ehr eingeführt wurde und der bei vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer offene Ohren und Herzen
gefunden hat. Ein Dienst, den die oder der sehr zu schätzen weis,
wenn er denn bei Krankheit freundschaftliche Unterstützung
erfährt.
Der Polizeiseelsorge-Beirat des Bistums und der protestantischen
Landeskirche, in ihm sind gewählte Beamte aus den Reihen der
Polizisten vertreten, ist in dieser Form einmalig in der
Bundesrepublik und genoss die besondere Beachtung von Hartmut von
Ehr.
Hartmut von Ehr ist ein begeisterter Pilger, hat
Polizeiwallfahrten ins Leben gerufen und ist selbst schon auf dem
Jakobsweg, dem Camino“ in Spanien, nach Santiago de Compostella,
unterwegs gewesen. „Geh den Weg als Seelsorger mit den Menschen
weiter – geh weiter den Pilgerweg mit und zu Gott – denn Gott ist
da - diese Botschaft gilt es zu verkünden“ waren die
aufmunternden Worte von Domkapitular Franz Vogelgesang an den
scheidenden Polizeiseelsorger.
„Mit ganzen Herzen den Beamtinnen und Beamten gewidmet“ - „Ein
leidenschaftlicher Streiter – wer etwas will – findet auch einen
Weg“ - „bei den unzähligen Begegnungen immer das rechte Wort
gefunden“ - „ein leidenschaftlicher Streiter auch für die Ökumene“
- nur einige Zitate die in den zahlreichen Grußworten immer wieder
so, oder in abgewandelter Form anklangen.
 Hartmut von Ehr dankte, in sehr persönlichen
Abschiedsworten, Allen, die ihn in den 25 Jahren bei der
Polizeiseelsorge begleitet und in vielfältigster Weise unterstützt
haben. Seinem Nachfolger, Patrick Stöbener, wünschte der scheidende
Seelsorger die Unterstützung welche er selbst erfahren hat, viel
Freude in diesem wichtigen Dienst und Gottes Segen.
Hartmut von Ehr dankte, in sehr persönlichen
Abschiedsworten, Allen, die ihn in den 25 Jahren bei der
Polizeiseelsorge begleitet und in vielfältigster Weise unterstützt
haben. Seinem Nachfolger, Patrick Stöbener, wünschte der scheidende
Seelsorger die Unterstützung welche er selbst erfahren hat, viel
Freude in diesem wichtigen Dienst und Gottes Segen.
Vor der Verabschiedung feierte Domkapitular Franz Vogelgesang
eine würdevolle Eucharistiefeier. Bettina Oster musizierte an der
Orgel.
Eucharistiefeier und Verabschiedung wurden vom, musikalisch
hochkarätigen, Holzbläserquintett des Landespolizeiorchesters
Rheinland-Pfalz, unter der Leitung von Bernd Schneider, gestaltet.
Bild:fg
04.07.2015
Partner aus Papua auf Rundreise in der Pfalz
 Begrüßung der Gäste im Landeskirchenrat in Speyer.
Begrüßung der Gäste im Landeskirchenrat in Speyer.
Austauschprogramm mit Missionsfest und Empfang im
Landeskirchenrat
Speyer- Weitgereister Besuch im
Landeskirchenrat: Oberkirchenrat Manfred Sutter hat am Donnerstag
eine achtköpfige Delegation der protestantischen Partnerkirche in
Papua, Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (GKI-TP), in Speyer
empfangen. Die Papuaner halten sich anlässlich des Missionsfestes
zum 200. Jubiläum der Basler Mission zu einem Austauschprogramm in
der Pfalz auf.
„Wer einmal in Papua war, lässt immer auch ein Stück vom Herzen
da“, begrüßte Sutter die Gäste. Der Ökumenedezernent der
Landeskirche hatte Papua vergangenes Jahr zur offiziellen
Unterzeichnung des Partnerschaftsvertrages besucht. Damals habe er
eine überwältigende Gastfreundschaft erlebt. „Ein bisschen was
davon wollen wir Ihnen hier zurückgeben.“
Unter der Leitung von Jürgen Dunst vom
Missionarisch-Ökumenischen Dienst (MÖD) Pfalz sieht das
Austauschprogramm u.a. den Besuch mehrerer Kirchengemeinden und
Einrichtungen sowie des Missionsfestes am 5. Juli in
Kaiserslautern-Erfenbach vor. Partnerschaftliche Beziehungen mit
der GKI-TP bestehen seit 1993. Sie werden schwerpunktmäßig vom
Papua-Arbeitskreis im Kirchenbezirk Rockenhausen und der
Kirchengemeinde Erfenbach in Kooperation mit dem
Missionarisch-Ökumenischen Dienst getragen.
Die 1815 gegründete Basler Mission ist Teil der Evangelischen
Mission in Solidarität, einer Gemeinschaft von evangelischen
Kirchen und Missionsgesellschaften in Afrika, Asien und
Lateinamerika. Das Missionsfest beginnt am Sonntag um 14 Uhr in der
Kreuzsteinhalle Kaiserslautern-Erfenbach mit einem Gottesdienst.
Die Predigt hält Oberkirchenrat Manfred Sutter, die Liturgie
gestalten Pfarrer Hartmut Eder sowie die Vertreter der
Partnerkirche aus Papua. Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr als
Vorsitzender der Basler Mission Pfalz wird durch das Programm des
Missionsfestes führen.
Text und Foto: lk
03.07.2015
Kirchentagstasche - Eine Idee mit großer Tragweite
 „Aufstehen zum Leben“: Frankenthalerinnen haben aus Schal
Umhängetasche gefertigt
„Aufstehen zum Leben“: Frankenthalerinnen haben aus Schal
Umhängetasche gefertigt
Frankenthal- Eine Idee mit großer
Tragweite: Christiane Rößler und ihrer Mutter Helga Kauffmann aus
Frankenthal ist es zu verdanken, dass das Motto des regionalen
Ökumenischen Kirchentages (ÖKT) – „Aufstehen zum Leben“ – womöglich
noch lange in alle Welt getragen wird. Die 88 Jahre alte Dame hat
aus dem magentafarbenen Schal mit dem markanten Aufdruck, der beim
ÖKT der Tochter als kleidsames Accessoire diente, eine praktische
Umhängetasche „mit Wiedererkennungseffekt“ gefertigt.
Der Einfall, das Motto des regionalen Kirchentages auf diese
Weise weiterzutragen, kam der Presbyterin der Frankenthaler
Lutherkirchengemeinde und Bezirkssynodalen Christiane Rößler
während des Kirchentagbesuches an Pfingsten in Speyer. Ihre Mutter
habe ihn dann mit Nadel und Faden in die Tat umgesetzt. Christiane
Rößler sieht darin auch einen Beitrag zum Umweltschutz: „Der Schal
landet nicht früher oder später in der Altkleidersammlung und man
kann auf Plastikbeutel verzichten, wenn man diesen
Kirchentagsbeutel beim Shoppen dabei hat.“ lk; Foto:
Privat
01.07.2015
Wein-Präsentation mit beglückendem Rahmenprogamm
 „2014er Sausenheimer Riesling trocken“ aus dem Weingut
Gaul soll helfen, neue Beleuchtung in der Gedächtniskirche zu
finanzieren
„2014er Sausenheimer Riesling trocken“ aus dem Weingut
Gaul soll helfen, neue Beleuchtung in der Gedächtniskirche zu
finanzieren
cr. Speyer- Es ist ein trockener
Sausenheimer Riesling, Jahrgang 2014, aus dem
Weingut Karl-Heinz Gaul, den jetzt der Bauverein
der Speyerer Gedächtniskirche als seinen „Wein des Jahres 2015“ in
Anwesenheit von Oberbürgermeister Hansjörg Eger
bei einer Präsentation im Historischen Ratssaal der Stadt
vorstellen konnte. Auge, Nase, Zunge und Gaumen – alle
Geschmackssinne seien im Spiel gewesen, als eine kleine,
fachkundige Abordnung des Bauvereins unter der Leitung von
Dekan Markus Jäckle diesen Wein ausgewählt habe.
Die anwesenden Mitglieder des Bauvereins und ihre Gäste, die zu
diesem Anlass in Speyers „guudi Stubb“ gekommen waren, konnte diese
Wahl nur loben, sprachen sie doch nach der musikalisch überzeugend
umrahmten, verbalen Vorstellung dem „köstlichen Tropfen“
genießerisch zu.
 Als Dekan und Pfarrer der Gedächtniskirchengemeinde
obliege es ihm nicht allein, seine Nase ins Weinglas zu tauchen, um
im Interesse und zum Wohle seiner „Schäfchen“ den besten Wein für
sie auszuwählen, erklärte Dekan Jäckle in seiner Begrüßung – nein,
als gelernterTheologe habe er seine Nase natürlich auch in die
Bibel gesteckt und dort den Begriff „Wein“ - real und allegorisch -
an gleich 220 Stellen wiedergefunden. Vom „Wein, der des Menschen
Herz erfreut“ bis hin zu dem Gleichnis, in dem
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock – Ihr seid die
Reben“ - viele Zitate belegten, dass Jesus „kein Kostverächter“
gewesen sei und auch einen „guten Tropfen“ durchaus zu genießen
verstanden habe.
Als Dekan und Pfarrer der Gedächtniskirchengemeinde
obliege es ihm nicht allein, seine Nase ins Weinglas zu tauchen, um
im Interesse und zum Wohle seiner „Schäfchen“ den besten Wein für
sie auszuwählen, erklärte Dekan Jäckle in seiner Begrüßung – nein,
als gelernterTheologe habe er seine Nase natürlich auch in die
Bibel gesteckt und dort den Begriff „Wein“ - real und allegorisch -
an gleich 220 Stellen wiedergefunden. Vom „Wein, der des Menschen
Herz erfreut“ bis hin zu dem Gleichnis, in dem
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock – Ihr seid die
Reben“ - viele Zitate belegten, dass Jesus „kein Kostverächter“
gewesen sei und auch einen „guten Tropfen“ durchaus zu genießen
verstanden habe.
 Dies habe der Heiland mit dem großen Reformator
Martin Luther gemeinsam gehabt, von dem so deftige
Aussagen stammen sollen wie die:„Wer nicht liebt Wein, Weib und
Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang“. Und weil er gerade so
schön am 'Zitieren' war und es so gut in seinen Duktus passte,
schob Jäckle noch eine weitere Sentenz hinterher, die ihm
zugegebenermaßen noch kurzfrisrig eingefallen sei: „Wer Wein
trinkt, dem geht ein Licht auf – und so manchem sogar ein ganzer
Kronleuchter!“. Und damit war der Geistliche auch schon bei dem
nächsten größeren Projekt zugunsten der Gedächtniskirche angelangt,
für das in diesen Tagen die Planung abgeschlossen werden soll: Eine
komplett neue Beleuchtungsanlage für das Innere des Gotteshauses,
für die die bauausführende Firma schon mit dem Eingravieren der
Namen der „edlen Spender“ auf den Kronleuchtern begonnen habe. Bis
Weihnachten, so erhofft es sich Dekan Jäckle, könne die einem
komplexen Beleuchtungskonzept folgende Gesamtmaßnahme wohl
abgeschlossen sein und so die Kirche, rechtzeitig zur Feier der
Geburt Christi, in „neuem Licht“ erstrahlen.
Dies habe der Heiland mit dem großen Reformator
Martin Luther gemeinsam gehabt, von dem so deftige
Aussagen stammen sollen wie die:„Wer nicht liebt Wein, Weib und
Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang“. Und weil er gerade so
schön am 'Zitieren' war und es so gut in seinen Duktus passte,
schob Jäckle noch eine weitere Sentenz hinterher, die ihm
zugegebenermaßen noch kurzfrisrig eingefallen sei: „Wer Wein
trinkt, dem geht ein Licht auf – und so manchem sogar ein ganzer
Kronleuchter!“. Und damit war der Geistliche auch schon bei dem
nächsten größeren Projekt zugunsten der Gedächtniskirche angelangt,
für das in diesen Tagen die Planung abgeschlossen werden soll: Eine
komplett neue Beleuchtungsanlage für das Innere des Gotteshauses,
für die die bauausführende Firma schon mit dem Eingravieren der
Namen der „edlen Spender“ auf den Kronleuchtern begonnen habe. Bis
Weihnachten, so erhofft es sich Dekan Jäckle, könne die einem
komplexen Beleuchtungskonzept folgende Gesamtmaßnahme wohl
abgeschlossen sein und so die Kirche, rechtzeitig zur Feier der
Geburt Christi, in „neuem Licht“ erstrahlen.
 Je zwei Euro des 8,50 Euro pro Flasche kostenden
„Sausenheimer Rieslings“ werden in die neue Beleuchtung fließen, so
der Dekan – bei zunächst 1.000 abgefüllten Flachen also 2.000 Euro
– sicher nicht zuviel, damit „den Frommen das Licht aufgeht“, wie
es in Psalm 112 und bei Felix Mendelssohn-Bartholdy heißt.
Je zwei Euro des 8,50 Euro pro Flasche kostenden
„Sausenheimer Rieslings“ werden in die neue Beleuchtung fließen, so
der Dekan – bei zunächst 1.000 abgefüllten Flachen also 2.000 Euro
– sicher nicht zuviel, damit „den Frommen das Licht aufgeht“, wie
es in Psalm 112 und bei Felix Mendelssohn-Bartholdy heißt.
Den Wein selbst präsentierten im Anschluß an Jäckles
Ausführungen die Schwestern Karoline und Dorothee
Gaul, die nach ihrem Studium an der international
renommmierten Weinbauhochschule in Geisenheim im Rheingau vor vier
Jahren den Betrieb ihres inzwischen verstorbenen Vaters Karl-Heinz
Gaul übernommen hatten – die eine verantwortlich für den vier
Hektar Rebfläche mit je 4.500 Rebstöcken umfassenden Betrieb und
für den Keller - die andere zuständig für die Vermarktung der im
Hause Gaul erzeugten „edlen Tropfen“
 Dorothee Gaul stellte sodann den ausgewählten
Riesling für den Bauverein der Speyerer Gedächtniskirche als eine
„trockene“ Kreszenz vor - „puristisch und selbstbewußt und mit
einem fein-edlen Apfelgeschmack“, in dem sich der „sehr kalkhaltige
Boden“, auf dem die Trauben zur Reife gelangen, auf das Feinste
wiederfindet.
Dorothee Gaul stellte sodann den ausgewählten
Riesling für den Bauverein der Speyerer Gedächtniskirche als eine
„trockene“ Kreszenz vor - „puristisch und selbstbewußt und mit
einem fein-edlen Apfelgeschmack“, in dem sich der „sehr kalkhaltige
Boden“, auf dem die Trauben zur Reife gelangen, auf das Feinste
wiederfindet.
Zu soviel guten Worten und einem derart köstlichen Wein gehörte
- als gelungene Abrundung eines anspruchsvollen Programms -
natürlich auch eine erlesene Musik. Und auch hier landete der
Bauverein einen „Volltreffer“, hatte er doch mit den beiden
Gitarristen - der aus Brasilien stammenden Instrumentalistin und
Sängerin Ignez Carvalho und dem Speyerer
Wolfgang Schuster zwei Vertreter ihres Genres eingeladen,
die höchst einfühlsam und mit virtuoser Technik ihre Parts
meisterten. Ausgewählt hatten die beiden dazu emotionsstarke
Stücke, in denen sich klassische Gitarrenkunst beglückend mit
südamerikanischen Rhythmen vereinen. Viel Beifall für einen
kurzweiligen Abend, an dem alle Sinne der anwesenden Menschen
angerührt wurden. Foto: gc
30.06.2015
In der Krypta einen kühlen Kopf bewahren
 Im Speyerer
Dom herrschen im Hochsommer auch ohne Klimaanlage angenehme
Temperaturen
Im Speyerer
Dom herrschen im Hochsommer auch ohne Klimaanlage angenehme
Temperaturen
Speyer- Bis zu 38 Grad soll es in den
kommenden Tagen in Teilen Süddeutschlands heiß werden. Glücklich,
wer in Speyer ist, denn hier gibt es jede Menge Eiscafés, ein
Freibad und den Dom. Was der Dom mit der Hitze zu tun hat? Der
riesige, massive Innenraum sorgt ganz von allein, ohne Klimaanlage,
dafür, dass es hier immer angenehm kühl bleibt. Noch frischer ist
es in der Krypta, dort sind es durchschnittlich 4 Grad weniger als
im Hauptschiff.
Für einen kühlen Kopf sorgen in der Krypta aber nicht nur die
angenehmen Temperaturen, sondern auch die klare geometrische
Gliederung der Krypta. Diese Klarheit wird durch die wechselnde
Farbgebung der Gewölbebögen noch betont und vermittelt ein Gefühl
göttlicher Ordnung. Die Unterkirche ist der älteste Teil des Doms
und seit fast 1000 Jahren beinahe unverändert erhalten. Das Wort
Krypta kommt aus dem Griechischen und bedeutet „verborgen“. Die
Bezeichnung kommt daher, dass Krypten größtenteils unterirdisch
angelegt und nicht gleich von Außen erkennbar sind. Die Krypta im
Speyerer Dom ist eine der größten ihrer Art und erstreckt sich
unter dem gesamten Querhaus, Chor und Apsis des Doms. Ihre Mauern
sind sehr dick, da sie die gesamte Auflast der darüber liegenden
Gebäudeteile tragen müssen. Diese gewaltigen Mauern und die Lage
unter der Erde sorgen auch im größten Hochsommer für angenehm kühle
Temperaturen. Ein kühles Lüftchen weht im Speyerer Dom auch immer:
und zwar 60 Meter höher auf der Aussichtsplattform im
Südwestturm.
 Besucher
sind herzlich eingeladen, die Kühle des Ortes zu genießen und im
Dom zu verweilen.
Besucher
sind herzlich eingeladen, die Kühle des Ortes zu genießen und im
Dom zu verweilen.
Öffnungszeiten:
werktags April bis Oktober 9-19 Uhr
werktags November bis März 9-17 Uhr
sonntags ganzjährig 12-18 Uhr
Krypta und Kaisergräber
Die Krypta öffnet und schließt eine Viertelstunde nach bzw. vor
den regulären Öffnungszeiten.
Kaisersaal und Aussichtsplattform
werktags April bis Oktober 10-17 Uhr
sonntags 12-17 Uhr
Auf Grund liturgischer Feiern kann es kurzfristig zu
Einschränkungen bei den Besichtigungsmöglichkeiten
kommen.
Text: is; Foto: GDKE – Landesmuseum Mainz, Ursula Rudischer ©
Domkapitel Speyer
30.06.2015
Land und Bischof würdigen kirchliche Religionslehrer
 Im Rahmen einer Feier im Kloster Esthal wurde 66 Religionslehrerinnen und Religionslehrern im Kirchendienst im Bistum Speyer der staatlich anerkannte Titel verliehen.
Im Rahmen einer Feier im Kloster Esthal wurde 66 Religionslehrerinnen und Religionslehrern im Kirchendienst im Bistum Speyer der staatlich anerkannte Titel verliehen.
Feier zur Titelverleihung im Kloster Esthal
Esthal- Der Bischof von Speyer, Dr.
Karl-Heinz Wiesemann, hat am Donnerstag im Kloster St. Maria in
Esthal 66 Religionslehrerinnen und Religionslehrern im
Kirchendienst einen staatlich anerkannten Titel für ihre Tätigkeit
in der Schule verliehen.
Alle Gemeindereferentinnen und -referenten, die hauptamtlich im
Religionsunterricht eingesetzt sind, erhalten den Titel
„Religionslehrer oder Religionslehrerin im Kirchendienst“.
Pastoralreferentinnen und -referenten, die hauptamtlich als
Religionslehrer arbeiten, sind ab sofort „Studienrat oder
Studienrätin im Kirchendienst“.
Bischof Wiesemann ermutigte die Ernannten: „Es ist meine
christliche Hoffnung, dass die Menschen immer auch abklopfen, wer
und was wirklich hinter einer Sache steht.“ Hinter diesen
Überzeugungen zu stehen im Bildungsgeschehen und für die Fragen der
Schüler von heute da zu sein, sei der große Verdienst von
Religionslehrern, dankte der Bischof. „Die Sinnfrage ist der
Urtypus von Überzeugungen“, erklärte Wiesemann. Der Titel für die
kirchlichen Mitarbeiter an Schulen belege diesen Einsatz der
Diözese nun auch im Amtsgeschehen.
Regierungsschulrat Thomas Brill, Vertreter der staatlichen
Schulbehörde (ADD Neustadt), dankte im Grußwort für das Land
Rheinland-Pfalz. Der kirchliche Einsatz sei ein wichtiger Dienst an
den Schulen. Mit den Titeln werde das bereits seit langem
geleistete gewürdigt und mache in Zukunft die Tätigkeit eindeutig
für die Lehrerkollegien.
Alle neuen Titelinhaber erhielten eine Flasche
„Religionslehrerwein“ nach einer Idee von Cäcilia Weis aus Landau,
Vorsitzende des Vertreterrats der kirchlichen Religionslehrer an
Grundschulen. Die Flasche ziert das biblische Zitat „Ihr seid das
Salz der Erde“ (Mt 5,13).
Hauptabteilungsleiter Domdekan Dr. Christoph Kohl übergab allen den
neuen Ökumenischen Leitfaden. Er dankte der zuständigen
Abteilungsleiterin, Studiendirektorin im Kirchendienst Birgitta
Greif.
Die beiden Amtsbezeichnungen haben innerkirchliche und
staatliche Geltung. Mit der staatlichen Genehmigung zur Führung
dieser Amtsbezeichnungen erkennen die Länder Rheinland-Pfalz und
Saarland erstmalig die offizielle Gleichwertigkeit von pastoralen
Mitarbeitern und staatlich ausgebildeten Lehrern an. Von den rund
95 Frauen und Männern, die als kirchliche Lehrer im staatlichen
Schuldienst arbeiten, haben 66 eine pastorale Ausbildung und
deshalb den Titel erhalten. Alle anderen kirchlichen
Religionslehrer sind staatlich ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer.
„Im Kirchendienst“ bedeutet, dass die Diözese Arbeitgeber ist,
während die staatlichen Religionslehrer Landesbeamte sind. Im
Bistum Speyer gibt es insgesamt rund 2.300 Lehrerinnen und Lehrer
für das Fach katholische Religion. Text und Foto: is
20.06.2015
„Starker Impuls für die notwendige ökologische und spirituelle Umkehr“
 Speyerer
Bischof Wiesemann sieht in der Enzyklika „Laudato si“ auch eine
Bestärkung für die Anliegen der Kampagne „Gutes Leben. Für alle!“ –
Zeit für ein Überdenken des eigenen Lebensstils
Speyerer
Bischof Wiesemann sieht in der Enzyklika „Laudato si“ auch eine
Bestärkung für die Anliegen der Kampagne „Gutes Leben. Für alle!“ –
Zeit für ein Überdenken des eigenen Lebensstils
Speyer- Als „starken Impuls für die
notwendige ökologische und spirituelle Umkehr“ würdigt der Speyerer
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann die Enzyklika „Laudato si“ von
Papst Franziskus. Der Bezug auf den Sonnengesang des Heiligen
Franziskus weise auf die Schönheit der Schöpfung und zugleich auf
die enge Verbundenheit aller Geschöpfe hin. „Der Klimawandel und
die ökologischen Probleme unserer Zeit sind untrennbar mit den
Fragen der sozialen und globalen Gerechtigkeit verbunden. Wir
brauchen einen grundlegenden Mentalitätswandel“, macht Bischof
Wiesemann deutlich.
Ihn beeindruckt besonders, dass der Papst nicht bei einer
Analyse der aktuellen Umweltproblemen stehen bleibt, sondern die
tiefergehenden theologischen und spirituellen Wurzeln der Krise
beleuchtet. Inspiriert von dem Religionsphilosophen und Theologen
Romano Guardini, kritisiert der Papst das „technokratische
Paradigma“. Es habe dazu geführt, dass die Menschen bei allen
Fortschritten auf dem Gebiet der Technik den Blick für das Ganze
verloren haben. Durch einen falsch verstandenen
„Anthropozentrismus“ sei das Bewusstsein für die Beziehung des
Menschen zu seinen Mitmenschen und zu seiner Umwelt immer mehr in
den Hintergrund getreten. Zur Überwindung der Krise hält der Papst
die Religion für unverzichtbar. Nur der Glaube an einen
Schöpfergott könne die Notwendigkeit einer umweltpolitischen und
spirituellen Umkehr tiefer begründen.
In seiner Enzyklika ruft der Papst dazu auf, die
Konsumorientierung und die „Globalisierung der Gleichgültigkeit“ zu
überwinden. Gefordert sei die Entwicklung eines Lebensstils, der
allen Menschen faire Zukunftschancen eröffnet, auch in den ärmeren
Ländern und für die nachfolgenden Generationen. Bischof Wiesemann
betrachtet die Enzyklika daher auch als Bestärkung und Ermutigung
für die Anliegen der Kampagne „Gutes Leben. Für alle!“, die der
Katholikenrat des Bistums Speyer, das Bistum Speyer und das
katholische Hilfswerk Misereor im Jahr 2013 gemeinsam gestartet
haben. Sie appelliert an die gemeinsame Verantwortung aller
Menschen, dass die Erde auch für künftige Generationen bewohnbar
bleibt. Die Kampagne gibt Anregungen, den eigenen Lebensstil so zu
verändern, dass auch die Menschen in den Entwicklungsländern eine
Perspektive haben. Der Einzelne, aber auch Gruppen und
Einrichtungen sind eingeladen, das eigene Verhalten hinsichtlich
der globalen Verantwortung kritisch unter die Lupe zu nehmen. Die
Darstellung positiver Beispiele soll dabei zur Nachahmung
motivieren. is
Link zur deutschsprachigen Fassung der Enzyklika und einer
Inhaltsangabe:
http://www.dbk.de/presse/details/?presseid=2831&cHash=b144d0b3f8d1c0f3e78b109486e662a8
Link zur Kampagne „Gutes Leben. Für alle!“:
http://www.gutesleben-fueralle.de/
19.06.2015
Dank für 800 Jahre Dienst am Nächsten
 Die Jubilarinnen mit Vorsteher Pfarrer Dr. Werner Schwartz und Oberin Sr. Isabelle Wien (hinten rechts).
Die Jubilarinnen mit Vorsteher Pfarrer Dr. Werner Schwartz und Oberin Sr. Isabelle Wien (hinten rechts).
Auf 800 Jahre Zugehörigkeit zur Diakonischen
Gemeinschaft bringen es die 16 Diakonissen und Diakonischen
Schwestern, die im Speyerer Mutterhaus an Christi Himmelfahrt
traditionell Schwesternjubiläum feierten.
Speyer- Auf 70 Jahre Diakonissen-Leben blickten
die dienstältesten Jubilarinnen zurück, die ehemaligen Speyerer
Oberinnen Sr. Ilse Wendel und Sr. Elfriede Brassat sind immerhin
seit 65 bzw. 50 Jahren Diakonissen. Auf die vielfältigen Lebenswege
der Jubiläumsschwestern aus Speyer und Mannheim, die zum zehnten
Mal gemeinsam Jubiläum feierten, ging Vorsteher Pfarrer Dr. Werner
Schwartz in seiner Predigt ein. Unter unterschiedlichen
Voraussetzungen eingetreten, haben die Jubilarinnen die
verschiedensten Tätigkeiten in Kranken- und Altenpflege, der
Kinderbetreuung und vielem mehr ausgefüllt, allen gemeinsam ist,
dass sie Diakonie im Alltag gelebt haben. „Ohne Sie wäre das
Unternehmen Diakonissen Speyer-Mannheim heute nicht das, was es
ist“, betonte Schwartz. Er hoffe, „dass Ihr Dienst auch Ansporn ist
für uns, für die Mitarbeitenden heute.“
Dem schloss sich Oberin Sr. Isabelle Wien bei der Feier im
Mutterhaus-Festsaal an, zu der sie zahlreiche Familienangehörige,
Freunde und Weggefährten der Jubilarinnen sowie Mitarbeitende
begrüßte. In festlichem Rahmen würdigte Pfarrer Dr. Werner Schwartz
die Jubilarinnen in ihren Arbeitsfeldern, bevor Diakonisse Martha
Brunner, die ihr 70. Schwesternjubiläum feierte, über ihren Glauben
an Gott als Motivation für ihre Arbeit und ihr Tun sprach und sich
im Namen ihrer Mitschwestern für das Fest bedankte. Text und
Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
15.05.2015
Domkapitular i. R. Otto Schüßler verstorben
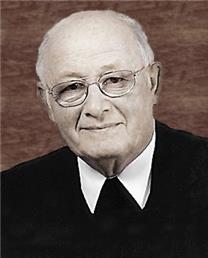 Fast 20 Jahre
Regens des Priesterseminars St. German in Speyer – Verantwortung
für verschiedene Aufgabenfelder in der Bistumsleitung
Fast 20 Jahre
Regens des Priesterseminars St. German in Speyer – Verantwortung
für verschiedene Aufgabenfelder in der Bistumsleitung
Speyer- Am 11. Mai ist Domkapitular i.R.
Otto Schüßler im Alter von 77 Jahren in Speyer verstorben.
Der gebürtige Neustadter wurde 1964 zum Priester geweiht. Er
wirkte als Kaplan in Pirmasens und St. Ingbert und war seit 1965
Präfekt des Studienheims St. Pirmin in Dahn. In Kusel und
Otterstadt war er als Pfarrverweser eingesetzt, bevor er 1972 als
Domvikar und Bischöflicher Sekretär nach Speyer gerufen wurde. Von
1987 bis 2006 war Otto Schüßler als Regens des Priesterseminars St.
German in Speyer tätig. Er kümmerte sich nicht nur um die
Priesteramtskandidaten, sondern auch um die Ausbildung der
Ständigen Diakone und der Pastoralreferenten.
1979 wurde Otto Schüßler in das Speyerer Domkapitel berufen. Er
gehörte der Speyerer Bistumsleitung rund drei Jahrzehnte an.
Zunächst war er für die Referate Liturgie, Ordensfragen und
Diaspora zuständig, dann übernahm er die Leitung der Diözesanstelle
für weltkirchliche Aufgaben. In dieser Funktion brachte der
Domkapitular maßgeblich die Partnerschaft zwischen dem Bistum
Speyer und der Diözese Cyangugu in Ruanda mit auf den Weg. 2002
wurde er zum Päpstlichen Ehrenprälat ernannt und übernahm 2003 die
Leitung des Dombauamtes. Als Domkustos war er Leiter der Abteilung
Diözesanmuseum, der Domschatzkammer und Verantwortlicher für die
Denkmal- und Kunstpflege im Bistum Speyer. Im Januar 2009 trat er
in den Ruhestand. „Otto Schüßler hat seine vielfältigen Begabungen
sehr segensreich für das Bistum Speyer eingebracht. Durch seine
Tätigkeit als Regens hat er eine ganze Generation von Priestern
entscheidend mitgeprägt“, würdigte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
das Wirken von Otto Schüßler.
Das Totenoffizium und Requiem für Prälat Otto Schüßler finden
am Montag, den 18. Mai, um 13.00 Uhr in der Friedenskirche St.
Bernhard in Speyer statt. Anschließend wird der Verstorbene auf dem
Kapitelsfriedhof beigesetzt.
Text und Foto: is
12.05.2015
Lautzkirchen Teil der Webseiten-Familie
 v.r.: Pastoralreferent Steffen Glombitza und Pfarrer Eric Klein präsentieren den neuen Auftritt in Speyer. Links daneben steht der Projektinitiator der Webseiten-Familie und Geschäftsführer von Peregrinus GmbH, Marco Fraleoni.
v.r.: Pastoralreferent Steffen Glombitza und Pfarrer Eric Klein präsentieren den neuen Auftritt in Speyer. Links daneben steht der Projektinitiator der Webseiten-Familie und Geschäftsführer von Peregrinus GmbH, Marco Fraleoni.
Mit Lautzkirchen ist ab sofort die erste saarländische
Pfarreiengemeinschaft Teil der Webseiten-Familie im Bistum
Speyer
Lautzkirchen/Speyer- Die Pfarreiengemeinschaft
Lautzkirchen feiert Premiere. Ab sofort ist unter www.pfarrei-lautzkirchen.de
der Internetauftritt online, der erstmals alle Ortschaften der
Pfarreiengemeinschaft umfasst. Damit zählt Lautzkirchen zu den
Vorreitern für die Neuausrichtung der Onlinekommunikation im Bistum
Speyer. Denn die Pfarreiengemeinschaft ist als erster
saarländischer Vertreter Bestandteil der stetig größer werdenden
Webseiten-Familie. Das zentrale Ziel der Webseiten-Familie ist es,
von der Pfarrei- über die Dekanats- bis zur Bistumsebene eine eng
vernetzte Onlinekommunikation zu etablieren. Besucher der neuen
Webseite sollen sich zielgerichtet orientieren können. Hierzu
zählt eine schnelle und professionelle Informationsaufbereitung mit
aktuellen redaktionellen Inhalten aus der
Pfarreiengemeinschaft.
Erstmals sind alle Ortschaften „online“ unter einem
Dach
Damit die vielfältigen Angebote und Leistungen, die die
katholische Kirche regional bietet, noch transparenter werden,
umfasst der neue Internetauftritt mit Alschbach, Bierbach,
Lautzkirchen, Limbach und Niederwürzbach erstmals alle Ortschaften
der Pfarreiengemeinschaft. Gottesdienstzeiten, Termine für
Veranstaltungen in den Gemeinden auf einen Blick, Angebote von
Kindertagesstätten oder die Adresse des Pfarrbüros – dank der
klaren Struktur, die sich an das identitätsstiftende
Erscheinungsbild der neuen Webseiten-Familie anlehnt, kommen
Interessenten nahezu intuitiv und mit wenigen Klicks ans gewünschte
Informationsziel.
Ehrenamtliche liefern Informationen ans
Redaktionsteam
 Nachrichten aus allen katholischen Einrichtungen der
Pfarreiengemeinschaft werden vom Team in der Onlineredaktion
eingepflegt. Pfarrer Eric Klein und Pastoralreferent Steffen
Glombitza erhalten die Informationen, Textvorlagen und Termine
direkt von Ehrenamtlichen, die in der Gemeindearbeit und den
katholischen Einrichtungen vor Ort aktiv sind. Als wichtige
Informationsquelle für die Gemeindearbeit ist beispielsweise auch
der Pfarrbrief online abrufbar.
Nachrichten aus allen katholischen Einrichtungen der
Pfarreiengemeinschaft werden vom Team in der Onlineredaktion
eingepflegt. Pfarrer Eric Klein und Pastoralreferent Steffen
Glombitza erhalten die Informationen, Textvorlagen und Termine
direkt von Ehrenamtlichen, die in der Gemeindearbeit und den
katholischen Einrichtungen vor Ort aktiv sind. Als wichtige
Informationsquelle für die Gemeindearbeit ist beispielsweise auch
der Pfarrbrief online abrufbar.
Pfarrer Eric Klein sagt: „Dass Lautzkirchen der erste
saarländische Vertreter der neuen Webseiten-Familie im Bistum
Speyer ist, freut uns. Wichtiger für die Gemeindearbeit vor Ort ist
jedoch die identitätsstiftende Rolle, die die Kommunikation für das
Zusammengehörigkeitsgefühl schafft.“
Zur besseren Orientierung sind die neuen Pfarreistrukturen, die
aus dem Prozess „Gemeindepastoral 2015“ resultieren, bereits
berücksichtigt. Was die Orientierung vereinfacht: Besucher können
über die sogenannte Landkarten- und die zusätzliche
Schlagwort-Navigation gezielt nach Inhalten suchen. Passgenaue
Informationen rund um Kirchenthemen, wie zum Beispiel zu häufigen
Suchschlagwörtern Hochzeit, Taufe oder Erstkommunion sind damit
schnell zur Hand. Aktuelle redaktionelle Inhalte von „der pilger“
dienen als flankierende Zusatzinformationen, die den Newswert und
die Attraktivität für Onlinebesucher erhöhen. Die
Projektverantwortlichen wurden bei der technischen und
redaktionellen Umsetzung umfassend begleitet und erhielten unter
anderem eine dreiteilige Schulung für das
Internet-Redaktionssystem.
Steffen Glombitza, Projektleiter in der Pfarrei, sagt: „Auf die
Einarbeitung folgt schnell das Erfolgserlebnis, wenn man mit den
technischen Möglichkeiten umgehen kann. Auch ist es eine schöne
Bestätigung, dass unsere neue Homepage bereits bei ersten
Vorabtests in der Gemeinde sehr gut ankommt!“ Die
Konzeptentwicklung zur Erstellung der Webseiten und der Schulungen
verantwortet die Peregrinus GmbH, der Verlag, in dem die
Bistumszeitung „der pilger“ erscheint.
Text: is; Foto: Peregrinus GmbH
10.05.2015
Kirche und Diakonie stellen 10.000 Euro Soforthilfe für Erdbebenhilfe zur Verfügung
 Speyer- Die Evangelische Kirche der Pfalz und die
Diakonie Pfalz unterstützen den Einsatz der Diakonie
Katastrophenhilfe für die Erdbebenopfer in Nepal mit 10.000 Euro
Soforthilfe. Gleichzeitig rufen sie zu Spenden auf.
Speyer- Die Evangelische Kirche der Pfalz und die
Diakonie Pfalz unterstützen den Einsatz der Diakonie
Katastrophenhilfe für die Erdbebenopfer in Nepal mit 10.000 Euro
Soforthilfe. Gleichzeitig rufen sie zu Spenden auf.
„Wie Haiti, das 2010 von einem schweren Erdbeben heimgesucht
wurde, trifft es auch in Nepal wieder eines der ohnehin ärmsten und
darum am wenigsten selbsthilfefähigen Länder der Welt. Ein sehr
armes Land ist niemals in der Lage, aus eigener Kraft solche
Katastrophen schultern und bewältigen zu können. Die Menschen
brauchen jetzt Ihre und unsere Unterstützung“, rufen
Oberkirchenrat Manfred Sutter und Diakoniepfarrer Albrecht
Bähr zu Spenden auf.
Partner der Diakonie Katastrophenhilfe aus dem weltweiten
kirchlichen Netzwerk der ACT Alliance haben unmittelbar nach dem
Beben, Soforthilfe eingeleitet. Die Überlebenden mit
Nahrungsmitteln und sauberem Trinkwasser zu versorgen hatte dabei
oberste Priorität. Da viele Häuser zerstört oder unbewohnbar
geworden sind, arbeiten die Helfer unter Hochdruck daran,
Notunterkünfte zum Schutz vor Regen und Kälte zu errichten.
„Die Menschen in Nepal werden sehr lange auf Hilfe angewiesen
sein, bis sie die Folgen dieser Katastrophe bewältigt haben“,
betonen Sutter und Bähr die langfristige Perspektive der
Hilfsmaßnahmen. Wiederaufbau und Katastrophenvorsorge müssten
Hand in Hand gehen und zusammen mit den Menschen vor Ort geplant
und umgesetzt werden.
Info: Die Diakonie Katastrophenhilfe ist Mitglied im
Aktionsbündnis Katastrophenhilfe. Die großen Hilfsorganisationen
Caritas international, Deutsches Rotes Kreuz, Diakonie
Katastrophenhilfe und Unicef Deutschland arbeiten im Bündnis
zusammen. Alle Organisationen verfügen über anerkannte langjährige
Erfahrungen in der Katastrophenhilfe, die sich jetzt auch im
Einsatz für die Opfer des Erdbebens in Nepal bewähren kann.
Spendenkonto:
Diakonie Katastrophenhilfe
Evangelische Bank eG
IBAN: DE78 5206 0410 0000 0014 14
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: Nepal
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz,
Presse
06.05.2015
„Baden schaut über den Rhein“
 Konzert zu Gunsten des Speyerer Dom
Konzert zu Gunsten des Speyerer Dom
von Franz Gabath
Speyer- Schon zum 12. Mal fand ein Konzert mit
dem Titel „Baden schaut über den Rhein“ im Dom statt. Chöre und
Orchester von der anderen Rheinseite konzertieren zu Gunsten des
Kaiser- und Mariendom. Auch das diesjährige Konzert fand
begeisterte Besucherinnen und Besucher. Der Dom war bis auf den
letzten Platz gefüllt.
In diesem Jahr gestalteten der Männerchor Hanauerland, der MGV
„Eintracht“ Mösbach, Der MGV Concordia Renchen-Ulm, Frauen der
Chorgemeinschaft, der Kammermusikkreis Rastatt, so wie die
Musikschule Gernsbach das Konzert. Weit über 120 Sängerinnen
und Sänger und ca. 80 Musikerinnen und Musiker füllten den Raum um
den Volksaltar und die Treppen vor den Königschor. Willi Kammerer
und Kreischorleiter des MSK, Friedemann Nikolaus leiteten die
Chöre. Die Stabführung des Orchesters hatte Joachim Kölmel inne. An
der Chororgel brillierte Holger Becker.
 Ein gewaltiger, beeindruckender Anblick bot sich
den Gästen und den Ehrengästen unter ihnen der erem.
Bischof, Anton Schlembach und Weihbischof Otto
Georgens, die vom 1. Vorsitzenden des Dombauvereins, Dr.
Wolfgang Hissnauer, willkommen geheißen wurden.
Ein gewaltiger, beeindruckender Anblick bot sich
den Gästen und den Ehrengästen unter ihnen der erem.
Bischof, Anton Schlembach und Weihbischof Otto
Georgens, die vom 1. Vorsitzenden des Dombauvereins, Dr.
Wolfgang Hissnauer, willkommen geheißen wurden.
Ein buntes, breitgefächertes Programm durch die verschiedensten
Stilrichtungen der Chormusik wurde den Zuhörern geboten. „One
Moment in Time“ von Whitney Houston, oder „Think of me“ aus der
Feder von Andrew Lloyd Webber, vom Orchester interpretiert,
sind modernere Stücke, jedem eingängig und bekannt. Frederic
Messner übernahm den Solotrompetenpart bei „Ich gehör nur mir“ aus
dem Musical „Elisabeth und bei „Once upon a Time“ von Ennio
Morricone. „The Rose“ von Mc Broon ist wohl eines der meist
gesungenen Stücke bei Chören aller Stilrichtungen. Ein besonderer
Genuss hier die Piccolo Trompeten von Jürgen Langmaier und Armin
Kühn. Eine Stecknadel hätte man hören fallen.
 Von moderneren Stücken wie „Mashiti aus Südafrika, oder
„My Lord what a morning, leiten die Männer gemeinsam mit den Frauen
zu konzertanteren Weisen über. „Sancta Maria“ von Johann Schweitzer
war genau so ein Hörgenuss wie “Ave Maria. Wenn ich ein Glöcklein
wär“ aus der Feder von J. Siegel. Franz Schubert zeichnet für
„Sanctus“ verantwortlich, Giuseppe Verdi für „La Vergine – die
Macht des Schicksals“.
Von moderneren Stücken wie „Mashiti aus Südafrika, oder
„My Lord what a morning, leiten die Männer gemeinsam mit den Frauen
zu konzertanteren Weisen über. „Sancta Maria“ von Johann Schweitzer
war genau so ein Hörgenuss wie “Ave Maria. Wenn ich ein Glöcklein
wär“ aus der Feder von J. Siegel. Franz Schubert zeichnet für
„Sanctus“ verantwortlich, Giuseppe Verdi für „La Vergine – die
Macht des Schicksals“.
Im Marienmonat, wurde besonders auch der Gottesmutter
gehuldigt. „Segne Du Maria, segne mich Dein Kind“ wurde
von Chor, Orchester, Orgel und der gesamten im Dom versammelten
Gemeinde angestimmt.
Domdekan Dr. Christoph Kohl dankte allen
Mitwirkenden, die sich in den Dienst des Domes gestellt hatten und
den Besuchern einen großen Kunstgenuss beschert hatten.
Einen besonderer Dank erhielt Udo Heidt von Dr. Hissnauer.
Die Konzertreihe „Baden schaut über den Rhein“ geht auf eine
Initiative von Udo Heidt, selbst Mitglied im Dombauverein, zurück.
Und seit 12 Jahren organisiert Udo Heidt dieses Konzert.
„Großer Gott wir loben Dich“, gesungen und gespielt von allen
Mitwirkenden und den Besuchern, war der krönende Abschluss
eines großartigen Konzertes, das den Gästen sicher noch lange in
Erinnerung bleiben wird und schon eine Werbung für die Fortsetzung
2016 darstellt.
Die Besucher dankten mit einer großzügigen Spende von über 5 000
Euro für den Erhalt, für Viele, „IHRES DOM zu SPEYER“!
Bild:fg
05.05.2015
Kinderbetreuung mit Engagement und Qualität
_1.jpg) Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kindertagesstätten
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann mit den Vertreterinnen und Vertretern der Kindertagesstätten
19 katholische Kitas im Bistum Speyer haben
Qualitätsmanagement eingeführt
Waldfischbach-Burgalben- In einer
dreijährigen Projektphase haben 19 katholische Kindertagesstätten
im Bistum Speyer ein Qualitätsmanagement eingeführt. Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann übergab nun im Rahmen einer Feier im
Bildungshaus Maria Rosenberg (Südwestpfalz) die Zertifikate,
ausgestellt vom Bundesverband Katholischer Tageseinrichtungen für
Kinder (KTK). Die anderen 221 Kitas in kirchlicher Trägerschaft
sollen in den nächsten Jahren folgen.
Wie der Bischof während seiner Predigt im vorausgegangenen
Gottesdienst betonte, sei die Einführung des Qualitätsmanagements
in den Kindertagesstätten bewusst eingebettet in die „Umbrüche
unserer Diözese“ durch den Erneuerungsprozess Gemeindepastoral
2015, der zum Jahreswechsel 2015/16 in Kraft tritt. Den
Kindertagesstätten komme in der neuen Struktur eine ganz besondere
Funktion zu: Sie sollen „Lernorte des Glaubens“ sein, in denen
authentisch die Botschaft Jesu gelebt und selbstbewusst in die
Gesellschaft getragen, Glaube und Liebe in alltäglichen Dingen
lebendig und die Liebe und die Sensibilität für die Kleinsten
spürbar werde. „Das Kostbarste, was wir haben, sind unsere Kinder“,
so der Bischof. Der Glaube solle daher nicht nur ein Baustein einer
katholischen Einrichtung sein, sondern der rote Faden, der sich
durch alle Bereiche zieht und zeigt: „Es ist Jesus Christus, der
uns leitet.“ Dieser rote Faden solle immer wieder neu entdeckt und
weiter in die Zukunft getragen werden, gab der Bischof den
anwesenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kindertagesstätten
und den Vertretern der Trägerpfarreien mit auf den Weg.
_1.jpg) Der Leiter der Abteilung Pfarrverbände und
Kindertagesstätten im Bischöflichen Ordinariat, Joachim
Vatter, der auch den Festabend moderierte, dankte in
seiner Ansprache daher auch den pastoralen Begleitern für ihre
Unterstützung in der Umsetzung. In dem Qualitätsprozess habe man
großen Wert darauf gelegt, dass alle Akteure eng zusammenarbeiten
und sich miteinander vernetzen. Als „einmalig“ würdigte er die
Tatsache, dass sich einige pädagogische Berater und
Verwaltungskräfte im Rahmen des Prozesses zu Qualitätsberatern
hatten fortbilden lassen.
Der Leiter der Abteilung Pfarrverbände und
Kindertagesstätten im Bischöflichen Ordinariat, Joachim
Vatter, der auch den Festabend moderierte, dankte in
seiner Ansprache daher auch den pastoralen Begleitern für ihre
Unterstützung in der Umsetzung. In dem Qualitätsprozess habe man
großen Wert darauf gelegt, dass alle Akteure eng zusammenarbeiten
und sich miteinander vernetzen. Als „einmalig“ würdigte er die
Tatsache, dass sich einige pädagogische Berater und
Verwaltungskräfte im Rahmen des Prozesses zu Qualitätsberatern
hatten fortbilden lassen.
Die Vertreterin des rheinland-pfälzischen Ministeriums für
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, Abteilungsleiterin
Regina Käseberg, stellte heraus, dass sich das Qualitätsmanagement
in den Kindertagesstätten im Bistum Speyer zu einer „echten Marke“
entwickelt habe, auf die alle Beteiligten stolz sein könnten. Jetzt
komme es darauf an, wie dies in der Praxis weiter umgesetzt werde.
„Wir brauchen Engagement und Qualität“, betonte sie.
Oberkirchenrat Manfred Sutter von der Evangelischen Kirche der
Pfalz wies auf die Vorreiterrolle hin, die die kirchlichen
Kindertagesstätten in Sachen Qualitätsmanagement im Land innehaben.
Auch die evangelischen Kindergärten sollen in den nächsten Jahren
einen ähnlichen Prozess durchlaufen.
Der Geschäftsführer des KTK-Bundesverbandes, Frank Jansen,
skizzierte die Inhalte des Bundesrahmenhandbuchs, das Grundlage des
KTK-Gütesiegels ist. Dies sei zum ersten eine Orientierungs- und
Arbeitshilfe für die Einrichtungen, um Arbeitsabläufe nach
aktuellen Anforderungen zu bewältigen. Zweitens umschreibe es die
inhaltliche Programmatik der katholischen Kindertagesstätten als
Orte des Glaubens mit einem sozialdiakonischen Profil, die eine
hochwertige Bildung und Erziehung sicherstellen. Und drittens sei
damit auch ein „Riesenengagement“ des Kita-Personals verbunden.
Immerhin seien über 200 Praxisindikatoren, die in neun
Qualitätsbereichen zusammengefasst sind, zu beachten. Die nun
zertifizierten Kindertagesstätten seien „kompetent in
Glaubensfragen“ und somit in der Lage, „das Recht jeden Kindes auf
Religion umzusetzen“.
Generalvikar Dr. Franz Jung wertete zum Abschluss des Abends die
Umsetzung des Qualitätsmanagements auch als Zeichen dafür, dass die
Kirche zur Veränderung fähig sei. Das Ende des Pilotprojekts sei in
Wahrheit ein Anfang: Denn in vier Staffeln würden nun auch alle
anderen katholischen Kindertagesstätten im Bistum Speyer dem
„Speyerer Qualitätsmanagement“ (SpeQM) unterzogen. Die nun
zertifizierten Einrichtungen sollen dabei als Ansprechpartner zur
Verfügung stehen und ihre Erfahrungen mit den anderen
Kindertagesstätten austauschen. „Wir sind auf dem Weg“, so der
Generalvikar, „aber der erste Schritt ist der allerwichtigste“.
Umrahmt wurde die Abschlussveranstaltung vom Elternchor
„Schwarzkehlchen“ der Kindertagesstätte Hermersberg sowie von
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Geschäftsstellen, die sich in
Sketchen dem Prozess des Qualitätsmanagements auf humorige Weise
annahmen. Text/Fotos: Holger Keller
04.05.2015
Europaweit Kriegsgegner miteinander ins Gespräch gebracht
 Der
Leiter der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, Friedhelm Schneider,
geht in den Ruhestand
Der
Leiter der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, Friedhelm Schneider,
geht in den Ruhestand
Speyer- Für Friedhelm Schneider, den
scheidenden Leiter der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt der
Evangelischen Kirche der Pfalz, darf es im Kernbereich
friedensethischer Fragen keine Kompromisse geben: „Nein zum Krieg“
lautete sein bis heute unveränderter Leitsatz, als er 1983 das neu
geschaffene Pfarramt für Kriegsdienstverweigerung und Zivildienst
übernahm. 2003 wurde Schneiders Dienststelle um den Umweltbereich
erweitert. Für den Friedenstheologen war das eine plausible
Entwicklung, denn die Überwindung von Gewalt und die Bewahrung der
Schöpfung sind „zentrale Anliegen christlicher Weltverantwortung“.
Am 31. Mai wird der 65-Jährige von Oberkirchenrat Michael Gärtner
in den Ruhestand verabschiedet. Der Gottesdienst in der
Auferstehungskirche Speyer beginnt um 14.30 Uhr, die Predigt zum
Thema „Frieden braucht Perspektivwechsel“ hält Pfarrer Schneider
selbst.
„Klar und klärend, differenziert und deutlich“ sollte nach
Schneiders Worten die friedensethische Position der Kirche sein.
Für den gebürtigen Aachener, der Theologie und Romanistik studiert
und nach seinem Vikariat zunächst an der Berufsbildenden Schule in
Ludwigshafen Religionsunterricht erteilt hat, ist es heute so
wichtig wie vor 32 Jahren, dieses Anliegen im Bewusstsein vor allem
der jungen Generation zu verankern. Angesichts von
Gewalt-Konflikten weltweit, zunehmenden Auslandseinsätzen der
Bundeswehr und enormen Rüstungsexporten („ein Skandal“) müsse die
Kirche „ohne Wenn und Aber“ ihre gesellschaftliche
Orientierungsfunktion wahrnehmen.
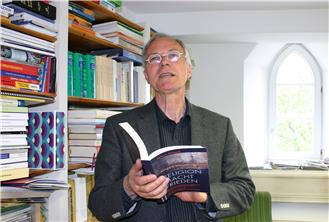 Bei dem
Versuch, Menschen für friedensethische Fragen zu sensibilisieren,
kann Schneider auf eine breite publizistische Tätigkeit
zurückblicken. Hunderte von Broschüren und Artikeln hat er im Laufe
der Jahre verfasst. 24 Jahre lang war er leitender Redakteur der
EKD-Zeitschrift „zivil“, die alle 50.000 evangelischen Zivis
erreichte. Über Jahrzehnte begleitete er Kriegsdienstverweigerer
beim Prozess der Gewissensentscheidung. Der von ihm aufgebaute
Auslandsdienst in Frankreich und Belgien half, Kriegsgegner aus
benachbarten Ländern miteinander ins Gespräch zu bringen,
Feindbilder abzubauen und europäische Perspektiven zu eröffnen.
Bei dem
Versuch, Menschen für friedensethische Fragen zu sensibilisieren,
kann Schneider auf eine breite publizistische Tätigkeit
zurückblicken. Hunderte von Broschüren und Artikeln hat er im Laufe
der Jahre verfasst. 24 Jahre lang war er leitender Redakteur der
EKD-Zeitschrift „zivil“, die alle 50.000 evangelischen Zivis
erreichte. Über Jahrzehnte begleitete er Kriegsdienstverweigerer
beim Prozess der Gewissensentscheidung. Der von ihm aufgebaute
Auslandsdienst in Frankreich und Belgien half, Kriegsgegner aus
benachbarten Ländern miteinander ins Gespräch zu bringen,
Feindbilder abzubauen und europäische Perspektiven zu eröffnen.
Wenn Schneider erzählt, veranschaulicht er seine Aussagen gerne
mit plakativen Beispielen: „Alle 14 Minuten stirbt ein Mensch durch
eine Kugel aus deutscher Produktion.“ Oder: „Jede Minute werden in
Deutschland 63.000 Euro für Rüstung ausgegeben“ und „automatisch
handelnde Waffen und bewaffnete Drohnen gehören völkerrechtlich
geächtet“. Wer Frieden will, muss den Frieden vorbereiten, erinnert
der Seelsorger an den Kernsatz der Friedensdenkschrift der EKD
(Evangelische Kirche in Deutschland) von 2007. „Ich sehe die
Entwicklung, dass Grundsätze christlicher Friedensethik in der
politischen Praxis immer mehr relativiert werden, mit großer
Sorge.“ Schneider regt an, dass die pfälzische Landeskirche hier
ein Zeichen setzen könne mit einer „Neuauflage“ einer umfassenden
friedensethischen Diskussion.
Seit Abschaffung der allgemeinen Wehrpflicht 2011 ist die
Arbeitsstelle Träger für den Bundesfreiwilligendienst in der
Landeskirche, sie ist national und international gut vernetzt mit
Organisationen und Programmen zur Kriegsdienstverweigerung und
Friedensbildung. Im Netzwerk Friedensbildung Rheinland-Pfalz
koordiniert die Arbeitsstelle 19 vorwiegend kirchlich orientierte
Friedensorganisationen und vertritt ihre Positionen in Schulen und
in der Jugendarbeit. Schneider ist Mitglied in der Evangelischen
Arbeitsgemeinschaft für Kriegsdienstverweigerung und Frieden (EAK)
und Präsident des Europäischen Büros für Kriegsdienstverweigerung
(EBCO). Keine Frage, dass ihn diese Aufgaben auch im Ruhestand
weiter beschäftigen werden – seine Beratung als Experte auf diesem
Gebiet ist sogar beim Europarat gefragt, in dessen Auftrag er u.a.
in Armenien, Russland, der Türkei und Griechenland tätig war.
Vor zwei Jahren beging die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt
dreißigjähriges Bestehen. Auch wenn schon viel erreicht wurde –
„Friedensarbeit ist kein Selbstläufer, sie braucht einen langen
Atem“, sagt Friedhelm Schneider. Und: „Sie kann einladend und auch
humorvoll sein, wie beispielsweise bei der
Anti-Kriegsspielzeug-Kampagne ‚Waffeln statt Waffen‘“. Der
begeisterte Hobbyfotograf ist selbst ein Freund origineller und
phantasievoller Bilder. Im Ruhestand will er einen Band mit
Bildimpressionen herausgeben. Arbeitstitel: „Meilensteine der
Friedensarbeit“.
Hinweis: Der Gottesdienst zur Verabschiedung von
Friedhelm Schneider findet am Sonntag, 31.Mai, um 14.30Uhr in der
Speyerer Auferstehungskirche (Am Renngraben) statt. Das
musikalische Rahmenprogramm gestaltet Viktor Bajlukov (Vibraphon).
Im Anschluss ist ein Empfang im Gemeindezentrum vorgesehen. Mehr
zum Thema unter www.frieden-umwelt-pfalz.de.
Text und Foto: lk
04.05.2015
Katholische Kirche und französische Besatzungspolitik
Forum Katholische Akademie und Bistumsarchiv laden zu
Vortrag ein
Speyer- „Katholische Kirche und französische
Besatzungspolitik in der Pfalz nach dem Ersten Weltkrieg“ lautet
das Thema eines Vortrags am Montag, 18. Mai (19.30
Uhr), im Friedrich-Spee-Haus (Edith-Stein-Platz 7) in Speyer.
Referent der gemeinsamen Veranstaltung des Forums Katholische
Akademie und des Bistumsarchivs Speyer ist Dr. Hans-Ludwig Selbach
(Bergisch-Gladbach), Verfasser einer 2013 veröffentlichten
Dissertation über die katholische Kirche und die französische
Rheinlandpolitik.
Mit der Besetzung des linken Rheinufers nach 1918 strebte
Frankreich letztlich eine deutliche Schwächung Deutschlands an.
Paris hoffte vor allem auf die Unterstützung der katholischen
Bevölkerung in diesem Gebiet, scheiterte jedoch auch im Südwesten
an der klaren Haltung von Bischof Ludwig Sebastian (1862-1943), von
Klerus und Gläubigen. Sie lehnten die Separatisten in der Pfalz
Ende 1923/Anfang 1924 ab, während die katholischen Saarländer sich
hartnäckig gegen eine Trennung von den deutschen Diözesen Speyer
und Trier wehrten.
Weitere Information und Anmeldung (bis 13. Mai): Forum Katholische
Akademie, Telefon 06 21/102-180. – Es wird ein Kostenbeitrag von
fünf Euro erhoben. is
04.05.2015
Christian Schad bleibt Vorsitzender der Union Evangelischer Kirchen
 Verbindungsmodell von Lutheranern und Unierten im
Mittelpunkt des Berichts vor der Vollkonferenz
Verbindungsmodell von Lutheranern und Unierten im
Mittelpunkt des Berichts vor der Vollkonferenz
Würzburg/Speyer- (lk). Der pfälzische
Kirchenpräsident Christian Schad ist erneut zum Vorsitzenden der
Union Evangelischer Kirchen (UEK) gewählt worden. Die Entscheidung
der Delegierten der UEK-Vollkonferenz in Würzburg fiel einstimmig.
Zum stellvertretenden Vorsitzenden wählten die Delegierten den
Kirchenpräsidenten der Evangelischen Kirche von Hessen und Nassau,
Volker Jung. Weitere Stellvertreterin bleibt die Präsidentin des
Kirchenamtes der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland,
Brigitte Andrae.
In seiner Vorstellungsrede betonte Schad, dass die
unterschiedlichen konfessionellen Prägungen einander bräuchten,
einander erforderten und einander beschenkten. „Es geht um Einheit
– unter Anerkennung gestalteter Vielfalt. Als Unionskirchen bringen
wir die Erfahrung ein, dass unterschiedliche konfessionelle Profile
der Einheit der Kirche nicht im Wege stehen“, sagte Schad vor dem
Plenum. Er wünsche sich „eine ausstrahlungsstarke evangelische
Kirche“ mit Christus als der gemeinsamen Mitte.
In seinem Bericht des Präsidiums der UEK ging Schad auf die
entscheidenden Weichenstellungen der vergangenen zwei Jahre ein. Im
Vordergrund habe die Weiterentwicklung des sogenannten
Verbindungsmodells von UEK und der Vereinigten
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Deutschland (VELKD) gestanden.
Grundlage des Modells sei die die „Leuenberger Konkordie“, die eine
Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft zwischen allen protestantischen
Konfessionen ermögliche. „Es geht darum, dass wir als lutherische,
reformierte und unierte Landeskirchen gemeinsam evangelische Kirche
sind“, erklärte Schad.
Im Blick auf 2017 erinnerte er daran, dass neben dem
Reformationsjubiläum auch die bevorstehenden Unionsjubiläen in den
Mitgliedskirchen der UEK gefeiert würden. „Wenn wir im Jahr 2017
und in den umliegenden Jahren an ‚200 Jahre Union’ erinnern, kann
dies auch der Besinnung darüber dienen, wie in der einen
evangelischen Kirche nicht nur unterschiedliche konfessionelle
Traditionen, sondern auch unterschiedliche Konfessionskulturen,
soziologische Milieus, politische Optionen und Frömmigkeitsstile
beheimatet sein können.“
Die Union Evangelischer Kirchen in der EKD arbeitet als
Zusammenschluss evangelischer Kirchen mit Sitz in Hannover. Die
Union der zwölf Mitgliedskirchen hat den Rechtsstatus einer
Körperschaft des öffentlichen Rechts. Die Vollkonferenz, das
Präsidium, die Ausschüsse und das Amt der UEK sind die handelnden
Organe der UEK. Der UEK gehören folgende Mitgliedskirchen an:
Anhalt, Baden, Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Bremen,
Evangelisch-reformierte Kirche, Hessen-Nassau, Kurhessen-Waldeck,
Lippe, Mitteldeutschland, Pfalz, Rheinland und Westfalen.
Kirchenpräsident Christian Schad steht seit 2013 an der Spitze der
UEK.
Neben der UEK gibt es innerhalb der Evangelischen Kirche in
Deutschland weiterhin die Vereinigte Evangelisch-Lutherische Kirche
Deutschlands (VELKD). Der VELKD gehören sieben Landeskirchen mit
insgesamt rund zehn Millionen evangelischen Christen an.
Mehr zum Thema: www.uek-online.de, www.velkd.de. Foto und Text:
Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche),
Presse
02.05.2015
Bistumshaus St. Ludwig: Wer hat das beste Konzept für eine neue Nutzung?
 Bistum Speyer schreibt Planung- und
Investorenwettbewerb aus – Preisgericht beurteilt die Konzepte im
November
Bistum Speyer schreibt Planung- und
Investorenwettbewerb aus – Preisgericht beurteilt die Konzepte im
November
Speyer- Das Bistum Speyer schreibt einen
Wettbewerb zur Nachnutzung des ehemaligen Bistumshauses St. Ludwig
in Speyer aus. Die Ausschreibung wurde gemeinsam mit der Stadt
Speyer erarbeitet und am 28. April im Bauausschuss der Stadt
beraten.
Gesucht wird eine Nachnutzung für das rund 7.000 Quadratmeter
große Grundstück zwischen Korngasse und Johannesstraße. Sie soll
das ehemalige Bistumshaus St. Ludwig bestmöglich in die Innenstadt
integrieren, sowohl optisch als auch funktional, sozial und
kulturell. Dabei sollen die denkmalgeschützte Kirche und der
ehemalige Klosterhof erhalten bleiben. Der Wettbewerb richtet sich
an Investoren, Bauträger oder Wohnungsbauunternehmen in Verbindung
mit Stadtplanern und Architekten. Die Ausschreibung gibt Raum für
innovative Ideen: Von Wohnprojekten über Ateliers, einem Hotel oder
Gastronomiebetrieb bis zu Nutzungen im Bereich Kunst und Kultur ist
vieles denkbar.
Der Wettbewerb ist in zwei Phasen unterteilt. In der ersten
Phase, die bis zum 23. Juni dauert, können potentielle Investoren
ihr Interesse bekunden und müssen dazu Referenzen sowie eine erste
Konzeptskizze vorlegen, aus der die angestrebte Nachnutzung
ersichtlich wird. Ein dreiköpfiges Gremium wählt aus den
eingegangen Bewerbungen bis zu zehn Arbeiten aus. Dem
Auswahlgremium gehören Kerstin Trojan (Stadtentwicklung und
Bauwesen der Stadt Speyer), Benjamin Schmitt (Abteilung
Liegenschaften des Bischöflichen Ordinariats) und Architekt Thomas
Andres (Gemeinnütziges Siedlungswerk Speyer) an.
Daran schließt sich in der zweiten Phase, die Anfang Juli
beginnt, ein Planungs- und Investorenwettbewerb an. Die
Aufgabenstellung: Bis Oktober sollen die Wettbewerbsteilnehmer ein
überzeugendes und tragfähiges Planungs- und Nutzungskonzept
vorlegen, verbunden mit einem Kaufpreisangebot. Die Konzepte werden
durch ein siebenköpfiges Preisgericht beurteilt, das im November
tagt. Ihm gehören Professor Bernhard Hort (Heidelberg), Professor
Dietrich Gekeler (Fachhochschule Darmstadt) Bernd Reif
(Stadtentwicklung und Bauwesen der Stadt Speyer), Baudirektor
Stephan Tschepella (Bischöfliches Ordinariat), Domkapitular Peter
Schappert (Bistum Speyer), Dompfarrer Matthias Bender und
Geschäftsführer Gerhard Müller (Gemeinnütziges Siedlungswerk) an.
Für jedes Mitglied des Preisgerichts wurde eine Vertreterin oder
ein Vertreter benannt. 13 Sachverständige werden in dem Wettbewerb
als Berater fungieren, darunter sind auch Vertreter des Speyerer
Stadtrates.
Die Beurteilung der Konzepte erfolgt in vier Dimensionen.
Bewertet wird ihre städtebauliche und architektonische Qualität.
Hinzu kommen die Angemessenheit der Nachnutzung und ihre soziale
und kulturelle Einbindung ins Stadtgefüge. Die Teilnehmer bleiben
bis zum Abschluss des Preisgerichts anonym. Ausgelobt sind
Preisgelder in Höhe von insgesamt 20.000 Euro, davon entfallen
8.000 Euro auf den Erstplatzierten. Der Wettbewerb wird vom
Architekturbüro „Kaupp und Franck“ aus Mannheim betreut. Im
Anschluss an das Urteil des Preisgerichts werden alle
Wettbewerbsarbeiten im Gemeinnützigen Siedlungswerk in Speyer
öffentlich ausgestellt. Text und Foto: is
Link zu den Ausschreibungsunterlagen: www.kaupp-franck-wettbewerb.de
29.04.2015
Diakonie ruft zu Spenden für Erdbebenopfer auf
 Erdbebenopfer benötigen dringend Hilfe
Erdbebenopfer benötigen dringend Hilfe
Speyer- Nach dem schweren Erdbeben in der
Himalaya-Region ruft die Diakonie Pfalz zu Spenden auf. Die Opfer
benötigen vor allem Medikamente, Decken, Nahrungsmittel und
sauberes Wasser. Die Zahl der Toten und Verletzten nach dem
schweren Erdbeben in der Himalaya-Region steigt ständig. Heftige
Nachbeben verängstigen die Überlebenden. Partner der Diakonie
Katastrophenhilfe sind in Nepal für die Opfer der Katastrophe
aktiv.
"Die größte Herausforderung für die Helferinnen und Helfer ist
nun die Betroffenen schnell zu erreichen. Nepal gehört zu den
ärmsten Ländern der Erde. Es gab sowieso nur wenige asphaltierte
Straßen und die Kommunikationssysteme sind überlastet. Nun wird der
Einsatz zum Kampf gegen die Zeit", sagt Martin Keßler, Leiter der
Diakonie Katastrophenhilfe.
Straßen zerstört - Täler unerreichbar
Langjährige Projektpartner der Diakonie Katastrophenhilfe haben
Büros und Mitarbeiter in Nepal und starteten bereits am Samstag
unmittelbar nach dem Beben erste Hilfsmaßnahmen. Das Notfallteam,
das sich in Kathmandu aufhält, ist einsatzbereit und koordiniert
die Hilfe vor Ort. Straßen sind zerstört, Kathmandu und 30 der 75
Distrikte im Westen und Zentrum Nepals sind von den Folgen des
Erdbebens betroffen. Es wird Tage dauern bis alle Verletzten
geborgen sind und alle betroffenen Regionen erreicht sind, um das
gesamte Ausmaß der Katastrophe abzuschätzen.
Das Team von Diakonie Katastrophenhilfe steht im engen Kontakt
mit den Projektpartnern in Nepal und in der Himalaya-Region. Um den
Menschen schnell helfen zu können, bittet das Hilfswerk um
Spenden.
Spendenkonto:
Diakonie Katastrophenhilfe
Evangelische Bank eG
IBAN: DE78 5206 0410 0000 0014 14
BIC: GENODEF1EK1
Stichwort: Nepal
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz,
Presse
www.diakonie-pfalz.de
27.04.2015
Mit der Aktion „Furchtlos“ für die Rechte von Frauen kämpfen
 v.l.: Wolfgang Huber, Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens
v.l.: Wolfgang Huber, Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens
„missio“-Präsident Wolfgang Huber zu Besuch bei Bischof
Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens – Monat der
Weltmission 2016 wird mit Gottesdienst in Speyer eröffnet
Speyer- Die Zusammenarbeit zwischen dem
katholischen Missionswerk „missio“ und dem Bistum Speyer stand im
Mittelpunkt einer Begegnung des Präsidenten von „missio“,
Monsignore Wolfgang Huber, mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und
Weihbischof Otto Georgens, der als Bischofsvikar für die
weltkirchlichen Aufgaben im Bistum Speyer verantwortlich ist. Es
war der erste Besuch des früheren Münchner Dompfarrers Wolfgang
Huber, der das katholische Missionswerk „missio“ München seit Mai
des vergangenen Jahres leitet.
Missio München ist mit 177 Jahren das älteste Werk seiner Art in
Deutschland. Die Organisation unterstützt Projekte in Afrika, Asien
und Ozeanien. Das Werk geht auf den 1838 gegründeten
Ludwig-Missionsverein zurück, der unter dem Protektorat des
Bayernkönigs Ludwig I. stand. Seinen heutigen Namen erhielt es nach
dem Zweiten Vatikanischen Konzil (1962 bis 1965). 2013 vergab
missio München rund 13,3 Millionen Euro für Entwicklungshilfe. Von
dem Geld profitierten 536 Projekte in mehr als 35 Ländern. Die
Mittel wurden unter anderem als Hilfe nach der Taifun-Katastrophe
auf den Philippinen oder zur Unterstützung katholischer Kopten in
Ägypten eingesetzt.
Monsignore Wolfgang Huber stellte den Speyerer Bischöfen die
neue Aktion „Furchtlos“ vor. Sie hat das Ziel, auf
Ungerechtigkeiten gegen Frauen hinzuweisen. Besondere Unterstützung
erfahren im Rahmen der Aktion Projekte, die sich für die Rechte von
Frauen stark machen. Pfarreien und Gemeinden können bei „missio“
ein Aktionspaket mit vielfältigen Materialien anfordern.
Ein weiteres Gesprächsthema war die bundesweite Eröffnung des
Monats der Weltmission, die im kommenden Jahr in Speyer gefeiert
wird. Dabei richtet sich der Blick auf die Philippinen als
Beispielland. Projektpartner von den Philippinen werden bei
Veranstaltungen und in Vorträgen über die Situation auf den
Philippinen berichten.
Weitere Informationen: www.missio.de Text und Foto:
is
27.04.2015
Detlev Besier wird neuer Pfarrer für Frieden und Umwelt
 Stadtjugendpfarrer von Kaiserslautern wechselt in
landeskirchliche Arbeitsstelle
Stadtjugendpfarrer von Kaiserslautern wechselt in
landeskirchliche Arbeitsstelle
Speyer/Kaiserslautern- (lk). Detlev
Besier wird neuer Pfarrer für Frieden und Umwelt in der
Evangelischen Kirche der Pfalz und Leiter der gleichnamigen
Arbeitsstelle . Das hat die Kirchenregierung am Freitag in Speyer
beschlossen. Der 55- Jährige ist seit 2010 Stadtjugendpfarrer in
Kaiserslautern und engagiert sich seit 2002 in der
Friedensinitiative Westpfalz, deren Sprecher er ist. Besier wird
Nachfolger von Friedhelm Schneider, der Ende Juni in Ruhestand
geht. Der in Hilden bei Düsseldorf geborene Besier hat in Bethel
und Erlangen studiert und war Gemeindepfarrer in
Reichenbach-Steegen und Landstuhl. Er ist verheiratet und hat zwei
erwachsene Kinder.
Die Arbeitsstelle Frieden und Umwelt ist die Fachstelle der
Landeskirche für Frieden und Umwelt, ihre Schwerpunktthemen sind
die Überwindung von Gewalt und die Bewahrung der Schöpfung, die als
zentrale Anliegen christlicher Weltverantwortung miteinander
verbunden sind. Zu den Aufgaben gehören friedensethische
Beratungsangebote und die Begleitung von jährlich rund 40 jungen
Menschen im Freiwilligendienst. Foto und Text: Evangelischen
Kirche der Pfalz (Protestantische Landeskirche), Presse
25.04.2015
„Proyecto Ija´tz“
 „Stipendienwerk Samenkorn“ will guatematekischen
Jugendlichen aus dem Volk der Maya Bildung und eine bessere Zukunft
ermöglichen
„Stipendienwerk Samenkorn“ will guatematekischen
Jugendlichen aus dem Volk der Maya Bildung und eine bessere Zukunft
ermöglichen
spk. Speyer. Das „Samenkorn“, das vor
inzwischen mehr als 20 Jahren in Form eines Stipendienwerks in die
Erde des mittelamerikanischen Landes Guatemala gelegt wurde – es
hat inzwischen längst eindrucksvoll bewiesen, dass es „reiche
Frucht“ zu bringen im Stande ist. Jetzt machten vier der
derzeitigen Stipendiaten von „Samenkorn e.V.“ – zwei Oberschüler
und zwei Universitätsstudenten - gemeinsam mit ihrem
Projektleiter, dem aus Kaiserslautern stammenden
und auf Menschenrechtsfragen spezialisierten Juristen
Christian Stich im Rahmen ihrer sie in 20 Städte
von Flensburg bis in den Südschwarzwald - von Aachen bis nach
Berlin führenden, vierwöchigen Reise durch Deutschland beim
Speyerer Bischofsvikar für weltkirchliche Aufgaben,
Weihbischof Otto Georgens, am Speyerer
Edith-Stein-Platz Station, um in einem Gespräch, an dem auch der
Leiter der Hauptabteilung Schulen und Hochschulen des Bischöflichen
Ordinariats in Speyer, Domdekan Dr. Christoph Kohl
und der Pastoralreferent für weltkirchliche
Fragen, Christoph Fuhrbach, teilnahmen, über die
Arbeit und Ziele dieser Einrichtung zu berichten.
 Bildung sei in Guatemala noch immer ein Privileg für eine
reiche Ober- und allenfalls eine Mittelschicht, so Christian Stich.
Nur jeder fünfte Jugendliche schaffe deshalb einen Schulabschluss
der Sekundarstufe - nur einer von Fünfzig ein Examen an einer
Universität. Besonders für die bis heute diskriminierten
Jugendlichen aus dem indigenen Volk der Maya sei der Weg zu Bildung
noch immer weitestgehend verschlossen, gäbe es nicht Einrichtungen
wie das Stipendienwerk „Samenkorn“.
Bildung sei in Guatemala noch immer ein Privileg für eine
reiche Ober- und allenfalls eine Mittelschicht, so Christian Stich.
Nur jeder fünfte Jugendliche schaffe deshalb einen Schulabschluss
der Sekundarstufe - nur einer von Fünfzig ein Examen an einer
Universität. Besonders für die bis heute diskriminierten
Jugendlichen aus dem indigenen Volk der Maya sei der Weg zu Bildung
noch immer weitestgehend verschlossen, gäbe es nicht Einrichtungen
wie das Stipendienwerk „Samenkorn“.
„Viele Kinder und Jugendliche müssen in ihren Familien schon
frühzeitig schlimme Erfahrungen von Gewalt machen und
Drogenmißbrauch durch ihre Eltern und Verwandten erleben“,
berichtete Stich. Häufig müssten sie zudem von klein auf bei der
Kaffeeernte mitarbeiten sowie bei der Betreuung ihrer oft
zahlreichen Geschwister sowie im Haushalt mithelfen. Besonders für
Mädchen gebe es deshalb meist kaum eine Chance auf eine höhere
Bildung, so der Projektleiter. „Mädchen sollen heiraten und
ihrerseits wieder Kinder bekommen“, so Stich, der vor gut fünf
Jahren den Weg nach Guatemala fand. Damals habe er den Einsatz für
das Stipendienwerk „Samenkorn“ als eine Möglichkeit für sich selbst
entdeckt, gegen die Benachteiligung der indigenen Bevölkerung in
Mittel- und Südamerika aktiv zu werden.
„Samenkorn“, so berichtete Stich weiter, vergebe seit fast
zwanzig Jahren Schul- und Universitätsstipendien an begabte junge
Guatemalteken aus armen Verhältnissen - vorzugsweise aus dem Volk
der Maya. Damit sei der Name „Samenkorn“ zugleich „Programm“,
wollten doch die Verantwortlichen in Guatemala und ihre
Unterstützer und Förderer im gleichnamigen Verein „Samenkorn e.V“
im sauerländischen Lüdenscheid mit diesem Projekt die Saat legen
für einen friedlichen Wandel in Guatemala. „Diese Saat soll durch
Bildung und Ausbildung ausgestreut werden“, unterstrich Christian
Stich sein eigenes„Credo“ und das seiner fünf vor Ort in Guatemala
tätigen hauptamtlichen Projektmitarbeiter sowie ihrer zahlreichen
Unterstützer in Deutschland.
 Das Stipendienwerk selbst sei bereits vor etwas mehr als
20 Jahren von der deutschen Journalistin und Politologin
Maria Christine Zauzich gegründet worden, die am 2. August
2009 leider bei einem Badeunfall an der guatemaltekischen
Pazifikküste ums Leben gekommen sei.
Das Stipendienwerk selbst sei bereits vor etwas mehr als
20 Jahren von der deutschen Journalistin und Politologin
Maria Christine Zauzich gegründet worden, die am 2. August
2009 leider bei einem Badeunfall an der guatemaltekischen
Pazifikküste ums Leben gekommen sei.
In den zwei Jahrzehnten seit der Gründung von „Samenkorn“ hätten
schon mehrere hundert Jugendliche auf den verschiedenen Ebenen – in
der Sekundarstufe und an der Universität - erfolgreich ihre
Abschlüsse machen können und arbeiteten heute als Ärzte, Lehrer,
Rechtsanwälte oder Psychologen. „Unsere Arbeit ist von der Vision
geleitet, die Gesellschaft Guatemalas durch Bildung schrittweise
verändern zu können“, erläuterte Stich die Motivation von Team und
Projekt. „Dabei wollen wir die bedrohte Kultur der Maya bewahren
und durch Bildung den immer noch latent vorhandenen Rassismus und
die Vorurteile in den Köpfen und Herzen überwinden“. „Samenkorn“
fördere dazu die Jugendlichen auf ihrem Bildungsweg und bei ihrer
Persönlichkeitsentwicklung. „Wer deshalb im Lande selbst eine
Perspektive sucht, der braucht nicht ins Ausland oder in die USA zu
fliehen, wie das immer noch viele tun, die im eigenen Land keine
Bildungs- und Zukunftschancen für sich sehen“, so der
Projektleiter.
Aktuell unterstütze „Samenkorn“ 35 Schüler und 20 Studenten –
derzeit übrigens mehrheitlich Mädchen und junge Frauen. Dabei
übersteige die Zahl der Bewerbungen für die Stipendien regelmäßig
die Zahl der freien Plätze um durchschnittlich das Dreifache, so
berichtete Christian Stich weiter.
Die Förderung für Schüler erstrecke sich dabei in der Regel über
drei Jahre bis zum Abitur und sei pro Monat mit eine Stipendium von
rund 100 Euro ausgestattet. Studenten würden in der Regel zwischen
fünf und sechs Jahren gefördert und erhielten dazu monatlich etwa
180 Euro. Durch die zuletzt eingetretene Verschlechterung des
Wechselkurses des Euro müsste derzeit jedoch höhere Förderbeträge
in der Landeswährung, dem „Quetzal“ aufgewendet werden, um das
gleiche Mass an Unterstützung zu gewähren.
 Zu der finanziellen Unterstützung komme zudem ein
begleitendes Bildungsprogramm, in dem „Samenkorn“ zum Beispiel die
Sprachkenntnisse der Stipendiaten erweitere, die in ihrer Mehrzahl
nur eine der gut zwanzig traditionellen Maya-Sprachen sprächen und
bereits bei der Amtssprache Spanisch oft erhebliche Defizite
aufweisen würden.
Zu der finanziellen Unterstützung komme zudem ein
begleitendes Bildungsprogramm, in dem „Samenkorn“ zum Beispiel die
Sprachkenntnisse der Stipendiaten erweitere, die in ihrer Mehrzahl
nur eine der gut zwanzig traditionellen Maya-Sprachen sprächen und
bereits bei der Amtssprache Spanisch oft erhebliche Defizite
aufweisen würden.
Aber auch Themen rund um Partnerschaft und Sexualität würden
behandelt, um so die noch immer große Zahl der „Kindermütter“ zu
verringern - Hilfen, die auch in die Familien und Dörfer
ausstrahlten, aus denen die Jugendlichen kommen. Häufig berichteten
die Jugendlichen in ihren Familien und Dörfern, was sie bei
„Samenkorn“ an neuen Kenntnissen gewonnen hätten.
Jeder Stipendiat engagiere sich darüber hinaus für gemeinnützige
Aufgaben in seinem Umfeld und verpflichte sich, hundert Stunden
gemeinnützige Arbeit pro Jahr einzubringen, wenn sie/ er auch
weiterhin die Förderung durch „Samenkorn“ erhalten wollten. „Darin
sehen wir eine Möglichkeit, wie die Jugendlichen etwas von dem
weitergeben können, was sie durch das Projekt erhalten haben“,
erklärt Christian Stich. Viele ehemalige Stipendiaten wirken in dem
Projekt zudem als Vertrauenspersonen für die jüngeren mit.
 Das Jahresbudget von „Samenkorn“ liege derzeit übrigens
bei etwa 125.000 Euro im Jahr und werde zum größten Teil von dem
deutschen Unterstützerkreis „Samenkorn e.V“ aufgebracht. Gemeinsam
mit Christian Stich arbeiten derzeit vier Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für „Samenkorn“ - alle aus dem Volk der Maya - unter
ihnen auch eine Psychologin.
Das Jahresbudget von „Samenkorn“ liege derzeit übrigens
bei etwa 125.000 Euro im Jahr und werde zum größten Teil von dem
deutschen Unterstützerkreis „Samenkorn e.V“ aufgebracht. Gemeinsam
mit Christian Stich arbeiten derzeit vier Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für „Samenkorn“ - alle aus dem Volk der Maya - unter
ihnen auch eine Psychologin.
Für den 23-jährigen Erwin Calel, der mit
Unterstützung von „Samenkorn“ Agrarwissenschaften in Guatemala
studiert, hat das Projekt auch eine große gesellschaftliche
Bedeutung: „Der geistige Horizont der einheimischen Bevölkerung
endet häufig am nächsten Hügel“, stellte er fest. Wenn es deshalb
gelinge, die Unwissenheit zu überwinden, dann könne daraus auch
eine kritische Haltung gegenüber politischen Ungerechtigkeiten
erwachsen, hofft er.
 Für die 24-jährige Jura-Studentin Maria-Jose
Xiloj sei die Begegnung mit „Samenkorn“ so etwas wie ein
„Weckruf“ gewesen.Sie habe dadurch viel Selbstbewusstsein dazu
gewonnen und glaube deshalb heute auch stärker als früher an sich
und ihre eigenen Fähigkeiten. Schon jetzt unterstütze sie die
Menschen in ihrem Dorf bei ihrer Korrespondenz mit Behörden und
anderen offiziellen Einrichtungen. Wichtig aber sei für sie vor
allem die Ermutigung, die sie durch „Samenkorn“ erfahren habe und
die sie nun an andere weitergeben könne. „Du kannst das auch
schaffen“ sei deshalb ein Satz, den die Menschen in ihrem Umfeld
häufig von ihr zu hören bekommen würden.
Für die 24-jährige Jura-Studentin Maria-Jose
Xiloj sei die Begegnung mit „Samenkorn“ so etwas wie ein
„Weckruf“ gewesen.Sie habe dadurch viel Selbstbewusstsein dazu
gewonnen und glaube deshalb heute auch stärker als früher an sich
und ihre eigenen Fähigkeiten. Schon jetzt unterstütze sie die
Menschen in ihrem Dorf bei ihrer Korrespondenz mit Behörden und
anderen offiziellen Einrichtungen. Wichtig aber sei für sie vor
allem die Ermutigung, die sie durch „Samenkorn“ erfahren habe und
die sie nun an andere weitergeben könne. „Du kannst das auch
schaffen“ sei deshalb ein Satz, den die Menschen in ihrem Umfeld
häufig von ihr zu hören bekommen würden.
 Ein Satz, den wohl auch die 21jährige Ana
Araceli oft gehört hat, die sich – eine Besonderheit im
Bildungswesen in Guatemala - derzeit auf ihren Beruf vorbereitet,
der sie gleichermaßen zur Arbeit als Grundschullehrerin wie zur
Erzieherin qualifizieren wird. Ana hat eine typische
guatemaltekische Karriere hinter sich: Schwester vieler Brüder und
Schwestern - Eltern, die Bildung für Mädchen für überflüssig halten
- da musste sie sich ihren Weg zu Ausbildung aus eigener Kraft
erkämpfen.
Ein Satz, den wohl auch die 21jährige Ana
Araceli oft gehört hat, die sich – eine Besonderheit im
Bildungswesen in Guatemala - derzeit auf ihren Beruf vorbereitet,
der sie gleichermaßen zur Arbeit als Grundschullehrerin wie zur
Erzieherin qualifizieren wird. Ana hat eine typische
guatemaltekische Karriere hinter sich: Schwester vieler Brüder und
Schwestern - Eltern, die Bildung für Mädchen für überflüssig halten
- da musste sie sich ihren Weg zu Ausbildung aus eigener Kraft
erkämpfen.
 Der 22jährige Annibal Garcia, der wie
die anderen Mitglieder der Besuchergruppe dank des regelmäßigen
Umgangs mit Christian Stich inzwischen durchaus brauchbar Deutsch
spricht, will nach dem Abitur Ökonomie studieren. Was ihn mit
seinen Kolleginnen und Kollegen eint, ist die feste Absicht, ihre
dank „Samenkorn“ gewonnenen Kenntnisse ganz in den Dienst ihres
Volkes, der Maya, zu stecken, das seit den Jahrhunderten der
Unterwerfung durch ihre spanischen Eroberer unendlich viel zu
leiden hatte.
Der 22jährige Annibal Garcia, der wie
die anderen Mitglieder der Besuchergruppe dank des regelmäßigen
Umgangs mit Christian Stich inzwischen durchaus brauchbar Deutsch
spricht, will nach dem Abitur Ökonomie studieren. Was ihn mit
seinen Kolleginnen und Kollegen eint, ist die feste Absicht, ihre
dank „Samenkorn“ gewonnenen Kenntnisse ganz in den Dienst ihres
Volkes, der Maya, zu stecken, das seit den Jahrhunderten der
Unterwerfung durch ihre spanischen Eroberer unendlich viel zu
leiden hatte.
 Weihbischof Otto Georgens, der mit einer
Delegation von „Adveniat“ das Land mit all seinen Problemen bereits
selbst kennenlernen konnte, zeigte sich tief beeindruckt von diesem
Projekt, das „in Menschen und ihre Bildung“ investiere. „Was als
Samenkorn vor mehr als zwanzig Jahren in den Boden gelegt wurde,
ist zu einem starken Baum emporgewachsen und trägt heute reiche
Frucht“, betonte Georgens. Der Weihbischof verband schließlich
seine Würdigung der Arbeit vor Ort in Guatemala mit der Hoffnung,
dass die Unterstützung für dieses Stipendienprojekt in Deutschland
nicht erlahmen möge.
Weihbischof Otto Georgens, der mit einer
Delegation von „Adveniat“ das Land mit all seinen Problemen bereits
selbst kennenlernen konnte, zeigte sich tief beeindruckt von diesem
Projekt, das „in Menschen und ihre Bildung“ investiere. „Was als
Samenkorn vor mehr als zwanzig Jahren in den Boden gelegt wurde,
ist zu einem starken Baum emporgewachsen und trägt heute reiche
Frucht“, betonte Georgens. Der Weihbischof verband schließlich
seine Würdigung der Arbeit vor Ort in Guatemala mit der Hoffnung,
dass die Unterstützung für dieses Stipendienprojekt in Deutschland
nicht erlahmen möge.
Weitere Informationen: www.stipendienwerk-guatemala.de <http://www.stipendienwerk-guatemala.de Foto: gc
23.04.2015
Modernes Blockheizkraftwerk für Wärme und Strom
 Sanierung und Umbau des Speyerer Priesterseminars tritt in
ihre „heiße“ Phase ein
Sanierung und Umbau des Speyerer Priesterseminars tritt in
ihre „heiße“ Phase ein
cr. Speyer- Mit der Demontage des alten,
längst nicht mehr ausreichend leistungsfähigen und bereits vor
Jahren von Öl auf Gas umgebauten Heizungskessels und dem Einbau
eines neuen, modernen, mit Gas „befeuerten“ Blockheizkraftwerkes
sind jetzt die umfangreichen Sanierungsmaßnahmen am Speyerer
Priesterseminar St. German im Vogelgesang im wahrsten Sinn des
Wortes in ihre „heiße“ Umsetzungsphase eingetreten. Im Beisein des
Hausherrn des Seminars, Regens Markus Magin und
dem für die Planung und Bauausführung des Gesamtprojektes
verantwortlichen Saarbrücker Architekten Oliver
Brünjes hat heute nämlich Peter Molitor
von dem mit dem Einbau der neuen Heizungs- und Warmwasserversorgung
des Seminars beauftragten Ludwigshafener Heizungsbauunternehmens
Willer GmbH Funktionsweise und Leistungsdaten der
neuen Heizungsanlage erläutert.
 Wie Molitor ausführte, leiste das neue Blockheizkraftwerk
(BHKW), das neben dem Priesterseminar auch das benachbarte
Karmel-Kloster mit Strom und Wärme versorgen wird, gleichzeitig 50
Kwh elektrische sowie 81 kwh thermische Energie. Angetrieben wird
dieses BHKW durch einen stationären Gasmotor mit 145 KW Leistung.
Die aus dem Kühlwasser des Gasmotors gewonnene Abwärme wird dabei
ebenso in das Heizungssystem eingespeist wie die Wärme aus den vier
zusätzlich für Bedarfsspitzen an kalten Tagen vorgehaltenen
Brennwertkesseln, die sich je nach Bedarf kaskadenartig selbständig
zuschalten.
Wie Molitor ausführte, leiste das neue Blockheizkraftwerk
(BHKW), das neben dem Priesterseminar auch das benachbarte
Karmel-Kloster mit Strom und Wärme versorgen wird, gleichzeitig 50
Kwh elektrische sowie 81 kwh thermische Energie. Angetrieben wird
dieses BHKW durch einen stationären Gasmotor mit 145 KW Leistung.
Die aus dem Kühlwasser des Gasmotors gewonnene Abwärme wird dabei
ebenso in das Heizungssystem eingespeist wie die Wärme aus den vier
zusätzlich für Bedarfsspitzen an kalten Tagen vorgehaltenen
Brennwertkesseln, die sich je nach Bedarf kaskadenartig selbständig
zuschalten.
Mit dieser Maßnahme zur Optimierung der Infrastruktur der
Baukörper von Karmel und Priesterseminar gehen nach Aussagen von
Regens Magin die Bauarbeiten langsam, aber sicher von der Phase der
Vorbereitung in den eigentlichen Umbau über. Dazu wird das
Priesterseminar am 1. Juli 2015 für voraussichtlich sechs Monaten
seine Pforten komplett schließen, um die umfangreichen Sanierungs-
und Umbaumaßnahmen zu ermöglichen, über die der
SPEYER-KURIER in seiner Rubrik „Kirchen“ bereits
in seiner Ausgabe vom 13.11.2014 unter der Überschrift
„Befreiungsschlag“ ausführlich berichtet hatte. Neben den derzeit
bereits in vollem Gange befindlichen Ausräumarbeiten werden dazu
die in den kommenden Wochen anstehenden Aushubarbeiten für die neu
zu errichtenden Aufzugschächte sowie Gerüstbaumaßnahmen dazu nur
erste „Vorboten“ sein.
Dann also allen Bauhandwerkern ein herzliches „Glückauf“ für
ihre Arbeit in den kommenden Monaten..Foto: gc
22.04.2015
Oberkirchenrat i.R. Ludwig Scheib verstorben
 Der
langjährige Bau- und Finanzdezernent der Landeskirche wurde 92
Jahre alt
Der
langjährige Bau- und Finanzdezernent der Landeskirche wurde 92
Jahre alt
Speyer/Annweiler- Der langjährige Bau- und
Finanzdezernent der Evangelischen Kirche der Pfalz (Protestantische
Landeskirche), Oberkirchenrat i.R. Ludwig Scheib, ist am 7. April
im Alter von 92 Jahren in Annweiler verstorben. Kirchenpräsident
Christian Schad würdigt ihn als „aufrechten Repräsentanten der
Evangelischen Kirche, dem wir zu tiefem Dank verpflichtet sind“.
Große Verdienste habe er sich „bei der Weiterentwicklung des
Haushaltsrechts, der Haushaltstransparenz und der Sicherstellung
der Altersversorgung der kirchlichen Beamten und Angestellten sowie
der Pfarrerinnen und Pfarrer“ erworben. Darüber hinaus habe er als
Baudezernent der Landeskirche den Blick auf die Kunst gelenkt.
„Viele künstlerische Gestaltungen im Bereich unserer Kirche sind
unter seinem Einfluss entstanden“, betont Kirchenpräsident Schad:
„Auch hat er vielen Künstlerinnen und Künstlern die Gelegenheit
gegeben, ihre Werke im Raum der Kirche aus- und darzustellen. Das
betone ich gerade in diesem Jahr der Reformationsdekade, in dem das
Thema ‚Bild und Bibel‘ im Mittelpunkt steht.“
Ludwig Scheib, 1922 in Bad Bergzabern geboren, hat das Bau- und
Finanzdezernat der Landeskirche fast zwei Jahrzehnte – von 1968 bis
1987 – geleitet. Vor seiner Ernennung zum Oberkirchenrat war er in
verschiedenen Funktionen der staatlichen Verwaltung tätig: Im
Landratsamt in Worms, beim Rechnungshof Rheinland-Pfalz in Speyer
sowie als Amts- und Verbandsbürgermeister in Kastellaun.
Der ehemalige Oberkirchenrat war zudem ein Verfechter der 1978
vollzogenen Namensänderung der Landeskirche in „Evangelische Kirche
der Pfalz“. Auf ihn geht auch die landeskirchliche Tradition
zurück, von regionalen Künstlern gestaltete Porträts früherer
Kirchenpräsidenten im Landeskirchenrat in Speyer in einer
Bildergalerie zu sammeln. Sprichwörtlich war Ludwig Scheibs
dienstliches Schlusswort anlässlich seiner Verabschiedung im Jahr
1987: „Wer sich einsetzt, der setzt sich aus, nur wer nichts tut,
macht auch keinen Fehler.“
Die Beerdigung findet am Montag, dem 13. April 2015, um 13 Uhr
auf dem Landauer Hauptfriedhof statt.
Text und Foto: lk
09.04.2015
180. Geburtstag von Heinrich Hilgard
 Hilgard-Büste vor dem Mutterhaus in der Hilgardstraße
Hilgard-Büste vor dem Mutterhaus in der Hilgardstraße
Speyer- Am 10. April jährt sich der Geburtstag
von Heinrich Hilgard, einem großzügigen Förderer zahlreicher
Einrichtungen der Speyerer Diakonissen, zum 180. Mal. 50 Jahre alt
war der gebürtige Speyerer, der 1853 nach Amerika auswanderte und
dort zu einem der großen Unternehmer des 19. Jahrhunderts wurde,
als er im Januar 1885 zur Einweihung des neugotischen
Mutterhausgebäude an der Hilgardstraße nach Speyer kam. Bereits ein
Jahr zuvor hatte er neben Pfarrer Karl Scherer, dem
Mutterhausvorsteher, mit dem er in Zweibrücken die Schulbank
gedrückt hatte, eine bemerkenswerte Rede anlässlich der
Grundsteinlegung gehalten.
Wenige Jahre zuvor hatte ihn der damalige Rechtskonsulent Georg
Süß, seinerzeit Mitglied im Verwaltungsrat des Mutterhauses, um
Unterstützung für ein neues Mutterhaus gebeten. Die
Schwesternschaft war auf neunzig Diakonissen angewachsen, die
Ausbildungsarbeit wurde zunehmend stärker, das Mutterhaus an der
Ecke Große Himmelsgasse/ St. Georgen-Gasse war zu klein
geworden.
Zur Grundsteinlegung 1884 kam Hilgard mit seiner Frau und seinem
kleinen Sohn. Er hielt sich zur Rekonvaleszenz in Deutschland auf
nach einem Schlaganfall, den er erlitten hatte, nachdem seine
Aktien plötzlich allen Wert verloren hatten. Mit seinem Reichtum,
den er sich durch den Verkauf von Eisenbahnaktien und als Erbauer
und Präsident der Northern Pacific Railroad sowie dem Bau und
Betrieb einer Schifffahrtslinie erworben hatte, war es zunächst
vorbei. Das Geld, das er dem Mutterhaus gestiftet hatte, musste für
den Neubau reichen, weitere Baupläne lagen zunächst auf Eis.
Erst später, als er erneut zu Wohlstand gekommen war, diesmal
vor allem durch die Übernahme und den Ausbau zweier Firmen des
Erfinders Thomas Edison, der Edison Machine und Lamp Company, aus
denen später der große Industriekomplex General Electric
hervorging, konnte das Diakonissenmutterhaus weiter von Hilgard
profitieren. 1889 wurde das Wilhelminenstift an der
Diakonissenstraße, benannt nach der Ehefrau Pfarrer Scherers, 1899
das Kinderheim an der Rulandstraße, damals das größte
Kinderkrankenhaus in Deutschland, gebaut. Aus dem Nachlass
Hilgards, der 1900 starb, konnte 1907 das erste Krankenhaus auf dem
Gelände errichtet werden, das heutige Ärztehaus I.
2014 hat mit der Neugestaltung des Parks beim Mutterhaus eine
Marmorbüste, die Heinrich Hilgard 1895 in New York herstellen ließ
und nach Speyer schickte, ihren Platz vor dem Hilgardstift
gefunden. Die Büste von Karl Scherer steht in Sichtweite im Park
vor dem Wilhelminenstift. Beide zusammen haben mit vielen anderen
Unterstützern den Ausbau des Diakonissenhauses in den letzten
beiden Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts wesentlich geprägt.
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
07.04.2015
„Voneinander lernen und miteinander Lösungen finden“
 Neu im
Presbyterium: Dirk Pohlmann aus Römerberg – Interesse auch an
übergeordneten Gremien
Neu im
Presbyterium: Dirk Pohlmann aus Römerberg – Interesse auch an
übergeordneten Gremien
Römerberg- Die ersten hundert Tage im Amt
haben die „Neuen“ in den Presbyterien der Evangelischen Kirche der
Pfalz schon hinter sich. Sie haben erste Erfahrungen gesammelt, den
Sitzungsbetrieb kennengelernt, ihre thematischen Schwerpunkte
gefunden. Die eine oder der andere hat bereits Interesse an
übergeordneten Entscheidungsgremien in der Landeskirche angemeldet.
So wie Dirk Pohlmann aus Römerberg im Kirchenbezirk Speyer. Der
45-Jährige ist vom Presbyterium in die Bezirkssynode gewählt worden
und freut sich nun darauf „gemeinsam mit Synodalen aus anderen
Gemeinden zu diskutieren, voneinander zu lernen und miteinander zu
Lösungen für gemeinsame Probleme zu kommen“.
Pohlmann, von Beruf Pressesprecher bei einem Unternehmen in der
Metropolregion, möchte – getreu dem Motto der Presbyteriumswahlen –
in seiner Kirche etwas „bewegen“: „Ich denke, dass Kirche noch
besser und gezielter vor Ort sichtbar sein sollte. Als Journalist
und Öffentlichkeitsarbeiter fühle ich mich da gefordert. Zudem sind
mir Musik und Liturgie wichtig, weil sie das Emotionale im Menschen
ansprechen, Gott im Gottesdienst auch sinnlich erfahrbar machen.“
In Römerberg sei genau die Hälfte des Presbyteriums neu im Amt.
„Das gibt ein schönes Miteinander aus wichtiger Erfahrung und neuem
Schwung. Ich bin sicher, dass wir einiges werden bewegen können.“
Das Engagement sei jedenfalls groß: „Als es zum Beispiel um die
Verteilung von Kirchendiensten ging, blieb keine Hand unten. Das
finde ich ein tolles Zeichen!“
Kirchennähe ist dem Wahlpfälzer, der in Hessen aufgewachsen ist,
sozusagen in die Wiege gelegt worden. „Meine Kindheit und Jugend
waren kirchlich geprägt – mit Jugendgruppe, Konfirmandenbetreuung
und Kindergottesdienst. Nach einer Zeit ohne aktive Beteiligung an
Kirche, in der Beruf und Familie im Vordergrund standen, habe ich
gemerkt, dass ich mich gerne wieder engagieren möchte. Da kamen die
Wahlen Ende 2014 genau richtig.“ Das Presbyter-Handbuch, in dem auf
552 Seiten alles Wesentliche über die Landeskirche, ihre Gremien
und ihre Aufgaben steht, hat er schon studiert. „Ich habe nicht
jedes Wort gelesen, aber die wichtigsten Abschnitte. Ich finde
dieses Buch als theoretische Begleitung wirklich gut“, sagt
Pohlmann. Trotzdem sei praktische Erfahrung nicht zu ersetzen. Das
gelte gerade für den Erfahrungsschatz der Presbyter, die schon die
eine oder andere Amtsperiode hinter sich haben. „Da werde ich noch
viel zuhören und nachfragen.“
Pohlmann ist verheiratet und Vater von drei Kindern zwischen
vier und neun Jahren. Berufliches und ehrenamtliches Engagement
könne er gut miteinander vereinbaren – weil die Familie mitspielt.
Sie sei bereit, gelegentlich abends für Sitzungen und
Veranstaltungen auf ihn zu verzichten. Nur bei den Wochenenden
hoffe er, „dass es nicht zu viele werden, denn die Zeit geht dann
echt vom Familienleben ab. Ich bin aber zuversichtlich, dass sich
immer ein Kompromiss findet, der allen gerecht wird – ab und an
wird sicher auch die Familie den Vorrang haben.“ Wenn
Kirchenpräsident Christian Schad am 26. September zum „Tag der
offenen Tür“ im Landeskirchenrat in Speyer einlädt, will er
jedenfalls dabei sein, am liebsten mit der ganzen Familie.
Hinweis: Die Bezirkssynode des Kirchenbezirks Speyer tagt
zum ersten Mal in der neuen Legislaturperiode am Samstag, 18.
April, 9 bis 13 Uhr, in Speyer. Zum Kirchenbezirk gehören 18
Kirchengemeinden – von Fußgönheim im Norden bis Römerberg im Süden.
Der Kirchenbezirk Speyer hat rund 47.000 Mitglieder, Dekan ist
Markus Jäckle.
Text und Foto: lk
07.04.2015
„Ostern beginnt mitten in den Wunden dieser Welt“
 Gläubige begehen mit feierlichen Ostergottesdiensten den
Höhepunkt des Kirchenjahres
Gläubige begehen mit feierlichen Ostergottesdiensten den
Höhepunkt des Kirchenjahres
Speyer- Mehrere tausend Gläubige besuchten
an den Ostertagen die festlich gestalteten Ostergottesdienste im
Speyerer Dom. In der Osternacht feierten sie die Auferstehung Jesu
als Höhepunkt des Karwoche und des gesamten Kirchenjahres.
„Ostern ist die Liebe, die in den Wunden dieser Welt leuchtet“,
wies Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann bei seiner Predigt am
Ostersonntag auf den inneren Zusammenhang mit den vorangegangenen
Tagen hin. „Es gibt kein Ostern ohne Gründonnerstag und Karfreitag.
Diese drei Tage bilden ein Geschehen.“ Was Auferstehung bedeutet,
können niemals an den Wunden dieser Welt vorbeigehen. Wer Ostern
von der Todesangst Jesu auf dem Ölberg und von dem gewaltlosen
Erleiden eines gewaltsamen Todes am Karfreitag ablöse, ebne den Weg
zu einer religiösen Banalisierung des Todes oder umgekehrt zu
seiner Heroisierung. „Man kann den Auferstandenen nicht ohne seine
Wunden sehen. Im Gegenteil: Man sieht ihn erst durch seine Wunden
hindurch.“ Er erinnerte an die vielen Menschen auf der Flucht,
„deren Ölbergstunden der Angst vor Terror und Gewalt kein Ende zu
nehmen scheinen.“ Es falle in diesem Jahr nicht leicht, angesichts
des Todes und der Gewalt in der Welt über die Freude der
Auferstehung zu predigen. „Das Gewaltsame des Todes greift nach uns
in der unbegreiflichen Tragik unschuldiger Schicksale, die er mit
sich in den Abgrund zieht, und in der rücksichtslosen Brutalität,
mit der er seine Wunden schlägt“, so Bischof Wiesemann auch im
Blick auf die Opfer des Flugzeugabsturzes in Südfrankreich. „Wir
fühlen mit den Betroffenen, den Angehörigen der Opfer und auch des
Täters.“
 Der
Mädchenchor, die Domsingknaben, der Domchor und das Domorchester
führten im Rahmen des festlichen Gottesdienstes die „Missa in C“
(„Spaurmesse“, KV 258) von Wolfgang Amadeus Mozart und das
„Halleluja“ aus dem „Messiah“ von Georg Friedrich Händel auf.
Der
Mädchenchor, die Domsingknaben, der Domchor und das Domorchester
führten im Rahmen des festlichen Gottesdienstes die „Missa in C“
(„Spaurmesse“, KV 258) von Wolfgang Amadeus Mozart und das
„Halleluja“ aus dem „Messiah“ von Georg Friedrich Händel auf.
Neuer Raum für das Wirken Gottes
In seiner Predigt in der Osternacht betonte Bischof Wiesemann,
die österliche Botschaft des leeren Grabes sei nicht nur der
physische Beweis für die Auferstehung Jesu. Das leere Grab weise
auch auf den neuen Raum für das Wirken Gottes hin, der alle
geschlossenen Denkweisen des Menschen durchkreuze. Es schaffe
ungeahnte Möglichkeiten der Freiheit Gottes, selbst über die Macht
des Todes hinaus.
Der Bischof verwies auf die Taufbewerberin, die im Anschluss an
die Ansprache das Sakrament der Taufe empfing. Aufgewachsen in der
ehemaligen DDR, in einer Welt ohne Gott, habe sie im Westen zum
christlichen Glauben gefunden. In ihrer Taufe werde sie – wie alle
Getauften - neu hineingeboren in die Freiheit Gottes. „Das ist das
Geheimnis dieser Nacht“, sagte Bischof Wiesemann.
 Begonnen hatte der rund dreistündige Gottesdienst mit der
Weihe des Osterfeuers und der Osterkerze in der Domvorhalle.
Anschließend zogen die Gläubigen, darunter die Kommunionkinder der
Dompfarrei, mit ihren Kerzen in die völlig dunkle Kathedrale und
gaben das Licht, Symbol für den auferstandenen Christus, an alle
Mitfeiernden weiter.
Begonnen hatte der rund dreistündige Gottesdienst mit der
Weihe des Osterfeuers und der Osterkerze in der Domvorhalle.
Anschließend zogen die Gläubigen, darunter die Kommunionkinder der
Dompfarrei, mit ihren Kerzen in die völlig dunkle Kathedrale und
gaben das Licht, Symbol für den auferstandenen Christus, an alle
Mitfeiernden weiter.
Für die musikalische Gestaltung des festlichsten Gottesdienstes
des Kirchenjahres sorgten unter der Gesamtleitung von
Domkapellmeister Markus Melchiori die Kantorenschola am Dom zu
Speyer, die Dombläser, Domkantor Alexander Lauer, Domorganist
Markus Eichenlaub sowie die Schola Cantorum Saliensis unter der
Leitung des stellvertretenden Domorganisten Christoph
Keggenhoff.
Weihbischof Georgens predigte bei Karfreitagsliturgie
„Die Feier des Leidens und Sterbens Christi öffnet uns einen
Weg“, betonte Weihbischof Otto Georgens in der Karfreitagsliturgie.
Christus nehme den Menschen bei der Hand, damit er lerne, wieder
die Arme zu öffnen und sich von neuem darauf einzulassen zu lieben.
In Zeiten der Trauer, in Erfahrungen von Trennung, Unverständnis,
Verrat und Unrecht bestehe die Tendenz, sich zu verschließen und
zurückzuziehen. „Das ist eine natürliche und verständliche
Reaktion“, so Georgens. Doch sie könne zur Verbitterung führen.
Christus habe dem Menschen einen anderen Weg aufgetan: „Vertrauen,
dass das Leben, trotz aller Trennung, weitergeht, dass die Liebe
alle Barrieren des Hasses überwindet, dass die Liebe den anderen
befreit, dass die Treue stärker ist als der Verrat – viele Menschen
gehen auf diesem Weg.“ Der Mädchenchor, die Domsingknaben und der
Domchor sangen die „Johannespassion“ von Wolfram Menschick und
Liedsätze von da Vittoria, Silcher, Mozart und Bach.
Predigt von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am Ostersonntag
im Wortlaut:
http://cms.bistum-speyer.de/www2/index.php?myELEMENT=279007&cat_id=31430&mySID=886e776742a7c70666253f3b273826d2
Predigt von Weihbischof Otto Georgens am Karfreitag im
Wortlaut:
http://cms.bistum-speyer.de/www2/index.php?myELEMENT=279006&cat_id=31426&mySID=886e776742a7c70666253f3b273826d2
Text: is; Foto: Klaus Landry
05.04.2015
„Vertrauen überdauert den Tod, Hoffnung wächst in den Himmel“
 Ostergottesdienst mit Kirchenpräsident Christian Schad in
der Speyerer Gedächtniskirche
Ostergottesdienst mit Kirchenpräsident Christian Schad in
der Speyerer Gedächtniskirche
Speyer- Himmel und Erde, Göttliches und
Menschliches sind nicht getrennt, sondern liegen nah beieinander:
Das Ostergeschehen, wie es im Johannes-Evangelium geschildert wird,
zeige, dass „das Vertrauen den Tod überdauert, Liebe Leid
überwindet und Hoffnung in den Himmel wächst“, hat Kirchenpräsident
Christian Schad im Gottesdienst am Ostersonntag in der Speyerer
Gedächtniskirche gesagt. Die Szenen zwischen himmlischer und
irdischer Wirklichkeit machten für die Menschen „einen Weg hinter
dem Horizont“ sichtbar. Wo vorher die Welt am Ende zu sein scheine,
erlebe sie einen neuen Aufbruch. Barmherzigkeit statt Verurteilung,
Hochachtung statt Geringschätzung, Leben statt Resignation und
Frieden statt Misstrauen seien möglich, sagte Kirchenpräsident
Christian Schad in seiner Predigt.
Die biblische Ostererzählung von Maria am Grab Jesu sei an
Zärtlichkeit und Behutsamkeit kaum zu übertreffen: „Eine Frau
weint, wie Menschen weinen, wenn ihnen etwas genommen wird, was
Hoffnung, Liebe und Leben versprach.“ Zwar gewinne der Tod umso
mehr an Macht, je länger die Erde bestehe, und es gehöre „zu unser
aller Wirklichkeit, dass wir uns vor dem Tod nicht drücken können“,
sagte Schad. Aber gegen die Resignation stehe die Gewissheit: „Gott
hat uns nicht nur ins Leben gerufen, als er uns erschaffen hat. Er
ruft uns auch in der Verzweiflung beim Namen.“ Darum setzten
Trauer, Träume, die Liebe, aber auch der Umgang mit Kunst und Musik
Erfahrungen frei für die Ewigkeit. „Klug ist nicht nur, wer mit
trockenem Auge die Wirklichkeit analysiert. Weise ist auch, wer in
allem, was er erlebt, den Himmel offen stehen sieht.“ Mit der
Auferstehung Jesu würden alle Wege neu beginnen, das Leid werde von
der Liebe überwunden, so Kirchenpräsident Schad.
Die Liturgie des Ostergottesdienstes in der Speyerer
Gedächtniskirche gestaltete Dekan Markus Jäckle. Das
Kammerorchester an der Gedächtniskirche, die Kantorei Speyer und
Vokalsolisten führten unter der Leitung von Kirchenmusikdirektor
Robert Sattelberger die Kantate „Heut triumphieret Gottes Sohn“ von
Dietrich Buxtehude auf.
Text und Foto: lk
05.04.2015
Bischof gratuliert Alt-Kanzler Helmut Kohl zum 85. Geburtstag
.jpg) „Er
hat sich in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt des
Weltkulturdenkmals Speyerer Dom verdient gemacht“
„Er
hat sich in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt des
Weltkulturdenkmals Speyerer Dom verdient gemacht“
Speyer- Heute am Freitag, den 3. April,
wird Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut Kohl 85 Jahre alt. Der Speyerer
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann wird ihn nach der
Karfreitagsliturgie besuchen und ihm persönlich gratulieren. Kohl
habe sich als Kanzler der Einheit und Architekt Europas
herausragende Verdienste erworben, so der Bischof. Bis heute stehe
er in einer lebendigen Beziehung zum Bistum Speyer und besonders
zum Speyerer Dom, der für ihn ein religiöses, historisches und
kulturelles Zeugnis der Einheit Europas darstellt.
In seiner Amtszeit hat Kohl zahlreiche ausländische Staatsgäste
nach Speyer geführt, darunter Margaret Thatcher, Michael
Gorbatschow, George Bush, Vaclav Havel, Boris Jelzin und König Juan
Carlos. Am Beispiel des Domes habe er ihnen die Bedeutung der
christlichen Wurzeln für ein Zusammenleben in Gerechtigkeit und
Frieden in Deutschland, Europa und der Welt verdeutlicht. „Durch
sein Engagement im Kuratorium der Europäischen Stiftung Kaiserdom,
dem er bis heute vorsteht, hat er sich in außergewöhnlicher Weise
um den Erhalt des Weltkulturdenkmals Speyerer Dom verdient
gemacht“, würdigte Wiesemann Kohls Engagement. Als Geschenk
überreicht er ihm ein Bronzekreuz des im Jahr 2011 verstorbenen
Künstlers Klaus Ringwald, der auch die Erinnerungstafel zum Besuch
von Papst Johannes Paul II. am Westportal des Domes geschaffen hat.
Text und Foto: is
03.04.2015
Religion und Gewalt schließen sich aus
 Kirchenpräsident wendet sich in seiner Karfreitagspredigt
gegen Missbrauch des Glaubens
Kirchenpräsident wendet sich in seiner Karfreitagspredigt
gegen Missbrauch des Glaubens
Otterbach- Als „Protest gegen alle Gewalt“
hat Kirchenpräsident Christian Schad den Tod Jesu am Kreuz
bezeichnet. In seiner Karfreitagspredigt in der Protestantischen
Kirche in Otterbach erklärte Schad, dass Gott in Jesus Christus die
Spirale von Gewalt und Gegengewalt durchbrochen habe und „sich
Religion und Gewalt seit Jesu Tod ein für allemal ausschließen“.
Der Gott, der am Kreuz gestorben sei, sei von Menschen gefoltert
und getötet worden, die einen Sündenbock gebraucht hätten, um ihre
Macht zu sichern. In der Konfrontation mit Gott habe sich das Böse
im Kreuz Jesu förmlich „aus-gewirkt, aus-getobt, im Sinne von:
erschöpft“.
Beim Karfreitagsgeschehen gehe es folglich darum, das Unrecht
aufzuheben. „Es soll Schluss sein mit der Gewalt unter Menschen im
Kleinen, wie im Großen: dort, wo ein Einzelner die Hand gegen den
Anderen erhebt ebenso wie dort, wo Staaten ihre Konflikte mit
Waffengewalt zu lösen versuchen“, sagte Schad. Das Kreuz Jesu
schärfe den Menschen auch heute ein, dass es ein Ende haben müsse
mit dem bösen Gemisch von Religion und Gewalt. In der Ohnmacht des
Gekreuzigten seien die humanen, die Frieden stiftenden
Kraftquellen aufzudecken, die alle Menschenfeindlichkeit überwinden
könnten, erklärte der Kirchenpräsident.
Zwar dürfe man über das Unrecht der Menschen schon wegen der
Opfer nicht einfach hinweggehen, „denn wenn Unrecht ungesühnt
bleibt, dann triumphieren die Täter ein zweites Mal über ihre
Opfer“, sagte Schad. Auch Gott mache deutlich, dass Unrecht gesühnt
werden müsse, jedoch indem er die Strafe, die eigentlich Menschen
gelten müsse, auf sich nehme. Wer auf Jesus schaue, setze an die
Stelle der Gewalt die Liebe, an die Stelle der Habsucht die
Bereitschaft zum Teilen.
Die Geschichte vom Kreuz spricht nach Auffassung des
Kirchenpräsidenten „mitten in unsere Wirklichkeit hinein“ und
verstecke das Leiden in der Welt und im persönlichen Leben nicht
hinter religiösen Wellnessformeln. Sie erzähle vielmehr von
einem Gott, der selbst gelitten habe und der den Menschen „hält und
trägt und frei machen will von dem, was ihn beschwert“.
Karfreitag ist der Tag der Kreuzigung Jesu auf dem Hügel
Golgatha vor den Toren Jerusalems. Der Name leitet sich von „karen“
(altdeutsch: wehklagen) ab. Die Gottesdienste, die an diesem Tag
gefeiert werden, stehen ganz im Zeichen der Trauer. Der
Gottesdienst in Otterbach wurde von Dekan Matthias Schwarz
und dem Protestantischen Kirchenchor mitgestaltet. lk
03.04.2015
„Christus lehrt uns, trotz Verwundungen immer wieder die Arme zu öffnen“
 Weihbischof Otto Georgens ruft bei Karfreitagsliturgie im
Dom dazu auf, nicht bei Enttäuschungen stehen zu bleiben
Weihbischof Otto Georgens ruft bei Karfreitagsliturgie im
Dom dazu auf, nicht bei Enttäuschungen stehen zu bleiben
Speyer- „Die Feier des Leidens und
Sterbens Christi öffnet uns einen Weg“, betonte Weihbischof Otto
Georgens in der Karfreitagsliturgie. Christus nehme den Menschen
bei der Hand, damit er lerne, wieder die Arme zu öffnen und sich
von neuem darauf einzulassen zu lieben.
In Zeiten der Trauer, in Erfahrungen von Trennung,
Unverständnis, Verrat und Unrecht bestehe die Tendenz, sich zu
verschließen und zurückzuziehen. „Das ist eine natürliche und
verständliche Reaktion“, so Georgens. Doch sie könne zur
Verbitterung führen.
Christus habe dem Menschen einen anderen Weg aufgetan:
„Vertrauen, dass das Leben, trotz aller Trennung, weitergeht, dass
die Liebe alle Barrieren des Hasses überwindet, dass die Liebe den
anderen befreit, dass die Treue stärker ist als der Verrat – viele
Menschen gehen auf diesem Weg.“ is
03.04.2015
Im Bistum Speyer wird es 376 Gemeinden geben
 Künftige Pfarreien haben Anzahl ihrer Gemeinden mitgeteilt
– Entscheidung hat auch Auswirkung auf die Wahl der Pfarrgremien im
Oktober
Künftige Pfarreien haben Anzahl ihrer Gemeinden mitgeteilt
– Entscheidung hat auch Auswirkung auf die Wahl der Pfarrgremien im
Oktober
Speyer- Im Durchschnitt gehören fünf bis
sechs Gemeinden zu jeder der 70 Pfarreien, die im Bistum Speyer am
1. Januar 2016 gebildet werden. Insgesamt wird es im Bistum 376
Gemeinden geben. Das hat die Rückmeldung der Pfarreien an das
Bischöfliche Ordinariat ergeben.
Die größte Zahl von Gemeinden, nämlich insgesamt zwölf, umfasst
die Pfarrei Heiliger Petrus in Dahn. Am anderen Ende der Skala
steht die Pfarrei Heiliger Disibod in Feilbingert, die keine
Unterteilung in Gemeinden vornimmt. Die Zahl der Gemeinden wirkt
sich unter anderem auf Wahl der Pfarrgremien im Oktober aus. Jede
Gemeinde hat einen Gemeindeausschuss, der aus mindestens drei
gewählten Mitgliedern besteht. Er hat die Möglichkeit, eigene
Vertreter in den Pfarreirat und den Verwaltungsrat der Pfarrei zu
entsenden. Im Pfarreirat ist die Gemeinde im Regelfall mit
mindestens einem Mitglied vertreten, im Verwaltungsrat mit zwei
Mitgliedern.
Die bisherigen Pfarrgemeinden waren im Juli dazu aufgerufen
worden, darüber zu beraten, welche Pfarreien,
Pfarreiengemeinschaften, Kuratien oder Filialen in Zukunft eine
Gemeinde sein sollen. Die Entscheidung darüber wurde von den
derzeitigen Pfarrgremien zusammen mit dem Pastoralteam und den
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Pfarrei im
künftigen Zuschnitt von „Gemeindepastoral 2015“ getroffen.
Das Verfahren der Gemeindebildung hatte sich auf
Territorialgemeinden beschränkt. Das neue Seelsorgekonzept des
Bistums ermöglicht in Zukunft auch, dass sich Gemeinden
zusammenschließen oder dass neue Gemeinden gebildet werden. Auch
die Bildung von Personalgemeinden soll möglich sein, dazu müssen
jedoch erst noch die rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen
werden. is
Hier die Übersicht der Gemeinden: 
02.04.2015
Heilsame Unterbrechung des Alltags
 Mit „spirituellem Weg“ Christen auf „Ökumenischen
Kirchentag 2015“ in Speyer vorbereiten
Mit „spirituellem Weg“ Christen auf „Ökumenischen
Kirchentag 2015“ in Speyer vorbereiten
spk. Speyer- Als ein Angebot, sich „Zeit in der
Zeit“ zu nehmen und die vielfältigen Anforderungen des Alltags
heilsam zu unterbrechen, haben heute der Präsident der
Evangelischen Landeskirche der Pfalz, Christian Schad, der
Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und der
Vorsitzende der „Arbeitsgemeinschaft Christlicher
Kirchen“ in der Region Südwest, Pastor Dr. Jochen
Wagner, bei der Vorstellung von Plakat und Begleitheft zum
„Ökumenischen Exerzitienangebot“ den spirituellen
Wegbegleiter „Aufstehen zum Leben“ charakterisiert. Dieser
spirituelle Weg solle der geistlichen Vorbereitung auf den
„Ökumenischen Kirchentag“ am Pfingstfest 2015, am 23. und
24. Mai, in Speyer dienen, zu dem die christlichen Kirchen
aus der Pfalz und der Saarpfalz ihre Mitglieder eingeladen
haben.
 An 35 Orten in dieser Region sollen sich dabei nach
Angaben der Vorbereitungsgruppe rund 700 bis 800 Teilnehmer in der
Zeit zwischen Ostern und Pfingsten an den ökumenischen „Exerzitien
im Alltag“ beteiligen. Die gemeinsame Erfahrung und das Gespräch in
den Gruppen könnten dabei helfen, das ökumenische Miteinander zu
vertiefen, zeigte sich dazu Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann überzeugt. Auferstehung sei nämlich nicht nur
als ein singuläres Ereignis zu verstehen, sondern als ein Weg, auf
dem man gemeinsame Erfahrungen sammeln und teilen könne.
Pastor Dr. Jochen Wagner hob die unterschiedlichen
Traditionen der Kirchen hervor, deren Vielfalt auch für das
geistliche Leben bereichernd sei. Kirchenpräsident
Christian Schad unterstrich, dass das spirituelle Angebot
Raum zur biblischen Meditation, zur Selbstreflexion, zur Hingabe an
Gott und zur Besinnung auf den Nächsten bieten solle. „Aufstehen
zum Leben“ bedeute deshalb darüber hinaus auch „sich einzusetzen
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung“.
An 35 Orten in dieser Region sollen sich dabei nach
Angaben der Vorbereitungsgruppe rund 700 bis 800 Teilnehmer in der
Zeit zwischen Ostern und Pfingsten an den ökumenischen „Exerzitien
im Alltag“ beteiligen. Die gemeinsame Erfahrung und das Gespräch in
den Gruppen könnten dabei helfen, das ökumenische Miteinander zu
vertiefen, zeigte sich dazu Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann überzeugt. Auferstehung sei nämlich nicht nur
als ein singuläres Ereignis zu verstehen, sondern als ein Weg, auf
dem man gemeinsame Erfahrungen sammeln und teilen könne.
Pastor Dr. Jochen Wagner hob die unterschiedlichen
Traditionen der Kirchen hervor, deren Vielfalt auch für das
geistliche Leben bereichernd sei. Kirchenpräsident
Christian Schad unterstrich, dass das spirituelle Angebot
Raum zur biblischen Meditation, zur Selbstreflexion, zur Hingabe an
Gott und zur Besinnung auf den Nächsten bieten solle. „Aufstehen
zum Leben“ bedeute deshalb darüber hinaus auch „sich einzusetzen
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung“.
 Mit täglichen geistlichen Übungen zu Hause, mit
Glaubensgesprächen an fünf Abenden in einer der 35 Gruppen und mit
der Möglichkeit zum Einzelgespräch mit einem Begleiter baue sich so
für jeden Teilnehmer sein „spiritueller Weg“ für die 50 Tage
zwischen Ostern und Pfingsten auf. Das erwarten sich
übereinstimmend die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe für diese
bundesweit wohl einzigartige Aktion, von denen bei dem
Pressegespräch neben dem Leiter der Abteilung „Spirituelle Bildung/
Exerzitienwerk“ beim Bischöflichen Ordinariat in Speyer,
Dr. Peter Hundertmark, und seinem
„Mitstreiter“ auf Protestantischer Seite, Oberkirchenrat
i.R. Dr. Klaus Bümlein auch der Pfarrer
der Protestantischen Kirchengemeinde Altrip, Bernhard
Pfeifer, zu Wort kam. Bei .Mit diesem gemeinsamen
Exerzitienangebot, so die Geistlichen, könnten sich die Teilnehmer
in die Grundthemen des Glaubens hineinfinden und „intensive
Erfahrungen mit unserem Gott machen, der sich gerne finden
lässt“.
Mit täglichen geistlichen Übungen zu Hause, mit
Glaubensgesprächen an fünf Abenden in einer der 35 Gruppen und mit
der Möglichkeit zum Einzelgespräch mit einem Begleiter baue sich so
für jeden Teilnehmer sein „spiritueller Weg“ für die 50 Tage
zwischen Ostern und Pfingsten auf. Das erwarten sich
übereinstimmend die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe für diese
bundesweit wohl einzigartige Aktion, von denen bei dem
Pressegespräch neben dem Leiter der Abteilung „Spirituelle Bildung/
Exerzitienwerk“ beim Bischöflichen Ordinariat in Speyer,
Dr. Peter Hundertmark, und seinem
„Mitstreiter“ auf Protestantischer Seite, Oberkirchenrat
i.R. Dr. Klaus Bümlein auch der Pfarrer
der Protestantischen Kirchengemeinde Altrip, Bernhard
Pfeifer, zu Wort kam. Bei .Mit diesem gemeinsamen
Exerzitienangebot, so die Geistlichen, könnten sich die Teilnehmer
in die Grundthemen des Glaubens hineinfinden und „intensive
Erfahrungen mit unserem Gott machen, der sich gerne finden
lässt“.
Leitmotiv dieses „spirituellen Weges“ sei dabei die biblische
Geschichte der Emmaus-Jünger, die nach der Kreuzigung Jesu von
Jerusalem aus in das Dorf Emmaus gingen und dabei dem
auferstandenen Christus begegneten. Abweichend von den üblichen
Darstellungen der Jünger, die sonst stets als zwei Männer gezeigt
würden, habe man im heutigen gesellschaftlichen Verständnis ein
Paar aus einer Frau und einem Mann gewählt.
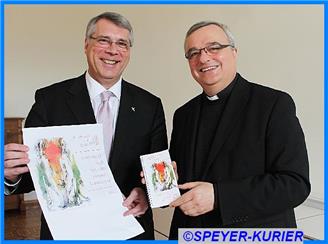 Während des „Ökumenischen Kirchentages“, über dessen
Ablauf zwischen Gedächtniskirche und Dom in Kürze noch gesondert
informiert werden soll, werde dieser „spirituelle Weg“ nicht
abgeschlossen sein, zeigten sich Bischof und Kirchenpräsident
überzeugt. Heute nur schon soviel: Während der beiden
Veranstaltungstage werde im „Friedrich-Spee-Haus“ am
Edith-Stein-Platz im Zusammenhang mit dem „Ökumenischen
Exerzitienangebot“ ein „Geistliches Zentrum“ eingerichtet, in dem
neben einer Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch ein „Raum der
Stille“ geöffnet sein wird, in dem durchgehend ein Mitglied des
Organisationsteams dieser so ganz besonderen Aktion des
Kirchentages als Gesprächspartner anwesend sein wird, mit dem man
an die Erfahrungen der Ökumenischen Kirchentage zur
Jahrtausendwende und zum 950. Weihejubiläum des Domes im Jahr 2012
anknüpfen wolle. Foto: gc
Während des „Ökumenischen Kirchentages“, über dessen
Ablauf zwischen Gedächtniskirche und Dom in Kürze noch gesondert
informiert werden soll, werde dieser „spirituelle Weg“ nicht
abgeschlossen sein, zeigten sich Bischof und Kirchenpräsident
überzeugt. Heute nur schon soviel: Während der beiden
Veranstaltungstage werde im „Friedrich-Spee-Haus“ am
Edith-Stein-Platz im Zusammenhang mit dem „Ökumenischen
Exerzitienangebot“ ein „Geistliches Zentrum“ eingerichtet, in dem
neben einer Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch ein „Raum der
Stille“ geöffnet sein wird, in dem durchgehend ein Mitglied des
Organisationsteams dieser so ganz besonderen Aktion des
Kirchentages als Gesprächspartner anwesend sein wird, mit dem man
an die Erfahrungen der Ökumenischen Kirchentage zur
Jahrtausendwende und zum 950. Weihejubiläum des Domes im Jahr 2012
anknüpfen wolle. Foto: gc
Orte, Begleiter, Kontaktadresse
Bad Bergzabern, Christine Roth, T. 06340/5308
Bad Dürkheim, Pfarrer Thomas Diener, T. 06322/1865
Bellheim, Marianne Hetterich, T. 07272/2103
Blieskastel, P. Rafael Lotawiec, T. 06842/2323
Bolanden, Carmen Rossol, T. 06352/5496
Contwig, Paul Beyer, T. 06332/5716
Deidesheim, Harald Beeck, T. 06321/487544
 Dirmstein, Pfarrer Alfred Müller, T. 06238/989292
Dirmstein, Pfarrer Alfred Müller, T. 06238/989292
Edenkoben, Clemens Kiefer, T. 06321/952781
Frankenthal, Annette Schulze, T. 06233/7713009
Hauenstein, Martin Fischer, T. 06392/993969
Homburg, Thomas Forthofer, T. 06841/9969226
Kaiserslautern, Pfarrer. Andreas Henkel, T. 0631/63173
Kaiserslautern, Andreas Braun, T. 0631/341210
Klingenmünster, Pfarrer Bernhard Pfeifer, T. 06349/9962559
Landau, Heilig Kreuz, Christine Klein, T. 06341/81120
Landau, St. Maria, Artur Kessler, T. 06341/968980
Lemberg, Pfarrer Klaus Westenweller, T. 06331/49205
Ludwigshafen-Maudach, Diakon Karlheinz Schwarz, T.
0621/553408
Ludwigshafen, Innenstadt, Dagmar Scherf, T. 0621/511255
Neustadt, Sieghard Jung, T. 06321/398931
Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern), Pfarrer Manfred Roos, T.
0163/6012816
Pirmasens, Pfarrer Bernd Rapp, T. 06331/73280
Queidersbach, Ute Garth, T. 06371/46390
Rockenhausen, Pfarrer Markus Horbach, T. 06361/7949
Speyer, Dom, Ana Tanke, T. 06232/60300
Waldfischbach-Burgalben, Dr. Margit Maar-Stumm, T.
06333/77106
Waldsee, Doris Heiner, T. 06236/8212
Weitere Informationen erhalten Sie unter:
spirituelle-bildung@bistum-speyer.de
oder
info@institut-kirchliche-fortbildung.de
30.03.2015
Veränderungen mit der Kraft der Hoffnung vorantreiben
 Kirchenpräsident Schad predigt im Berliner Dom: „Politik
und Religion sind zu unterscheiden“
Kirchenpräsident Schad predigt im Berliner Dom: „Politik
und Religion sind zu unterscheiden“
Berlin- Für eine klare Unterscheidung von
Politik und Religion hat sich der Kirchenpräsident der
Evangelischen Kirche der Pfalz und Vorsitzende der Union
Evangelischer Kirchen (UEK), Christian Schad, in seiner Predigt zum
Palmsonntag im Berliner Dom ausgesprochen. Nur wer diese
Unterscheidung beherzige, sei in der Lage, einerseits „die
dunklen Mechanismen aufzuspüren, die Religion zu einem
zerstörerischen Potenzial machen, andererseits auch die Frieden
stiftenden Kraftquellen der Religion aufzudecken“, sagte Schad.
Wer den christlichen Glauben ernst nehme, begebe sich auf den
mühsamen Weg des Kompromisses, der Friedfertigkeit, der
Gewaltlosigkeit und des offenen Dialogs. „Nicht Hass und Gewalt und
Tod sollen das letzte Wort behalten, sondern Recht und
Gerechtigkeit und die für alle Menschen unterschiedslos geltende gleiche Würde“, sagte Schad.
Jesus unterscheide streng zwischen Gott und Menschen, zwischen
göttlicher und weltlicher Macht, zwischen dem Reich Gottes und dem
Ziel menschlichen Geschichtshandelns. „Wo diese Unterscheidung
missachtet wird, schlägt Religion in Ideologie um, dient sie der
Rechtfertigung totalitärer Machtansprüche“, erklärte Schad.
Die Geschichte vom Einzug Jesu in Jerusalem zeige, dass die
Menschen in ihm den politischen Hoffnungsträger gesehen haben, der
sie von der Fremdherrschaft durch die römische Besatzungsmacht
befreien und aus dem gesellschaftlichen Abseits führen solle. „Sie
fordern einen Systemwechsel, den sich auch heute viele von uns
wünschen: angesichts der Dominanz der Wirtschaft über die Politik,
der immer größer werdenden Schere zwischen Arm und Reich und den
damit verbundenen gesellschaftlichen Verwerfungen“, sagte der
Kirchenpräsident. Dabei sei es berechtigt, für diese Anliegen in
friedlichen Demonstrationen auf die Straße zu gehen.
Nicht nur zur Zeit Jesu erwarteten die Menschen von ihm die
sofortige Lösung persönlicher Probleme und Gerechtigkeit für alle,
erklärte Schad. Doch Jesus habe sich den Wünschen entzogen. „Er
wollte zu keinem Zeitpunkt eine christliche Republik, nie eine
Theokratie installieren. Der Einzug Jesu in Jerusalem unterscheide
sich fundamental von allen Um- und Aufbrüchen in dieser Welt. „So
wichtig revolutionäre Veränderungen sein mögen, so notwendig die
Neugestaltung unseres gesellschaftlichen Lebens auch ist, dies sind
Prozesse, die fernab von jeder religiösen Entscheidungsschlacht
liegen“, sagte der Kirchenpräsident. Die Aufgabe der Christen heute
sei es, die Veränderungen – die immer nur vorläufigen Charakter
hätten – „in der Kraft der uns verheißenen Hoffnung
voranzutreiben“.
Die Trauernden nicht im Stich
lassen
Kirchenpräsident Schad ruft zur Fürbitte für die Opfer
des Flugzeugabsturzes auf
Nicht die Allmacht Gottes, wohl aber die Allmachtsvorstellungen
der Menschen werden durch die Ereignisse des Flugzeugabsturzes in
Südfrankreich in ihre Schranken gewiesen. Dies hat der
Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz und Vorsitzende
der Union Evangelischer Kirchen (UEK), Christian Schad, am
Palmsonntag im Berliner Dom erklärt. Gottes Allmacht könne man sich
nicht so vorstellen, dass er all das Böse und Unbegreifliche im
Vorhinein aus dem Lauf der Dinge „herausschneide“. Gottes Allmacht
zeige sich in diesen Tagen vielmehr in der Ohnmacht, „mit der er
uns zur Seite steht, mit der er sich uns Menschen zuwendet:
schweigend, all das Unerträgliche mit aushaltend, damit wir uns an
ihm orientieren“, sagte Schad.
Zwar wisse man, dass das Lebn zerbrechlich und immer vom Tod
bedroht sei. „Aber wenn uns diese Wirklichkeit hautnah auf den Leib
rückt, kann es uns den Atem verschlagen“, sagte der
Kirchenpräsident. Das Evangelium des Palmsonntags, das vom Einzug
Jesu in Jerusalem berichtet, zeige den Sohn Gottes, der den
Menschen stumm entgegenkomme und Bilder und Zeichen für sich
sprechen lasse. So bete man auch in diesen Tagen des umfassbaren
Leids und der Trauer zu Gott, „dass er jetzt all die Trauernden
nicht im Stich lässt, sondern ihnen entgegen kommt und ihnen
aushalten hilft, was kaum auszuhalten ist und dass er ihnen
Menschen zur Seite stellt, die das Unfassbare mittragen, und dass
er die Opfer aufnimmt in sein ewiges Reich.“
Schad rief im Gottesdienst zur Fürbitte für die Opfer der
Flugzeugkatastrophe und ihre Angehörigen sowie für die
Rettungskräfte und Notfallseelsorger auf, die Tag und Nacht im
Einsatz seien. Bereits am vergangenen Mittwoch hatten zahlreiche
Menschen an einer Trauerandacht im Berliner Dom teilgenommen und
sich in das Kondolenzbuch eingetragen, darunter auch der Regierende
Bürgermeister von Berlin und der Präsident des Abgeordnetenhauses.
lk
29.03.2015
Gustav Appeltauer in Ruhestand verabschiedet
 Mehr als 20 Jahre beim Bischöflichen Ordinariat tätig,
Baudirektor seit dem Jahr 2012
Mehr als 20 Jahre beim Bischöflichen Ordinariat tätig,
Baudirektor seit dem Jahr 2012
Speyer- Nach mehr als 20 Jahren Mitarbeit
beim Bischöflichen Ordinariat ist Baudirektor Gustav Appeltauer in
den Ruhestand verabschiedet worden.
Domkapitular Peter Schappert, der Leiter der Hauptabteilung
Finanzen und Immobilien des Bischöflichen Ordinariats, würdigte ihn
im Rahmen einer Feierstunde als kompetenten und verlässlichen
Mitarbeiter, der die vielfältigen beruflichen Anforderungen mit
hoher Fachkenntnis gemeistert hat. „Sie waren immer der Sache
verpflichtet, gleichzeitig hatten Sie eine große Fähigkeit in der
Vermittlung“, dankte er Appeltauer für sein Engagement.
An der Feier nahmen Generalvikar Dr. Franz Jung, zahlreiche
Mitglieder des Domkapitels, des Diözesanvermögensverwaltungsrats
und des Diözesan-Bauausschusses sowie eine große Zahl von
Mitarbeitenden des Bischöflichen Ordinariats und des Domkapitels
teil. Alexandra Ruffing dankte dem scheidenden Baudirektor im Namen
der Mitarbeiter der Hauptabteilung Finanzen und Immobilien: „Sie
waren nicht nur fachlich, sondern auch als Mensch ein Vorbild.“
Gustav Appeltauer, der ursprünglich aus Rumänien stammt, hatte
seine Mitarbeit beim Bistum Speyer im Jahr 1994 begonnen, zunächst
als Gebietsingenieur für das Dekanat Donnersberg und den nördlichen
Teil des Dekanats Bad Dürkheim. Im Jahr 2012 wurde er zum
Baudirektor und Leiter des Bischöflichen Bauamtes ernannt. Text
und Foto: is
29.03.2015
Frühlingsluft in 60 Meter Höhe schnuppern
 Kaisersaal und
Aussichtsplattform öffnen nach Winterpause wieder für
Besucher
Kaisersaal und
Aussichtsplattform öffnen nach Winterpause wieder für
Besucher
Speyer- Ab 1. April kann man am Dom dem
Himmel wieder ein Stückchen näher kommen: Kurz vor Ostern werden
der Kaisersaal und die Aussichtsplattform in 60 Metern Höhe wieder
für Besucher geöffnet. Witterungsbedingt bleiben die beiden
Bereiche im Winterhalbjahr geschlossen. Die Zeit wurde für
notwendige Restaurierungsarbeiten und einer Nachjustierung des
Beleuchtungssystems genutzt.
In diesem Jahr fällt der Saisonstart fast auf den Tag mit dem
Osterfest zusammen. „Wir freuen uns“, so der Leiter des
Besuchermanagements Bastian Hoffmann, „wenn über die Ostertage
viele Menschen zu uns kommen. Es wäre toll, wenn gleich zu Beginn
der Saison das Wetter mitspielt, so dass die Menschen Lust
bekommen, in 60 Metern Höhe Frühlingsluft zu schnuppern.“ Einen
Überblick über die besonderen Öffnungszeiten während der Kar- und
Ostertage gibt es auf der Homepage www.dom-zu-speyer.de.
Fresken und Fernsicht als Besucherattraktionen
 Seit Oktober 2012
erwarten zwei neue Attraktionen am Speyerer Dom ihre Besucher. Die
Ausstellung der Schraudolph-Fresken im neu gestalteten Kaisersaal
und die Aussichtsplattform im Südwest-Turm bereichern die
UNESCO-Welterbestätte und zogen bereits mehr als 70.000 Gäste aus
nah und fern in ihren Bann.
Seit Oktober 2012
erwarten zwei neue Attraktionen am Speyerer Dom ihre Besucher. Die
Ausstellung der Schraudolph-Fresken im neu gestalteten Kaisersaal
und die Aussichtsplattform im Südwest-Turm bereichern die
UNESCO-Welterbestätte und zogen bereits mehr als 70.000 Gäste aus
nah und fern in ihren Bann.
Der über der Vorhalle des Doms gelegene Kaisersaal beherbergt
eine Dauerausstellung mit neun monumentalen Fresken des Malers
Johann Baptist Schraudolph. Sie zeigen Szenen aus dem Leben des
heiligen Bernhard von Clairvaux, des heiligen Erzmärtyrers
Stephanus und des Papstes Stephan I. Ursprünglich waren die Fresken
an den Wänden der Seitenschiffe des Domes angebracht. Von dort
wurden sie im Zuge der großen Domrestaurierung der 1950er-Jahre
entfernt. Voraussetzung für die neue Präsentation der Wandbilder
war deren gelungene Konservierung und Restaurierung. Für die
Präsentation wurde ein Bildraum mit moderner Formensprache
geschaffen
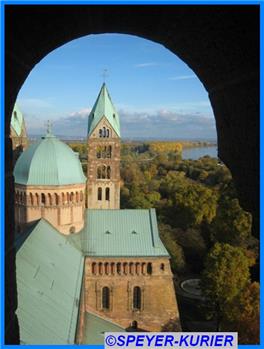 Insgesamt 304 Stufen
führen auf die Aussichtsplattform in rund 60 Metern Höhe. Dort
erwartet die Besucher ein einzigartiger Rundblick über die Stadt
Speyer, die Vorderpfalz und in die badische Nachbarschaft. An Tagen
mit guter Fernsicht überblickt man eine Entfernung von mehr als 50
Kilometern. Der Blick reicht vom Pfälzer Wald im Westen bis zu
Odenwald und Schwarzwald im Osten. Besonders reizvoll ist der Blick
auf die Maximiliansstraße, die Fußgängerzone im Herzen von Speyer,
die in einer leicht geschwungenen Linie den Dom und das
mittelalterliche Stadttor „Altpörtel“ miteinander verbindet
Insgesamt 304 Stufen
führen auf die Aussichtsplattform in rund 60 Metern Höhe. Dort
erwartet die Besucher ein einzigartiger Rundblick über die Stadt
Speyer, die Vorderpfalz und in die badische Nachbarschaft. An Tagen
mit guter Fernsicht überblickt man eine Entfernung von mehr als 50
Kilometern. Der Blick reicht vom Pfälzer Wald im Westen bis zu
Odenwald und Schwarzwald im Osten. Besonders reizvoll ist der Blick
auf die Maximiliansstraße, die Fußgängerzone im Herzen von Speyer,
die in einer leicht geschwungenen Linie den Dom und das
mittelalterliche Stadttor „Altpörtel“ miteinander verbindet
Besucherinformationen Dom zu Speyer
Öffnungszeiten:
Dom: geöffnet werktags April bis
Oktober 9 – 19 Uhr, werktags November bis März 9 – 17 Uhr, sonntags
ganzjährig 12 – 18 Uhr.
Kaisersaal und Aussichtsplattform: Geöffnet werktags April bis
Oktober 10–17 Uhr, sonntags 12 – 17 Uhr. Einlass im 20-
Minuten-Takt.
Öffnungszeiten während der Ostertage:
01. April 2015:
Besichtigung bis 16.00 Uhr (17.00 Uhr Chrisammesse)
03. April 2015, Karfreitag:
Stille Besichtigung nur 12.00 - 14.00 Uhr ( 10.00 Uhr
Kinderkreuzweg, danach Beichtgelegenheit bis 13.00 Uhr. 15.00 Uhr
Karfreitagsliturgie, anschließend Beichtgelegenheit)
04. April 2015, Karsamstag:
Stille Besichtigung 10.00 bis 18.00 Uhr (21.00 Uhr Feier der
Osternacht)
05. April 2015, Ostern:
Besichtigung 12.30 Uhr bis 16.00 Uhr (10.00 Uhr
Pontifikalamt, 16.30 Uhr Pontifikalvesper, 18.00 Uhr
Abendmesse)
06. April 2015, Ostermontag:
Besichtigung 12.30 Uhr bis 17.30 Uhr (10.00 Uhr
Pontifikalamt, 18.00 Uhr Abendmesse)
Während der Gottesdienste und bei Sonderveranstaltungen ist eine
Besichtigung nicht möglich. Gesonderte Öffnungszeiten werden
zeitnah auf www.dom-zu-speyer.de
vermeldet.
Eintrittspreise:
Krypta und Kaisergräber: € 3,50,
Ermäßigt € 1.-. Familien € 8.- Für Kinder bis 6 Jahre und
Schulklassen sowie Schwerbehinderten mit Ausweis ist der Eintritt
zur Krypta frei.
Kaisersaal und Aussichtsplattform: € 6.-, Ermäßigt € 3.-,
Eintritt für Familien mit mehreren Kindern: € 15.-
Ermäßigung gilt für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre,
Schüler, Studenten und Schwerbehinderte mit Ausweis sowie
Teilnehmer von FSJ und BuFdi.
Eintrittskarten sind am Kassencontainer an der Nordseite des
Domes und am Kryptaeingang erhältlich.
Führungen durch Dom und/oder Kaisersaal:
Telefon 0
62 32/102-118 (Bürozeiten: Dienstag bis Freitag 10 bis 12 Uhr sowie
Montag und Donnerstag 14 bis 16 Uhr)
Fax 0 62 32/102-119
E-Mail: domfuehrungen@bistum-speyer.de
Audioguide:
Hörtouren für Kinder und Erwachsene sind in Deutsch, Englisch
und Französisch erhältlich.
Dom-App
Die Dom-App ist im iTunes App Store und im Google
Play Store zu finden und steht gratis zum Download zur
Verfügung. Am Dom selbst wurden WLAN Zugänge für schnellen Download
eingerichtet.
www.dom-zu-speyer.de
Text: is; Foto: pem
28.03.2015
„Gott will das Vertrauen des Menschen gewinnen“
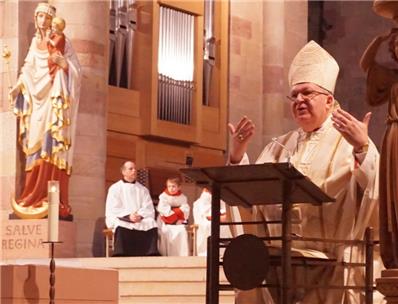 Weihbischof Otto Georgens blickt bei Pontifikalamt
im Speyerer Dom auf 20 Jahre im Amt des Weihbischofs zurück
Weihbischof Otto Georgens blickt bei Pontifikalamt
im Speyerer Dom auf 20 Jahre im Amt des Weihbischofs zurück
Speyer-. Das Fest der Verkündigung des Herrn
hat für Weihbischof Otto Georgens eine zusätzliche Bedeutung: An
diesem Tag vor 20 Jahren empfing er die Bischofsweihe. Am
Mittwochabend zelebrierte er im Dom das Hochfest. In der Predigt
ging Weihbischof Georgens auf sein Jubiläum ein und stellte das
Vertrauen zwischen Gott und Menschen in den Mittelpunkt.
"Maria hat uns Gott gebracht", sagte der Weihbischof zu Beginn
der Messe mit Blick auf die Verkündigungsgeschichte. "Sie hat jenes
Spitzengespräch geführt, das Gipfeltreffen absolviert." Georgens
unterstrich in seiner sehr persönlichen Predigt, wie wichtig die
Verkündigung für die Gläubigen ist und was sie ihm selbst bedeutet.
Vertrauen auf Gott sei dabei das Wesentliche. "Sollten wir das
Evangelium vom heutigen Fest der Verkündigung des Herrn nicht
einmal unter diesem Aspekt lesen und hören, unter dem Aspekt des
Vertrauens?" Er schlug den Bogen zu seinem Bischofsamt, machte
deutlich, dass die Weihe eine besondere Gabe ist: "Ich bin davon
überzeugt: Was wir als Bischöfe und Priester sind, wurde uns
geschenkt, weil Christus uns vertraut."
Gott will das Vertrauen gewinnen, achtet gleichzeitig die
Freiheit der Menschen, erklärte Georgens im Hinblick auf die
Verkündigung. Deshalb falle der Herr "nicht mit der Tür ins Haus".
Stattdessen schickte er einen Boten, der Maria die Botschaft
überbrachte. Der Engel bat Maria, die auch Rückfragen stellen
konnte, um ihr Einverständnis. Im Gespräch fasste Maria Vertrauen
und sagte schließlich: "Mir geschehe, wie du es gesagt hast."
Das Vertrauen ist wechselseitig, legte Otto Georgens dar. "Der
Inkarnation geht das Vertrauen voraus: Der Vertrauensvorschuss
Gottes und das Vertrauen eines Menschen auf seine Zusage." Gottes
Vertrauen verbinde die Menschen und schlage eine Brücke zwischen
Menschlichkeit und Glauben. Georgens betonte, wie sehr er während
seiner Zeit als Weihbischof stets auf die Gnade Gottes bauen
konnte: "Ich überlebe durch das mir geschenkte Vertrauen, indem ich
aus den Quellen für das geistliche Leben schöpfe: die Stille, die
Eucharistie, das Wort Gottes und die geistliche Begleitung."
Sein Jubiläum bezeichnete er als "wichtige Wegmarke, als
Haltepunkt auf dem Weg, um zurück, aber auch nach vor zu schauen."
Jetzt als 65-Jähriger habe er zwei Drittel seines Weges als Bischof
zurückgelegt – wenn man davon ausgehe, dass Bischöfe mit 75 Jahren
in den Ruhestand gehen. Georgens will diesen Weg bis dorthin gehen,
"wenn mir Gott Gesundheit schenkt, wenn meine Kräfte bis dahin
ausreichen, wenn ich geistig jung bleibe und den Humor nicht
verliere, wenn ich Gefährten finde, die mich auf meinem Weg
weiterhin begleiten, mich unterstützen und mir mit Rat und Tat zur
Seite stehen". Er dankte vor allem seiner kürzlich verstorbenen
Mutter, die ihn immer Mut gemacht habe. Seinen Dank richtete der
Weihbischof ebenso an seine Weggefährten, mit denen er
vertrauensvoll zusammenarbeitet.
Die Fürbitten galten dem Anlass entsprechend auch dem
Weihbischof. Es sangen die Speyerer Domsingknaben und der
Mädchenchor unter der Leitung von Domkapellmeister Markus
Melchiori. An der Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub.
Otto Georgens kam 1950 in Weisenheim am Berg im Kreis Bad
Dürkheim zur Welt. Am 26. Juni 1977 wurde er in Speyer zum Priester
geweiht. Bis 1986 war er als Sekretär des Speyerer Bischofs
Friedrich Wetter und seines Nachfolgers Anton Schlembach tätig,
anschließend als Pfarrer im südwestpfälzischen Eppenbrunn und 1994
als Dekan des Dekanats Pirmasens. Am 27. Januar 1995 ernannte Papst
Johannes Paul II. Otto Georgens zum Weihbischof in Speyer. Am 24.
März des gleichen Jahres empfing er durch Anton Schlembach die
Bischofsweihe. Drei Tage darauf wurde Georgens zum Dompropst von
Speyer ernannt.
2009 übernahm Weihbischof Georgens in der Diözesanleitung die
Aufgabe des Bischofsvikars für die Caritasarbeit und war
Vorsitzender des Diözesan-Caritasverbandes. Nach der Emeritierung
von Bischof Anton Schlembach wählte das Domkapitel den Weihbischof
im Februar 2007 zum Diözesanadministrator. Dieses Amt übte er rund
ein Jahr bis zum Amtsantritt des neuen Bischofs Karl-Heinz
Wiesemann aus. Seit Februar 2009 ist Georgens Bischofsvikar für
weltkirchliche Aufgaben sowie für die Orden, die Säkularinstitute
und die Gemeinschaften des Apostolischen Lebens im Bistum
Speyer.
Daneben gehört Weihbischof Georgens der Kommission Weltkirche
und der Pastoralkommission der Deutschen Bischofskonferenz an. In
der Pastoralkommission leitet er die Arbeitsgruppe Diakonische
Pastoral, ist Beauftragter für die Behindertenpastoral und
Ansprechpartner für die Gefängnisseelsorge. Als Mitglied der
Kommission Weltkirche gehört er den Unterkommissionen für Kontakte
mit Lateinamerika und für Entwicklungsfragen an. Als Delegierter
vertritt er die Deutsche Bischofskonferenz bei der Vollversammlung
der französischen Bischöfe.
Die Predigt im Wortlaut:
http://cms.bistum-speyer.de/www2/index.php?myELEMENT=278877&cat_id=31426&mySID=65ecbd1a8688b92ef99e394649b029b4
Text und Foto: is
26.03.2015
Amerikanischer Generalkonsul Kevin Milas besuchte den Kaiserdom
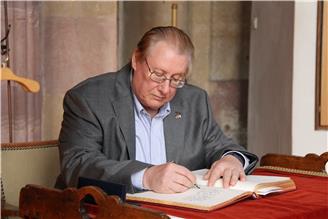 Generalkonsul Kevin Milas beim Eintrag ins Goldene Buch
Generalkonsul Kevin Milas beim Eintrag ins Goldene Buch
spk.Speyer- Schon beim Betreten der Kathedrale
zeigte sich Kevin Milas sehr beeindruckt von der
gewaltigen Größe dieses Bauwerks. Sichtlich erfreut zeigte sich das
Ehepaar über den von Domkapitular Peter Schappert
begleiteten Rundgang.
Besonders historischen Ereignisse, wie dem Aufruf zum
zweiten Kreuzzug durch Bernhard von Clairvaux oder inwieweit die
protestantische Bewegung die Stadt Speyer beeinflusste
interessierten den Generalkonsul..
Der Umstand dass der Dom zu Speyer schon damals die Menschen
beeindruckte, die zum großen Teil in kleinen ärmlichen Häusern
lebten, war für den Generalkonsul ebenfalls sehr interessant. Er
sprach von &Generalkonsul;shared wealth" (geteilter Reichtum),
da jeder getaufte die Kirche betreten durfte und an ihrem
weltlichen und religiösen Reichtum teilnehmen konnte.

Dass die erste Bauphase des Doms lediglich 30 Jahre betrug, hat
das Ehepaar Milas ebenfalls zum Staunen gebracht.
Selbstverständlich war der Eintrag ins Goldene Buch des Domes in
dem sich sein ehemaliger Präsident George Bush Senior bei seinem
Besuch im November 1990 ebenfalls verewigt hat. Von diesem Eintrag
lies sich der Generalkonsul ein Foto als Erinnerung machen.
.Foto: is
22.03.2015
Kein Geld für bessere gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit Behinderung
Diakonie kritisiert die Kabinettsentscheidung, die
ursprünglich für die Eingliederungshilfe geplanten fünf Milliarden
Euro für andere Aufgaben zu verwenden.
Speyer- „Menschen mit Behinderung hoffen
seit Jahren, dass die geplante Reform der Eingliederungshilfe ihnen
mehr Selbstbestimmung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben
bringen wird", sagt Albrecht Bähr, Landespfarrer für Diakonie
anlässlich der Kabinettsentscheidung. „Wir sind enttäuscht,
dass die ursprünglich dafür vorgesehenen Mittel nun für andere
Aufgaben eingesetzt werden sollen."
Hintergrund ist, dass die Bundesregierung den Kommunen fünf
Milliarden Euro versprochen hatte als Ausgleich für die steigenden
Belastungen durch die Eingliederungshilfe. Im Gegenzug sollten die
Kommunen der Reform der Eingliederungshilfe zustimmen, die die
Versorgung und die Qualität der Leistungen für Menschen mit
Behinderung verbessert.
„Ohne die Investitionen des Bundes wird die Reform der
Eingliederungshilfe scheitern. Die Kommunen brauchen das Geld, um
ihren Verpflichtungen nachzukommen“, betont Bähr. „Im Interesse der
Menschen mit Behinderungen fordern wir die Bundesregierung auf, die
Finanzzusagen an die Kommunen an das Reformvorhaben der
Eingliederungshilfe zu koppeln“, sagt Bähr weiter: „Ohne eine
Richtungsvorgabe des Bundes werden die Menschen mit Behinderung
angesichts der Vielzahl kommunaler Aufgaben den kürzeren ziehen.“
dwp
22.03.2015
Katholische Jugend trifft Ministerpräsidentin Dreyer
 v.l.: Erik Niekisch (BDKJ Mainz), Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Felix Goldinger (BDKJ Speyer) und Susanne Kiefer (BDKJ Trier.)
v.l.: Erik Niekisch (BDKJ Mainz), Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Felix Goldinger (BDKJ Speyer) und Susanne Kiefer (BDKJ Trier.)
Jugendpolitische Themen des Bundes der Deutschen Katholischen
Jugend Rheinland-Pfalz (BDKJ) in der Staatskanzlei |
Ministerpräsidentin Dreyer im Gespräch mit Susanne Kiefer (BDKJ
Trier), Felix Goldinger (BDKJ Speyer) und Eric Niekisch (BDKJ
Mainz)
Mainz/ Speyer- Vertreter des Bundes der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) trafen heute in Mainz
Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD). Schwerpunkt des Gespräches
war die jugendpolitische Strategie „U28 – Die Zukunft lacht“ des
BDKJ, die derzeit bundesweit die Etablierung einer eigenständigen
und ressortübergreifenden Jugendpolitik zum Ziel hat.
Ministerpräsidentin Dreyer freute sich über das Engagement der
katholischen Jugend in den Bereichen Jugendpolitik, Nachhaltigkeit
und Partizipationsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche. Sie
verwies im Gespräch auf den Demografie-Check der Landesregierung
Rheinland-Pfalz, mit dem Gesetzesvorhaben auf
Generationengerechtigkeit hin überprüft würden.
Felix Goldinger, Diözesanvorsitzender des BDKJ Speyer, sprach
sich für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahre aus. Zugleich
betonte er die Notwendigkeit breiterer Beteiligungsmöglichkeit von
jungen Menschen in einer alternden Gesellschaft. Die
Ministerpräsidentin unterstütze diese Forderung und warb für
Solidarität zwischen den Generationen, die sich auch in der
Ausgestaltung finanzpolitischer Entscheidungen niederschlage.
Gleichzeitig betonte Dreyer, dass es eine Balance geben müsse,
zwischen dem Abbau von Schulden einerseits und notwendigen
Zukunftsinvestitionen andererseits. Eric Niekisch,
Diözesanvorsitzender des BDKJ Mainz, bedankte sich ausdrücklich für
die Erhöhung der Fördermittel im Bereich der sozialen Bildung.
Diese Fördermittel für außerschulische Maßnahmen, etwa Kinder- und
Jugendfreizeiten, kämen den Ortsgruppen und damit direkt Kindern
und Jugendlichen zu Gute. Der Zugang zu Freizeit- und
Bildungsangeboten müsse unbedingt auch Kindern und Jugendlichen aus
asylsuchenden Familien erleichtert werden. Hierfür würden eigene
finanzielle Mittel benötigt.
Susanne Kiefer, Diözesanvorsitzende des BDKJ Trier, machte
darauf aufmerksam, dass Veränderungen in der Schul- und
Hochschulpolitik zu einem erhöhten Leistungs- und Zeitdruck für
Schüler und Studenten geführt habe. Vor diesem Hintergrund fordere
der BDKJ etwa die 35-Stunden-Woche für Schüler und die Anerkennung
ehrenamtlichen Engagements während Ausbildungs- und
Studienzeiten.
Ministerpräsidentin Dreyer warb für die Kooperation von
Verbänden und Ganztagsschulen und zeigte Verständnis für die
Forderung des BDKJ nach verstärkter Anerkennung des Ehrenamtes. Sie
lobte zum Abschluss des Gespräches das jugendpolitische Engagement
des BDKJ in Rheinland-Pfalz und wagte selbst den Blick durch die
orangerote Aktionsbrille.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) ist
Dachverband der katholischen Jugendverbände. In Rheinland-Pfalz
vertritt er die Interessen von 36.000 Kindern und Jugendlichen. Die
Diözesanverbände der rheinland-pfälzischen Bistümer Speyer, Mainz,
Trier und Limburg koordinieren insbesondere ihre landespolitische
Interessenvertretung aber auch Aktionen wie die 72-Stunden-Aktion
über die BDKJ-Landesstelle Rheinland-Pfalz. Vorsitzender der
Landesstelle ist Felix Goldinger.
Text: BDKJ Speyer; Foto: (c) Staatskanzlei
RLP
21.03.2015
Kirche und Diakonie stellen 10.000 Euro Soforthilfe bereit
 Millionen Menschen in
Syrien und Irak auf der Flucht
Millionen Menschen in
Syrien und Irak auf der Flucht
Speyer- Die Evangelische Kirche der Pfalz und
die Diakonie Pfalz unterstützen die Nothilfe für Flüchtlinge in
Syrien, Irak und den Nachbarstaaten mit 10.000 Euro Soforthilfe.
Gleichzeitig rufen sie zu weiteren Spenden auf. „Die Lage ist nach
wie vor dramatisch. Flüchtlingsfamilien suchen in Syrien und den
angrenzenden Ländern Zuflucht in Zelten, Bauruinen und Garagen. Sie
benötigen unsere Hilfe, um zu überleben“, sagen Oberkirchenrat
Manfred Sutter und Diakoniepfarrer Albrecht Bähr.
Seit vier Jahren herrscht in Syrien Krieg. Infolge der sich
weiterhin verschlechternden Sicherheits- und Versorgungslage
innerhalb des Landes sind viele Syrerinnen und Syrer vor der Gewalt
geflohen und haben in sicheren Regionen Syriens oder in den
Nachbarländern Schutz gesucht. Die gewaltsamen Übergriffe seitens
des Islamischen Staats (IS) und anderer Gruppierungen im Irak und
Nordsyrien seit Juni 2014 sind ein zusätzlicher Konfliktherd, der
die Sicherheit des gesamten Nahen Ostens zunehmend bedroht.
Mehr als 3 Millionen Menschen ließen sich in Syriens
Nachbarländern Türkei, Libanon, Jordanien, Irak und Ägypten nieder.
Rund drei Viertel der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder. Insgesamt
sind mehr als 12 Millionen Menschen auf humanitäre Hilfe
angewiesen. Seit Beginn des Krieges in Syrien und im Irak
unterstützt die Diakonie Katastrophenhilfe mit etwa 16 Millionen
Euro die Partnerorganisationen vor Ort und hilft damit über einer
halben Million Menschen. Ein großer Teil der finanziellen
Mittel wird vom Auswärtigen Amt bereitgestellt.
„Um noch mehr Menschen zu erreichen, ist die Diakonie
Katastrophenhilfe zusammen mit ihren Partnern dringend auf Ihre
Spenden angewiesen“, rufen Sutter und Bähr die Menschen in
der Pfalz und der Saarpfalz zu Spenden auf.
Spendenkonto:
Diakonie Katastrophenhilfe
Evangelische Bank eG
Konto 1414
Bankleitzahl 520 604 10
IBAN: DE78 5206 0410 0000 0014 14
Stichwort: Syrien und Irak
Schwerpunkt der Nothilfe der Diakonie Katastrophenhilfe in den
Ländern Syrien, Jordanien, Irak, Libanon und Türkei ist die
Versorgung der Flüchtlingsfamilien vor allem außerhalb der Camps
sowie die Unterstützung von Gastgeberfamilien und Gemeinden. „Die
Menschen benötigen dringend Unterkünfte, Kleidung, Decken, Öfen,
Heizmaterial und Nahrungsmittel“, erläutern Bähr und Sutter.
Zusammen mit ihren lokalen Partnerorganisationen verteilt die
Diakonie Katastrophenhilfe die genannten Hilfsgüter, unterstützt
die Flüchtlinge aber auch mit Zahlungen von Mietzuschüssen sowie
der Verteilung von Hygieneartikeln, Küchenbedarf, Bettwäsche und
anderem Alltagsbedarf. Viele Projekte haben außerdem eine
psychosoziale Komponente: Zusammen mit ihren lokalen Partnern
unterstützt die Diakonie Katastrophenhilfe die Flüchtlinge bei der
Bewältigung von Kriegstraumata. Außerdem bietet sie Unterstützung
im Bereich der schulischen Aus- und Weiterbildung von Kindern und
Erwachsenen an.
Hintergrund: Kostenbeispiele für konkrete Hilfe:
- 1 Hygienepaket für eine Familie enthält u.a. Seife, Shampoo,
Rasiercreme, Zahnpasta, Zahnbürsten, Badeschwämme, Bürsten,
Toilettenpapier, Geschirrspülmittel, Waschpulver und kostet 24
Euro.
- 1 Lebensmittelpaket für eine Familie enthält u.a. Reis, Zucker,
getrocknete Bohnen, Mehl, Linsen, Salz und Tee und kostet 40 Euro.
Dies dient der Nahrungsergänzung (+ 800 kcal).
- 1 Wasserfilter kostet 276 Euro.
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der
Pfalz
12.03.2015
Diakonie weist Vorwürfe des Landesrechnungshofes zurück
 Speyer- In
seinem jüngsten Bericht übt der Landesrechnungshof Kritik an den
seiner Meinung nach zu hohen Kosten für Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz. Der Landespfarrer für
Diakonie und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in
Rheinland-Pfalz, Albrecht Bähr, kritisiert: „Der Bericht entspricht
nicht den Tatsachen!“ Laut Landesrechnungshof zahle das Land
Rheinland-Pfalz den Behindertenwerkstätten zu viel Geld – 30
Millionen mehr als andere Bundesländer im Schnitt. Allerdings
basiere diese Berechnung auf den bundesweit ermittelten
durchschnittlichen Fallkosten. „Nicht berücksichtigt ist, dass die
Pflegesätze der neuen Bundesländer mit einfließen und dabei die
Personalkosten in den neuen Bundesländern deutlich niedriger liegen
als in den westlichen Bundesländern“, betont Bähr. Zudem seien in
anderen Bundesländern mit niedrigeren Tagessätzen die Fahrkosten
und die Sozialversicherungsbeiträge nicht enthalten und würden
extra abgerechnet. Diese Kosten seien in Rheinland-Pfalz aber
Bestandteil des Tagessatzes.
Speyer- In
seinem jüngsten Bericht übt der Landesrechnungshof Kritik an den
seiner Meinung nach zu hohen Kosten für Werkstätten für Menschen
mit Behinderungen in Rheinland-Pfalz. Der Landespfarrer für
Diakonie und Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Diakonie in
Rheinland-Pfalz, Albrecht Bähr, kritisiert: „Der Bericht entspricht
nicht den Tatsachen!“ Laut Landesrechnungshof zahle das Land
Rheinland-Pfalz den Behindertenwerkstätten zu viel Geld – 30
Millionen mehr als andere Bundesländer im Schnitt. Allerdings
basiere diese Berechnung auf den bundesweit ermittelten
durchschnittlichen Fallkosten. „Nicht berücksichtigt ist, dass die
Pflegesätze der neuen Bundesländer mit einfließen und dabei die
Personalkosten in den neuen Bundesländern deutlich niedriger liegen
als in den westlichen Bundesländern“, betont Bähr. Zudem seien in
anderen Bundesländern mit niedrigeren Tagessätzen die Fahrkosten
und die Sozialversicherungsbeiträge nicht enthalten und würden
extra abgerechnet. Diese Kosten seien in Rheinland-Pfalz aber
Bestandteil des Tagessatzes.
Auch die Kritik an der Höhe des Tagessatzes von 46 Euro für
Menschen mit Behinderung sei falsch. „Ein Blick auf die Zahlen
relativiert den hohen Kostenanstieg“, so Bähr. Das
Durchschnittsentgelt, eine Rechengröße in der Sozialversicherung,
habe sich von 1985 bis 2011 von 18.041 Euro auf 32.100 Euro
erhöht.
Die Zunahme der Plätze von 5.000 auf 14.600 im Zeitraum von 1985
bis 2011 sei laut Consens-Studie zu Werkstätten für Menschen mit
Behinderung Ausdruck des steigenden Bedarfs. Die Flächenländer
wiesen nach dieser Studie eine Ausstattung mit Werkstattplätzen von
3,52 bis 4,47 pro 1.000 Einwohner aus. Rheinland-Pfalz läge hier im
Mittelfeld.
Der Landesrechnungshof kritisiert die pauschale Entgeltanhebung:
Sie führe im Ergebnis zu überhöhten Finanzierungen. Das Gegenteil
ist der Fall. Die fehlenden Vereinbarungen verhindern
bedarfsgerechte Vergütungsverhandlungen. „Die pauschalen
Entgelterhöhungen decken seit Jahren die Lohnkostensteigerungen
nicht mehr ab“, erläutert Bähr.
Weiterhin spricht der Landesrechnungshof von nicht sachgerecht
bemessenen Personalschlüsseln, da der rheinland-pfälzische
Schlüssel über dem der Werkstättenverordnung liegt. Bei den in der
Werkstättenverordnung festgelegten Schlüsseln handelt es sich um
den minimalen Konsens aller Bundesländer. „Wir sind der Meinung:
Die verbesserten Personalschlüssel führen zu einer individuelleren
und differenzierteren Förderung, Bildung und Begleitung von
Menschen mit Behinderungen in Werkstätten. Ihr Streichen würde zu
einem direkten Qualitätsverlust für die Menschen mit Behinderung
führen. Darüber hinaus wäre die Höhe ihres Werkstattlohnes
gefährdet. Aber auch der Verbleib in der Werkstatt wäre bei einigen
Menschen mit Behinderung ohne den Einsatz von Zusatzkräften in
Frage gestellt. Alternativ müssten sie eine Tagesförderstätte mit
deutlich höheren Kosten als die Werkstattkosten besuchen“, sagt
Bähr.
„Wir verwahren uns insgesamt gegen den vom Landesrechnungshof
erweckten Eindruck, die rheinland-pfälzischen Werkstätten für
Menschen mit Behinderung seien überfinanziert und hier würden
unkontrolliert Millionen an Steuergeldern versanden“, empört sich
Bähr. Er sei mehr als irritiert darüber, dass es der Rechnungshof
nicht als nötig erachte, die verschiedenartige Ausgestaltung der
Tagessätze oder das Zustandekommen der Personalschlüssel und die
damit erzielte qualitativ hochwertige Arbeit in den
rheinland-pfälzischen Behindertenwerkstätten zu
berücksichtigen.
Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz,
Presse
10.03.2015
Woche der Brüderlichkeit: Verantwortung braucht Erinnerung
 Kirchenpräsident fordert Solidarität mit Verfolgten heute
- Christlich-Jüdische Gemeinschaftsfeier
Kirchenpräsident fordert Solidarität mit Verfolgten heute
- Christlich-Jüdische Gemeinschaftsfeier
Ludwigshafen- Nach den Worten des pfälzischen
Kirchenpräsident Christian Schad darf unter die Erinnerung an das
während des Naziregimes an der jüdischen Bevölkerung begangene
Unrecht kein Schlussstrich gezogen werden. Vielmehr verpflichte der
Rückblick auf die Geschichte und auf die eigene Mitverantwortung
auch die Kirchen in besonderem Maße zur Solidarität mit den
gegenwärtig zu Unrecht verfolgten Menschen. „Frauen, Männer und
Kinder kommen in diesen Tagen bei uns an, weil die Gewalt sich
immer mehr ausbreitet und sie an Leib und Leben bedroht. Helfen wir
denen, die es nach schlimmen Erfahrungen zu Hause und auf der
Flucht bis hierher geschafft haben und heißen wir sie unter uns
herzlich willkommen“, sagte Schad zur bundesweiten Eröffnung der
„Woche der Brüderlichkeit“ am Samstag in Ludwigshafen.
Der Kirchenpräsident erinnerte in seiner Ansprache in der
Christlich-Jüdischen Gemeinschaftsfeier im Pfalzbau daran, dass
auch die evangelische Kirche im nationalsozialistischen
Unrechtsstaat stumm geblieben sei: „Es gab keinen Aufschrei in
unseren Kirchen. Es mangelte an Klarheit. Als Volk und als Kirche
sind wir in einen ungeheuren Abgrund gestürzt.“ Die Scham über
zugefügtes Unrecht, die Verantwortung für die Folgen vergangener
Schuld und die Pflicht zur Erinnerung müssten heute das gemeinsame
Handeln bestimmen.
Mit Blick auf den Leitgedanken der Woche der Brüderlichkeit „Im
Gehen entsteht der Weg“ forderte der Kirchenpräsident dazu auf,
dass nur in „wahrhaftiger Reue neue gemeinsame Wege entstehen
können“. Die Belastung der Geschichte durch die Nazi-Zeit sei
bleibend, sagte Schad. „Wir sind alle von ihren Folgen betroffen
und für sie in Haftung genommen.“ Dementsprechend habe die
Evangelische Kirche der Pfalz bereits 1995 in ihrer Verfassung die
Selbstverpflichtung festgeschrieben, jeder Form von
Judenfeindschaft entgegenzutreten.
Impulse für die christlich-jüdische Begegnung setzten anlässlich
der Eröffnung der Woche der Brüderlichkeit auch Schüler der
Integrierten Gesamtschule Ernst Bloch aus Ludwigshafen. In einer
Ausstellung präsentierten sie Bilder, Skulpturen und Objekte zum
Thema „Im Gehen entsteht der Weg“. So entwarfen Abiturienten unter
dem Leitgedanken „Religionen spielend lernen“ Spiele zu Judentum,
Christentum und Islam für Schüler der Jahrgänge 9 und 10, wie
Schulpfarrerin Anke Lind mitteilte. Schüler der zehnten
Jahrgangsstufe hatten sich auch mit dem Schicksal heute verfolgter
Menschen befasst, die im „Café Asyl“ der Protestantischen
Kirchengemeinde Ludwigshafen-Mundenheim Hilfe und Unterstützung
erfahren.
Die christlich-jüdische Gemeinschaftsfeier in Ludwigshafen wurde
von Landesrabbiner Henry G. Brandt, Bischof Karl-Heinz Wiesemann
und Kirchenpräsident Christian Schad gestaltet. Die „Woche der
Brüderlichkeit“ findet seit 1952 jedes Jahr statt. Sie wird
getragen von den Gesellschaften für Christlich-Jüdische
Zusammenarbeit in Deutschland. lk
08.03.2015
Dombauverein Speyer stellt neuen „Domführer für Kinder“ vor
 Mit dem „Brezelferdinand“ auf Entdeckungsreise durch den
Kaiser- und Mariendom
Mit dem „Brezelferdinand“ auf Entdeckungsreise durch den
Kaiser- und Mariendom
spk. Speyer. Welch hohen Stellenwert 'Kirche'
heute dem Gewinnen der nachwachsenden Generation für ihre
Glaubensziele zukommen lässt (oder vielleicht auch zukommen lassen
muss), das wurde jetzt einmal mehr bei der Vorstellung des neuen
Domführers für Kinder im Grundschulalter deutlich, den der
„Dombauverein Speyer“ unter dem Titel „Ein Besuch im
Speyerer Dom - der Brezelferdinand auf Entdeckungsreise“
herausgegeben hat. Denn der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann, Domdekan Dr. Christoph Kohl - im Domkapitel
u.a. auch für alles zuständig, was mit Schule und Bildung zu tun
hat und der „summus custos“ - der „oberste Hüter“
der romanischen Kathedrale, Domkapitular Peter
Schappert, ließen es sich nicht nehmen, persönlich zu dem
Pressegespräch des Dombauvereins in den höchst stil- und
geschmackvolllvoll renovierten „Blauen Salon“ im Haus der
Bischöflichen Finanzkammer dazuzukommen.
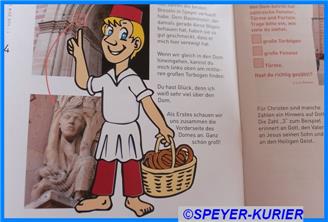 Dort stellte der Vorsitzende des Dombauvereins,
Dr. Wolfgang Hissnauer, gemeinsam mit seiner
Stellverterterin Gudrun Lanig und
Schriftführerin, Dr. Barbara Schmidt-Nechl, das
neue Büchlein vor, mit dem Kinder für den Dom begeistert werden und
eine dauerhafte Beziehung zu der „Mutterkirche des Bistums“
aufbauen sollen. Dass diese Veröffentlichung möglich geworden ist,
dafür dankte Dr. Hissnauer dem Geschäftsführer der „modus medien
und kommunikation“ im südpfälzischen Offenbach, Udo
Kuhn, den Sponsoren des Projektes, bei dieser Gelegenheit
vertreten durch Beate Klehr-Merkl vom
Erdöl-Explorations- und Förder-Konsortium „GDF SUEZ & Palatina
GeoCon“ und, last but not least, den engierten MitarbeiterInnen der
Schulabteilung und des Seelsorgeamtes des Bischöflichen
Ordinariats, die die Konzeption des neuen Domführers übernommen
hatten.
Dort stellte der Vorsitzende des Dombauvereins,
Dr. Wolfgang Hissnauer, gemeinsam mit seiner
Stellverterterin Gudrun Lanig und
Schriftführerin, Dr. Barbara Schmidt-Nechl, das
neue Büchlein vor, mit dem Kinder für den Dom begeistert werden und
eine dauerhafte Beziehung zu der „Mutterkirche des Bistums“
aufbauen sollen. Dass diese Veröffentlichung möglich geworden ist,
dafür dankte Dr. Hissnauer dem Geschäftsführer der „modus medien
und kommunikation“ im südpfälzischen Offenbach, Udo
Kuhn, den Sponsoren des Projektes, bei dieser Gelegenheit
vertreten durch Beate Klehr-Merkl vom
Erdöl-Explorations- und Förder-Konsortium „GDF SUEZ & Palatina
GeoCon“ und, last but not least, den engierten MitarbeiterInnen der
Schulabteilung und des Seelsorgeamtes des Bischöflichen
Ordinariats, die die Konzeption des neuen Domführers übernommen
hatten.
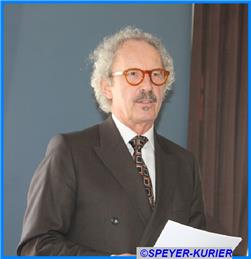 Der entscheidende Impuls für diese Veröffentlichung, so
Dr. Hissnauer, sei von einem der letzten „Familientage“ des
Dombauvereins ausgegangen, bei dem Kinder ihr großes Interesse an
der Kathedrale zum Ausdruck gebracht hätten. Mit dem jetzt
vorgelegten Domführer solle deshalb das Wissen der Kinder über den
Dom gefördert und die visuelle Beziehung zu der Kathedrale
aufgebaut und gestärkt werden.
Der entscheidende Impuls für diese Veröffentlichung, so
Dr. Hissnauer, sei von einem der letzten „Familientage“ des
Dombauvereins ausgegangen, bei dem Kinder ihr großes Interesse an
der Kathedrale zum Ausdruck gebracht hätten. Mit dem jetzt
vorgelegten Domführer solle deshalb das Wissen der Kinder über den
Dom gefördert und die visuelle Beziehung zu der Kathedrale
aufgebaut und gestärkt werden.
Größte Herausforderung im Vorfeld der Veröffentlichung sei die
Entscheidung darüber gewesen, welche der unzählig vielen
Informationen über den Dom Eingang in das Büchlein finden sollten,
um es einerseits nicht zu überfrachten, andererseits aber auch kein
wichtiges Detail zu vergessen. In zahlreichen Sitzungen habe sich
das Redaktionsteam dann auf die jetzt vorgelegten Inhalte
verständigt und als Begleiter durch die Kathedrale den „Brezelbub
Ferdinand“ ausgewählt, der schon in der kunstvollen Steinmetzarbeit
des Bogens über dem mittleren Eingang zur Vorhalle des Domes
verewigt worden sei. Mit der Einbeziehung eines das gesamte
Büchlein begleitenden Quiz' erhalte der neue Domführer zudem auch
einen dialogischen Charakter, so Dr. Hissnauer.
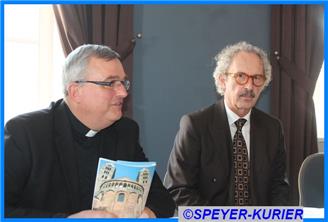 Auch Bischof Dr. Wiesemann lobte diesen
interaktiven Ansatz, der Kinder in ihrer Form der Wahrnehmung ernst
nehme, denn „Kinder sind oft weitaus bessere Beobachter als
Erwachsene“, so der „Jugendbischof“ der Deutschen
Bischofskonferenz, der es als eine der wichtigsten pädagogischen
Aufgaben überhaupt bezeichnete, „Kinder das Sehen zu lehren – das
Schauen und das Staunen“. Der Speyerer Kaiser- und Mariendom lade
geradezu ein „zum Staunen und zum Wahrnehmen des Großen und des
Kleinen“ - jener Mystheriologie, die diesem Bauwerk innewohne. Als
Beispiel verwies Bischof Dr. Wiesemann auf das runde
„Sonnenfenster“ in der Apsis des Domes, durch das an zwei Tagen im
Jahr die Sonne direkt auf das Kreuz im Vierungsgewölbe der
Kathedrale falle – nur eines von zahllosen Details in der
Kathedrale, von denen die Wichtigsten in dem neuen Domführer
zusammengefaßt seien. „Unsere Gesellschaft ist heute bestimmt von
einer
Auch Bischof Dr. Wiesemann lobte diesen
interaktiven Ansatz, der Kinder in ihrer Form der Wahrnehmung ernst
nehme, denn „Kinder sind oft weitaus bessere Beobachter als
Erwachsene“, so der „Jugendbischof“ der Deutschen
Bischofskonferenz, der es als eine der wichtigsten pädagogischen
Aufgaben überhaupt bezeichnete, „Kinder das Sehen zu lehren – das
Schauen und das Staunen“. Der Speyerer Kaiser- und Mariendom lade
geradezu ein „zum Staunen und zum Wahrnehmen des Großen und des
Kleinen“ - jener Mystheriologie, die diesem Bauwerk innewohne. Als
Beispiel verwies Bischof Dr. Wiesemann auf das runde
„Sonnenfenster“ in der Apsis des Domes, durch das an zwei Tagen im
Jahr die Sonne direkt auf das Kreuz im Vierungsgewölbe der
Kathedrale falle – nur eines von zahllosen Details in der
Kathedrale, von denen die Wichtigsten in dem neuen Domführer
zusammengefaßt seien. „Unsere Gesellschaft ist heute bestimmt von
einer  Überfülle von Eindrücken und Informationen“, stellte der
Bischof fest; „deshalb brauchen wir auch die Reduktion auf das
Wesentliche“. Dies gelte insbesondere auch für Kinder, die deshalb
schon früh an die große Kultur- und Geisteswelt des Abendlandes
herangeführt werden sollten.
Überfülle von Eindrücken und Informationen“, stellte der
Bischof fest; „deshalb brauchen wir auch die Reduktion auf das
Wesentliche“. Dies gelte insbesondere auch für Kinder, die deshalb
schon früh an die große Kultur- und Geisteswelt des Abendlandes
herangeführt werden sollten.
Den Verantwortlichen des Dombauvereins dankte Bischof Dr.
Wiesemann, dass sie sich mit dem neuen Domführer dieser
Herausforderung gestellt hätten. Er freue sich sehr über dieses
„überaus gelungene Werk“, dem er eine große Resonanz bei seiner
jungen Leserschaft wünschte.
Auch Domdekan Dr. Christoph Kohl betonte, dass
es wichtig sei „die Kinder auf Entdeckungsreise zu schicken und
nicht auf alles eine bereits fertige Antwort zu liefern.“ Dadurch
werde die Wahrnehmung geschult und größere Zusammenhänge könnten
sich leichter erschließen.
 Das handliche, 36 Seiten umfassende Büchlein ist wie eine
Führung durch den Speyerer Dom angelegt. Auf einer ausklappbaren
Übersicht sind die 13 darin erläuterten Stationen gekennzeichnet.
Start ist am Hauptportal, wo der „Brezelferdinand“ die Kinder
empfängt. Er ist die Leitfigur, die die Mädchen und Jungen
gewissermaßen an die Hand nimmt und durch die Kathedrale
begleitet.
Das handliche, 36 Seiten umfassende Büchlein ist wie eine
Führung durch den Speyerer Dom angelegt. Auf einer ausklappbaren
Übersicht sind die 13 darin erläuterten Stationen gekennzeichnet.
Start ist am Hauptportal, wo der „Brezelferdinand“ die Kinder
empfängt. Er ist die Leitfigur, die die Mädchen und Jungen
gewissermaßen an die Hand nimmt und durch die Kathedrale
begleitet.
Das Buch geht unter anderem auf die Baugeschichte ein und
erklärt, warum der Grundriss des Doms die Form eines Kreuzes
darstellt und welche Zahlensymbolik dem Bau zugrunde liegt. Der
Kinder-Domführer zeigt die Grablege der Kaiser, die Afra-Kapelle
sowie die große Orgel. Um die jungen Leser einzubeziehen, stellt
der Domführer Fragen, etwa ob das Bronzeportal so schwer ist wie
ein, drei oder fünf Autos. Im Anhang sind die wichtigsten
 Begriffe erläutert. Außerdem verweisen QR-Codes auf
zusätzliche Informationen und verlinken zur Dom-App, zum virtuellen
Kaiserdom, zu den Internetauftritten des Dombauvereins, des
Bistums, der Dommusik und des Historischen Museums der Pfalz, in
dem auch der Domschatz ausgestellt ist.
Begriffe erläutert. Außerdem verweisen QR-Codes auf
zusätzliche Informationen und verlinken zur Dom-App, zum virtuellen
Kaiserdom, zu den Internetauftritten des Dombauvereins, des
Bistums, der Dommusik und des Historischen Museums der Pfalz, in
dem auch der Domschatz ausgestellt ist.
Die Texte sind kurz gehalten, damit Mädchen und Jungen sie
leicht erfassen können. Viele Bilder illustrieren das Geschriebene.
Der Domführer soll nicht nur Begleiter vor Ort sein, sondern auch
Kindern das Bauwerk nahe bringen, die noch nicht im Dom waren.
Autoren sind Mitarbeiter des Bistums, Grundschullehrer sowie Dr.
Wolfgang Hissnauer, Vorsitzender des Dombauvereins Speyer. Das
Vorwort lieferte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
„Ein Besuch im Speyerer Dom. Der Brezelferdinand auf
Entdeckungsreise“ (ISBN-Nummer 978-3-9816790-0-7) ist ab sofort zum
Preis von 5 Euro in allen Buchhandlungen erhältlich.
Fotos: gc
07.03.2015
Das Miteinander gestalten
 Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz e.V. (ZIRP) unterstützt
Bürgerinitiative „Respekt: Menschen“
Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz e.V. (ZIRP) unterstützt
Bürgerinitiative „Respekt: Menschen“
Ludwigshafen- (zirp/lk). Die Aufnahme
von Flüchtlingen erfüllt nach Auffassung von Kirchenpräsident
Christian Schad einen genuin biblischen Auftrag und ist zudem eine
große Bereicherung für die Gesellschaft insgesamt. „Wenn Menschen
unterschiedlicher Herkunft, Kulturen und Religionen das Miteinander
gestalten, ist dies eine Chance für die Zukunft unseres Landes“,
sagte Schad bei der Übergabe einer Spende der Zukunftsinitiative
Rheinland-Pfalz e.V. (ZIRP) an die Bürgerinitiative „Respekt:
Menschen“ in Ludwigshafen-Mundenheim. ZIRP-Geschäftsführerin Heike
Arend betonte, dass eine gelebte Willkommenskultur die Ankunft von
Menschen erleichtern könne, wie dies die Bürgerinitiative in
vorbildlicher Weise zeige.
Schad und Arend lobten das Engagement der Ehrenamtlichen, die
wichtige Hilfen im Alltag geben, wie zum Beispiel die Begleitung
bei Behördengängen oder Arztbesuchen. „Die Menschen spüren, dass
sie mit offenem Herzen empfangen werden und tatkräftige
Unterstützung finden“, sagte der Kirchenpräsident. Freilich könne
dies nur im Zusammenspiel vieler unterschiedlicher
zivilgesellschaftlicher Akteure gelingen, von den staatlichen
Verwaltungen über die Wirtschaft, die Kirchen und ihre Diakonie bis
hin zu Bürgerinitiativen. Mit der Spende von 1.000 Euro wolle die
ZIRP deutlich machen, wie wichtig eine sozial gerechte Zukunft sei,
bei der der Mensch im Mittelpunkt stehe, erklärte Geschäftsführerin
Arend.
Da die Teilnahme am Alltagsleben in Deutschland nur möglich sei,
wenn die Flüchtlinge ausreichende Sprachkenntnisse besitzen würden,
stellte der Kirchenpräsident spontan weitere 1.000 Euro für einen
Deutschkurs zur Verfügung. „Die deutsche Sprache zu verstehen und
sie sprechen zu können, sind Grundvoraussetzungen für gelingende
Integration“, sagte der Kirchenpräsident.
Norbert Bensch, lange Jahre Vorsitzender des Presbyteriums der
Protestantischen Kirchengemeinde Mundenheim betonte, dass man für
die finanzielle Unterstützung sehr dankbar sei, ebenso für
innovative Ideen. So sei neben der Einrichtung einer
Fahrradwerkstatt auch an die Anlage eines Gemüsegartens gedacht.
Christel Aderhold, eine der Gründungsmitglieder der
Bürgerinitiative, kündigte an, dass die Spende der ZIRP für die
Arbeit im „Café Asyl“ im Mundenheimer Gemeindehaus verwendet
würde.
Die Zukunftsinitiative Rheinland-Pfalz e. V. (ZIRP) wird von
rund 80 Persönlichkeiten, Unternehmen und Institutionen aus
Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Kultur getragen. Die ZIRP
stärkt im gemeinsamen Engagement von Wirtschaft und Politik das
Land als internationalen Wirtschaftsstandort und fördert seine
Attraktivität als Lebens- und Arbeitsraum sowie als zentraler
europäischer Ort der Kultur. Alljährlich unterstützt sie mit einer
Spende ein beispielhaftes gemeinnütziges Projekt. Kirchenpräsident
Christian Schad ist Mitglied des Vorstandes der ZIRP.
In der Initiative „Respekt: Menschen“ engagieren sich rund 20
Personen. In Zusammenarbeit mit der Arbeitsstelle Flüchtlingshilfe
im Haus der Diakonie in Ludwigshafen, dem Gemeindepädagogischen
Dienst und der Protestantischen Kirchengemeinde Mundenheim hat
„Respekt: Menschen“ das „Café Asyl“ eingerichtet, das jeden
Dienstag Heimat suchenden Menschen die Möglichkeit zum Austausch
bietet und es ermöglicht, hilfreiche Kontakte zu knüpfen.
Inzwischen hat sich das „Café Asyl“ zu einem wöchentlichen
Treffpunkt für ca. 80 bis 100 Menschen jeden Alters und jeder
Herkunft entwickelt.
Hinweis: http://www.respekt-menschen.de/
Text und Foto: Evangelischen Kirche der Pfalz
(Protestantische Landeskirche), Presse
06.03.2015
Familienbund der Katholiken von geplanter Kindergelderhöhung enttäuscht
Kein Geld für Familien!
Speyer- Der Familienbund der
Katholiken hat die heute bekannt gewordenen Pläne für eine
Kindergelderhöhung als ungenügend und enttäuschend kritisiert. „Die
geplante Erhöhung des Kindergeldes von vier und im nächsten Jahr
zwei Euro bleibt deutlich hinter den Erwartungen der Familien und
den Versprechungen der Regierungsparteien zurück. Insbesondere
Familien mit kleineren Einkommen hätten in Anbetracht der guten
Steuerentwicklung jetzt spürbar entlastet werden können“ sagten
Hede Metz-Strubel und Jeannette Sommer, stellvertretende
Vorsitzende des Familienbundes der Katholiken im Bistum Speyer. In
keiner Weise nachvollziehbar ist es, dass die bereits 2014 fällige
Anpassung des Kinderfreibetrages und des Kindergeldes nicht mehr
nachgeholt werden soll. „Die Erhöhung des Kindergeldes ist kein
Geschenk für Familien, sondern verfassungsrechtlich zwingend
geboten, wie die Bundesregierung selbst unlängst in ihrem Bericht
über das steuerfrei zu stellende Existenzminimum festgestellt hat.
Es darf nicht sein, dass Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble
seinen Haushalt ausgerechnet auf dem Rücken der Familien
ausgleichen will“.
Die geplante Erhöhung des Kinderzuschlages
für Geringverdiener sei gut und richtig, muss allerdings sofort und
nicht erst Mitte kommenden Jahres erfolgen. Als überfällig
bezeichnete Jeannette Sommer eine Erhöhung des Freibetrages für
Alleinerziehende. Dieser sei seit zehn Jahren nicht erhöht worden,
eine Anpassung dürfe nicht wieder verschoben werden. Der
Familienbund fordert grundsätzlich die Anhebung des
Kinderfreibetrages auf das Niveau der Erwachsenen und die
entsprechende Erhöhung des Kindergeldes. „Familien sichern die
Zukunft unserer Gesellschaft! Bei ihnen zu sparen, wäre das falsche
Signal“, so Jeannette Sommer.
Der Familienbund der Katholiken ist der
mitgliederstärkste Familienverband Deutschlands.
Ihm gehören 25 Diözesan-, 10 Landes- sowie 15
Mitgliedsverbände an. Im Bistum Speyer gehören ihm 11 Verbände oder
Einrichtungen an.
Text: Familienbund der Katholiken e.V.,
Presse
05.03.2015
Das goldene Buch des Mittelalters
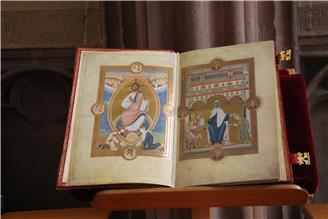 Vor 20 Jahren am 4.
März 1995 wurde dem Dom zu Speyer eine Faksimileausgabe des
Speyerer Evangeliars übergeben
Vor 20 Jahren am 4.
März 1995 wurde dem Dom zu Speyer eine Faksimileausgabe des
Speyerer Evangeliars übergeben
Speyer- (is). Das Speyerer Evangeliar
gehört zu den prachtvollsten Pergamenthandschriften des
Mittelalters. Mönche des Klosters Echternach schrieben um 1045 mit
goldener Tinte die Texte der vier Evangelien nieder. Das Evangeliar
trägt daher auch die Bezeichnung „Codex Aureus“: Goldenes Buch.
Gefertigt wurde das liturgische Buch im Auftrag des Kaisers
Heinrich III. für den Speyerer Dom. Der Anlass zur Stiftung war die
Weihe des Hochaltars im Jahr 1046. Das Dedikationsbild zeigt Maria,
Patronin des Doms, im Zentrum, Heinrich III. und seine Frau
Kaiserin Agnes links und rechts daneben. Die Medaillons zeigen die
vier Kardinaltugenden Klugheit, Mäßigkeit, Stärke und
Gerechtigkeit. In der oberen Bildhälfte ist der Speyerer Dom
abgebildet – in vorweg genommener Vollendung, denn die Kathedrale
war damals noch eine Baustelle. Die Stiftung Heinrich III. sollte
die Verbindung zwischen der Himmelskönigin und der salischen
Dynastie liturgisch bestätigen und bestärken und so das Werk seines
Vaters, des salischen Domgründers Konrad II., fortsetzten.
13 ganzseitige und 43 halbseitige Bilder zieren die Handschrift.
Hinzu kommen 12 Kanontafeln und eine große Zahl von Zierelementen,
zusammen 141 Dekorseiten und 46 Miniaturen. Diese Verzierungen
stehen ganz im Dienst der „Worte des Lebens“ und verleihen zusammen
mit der Goldtinte der Würde des Textes Ausdruck. Als
„Non-plus-ultra der mittelalterlichen Buchkunst“ bezeichnete es
Bischof Dr. Anton Schlembach das Speyerer Evangeliar anlässlich der
Übergabe eines Faksimiles vor 20 Jahren.
Da Original kam dem Speyerer Dom im 15. Jahrhundert abhanden.
Wahrscheinlich als Geschenk des Pfalzgrafen und Bischofs von Speyer
Georg an Kaiser Maximilian I. gelangte es über die Erbfolge
schließlich bis nach Spanien. Der Codex ging für Speyer zwar
verloren, fiel auf diesem Weg aber wenigstens nicht den
Zerstörungen und Zerschlagung des Speyerer Domschatzes in späteren
Jahrhunderten zum Opfer. 950 Jahre nach seiner Erschaffung schenkte
der spanische König Juan Carlos I. dem Speyerer Dom eine Faksimile
Ausgabe des Speyerer Evangeliars. Kurt Beck, der damalige
Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz sprach anlässlich der
Übergabe von einem „Symbol für das Zusammenwachsen Europas in
Frieden und Freiheit“. Übergeben wurde es an den damaligen Bischof
von Speyer Dr. Anton Schlembach von Julio de la Guardia García,
Leitender Rat des Patrimonio Nacional. Die Herstellung gelang dem
spanischen Verlag Testimonio, nachdem eine Faksimilierung in den
1980er-Jahren gescheitert war.
Je nach Betrachtungsweise nennt man die Pergamenthandschrift
nach ihrem zugedachten Bestimmungsort, dem Dom zu Speyer, „Codex
Aureus Spirensis” oder nach der Escorial-Bibliothek, die sie heute
verwahrt, „Codex Aureus Escorialensis”. Der Codex zählt zu den
Hauptwerken der ottonischen Buchmalerei und ist auch unter den
Bezeichnungen Salisches Kaiser-Evangeliar oder Goldenes
Evangelienbuch Heinrichs III. bekannt. Foto: Domkapitel
Speyer
04.03.2015
Stephan Tschepella ist neuer Leiter des Bischöflichen Bauamtes
 Diplom-Ingenieur und Architekt hat zum 1. März die
Nachfolge von Gustav Appeltauer angetreten
Diplom-Ingenieur und Architekt hat zum 1. März die
Nachfolge von Gustav Appeltauer angetreten
Speyer- (is). Das Bischöfliche Bauamt
hat zum 1. März einen neuen Leiter bekommen: Stephan Tschepella
tritt die Nachfolge von Gustav Appeltauer an, der die Altersgrenze
erreicht hat und in den Ruhestand geht. Im Rahmen einer kleinen
Feier begrüßte Domkapitular Peter Schappert, Leiter der
Hauptabteilung Finanzen und Immobilien, heute offiziell den neuen
Baumamtsleiter und stellte ihn den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Abteilung vor. Dem bisherigen Diözesanbaudirektor
i.K. Gustav Appeltauer dankte Schappert dafür, dass er noch bis zu
seiner Verabschiedung Ende März für die Einführung seines
Nachfolgers zur Verfügung steht.
Stephan Tschepella (40) stammt aus Reutlingen. Er hat an der
Universität Karlsruhe Architektur studiert. Ein Auslandssemester
führte ihn nach Florenz, in seiner Diplomarbeit befasste er sich
mit dem neuen Hochgeschwindigkeitsbahnhof der norditalienischen

Metropole. Seine berufliche Laufbahn begann der
Diplom-Ingenieur und Architekt als Projektleiter bei einem
Karlsruher Architekturbüro. In den Jahren 2007 und 2008 nahm er
zudem einen Lehrauftrag am Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen
der Universität Karlsruhe wahr. Vor sieben Jahren wechselte Stephan
Tschepella zur Kreisverwaltung Südliche Weinstraße nach Landau, wo
er in der Abteilung Bauen und Umwelt einen Baubezirk leitete. Über
mehrere Jahre engagierte sich Stephan Tschepella in der
Architektenkammer und einem Karlsruher Bürgerverein.
Seine neue Aufgabe im Bischöflichen Bauamt bewertet er als
Herausforderung, der er sich gerne stellt: „Ich freue mich auf die
neue Aufgabe und die Herausforderung. Die Arbeit wird uns bei dem
Gebäudebestand sicher nicht ausgehen.“
Text und Bild: Bistum Speyer, Presse03.03.2015
Die Kirche: „Haus aus Steinen“ und „Haus aus Menschen“
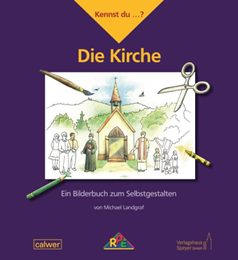 Von Michael Landgraf ist ein neues Kinderbuch zum
Selbstgestalten erschienen
Von Michael Landgraf ist ein neues Kinderbuch zum
Selbstgestalten erschienen
Neustadt- (lk). Wenn von Kirche die Rede ist,
dann sind einerseits die Gebäude, aber auch die Gemeinden und die
umfassende Gemeinschaft gemeint. In seinem neuen Kinderbuch „Die
Kirche“ schickt der Neustadter Autor und Leiter des
Religionspädagogischen Zentrums, Michael Landgraf, junge Leser auf
Entdeckungsreise durch das „Haus aus Steinen“ und das „Haus aus
Menschen“. Kinder können mit Hilfe des Buches dem Schlüsselbegriff
„Kirche“ differenziert auf den Grund gehen. Der Band ist in der
Reihe „Kennst du…?“ erschienen und ist ein Gemeinschaftsprojekt der
Verlage Calwer, RPE und Verlagshaus Speyer GmbH.
Was ist eine Kanzel, ein Altar oder ein Gesangbuch? Wie kommen
die Glocken in den Kirchturm und wie die Töne aus der Orgel? Anhand
elementarer Texte und der Grafiken der Bad Dürkheimer Künstlerin
Claudia Held-Bez gehen die jungen Leser auf Spurensuche in
evangelischen und katholischen Kirchengebäuden. Das Buch erklärt
christliche Symbole, beschreibt Formen und Elemente des
Gottesdienstes und stellt die Kirchengemeinde mit ihren
vielfältigen Aufgaben dar. Es enthält zudem einen Überblick über
Konfessionen und Kirchengemeinschaften und zeigt auf, was sie
unterscheidet und was sie eint.
Schon das Titelbild mit der Abbildung von Schere und Stift
zeigt, dass auch dieser Band mehr ist als nur ein bebildertes
Lesebuch: Es ist vielmehr ein Buch zum Selbstgestalten. „Der
Betrachter wird dazu angeregt, genau hinzusehen und etwas
auszuprobieren. Jedes Buch erhält so eine persönliche Note“, sagt
Michael Landgraf. Am Ende können die jungen Leser ihr Wissen unter
dem Stichwort „Wie war das noch?“ überprüfen. Der Band „Kennst du…?
Die Kirche“ eigne sich für die Schule, für die Arbeit mit Kindern
sowie die Kinderkirche „und für Neugierige, die selbst etwas
entdecken wollen“.
Hinweis: Michael Landgraf: „Kennst du ...? Die Kirche.
Ein Bilderbuch zum Selbstgestalten“, Speyer und Stuttgart 2015, 32
Seiten, mit Illustrationen von Claudia Held-Bez; 6,95 Euro, ab zehn
Exemplaren 5,95 Euro, ab 25 Exemplaren 4,95 Euro; ISBN
978-3-7668-4345-6 (Calwer Verlag Stuttgart), ISBN 978-3-938356-60-9
(RPE Verlag Stuttgart) oder ISBN 978-3-939512-70-7 (Verlagshaus
Speyer). Text und Bild: EVANGELISCHE KIRCHE DER PFALZ,
Presse
28.02.2015
Starker Jahrgang: Neue Pfarrer treten Dienst an
 v.l.: Michelle Scherer, Benjamin Leppla, Oberkirchenrat Gottfried Müller, Katherina Westrich, Robert Fillinger, Susanne Leingang, Markus Spreckelsen, Tobias Dötzkirchner, Anne Trautmann, Nicole Pusch, Janina Kuhn, Jan Meckler und Johannes Gerhardt.
v.l.: Michelle Scherer, Benjamin Leppla, Oberkirchenrat Gottfried Müller, Katherina Westrich, Robert Fillinger, Susanne Leingang, Markus Spreckelsen, Tobias Dötzkirchner, Anne Trautmann, Nicole Pusch, Janina Kuhn, Jan Meckler und Johannes Gerhardt.
Ernennungsurkunden für Theologen – Personaldezernent
freut sich über positive Entwicklung
Speyer- Zwölf Theologen treten ab 1. März
ihren Dienst als Pfarrer der Evangelischen Kirche der Pfalz an.
Nach drei kleineren Jahrgängen kämen jetzt wieder größere in den
Dienst, erklärte anlässlich der Verleihung der Ernennungsurkunden
an die Pfarrerinnen und Pfarrer der Personaldezernent der
Landeskirche, Oberkirchenrat Gottfried Müller. „Über diese positive
Entwicklung freuen wir uns sehr.“
Der Oberkirchenrat wünschte den Pfarrern einen guten Start in
den neuen Lebensabschnitt: „Sie sind jetzt eine Person des
öffentlichen Lebens.“ Denjenigen, die eine Gemeindepfarrstelle
antreten, empfahl Müller, ein konstruktives Verhältnis zum
Presbyterium zu schaffen, aber auch eigene Positionen zu vertreten.
Der Pfarrberuf sei geprägt von persönlicher Ausstrahlung und
Überzeugungskraft des gelebten Glaubens
Die frischgebackenen Pfarrerinnen und Pfarrer übernehmen
Pfarrstellen in folgenden Gemeinden:
Im Kirchenbezirk Homburg teilt sich Tobias Dötzkirchner
(30) die Pfarrstelle in Miesenbach mit seiner Frau Dorothea
Dötzkirchner. Anne Trautmann (27) wird Pfarrerin in Landstuhl und
Markus Spreckelsen (34) Pfarrer in Waldmohr. Im Kirchenbezirk
Kaiserslautern übernimmt Katherina Westrich (29) die
Pfarrstelle 2 der Christuskirchengemeinde. Im Kirchenbezirk
Lauterecken wird Benjamin Leppla (46) Pfarrer in Wolfstein. Im
Kirchenbezirk Ludwigshafen betreut Johannes Gerhardt (33)
die Pfarrstelle 2 Ludwigshafen-Friesenheim in der
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde. Im Kirchenbezirk Zweibrücken
wird Michelle Scherer (29) Pfarrerin in St. Ingbert,
Martin-Luther-Kirche
Robert Fillinger (31) übernimmt die Vertretung als
Religionslehrer am Burggymnasium in Kaiserslautern.
Pfarrstellen zur Dienstleistung treten Janina Kuhn (29) in
Kusel und Susanne Leingang (28) in Pirmasens (ab 1.
Juni 2015) an. Jan Meckler (32) beginnt nach Ablauf einer
Elternzeit voraussichtlich auf einer Gemeindepfarrstelle. Nicole
Pusch (30) absolviert ein Volontariat beim Saarländischen Rundfunk
in Saarbrücken.
In der Evangelischen Kirche der Pfalz sind nach Auskunft von
Oberkirchenrat Müller zurzeit 574 Pfarrerinnen und Pfarrer im
Dienst. Auf der Liste der Theologiestudierenden befänden sich 49
junge Leute, Vikare gebe es 27. Text und Foto: lk
26.02.2015
Unterschiedliche Wege zum Glauben
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann mit einem der Taufbewerber aus dem Bistum Speyer
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann mit einem der Taufbewerber aus dem Bistum Speyer
Zentrale Zulassungsfeier für erwachsene
Taufbewerber in der Domkrypta in Speyer
Speyer- Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
hat am Sonntag in der Krypta des Speyerer Domes 18 erwachsenen
Taufbewerberinnen und Taufbewerbern (Katechumenen) aus dem Bistum
Speyer offiziell die Zulassung zu den Sakramenten des Christwerdens
erteilt. Die Frauen und Männer im Alter von 19 bis 50 Jahren werden
in der Osternacht in ihren Heimatpfarreien getauft, gefirmt und
empfangen zum ersten Mal die heilige Kommunion.
Die Taufbewerberinnen und Taufbewerber sind auf ganz
unterschiedlichen Wegen mit dem Glauben in Kontakt gekommen: In
einer längeren Zeit der Vorbereitung (Katechumenat) haben sie sich
auf den Empfang der Sakramente vorbereitet. Unter Anleitung
erfahrener Christen lernten die Taufanwärter im Katechumenat
christlichen Glauben und Lebensstil kennen. Mit der Zulassung zur
Taufe beginnt jetzt für die Frauen und Männer die letzte intensive
Phase der Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente an
Ostern.
In seiner Predigt ging Bischof Dr. Wiesemann zunächst auf das
Schriftwort des Propheten Jesaja ein: „Seht das ist mein Knecht,
den ich erwählt habe“. Gott sage zu jeder Taufbewerberin, zu jedem
Taufbewerber mit diesem Schriftwort „Ich habe dich erwählt.“ Die
Worte der Bibel seien nicht Menschenwort sondern Gotteswort und
wirkten bis ins Heute. Weiter heißt es im Schrifttext: „Ich habe
dich von den Enden der Erde geholt, aus ihrem äußersten Winkel habe
ich dich gerufen.“ Bischof Wiesemann verwies darauf, dass
geographisch gesehen auch die Katechumenen aus den entferntesten
Winkel der Erde, von Kasachstan über Kleinasien, bis hin nach Kuba
kommen. Aber es gehe nicht nur um die äußere Entfernung, sondern
auch um die innere. Gott habe diese Katechumenen mit ihren Talenten
und Charismen herausgerufen und erwählt, um in die Gemeinschaft der
Kirche aufgenommen zu werden. Kirche heiße im Lateinischen
ecclesia, die Herausgerufene. Mit der Taufe berufe Gott Menschen in
die Gemeinschaft der Kirche und sende sie in die Welt, damit sie
das Evangelium in Wort und Tat bezeugten. „Das ist nicht immer
einfach, aber Gott sagt zu uns: 'Fürchte dich nicht, denn ich bin
mit dir!'“, so Wiesmann.
Weiter verwies Bischof Dr. Wiesemann auf die besondere Symbolik
des Ortes der Feier: In die Krypta muss man hinabsteigen, von außen
ist sie nicht sichtbar, sie scheint verborgen im Innern des großen
Domes. Sie bildet mit das Fundament des Domes. Und im Zentrum der
Krypta steht der alte Taufbrunnen. Auf das Fundament der Krypta
stützt sich der Altarraum, der Vierungsturm mit seinem gewaltigen
Gewölbe, quasi der ganze Dom. Dieses Bild könne auch für die
Menschen stehen: „Wenn der Glaube, auf den wir getauft werden,
Fundament unseres Lebens ist, dann werden wir spüren welche Kraft
und welche Perspektive uns Gott schenken kann." Dies sollten die
Getauften immer wieder durch Wort und Tat in ihrem Leben
bezeugen.
In der feierlichen Liturgie stellten die Glaubensbegleiter aus
den Gemeinden die Taufbewerber dem Bischof vor und übergaben
Empfehlungsschreiben, in denen die Gemeinden um die Taufe der
Katechumenen bitten. Pfarrer Benno Riether berichtete
stellvertretend über den Glaubensweg einer Bewerberin und eines
Bewerbers.
Die Feier wurde musikalisch beeindruckend mitgestaltet durch ein
Vokalensemble unter Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori
und Domorganist Markus Eichenlaub.
Hintergrund
Das Wort "Katechumenat" leitet sich vom
griechischen "katechein" her, das "entgegentönen", aber auch
"unterrichten" bedeutet. Bis ins vierte Jahrhundert hat diese Form
der Sakramentenvorbereitung das kirchliche Leben geprägt; sie
erlebt seit gut einem Jahrzehnt eine Renaissance. Erwachsene
Taufbewerber wurden – damals wie heute - durch Bürgen der Gemeinde
vorgestellt und in einem ersten Ritus in den Katechumenat
aufgenommen.
Katecheten trugen Verantwortung für einen Glaubensunterricht. Wenn
in den Katechumenen die Entscheidung gereift war, sich in der
folgenden Osternacht taufen zu lassen, wurden sie sechs Wochen
zuvor, zu Beginn der Fastenzeit, vom Bischof feierlich zur Taufe
zugelassen. Damit begann die letzte intensive Phase der
Vorbereitung auf den Empfang der Sakramente der Eingliederung in
die Kirche (Taufe, Firmung, Eucharistie). An diese altkirchliche
Tradition knüpft die heutige Praxis an. Text und Foto:
is
23.02.2015
Bistumsarchiv Speyer mit geänderten Öffnungszeiten
 Verlängertes Angebot am Mittwochabend – Montags
geschlossen
Verlängertes Angebot am Mittwochabend – Montags
geschlossen
Speyer- Für den Lesesaal im Bistumsarchiv
Speyer gelten ab 1. März geänderte Öffnungszeiten.
Geschichtsinteressierte können die kirchliche Einrichtung in der
Kleinen Pfaffengasse 16 in Speyer dienstags und donnerstags von 9
bis 16 Uhr, mittwochs von 9 bis 18 Uhr sowie freitags von 9 bis 12
Uhr aufsuchen.
Eine Voranmeldung (Telefon 0 62 32/102-256, E-Mail: bistumsarchiv@bistum-speyer.de)
ist aufgrund der beschränkten Platzanzahl empfehlenswert.
Der Lesesaal des Bistumsarchivs zählt jährlich rund 500 Nutzerinnen
und Nutzer, die Archivalien zu familienkundlichen,
ortsgeschichtlichen und wissenschaftlichen Fragestellungen
einsehen. Das Archiv verwahrt Bestände zur Geschichte des Bistums
Speyer vor allem aus dem 19. und 20. Jahrhundert.
Weitere Informationen unter www.bistumsarchiv-speyer.de.
Text und Foto: is
23.02.2015
Zeit der bewussten Ausrichtung auf Gott
 Weihbischof Georgens predigte am Aschermittwoch im
Speyerer Dom - Gläubige mit Aschenkreuz bezeichnet
Weihbischof Georgens predigte am Aschermittwoch im
Speyerer Dom - Gläubige mit Aschenkreuz bezeichnet
Speyer- „Fastenzeit ist keine Art von
religiösem Trainingslager, sondern meint die bewusste Ausrichtung
auf Gott“, erklärte Weihbischof Otto Georgens in seiner Predigt im
Aschermittwochsgottesdienst im Speyerer Dom. Ausgangspunkt für
diese Zeit der Umkehr und Buße sei nicht das Vertrauen auf die
eigenen Selbstheilungskräfte sondern das Vertrauen auf Gott, so wie
es auch im Tagesgebet formuliert werde: „Getreuer Gott, im
Vertrauen auf dich beginnen wir die vierzig Tag der Umkehr und
Buße. Gib uns die Kraft zu christlicher Zucht, damit wir dem Bösen
absagen, und mit Entschiedenheit das Gute tun.“ Dieses Gebet sei
„Programm“ für die ganze Fastenzeit, so der Weihbischof.
Mit „christliche Zucht“ sei nicht eine Sammlung von
Verhaltensmaßregeln zum „züchtigen“ des Menschen gemeint, sondern
die Bereitschaft „sich von Gott anziehen zu lassen“ und ihn als die
Grunddynamik des eigenen Lebens anzuerkennen. Wer sich davon
faszinieren lasse, bekomme Kraft zur Umkehr, zu einem Leben, wie es
Jesus gelebt habe.
Zur dieser Umkehr gehöre außerdem nicht nur „dem Bösen abzusagen“
sondern „mit aller Entschiedenheit das Gute zu tun“, betonte der
Weihbischof. Mehr als alle anderen Zeiten im Kirchenjahr stehe die
40-tägige Fastenzeit im Zeichen des Kreuzes, Zeichen der
Orientierung an Jesus. Er gab den Gläubigen die Anregung mit „in
den vor uns liegenden 40 Tagen bewusster als sonst nach den Kreuzen
in unserer Umgebung Ausschau zu halten. Nicht mit dem
kontrollierenden Blick, der sehen will, ob sie noch da sind,
sondern mit dem Blick, der uns neu entdecken lässt: Du, Jesus, bist
die Orientierung meines Lebens.“
Während des Gottesdienstes zeichneten Weihbischof Georgens und
Mitglieder des Domkapitels den Gläubigen - wie es seit dem elften
Jahrhundert Tradition ist - ein Aschenkreuz auf die Stirn. Die aus
geweihten Palmzweigen des Vorjahres gewonnene Asche gilt als
äußeres Zeichen für Trauer und Buße. Mit dem Empfang des
Aschenkreuzes beginnen die Gläubigen die österliche Bußzeit, an
deren Ende Ostern, das Fest der Auferstehung, steht. Der
Aschermittwoch ist neben dem Karfreitag der einzige Tag, der in der
katholischen Kirche als strenger Fastentag
gilt. is
19.02.2015
Weltgebetstag 2015 stellt Bahamas in den Mittelpunkt

Ökumenische Gottesdienste am 6. März auch in der Pfalz und
der Saarpfalz
Speyer- Rund um den Erdball gestalten Frauen in
über 170 Ländern am Freitag, 6. März, Gottesdienste zum
Weltgebetstag. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „Begreift
ihr meine Liebe?“. Frauen von den Bahamas haben die Vorlage dafür
gestaltet. Auch in der Pfalz und der Saarpfalz finden in den
Kirchengemeinden Gottesdienste zum Weltgebetstag statt, vorbereitet
und gestaltet von ökumenischen Gruppen.
Die 700 Inseln der Bahamas zählen mit ihren Traumstränden,
Korallenriffen, glasklarem Wasser zu den touristischen Traumzielen.
Der Inselstaat zwischen den USA, Kuba und Haiti ist nach Angaben
der Weltgebetstagsbewegung das reichste karibische Land und hat
eine lebendige Vielfalt christlicher Konfessionen. Aber das
Paradies hat mit Problemen zu kämpfen: extreme Abhängigkeit vom
Ausland, Arbeitslosigkeit und eine erschreckend verbreitete
häusliche und sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder.
Sonnen- und Schattenseiten ihrer Heimat – beides greifen Frauen der
Bahamas in ihrem Gottesdienst zum Weltgebetstag 2015 auf. Im
Zentrum steht die Bibelstelle aus dem Johannesevangelium (13,1-17),
in der Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht.
Weltweite Basisbewegung
Der Weltgebetstag ist eine weltweite Basisbewegung von christlichen
Frauen. Traditionell wird der Weltgebetstag jährlich am ersten
Freitag im März mit einem ökumenisch gestalteten Gottesdienst
gefeiert. Als sichtbares Zeichen der Solidarität werden mit der
Kollekte der Gottesdienste weltweit Projekte gefördert, die die
Lebenssituation von Frauen verbessern helfen. Darunter ist auch
eine Medienkampagne des Frauenrechtszentrums „Bahamas Crisis
Center“ (BCC), die sexuelle Gewalt gegen Mädchen bekämpft.
Der Gottesdienst wird jedes Jahr von Frauen aus einem anderen Land
vorbereitet. Diese Frauen sind Mitglieder in unterschiedlichen
christlichen Kirchen. Auch das Deutsche Weltgebetstag-Komitee wird
von Frauenorganisationen und -verbänden christlicher Kirchen
getragen. Mitglieder des Komitees sind nach eigenen Angaben zurzeit
zwölf kirchliche Frauenverbände und -organisationen aus neun
verschiedenen Konfessionen.
Film aus Haßloch zum Weltgebetstag
Ein Beispiel dafür, wie Frauen aus der Pfalz den Weltgebetstag
vorbereiten, zeigt ein Film von Wilhelm Rieger. In der
Christuskirche in Haßloch hat er wie in den letzten Jahren
gemeinsam mit Judith Gerlach und Brigitte Schaaf aus dem
ökumenischen Vorbereitungsteam einen Vorschaufilm gedreht. In dem
Beitrag erklären die beiden Frauen worum es beim Weltgebetstag
geht, informieren über die Situation der Frauen auf den Bahamas und
laden zum Gottesdienst am 6. März (19 Uhr) ein. Der Film zeigt auch
Bilder der Inselgruppe, unterlegt mit landestypischer Musik.
is
Ab Mitte Februar ist der Beitrag mehrmals im „Offenen Kanal
Weinstraße“ zu sehen. Auf youtube findet man den Film unter
WGT2015Haßloch.
Hinweis: Der Offene Kanal Weinstraße zeigt den
Film von Wilhelm Rieger wieder am 19. Februar (19.15 Uhr), am 20.
Februar (18 Uhr) , am 21. Februar (18 Uhr), am 22. Februar (11
Uhr), 24. Februar (21.01 Uhr), am 26. Februar (18.22 Uhr), am 3.
März (22 Uhr) und am 5. März (20 Uhr).
Link zu zum Film von Wilhelm Rieger auf youtube: http://youtu.be/4VELYuQLnll
oder WGT2015Haßloch
Weitere Informationen zum Weltgebetstag unter: www.weltgebetstag.de
18.02.2015
Konviktskirche St. Ludwig: Verkauf des Gotteshauses beschlossene Sache
 Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling
Von unserem
Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Was wird aus der Konviktskirche
St. Ludwig nach dem Verkauf des Bistumshauses? Diese Frage
bewegt nicht nur die Katholiken, sondern auch viele protestantische
Christen. Sie alle wehren sich gegen die Profanierung des
zweitältesten Speyerer Gotteshauses und plädieren für eine
Umwandlung in ein Kolumbarium, also eine Begräbnisstätte für Urnen.
Ein Listen-Paket mit über 1600 Unterschriften übergaben nun Helga
Schädler und Diplom-Theologe Klaus Pfeifer für den Bund
katholischer Männer und Frauen bei einem von annähernd 100
Gläubigen besuchten Diskussionsabend im Ägidienhaus an Generalvikar
Dr. Franz Jung. Im Anschreiben für Bischof Karl-Heinz
Wiesemann weist Pfeifer darauf hin, dass zu den Unterzeichnern acht
Theologieprofessoren, 25 Pfarrer, zwei evangelische Pastoren und
sogar 21 in Speyer wohnende Muslime gehören. Die hätten eindeutig
Stellung bezogen: „Ein Gotteshaus in Speyer verkauft man
nicht!“
Für alle Bistümer in Deutschland sei die Loslösung von
Kirchengebäuden ein großes Thema, warben der Generalvikar und
Domkustos Peter Schappert unisono um Verständnis für die
Finanznöte. „Der Abschied von der Immobilie im Herzen der Stadt tut
sehr weh“, verwies Jung auf den „schmerzhaften Prozess“. Da
in Speyer aufgrund der Gemeindepastorale bis 2016 nur noch
eine Pfarrei gebildet werde, gebe es in der Innenstadt auf engstem
Raum zu viele katholische Kirchen. Der Verantwortliche
der Diözesanverwaltung zählte neben dem zentralen Dom noch die
St.Bernhardskirche, die Pfarrkirche St.Joseph sowie die Kirche des
Magdalenenklosters im Hasenpfuhl auf. Bei St. Ludwig handle es sich
ohnehin um keine Pfarrkirche. Darum sieht Jung keine Chance, vom
Verkauf dieses Gotteshauses abzurücken. Die Losung für den aus
seiner Sicht nötigen Einschnitt formulierte der Generalvikar so:
„Es geht darum, Kirche zu erhalten und nicht Kirchen.“ Jung stellte
überdies klar: „Es ist nicht Aufgabe der Kirche, Friedhöfe
vorzuhalten.“
Dass die St.Ludwigskirche verkauft wird, bedeutet für
Helga Schädler noch lange nicht, dass sich die Diözese aus der
Verantwortung für die einstige Dominikanerkirche stiehlt. Sie kann
sich vorstellen, dass die Ludwigskirche aus der Ausschreibung für
das Bistumshaus herausgelöst und einem Investor eine ökumenische
Lösung, eventuell im Zusammenspiel mit der benachbarten und schon
seit rund 30 Jahren für Ausstellungen, Theater- und
Konzertveranstaltungen genutzten Heiliggeistkirche, schmackhaft
gemacht wird. Für ein Kolumbarium sollten katholische und
evangelische Kirche die Trägerschaft übernehmen. Dies auch um eine
Kontinuität der Einrichtung zu gewährleisten, fügte Klaus Pfeifer
hinzu. Es genüge, wenn einmal im Jahr eine Messe über den Gräbern
gehalten werde. Als nachahmenswertes Beispiel führten die beiden
Sprecher der St.Ludwig-Initiative die Klosterkirche der
Protestantischen Kirchengemeinde Seebach an, in der 2008 ein
Kolumbarium eingerichtet wurde. Auf diese Weise gelinge es, die
Verstorbenen vom Rande der Stadt ins Zentrum zu holen. Schappert,
Ökonom der Diözese, räumte ein, die Idee eines Kolumbariums
könne „so lange unterstützt werden, so lange ein
Investor die Nachnutzung so sieht“. Kolumbarien in Aachen,
Köln und Erfurt und hätten sich bewährt, eine weitere sei in
geplant, informierten Schädler und Pfeifer.
Für eine kostendeckende Nutzung als Grabeskirche machte sich
unter anderen auch der ehemalige Landrat Dr. Paul Schädler stark.
Er legte dem Generalvikar ans Herz, sich pfalzweit um die
Einrichtung von Kolumbarien einzusetzen. Um eine solche
Begräbnisstätte für St.Ludwig zu bekommen, regte Pfarrer i.R.
Bernhard Linvers das Bilden eines Arbeitskreises an, mit dem Ziel,
dem künftigen Besitzer ein tragfähiges Konzept zur Hand zu geben.
Ein Nutzungskonzept kann bei der sensiblen Vergabe des
Bistumshaus-Komplexes nach Ansicht von Oberbürgermeister Hansjörg
Eger schon von Vorteil sein. Er hält die Gründung einer
Stiftung für die beste Lösung. Ob das Bischöfliche Ordinariat
hierfür einen Millionen-Betrag einräumen könnte, ließen Jung und
Schappert offen. Die erforderlichen Instandsetzungskosten für
die St. Ludwigskirche hatten die beiden Kirchenoberen mit
zwei Millionen Euro beziffert.
 Info: Die Kirche St.Ludwig stammt aus dem 13.
Jahrhundert und bildete bis zum 17. Jahrhundert das geistige
Zentrum eines Dominikanerklosters. Für den bisherigen Kirchenraum
wird ein neues Nutzungskonzept gesucht, das der religiösen,
kulturellen und stadtgeschichtlichen Bedeutung des Ortes Rechnung
trägt.
Info: Die Kirche St.Ludwig stammt aus dem 13.
Jahrhundert und bildete bis zum 17. Jahrhundert das geistige
Zentrum eines Dominikanerklosters. Für den bisherigen Kirchenraum
wird ein neues Nutzungskonzept gesucht, das der religiösen,
kulturellen und stadtgeschichtlichen Bedeutung des Ortes Rechnung
trägt.
Von hohem Wert sind ein Wandteppich und der spätgotische
Boßweiler Altar. Es handelt sich dabei um einen
Flügelaltar aus dem Umfeld Martin
Schongauers, der um 1485 entstand, sich früher im Dom befand
und nun in St. Ludwig auf seinen künftigen Standort wartet. Er gilt
als einer der wertvollsten und bedeutendsten mittelalterlichen
Altäre der Pfalz.
Sehr beliebt waren wöchentliche Andachten in der Konviktskirche,
besonders in der Adventszeit als willkommene 20-minütige
Verschnaufpause. Die Kirche ist seit der Schließung des
Bistumshauses verwaist.
17.02.2015
Kooperator Michael Paul wird neuer Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Geinsheim
Speyer/Waldsee/Geinsheim- Pfarrer Michael
Paul, seit drei Jahren Kooperator in der Pfarreiengemeinschaft
Waldsee, wurde von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zum neuen
Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Geinsheim ernannt.
Der 34-jährige Geistliche, der aus St. Ingbert-Hassel stammt,
wird seine Stelle am 1. September 2015 antreten. Sein Studium hat
er in Eichstätt absolviert, bevor er 2007 in Speyer zum Priester
geweiht wurde. Zunächst war als Kaplan in Landau, dann als Domvikar
in Speyer tätig.
Er wird in seinem neuen Wirkungsfeld, zu dem 8000 Katholiken in
fünf Pfarreien gehören, unterstützt von Pater Gerhard Hemken aus
dem Herz-Jesu-Kloster Neustadt, Diakon Johannes Hellenbrand sowie
Pastoralreferentin Margareta Kirsch.
Michael Paul folgt auf Pfarrer Bernd Schneider, der im Dezember als
Kooperator nach Rockenhausen gewechselt ist.
Durch die diözesane Strukturreform werden die fünf Pfarreien,
aus denen derzeit die Pfarreiengemeinschaft Geinsheim besteht, ab
1. Januar 2016 in der neuen Pfarrei „Heilig Geist“ zusammengefasst.
Zugleich hat Bischof Wiesemann die Bewerbung von Pfarrer Franz
Ramstetter angenommen, der derzeit übergangsweise die
Pfarreiengemeinschaft Geinsheim leitet, und ihn ebenfalls zum 1.
September zum neuen Leiter der Pfarreiengemeinschaft Rodalben im
Dekanat Pirmasens ernannt. Er folgt dort auf Dekan Martin Ehling,
der im Mai letzten Jahres mit 57 Jahren plötzlich verstorben ist.
Die Pfarreiengemeinschaft Rodalben, zu der knapp 10.000 Gläubige
gehören, umfasst die Stadt Rodalben sowie die benachbarten Dörfer
Clausen, Donsieders, Merzalben, Münchweiler und Leimen.
is
16.02.2015
Domvikar Thomas Becker wird neuen Pfarrer der Pfarreiengemeinschaft Lauterecken
Speyer/Lauterecken- Domvikar Thomas
Becker wurde von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann zum neuen Pfarrer
der Pfarreiengemeinschaft Lauterecken ernannt. Seine neue Stelle im
Dekanat Kusel wird er am 1. September antreten.
Der 42-jährige Geistliche stammt aus Malsch bei Heidelberg, hat
in Freiburg studiert und kann neben seinem Diplom in Theologie auch
ein juristisches Staatsexamen vorweisen. Als Kaplan war er zunächst
in Frankenthal tätig, bevor er 2012 nach Speyer wechselte, wo er
seitdem Dompfarrer Matthias Bender bei der Seelsorge in der
Dompfarrei und der Pfarrei St. Konrad unterstützt. Als Domvikar
obliegt ihm auch die Aufgabe, als Zeremoniar die großen Liturgien
an der Kathedrale vorzubereiten und zu begleiten.
Sein zukünftiges Wirkungsfeld gehört zu den Diasporagebieten der
Diözese. Die ca. 2000 Katholiken seines zukünftigen Wirkungsfeldes
verteilen sich auf die drei Pfarreien Lauterecken, Reipoltskirchen
und Wolfstein. Unterstützt wird er dort in der Seelsorge von
Kooperator Anton Ociepka (66), der derzeit übergangsweise die
Pfarreiengemeinschaft leitet. Thomas Becker folgt auf Pfarrer
Mathias Köller (54), der sieben Jahre im Lautertal tätig war und
krankheitsbedingt im Dezember des letzten Jahres von der Leitung
entpflichtet wurde.
Durch die diözesane Strukturreform werden die bislang drei
Pfarreien zum 1. Januar 2016 in einer einzigen Pfarrei
zusammengefasst, die den Namen des großen Jesuitenmissionars Franz
Xaver tragen wird. is
16.02.2015
Professionelle Software für das neue Pfarrbüro
 Kanzleidirektor Wolfgang Jochim (im Vordergrund) zusammen mit Stefan Knoblauch (links) und Kurt Werner Malter (rechts) von der Firma Compelec
Kanzleidirektor Wolfgang Jochim (im Vordergrund) zusammen mit Stefan Knoblauch (links) und Kurt Werner Malter (rechts) von der Firma Compelec
Von der Adressverwaltung bis zur Pfarrbrieferstellung:
Computerprogramm erleichtert vernetztes Arbeiten in der
Pfarrei
Speyer- Wenn am 1. Januar 2016 im Bistum
Speyer 70 neue Pfarreien errichtet werden, hat das weitreichende
Konsequenzen auch für die tägliche Arbeit in den zentralen
Pfarrbüros. Die Aktivitäten mehrerer Gemeinden müssen koordiniert
werden, zugleich gilt es Aufgaben und Termine in den Pfarrgremien
und im pastoralen Team aufeinander abzustimmen. Um die
Zusammenarbeit zu erleichtern, stattet das Bistum Speyer die
zentralen Pfarrbüros im Lauf des Jahres mit dem Software-Produkt
„InGenius-Office“ aus.
„Kommunikation und Koordination sind Schlüsselfaktoren für die
Arbeit in den neuen Pfarreien“, erklärt Kanzleidirektor Wolfgang
Jochim. Die neue Software bietet dazu die technischen
Voraussetzungen, von der Adressverwaltung und Terminplanung über
das Erstellen der Gottesdienstordnung und der Dienstpläne bis hin
zur einheitlichen Dokumentenablage. Der Zeitaufwand für die
Erstellung des Pfarrbriefs wird deutlich geringer. Das Programm
„InGenius-Office“ soll zugleich als zentrale Informationsplattform
für die interne Kommunikation zwischen den verschiedenen Gremien
und Gruppen der Pfarrei Anwendung finden. „Da es auch als App für
Smartphones zur Verfügung steht, können die pastoralen Mitarbeiter
auch unterwegs zum Beispiel auf den zentralen Terminkalender der
Pfarrei zugreifen“, verdeutlicht Wolfgang Jochim. Ein einheitliches
Verwaltungsprogramm in allen Pfarrbüros biete zudem den Vorteil,
dass sich eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter beim beruflichen
Wechsel in eine andere Pfarrei nicht erst mühsam auf ein neues
Programm einstellen muss.
Die Mitglieder der im Zuge des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“
gebildeten Arbeitsgruppe „Pfarrbüro“ hatten Verwaltungsprogramme
mehrerer Anbieter intensiv getestet, bevor man sich für die
Software „InGenius-Office“ entschied. Insbesondere die hohe
Bedienerfreundlichkeit des Programms überzeugte. Positiv ins
Gewicht fiel auch, dass mit der Firma Compelec ein erfahrener
Kooperationspartner gewonnen wurde. Das mittelständische
Unternehmen aus dem saarländischen Wadgassen ist seit rund 30
Jahren als Spezialist auf dem Gebiet der Datenbankentwicklung
tätig. Mit einem Stamm von 16 Mitarbeitern garantiert es
hinsichtlich der technischen Betreuung die notwendige Kontinuität
und Verlässlichkeit. Das Programm „InGenius-Office“ kam vor zwei
Jahren auf den Markt, inzwischen wird es von rund 100
Pfarreiengemeinschaften im Bistum Trier erfolgreich eingesetzt.
Auch mehrere andere Bistümer haben bereits Interesse signalisiert.
„Wir haben das Programm aus der Praxis heraus entwickelt, indem wir
die täglichen Anforderungen in einem Pfarrbüro mit unserem
langjährig erprobten Know-How aus der Datenbanktechnik
zusammengebracht haben“, erklärt Kurt Werner Malter,
Geschäftsführer der Firma Compelec.
Den Vertrag zur Zusammenarbeit haben das Bistum Speyer und die
Firma Compelec bereits Ende des vergangenen Jahres geschlossen.
Aktuell bereitet die Projektgruppe, der von Seiten des Ordinariats
auch EDV-Abteilungsleiter Dr. Achim Knoll angehört, die Schulungen
vor. In einem ersten Schritt sollen 15 Pfarrsekretärinnen für die
Arbeit mit „InGenius-Office“ fit gemacht werden. Als
Multiplikatorinnen sollen sie ihr Wissen später an die Kolleginnen
und Kollegen in den anderen Pfarrbüros weitergeben. Auch die
Pfarrer, Pastoral- und Gemeindereferenten werden für die Arbeit mit
der neuen Verwaltungssoftware geschult. „Nur wenn jeder über die
nötigen Grundkenntnisse verfügt, entfaltet das Programm seinen
vollen Nutzen, sorgt für Arbeitserleichterung und trägt zu einem
spürbaren Mehr an Koordination und Vernetzung bei“, ergänzt Stefan
Knoblauch von der Firma Compelec. Text und Foto: is
09.02.2015
Kindertagesstätten auf dem Weg zu „Qualität mit Brief und Siegel“
 Bistum
Speyer plant flächendeckende Einführung eines Qualitätsmanagements
in den katholischen Kindertagesstätten / Bis zum Jahr 2018 sollen
alle Einrichtungen gestartet sein
Bistum
Speyer plant flächendeckende Einführung eines Qualitätsmanagements
in den katholischen Kindertagesstätten / Bis zum Jahr 2018 sollen
alle Einrichtungen gestartet sein
Speyer- Das Bistum Speyer plant die
flächendeckende Einführung eines Qualitätsmanagements in seinen
rund 240 katholischen Kindertagesstätten. 19 Einrichtungen stehen
kurz vor dem Erwerb des Qualitätsbriefes des Bundesverbandes
Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK). Eine weitere
Staffel mit 50 Einrichtungen macht sich dieses Jahr auf den Weg.
Bis zum Jahr 2018 sollen alle Einrichtungen gestartet sein.
„Das Qualitätsmanagement soll helfen, die katholischen
Kindertagesstätten auf der Grundlage des Leitbildes weiter zu
profilieren“, erklärte Generalvikar Dr. Franz Jung beim
Projektstart am 4. Februar in Kaiserslautern. Er sprach von einem
ambitionierten Ziel, das zugleich die Bedeutung zeige, die das
Bistum Speyer den Kindertagesstätten zuerkennt. Als Beispiele für
das erweiterte Anforderungsspektrum an die Kindertagesstätten
nannte er die Betreuung der Unterdreijährigen und der
Unterzweijährigen sowie den Ausbau von Ganztagsangeboten. „Wir
müssen lernen, angesichts veränderter Anforderungen und begrenzter
Ressourcen unsere Arbeitsweise zu verändern“, warb er gegenüber
Erzieherinnen, Kita-Leiterinnen und Trägervertretern für das
Projekt.
Grundlage ist das KTK-Gütesiegel
 Das Bistum Speyer hat sich für das Gütesiegel des
Bundesverbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)
als Grundlage seines Qualitätsmanagements entschieden. Das
KTK-Gütesiegel ist ein bundesweit anerkanntes
Qualitätsmanagementssystem, das Kindertagesstätten dabei
unterstützt, die Qualität ihrer Arbeit zu reflektieren,
weiterzuentwickeln und zu dokumentieren. Dazu werden neun
Qualitätsbereiche – von „Kinder“ und „Eltern“ über „Mittel“ und
„Personal“ bis hin zu „Kirchengemeinde“ und „Glaube“ – genau unter
die Lupe genommen.
Das Bistum Speyer hat sich für das Gütesiegel des
Bundesverbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)
als Grundlage seines Qualitätsmanagements entschieden. Das
KTK-Gütesiegel ist ein bundesweit anerkanntes
Qualitätsmanagementssystem, das Kindertagesstätten dabei
unterstützt, die Qualität ihrer Arbeit zu reflektieren,
weiterzuentwickeln und zu dokumentieren. Dazu werden neun
Qualitätsbereiche – von „Kinder“ und „Eltern“ über „Mittel“ und
„Personal“ bis hin zu „Kirchengemeinde“ und „Glaube“ – genau unter
die Lupe genommen.
In zehn Ausbildungsabschnitten über einen Zeitraum von zwei
Jahren machen sich die Trägervertreter, Leiterinnen und die
Qualitätsbeauftragten der Kindertagesstätten mit den Grundsätzen
und Methoden des Qualitätsmanagements vertraut. Dabei entwickeln
sie auf der Grundlage des im Pilotprojekt erarbeiteten
Einrichtungshandbuchs ein Qualitätshandbuch speziell für ihre
Einrichtung. Nach drei Jahren schließt das Projekt mit dem Erwerb
des KTK-Qualitätsbriefes ab, nach zwei weiteren Jahren besteht die
Möglichkeit zur Zertifizierung mit dem KTK-Gütesiegel.
Kindertagesstätten starten in vier Staffeln
Für die Einführung des Qualitätsmanagements werden vier Staffeln
gebildet, die sich jeweils aus rund 50 Kindertageseinrichtungen
zusammensetzen und um ein Jahr zeitversetzt starten. Jede Staffel
ist in vier Regionalgruppen unterteilt. Die fachliche Begleitung
übernimmt ein 14-köpfiges Team von Mitarbeitern des Bischöflichen
Ordinariats und des Caritasverbandes für die Diözese Speyer. Darin
wirken die Bereichsleitungen für die katholischen
Kindertagesstätten in den neu gebildeten Regionalverwaltungen, die
Fachberatung des Caritasverbandes für die Diözese Speyer und zwei
theologischen Referenten des Bischöflichen Ordinariats eng
zusammen.
Die Einrichtungen können sich bis Ende März bei der Abteilung
„Pfarrverbände und Kindertagesstätten“ des Bischöflichen
Ordinariats für die Teilnahme in einer der vier Staffeln bewerben.
Die Benachrichtigung über die Einteilung der vier Staffeln ist für
Mitte April vorgesehen.
„Das Wesentliche rückt stärker in den Vordergrund“
 Die
Erfahrungen der 19 Kindertagesstätten, die am Pilotprojekt zum
Qualitätsmanagement teilgenommen haben, wurden bei der
Veranstaltung in Kaiserslautern in einer Gesprächsrunde beleuchtet.
„Das Qualitätsmanagement zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch
unsere Arbeit. Es führt im Ergebnis dazu, dass das einzelne Kind
besser in den Blick kommt und die wesentlichen Fragen stärker in
den Vordergrund rücken“, zog Petra Ruffing, Leiterin der
katholischen Kindertagesstätte in Schönenberg-Kübelberg, eine erste
Bilanz. Heribert Brenk, Mitglied des Verwaltungsrats der Pfarrei
St. Maria Magdalena in Roxheim, schätzt vor allem den Zugewinn an
Klarheit: „Es ist jetzt für alle nachvollziehbar geregelt, wer
wofür verantwortlich ist. Außerdem können wir nach außen eindeutig
kommunizieren, wer wir sind, was wir wollen und nach welchen Regeln
in unserer Kindertagesstätte gearbeitet wird.“ Für Pfarrer Andreas
Rubel aus Roxheim hat sich durch die Einführung des
Qualitätsmanagements das Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit
von Kindertagesstätte und Pfarrgemeinde verbessert: „Wir haben
gespürt, dass die Kindertagesstätte wirklich zur Gemeinde gehört
und umgekehrt.“ Durch Patenschaften für das Essensgeld von Kindern
aus einkommensschwachen Familien und Deutschkurse für Mütter von
Kindern mit Migrationshintergrund wird ein starker caritativer
Akzent gesetzt. „Das Qualitätsmanagement erfüllt das Leitbild der
Einrichtung mit Leben“, so das Resümee von Pfarrer Rubel.
Die
Erfahrungen der 19 Kindertagesstätten, die am Pilotprojekt zum
Qualitätsmanagement teilgenommen haben, wurden bei der
Veranstaltung in Kaiserslautern in einer Gesprächsrunde beleuchtet.
„Das Qualitätsmanagement zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch
unsere Arbeit. Es führt im Ergebnis dazu, dass das einzelne Kind
besser in den Blick kommt und die wesentlichen Fragen stärker in
den Vordergrund rücken“, zog Petra Ruffing, Leiterin der
katholischen Kindertagesstätte in Schönenberg-Kübelberg, eine erste
Bilanz. Heribert Brenk, Mitglied des Verwaltungsrats der Pfarrei
St. Maria Magdalena in Roxheim, schätzt vor allem den Zugewinn an
Klarheit: „Es ist jetzt für alle nachvollziehbar geregelt, wer
wofür verantwortlich ist. Außerdem können wir nach außen eindeutig
kommunizieren, wer wir sind, was wir wollen und nach welchen Regeln
in unserer Kindertagesstätte gearbeitet wird.“ Für Pfarrer Andreas
Rubel aus Roxheim hat sich durch die Einführung des
Qualitätsmanagements das Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit
von Kindertagesstätte und Pfarrgemeinde verbessert: „Wir haben
gespürt, dass die Kindertagesstätte wirklich zur Gemeinde gehört
und umgekehrt.“ Durch Patenschaften für das Essensgeld von Kindern
aus einkommensschwachen Familien und Deutschkurse für Mütter von
Kindern mit Migrationshintergrund wird ein starker caritativer
Akzent gesetzt. „Das Qualitätsmanagement erfüllt das Leitbild der
Einrichtung mit Leben“, so das Resümee von Pfarrer Rubel.
Text und Foto: is
06.02.2015
Dekanat Ludwigshafen ist ab sofort Bestandteil der neuen Webseiten-Familie im Bistum Speyer
 v.l.: Dekan Alban Meißner, Brigitte Deiters und Marco Fraleoni beim offiziellen Startschuss.
v.l.: Dekan Alban Meißner, Brigitte Deiters und Marco Fraleoni beim offiziellen Startschuss.
Bistum Speyer unterstützt neue Onlinekommunikation:
Gläubige, Mitglieder in den Gemeinden und Interessierte sollen im
Web schneller an Informationen gelangen
Ludwigshafen/Speyer- Die Neuausrichtung der
Onlinekommunikation im Bistum Speyer schreitet weiter voran. Nach
dem erfolgreichen Online-Start der beiden Projekt-Pfarreien
Germersheim und Queidersbach ist mit dem Dekanat Ludwigshafen seit
Anfang Februar das erste von zehn Dekanaten integrativer
Bestandteil der neuen Webseiten-Familie im Bistum Speyer. Das
zentrale Ziel der Webseiten-Familie ist es, von der Pfarrei- bis
zur Bistumsebene eine eng vernetzte Onlinekommunikation zu
etablieren, sodass Gläubige und Gemeindemitglieder, ebenso wie
Besucher mit einem weniger engen Kirchenbezug, schnell und
zielgerichtet Informationen finden können. Damit die vielfältigen
Angebote und Leistungen, die die katholische Kirche im Dekanat
Ludwigshafen bietet, noch transparenter werden, umfasst der neue
Internetauftritt unter www.kath-dekanat-lu.de die
fünf künftigen Pfarreien sowie die katholischen Einrichtungen der
Stadt.
 Gottesdienstzeiten, Termine für Veranstaltungen in den
Gemeinden auf einen Blick, Angebote von Kindertagesstätten oder die
Adresse des Pfarrbüros – dank der klar strukturierten
Informationsaufbereitung, die sich an das identitätsstiftende
Erscheinungsbild der neuen Webseiten-Familie anlehnt, kommen
Interessenten mit wenigen Klicks und intuitiv ans Ziel. Nachrichten
aus allen katholischen Einrichtungen werden von der Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Dekanats recherchiert und
eingepflegt. Dekan Alban Meißner erklärt: „Da auch in Ludwigshafen
die Räume für die Seelsorge größer werden, wollen wir mit dem
zeitgemäßen Onlineauftritt die Vielfalt und Breite unserer Angebote
und Leistungen bekannter machen, um – parallel zu besseren
Kommunikation – weitere Anlässe für reale Begegnungen mit Menschen
zu schaffen!“ Zur besseren Orientierung sind die neuen
Pfarreistrukturen des Dekanats, die aus dem Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ resultieren, bereits berücksichtigt. Was
die Orientierung vereinfacht: Besucher können über die sogenannte
Landkarten- und die zusätzliche Schlagwort-Navigation gezielt nach
Inhalten suchen. Passgenaue Informationen rund um Kirchenthemen,
wie zum Beispiel zu häufigen Suchschlagwörtern Hochzeit, Taufe oder
Erstkommunion sind damit schnell zur Hand. Text und Foto:
Dekanat Ludwigshafen
Gottesdienstzeiten, Termine für Veranstaltungen in den
Gemeinden auf einen Blick, Angebote von Kindertagesstätten oder die
Adresse des Pfarrbüros – dank der klar strukturierten
Informationsaufbereitung, die sich an das identitätsstiftende
Erscheinungsbild der neuen Webseiten-Familie anlehnt, kommen
Interessenten mit wenigen Klicks und intuitiv ans Ziel. Nachrichten
aus allen katholischen Einrichtungen werden von der Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Dekanats recherchiert und
eingepflegt. Dekan Alban Meißner erklärt: „Da auch in Ludwigshafen
die Räume für die Seelsorge größer werden, wollen wir mit dem
zeitgemäßen Onlineauftritt die Vielfalt und Breite unserer Angebote
und Leistungen bekannter machen, um – parallel zu besseren
Kommunikation – weitere Anlässe für reale Begegnungen mit Menschen
zu schaffen!“ Zur besseren Orientierung sind die neuen
Pfarreistrukturen des Dekanats, die aus dem Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ resultieren, bereits berücksichtigt. Was
die Orientierung vereinfacht: Besucher können über die sogenannte
Landkarten- und die zusätzliche Schlagwort-Navigation gezielt nach
Inhalten suchen. Passgenaue Informationen rund um Kirchenthemen,
wie zum Beispiel zu häufigen Suchschlagwörtern Hochzeit, Taufe oder
Erstkommunion sind damit schnell zur Hand. Text und Foto:
Dekanat Ludwigshafen
Weitere Informationen:
 In der neuen
Struktur umfasst die Webseiten-Familie den Internetauftritt des
Bistums Speyer, seiner zehn Dekanate und 70 Pfarreien. Um eine
optimale Breitenwirkung und möglichst schnelle Wiedererkennung zu
entfalten, richtet sich das freiwillige Angebot zur
Projektbeteiligung zunächst an alle Dekante und Pfarreien im
Bistum. Durch Verlinkungen und die gemeinsame Nutzung von
Nachrichten und Datenbankinformationen entsteht in Schritten eine
vernetzte „Plattform für Kommunikation“ mit immer größerer
Reichweite. Vergleichbar mit einem „Baukasten-System“ sind die
einzelnen Internetauftritte ähnlich strukturiert und als Teil der
Webseiten-Familie leicht zu erkennen. Dank des neuen Konzepts
werden die Orientierung und der Informationszugang vereinfacht und
gleichzeitig der Nachrichtenwert erhöht. Besonderes Augenmerk wird
darauf gelegt, dass jede Pfarrei ausreichend Gestaltungsspielraum
hat und die eigenen Seiten entsprechend regionalisieren und
personalisieren kann. Um dieses Ziel zu gewährleisten, lassen sich
alle Inhalte und Funktionalitäten sehr einfach mit einem
Content-Management-System auf Typo-3-Basis einpflegen und anpassen.
Das Bistum Speyer unterstützt die neue Onlinekommunikation. Die
Konzeptentwicklung zur Erstellung der Webseiten und der Schulungen
verantwortet die Peregrinus GmbH, der Verlag in dem die
Bistumszeitung „der pilger“ erscheint. www.kaiserdom-virtuell.de,
www.pilgerreisen-speyer.de
und www.gutesleben-fueralle.de
sind aktuelle Referenzprojekte im Bereich Internetkommunikation,
die der Dienstleister für Medien und Kommunikation im Bistum Speyer
federführend initiiert und konzipiert hat.
In der neuen
Struktur umfasst die Webseiten-Familie den Internetauftritt des
Bistums Speyer, seiner zehn Dekanate und 70 Pfarreien. Um eine
optimale Breitenwirkung und möglichst schnelle Wiedererkennung zu
entfalten, richtet sich das freiwillige Angebot zur
Projektbeteiligung zunächst an alle Dekante und Pfarreien im
Bistum. Durch Verlinkungen und die gemeinsame Nutzung von
Nachrichten und Datenbankinformationen entsteht in Schritten eine
vernetzte „Plattform für Kommunikation“ mit immer größerer
Reichweite. Vergleichbar mit einem „Baukasten-System“ sind die
einzelnen Internetauftritte ähnlich strukturiert und als Teil der
Webseiten-Familie leicht zu erkennen. Dank des neuen Konzepts
werden die Orientierung und der Informationszugang vereinfacht und
gleichzeitig der Nachrichtenwert erhöht. Besonderes Augenmerk wird
darauf gelegt, dass jede Pfarrei ausreichend Gestaltungsspielraum
hat und die eigenen Seiten entsprechend regionalisieren und
personalisieren kann. Um dieses Ziel zu gewährleisten, lassen sich
alle Inhalte und Funktionalitäten sehr einfach mit einem
Content-Management-System auf Typo-3-Basis einpflegen und anpassen.
Das Bistum Speyer unterstützt die neue Onlinekommunikation. Die
Konzeptentwicklung zur Erstellung der Webseiten und der Schulungen
verantwortet die Peregrinus GmbH, der Verlag in dem die
Bistumszeitung „der pilger“ erscheint. www.kaiserdom-virtuell.de,
www.pilgerreisen-speyer.de
und www.gutesleben-fueralle.de
sind aktuelle Referenzprojekte im Bereich Internetkommunikation,
die der Dienstleister für Medien und Kommunikation im Bistum Speyer
federführend initiiert und konzipiert hat.
05.02.2015
Wissen, wo Kirche gebraucht wird
 Pfarrer Pirmin Weber (l.) und Christian Anstäth sind stolz auf das pastorale Konzept der Pfarrei Homburg 1.
Pfarrer Pirmin Weber (l.) und Christian Anstäth sind stolz auf das pastorale Konzept der Pfarrei Homburg 1.
Gemeindepastoral 2015: Projektpfarrei Homburg hat erstes
pastorales Konzept im Bistum Speyer entwickelt – Pfarreianalyse
zeigt hohe Altersarmut und gestiegene Zahl an alleinstehenden
Männern
Speyer- Für die Projektpfarrei Homburg 1
steht jetzt schwarz auf weiß fest, was Seelsorge in ihren vier
Gemeinden bedeutet – und zwar für die Bereiche Caritas, Katechese,
Ökumene, Kindertagesstätten und Jugend. Von der Erfahrung des
Projektteams um Pfarrer Pirmin Weber können die anderen 69
Pfarreien im Bistum Speyer profitieren. Aus Homburg kommen Tipps,
wie man die Sache anpacken kann.
Zugegeben: In dem Papier steckt eine Menge Arbeit, sagen die
Macher, doch es habe sich gelohnt. „Es war schon eine riesige
Baustelle, die wir nun hinter uns haben“, erklärt Pfarrer Pirmin
Weber. „Und es lief nicht immer harmonisch. Doch wir haben uns
zusammengerauft und ein Ergebnis geschafft, auf das wir stolz sind
und mit dem wir uns identifizieren.“ Es sei über das Gemeindeleben
in der Pfarrei viel diskutiert worden, ergänzt Christian Anstäth,
der als Pfarreiratsvorsitzender an dem pastoralen Konzept intensiv
mitgewirkt hat. „Wir kennen unsere Pfarrei nun viel besser und
wissen, wo wir pastorale Schwerpunkte setzen wollen.“
In Homburg leben noch echte Pioniere. Nicht nur, dass man dort
im Sommer 2011 den Finger hob, als „Projektpfarreien“ gesucht
wurden, also Pfarreien, in denen beispielhaft die neue
Strukturreform umgesetzt wird. Anschließend waren sie auch die
ersten, die sich daran machten, die neue Form mit Inhalt zu füllen.
Will heißen: ein pastorales Konzept zu erarbeiten. Das war im
Herbst 2012. Ziel war es, so ist in dem Konzept zu lesen,
„einerseits einen verbindlichen Rahmen der Gemeinsamkeit und
Einheit zu garantieren; und andererseits vor Ort den Gemeinden und
Gemeinschaften Möglichkeiten und Freiräume einzuräumen.“
„Sehen, Urteilen, Handeln“
Die Saarländer gingen gemäß dem Dreischritt vor, den Bischof
Karl-Heinz Wiesemann im Vorwort zur entsprechenden Arbeitshilfe
beschrieben hat. Sehen bedeutet genau auf die eigene Pfarrei
draufschauen: Wer genau lebt hier? Wie leben die Menschen – als
Paar, in Familien oder allein? Wer ist (nicht) getauft? Solche und
ähnliche Fragen beinhaltete die Situationsanalyse, die über eine
rein kirchliche Betrachtung weit hinausging. „Mit den vielen Daten,
Zahlen und Fakten wäre ich allein überfordert gewesen“, gibt
Pfarrer Weber unumwunden zu. „Gut, dass ich in unserem Analyseteam
Fachleute hatte, die hier den Karren gezogen haben.“ Dabei ist vor
allem auch Christian Anstäth gemeint, der als Jugend-Sozialarbeiter
mit soziologischen Kenntnissen solche Datensätze lesen und
interpretieren kann. „In dieser Ausführlichkeit, wie wir das
gemacht haben, ist das sicher nicht notwendig“, räumt er ein. „Es
genügt zu wissen, von welchem Amt man die Informationen bekommt und
was sie einem grundsätzlich sagen.“ Das dürfte viele andere
Pfarreien, die sich auf den Weg hin zu einem pastoralen Konzept
machen, beruhigen. Die Analyse bedeutet zwar Arbeit, ist aber auch
ohne Statistikstudium machbar. Und eröffnet dem Analyseteam einen
ganz neuen und wohl oft erhellenden Blick auf die eigene Pfarrei.
„Für uns war das schon ein Aha-Erlebnis“, erklärt Christian
Anstäth. „Über manche Zahlen und Prozente sind wir geradezu
gestolpert und haben uns gewundert. Dass wir beispielsweise doch
recht viel Altersarmut haben, war uns so nicht bewusst.“
Bei diesem zweiten Teil des Dreischritts, dem Urteilen, wird es
für eine Pfarrei also spannend. Was sagen die nackten Zahlen aus?
Wie beurteilen wir sie? Hier werden aus Zahlen Schicksale
herausgelesen; aus Prozenten Lebenssituationen. In Homburg stutzte
das Analyseteam nicht nur über die hohe Altersarmut, sondern auch
über eine gestiegene Zahl an alleinstehenden Männern. Wie sieht ihr
Leben aus? Wie können wir als Kirche ihnen beistehen und sie in die
Gemeinschaft einbinden? Der Dreischritt gleitet nahezu automatisch
vom Sehen übers Urteilen zum Handeln. Ein „Caritas-Ausschuss“ wurde
gegründet, der sich der „pastoralen Männerarbeit“ annahm. Nach und
nach sollen mit den Alleinstehenden zuhause Gespräche geführt
werden, um zu erfahren, wie es ihnen geht – und nicht zuletzt um
sie ins kirchliche Leben der Pfarrei (wieder) einzubinden. Dabei
scheinen, zumindest ansatzweise, die vier Prinzipien leitenden
Prinzipien für pastorales Handeln durch: Spiritualität,
Evangelisierung, Anwaltschaft und weltweite Kirche.
Wichtig ist ein abgesteckter Zeitplan
Eine „Zielplanung“ hat das Homburger Analyseteam gemeinsam mit
den jeweiligen Verantwortlichen nicht nur für den Bereich Caritas,
sondern auch für die Bereiche Liturgie, Katechese,
Kindertagesstätten, Jugend, Öffentlichkeitsarbeit, Ökumene und
Immobilien erstellt – zusammengefasst in einem „Pastoralplan“ für
die Pfarrei. Die weitere Herausforderung liegt nun vor allem darin,
an den Themen dranzubleiben und aus den Zielen konkrete Maßnahmen
zu machen. „Wir haben uns so manches ins Stammbuch geschrieben“,
weiß Christian Anstäth. „Jetzt gilt es, uns auch daran zu
halten.“
Anderen Pfarreien, die jetzt vor der Aufgabe stehen, ein
pastorales Konzept zu entwickeln, empfiehlt Pfarrer Pirmin Weber
einen strikten Zeitplan aufzustellen und dafür maximal ein
dreiviertel Jahr zu veranschlagen. „Sonst geht das ins Uferlose.
Und ein Konzept ist nie wirklich fertig. Irgendwann muss man sagen:
Das haben wir jetzt gemeinsam erarbeitet, und das ist vorläufig
auch so in Ordnung!“ Text und Foto: is
Hintergrundinterview mit Dr. Thomas Kiefer, dem Leiter der
Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen:
Praktische Hilfe für den Alltag in der Seelsorge
Das Bischöfliche Ordinariat des Bistums Speyer unterstützt die
Projektpfarreien Germersheim, Queidersbach, Kaiserslautern und
Homburg wie auch die übrigen Pfarreien bei der
Entwicklung ihrer pastoralen Konzepte. Zuständig ist die Abteilung
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen, die auch eine eigene
Arbeitshilfe herausgegeben hat. Leiter ist Dr. Thomas Kiefer.
Herr Kiefer, was zeichnet die geleistete Arbeit in
Homburg aus? Wie würden Sie das pastorale Konzept
charakterisieren?
„Den Homburgern ist es gelungen, aufgrund einer gründlichen
Analyse konkrete Ziele zu formulieren und dann in Folge konkrete
Maßnahmen zu planen. Sehr schön sieht man dies beim Grunddienst
Caritas: Die sehr hohe Zahl von alleinstehenden Senioren mit dem
Schwerpunkt Männer hat zur Folge, dass hier ein neues Seelsorgefeld
entstehen soll. Obwohl die Vorgaben und Schritte zur
Konzepterstellung von uns im Bischöflichen Ordinariat erstellt
worden waren, war ich dann doch erst einmal sehr beeindruckt:
beindruckt von der Mühe und Arbeit, die investiert worden sind,
aber auch von dem Ertrag.“
Was bringt es Ihrer Ansicht nach einer Pfarrei, ein
pastorales Konzept zu haben?
„Ein solches Konzept hilft wirklich, den vielfältigen Alltag in
der Seelsorge anzugehen. Der erste Schritt besteht in einem
vertieften Sehen: Auf welcher Grundlage engagieren wir uns in der
Seelsorge? Für welche Menschen mit welchen Bedürfnissen, Sorgen und
Hoffnungen sind wir da? Nur auf der Grundlage dieses Sehens kann
ich dann fragen: Was würde wohl Jesus Christus heute von uns
erwarten? Und dann gilt es zu überlegen, welche Ziele künftig im
Vordergrund stehen sollen. Gerade in einer unübersichtlicheren
Gesellschaft wird auch die Seelsorge in gewisser Weise
unübersichtlicher. Klare Zielformulierungen helfen dann, auf der
Spur zu bleiben. Außerdem lässt sich dann auch festlegen, was
wichtiger und weniger wichtig ist. Wir erhoffen von uns durch das
Konzept eine Hilfe zur Konzentration und damit letztendlich auch
zur Entlastung. Auch wenn die Erstellung des Konzeptes auch erst
einmal Arbeit bedeutet.“
Was wünschen Sie sich von den anderen Pfarreien?
„Ich wünsche mir, dass sie das Konzept als ein wertvolles
Arbeitsinstrument entdecken können. Und ich wünsche mir dann, dass
die positiven Erfahrungen ausstrahlen auf die vielen anderen
Pfarreien. Immerhin haben inzwischen 26 der zukünftig 70 Pfarreien
ihre ersten Schritte in Richtung pastorales Konzept gemacht.“
05.02.2015
Planung für Dom-Besucherzentrum verändert
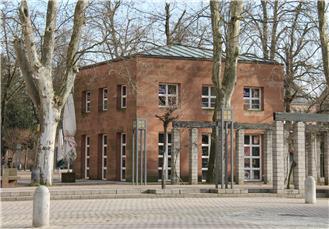 Domkapitel fasst
Dompavillion als neue Lösung ins Auge
Domkapitel fasst
Dompavillion als neue Lösung ins Auge
Speyer- Nach eingehender Beratung hat das Domkapitel
beschlossen, die Planung für das Besucherzentrum zu verändern. Um
möglichst viele Besucher effektiv zu erreichen, soll der
Dompavillon auf der Südseite der Kathedrale künftig als
Anlaufstelle für die zahlreichen Dombesucher aus aller Welt
eingerichtet werden. Zuvor war geplant, das Besucherzentrum im so
genannten Vikarienhof am Domplatz unterzubringen.
Bei der konkreten Planung einer Unterbringung im Vikarienhof
hatte sich als nachteilig herausgestellt, dass die mit dem
Erfordernis der Barrierefreiheit einhergehende räumliche Begrenzung
für die Auf- und Abgänge keine größeren Besucherströme zugelassen
hätten. Zudem wäre das Kellergeschoss, wo ein Shop und Gastronomie
vorgesehen waren, nur eingeschränkt nutzbar gewesen.
Der Dompavillon hingegen stellt in mehrfacher Hinsicht eine
günstigere Lösung dar. Bei einer Analyse des Besucherstroms zeigte
sich, dass die Lage des Dompavillons am ehesten dazu geeignet ist,
möglichst viele Besucher anzusprechen. Die Nähe zum Dom ohne eine
Straße als Barriere sowie der ebenerdige Zugang sind weitere
Vorteile des neuen Standorts. Auch im direkten Kostenvergleich
schneidet der Dompavillion deutlich günstiger ab. Angesichts zu
erwartender Rückgänge bei den Kirchensteuern werden Bauprojekte,
die ein über Jahrzehnte anhaltendes Engagement erfordern, im Bistum
Speyer in Zukunft eher die Ausnahme darstellen. Für die
Unterbringung im Vikarienhof hätte die Bausubstanz, die derzeit in
Form von Wohnungen angelegt und unterteilt ist, mit einem großen
finanziellen Aufwand umgebaut werden müssen. Dagegen fallen die
Investitionen und Unterhaltskosten für den Pavillon deutlich
geringer aus.
Ziel der Einrichtung eines Besucherzentrums war und ist, dass
Verkaufs- und Informationsangebote soweit wie möglich aus dem Dom
ausgelagert werden sollen, wohingegen die Mittel zur Erschließung
des Doms sowie alle seelsorglichen Angebote in der Kirche selbst
verortet bleiben. Darüber hinaus verbindet sich mit dem neuen
Standort aber auch die Absicht, die Angebote für Besucher des Domes
und der Stadt künftig stärker zu vernetzen. So könnten
Informationsmöglichkeiten auch in anderen Räumen der Kirche oder
bei anderen Institutionen sowie, mittels Angeboten für mobile
Endgeräte, im virtuellen Raum verortet werden.
Zurzeit ist der Dompavillon noch verpachtet. Mit dem derzeitigen
Pächter wurde eine einvernehmliche Lösung erzielt, die eine
vorzeitige Beendigung des Pachtvertrags zum November 2015 vorsieht.
Text und Foto: is
04.02.2015
Bistum Speyer veröffentlicht Satzung für die neuen Pfarrgremien
 Angaben
unter anderem zu Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeitsweise der
neuen Pfarrgremien / Grundlage für die Wahlen am 10. und 11.
Oktober 2015
Angaben
unter anderem zu Aufgaben, Zusammensetzung und Arbeitsweise der
neuen Pfarrgremien / Grundlage für die Wahlen am 10. und 11.
Oktober 2015
Speyer- Das Bistum Speyer erneuert seine
pastoralen Strukturen: Am 1. Januar 2016 werden aus bisher 346
Pfarrgemeinden 70 neue Pfarreien gebildet. Jede Pfarrei wird
künftig aus mehreren Gemeinden bestehen. Damit ändert sich zugleich
die Rolle der pfarrlichen Gremien. Bei den Wahlen am 10. und 11.
Oktober werden neben dem Pfarrei- und dem Verwaltungsrat erstmals
auch Gemeindeausschüsse gewählt. Die unterschiedlichen
Aufgabenschwerpunkte werden in der Satzung für die Pfarrgremien im
Bistum Speyer beschrieben. Sie wurde im Rahmen des Prozesses
„Gemeindepastoral 2015“ neu gefasst und jetzt im Oberhirtlichen
Verordnungsblatt des Bistums Speyer veröffentlicht.
Aus der Satzung gehen unter anderem die Aufgaben, die
Zusammensetzung und die Arbeitsweisen der verschiedenen
Pfarreigremien hervor. Betont wir ihre gemeinsame Verantwortung für
ein aktives Pfarrei- und Gemeindeleben. Dem Pfarreirat kommt die
Aufgabe zu, das Zusammenwachsen der Gemeinden zu fördern und ein
gemeinsames pastorales Konzept zu entwickeln. Die Pflege des
kirchlichen Lebens vor Ort ist hauptsächlich Aufgabe der
Gemeindeausschüsse. Der Verwaltungsrat hingegen sorgt für die
Finanzen und Immobilien der Kirchengemeinde und der in ihrem Gebiet
gelegenen Kirchenstiftungen. Alle drei Gremien werden direkt durch
die Gemeindemitglieder gewählt. Das geht aus der Wahlordnung für
die Pfarrgremien hervor, die ebenfalls im Oberhirtlichen
Verordnungsblatt veröffentlicht wurde. Sie erläutert die einzelnen
Schritte, in denen die Wahl vorbereitet und durchgeführt wird: von
der Bildung eines Wahlausschusses über die Erstellung einer
Kandidatenliste bis zur Feststellung des Wahlergebnisses und zum
Umgang mit eventuell eingehenden Wahleinsprüchen. is
Satzung und Wahlordnung für die Pfarrgremien im Bistum Speyer
(OVB 2/2015):
http://cms.bistum-speyer.de/www2/index.php?cat_id=31350&mySID=59eaab1f6f72c81bfc5ad3a1ca84e79f
04.02.2015
Schülertage des Bistums Speyer gestartet
 500
Schülerinnen und Schüler aus 15 Schulen nehmen bis Freitag daran
teil
500
Schülerinnen und Schüler aus 15 Schulen nehmen bis Freitag daran
teil
Speyer- Gestern starteten im Bistum Speyer
die Schülertage. Rund 80 Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums in
Maxdorf und des Edith-Stein Gymnasiums Speyer waren die Ersten, die
die Chance nutzten mehr über die Diözese Speyer zu erfahren.
Erster Programmpunkt war der Besuch im Dom. In Kleingruppen
lernten die Jugendlichen auch Bereiche der Kathedrale kennen, die
nicht allen Besucherinnen und Besuchern offen stehen. Domorganist
Christoph Keggenhoff vermittelte den Schülerinnen und Schülern
einen Eindruck von der Orgel auf dem Königschor, Domkapitular
Karl-Ludwig Hundemer erklärte in der Sakristei die Geschichte des
mittelalterlichen Codex Aureus und Schulrat i.K. Thomas Mann führte
durch die Domkrypta.
Im Priesterseminar präsentierte anschließend Pressesprecher
Markus Herr Informationen über die Diözese. Mitarbeiter der Caritas
gaben einen Einblick in die Arbeit ihres Verbandes und stellten
stellvertretend für das breitgefächerte Beratungs- und Hilfsangebot
der Caritas die Bereiche Young Caritas sowie die Schwangerschafts-
und die Suchtberatung vor.
 Am Nachmittag hatte die Schülerinnen und Schüler
die Wahl zwischen fünf verschiedenen Workshop-Angeboten - von der
Recherche im Bistumsarchiv, einem Gespräch mit Gefängnisseelsorger
Johannes Finck zum Thema „Wie spreche ich mit einem Mörder?“,
Angeboten zum Thema „Berufung“ mit Ordensleuten und
Priesteramtskandidaten aus dem Bistum bis hin zu Informationen über
die Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes. Zum Abschluss des
Tages stellte sich Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der
Jugendlichen.
Am Nachmittag hatte die Schülerinnen und Schüler
die Wahl zwischen fünf verschiedenen Workshop-Angeboten - von der
Recherche im Bistumsarchiv, einem Gespräch mit Gefängnisseelsorger
Johannes Finck zum Thema „Wie spreche ich mit einem Mörder?“,
Angeboten zum Thema „Berufung“ mit Ordensleuten und
Priesteramtskandidaten aus dem Bistum bis hin zu Informationen über
die Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes. Zum Abschluss des
Tages stellte sich Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der
Jugendlichen.
„Es war ein interessanter Tag, vor allem das Workshop-Angebot.
Ich war bei „He is calling“. Es war schön von Menschen erzählt zu
bekommen, wie sie ihre Berufung gefunden haben“, berichtet die
18-jährige Sarah, Schülerin des Edith-Stein-Gymnasiums. „Ja das war
ein sehr spannender Workshop“, bestätigt auch der 16-jährige Niklas
aus Maxdorf und bewertet den ganzen Tag als „sehr gelungen“. Lea
und Lea, beide 18 Jahre alt und Schülerinnen des
Edith-Stein-Gymnasiums sind sich ebenfalls einig: „Es war alles
sehr interessant und wir haben viel Neues erfahren“. Besonders
gefallen hat ihnen das Gespräch in Kleingruppen mit einem
Priesteramtskandidaten: „Es war ein sehr offenes Gespräch, wir
konnten alle Fragen stellen und haben darauf auch Antworten
bekommen.“
 Die
Schülertage werden in diesem Jahr zum dritten Mal angeboten. Bis
einschließlich Freitag nehmen rund 500 Schülerinnen und Schüler aus
insgesamt 15 Schulen - Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und
Berufsbildenden Schulen - daran teil. Mitarbeiter aus insgesamt
zwölf Bereichen des Bistums präsentieren ihre Arbeit. Fachleute des
Caritasverbandes stellen ihre Beratungs- und Hilfsangebote vor, die
Redakteure der Kirchenzeitung lassen sich bei der Produktion des
„Pilger“ über die Schulter schauen. Neben Bischof Wiesemann stellen
sich auch Generalvikar Dr. Franz Jung (am Mittwoch) und Domdekan
Dr. Christoph Kohl (am Donnerstag) den Fragen der Jugendlichen.
Die
Schülertage werden in diesem Jahr zum dritten Mal angeboten. Bis
einschließlich Freitag nehmen rund 500 Schülerinnen und Schüler aus
insgesamt 15 Schulen - Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und
Berufsbildenden Schulen - daran teil. Mitarbeiter aus insgesamt
zwölf Bereichen des Bistums präsentieren ihre Arbeit. Fachleute des
Caritasverbandes stellen ihre Beratungs- und Hilfsangebote vor, die
Redakteure der Kirchenzeitung lassen sich bei der Produktion des
„Pilger“ über die Schulter schauen. Neben Bischof Wiesemann stellen
sich auch Generalvikar Dr. Franz Jung (am Mittwoch) und Domdekan
Dr. Christoph Kohl (am Donnerstag) den Fragen der Jugendlichen.
Organisiert wird die Veranstaltung von der Hauptabteilung
Schulen, Hochschulen und Bildung im Bischöflichen Ordinariat.
Teilnehmende Schulen:
- Gymnasium Maxdorf (Montag)
- Edith-Stein-Gymnasium Speyer (Montag)
- Hugo-Ball-Gymnasium Pirmasens (Dienstag)
- Maria Ward Schule Landau (Dienstag)
- Berufsbildungszentrum St. Ingbert (Dienstag)
- Burg-Gymnasium Kaiserslautern (Dienstag)
- Carl-Bosch Gymnasium Ludwigshafen (Mittwoch)
- Karolinen-Gymnasium Frankenthal (Mittwoch)
- Integrierte Gesamtschule Berta-von-Suttner Kaiserslautern
(Donnerstag)
- Wilhelm-von-Humboldt Gymnasium Ludwigshafen (Donnerstag)
- Integrierte Gesamtschule Mutterstadt (Donnerstag)
- Goethegymnasium Germersheim (Donnerstag)
- Albert Einstein Gymnasium Frankenthal (Freitag)
- Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium Neustadt (Freitag)
- Eduard-Spranger Gymnasium Landau (Freitag)
Text: is; Foto: Klaus Landry; Bistum Speyer
03.02.2015
„Vorbehaltloses Ja zum Leben und zur Nächstenliebe“
 Pfarrer Annweiler
als Telefonseelsorger eingeführt – Vorgänger Seidlitz
verabschiedet
Pfarrer Annweiler
als Telefonseelsorger eingeführt – Vorgänger Seidlitz
verabschiedet
Kaiserslautern- Ein uneingeschränktes und
vorbehaltloses „Ja“ zum eigenen Leben und dem des Anderen, zu
Nächstenliebe und zu Gott stellte Pfarrer Peter Annweiler in den
Mittelpunkt seiner Predigt anlässlich seiner Einführung ins
Leitungsteam der Telefonseelsorge Pfalz. Zum 1. Februar übernimmt
der Pfälzer Pfarrer auf evangelischer Seite die Leitung der
ökumenischen Einrichtung. Bei der Feier am Freitag in der „Kleinen
Kirche“ in Kaiserslautern mit anschließendem Empfang ist Annweilers
Vorgänger, der Psychologe und evangelische Theologe Heiner
Seidlitz, in den Ruhestand verabschiedet worden. Seidlitz hatte die
von der Evangelischen Kirche der Pfalz und dem Bistum Speyer
getragene Telefonseelsorge 26 Jahre lang geleitet.
Oberkirchenrat Manfred Sutter würdigte Seidlitz als kompetenten
und sensiblen Menschen, der die Telefonseelsorge Pfalz zu einer
Einrichtung mit hohen Standards, sehr gutem Organisationsgrad und
einer gut ausgebildeten und begleiteten Mitarbeiterschaft gemacht
habe. „Dass die Telefonseelsorge Pfalz so großes Ansehen genießt,
ist Ihr Verdienst und Ihre Lebensleistung“, sagte Sutter. Seidlitz
sei es durch unermüdliche Vernetzungsarbeit gelungen, die
Telefonseelsorge als gesellschaftlich wichtiges Angebot zu
etablieren, um die seelische Gesundheit der Menschen zu erhalten
und ihnen in persönlichen Krisen zu helfen. Deutlich sei dies durch
die Gründung und Organisation der Nachsorgearbeit der
Flugkatastrophe von Ramstein geworden. Einen ganz besonderen Dank
für die kontinuierliche Begleitung und Hilfe sprach eine
Vertreterin der Hinterbliebenen aus.
16.000 Anrufe gehen jährlich bei der Telefonseelsorge Pfalz ein.
Diese Statistik zeige, dass viele Menschen sich vom Leben nicht
angenommen fühlten, führte Pfarrer Peter Annweiler aus. „Das Nein
kann sehr massiv sein.“ Gottes Ja umfasse indes alle Menschen. „Es
gilt jedem von uns sieben Milliarden Menschenkindern auf dieser
Erde, nicht nur den eigenen Leuten, der eigenen Religion, Nation
oder Kultur. Selbst zu Verbrechern und Kriminellen sagt Gott Ja.
Das Evangelium ist Liebeserklärung und Provokation gleichermaßen.“
Diese christlich grundierte Lebensbejahung sei universal und auch
für die Arbeit am Telefon unentbehrlich: „Gottes Ja liegt wie ein
Schutzmantel über unserem Leben, der nicht zerstört werden
kann.“
Nach mehr als sieben Jahren als Citykirchen-Pfarrer in Mannheim
und Schifferseelsorger ist Peter Annweiler an seinen früheren
Wirkungsort Kaiserslautern zurückgekehrt. Bis 2007 war er Pfarrer
an der Apostelkirche in Kaiserslautern. „Die seelsorgerliche
Identität zieht sich wie ein roter Faden durch Ihre Biographie und
ist Kennzeichen Ihrer Persönlichkeit und Grundhaltung als
Geistlicher“, sagte Oberkirchenrat Manfred Sutter. Nur wer selbst
für die geistliche Dimension offen sei und mit den Fragen des
Glaubens und Zweifels ringe, könne einem anderen Menschen
Seelsorger werden, betonte der Oberkirchenrat.
Die Ökumenische Telefonseelsorge Pfalz gibt es seit 1979. Träger
sind die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer. Im
Leitungsteam der ökumenischen Telefonseelsorge Pfalz arbeiten neben
den evangelischen hauptamtlichen Mitarbeitern auf katholischer
Seite die Pädagogin Astrid Martin und die Theologin und Psychologin
Ursula Adam. Rund 90 Personen sind derzeit im Ehrenamt tätig.
lk
Mehr zum Thema unter www.telefonseelsorge-pfalz.de.
02.02.2015
Kirchentag: Mit Bike, Bus und Bahn in die Schwabenmetropole
 „Erkundungstour“ nach Stuttgart mit der Geschäftsführerin des Landesausschusses Pfalz, Andrea Keßler (rechts) und dem Vorsitzenden Gert Langkafel (5. v. rechts).
„Erkundungstour“ nach Stuttgart mit der Geschäftsführerin des Landesausschusses Pfalz, Andrea Keßler (rechts) und dem Vorsitzenden Gert Langkafel (5. v. rechts).
Christenfest in Stuttgart: Landesausschuss rechnet mit
1000 Pfälzer Teilnehmern
Speyer/Kaiserslautern/Stuttgart- Andacht
und Bibelarbeit, Gottesdienst und Konfitag, Markt der
Möglichkeiten, Musik, Theater und Tanz: Zum 35. Deutschen
Evangelischen Kirchentag (DEKT) vom 3. bis 7. Juni in Stuttgart
unter dem Motto „damit wir klug werden“ erwarten die Veranstalter
rund 100.000 Menschen. Auch in der Pfalz laufen die Vorbereitungen
für das Großereignis schon auf Hochtouren. Gert Langkafel und
Andrea Keßler, die die pfälzische Teilnahme koordinieren, rechnen
mit etwa 300 Mitwirkenden und 1000 Besuchern aus der Pfalz.
Sportlich Ambitionierte starten am 1. Juni in Speyer zu einer von
der Evangelischen Jugend Pfalz organisierten „Bike & Help“ Tour
nach Stuttgart.
Gerade sind die Mitglieder des Landesausschusses Pfalz von einer
„Erkundungsfahrt“ nach Stuttgart zurückgekehrt. 2.000
Veranstaltungen, darunter ein „Konfitag“ am 6. Juni, erwarten die
Kirchentagsbesucher. Langkafel rät daher allen Interessierten, das
Programm vorher genau zu studieren und „zu selektieren“. Unter den
Pfälzer Mitwirkenden im Bereich Musik, Theater und Kleinkunst sind
u.a. Posaunenchöre unter der Leitung von Landesposaunenwart
Christian Syperek, die NewBrass Big Band aus Neustadt-Mußbach unter
Leitung von Alexander Bähr und das Kirchenkabarett „Wollläuse“ aus
Böhl-Iggelheim.
Der Migrationsbeauftragte der pfälzischen Landeskirche, Reinhard
Schott, die Neue Arbeit Westpfalz im ökumenischen Gemeinschaftswerk
Pfalz, das Diakonissen-Mutterhaus Lachen im Deutschen
Gemeinschafts-Diakonieverband, der Missionarisch-Ökumenische Dienst
Pfalz (MÖD) und Elke Pickard für den Verband Evangelischer
Pfarrerinnen und Pfarrer sowie Pfarrer Andreas Große für die
pfälzische Konfirmandenarbeit sind u.a. mit eigenen Ständen auf dem
Markt der Möglichkeiten vertreten. Langkafel ist seit 1998
Vorsitzender des Landesausschusses Pfalz des Deutschen
Evangelischen Kirchentages, Andrea Keßler ist seit 2001
Geschäftsführerin des pfälzischen Landesausschusses des DEKT. Ihre
Aufgabe besteht vor allem in der Koordination, Planung und
Finanzierung der auf dem Kirchentag vertretenen Pfälzer
Gruppen.
Die von der Evangelischen Jugend Pfalz organisierte Bike &
Help Tour startet am 1. Juni in Speyer. Am Vorabend kommen dort
etwa 100 Teilnehmer aus der ganzen Pfalz in der Jugendherberge
zusammen, um am Montagmorgen vom Landeskirchenrat aus gemeinsam los
zu radeln. Wegen der großen Zahl seien die Fahrradfahrer in zwei
Teams teilweise auf getrennten Strecken nach Stuttgart unterwegs,
teilt das Landesjugendpfarramt mit. Die Tour führe über Mosbach und
Murrhardt, bzw. Ludwigsburg. Die Teilnehmer der Bike & Help
Tour sammeln mit jedem gefahrenen Kilometer für ein Hilfsprojekt
der Aids Foundation South Africa (AFSA). Mitfahren können Jungen
und Mädchen, Männer und Frauen ab 14 Jahren. Landesjugendpfarrer
Florian Geith, der ebenfalls in die Pedale treten wird, sagt: „Ich
freue mich, dass sich immer mehr Menschen finden, die mitmachen,
und die Bewegung, Gemeinschaft und Solidarität miteinander
verbinden möchten.“
Der DEKT verspricht ein „Kirchentag der kurzen Wege“ zu werden:
Veranstaltungsorte und Quartiere seien mit öffentlichen
Verkehrsmitteln gut zu erreichen. Die meisten großen
Veranstaltungen des Kirchentages finden in der Stuttgarter
Innenstadt und rund um den Bad Canstatter Neckarpark statt. Dort
wird auch der Markt der Möglichkeiten aufgebaut. Dazu kommen
Kirchen und andere Orte im weiteren Stadtgebiet. Rund um den
Neckarpark mit Großzelten gestaltet der Kirchentag ein eigenes
Messegelände. Das Kultur- und Kongresszentrum Liederhalle, der
Schloss- und Marktplatz, der Hospitalhof, Stifts- und
Leonhardskirche, der Cannstadter Wasen, die
Hanns-Martin-Schleyer-Halle und die Porsche-Arena gehören zu den
etwa 230 Orten, die nach Angaben der Veranstalter das Programm des
Kirchentages beherbergen werden. Mitten im Geschehen, nämlich auf
dem „Cannstadter Wasen“, schlägt die Jugend ihre
Veranstaltungszelte auf. Die Eröffnungsgottesdienste finden am
Mittwoch, 3. Juni, um 18. 15 Uhr am Schlossplatz, Rotebühlplatz und
Marktplatz statt. Der Schlussgottesdienst mit Abendmahl wird am
Sonntag, 7. Juni, um 10 Uhr im Cannstadter Neckarpark gefeiert.
Hinweis: Mehr zum Thema unter www.kirchentag.de und www.evkirchepfalz.de/landeskirche/kirchentag.
Informationen über die Mitreise zum Evangelischen Kirchentag in
Stuttgart erteilen auch Volker Steinberg vom Protestantischen
Landesjugendpfarramt, Telefon 0631/3642-008, E-Mail: steinberg@evangelische-jugend-pfalz.de
sowie Ruprecht Beuter von der Evangelischen Arbeitsstelle Bildung
und Gesellschaft, Telefon 06361/5559, E-Mail: ruprecht.beuter@evkirchepfalz.de.
Text: lk; Foto: Privat
28.01.2015
Bistum Speyer veröffentlicht Haushaltszahlen für das Jahr 2015
 Konjunkturentwicklung wirkt sich positiv auf die
Entwicklung der Kirchensteuer aus / Ausgaben für Instandhaltung
kirchlicher Gebäude stellen starke Belastung dar
Konjunkturentwicklung wirkt sich positiv auf die
Entwicklung der Kirchensteuer aus / Ausgaben für Instandhaltung
kirchlicher Gebäude stellen starke Belastung dar
Speyer- Das Bistum Speyer hat die
Haushaltszahlen für das Jahr 2015 veröffentlicht. Auf der
Internetseite des Bistums wurden die aktuellen Haushaltspläne für
das Bistum, den Bischöflichen Stuhl, das Domkapitel, die
Pfarrpfründestiftung und die Emeritenanstalt publik gemacht.
Haushalt des Bistums
Das Bistum Speyer rechnet für dieses Jahr mit rund 121 Millionen
Euro Einnahmen aus der Kirchensteuer. Das sind rund zwei Millionen
Euro mehr als im vergangenen Jahr. Der Haushalt 2015 hat damit ein
Gesamtvolumen von rund 142 Millionen Euro.
Im Haushalt des Bistums entfallen rund 54 Prozent der Ausgaben
auf die Seelsorge in den Kirchengemeinden, weitere sieben Prozent
auf die übergemeindliche Seelsorge. Knapp zwölf Prozent seiner
Mittel setzt das Bistum Speyer für den Religionsunterricht und die
katholischen Schulen ein. Weitere 8 Prozent wendet es für
caritative Zwecke auf. Die Ausgaben für die Erwachsenenbildung und
die katholischen Tagungshäuser schlagen mit knapp drei Prozent zu
Buche.
Für die Instandhaltung kirchlicher Gebäude in den Pfarreien
stellt das Bistum in diesem Jahr rund 8,2 Millionen Euro bereit.
Hinzu kommen Zuschüsse für einzelne Bauprojekte. So ist zum
Beispiel die Sanierung des Priesterseminars am Germansberg in
Speyer mit 3,8 Millionen Euro eingeplant, der zweite Bauabschnitt
des Hauses der Kirchenmusik mit 1,8 Millionen Euro. „Die
Instandhaltung der kirchlichen Gebäude bereitet uns im Blick auf
die Zukunft die meisten Probleme“, erklärt Diözesanökonom Peter
Schappert. Zurzeit beschränke sich das Bistum auf besonders
dringliche Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen. „Auf mittlere Sicht
müssen wir unseren Gebäudebestand jedoch deutlich reduzieren.“
Haushalt des Bischöflichen Stuhls
Der Bischöfliche Stuhl ist eine Körperschaft des öffentlichen
Rechts, die seit der Neuerrichtung des Bistums Speyer im Jahr 1817
besteht. Beim Vermögen des Bischöflichen Stuhls handelt es sich um
ein langfristig angelegtes Stammvermögen, das nicht angetastet
wird. Nur die Erträge werden verwendet, mit ihnen werden pastorale
und caritative Projekte im Bistum Speyer gefördert.
Aus dem Vermögen des Bischöflichen Stuhls wird in diesem Jahr
ein Ertrag in Höhe von rund 600.000 Euro erwartet. „Das anhaltend
niedrige Zinsniveau führt dazu, dass wir bei Finanzanlagen mit
deutlich tieferen Erträgen rechnen müssen“, verdeutlicht Tatjana
Mast. Mit den Erträgen aus dem Bischöflichen Stuhl soll in diesem
Jahr die Sanierung des Priesterseminars eine zusätzliche
Unterstützung erhalten.
Haushalt des Domkapitels
Das Speyerer Domkapitel ist ebenfalls eine Körperschaft des
öffentlichen Rechts und trägt die Verantwortung für den Speyerer
Dom. Dazu zählen die Gottesdienste und die Angebote der Dommusik,
aber auch notwendige Sicherungs- und Erhaltungsmaßnahmen am
Dom.
Das Domkapitel rechnet in diesem Jahr mit Aufwendungen in Höhe
von rund 4,5 Millionen Euro, davon sind rund die Hälfte
Personalkosten für die am Dom, im Dombauamt und der Dommusik
beschäftigten Mitarbeiter. Für den baulichen Erhalt des Domes und
der weiteren Immobilien des Domkapitels sind rund zwei Millionen
Euro veranschlagt, rund 700.000 Euro mehr als im Vorjahr. „Da der
Zuschuss des Bistums an das Domkapitel konstant 1,7 Prozent der
Kirchensteuer beträgt, macht sich auch hier die positive
Kirchensteuerentwicklung bemerkbar“, erklärt Domkustos Peter
Schappert.
Haushalt der Pfarrpfründestiftung
Die Pfarrpfründestiftung hat den Zweck, die Diözese bei ihrer
Aufgabe zu unterstützen, die Besoldung der aktiven Pfarrer
sicherzustellen. Sie wurde im Jahr 2012 durch die Zusammenführung
der lokalen Pfarrpfründestiftungen gegründet. Das Stiftungsvermögen
ist als Stammvermögen fest angelegt und wird in seinem Bestand
ungeschmälert erhalten. Die Erträge aus dem Stammvermögen werden
für die Besoldung der Pfarrer verwendet.
Aus der Pfarrpfründestiftung erwartet das Bistum in diesem Jahr
einen Beitrag in Höhe von rund 1,3 Millionen Euro zur Bezahlung der
Priester im aktiven Dienst. Die Erträge aus der Bewirtschaftung des
Liegenschafts- und Finanzvermögen sind gegenüber dem Vorjahr um
etwa 300.000 Euro tiefer angesetzt – „eine Folge des niedrigen
Zinsniveaus“, wie Finanzdirektorin Tatjana Mast erläutert.
Haushalt der Emeritenanstalt
Die Emeritenanstalt ist die Rentenkasse für die Priester des
Bistums Speyers. Sie sind nicht im staatlichen System
rentenversichert, daher gibt es die Emeritenanstalt als
eigenständige Rentenkasse. Ihr Zweck besteht darin, die
Versorgungsbezüge der Priester im Ruhestand sicherzustellen. Die
Priester des Bistums Speyer sind in der Regel bis zum 70.
Lebensjahr im aktiven Dienst.
Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind die Erträge aus der
Anlage von Wertpapieren und Festgeldern in diesem Jahr deutlich
tiefer angesetzt: bei 1,6 Millionen Euro für 2015, gegenüber 4
Millionen Euro für 2014. Durch laufende Zahlungen wie auch durch
eine jährliche Sonderzahlung des Bistums in Höhe von 5,3 Millionen
Euro kann die Emeritenanstalt ihre Verpflichtungen derzeit zwar
vollständig bedienen, Sorge bereitet auf mittlere Sicht jedoch eine
Deckungslücke, die aktuell bei rund 37,5 Millionen Euro liegt.
Einsatz einer neuen Finanzsoftware
Die Haushaltspläne wurden mit Hilfe einer neuen Finanzsoftware
aufgestellt. Mit ihr kommt das System der doppischen Buchführung
zur Anwendung, die Rechnungslegung orientiert sich an den
Vorschriften des Handelsgesetzbuches. „Der Vorteil liegt darin,
dass wir Einnahmen und Ausgaben wesentlich besser steuern können
und die Risiken besser im Blick haben“, hebt Tatjana Mast hervor.
Im nächsten Jahr soll die Finanzsoftware auch für die
Finanzverwaltung der Pfarreien eingesetzt werden. is
Link zu den Haushaltsplänen der diözesanen Haushalte und
weitere Informationen zum Thema Bistumsfinanzen:
http://cms.bistum-speyer.de/www2/index.php?myELEMENT=277610&cat_id=&mySID=1ab3bf0b346bd310c8a1518679b06e0d
27.01.2015
Diakonisse Lieselotte Koch feiert 80. Geburtstag
 Vorsteher Pfarrer Dr. Werner Schwartz und Oberin Diakonisse Isabelle Wien gratulieren Diakonisse Lieselotte Koch (Mitte) zum 80. Geburtstag.
Vorsteher Pfarrer Dr. Werner Schwartz und Oberin Diakonisse Isabelle Wien gratulieren Diakonisse Lieselotte Koch (Mitte) zum 80. Geburtstag.
An ihrem 80. Geburtstag am 26. Januar ließ es sich
Diakonisse Lieselotte Koch nicht nehmen, ihrer Leidenschaft dem
Cello-Spiel nachzugehen und die Feier ihr zu Ehren selbst mit Musik
zu untermalen.
Speyer- Die ehemalige stellvertretende Oberin
des Speyerer Diakonissen-Mutterhauses ist gelernte
Kirchenmusikerin: Nach einer Ausbildung an der Krankenpflegeschule
der Diakonissenanstalt 1955 folgte sie als Pfarrersfrau ihrem Mann
in seine Gemeinde, in der sie selbst in der Gemeindearbeit und im
Religionsunterricht aktiv war, bevor sie Ende der 1970er Jahre
kirchenmusikalische Seminare besuchte und die D- und C-Prüfung für
Kirchenmusik ablegte. Nach dem Tod ihres Mannes arbeitete die
gebürtige Wormserin in der Altenpflege, von 1988 bis 2000 war sie
stellvertretende Oberin der Speyerer Diakonissen und begleitete im
Kreis ihrer Vorstandskollegen zahlreiche Entwicklungen wie etwa die
Einweihung der Kindertagesstätte Rulandstraße, der Hebammenschule,
des Hospizes oder der Maudacher Werkstatt in Ludwigshafen.
Anlässlich ihres runden Geburtstags blickte Vorsteher Pfarrer
Dr. Werner Schwarz auf den ungewöhnlichen Lebenslauf der
„Diakonisse mit Enkeln“, die als stellvertretende Oberin vor allem
für die Schulen mit ihren angeschlossenen Internaten verantwortlich
war. Oberin Sr. Isabelle Wien gratulierte im Namen der
Schwesternschaft und hob das vielseitige Engagement der Jubilarin
für Mutterhaus, Diakonie und Gemeinschaft hervor. Die Vielfalt der
Tätigkeiten machte auch Dekan i. R. Friedhelm Jakob deutlich, der
in einem Grußwort auf das große Engagement von Sr. Lieselotte in
der Gedächtniskirchengemeinde einging, bevor die Jubilarin selbst
ein Geheimnis preisgab, warum es ihr gutgehe: „Es gibt Menschen,
die sich als Boten Gottes um mich sorgen.“
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
27.01.2015
Familientreffen im Bistumsarchiv zum Geburtstag Elisabeth Stützels
 Nachkommen des
Architekten Albert Boßlet informierten sich über Nachlass - Rund
100 Kirchen geschaffen
Nachkommen des
Architekten Albert Boßlet informierten sich über Nachlass - Rund
100 Kirchen geschaffen
Speyer- Aus Anlass des 85. Geburtstages
der langjährigen ehemaligen Speyerer Stadträtin Elisabeth Stützel
fand am Samstagmorgen im Bistumsarchiv Speyer ein Familientreffen
statt. Im Fokus stand dabei der Großvater Frau Stützels, Albert
Boßlet (1880-1957), einer der bedeutendsten Kirchenarchitekten der
Zwischenkriegszeit. Nachkommen des gebürtigen Frankenthalers, der
im Bistum Speyer mehr als 40 Kirchen schuf, informierten sich über
Leben und Wirken ihres Ahnen, dessen Nachlass seit 1979 in dem
kirchlichen Archiv aufbewahrt wird.
Archivleiter Dr. Thomas Fandel und Archivarin Jutta Hornung
präsentierten den Gästen aus Freiburg, München, der Region
Frankfurt sowie der Pfalz Fotos, Zeitungsausschnitte, aber auch
Pläne und Zeichnungen Boßlets. Auf besonderes Interesse stießen
zwei großformatige Alben zum 70. und 75. Geburtstag des Architekten
mit Glückwunschschreiben kirchlicher und weltlicher Prominenz, an
der Spitze die Bischöfe Julius Döpfner, Joseph Wendel und Isidor
Markus Emanuel. Schriftstücke aus dem familiären Umfeld sowie Fotos
aus Boßlets Wohnung regten zum intensiven Austausch von
Erinnerungen an.
Auf Boßlet gehen annähernd 100 Kirchenbauten zurück. Im Bistum
Speyer schuf er unter anderem Kirchen in Ludwigshafen (St. Bonifaz,
Herz Jesu und St. Maria), Frankenthal, St. Ingbert, Schifferstadt,
Zweibrücken-Ixheim, Hornbach und Hauenstein. Als sein bedeutendstes
Werk gilt die 1936/37 errichtete Benediktinerabtei
Münsterschwarzach. Sie wird auch „fränkisches Speyer“ genannt, da
die Silhouette stark an die der romanischen Kathedrale erinnert.
Der Architekt war auch außerhalb Europas tätig. So ließen die
Zisterzienser von Itaporanga in Brasilien in den 1930er Jahren nach
Boßlet-Plänen eine monumentale Klosterkirche samt Konvent
errichten. Auf Boßlet gehen zudem zahlreiche Profanbauten zurück,
beispielsweise Krankenhäuser und Schulen, aber auch das Weingut „Im
Forstgärtel“ in St. Martin oder das Studentenheim St. Joseph in
Speyer, heute Zentrale des Diözesan-Caritasverbandes. Text und
Foto: is
25.01.2015
Diakonissen übernehmen Erziehungsberatung des Diakonischen Werks
Zum 1. Januar haben die Diakonissen Speyer-Mannheim die
örtliche Erziehungsberatungsstelle des Diakonischen Werkes Pfalz
mit Sitz in Speyer übernommen
Speyer- Durch die Übernahme der
Erziehungsberatungsstelle in der Speyerer Ludwigstraße sichern die
Diakonissen Speyer-Mannheim dieses wichtige niedrigschwellige
Angebot für Familien, Kinder und Jugendliche. „Ratsuchende können
sich direkt an die Beratungsstelle wenden, sie ist damit eine gute
Ergänzung und Erweiterung zu unseren bereits bestehenden ambulanten
Betreuungsangeboten“, erklärt Rolf Schüler-Brandenburger, Leiter
der Diakonissen Kinder- und Jugendhilfe, die neben stationären
Wohngruppen etwa die Sozialpädagogische Familienhilfe und
Schülerhilfe oder Erziehungsbeihilfe betreibt.
„Die Diakonissen Speyer-Mannheim verfügen über eine große
Erfahrung auf dem Gebiet der Beratung und Betreuung von Familien,
so dass die Beratungsqualität sichergestellt ist und der Charakter
des Hauses der Diakonie als vernetzte Beratungsstelle mit
unterschiedlichen Angeboten erhalten bleibt“, hebt
Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr hervor.
Fünf Sozialpädagogen und Psychologen, eine Mototherapeutin sowie
zwei Verwaltungsfachkräfte sind weiterhin mit ihrem jeweiligen
bisherigen Arbeitsumfang in der Erziehungsberatungsstelle tätig.
„Dadurch, dass Angebot und Ansprechpartner gleich bleiben, ändert
sich für die Ratsuchenden durch den Trägerwechsel nichts“, betont
Dr. Werner Schwartz, Vorsteher der Diakonissen Speyer-Mannheim.
Lediglich die Telefonnummer ist neu: Die Erziehungsberatung im Haus
der Diakonie ist nun unter 919499-0 zu erreichen.
Info:
Die Diakonissen Speyer-Mannheim stehen in der Tradition
der Diakonissenmutterhäuser und betreiben mit rund 4.200
Mitarbeitenden Krankenhäuser, Einrichtungen für Senioren, Kinder
und Jugendliche sowie Menschen mit Behinderung, Schulen und ein
Hospiz in mehreren Orten in Rheinland-Pfalz sowie in Mannheim und
Homburg/ Saarland.
Das Diakonische Werk Pfalz ist der soziale Dienst der
Evangelischen Kirche der Pfalz. In den zwölf Häusern der Diakonie
sind die unterschiedlichen Beratungsangebote gebündelt. Rund 250
Mitarbeitende sind im Diakonischen Werk Pfalz beschäftigt.
19.01.2015
Bekenntnis zur gemeinsamen Quelle des Glaubens
 Am Altar (v.l.n.r.): Dompfarrer Matthias Bender, der Präsident der Landessynode Henri Franck, der Vertreter der Orthodoxen Kirche Argirios Giannios, Bischof Wiesemann, Kirchenpräsident Schad, Pfarrer Jürgen Wienecke, die Vertreterin des Katholikenrates Astrid Waller und Pfarrerin Christine Gölzer.
Am Altar (v.l.n.r.): Dompfarrer Matthias Bender, der Präsident der Landessynode Henri Franck, der Vertreter der Orthodoxen Kirche Argirios Giannios, Bischof Wiesemann, Kirchenpräsident Schad, Pfarrer Jürgen Wienecke, die Vertreterin des Katholikenrates Astrid Waller und Pfarrerin Christine Gölzer.
Ökumenischer Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der
Christen im Speyerer Dom
Speyer- Mit einem ökumenischen
Gottesdienst wurde heute in Speyer die Gebetswoche für die Einheit
der Christen eröffnet. Kirchenpräsident Christian Schad und Bischof
Dr. Karl-Heinz Wiesemann zogen mit gefüllten Wasserkrügen in den
Händen gemeinsam mit Vertretern der in der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) – Region Südwest zusammengeschlossenen
Kirchen, der örtlichen Gemeinden sowie des Katholikenrates und der
Landessynode in den Speyerer Dom ein. Am Altar füllten sie das
Wasser aus den Krügen in einen symbolischen Brunnen. Die
Gebetswoche für die Einheit der Christen steht in diesem Jahr unter
dem Thema „Gib mir zu trinken“ (Joh 4,7).
„Als Christinnen und Christen sind wir mit der Gabe des
lebendigen Wassers beschenkt. Als Kirche haben wir den Auftrag, das
lebendige Wasser auf alle Menschen überfließen zu lassen, um ihren
Durst nach Leben und Gemeinschaft zu stillen“, erklärte Bischof
Wiesemann in seiner Begrüßung. Im Blick auf das Motto des
Gottesdienstes sprach er die Hoffnung aus, dass der Gottesdienst
immer wieder „aufs Neue den Durst, die Sehnsucht nach der Einheit
alle Christinnen und Christen wecken und vertiefen möge“ und allen
„den rechten Mut, die nötige Kraft und die Haltung der Offenheit
füreinander schenke, um auf dem ökumenischen Weg
weiterzugehen“.
Kirchenpräsident Schad: Jesus ist die wahre Quelle, aus der
unterschiedliche Konfessionen schöpfen
In seiner Predigt über die biblische Geschichte von der
Begegnung der samaritanischen Frau mit Jesus an einem Brunnen
bezeichnete Kirchenpräsident Christian Schad, „Jesus als die wahre
Quelle, aus der die unterschiedlichsten Konfessionen schöpfen“. Die
verschiedenen Weisen, an diese eine Quelle zu glauben, sollten die
Christen als Bereicherung erfahren und führe die ökumenische
Gemeinschaft immer weiter zusammen. Nur im Miteinander könnten die
Missverständnisse der vergangenen Jahrhunderte überwunden werden.
Wer die Lebens- und Glaubensgeschichte des jeweils anderen
verstehe, werde „ein Teilen und Heilen der Erinnerungen in Gang
setzen“.
Diejenigen, die das Wasser des Lebens gefunden hätten, würden
auch selbst zur Quelle für Andere, sagte Schad. Daher sei es
Aufgabe der Christen, „hinauszugehen, um auch Anderen von ihrer
Begegnung mit Jesus Christus zu erzählen. Das Wasser des Lebens
stille nicht nur den eigenen Lebensdurst, sondern fließe über und
reiche in ökumenischer Weite auch für alle Anderen aus. „Niemand
ist davon ausgeschlossen. Jede und jeder bekommt davon. Alle
Menschen brauchen es so nötig wie das tägliche Brot, wie den
täglichen Schluck Wasser“, betonte Schad.
Erneuerung des Taufgedächtnisses
 Dass Wasser ein wichtiges Symbol für einen lebendigen
Glauben und für die Verbundenheit aller Christen durch die Taufe
ist, wurde bei der Erneuerung des Taufgedächtnisses der Gläubigen
deutlich. Dazu waren alle Mitfeiernden eingeladen, sich einzeln von
den Liturgen mit Wasser bekreuzigen zu lassen.
Dass Wasser ein wichtiges Symbol für einen lebendigen
Glauben und für die Verbundenheit aller Christen durch die Taufe
ist, wurde bei der Erneuerung des Taufgedächtnisses der Gläubigen
deutlich. Dazu waren alle Mitfeiernden eingeladen, sich einzeln von
den Liturgen mit Wasser bekreuzigen zu lassen.
An dem gut besuchten Gottesdienst wirkten Vertreter mehrerer
Kirchen mit, die in der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen
(ACK) zusammengeschlossen sind: Argirios Giannios vertrat die
orthodoxen Kirchen und Pfarrer Jürgen Wienecke die Selbstständige
Evangelisch-Lutherische Kirche. Ebenfalls beteiligt waren Pfarrerin
Christine Gölzer von der protestantischen
Dreifaltigkeitskirchengemeinde und Dompfarrer Matthias Bender aus
Speyer sowie Astrid Waller vom Katholikenrat im Bistum Speyer und
der Präsident der Landessynode Henri Franck.
Musikalisch umrahmt wurde die Feier von der Evangelischen
Jugendkantorei der Pfalz unter der Leitung von
Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald und Domorganist Markus
Eichenlaub an der Orgel.
Die Texte und die Liturgie zum Thema der Gebetswoche für die
Einheit der Christen wurden in diesem Jahr von Christinnen und
Christen aus Brasilien erstellt.
Seit 2009 findet zur Gebetswoche für die Einheit der Christen ein
zentraler ökumenischer Gottesdienst in Speyer statt, bei dem
abwechselnd die Landeskirche und das Bistum Gastgeber sind. Daran
beteiligt ist außerdem die ACK in Rheinland-Pfalz und im Saarland.
Text: is; Foto: Klaus Landry
18.01.2015
Unterschriftenaktion geht weiter
 Über
eintausend Speyerer protestieren gegen den geplanten Verkauf der
Konviktskirche St.Ludwig.
Über
eintausend Speyerer protestieren gegen den geplanten Verkauf der
Konviktskirche St.Ludwig.
Speyer- Das Führungstrio der
Bürgerinitiative sammelt noch bis Mitte Februar weitere
Unterschriften von Bürgern, die sich damit gegen die beabsichtigte
Profanierung des Gotteshauses aussprechen (wir berichteten am
20.November 2014). Die Kirche gehört zum Bischöflichen Konvikt
St.Ludwig, das zunächst saniert und umgestaltet, während das
Priesterseminar am Germansberg abgerissen werden sollte.
Doch dann entschieden sich die verantwortlichen Gremien des
Bistums Speyer um und beschlossen den Erhalt des
Priesterseminars. Das Geld für dessen Sanierung wollen
Generalvikar Dr.Franz Jung und Domkapitular Peter Schappert
vom Verkauf des Konvikts generieren.
Vor allem die Stadtführerin Ursula Büchs legt Wert darauf, dass
der spätgotische Boßweiler-Altar und der kostbare Wandteppich in
diesem Gotteshaus bleiben. Unklar ist der Initiative auch, was mit
den Gefallenentafeln vom ersten Weltkrieg und den gotischen
Kirchenfenstern im Falle des Verkaufs passieren soll.
Es ist geplant, die Unterschriften am 12.Februar an Generalvikar
Dr.Franz Jung und Domkapitular Peter Schappert zu übergeben.
ws
Lesen Sie hierzu auch:
Interview mit dem Diplom-Theologe Klaus Pfeifer:  Kommentar von Werner Schilling:
Kommentar von Werner Schilling: 
16.01.2015
„Aufstehen, wenn in der Kirche etwas falsch läuft“
Von unserem Mitarbeiter Werner Schilling
Speyer- Nicht zusehen, wie ein Gotteshaus
entweiht wird, wollen viele Speyerer Bürger, denen die zur
Innenstadt gehörende Konviktskirche St. Ludwig am Herzen liegt.
„Motor“ der Bürgerinitiative, die sich mit einem deutlichen Veto
gegen den Verkauf ausspricht, ist Diplom-Theologe Klaus Pfeifer.
Der pensionierte Gymnasiallehrer für Theologie und Latein am
Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium hat zusammen mit Stadtführerin
Ursula Büchs und dem Protestanten Eberhard Jahner eine
Unterschriftenaktion gestartet.
Unser Mitarbeiter Werner Schilling hat mit
Klaus Pfeifer über seine Beweggründe für den Kampf zum Erhalt
der Kirche gesprochen.
Woher nehmen Sie den Mut, mit dem Thema in die
Öffentlichkeit zu gehen und sich gegen eine Entscheidung der
kirchlichen Obrigkeit zu wehren?
Pfeifer: Ich bin von Haus aus Diplom-Theologe
und habe in München bei Prof. Mörsdorf, dem damalig führenden
Kirchenrechtler, das Kirchenrecht studiert und weiß daher um seine
Bedeutung. Im Canon 212 steht, dass ein Katholik das Recht und
sogar die Pflicht hat aufzustehen, wenn etwas falsch läuft in
seiner Kirche.
Was war der konkrete Anlass für den Protest?
Pfeifer: Bei einem Treffen ehemaliger
Studienkollegen und zahlreichen Vertretern kirchlicher Verbände
berichtete Helga Schädler von dem Aufruf von Professor Bucher:
„Verkauft keine Kirchen!“ Ich selbst hatte am 12.Oktober 2014 beim
Diözesanforum in Ludwigshafen den Antrag gestellt, beide
christlichen Kirchen mögen beim Freiwerden einer Kirche sich
Gedanken machen über ein Columbarium. Beides zusammen führte zu
dieser Unterschriften-Aktion, die kein Selbstläufer war. Jeder
Einzelne musste gefragt werden, ob er gegen den Verkauf von
St.Ludwig ist.
Warum soll die Kirche erhalten werden?
Pfeifer: Sie liegt im Herzen von Speyer, war
niemals Gemeindekirche, bewahrt aber eine lange Tradition: Im
Tymbanon des Eingangs sind die Heiligen Drei Könige dargestellt. Es
erinnert daran, dass die Gebeine der Könige 1164 von Reinald van
Dassel, dem Kanzler des Reiches, vorübergehend hier in der Kirche
aufbewahrt wurden. Das war ein Geschenk von Kaiser Barbarossa. Der
Boßweiler Altar, das Antependium sind kostbare Zeugen des
Mittelalters, und die wunderschönen Glasfenster in der Apsis laden
ein zu Stille und Besinnung. Auch die Orgel hat einen
hervorragenden Klangkörper.
Wie kamen Sie auf die Idee in einem Gotteshaus ein
Columbarium, also eine Begräbnisstätte für Urnen,
einzurichten?
Pfeifer: Im Jahr 2010 lag ich auf der
Intensivstation eines Krankenhauses und hatte reichlich Zeit, um
über den Tod und die Zeit danach nachzudenken. Diesen
Columbarium-Gedanken trug ich auch unserem Bischof im Kreis von
katholischen Akademikern vor. Da war gerade der Mannheimer
Katholikentag unter dem Motto „Neuen Aufbruch wagen“ zu Ende
gegangen. Aber Bischof Wiesemann wollte damals diese Idee nicht
aufgreifen. Es ging damals allerdings noch um das Gebäude und die
Kirche des Priesterseminars auf dem Germansberg. Erst später
entschied man sich ja das Gelände zu behalten und stattdessen das
Bistumsgebäude aufzugeben.
Wie sehen andere kirchennahe Speyerer die Chance eines
Columbariums?
Pfeifer: Prominente Unterstützer dieser Idee
sind Speyers Ehrenbürger Dr. Bernhard Vogel, nach seiner Amtszeit
in Rheinland-Pfalz lange auch Ministerpräsident von Thüringen. In
Erfurt steht auch die Allerheiligenkirche, nun ein
Columbarium der Diözese Erfurt. Unterstützt wird der Gedanke unter
anderem vom ehemaligen ZDF-Intendanten Dr. Markus Schächter,
selbst ehemaliger Bewohner des Konvikts. Auch acht Professoren, die
eine enge Beziehung zu dieser Kirche haben, sowie emeritierte
Priester aus dem ganzen Bistum befürworten die Columbarium-Idee. So
hat auch Pfarrer Bernhard Linvers die Liste mit unterschrieben.
Welcher Gedanke steckt eigentlich dahinter?
Pfeifer: Ich zitiere gerne, was Erzbischof
Dr.Werner Thissen von Hamburg gesagt hat: „Wir holen auf diese
Weise unsere Toten vom Rande der Stadt wieder ins Zentrum und
beleben den frühchristlichen Brauch, dass die Heilige Messe über
den Gräbern der Verstorbenen ermöglicht wird. Das ist auch ein
Dienst an den Trauernden. Denn wer den Tod nicht verdrängt, der
gibt dem Leben Raum. Die Hinwendung zu unseren Toten hilft uns zum
Leben.“ Hamburg hat auch den Columbarium-Raum eindrucksvoll
gestaltet. Auf einer Backsteinwand steht in goldenen Lettern: Freut
euch, daß eure Namen im Himmel verzeichnet sind (Lk 10,29). Wir
sind vor Gott keine namenlosen Wesen oder nur Nummern, sondern Gott
hat jeden beim Namen gerufen (Jes.43,1) und eure Namen sind im
„Buch des Lebens“ (Phil. 4,3) verzeichnet.
16.01.2015
Kommentar
Von Werner Schilling
Sehr geehrter Herr Bischof,
ich hoffe, Sie sind gut ins neue Jahr gekommen. Dieses wird
Ihnen eine weitreichende Entscheidung abverlangen. Soll die Kirche
St.Ludwig wirklich im Paket mit dem gesamten Bischöflichen Konvikt
an einen Investor verkauft oder kann die Kirche vom Verkauf
ausgespart werden? Zwei Dinge sind bei dieser Immobilie meiner
Ansicht nach falsch gelaufen. Zunächst der Beschluss, dass
St. Ludwig verkauft werden soll. Dann die Art und Weise, wie dies
beschlossen wurde. Denn es wurde meines Wissens keiner der ehemals
für das Kirchengebäude Verantwortlichen in die Entscheidungsfindung
miteinbezogen. Man hat keine Rücksicht genommen auf die Gefühlswelt
der vielen Speyerer Hochzeitspaare, die sich in St.Ludwig das
Ja-Wort gegeben haben und der Christen, die das innenstadtnahe
Gotteshaus häufig zum Atemholen nutzen. Mich würde ganz nebenbei
interessieren, ob denn von kirchlicher Seite aus ins Kalkül gezogen
wurde, den gesamten Komplex als Auffanglager für Asylsuchende
anzubieten. Aber dieser Zug ist vermutlich abgefahren, denn das
Geld aus dem Verkauf wird ja zur Generalsanierung des
Priesterseminars benötigt.
Bitte öffnen Sie sich den Argumenten der Christeninitiative und
lassen Sie ihrem Generalvikar freie Hand, was den Verbleib des
Gotteshauses beim Bistum betrifft. Es wäre ein starkes Signal
dafür, dass sich die katholische Kirche nicht ausschließlich vom
monitären Gedanken leiten lässt. Schließlich hat Papst Franziskus
in seiner Weihnachtansprache einen behutsameren Umgang mit
allen Gläubigen angemahnt. Die Diözese sollte Betreiber des von der
Initiative um den Theologen Klaus Pfeifer angedachten Columbariums
sein, weil sie die Kontinuität garantiert, die ein Trägerverein
nicht zusichern könnte. Sicher lässt sich ein freiwilliger,
ökumenisch besetzter Helferverein bilden, der das Domkapitel bei
der Arbeit unterstützt.
Ich bin gespannt auf Ihre Antwort, lieber Herr Wiesemann.
Bild und Bibel: Ein spannendes und spannungsreiches Verhältnis
 Birgit Weindl, Cornelia Zeißig und Gerlinde Wnuck-Schad (v. l.)vom landeskirchlichen Forum Kunst und Kirche.
Birgit Weindl, Cornelia Zeißig und Gerlinde Wnuck-Schad (v. l.)vom landeskirchlichen Forum Kunst und Kirche.
Beim Neujahrsempfang geht Kirchenpräsident Schad auf das
Schwerpunktthema 2015 ein
Speyer- Kunst und Kirche kommen nach den
Worten des pfälzischen Kirchenpräsidenten Christian Schad ohne
einander nicht aus – sie ergänzen sich und fordern zum Dialog auf.
„Mir liegt die Wertschätzung der Kunst sehr am Herzen“, sagte Schad
beim Neujahrsempfang am Donnerstag im Landeskirchenrat in Speyer.
Gerade Bilder seien „Teil des kulturellen Gedächtnisses“. Sie
hätten die Kraft, nicht nur innere Räume zu erschließen, sondern
auch Kirchenräume immer wieder neu zu erkunden. Beim
Neujahrsempfang stellte der Kirchenpräsident das diesjährige Thema
der Reformationsdekade „Bild und Bibel“ in den Mittelpunkt seiner
Ansprache.
Beide stünden in einem „spannenden und spannungsreichen
Verhältnis“ zueinander, sagte der Kirchenpräsident vor rund hundert
Gästen aus Kirche, Kultur, Politik und Wissenschaft. Für das
landeskirchliche „Forum Kunst und Kirche“ begrüßte Schad
stellvertretend Birgit Weindl und Pfarrer Steffen Schramm vom
Institut für kirchliche Fortbildung in Landau. Gott sei zwar nicht
in Bildern zu begreifen, aber die Menschen könnten sich von den
Bildern, die Gott ihnen gebe, ergreifen und mitnehmen lassen, sagte
Schad. So sei auch der Protestantismus trotz seiner Kargheit voller
Gleichnisse und Metaphern, die Bibel voller Bilder von Gott. „Sie
malt uns Sprachbilder vor Augen. Auch da, wo nur etwas zu hören
ist, gibt es etwas zu sehen.“ Im Gegensatz dazu stünden die, die
sich selbst zum Idol machen, die Deutungshoheit des Göttlichen für
sich in Anspruch nehmen und Absolutheitsansprüche notfalls mit
Gewalt durchsetzen. Auch mit Blick auf die jüngsten Ereignisse in
Frankreich sagte der Kirchenpräsident: „Sich selbst die letzte
Instanz sein zu wollen, ist uns heilsam untersagt!“
 Beim
Neujahrsempfang sprach der Kirchenpräsident auch denjenigen, die
sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Krisengebieten
engagieren, seinen Dank und seine Anerkennung aus. Stellvertretend
nannte Schad den Migrationsbeauftragten der Landeskirche, Reinhard
Schott, und für den „Treffpunkt Asyl“ in Speyer Pfarrer Uwe
Weinerth und Dekan Markus Jäckle. „Frauen, Männer und Kinder kommen
in diesen Tagen bei uns an, weil die Gewalt sich immer mehr
ausbreitet und sie an Leib und Seele bedroht. Ich bedanke mich
heute bei allen, die diejenigen, die es nach schlimmen Erfahrungen
zu Hause und auf der Flucht bis hierher geschafft haben, bei uns
herzlich empfangen und willkommen heißen“, sagte der
Kirchenpräsident.
Beim
Neujahrsempfang sprach der Kirchenpräsident auch denjenigen, die
sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Krisengebieten
engagieren, seinen Dank und seine Anerkennung aus. Stellvertretend
nannte Schad den Migrationsbeauftragten der Landeskirche, Reinhard
Schott, und für den „Treffpunkt Asyl“ in Speyer Pfarrer Uwe
Weinerth und Dekan Markus Jäckle. „Frauen, Männer und Kinder kommen
in diesen Tagen bei uns an, weil die Gewalt sich immer mehr
ausbreitet und sie an Leib und Seele bedroht. Ich bedanke mich
heute bei allen, die diejenigen, die es nach schlimmen Erfahrungen
zu Hause und auf der Flucht bis hierher geschafft haben, bei uns
herzlich empfangen und willkommen heißen“, sagte der
Kirchenpräsident.
Der Neujahrsempfang wurde musikalisch umrahmt von
Landeskirchenmusikdirektor Jochen Steuerwald und seiner Tochter
Clara am Klavier.
Hinweis: Im Schwerpunktjahr 2015 ist die Evangelische
Kirche der Pfalz mit mehreren Projekten und Veranstaltungen zum
Thema „Bild und Bibel“ beteiligt: Unter anderem hält Professorin
Irene Dingel vom Leibniz-Institut für Europäische Geschichte
(Mainz) am 12. März, um 19 Uhr in der Bibliothek und Medienzentrale
der Landeskirche in Speyer einen Vortrag zum Themenjahr. Vom 1. Mai
bis 30. Juni setzen sich Bildende Künstler in der
Zwölf-Apostel-Kirche Frankenthal im Rahmen des Projekts
„Lichtgestalten“ mit dem menschlichen Bedürfnis nach
„Heldenbildern“ auseinander; am 19. Juni um 18 Uhr lädt
Kirchenpräsident Christian Schad haupt- und ehrenamtlich im Bereich
von Kunst und Kirche Engagierte und Künstler zu einem Empfang in
die Stiftskirche Neustadt ein.
Text und Foto: lk
16.01.2015
„Achtung vor der persönlichen Meinungs- und Glaubensfreiheit ist ein Grundwert unserer Gesellschaft“
 Bischof Wiesemann bringt in einem Brief an das
Partnerbistum Chartres die Verbundenheit der Katholiken im Bistum
Speyer angesichts der Terrorakte in Frankreich zum Ausdruck
Bischof Wiesemann bringt in einem Brief an das
Partnerbistum Chartres die Verbundenheit der Katholiken im Bistum
Speyer angesichts der Terrorakte in Frankreich zum Ausdruck
Speyer- Auch in der Pfalz und dem
Saarpfalzkreis habe diese „abscheuliche, aus religiösem Fanatismus
begangene Tat“ allgemeines Entsetzen hervorgerufen. „Wir fühlen uns
mit den Angehörigen der Opfer in Trauer vereint, darüber hinaus mit
allen Franzosen und Menschen jedweder Nationalität, die diesen Akt
barbarischer Gewalt verurteilen.“ Der Terroranschlag sei ein
Angriff auf die Menschlichkeit, die Freiheit und die Grundwerte der
Gesellschaft. Zugleich sei die Tat ein Missbrauch der Religion:
„Denn Gewalt ist niemals religiös zu rechtfertigen.“
Die Gläubigen im Bistum Speyer stünden im Einsatz gegen Hass und
Gewalt eng an der Seite ihrer französischen Schwestern und Brüder.
„Entschlossen treten wir für ein friedliches Zusammenleben von
Menschen unterschiedlicher Religionen ein.“ Aus Sicht des Bischofs
wäre es falsch, „uns durch die Terroristen in einen Kampf der
Kulturen oder einen Religionskrieg treiben zu lassen.“ Stattdessen
wirbt er für Haltungen der Friedfertigkeit, des Gewaltverzichts und
der Dialogbereitschaft. Die weltweiten Reaktionen auf die
Terrorakte in Paris zeigen nach seiner Überzeugung:
„Einschüchterung durch Terror und Gewalt darf in unserem
Zusammenleben keinen Platz bekommen. Die Achtung vor der
persönlichen Meinungs- und Glaubensfreiheit ist ein elementarer
Grundwert unserer Gesellschaft.“
Der Bischof erinnert an das Vorbild Jesu, der seliggepriesen
habe, wer „keine Gewalt anwendet“ (Mt 5,5). „Wir beten mit Dir und
den Gläubigen der Diözese Chartres für die Opfer und ihre
Angehörigen, dass die Liebe den Hass besiege“, schreibt Wiesemann
an seinen französischen Amtsbruder. Text und Foto: is
15.01.2015
Schon über 210 Teilnehmer bei Gebetskette im Bistum Speyer
Seit dem 30. November 2014 wird jeden Tag für die pastorale
Erneuerung des Bistums im Sinn von „Gemeindepastoral 2015“ gebetet
/ Fortsetzung bis zum 1. Advent 2015
Speyer- Ein Bistum verbunden im Gebet für
die Anliegen des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“: Diese Idee
steht hinter der bistumsweiten Gebetskette, die am 1. Advent 2014
gestartet wurde und die noch bis zum 1. Advent 2015 andauern wird.
Jeden Tag treffen sich an irgendeinem Ort des Bistums Gläubige,
Gruppen oder ganze Pfarreien, um für die pastorale Erneuerung des
Bistums Speyer im Sinn seines neuen Seelsorgekonzepts „Der Geist
ist es, der lebendig macht“ zu beten.
Auf der Internetseite des Bistums haben sich schon mehr als 210
Personen, Familien, Gebetskreise, Ordensgemeinschaften oder andere
kirchliche Gruppierungen eingetragen, die bei der Gebetskette
mitmachen. „Die starke Resonanz freut uns sehr“, erklärt
Liturgiereferent Clemens Schirmer, der die Gebetskette betreut.
Viele Tage seien sogar schon mehrfach belegt, was aber kein Problem
darstelle. Im Gegenteil: „Je mehr sich zur Teilnahme entscheiden,
umso stärker wird die Verbundenheit im gemeinsamen Gebet.“ Die
meisten Teilnehmer übernehmen einen bestimmten Tag. Einige beten
wöchentlich zu festen Zeiten für die Anliegen des Bistums, manche –
wie zum Beispiel die Schwestern im Karmelkloster St. Josef in
Hauenstein – sogar täglich.
„Die Gebetskette ist ein starkes Zeichen, dass der Geist Gottes
in unseren Pfarreien, Gemeinschaften und Gruppen lebendig bleibt.
Die pastorale Erneuerung, die wir mit dem Stichwort
‚Gemeindepastoral 2015‘ verbinden, ist eben nicht nur eine Frage
der Organisation und der Strukturen, sondern vor allem ein
geistlicher Prozess“, erklärt Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann. Die
Gebetskette sei daher ein zentraler Baustein der geistlichen
Impulse für den Weg des Bistums und seiner Pfarreien zu
„Gemeindepastoral 2015“.
Die Teilnehmer der Gebetskette erhalten für die Gestaltung der
Gebetstreffen einen Modellablauf, der die Offenheit bietet, die
Gebetsform an die Bedürfnisse vor Ort anzupassen. Wer möchte, kann
beim Karmelitinnenkloster in Speyer eine passende Kerze mit der
Aufschrift „Der Geist ist es, der lebendig macht“ bestellen. Die
Gebetsanliegen werden vom Bistum ausgearbeitet und beinhalten eine
Schriftlesung, Besinnungsfragen und Fürbitten. Jeden Monat wird ein
anderer Schwerpunkt gesetzt. So stand zum Beispiel im Dezember die
Perspektive der Evangelisierung im Mittelpunkt. Aktuell sind die
Gebetstreffen dem Anliegen der Ökumene gewidmet. Als weitere
Schwerpunkte sind unter anderem die Themen Spiritualität, Ehrenamt,
Dialog, Leitung, Anwaltschaft, weltweite Kirche und Gemeinschaft
vorgesehen.
Wer bei der Gebetskette mitmachen möchte, kann sich auf der
Internetseite des Bistums in einen Terminkalender eintragen. „Damit
erkläre ich meine Bereitschaft, mich als Einzelner oder als Gruppe
an diesem bestimmten Tag mit meinem Gebet in die bistumsweite
Gebetskette einzubringen“, verdeutlicht Liturgiereferent Clemens
Schirmer. Er ist beeindruckt, wie viele sich bereits in die Liste
eingetragen haben, und hofft, dass noch viele weitere
Einzelpersonen oder Gruppen auf den Geschmack kommen, sich in Form
der Gebetskette auf den Start des neuen Seelsorgekonzeptes
einzustimmen. is
Link zur Gebetskette des Bistums Speyer:
http://cms.bistum-speyer.de/www2/?myELEMENT=275165&mySID=03cc794b95ba9b180e2f5cc527cb42a3
12.01.2015
Attentat: Französische Protestanten reagieren mit Entsetzen und Empörung
 Stellungnahmen der französischen Kirchen bekräftigen
Solidarität mit Opfern und ihren Familien
Stellungnahmen der französischen Kirchen bekräftigen
Solidarität mit Opfern und ihren Familien
Paris/Straßburg- Mit Entsetzen und
Empörung haben die Union der Protestantischen Kirchen von Elsaß und
Lothringen (Union des Églises protestantes d’Alsace et de Lorraine)
und der Französische Protestantische Kirchenbund (Fédération
protestante de France) auf das gegen die Redaktion der
französischen Satire-Zeitung „Charlie Hebdo“ gerichtete Attentat in
Paris am 7. Januar reagiert. Frankreich befinde sich in einem
Schockzustand, erklärt der Generalsekretär der Konferenz der
Kirchen am Rhein (KKR), der pfälzische Pfarrer Rudolf Ehrmantraut,
in Straßburg.
In der von dem Präsidenten des Französischen Kirchenbundes,
François Clavairoly, unterzeichneten Stellungnahme heißt es:
„In der Stunde, da ein schreckliches Attentat in den Räumen der
Zeitung Charlie Hebdo begangen wurde, das bisher zwölf Todesopfer,
zehn Journalisten und zwei Polizeibeamte forderte, wollen wir
unsere Betroffenheit und vor allem unsere Anteilnahme und unsere
Solidarität den Opfern, ihren Familien, den ihnen nahestehenden
Personen und Freunden zum Ausdruck bringen.
Im Namen des Französischen Protestantismus bringen wir unsere
Empörung zum Ausdruck und wir verurteilen diese
verabscheuenswürdige Tat, die unsere Herzen und unser Gewissen
berührt.“ Der Kirchenbund ruft in seiner Stellungnahme in
Erinnerung „wie wertvoll menschliches Leben in den Augen Gottes
ist.“ Es gebe für eine solche Tat keine Rechtfertigung, ganz
gleich, auf welche Religion sich auch immer berufen werde. Weiter
heißt es: „Wir bringen erneut deutlich zum Ausdruck, dass die
laizistische Republik und ihre Werte, besonders die
Gewissensfreiheit, die Werte der Demokratie und die Freiheit der
Presse für uns Grundwerte unseres Zusammenlebens sind und
bleiben.“
Die interreligiöse Arbeitsgemeinschaft im Elsass, dem auch die
Union der Protestantischen Kirchen von Elsass und Lothringen
angehört, schreibt in einer offiziellen Stellungnahme:
„Die interreligiöse Arbeitsgemeinschaft im Elsass und die
Verantwortlichen der großen elsässischen Religionsgemeinschaften
(Katholiken, Protestanten, Juden und Muslime) haben mit Entsetzen
von dem widerlichen Attentat erfahren, das am Mittwoch, 7. Januar
2015, beim Sitz der Zeitung Charlie Hebdo das Leben mehrerer
Personen kostete. Sie bringen ihre umfängliche Solidarität mit
allen bei diesem Attentat betroffenen Personen zum Ausdruck. Sie
ehren das Gedenken der Toten und versichern den Familien, die
Trauer tragen, ihre tiefe Anteilnahme. Sie bringen ihre totale
Verurteilung dieser Tat, die durch nichts gerechtfertigt werden
kann, zum Ausdruck. Sie laden die Mitglieder der
Religionsgemeinschaften ein, äußerste Wachsamkeit walten zu lassen,
um aller Gewalt entgegenzutreten und den republikanischen
Bürgersinn, die vollständige Achtung jeder Person und die
Brüderlichkeit zu befördern.“
Evangelischen Kirche der Pfalz, Presse
08.01.2015
Seelsorge bedeutet Nähe zu den Menschen
 Pfarrer Peter
Annweiler kehrt als Telefonseelsorger in die Pfalz
zurück
Pfarrer Peter
Annweiler kehrt als Telefonseelsorger in die Pfalz
zurück
Kaiserslautern- Nach mehr als sieben
Jahren als Citykirchen-Pfarrer in Mannheim und Schifferseelsorger
kehrt Peter Annweiler an seinen früheren Wirkungsort Kaiserslautern
zurück. Zum 1. Februar 2015 übernimmt der Pfälzer Pfarrer dort auf
evangelischer Seite die Leitung der ökumenischen Telefonseelsorge
Pfalz. Telefonseelsorge sei ein wichtiger Bereich christlicher
Arbeit und „ein Fenster zur Welt“, sagt der 52-Jährige. Während
seiner Tätigkeit an der Kaiserslauterer Apostelkirche habe er
gelernt, über den Tellerrand der eigenen Gemeinde hinauszublicken.
„Die verfasste Kirche darf nicht nur in Gemeindestrukturen denken.
Meiner Erfahrung nach bieten gerade Seelsorge und Diakonie direkte
Anknüpfungspunkte an das Leben der Menschen.“
Noch vor der ersten Pfarrstelle hat Annweiler in New York eine
pastoralpsychologische Ausbildung in klinischer Seelsorge
absolviert und das dort erworbene Wissen in Kaiserslautern in die
Praxis umgesetzt. Unter anderem war er im Kaiserslauterer
Hospizverein tätig und am Aufbau der dortigen Notfallseelsorge
beteiligt. „Seelsorge ist der rote Faden in meinem pastoralen
Wirken. In der Seelsorge pflegen Mitarbeiter eine besondere Nähe zu
den Menschen. In ihr bleibt die „Muttersprache der Kirche“ wirksam
und erkennbar.“ Seine seelsorgerischen Kompetenzen vertieft
Annweiler durch eine Weiterbildung in systemischer Beratung.
Bereits als Citykirchen-Pfarrer und Schifferseelsorger in
Mannheim habe er auf sein zuvor erworbenes und angewandtes Wissen
zurückgreifen können. „Kirche in der Stadt steht vor der besonderen
Herausforderung, zu Begegnungen anzustiften“, führt der Theologe
aus. Sein Motto: „Menschen zusammenbringen, die sonst nicht
zusammen kämen.“ Gerade in Mannheim seien daher Diakonie, Kultur
und besonders der interreligiöse Dialog wichtige kirchliche
Arbeitsfelder. Kirche könne nur dort stark und glaubhaft bleiben,
wo sie auch Brückenschläge zwischen Milieus fördere.
Auch in Mannheim engagierte sich Annweiler in der
Notfallseelsorge. Zudem habe er die Begegnung mit Künstlern und
Kunst als für die Gemeindearbeit sehr bereichernd erfahren.
„Moderne Kunst stellt oft die Sinnfrage und ist mit ihren
Ausdrucksformen eine Bereicherung für die Zeitgenossenschaft des
Protestantismus“, erklärt der Seelsorger.
Nun freut sich Annweiler, mit neuem Arbeitsfeld an seine alte
Wirkstätte zurückzukehren. „Die
Telefonseelsorge ist ganz nah dran am Menschen. Anonym können
Anrufer über ihre Nöte und Ängste sprechen“, erklärt der
Seelsorger. Eine Herausforderung erkennt Annweiler in der
medial-vernetzten Kommunikation. Neben der klassischen
Telefonseelsorge bestehe auch die Möglichkeit, per E-Mail oder in
einem Chat Beratung zu erhalten. „Solche niedrigschwelligen
Angebote können die Face-to-Face-Beratung selbstverständlich
nicht ersetzen, sind aber eine wichtige Ergänzung“, führt der
Theologe aus. Auch die Kirchen der Reformationszeit hätten „neue
Medien“ genutzt. „Allerdings muss man die Grenzen kennen und die
Medien sinnvoll und fachgerecht nutzen.“
Text: lk; Foto: privat
08.01.2015
„Kirche ist nicht Selbstzweck, sondern Werkzeug des Heils“
 Pontifikalamt
zum Fest der Erscheinung des Herrn im Speyerer Dom / Empfang im
Friedrich-Spee-Haus für Mitarbeiter von Ordinariat und
Caritasverband
Pontifikalamt
zum Fest der Erscheinung des Herrn im Speyerer Dom / Empfang im
Friedrich-Spee-Haus für Mitarbeiter von Ordinariat und
Caritasverband
Speyer- „Die Kirche darf nicht um sich
selbst kreisen. Sie ist Werkzeug in der Hand Gottes, um sein Heil
allen Menschen zuzuwenden.“ Das sagte Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann beim Pontifikalamt zum „Fest der Erscheinung des Herrn“
am 6. Januar im Speyerer Dom. Das „Licht der Welt“ sei Christus
selbst, betonte er mit Hinweis auf das Zweite Vatikanische Konzil.
Die Kirche habe die Aufgabe, dieses Licht widerzuspiegeln und es
„hell leuchten zu lassen für die Welt“.
Das Fest Epiphanie rufe den einzelnen Gläubigen und die Kirche
dazu auf, sich immer wieder auf den Weg zu machen, um „Christus neu
zu entdecken und aus der Begegnung mit ihm Kraft und Freude für
ihren Auftrag in der Welt zu schöpfen.“ Ein Aufbruch sei möglich,
wo sich Christen als Empfangende und Dienende begreifen. Das Jahr
2015 nannte der Bischof ein „entscheidendes Jahr für die pastorale
Erneuerung des Bistums Speyer“. Im Blick auf das neue
Seelsorgekonzept des Bistums unterstrich er die wachsende Bedeutung
der Aufgabe, das Leben im Licht des Evangeliums zu deuten. Zugleich
mahnten die Perspektiven der Anwaltschaft und der Weltkirche zur
Offenheit für andere. „Jedem Mensch kommt die unverlierbare Würde
der Kinder Gottes zu. Wir bezeugen Christus als den Heiland aller
Welt, also nicht nur unserer Diözese oder Pfarrei.“
 Bischof Wiesemann zelebrierte den Gottesdienst am
Dreikönigstag gemeinsam mit Weihbischof Otto Georgens, Generalvikar
Dr. Franz Vogelgesang, Domkapitular Franz Vogelgesang und
Dompfarrer Matthias Bender. Sternsinger aus der Dompfarrei brachten
dem Dom ihren Segen. Die Dommusik gestaltete die Liturgie mit
Kantorengesängen, die Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub.
Bischof Wiesemann zelebrierte den Gottesdienst am
Dreikönigstag gemeinsam mit Weihbischof Otto Georgens, Generalvikar
Dr. Franz Vogelgesang, Domkapitular Franz Vogelgesang und
Dompfarrer Matthias Bender. Sternsinger aus der Dompfarrei brachten
dem Dom ihren Segen. Die Dommusik gestaltete die Liturgie mit
Kantorengesängen, die Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub.
Generalvikar: Selbstbewusst für den Glauben in der Zeit des
Umbruchs eintreten
 Beim anschließenden Empfang für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats und des Caritasverbandes
im Friedrich-Spee-Haus ging Generalvikar Dr. Franz Jung auf den
„Krippenstreit“ ein, der sich vor Weihnachten in Frankreich
abgespielt hatte. Die Vereinigung der Freidenker hatte unter
Hinweis auf den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat
erzwingen wollen, dass im öffentlichen Raum keine Weihnachtskrippen
mehr aufgestellt werden dürfen. Der Bürgermeister von Castres bei
Toulouse hatte den Freidenkern in einem öffentlichen Brief Paroli
geboten. „Die Krippe ist auch ein Zeichen der Hoffnung für alle,
die ohne Obdach sind.“ Sie stehe zugleich für einen arabischen,
einen afrikanischen und einen asiatischen König, die sich bei einem
Juden einfinden. „Ein hoffnungsfrohes Zeichen des Friedens in
Zeiten, wo Zivilisationen aufeinander prallen und im Nahen Osten
ein furchtbarer Konflikt tobt“, zitierte der Generalvikar aus dem
öffentlichen Schreiben des Bürgermeisters.
Beim anschließenden Empfang für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats und des Caritasverbandes
im Friedrich-Spee-Haus ging Generalvikar Dr. Franz Jung auf den
„Krippenstreit“ ein, der sich vor Weihnachten in Frankreich
abgespielt hatte. Die Vereinigung der Freidenker hatte unter
Hinweis auf den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat
erzwingen wollen, dass im öffentlichen Raum keine Weihnachtskrippen
mehr aufgestellt werden dürfen. Der Bürgermeister von Castres bei
Toulouse hatte den Freidenkern in einem öffentlichen Brief Paroli
geboten. „Die Krippe ist auch ein Zeichen der Hoffnung für alle,
die ohne Obdach sind.“ Sie stehe zugleich für einen arabischen,
einen afrikanischen und einen asiatischen König, die sich bei einem
Juden einfinden. „Ein hoffnungsfrohes Zeichen des Friedens in
Zeiten, wo Zivilisationen aufeinander prallen und im Nahen Osten
ein furchtbarer Konflikt tobt“, zitierte der Generalvikar aus dem
öffentlichen Schreiben des Bürgermeisters.
Das Beispiel zeige, wie man heute selbstbewusst und mit einer
gehörigen Portion Humor für den Glauben eintreten könne. Für die
Verständigung mit einer zunehmend säkularisierten Welt brauche man
eine andere Sprache als für fromme Insider. „Wir brauchen uns als
Christen nicht zu verstecken, sondern können – ohne verletzend oder
hochmütig zu sein – jedem Rede und Antwort stehen.“ Wenn dabei noch
die Freude am Glauben spürbar werde, so „sind wir auf einem guten
Weg zu „Gemeindepastoral 2015“, so der Generalvikar. Text und
Foto: is
07.01.2015
Protestmarsch für Kinderrechte eröffnet Sternsingeraktion im Bistum Speyer
-01.jpg) Jugendministerin Irene Alt und Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann unterstützen Forderungen der
Sternsinger
Jugendministerin Irene Alt und Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann unterstützen Forderungen der
Sternsinger
Speyer- Mit einem Marsch für
Kinderrechte wurde heute die Sternsingeraktion im Bistum Speyer
eröffnet. Etwa vierhundert Kinder und Jugendliche mit bunten
Gewändern und Kronen waren unterwegs zwischen Dom und Altpörtel und
warben lautstark und mit Plakaten für die Rechte der Kinder. Vorab
hatten die Sternsingergruppen im Forum des Historischen Museums der
Pfalz Plakate und Rufe vorbereitet, sich über das diesjährige
Schwerpunktland der Aktion, die Philippinen informiert und
gemeinsam den Marsch vorbereitet.
-01.jpg) Der Protestmarsch der kleinen und großen Könige wurde
prominent unterstützt von Kinder- und Jugendministerin Irene Alt.
Er endete mit einer Kundgebung am Altpörtel. Auf der Bühne machte
Sternsingerkönig Jonas aus Erfweiler-Ehlingen
deutlich, was sich hinter der Forderung nach besserer
Ernährung für Kinder weltweit konkret verbirgt. Der Elfjährige ist
überzeugt: "Wenn man immer Hunger haben muss, kann man nicht groß
werden". Im Gespräch mit Christoph Fuhrbach (Referent für
weltkirchliche Aufgaben) und Felix Goldinger (Diözesanvorstand des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Speyer)
unterstützte auch die zwöfjährige Kim aus
Schifferstadt die Forderungen der Sternsinger: "Ohne Bildung
gibt es kein Geld, keine Arbeit und keine Chancen auf eine gute
Zukunft". Ministerin Alt freute sich über den Einsatz der Kinder
und Jugendlichen. In ihren Grußwort betonte sie: "Gesunde Ernährung
ist leider nach wie vor nicht selbstverständlich. In aller Welt –
auch bei uns in Deutschland – gibt es Kinder, die nicht einmal
jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Ich freue mich, dass die
Sternsinger-Aktion auf das Kinderrecht hinweisen, das besagt, dass
Kinder das Recht auf Gesundheit haben – hierzu gehört auch eine
gesunde Ernährung."
Der Protestmarsch der kleinen und großen Könige wurde
prominent unterstützt von Kinder- und Jugendministerin Irene Alt.
Er endete mit einer Kundgebung am Altpörtel. Auf der Bühne machte
Sternsingerkönig Jonas aus Erfweiler-Ehlingen
deutlich, was sich hinter der Forderung nach besserer
Ernährung für Kinder weltweit konkret verbirgt. Der Elfjährige ist
überzeugt: "Wenn man immer Hunger haben muss, kann man nicht groß
werden". Im Gespräch mit Christoph Fuhrbach (Referent für
weltkirchliche Aufgaben) und Felix Goldinger (Diözesanvorstand des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Speyer)
unterstützte auch die zwöfjährige Kim aus
Schifferstadt die Forderungen der Sternsinger: "Ohne Bildung
gibt es kein Geld, keine Arbeit und keine Chancen auf eine gute
Zukunft". Ministerin Alt freute sich über den Einsatz der Kinder
und Jugendlichen. In ihren Grußwort betonte sie: "Gesunde Ernährung
ist leider nach wie vor nicht selbstverständlich. In aller Welt –
auch bei uns in Deutschland – gibt es Kinder, die nicht einmal
jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Ich freue mich, dass die
Sternsinger-Aktion auf das Kinderrecht hinweisen, das besagt, dass
Kinder das Recht auf Gesundheit haben – hierzu gehört auch eine
gesunde Ernährung."
-01.jpg) Bischof Wiesemann eröffnete noch am Altpörtel den
Gottesdienst, der mit einem Schweigemarsch zurück in den Dom
begann. Hier segnete der Bischof die Sternsinger und ihr Tun
und gab damit offiziell den Startschuss für die Sternsingeraktion
2015. Die Könige nahmen neben dem bischöflichen Segen auch dessen
Dank entgegen. In seiner Predigt sagte Wiesemann: "Ihr habt
gesehen, dass es Kinder gibt, die jemanden brauchen, der für sie
die Stimme erhebt. Das habt ihr getan. Ich finde es toll, dass ihr
euch für die Rechte von Kindern einsetzt! Dafür möchte ich
euch Danke sagen."
Bischof Wiesemann eröffnete noch am Altpörtel den
Gottesdienst, der mit einem Schweigemarsch zurück in den Dom
begann. Hier segnete der Bischof die Sternsinger und ihr Tun
und gab damit offiziell den Startschuss für die Sternsingeraktion
2015. Die Könige nahmen neben dem bischöflichen Segen auch dessen
Dank entgegen. In seiner Predigt sagte Wiesemann: "Ihr habt
gesehen, dass es Kinder gibt, die jemanden brauchen, der für sie
die Stimme erhebt. Das habt ihr getan. Ich finde es toll, dass ihr
euch für die Rechte von Kindern einsetzt! Dafür möchte ich
euch Danke sagen."
Im Bistum Speyer sind jährlich etwa 8.000 bis
10.000 Kinder und Jugendliche in den Pfarreien
unterwegs. Träger der Aktion ist das Kindermissionswerk in
Kooperation mit dem Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
und dem Referat Weltkirche des Bischöflichen Ordinariates
Speyer. Die Sternsingeraktion hat in den letzten Jahren
im Bistum Speyer jährlich etwa 1,3 Mio. Euro für Kinder
und Jugendliche weltweit erbracht. Unterstützt werden durch die
Sternsingeraktion insgesamt ca. 2.400 Projekte in mehr als 100
Ländern.
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) Speyer ist Dachverband für sieben katholische Kinder-und
Jugendverbände. Er vertritt die Anliegen von ca. 8.500 Kindern und
Jugendlichen im Bistum Speyer.
Weitere Informationen zur unserer Kinder- und
Jugendverbandsarbeit: www.bdkj-speyer.de.
Text und Foto: BDKJ Speyer
06.01.2015
Pfarrer Rudolf Gieser verstorben
Speyer- Am 31. Dezember ist Pfarrer im
Ruhestand Rudolf Gieser im Alter von 84 Jahren verstorben.
In Ludwigshafen geboren, wurde er 1955 zum Priester geweiht. Er
wirkte als Kaplan in Neustadt, Rheinzabern, Speyer, Kusel und
Zweibrücken und als Kurat in Elschbach. 1970 wurde ihm als Pfarrer
die Leitung der Pfarrei St. Jakobus in Schifferstadt übertragen. Ab
1984 war Pfarrer Gieser zugleich Leiter des Pfarrverbandes
Schifferstadt. Er trat im Jahr 1975 in den Ruhestand.
Das Totenoffizium und Requiem finden am Donnerstag (8. Januar)
um 12 Uhr in der Pfarrkirche St. Sebastian in
Ludwigshafen-Mundenheim statt. Um 14 Uhr erfolgt die Beisetzung auf
dem Mundenheimer Friedhof. is
05.01.2015
Den Anderen kennenlernen
 Arbeitskreis Kirche und Judentum im Gespräch mit der
jüdischen Kultusgemeinde
Arbeitskreis Kirche und Judentum im Gespräch mit der
jüdischen Kultusgemeinde
Kaiserslautern / Speyer- Vor
den Gefahren einer zunehmenden Judenfeindschaft in der
Bundesrepublik haben Vertreter des protestantischen Arbeitskreises
„Kirche und Judentum“ und der jüdischen Kultusgemeinde in
Kaiserslautern gewarnt. Bei einem Treffen im jüdischen
Gemeindezentrum betonte Oberkirchenrat Manfred Sutter,
Antisemitismus sei weder in der Kirche noch in der
Zivilgesellschaft zu dulden. Er erinnerte an die Erweiterung der
Kirchenverfassung aus dem Jahr 1995, nach der die Landeskirche „zur
Umkehr gerufen, die Versöhnung mit dem jüdischen Volk sucht
und jeder Form von Judenfeindschaft entgegentritt.“
Arbeitskreisvorsitzender Stefan Meißner erklärte,
dass viele Ressentiments darauf beruhten, „dass man den anderen
nicht kennt. Dem wollen wir mit unserer Arbeit entgegen wirken“.
Vorstandsmitglied Larissa Jantzewitsch und der Geschäftsführer der
jüdischen Kultusgemeinde, Daniel Nemirovsky berichteten von
Sachbeschädigungen zum Beispiel am Gemeindezentrum in
Kaiserslautern. Auch sei es derzeit nicht ratsam, mit der Kippa,
der klassischen jüdischen Kopfbedeckung, auf die Straße zu
gehen.
Zu den Herausforderungen der kommenden Jahre gehört
nach Angaben der Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde intern die
Integration von Zuwanderern aus Osteuropa. Dabei sei eine
Verschiebung des theologischen Spektrums in Richtung
(Neu-)Orthodoxie festzustellen, die sich u.a. in der
Frauenfrage manifestiere. Dies bedeute unter anderem: Frauen nehmen
im Gottesdienst keine aktive Rolle ein, in der Synagoge sitzen
Männer und Frauen getrennt; eine Frau kann nicht zur Rabbinerin
ordiniert werden. Die Gemeinden in der Rheinpfalz verstünden sich
weiterhin als Einheitsgemeinden, die sich durch eine gewisse
Vielfalt religiöser Ausrichtungen auszeichneten, sagten die
Vertreter der jüdischen Kultusgemeinde.
Die Vertreter der Landeskirche und der
Kultusgemeinde sehen sich als Institution vor ähnlichen
Entwicklungen. Beide seien betroffen vom demografischen
Faktor, der viele Gemeinden schrumpfen lasse, sagten Sutter und
Nemirovsky. Auch sei auf beiden Seiten die Tendenz zu beobachten,
dass zahlreiche Gemeindemitglieder Gottesdienste nur an ganz
bestimmten hohen Feiertagen besuchen würden: „Bei uns gibt es
Chanukkajuden, so wie bei Ihnen Weihnachtschristen“, bemerkt
Nemirovsky ironisch.
Text und Foto: lk
03.01.2015
Landeskirche stellt Teile der Arbeit in den sozialen Netzwerken ein
 v.l.: Alexander Ebel und Mechthild Werner mit dem Internetbeauftragten der Evangelischen Kirche im Rheinland, Ralf Peter Reimann.
v.l.: Alexander Ebel und Mechthild Werner mit dem Internetbeauftragten der Evangelischen Kirche im Rheinland, Ralf Peter Reimann.
Letzter Webtagebuch-Eintrag zum Jahresende –
Regelmäßigkeit nicht mehr gewährleistet
Speyer- Die Evangelische Kirche der Pfalz
reduziert ihre Social-Media-Aktivitäten und stellt zum Jahresende
ihr wöchentlich erscheinendes Blog ein. Das hat das
Öffentlichkeitsreferat der Landeskirche in Speyer mitgeteilt. „Da
soziale Medien Teile der realen Welt sind und aus lebendigen
Menschen bestehen, brauchen wir personelle Ressourcen, die uns
nicht mehr zur Verfügung stehen“, erklärte der
Öffentlichkeitsreferent der Landeskirche, Kirchenrat Wolfgang
Schumacher.
Mit dem Blog, dem Webtagebuch, verzichte die Landeskirche
schweren Herzens auf ein Format, das die Nutzer zum Gespräch über
Glaube, Kirche und persönliche Fragen eingeladen hatte und nicht
nur junge Leute zueinander gebracht habe, sagte Schumacher. Durch
das Blog habe man die Räume der Kommunikation erweitert und die
Möglichkeit geschaffen, mit Menschen, die mit dem Internet
aufgewachsen seien, über religiöse und seelsorgerliche Fragen zu
diskutieren.
Mit Pfarrerin Mechthild Werner und Pfarrer Alexander Ebel habe
die Landeskirche seit dem Reformationstag 2011 regelmäßig „Gesicht
gezeigt“. Das Blog sei kein „Verlautbarungsorgan“ gewesen, sondern
Ort persönlicher Geschichten und Einschätzungen der Blogautoren.
Nachdem beide „Social-Media-Pfarrer“ andere Aufgaben übernommen
hätten, sei die für eine persönliche Kommunikation erforderliche
„Verlässlichkeit und Regelmäßigkeit“ nicht mehr gewährleistet
gewesen, erläuterte der
Öffentlichkeitsreferent.
Der Versuch, das freitägliche Webtagebuch auf die Schultern von
insgesamt fünf Bloggern zu verteilen, habe sich nach Ansicht der
Beteiligten nicht bewährt. Zwar seien die Abrufzahlen im Großen und
Ganzen auf dem gleichen Niveau von monatlich 2000-2500
Seitenaufrufen geblieben, die Kommentardebatten dagegen deutlich
zurückgegangen. „Der beste Teamwille genügt nicht, wenn Redaktion
und thematische Absprachen mangels Zeit und koordinierender Person
auf der Strecke bleiben“, sagt Pfarrer Alexander Ebel, der auch der
Initiator der landeskirchlichen Social-Media-Arbeit ist.
Der vorläufig letzte Blogbeitrag ist unter http://blog.evkirchepfalz.de/
zu lesen. Dort finden sich auch die „beliebtesten“ Texte der
vergangenen drei Jahre. Text und Foto: lk
02.01.2015
Grundvertrauen ist Kapital der Gesellschaft
 Bischof Wiesemann hält Pontifikalamt zum
Jahresabschluss
Bischof Wiesemann hält Pontifikalamt zum
Jahresabschluss
Speyer- Mit einem Appell, ein neues
Grundvertrauen in der Gesellschaft zu schaffen, verband Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann am letzten Nachmittag des Jahres seinen Dank
an den Herrgott, der die Menschen durch die vergangenen zwölf
Monate geleitet hat. Voll besetzt war der Dom beim Pontifikalamt
zum Jahresabschluss, der sowohl in Wort als auch Gesang den
Gläubigen wichtige Botschaften mit auf den Weg gab.
Die Frage, wie ein kleines Kind in Windeln der Retter der
Menschheit sein kann – wie in dem berühmten weihnachtlichen
Kirchenlied „Stille Nacht“ beschrieben – beschäftigte Wiesemann in
seiner Predigt. Die Ratlosigkeit, mit der viele vor diesem Phänomen
stehen, machte er fest an dem Zwiespalt, in dem die Menschen
stecken. Auf der einen Seite stehe die vom Herzen kommende
Ergriffenheit des geborenen Christkinds wegen, auf der anderen
nehme der Verstand Bilder von der Welt wahr, die nichts mit
friedlichem Glanz zu tun haben.
Die Ukraine und die Krim nannte Wiesemann als Beispiele für das
Wiederaufkeimen eines Kalten Krieges, seinen Blick richtete er auf
die Millionen Flüchtlinge, die ihre Heimat unfreiwillig verlassen
müssen und in der Fremde anbranden und der Bischof sprach die frei
zugänglichen Bilder von Darstellungen verschiedenster Grausamkeiten
im Internet an, die alles bisher da gewesene überschreiten.
„Wir spüren die Erschütterung und Verunsicherung, die in die
Gesellschaft eindringt, etwa die Angst vor einer vermeintlichen
‚Islamisierung‘ unseres in der Wurzel christlichen Abendlandes“,
wusste er die Befürchtungen der Menschen in Worte zu fassen. Der
Umgang mit dieser Furcht sei gerade in der jetzigen Zeit von nicht
zu unterschätzender Bedeutung. „Wir brauchen ein Grundvertrauen in
die Gerechtigkeit und die Sicherheit des Lebens“, stellte Wiesemann
heraus. Verlassen können sollten sich alle auf das Miteinander, in
dem die Freiheit und Verantwortung nicht gegeneinander ausgespielt
würden und der eine nicht einfach zu Lasten der Gesamtheit leben
oder rücksichtslos handeln könne. Es brauche ein Grundvertrauen in
die Ehrlichkeit und die Gewissenhaftigkeit vor allem derer, die
Macht über andere ausübten, ein Grundvertrauen in die
Unbestechlichkeit der entscheidenden politischen, wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Akteure. „Das eigentliche Kapital einer
Gesellschaft“, machte der Bischof deutlich, „ist das Vertrauen.
Alle anderen Werte sind sonst schnell verspielt.“
Aus der Geschichte lernen und Lehren ziehen könnten die Menschen
beispielsweise aus den Ereignissen in Bosnien-Herzegowina, wo
jahrhundertelang Gläubige verschiedener Konfessionen friedlich
nebeneinander lebten, bis nur wenige Agitatoren reichten, um Krieg
zwischen ihnen anzustiften. Ähnliches, ergänzte Wiesemann, geschehe
heute im Irak und anderen Orten der Welt, weshalb er zu bedenken
gab: „Wir müssen aufpassen, dass die Stimme des kleinen Mannes
nicht von den Falschen missbraucht wird.“
Einen größeren breiteren Dialog in der Gesellschaft müsse es
geben über die geistigen, moralische und sozialen Werte und Ziele,
die die Menschheit bewegten. „Hierin liegt eine wichtige Aufgabe
für das Jahr 2015“, forderte der Bischof die Gläubigen dazu auf,
sich der Herausforderung zu stellen. Denn: „Ohne gegenseitiges
Vertrauen, das aber die Anerkennung der Unantastbarkeit der Würde
eines jeden einzelnen gleich welcher Herkunft, Religion oder
Weltanschauung voraussetzt, kann die gemeinsame Zukunft nicht
gelingen.“
 „Wir haben tiefste Hochachtung vor allen Menschen,
gleichwelcher Religion und Abstammung, die sich nicht brechen
lassen durch Gewalt und Hass. Dass das überhaupt möglich ist, das
ist für mich das Wunder des Glaubens. Hier zeigt sich, dem
einzelnen bewusst oder nicht, das Wirken des Geistes Gottes in
unserer Welt“, erklärte Wiesemann.
„Wir haben tiefste Hochachtung vor allen Menschen,
gleichwelcher Religion und Abstammung, die sich nicht brechen
lassen durch Gewalt und Hass. Dass das überhaupt möglich ist, das
ist für mich das Wunder des Glaubens. Hier zeigt sich, dem
einzelnen bewusst oder nicht, das Wirken des Geistes Gottes in
unserer Welt“, erklärte Wiesemann.
Gott habe sich nicht gescheut, Mensch zu werden – „ein hilfloses
Kind und ein gewaltloser Mann.“ Er habe damit der Welt ein
Gegenmittel gegen das schleichende Gift der Angst gegeben, ein
Gift, „das uns so unglaublich entstellen kann, dass wir das
Kostbarste in uns vergessen oder gar verlieren: unsere
Menschlichkeit, unsere Fähigkeit zur Liebe.“
„Wir wissen“, fasste Wiesemann zusammen, „dass das Vertrauen der
einzige Weg ist, damit sich das Leben nicht selbst zerstört.“ Die
Gottesmutter Maria sei der Inbegriff eines Menschen, „der aus dem
Zutrauen Gottes lebt und Ja sagt.“
Verstärkt wurde der Aufruf des Bischofs durch den Inhalt der
Fürbitten, in denen um die Kraft zum Verzeihen und Versöhnen, den
Schutz in Gefahr und um Zuflucht gebetet wurde. Die glanzvolle
klingende Note verliehen den Botschaften neben Domorganist Markus
Eichenlaub und den Dombläsern der Mädchenchor am Dom, die Speyerer
Domsingknaben sowie der Domchor unter der Leitung von Kantor
Alexander Lauer und Domkapellmeister Markus Melchiori. Text und
Fotos: Susanne Kühner
01.01.2015
Gemeinsames Wort der Kirchen zum 75. Jahrestag der Deportation nach Gurs am 22. Oktober 1940
 Wenn wir in diesem Jahr der Deportation jüdischer
Mitmenschen nach Gurs vor 75 Jahren gedenken, dann tun wir dies
nicht nur, um die Erinnerung an diese schrecklichen Geschehnisse
wach zu halten, sondern auch um dafür zu sensibilisieren, dass
solche Gräueltaten nie wieder geschehen dürfen. Gerade auch die
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Blick in andere
Länder fordern uns heraus, uns zu Wort zu melden, wenn die Würde
des Menschen angetastet oder gar mit Füßen getreten wird.
Wenn wir in diesem Jahr der Deportation jüdischer
Mitmenschen nach Gurs vor 75 Jahren gedenken, dann tun wir dies
nicht nur, um die Erinnerung an diese schrecklichen Geschehnisse
wach zu halten, sondern auch um dafür zu sensibilisieren, dass
solche Gräueltaten nie wieder geschehen dürfen. Gerade auch die
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Blick in andere
Länder fordern uns heraus, uns zu Wort zu melden, wenn die Würde
des Menschen angetastet oder gar mit Füßen getreten wird.
Am frühen Morgen des 22. und 23.Oktober 1940 wurden über 6.500
badische, pfälzische und saarländische Juden und Christen jüdischer
Abstammung von den Nazis festgenommen, in Züge verfrachtet und in
das Internierungslager Gurs am Fuße der südfranzösischen Pyrenäen
verschleppt. Dieser Ort wurde so für die jüdischen Mitmenschen aus
unseren Städten und Gemeinden für Alte, Kranke, Männer, Frauen,
Kinder und Babys zum Ort des Verderbens.
Mit dieser verbrecherischen Aktion wurde das jüdische Leben in
Baden, der Pfalz und im Saarland langfristig und grundlegend
zerstört, Mitbürgerinnen und Mitbürger ihrer Heimat beraubt.
Was damals geschah, vollzog sich vor aller Augen. Als die
Gauleiter Badens und der Saarpfalz ihre Gaue stolz als „judenrein“
meldeten, erhoben sich kein Sturm der Entrüstung und kein
wahrnehmbarer Protest. „Der Abtransport ging in aller Ordnung vor
sich“, so notierte lapidar der Freiburger Polizeibericht. Längst
hatte sich angebahnt, was dann bei der berüchtigten
Wannsee-Konferenz 1942 auf den Begriff der Endlösung gebracht
wurde. Für Tausende jüdischer Menschen endete ihr Leidensweg nach
Gurs schließlich in Zügen in die Vernichtungslager von Majdanek,
Sobibor oder Auschwitz.
Die Schwestern und Brüder des jüdischen Gottesvolkes feierten in
jenen Tagen, in denen sie die Deportation erleiden mussten, das
Laubhüttenfest: die Bewahrung des Volkes Israels auf seinem Zug
durch die Wüste, aus der Knechtschaft ins Land der Verheißung. Doch
die Oktobertage des Jahres 1940 verkehrten diesen jüdischen
Freiheitszug in einen Trauermarsch der Diffamierten und
Entrechteten.
Anlässlich des diesjährigen Jahrestages der Deportation erkennen
und bekennen wir: Kirchen und Christenmenschen haben zur Bedrohung
und Vernichtung jüdischen Lebens in der deutschen Geschichte allzu
oft geschwiegen oder sie gar befördert. Auch vor 75 Jahren war das
nicht anders. Tatenlos standen die Kirchen dem Geschehen gegenüber,
wo entschlossenes Handeln gefragt gewesen wäre; sprachlos dort, wo
der Aufschrei der Kirchen hätte hörbar werden müssen.
Im Gedenken an die Opfer bekennen wir heute ohne Wenn und Aber
unsere Schuld.
In ökumenischer Verbundenheit suchen wir heute Wege, um unsere
Beziehung zu Israel und zum Judentum zu erneuern. Dabei trägt uns
die Einsicht in die unverbrüchliche Geltung des Bundes Gottes mit
seinem Volk. Die Kirchen, die zu „Gurs“ geschwiegen haben, erheben
heute ihre Stimme gegen Antisemitismus und Rassismus, treten ein
für die Rechte anderer und rufen auf zu politischer Wachsamkeit und
Zivilcourage.
Unsere Kirchen in der Pfalz und in Baden begrüßen und fördern
nach Kräften Initiativen und Einrichtungen, die sich der
Neugestaltung des Verhältnisses von Judentum und Christentum widmen
und Begegnungen zwischen jüdischen und christlichen Menschen
ermöglichen.
Sie unterstützen die Bemühungen aller Menschen guten Willens,
das menschenverachtende Geschehen von Gurs nicht dem Vergessen zu
überlassen. Hoffnungsvoll blicken wir auf die Bereitschaft vieler
junger Menschen, das Wahrnehmen und Aufarbeiten der Schuld in der
Vergangenheit mit einem Erinnern zu verbinden, das auch die
Gegenwart und die Zukunft Israels und des Judentums im Blick hat.
Dafür steht als Beispiel das Ökumenische Jugendprojekt Mahnmal in
Neckarzimmern.
Möge das Gedenken an „Gurs“ im Jahre 2015 ein weiterer
Meilenstein auf dem Weg zu gegenseitiger Achtung, zu Respekt und
Geschwisterlichkeit zwischen jüdischen und christlichen Menschen
werden. Möge der Wunsch aus Psalm 122 in Erfüllung gehen: Friede
wohne in deinen Mauern, in deinen Häusern Geborgenheit.
Landesbischof Prof. Dr. Jochen Cornelius-Bundschuh
Evangelische Landeskirche in Baden
Erzbischof Stephan Burger Erzdiözese Freiburg
Kirchenpräsident Christian Schad Evangelische Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche)
Bischof Dr.Karl-Heinz Wiesemann Diözese Speyer
24.10.2015
Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs verabschiedet - Bilderalbum
Frühgeschichte von Stadt und Bistum Speyer
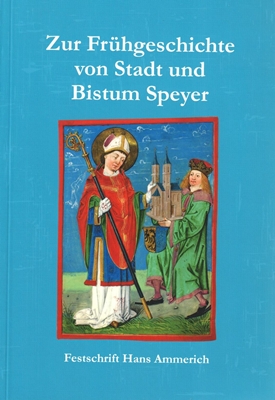 Festschrift zu Ehren Professor Hans Ammerichs erschienen –
35 Jahre Leiter des Bistumsarchivs
Festschrift zu Ehren Professor Hans Ammerichs erschienen –
35 Jahre Leiter des Bistumsarchivs
Speyer- Die „Frühgeschichte von Stadt und
Bistum Speyer“ steht im Fokus des jetzt im Pilger-Verlag
erschienenen Bandes 49 der Schriftenreihe des Diözesan-Archivs
Speyer. Das 148 Seiten starke Buch ist dem ehemaligen Leiter des
kirchlichen Archivs, Professor Dr. Hans Ammerich, gewidmet, der
sich als Archivar und Historiker große Verdienste weit über die
Grenzen der Pfalz hinaus erworben hat.
Aus Anlass der Verabschiedung Ammerichs in den Ruhestand ehrten
die Pfälzische Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften und
die Abteilung Kulturelles Erbe (Stadtarchiv) Speyer den gebürtigen
Zweibrücker 2014 mit einer wissenschaftlichen Tagung, die auf große
Resonanz stieß. Eine Drucklegung der Vorträge über den Namensgeber
sowie die Überreste des frühmittelalterlichen Klosters St. German,
das sich auf dem Gelände des heutigen Priesterseminars befand, war
zunächst nicht vorgesehen. Doch auf vielfachen Wunsch können die
Referate jetzt nachgelesen werden.
Mit der Biografie des heiligen German, der im fünften
Jahrhundert als Bischof von Auxerre wirkte, befassen sich Professor
Dr. Hans Hattenhauer (Speyer) sowie Dr. Richard Antoni (Rodalben).
Weshalb und wann German zum Patron des Speyerer Klosters gewählt
wurde, ist nicht bekannt. Aufgrund der Interpretation der
Heiligenvita machen die beiden Historiker jedoch deutlich, dass der
hoch gebildete, ehemalige römische Staatsbeamte in der „wild
bewegten“ Epoche der Völkerwanderung einer der bedeutendsten
Bischöfe Galliens war.
Um die archäologischen Befunde zur Entstehung der Kirche St.
German auf dem Germansberg im heutigen Süden von Speyer geht es in
dem Beitrag von Dr. Sven Gütermann (Busenberg). Die Grabungen der
Jahre 1946/47 sind zum einen entscheidend für die Beantwortung der
Frage nach der Kontinuität der Stadt Speyer von der Spätantike zum
Frühmittelalter, zum anderen von großer Bedeutung für das frühe
Christentum in der Diözese Speyer. Über die Einordnung der Befunde
wird in der Forschung nach wie vor kontrovers diskutiert. Gütermann
informiert über die wissenschaftliche Debatte und macht einen
Vorschlag zu einer Neuinterpretation.
An die Blüte der Domschule von Speyer um das Jahr 1000 erinnert
der Heidelberger Professor Dr. Walter Berschin. Neben den beiden
Bischöfen Balderich und Walther würdigt der Experte für die
lateinische Philologie des Mittelalters den Speyerer Domkapitular
Onulf und dessen kunstvolles Lehrbuch „Colores rhetorici“
(Redefarben). „Man sollte ihn wieder lesen – in Speyer und
andernorts“, so Berschin.
Zwei Beiträge hat Dr. Herbert Wurster, Leiter des Bistumsarchivs
Passau und langjähriger Weggefährte Ammerichs, beigesteuert. Als
Historiker und Philologe beleuchtet Wurster unter der Überschrift
„Ein Lied vom Rhein und von der Donau“, wie das Nibelungenlied
„durch die Einbeziehung fast des gesamten deutschen Raumes aus
einer regionalen Sage ein einheitsstiftendes deutsches
Geschichtsbild formte“. Um „aktuelle Herausforderungen“ der Archive
der katholischen Kirche in Deutschland geht es im zweiten Beitrag.
Wurster macht deutlich, dass die gewaltigen Veränderungen der
letzten Jahre in den Bereichen Internet und Digitalisierung auch
für die Archivwelt ganz neue Denkansätze und Vorgehensweisen
erfordern.
Abgerundet wird die Festschrift zu Ehren Hans Ammerichs, den der
Bezirksverband Pfalz 2015 mit dem Lebenswerkpreis auszeichnete,
durch zwei Laudationes aus der Feder Generalvikar Dr. Franz Jungs
sowie des ehemaligen Speyerer Oberbürgermeisters Werner
Schineller.
Buchtipp: Thomas Fandel/Lenelotte Möller/Joachim Kemper (Hg.),
Zur Frühgeschichte von Stadt und Bistum Speyer (Schriften des
Diözesan-Archivs Speyer, Band 49), Pilger-Verlag Speyer 2016, ISBN
9-783946-777007, 14,80 Euro. - Erhältlich im Buchhandel oder direkt
beim Pilger-Verlag, Telefon 0 62 32/31 83 0, E-Mail: info@pilger-speyer.de
Text und Foto: is
13.12.2016
Aussendungsfeier des Friedenslichts aus Bethlehem im Speyerer Dom
 Speyer- Die Aussendungsfeier des
Friedenslichts lockte am 11. Dezember mehr als 1.000 Pfadfinder und
Besucher in den Speyerer Dom. Die Flamme, die in der Geburtsgrotte
Jesu in Bethlehem entzündet worden war, wurde von einer
fünfköpfigen Delegation aus Wien in die Pfalz geholt. Die
Delegierten vertraten die Pfadfinderverbände Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG) und Verband christlicher Pfadfinderinnen und
Pfadfinder (VCP). Seit vielen Jahren findet die Aussendung des
Friedenslichts in einem ökumenischen Gottesdienst in Speyer
statt.
Speyer- Die Aussendungsfeier des
Friedenslichts lockte am 11. Dezember mehr als 1.000 Pfadfinder und
Besucher in den Speyerer Dom. Die Flamme, die in der Geburtsgrotte
Jesu in Bethlehem entzündet worden war, wurde von einer
fünfköpfigen Delegation aus Wien in die Pfalz geholt. Die
Delegierten vertraten die Pfadfinderverbände Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG) und Verband christlicher Pfadfinderinnen und
Pfadfinder (VCP). Seit vielen Jahren findet die Aussendung des
Friedenslichts in einem ökumenischen Gottesdienst in Speyer
statt.
In diesem Jahr stand die Aktion unter dem Motto „Frieden:
Gefällt mir! Ein Netz verbindet alle Menschen guten Willens“.
Während der Aussendungsfeier berichteten die Teilnehmer der
Delegation, was sie motiviert hatte, das Friedenslicht aus
Bethlehem in Wien abzuholen. Laura (20) aus Lambrecht
erfüllte sich damit einen Kindheitstraum, da sie von klein auf
begeistert von der Aktion ist. Katharina (17) aus Landstuhl
wollte unbedingt mit nach Wien, um von dort das Licht des Friedens
in die Welt zu tragen. Sie haben sich mit vielen anderen
Pfadfindern aus ganz Europa und Amerika auf den Weg gemacht, haben
sich vernetzt und neue Freundschaften geschlossen.
 Um Verbundenheit, die Frieden ermöglicht, ging es auch im
Gottesdienst. Alle Teilnehmer verbanden sich mit den Händen zu
einem großen Netz, das den Dom ausfüllte.
Um Verbundenheit, die Frieden ermöglicht, ging es auch im
Gottesdienst. Alle Teilnehmer verbanden sich mit den Händen zu
einem großen Netz, das den Dom ausfüllte.
Die Aktion, die vor über zwanzig Jahren vom Österreichischen
Rundfunk (ORF) gestartet wurde, verbindet Menschen weltweit und ist
ein Symbol des Friedens. Die Pfadfinder und Besucher, die es am
dritten Advent in Speyer abgeholt haben, bringen es mit in ihre
Gemeinden, Dörfer und Städte. In vielen Gemeinden brennt die Flamme
bis zum Weihnachtsfest.
Weitere Infos unter www.friedenslicht.de.
Die Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) Speyer ist
Mitgliedsverband des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) Speyer. Der BDKJ Speyer vertritt die Interessen von
7.500 Kindern und Jugendlichen in Politik, Kirche und Gesellschaft.
Mehr: www.bdkj-speyer.de
Text und Foto: Deutsche Pfadfinderschaft St. Georg
(DPSG) Speyer; Bistum Speyer
12.12.2016
Dombauverein stellt neuen Domsekt vor
 Der neue Domsekt
Der neue Domsekt
Winzergenossenschaft Weinbiet eG (Neustadt-Mussbach) Sieger
einer pfalzweiten Ausschreibung – 1,50 Euro des Verkaufserlöses
kommen dem Dom zu Gute
Speyer. Rechtzeitig zu Weihnachten und dem
anstehenden Jahreswechsel präsentierte der Dombauverein Speyer e.V.
den neuen Domsekt. Ein Riesling brut der Winzergenossenschaft
Weinbiet eG steht ab sofort für 8,90 Euro zum Verkauf. Pro Flasche
gehen dabei 1,50 Euro auf das Konto des Dombauvereins, der damit
den Erhalt der romanischen Kathedrale unterstützt. Der Domsekt
gehört zu den Verkaufsschlagern der als „Dombausteine“ bezeichneten
Verkaufsartikel des Vereins. 900 Flaschen wurden bereits direkt bei
der Winzergenossenschaft geordert.
„Wir freuen uns, dass wir als Sieger einer von Pfalzwein e.V.
dankenswerterweise durchgeführten pfalzweiten Ausschreibung mit der
Winzergenossenschaft Weinbiet eG aus Neustadt-Mussbach einen neuen
Partner gefunden haben“, gab der Vorsitzende des Dombauverein
Speyer e.V., Dr. Gottfried Jung, bekannt. In den Jahren davor
stammte der Domsekt vom Weingut Anselmann, dem Vorstandsmitglied
Mathias Geisert noch einmal für die gute Zusammenarbeit dankte.
„Jetzt wollten wir, wie das beim Domwein bereits guter Brauch ist,
einen Wechsel um etwas Neues anbieten zur können. Eine
herausragende Qualität und ein gutes Vertriebsnetz waren dabei die
entscheidenden Kriterien“, so Geisert, der für den Dombauverein die
Ausschreibung federführend begleitete. Das Etikett der Sektflaschen
ziert ein hierfür bereits etabliertes Motiv des Speyerer Künstlers
Johannes Doerr.
„Wir haben uns mit dem Domsekt viel Mühe gegeben“, so Gottfried
Jung. Bei der Blindverkostung für den neuen Domsekt, an der unter
anderem die Pfälzische Weinkönigin Anastasia Kronauer, der Leiter
der Prüfstelle Markus Fischer, dessen Stellvertreterin Petra
Eichberger sowie der Leiter des Weinbauamts Dr. Thomas Weihl
teilnahmen, belegte der Riesling-Sekt (brut) aus dem Jahrgang 2015
unter sieben Kandidaten den ersten Platz. Hergestellt wird er in
traditioneller Flaschengärung.
 Der neue Domsekt ist ab sofort in der Geschäftsstelle des
Dombauvereins (Edith-Stein-Platz 8) sowie im Dom-Besucherzentrum
(Domplatz) erhältlich. Zudem kann er direkt über die
Winzergenossenschaft Weinbiet bezogen werden. Diverse Einzelhändler
sowie Supermärkte der Region haben den Domsekt ebenfalls in ihrem
Programm.
Der neue Domsekt ist ab sofort in der Geschäftsstelle des
Dombauvereins (Edith-Stein-Platz 8) sowie im Dom-Besucherzentrum
(Domplatz) erhältlich. Zudem kann er direkt über die
Winzergenossenschaft Weinbiet bezogen werden. Diverse Einzelhändler
sowie Supermärkte der Region haben den Domsekt ebenfalls in ihrem
Programm.
Neuer Vorsitzender des Dombauvereins Dr. Gottfried Jung
berichtet über die ersten Monate seiner Amtszeit
Bei der Vorstellung des neuen Domsekts antwortete der
Vorsitzende des Dombauvereins Dr. Jung bereitwillig auf Fragen zu
seiner bisherigen Amtszeit, die im März bei einer außerplanmäßigen
Vorstandswahl begonnen hatte. „Ich habe einen Verein mit guter
Atmosphäre vorgefunden, dessen Vorstand mit Teamgeist
zusammenarbeitet.“ Die Zusammenarbeit mit Domkustos Peter Schappert
schilderte er als „unkompliziert und reibungslos“. Er werde sich
bei der Mitgliederversammlung im kommenden Frühjahr gerne erneut
zur Wahl stellen. Ihn freue, dass Bischof Wiesemann bereits seine
Teilnahme an dieser Versammlung zugesagt habe, so Jung.
Als Aktivitäten seit seinem Amtsantritt nannte Jung die
Erneuerung der Homepage, die Anfang des kommenden Jahres ans Netz
gehen solle. Zudem seien er und seine Vorstandskollegen mit der
Aufstellung eines Jahresprogramms für 2017 beschäftig gewesen.
Neben den wissenschaftlichen Foren und den Fahrten für die
Mitglieder nach Colmar und Strasbourg sei auch wieder ein
Golfturnier in Planung. Erstmals sei für Neumitglieder eine
spezielle Domführung geplant, die Domkustos Schappert übernehmen
werde. „Wobei“, so schränkte Jung ein, „der Dombauverein
erfreulicherweise im letzten Jahr 60 neue Mitglieder hinzu gewonnen
hat, die wohl nicht alle gleichzeitig an einer Führung teilnehmen
können.“ Die aktuelle Zahl von 2.800 Mitgliedern sei sehr
erfreulich, fügte Jung an. „Die Mitglieder sind ohne jede Frage das
Kapital des Vereins.“ Sie unterstützen den Verein zum einen durch
ihre Mitgliedsbeiträge zum anderen aber auch über Spendenaufrufe
anlässlich von privaten Feiern oder auch Betriebsfesten, erklärte
der Vereinsvorsitzende.
Text/Fotos: Friederike Walter
09.12.2016
Für die Kirche des Wortes ist Widerspruch Christenpflicht
 Kirchenpräsident Schad
mahnt beim Pressetee Werte der „freien, streitbaren Demokratie“
an
Kirchenpräsident Schad
mahnt beim Pressetee Werte der „freien, streitbaren Demokratie“
an
Speyer/Bad Dürkheim- Angesichts
erstarkender nationalistischer Strömungen in der Gesellschaft ruft
der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad die Christen zum
Widerspruch gegen Intoleranz und Populismus auf. 500 Jahre nach der
Reformation feierten die Protestanten im kommenden Jahr ein
Jubiläum, in dem die öffentlichen und politischen Konsequenzen der
von Luther neu entdeckten „Freiheit eines Christenmenschen“ hörbar
würden, sagte Schad beim traditionellen „Pressetee“ der
Evangelischen Kirche der Pfalz am Dienstag in Bad Dürkheim. Für die
Kirche des Wortes sei hier „Widerspruch Christenpflicht“.
Rechtspopulisten antworteten mit einfachen Lösungen auf komplexe
Fragen, sie spielten mit der Angst der Menschen oder wollten daraus
Kapital schlagen. Schad mahnte, diesem Mechanismus mit den humanen
und zivilen Grundlagen des menschlichen Zusammenlebens zu begegnen.
Der Kirchenpräsident erinnerte daran, dass die Reformation
eine „entängstigende und weltoffene Bewegung“ gewesen sei, die den
Menschen aus dem Zwang zur Selbstermächtigung befreit und ihn frei
zum Dienst an seinem Nächsten gemacht habe: „frei aus Glauben und
frei zur Liebe, die tut was dem Nächsten dient“.
Schad appellierte an eine „freie, streitbare Demokratie, die
ihre Grundlagen verteidigt“. Dazu gehöre Gastfreundlichkeit, die
Integration von Flüchtlingen und soziale Gerechtigkeit. „So werden
die Ängste und Sorgen der Menschen tatsächlich ernst genommen.“ Wer
hingegen ankündige, Muslime verdrängen und Minarette verbieten zu
wollen, handele unchristlich und widerspreche der Religionsfreiheit
des Grundgesetzes. „Wir werden Haltungen, die Fremdenfeindlichkeit
und Rassismus schüren, entschieden zurückweisen und hart
bekämpfen.“
Zugleich sprach sich der Kirchenpräsident für „argumentative
Auseinandersetzungen“ aus: „Wir müssen auch mit denen ins Gespräch
kommen, die unsere Ansichten verachten oder ignorieren.“
Die reformatorische Unterscheidung von Person und Werk,
zwischen dem Menschen und seinen Aussagen und Haltungen, sei ein
„Halteseil der Humanität“ in der Gesellschaft. „Mit seiner Hilfe
können wir zu einer Debattenkultur zurückfinden, die Abstand nimmt
von persönlichen Verletzungen und gerade in der sachlichen
Kontroverse zu einem zivilisierten Umgang miteinander beiträgt.“
Das ur-evangelische Modell von „Einheit und Gemeinschaft in
versöhnter Verschiedenheit“ eigne sich dazu, mit Vielfalt
konstruktiv, verbindend und verbindlich umzugehen, sagte Schad in
seiner Ansprache beim „Pressetee“. Dieser bietet Kirchenleitung und
Journalisten Gelegenheit, gegen Ende des Jahres intensiv
miteinander ins Gespräch zu kommen.
Mehr zum Thema: www.reformation2017.evpfalz.de,
www.r2017.org und www.luther2017.de. Text: lk;
Foto: pem
07.12.2016
Intensiver Austausch über Diözesan- und Landesgrenzen hinweg
 v.l.:Generalvikar Dr. Franz Jung (Speyer), Jean-Luc Lienard (Strasbourg), Jean-Christophe Meyer (Metz), Markus Thürig (Basel), Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Speyer), Leo Wagener (Luxembourg), Guido Scherrer (St. Gallen) und Clemens Stroppel (Rottenburg-Stuttgart).
v.l.:Generalvikar Dr. Franz Jung (Speyer), Jean-Luc Lienard (Strasbourg), Jean-Christophe Meyer (Metz), Markus Thürig (Basel), Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Speyer), Leo Wagener (Luxembourg), Guido Scherrer (St. Gallen) und Clemens Stroppel (Rottenburg-Stuttgart).
Generalvikare aus Luxemburg, Frankreich, Deutschland und der
Schweiz trafen sich in der Domstadt Speyer
Speyer - Die Generalvikare der Diözesen
Straßburg und Metz (Frankreich), Basel und St. Gallen (Schweiz),
Luxemburg sowie der südwestdeutschen Diözesen Freiburg,
Rottenburg-Stuttgart und Speyer kamen in Speyer zu ihrem
Jahrestreffen zusammen. Die Diözesen, die entlang des Rheins
zwischen Bodensee und Mosel legen, pflegen seit vielen Jahren einen
intensiven Austausch.
Auf Einladung des Speyerer Generalvikars Dr. Franz Jung hielten
sich die Amtskollegen zwei Tage in der Domstadt auf. Im Fokus der
Gespräche standen die kirchlichen und politischen Entwicklungen in
den jeweiligen Ländern sowie die künftigen Perspektiven der
Zusammenarbeit in Europa. „Angesichts einer vielfach verbreiteten
Europaskepsis und Europamüdigkeit setzt das Treffen zugleich ein
Zeichen, dass sich der christliche Glaube und die Kirche
grenzüberschreitend verstehen und Menschen unterschiedlicher
Nationalitäten verbinden und zueinander führen möchte“, so
Generalvikar Jung.
Ein Besuch des Speyerer Domes stand ebenso auf dem
Tagungsprogramm wie eine Begegnung mit dem Speyerer Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann. Dieser unterstrich die Bedeutung guter
nachbarschaftlicher Beziehungen zwischen den Diözesen entlang des
Rheins. „Der Speyerer Dom steht wie kaum ein anderes Bauwerk für
die Idee eines geeinten Europas mit starken christlichen Wurzeln“,
würdigte er die länderübergreifende Begegnung.
Die Generalvikare leiten die kirchliche Verwaltung in ihren
Diözesen und sind die engsten Mitarbeiter der jeweiligen
Diözesanbischöfe. Dem Kreis, der sich jedes Jahr in einer anderen
Diözese trifft, gehören außerdem die Generalvikare der Diözesen
Mainz und Trier an.
Bistum Speyer
06.12.2016
Pfalzweite Eröffnung von „Brot für die Welt“ in Ludwigshafen
 Kirchenpräsident prangert Ungerechtigkeiten
an
Kirchenpräsident prangert Ungerechtigkeiten
an
Speyer/Ludwigshafen- Zum Auftakt der
Spendenaktion „Brot für die Welt“ für die Pfalz und Saarpfalz
appellierte der pfälzische Kirchenpräsident Christian Schad an die
Christen, sich solidarisch und verantwortungsbewusst in der
Einen Welt zu verhalten und auch das eigene Konsumverhalten
zu überdenken. „Es gibt keinen Grund dafür, dass Menschen in
anderen Teilen der Welt weniger Recht auf Nutzung der Ressourcen
dieser Erde haben sollten, als wir selbst“, sagte Schad im
Gottesdienst am ersten Advent in der Apostelkirche in
Ludwigshafen.
Die 58. evangelische Spendenaktion hat das Motto „Satt ist nicht
genug! Zukunft braucht gesunde Ernährung“. Im Mittelpunkt der neuen
Spendenaktion steht die Ernährung der Menschen in den wachsenden
Städten. Denn bis zum Jahr 2050 werden zwei Drittel der
Weltbevölkerung in Städten leben. Heute erzeugt die
familienbetriebene Landwirtschaft etwa 80 Prozent aller
Nahrungsmittel weltweit. Um dies auch in Zukunft leisten zu können,
braucht sie Unterstützung. Die ausgewählten Pfälzer Projekte in
Brasilien, Togo und Malawi helfen sowohl Bauernfamilien als auch
Familien in Städten. Immer geht es dabei darum, ein Bewusstsein für
gesunde Ernährung aus regionaler Produktion zu schaffen sowie
regionale Produktions- und Vermarktungskreisläufe zu etablieren und
zu festigen.
Ein weiteres Projekt stellten Jugendliche aus Rheingönheim im
Gottesdienst vor. „Nicht reden - handeln“ ist ein
Menschenrechtsprojekt in Südafrika, das Minenarbeiter und ihre
Familien beim Kampf um ihre Rechte unterstützt. Internationale
Bergbaukonzerne und deren Kunden werden öffentlichkeitswirksam an
ihre soziale und ökologische Verantwortung erinnert.
An dem Gottesdienst zur pfalzweiten Eröffnung von Brot für die
Welt wirkten Dekanin Barbara Kohlstruck, die
Brot-für-die-Welt-Beauftragte im Kirchenbezirk Ludwigshafen,
Pfarrerin Corinna Weissmann, sowie Diakoniepfarrer Albrecht Bähr
mit. Die musikalische Gestaltung lag bei Hansmartin Weber und dem
Chor „The Singers“, der die Apostelkirche mit afrikanischen Klängen
erfüllte.
Hintergrund: Das weltweit tätige Hilfswerk der
evangelischen Landes- und Freikirchen in Deutschland wurde 1959
gegründet und fördert mehr als 2000 Projekte in Afrika, Asien,
Lateinamerika und Osteuropa.
Wirkliche Hilfe muss dem Armen helfen, sich selbst zu helfen,
lautete ein entscheidender Grundsatz, der bis heute gilt. Die
Menschen in der Pfalz und der Saarpfalz haben im vergangenen Jahr
1.030.258 Euro für Brot für die Welt gespendet. Die meisten Spenden
gingen mit 2,37 Euro pro Kirchenmitglied im Kirchenbezirk Bad
Dürkheim ein, gefolgt vom Kirchenbezirk Frankenthal mit 1,58 Euro
pro Kirchenmitglied und dem Kirchenbezirk Donnersberg mit 1,53 Euro
pro Kirchenmitglied. dwp/lk
27.11.2016
Pfarrer Frank Aschenberger wird neuer Dekan im Dekanat Speyer
 Bischof
Wiesemann bestätigt Wahl der Dekanatsversammlung
Bischof
Wiesemann bestätigt Wahl der Dekanatsversammlung
Speyer- Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
hat die Wahl der Dekanatsversammlung im Dekanat Speyer, die am 10.
November stattfand, bestätigt und mit Wirkung zum 1. Dezember 2016
Pfarrer Frank Aschenberger aus Waldsee zum Dekan für das Dekanat
Speyer ernannt.
Er tritt damit die Nachfolge von Pfarrer Peter Nirmaier an, der
als Pfarrer von Schifferstadt nach Maikammer gewechselt war.
Die Amtszeit von Dekan Aschenberger beträgt sechs Jahre.
Prodekan bleibt weiterhin Pfarrer Andreas Rubel.
21.11.2016
Päpstlicher Gregorius-Orden für Dr. Manfred Fuchs
 Dr. Manfred Fuchs (links) mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (rechts) bei der Verleihung des päpstlichen Gregorius-Ordens
Dr. Manfred Fuchs (links) mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (rechts) bei der Verleihung des päpstlichen Gregorius-Ordens
Bischof Wiesemann ehrt den zum Jahresende scheidenden
Vorsitzenden der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer für sein
vielfältiges Engagement für den Dom
Speyer- Mit der Verleihung des
päpstlichen Gregorius-Ordens für Dr. Manfred Fuchs würdigte Bischof
Dr. Karl-Heinz Wiesemann dessen langjähriges und vielfältiges
Engagement für den Dom zu Speyer. Die Ehrung erfolgte im Rahmen der
Jahrestagung der Gremien der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu
Speyer im Anschluss an die europäische Rede des früheren
BASF-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr. Jürgen Strube im Speyerer
Dom.
Dr. Manfred Fuchs, bis 2003 Vorstandsvorsitzender der Fuchs
Petrolub SE mit Sitz in Mannheim, wurde im Jahr 2007 durch den
Stiftungsrat der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer als
Mitglied in den Stiftungsvorstand gewählt. Im Juni 2012 übernahm er
den Vorstandsvorsitz. Er wirkte an der Erweiterung des Kuratoriums
mit unter anderem durch Berufung von Erzherzog Karl von
Habsburg-Lothringen, Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Prof. Dr.
Maria Böhmer und anderer Persönlichkeiten. Mit Bundespräsident a.D.
Prof. Horst Köhler und Kardinal Reinhard Marx holte er für die
Reihe der „Europäischen Reden“ herausragende Persönlichkeiten nach
Speyer. Auf seinen Wunsch gibt Dr. Fuchs das Amt des
Vorstandsvorsitzenden der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer
zum Ende des Jahres ab.
„In seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender gelang es Dr.
Fuchs in hervorragender Art und Weise, durch Ideen und Initiativen
das öffentliche Interesse an der Erhaltung des Doms zu wecken und
wach zu halten. Durch seine Kontakte und persönliche Ansprache
motivierte er darüber hinaus immer wieder wichtige Persönlichkeiten
für den Dom aktiv zu werden“, würdigte Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann den Einsatz von Dr. Manfred Fuchs. Durch seine
unternehmerische Erfahrung und sein breites gesellschaftliches
Engagement habe die Arbeit der Stiftung unter seinem Vorsitz
wichtige neue Impulse erfahren.
Durch eine persönliche Spende von Dr. Manfred Fuchs wurde im
Jahr 2012 der Umbau des Benno-Portals des Domes zum barrierefreien
Zugang ermöglicht. Menschen im Rollstuhl, aber auch junge Eltern
mit Kinderwagen haben seitdem einen hindernisfreien und leichten
Zugang zum Dom. Auch die neue Außenbeleuchtung des Domes wurde von
Dr. Manfred Fuchs mit einer Einzelspende in Höhe von 100.000 Euro
unterstützt.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann überreichte Dr. Manfred Fuchs
den päpstlichen Gregorius-Orden in der Klasse „Komtur mit Stern“.
Der päpstliche Gregorius-Orden ist die vierthöchste Auszeichnung
innerhalb der katholischen Kirche und muss beim Papst persönlich
beantragt werden.
Text: is; Foto: Klaus Venus
17.11.2016
Probeleuchten am Speyerer Dom
 Den Probelauf für die neue Außenbeleuchtung des Domes starteten Manfred Fuchs (rechts im Bild) und Horst Kleiner.
Den Probelauf für die neue Außenbeleuchtung des Domes starteten Manfred Fuchs (rechts im Bild) und Horst Kleiner.
Alle Strahler der neuen Dombeleuchtung installiert –
Individuelle Anpassung an den Dom erfolgt in den kommenden
Wochen
Speyer- Am 15. November wurde die neue
Außenbeleuchtung des Doms in einem Probelauf erstmals komplett
eingeschaltet. Anlass war der Jahrestag der Europäischen Stiftung
Kaiserdom zu Speyer, welche die Außenbeleuchtung maßgeblich
finanziert hatte. Dombaumeister Mario Colletto lobte das große
Engagement der Speyerer Stadtwerke und der ausführenden Firmen, die
mit Zusatzschichten dafür gesorgt hatten, dass die Beleuchtung
früher als gedacht installiert werden konnte.
In den kommenden Wochen werden die neuen Strahler nun
ausgerichtet und individuell an den Dom angepasst. Dies beinhaltet
auch die Bestückung der Leuchten mit Verschattungstuben. Damit wird
auch die noch vorhandene Blendung gemildert, die noch von einigen
Leuchten ausgeht. Zum vierten Advent soll dann alles fertig sein,
so dass rechtzeitig zu Weihnachten der Dom in neuem Licht
erstrahlt.
 Ziel der neuen Außenbeleuchtung ist vor allem die
Erneuerung der in die Jahre gekommen Technik. Die neuen
LED-Lichtquellen bringen zum einen eine sehr viel höhere
Energieeffizienz mit sich und ermöglichen gleichzeitig eine
dynamische Lichtsteuerung, die den Tages- und Nachtzeiten angepasst
ist. Zum anderen betont die neue Beleuchtung die Plastizität der
einzelnen Bauteile, die für die romanische Kathedrale so
charakteristisch ist.
Ziel der neuen Außenbeleuchtung ist vor allem die
Erneuerung der in die Jahre gekommen Technik. Die neuen
LED-Lichtquellen bringen zum einen eine sehr viel höhere
Energieeffizienz mit sich und ermöglichen gleichzeitig eine
dynamische Lichtsteuerung, die den Tages- und Nachtzeiten angepasst
ist. Zum anderen betont die neue Beleuchtung die Plastizität der
einzelnen Bauteile, die für die romanische Kathedrale so
charakteristisch ist.
Die Außenbeleuchtung ist ein Förderprojekt der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer. Entscheidend war das persönliche
Engagement zweier Stiftungsmitglieder, nämlich das von Isolde
Laukien-Kleiner und von dem Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Dr.
Dr. h.c. Manfred Fuchs. Zusammen mit Stiftungserträgen konnten so
insgesamt 300.000 Euro aufgebracht werden. Die Stadt Speyer
unterstützt die neue Beleuchtung ebenfalls mit einem Zuschuss von
80.000 Euro und teilt sich mit dem Domkapitel die laufenden
Kosten.
Text: Bistum Speyer, Presse Foto: pem
16.11.2016
12 Themenführungen in der Gedächtniskirche zum Reformationsjubiläum
Speyer- Am kommenden Samstag beginnt die Reihe der 12
Themenführungen in der Gedächtniskirche zum Reformationsjubiläum
2017. Jeweils am 3. Samstag im Monat um 14.30 Uhr, für ca. 1
Stunde, wird zu einem besonderen Thema eine Kirchenführung
stattfinden. Ohne Anmeldung kann man für 5,00 Euro pro Person daran
teilnehmen. (Kinder bis 12 Jahre frei).
Thema am 19.11. 14.30 Uhr: Auf Entdeckungsreise in der GDK: Vom
Keller bis zum Turm. Herr Peter Emering und Frau Rita
Gerberding-Frank entdecken mit Ihnen interessante Stellen und
Geschichten in der Kirche.
Text: Prot. Dekanat Speyer, Presse
16.11.2016
Erbgroßherzog von Luxemburg zu Besuch in Speyer
 Der Teilnahme an
der Jahrestagung der Stiftungsgremien gingen eine Begrüßung durch
den Bischof und ein Besuch des Doms voraus
Der Teilnahme an
der Jahrestagung der Stiftungsgremien gingen eine Begrüßung durch
den Bischof und ein Besuch des Doms voraus
Speyer- Der Erbgroßherzog von Luxemburg
Prinz Guillaume besuchte heute die Bischofsstadt Speyer und den
Speyerer Dom. Anlass dafür war die Jahrestagung der „Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer“. Im Januar hatte Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann den Erbgroßherzog in das Kuratorium der
Stiftung berufen. Damit sind jetzt alle Adelsgeschlechter, die mit
dem Dom in Zusammenhang stehen, im Kuratorium der Stiftung
vertreten. Der Ahnherr des Hauses Nassau-Luxemburg, König Adolf,
ist im Dom begraben. Das Nassauer Wappen ist in der Achse der
Westfassade zu sehen.
 Der
Teilnahme an der Jahrestagung der Stiftungsgremien gingen eine
Begrüßung durch Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und ein Rundgang
durch den Dom voraus. Anschließend nahm der Erbgroßherzog an der
Europa-Rede des ehemaligen BASF-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.
Jürgen Strube im Dom teil.
Der
Teilnahme an der Jahrestagung der Stiftungsgremien gingen eine
Begrüßung durch Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und ein Rundgang
durch den Dom voraus. Anschließend nahm der Erbgroßherzog an der
Europa-Rede des ehemaligen BASF-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.
Jürgen Strube im Dom teil.
Der Erbgroßherzog, Jahrgang 1981, ist der älteste Sohn des
amtierenden Staatsoberhauptes von Luxemburg Großherzog Henri und
dessen Ehefrau Maria Teresa. Seit seiner Ernennung vor sechzehn
Jahren zum Erbgroßherzog haben sich die offiziellen Aufgaben von
Prinz Guillaume vervielfältigt. Er setzt sich beispielsweise für
die Förderung der luxemburgischen Wirtschaft im In- und Ausland.
Der Erbgroßherzog ist mit der belgischen Gräfin Stéphanie de Lannoy
verheiratet. is: Fotos: Klaus Landry
16.11.2016
„Liebe zu Europa öffentlich bekennen“
 Rede von
Professor Jürgen Strube im Dom zu Speyer
Rede von
Professor Jürgen Strube im Dom zu Speyer
Speyer- Unter der Überschrift „Wir
Europäer?“ hielt Prof. Dr. Jürgen Strube, ehemaliger
Vorstandsvorsitzender der BASF, ein flammendes Plädoyer für ein
Festhalten an der europäischen Integration. Dabei forderte er die
Zuhörer des im Speyerer Dom dazu auf, aus dem Fragezeichen ein
Ausrufezeichen zu machen, indem sie ihre Liebe zu Europa öffentlich
bekennen. Diesem Schlussappell stellte eine kritische Analyse des
Status quo der europäischen Einigung voraus, in die er den Brexit
und die Wahl des neuen US-Präsidenten Trump mit einbezog. Bei allen
Feststellungen zu den aktuellen Herausforderungen und zur
Reformbedürftigkeit der Union betonte er jedoch entschieden die
Verdienste des europäischen Einigungsprozesses für Sicherheit und
Wohlstand. Zudem zweifelte er daran, dass es eine Umkehr dieses
Prozesses geben könne. Es sei seine Überzeugung, so Strube, „dass
Europa wirklich die Zukunft ist.“ Dabei müsse ein zukunftsfähiges
Europa auch die Herzen der Menschen ansprechen, damit ein „Wir
Bewusstsein“ entstehen könne. So könnten die Bürger „die
Europäische Union mit allen ihren Stärken und Schwächen als die
Wirklichkeit der europäischen Idee akzeptieren, die der Reform
bedarf.“
Strube sprach im Speyerer Dom im Rahmen der öffentlichen
Vortragsreihe „Europäische Reden - Reden über Europa“ auf
Einladung der „Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“, die am
gleichen Tag ihre traditionelle Jahrestagung abhielt. is; Foto:
Klaus Landry
Lesen Sie hier die Rede von Professor Jürgen Strube im
Wortlaut„Wir Europäer?“
Exzellenzen, meine Herren Bischöfe und Herr
Kirchenpräsident,
Königliche Hoheiten, Durchlaucht,
sehr geehrte Herren Ministerpräsidenten,
verehrte Frau Staatsministerin, Professor Böhmer,
meine Herren Oberbürgermeister,
Herr Dr. Fuchs, lieber Manfred,
meine sehr geehrten Damen und Herren!
1.) Der Kaiserdom zu Speyer ist für mich und wohl
auch für Sie ein Symbol der Dauerhaftigkeit und der
Gegenwart der Geschichte. Mit Worten von Bundeskanzler a.D. Dr.
Helmut Kohl ist dieser Dom „ein Symbol der Einheit der deutschen
und der europäischen Geschichte“. Dies Verständnis erläutert er mit
dem Hinweis: (ich zitiere) „Die römisch-deutschen Kaiser herrschten
nicht über einen Nationalstaat, sondern über ein frühes Haus
Europa, das von Sizilien bis zur Nordsee reichte. Sie trugen das
Bewusstsein der abendländischen Welt in sich, dieses antik und
christlich geprägten Kulturkreises.“ (Ende des Zitats)
Bundeskanzler Kohl sagte oft: „Die Pfalz ist meine Heimat,
Deutschland ist mein Vaterland, und Europa ist unsere Zukunft.“ Er
hat seine Vorstellung zur Gestaltung Europas anlässlich des
Bundesparteitages der CDU 1976 konkretisiert: nämlich „ohne Verzug
an die Verwirklichung eines europäischen Bundesstaates zu gehen“.
Dabei unterstrich er, (ich zitiere): „ Die Einheit Europas
ist keine Sache, die allein von den Regierenden ausgehen kann. Sie
muss auch von den Völkern mitgetragen werden. Es ist eine Sache von
Herz und Verstand“ (Zitat Ende)
2) Das Votum einer Mehrheit der Briten für den
„Brexit“, also für den Austritt ihres Landes aus der
Europäischen Union, wirft 40 Jahre nach dieser Rede viele Fragen
auf. Dabei geht es mir mehr um Meinungen, Gefühle und Symbole und
weniger um die Institutionen und Entscheidungsprozesse der EU. Denn
ich bin überzeugt, dass das Votum für den „Brexit“ nicht das
Ergebnis einer Kosten- und Nutzenrechnung gewesen ist.
Welche Fragen werde ich vorrangig behandeln:
- Warum ist die „Verwirklichung einer immer engeren Union
der Völker Europas“ zum Kritikpunkt geworden?
- Wird der Zusammenhalt überzeugend
vermittelt?
- Lernen wir aus der Geschichte Europas?
- Überzeugt die Strategie zur Weiterentwicklung der EU
die Europäer?
- Welche Risiken und Chancen gibt es für die
EU?
3) Lassen Sie mich aber zunächst meinen Ausgangspunkt
für diese Rede erläutern:
Ich spreche zu Ihnen nicht als Vertreter der Wirtschaft,
sondern als Bürger dieser Region mit Wirtschafts- und Welterfahrung
und vielfältigen Interessen. Mein Leben verbindet deutsche,
europäische und kosmopolitische Erfahrungen und Einsichten, ist
aber auch geprägt von der Zugehörigkeit zur Generation der
Kriegskinder. Viele von Ihnen können mit mir sagen, wir sind
Angehörige einer glücklichen Generation. Denn wir erinnern uns noch
an den zweiten Weltkrieg und seine Folgen. Wir sind dankbar für
sieben Jahrzehnte mit Frieden, Freiheit und wachsendem Wohlstand.
Wir sind dankbar für die Versöhnung und für die Wiedervereinigung
in einem Europa des Verbundes von Staaten.
Wir bemerken aber, wie viele Errungenschaften
Selbstverständlichkeiten und Annehmlichkeiten werden, die kaum noch
Beachtung finden. Daher darf sich unsere Generation nicht mit der
zunehmenden Geschichtsvergessenheit abfinden!
4) Geschichte mag sich nicht wiederholen, aber wir
können aus ihr lernen! Es gab zum Beispiel vor dem Ersten Weltkrieg
bereits eine von Europa geprägte Phase der Globalisierung. Wird
unsere Globalisierung, die in den 80er Jahren begann und seit den
90er Jahren immer mehr Länder einbezog, gegen zur Zeit spürbare
Tendenzen zum Protektionismus bestehen?
Denn in einzelnen Ländern der EU gibt es Parteien mit stark
national-konservativen Programmen und auch Parteien mit
ökologischer Ausrichtung, die den Freihandel kritisieren und
begrenzen wollen. Der nächste Präsident der USA, Donald Trump, hat
schon im Wahlkampf stark protektionistische Tendenzen gezeigt: ein
Eintreten für Freihandel ist von ihm nicht zu erwarten. Die
Mehrheiten der Republikaner im Repräsentantenhaus und im Senat
werden seine protektionistische Politik stützen.
Europa hat mit dem Binnenmarkt einen großen wirtschaftlichen
und politischen Erfolg: er ist das Kernstück der europäischen
Einigung. Aber Europa hat zugleich ein vitales Interesse am freien
Welthandel!
Die Überzeugung, die Entwicklung Europas zur Einheit sei
unumkehrbar, ist durch das Referendum über den Brexit widerlegt. Im
Vergleich zur Zielvorstellung des Jahres 1976 ist die Europäische
Union viel größer, aber auch viel komplexer, distanzierter und viel
heterogener geworden.
Von einer Bundesstaatlichkeit ist die EU weit entfernt; und
nur ein Fünftel der Deutschen kann sich ein „vereintes Europa“
vorstellen.
Die grundsätzlichen Veränderungen der Rahmenbedingungen seit
den 90er Jahren haben die Stimmungen der Völker Europas deutlich
verändert: Das Ende des „Kalten Krieges“ mit der Auflösung des
sowjetischen Macht-Blockes hatte die Angst vor der Bedrohung aus
dem Osten verschwinden lassen. Gegenüber den neuen
Herausforderungen im Zuge der Globalisierung besteht ein Gefühl der
Unsicherheit: Klimawandel, Bevölkerungswachstum in weniger
entwickelten Ländern bei Überalterung in hoch entwickelten Ländern,
Migration in großen Zahlen, Abnahme des Wachstums der
Weltwirtschaft, Finanz – und Schuldenkrisen, Digitalisierung,
Versagen und Zerfall von Staaten, regionale bewaffnete Konflikte,
Terrorismus, Zweifel an den Fähigkeiten der Eliten, zunehmender
Populismus, Trend zu neuem Protektionismus, u.s.w.
Diese vielen Herausforderungen schaffen eine neue
Unübersichtlichkeit und können die Europäer nicht einen; das
beherrschende Gefühl der Angst im „Kalten Krieg“ konnte
einen!
In dieser Situation nehmen Fortschrittsoptimismus und
Zukunftsvertrauen in Europa ab. Die Sehnsucht nach Versöhnung,
Frieden, Freiheit und Wohlstand, also die mächtigen Impulse der
Europabegeisterung in der zweiten Hälfte des zwanzigsten
Jahrhunderts ist, bis auf Wohlstand, befriedigt. Der Wunsch nach
Sicherheit tritt an die Stelle dieser Sehnsucht!
5) Steuern wir auf einen Wendepunkt zu? Auf einen
Trend zur Renationalisierung?
Halten wir zunächst fest: Die Umkehrbarkeit der
Globalisierung bildet ein großes Risiko dieser Entwicklung;
das hat der Erste Weltkrieg bewiesen. Zwar garantiert die
Globalisierung weder ein friedliches Zusammenleben der Nationen
noch ein Zusammenwachsen der Völker zu einer Art von
Welt-Innenpolitik. Aber sie erhöht durch internationale
Arbeitsteilung und wachsende gegenseitige Abhängigkeiten die
Chancen des Friedens und allgemeiner Wohlstandsgewinne. Wenn ein
Land aber bereit ist, den Preis für den „Austritt aus der
Globalisierung“ zu zahlen, so ist der Austritt möglich. Während der
Iran und Cuba bereit sind einzulenken, bleibt Nordkorea
draußen!
Es sieht so aus, als ob Russland prüfe, wie weit man die
allgemein akzeptierten Regeln dehnen oder umgehen könne, um seinen
Drang nach Expansion und Macht zu befriedigen.
6) Daher frage ich mich voller Sorge, ob nicht bald ein Buch
erscheint mit dem Titel „Die Welt von gestern“, in dem die
Zeit der EU vor den großen Krisen als „das goldene Zeitalter der
Sicherheit“, das uns auf dem geraden und unfehlbaren Weg zur
„besten aller Welten“ führt, beschrieben wird. So hatte Stefan
Zweig in seinem Buch dieses Titels die Welt vor dem Ersten
Weltkrieg geschildert.
„Freiheit im privaten Tun und Lassen galt als eine
Selbstverständlichkeit“, „Optimismus und Weltvertrauen beseelten
uns junge Menschen seit jener Jahrhundertwende“, so Stefan
Zweig.
War es Wunschdenken, wenn Stefan Zweig schreibt: „… aus
Stolz auf die sich stündlich überjagenden Triumphe unserer Technik
und unserer Wissenschaft war zum ersten Mal ein europäisches
Gemeinschaftsgefühl, ein europäisches Nationalbewusstsein im
Werden“?
Die beiden Weltkriege haben bewiesen, dass der Nationalismus
stärker war als ein „europäisches Gemeinschaftsgefühl“. Die
Bemühungen um eine Verständigung und Versöhnung in Europa zwischen
1918 und 1939 scheitern tragisch. Manche Historiker nennen die Zeit
von 1914 bis 1945 den zweiten Dreißigjährigen Krieg, eine
Bezeichnung die diese Periode traurig verdient.
7) Wir leben jetzt auch nicht in einer „Epoche des
Weltvertrauens“! Können wir denn mit der „Verwirklichung einer
immer engeren Union der Völker Europas“ den
Herausforderungen unserer Zeit und Zukunft begegnen? Nach dem Votum
der Briten für den Austritt aus der EU fällt eine positive Antwort
schwer! Da aber die Regierung Schottlands bereits erklärt hat,
Schottland wolle Mitglied der EU bleiben bzw. nach dem Austritt von
Großbritannien wieder werden, ist zu klären, ob der Begriff
„Völker“ nicht verschiedene Auffassungen zulässt. Bei der
Europa-Fußball-Meisterschaft sind ja vier Mannschaften aus UK
angetreten, nämlich Engländer, Nordiren, Schotten und
Waliser!
Wenn wir den Begriff Volk als die „Gesamtheit der durch
Sprache, Kultur und Geschichte verbundenen Menschen“ verstehen,
dann werden Katalanen, Flamen, Wallonier, Korsen, Basken und andere
Personengruppen sich als Volk betrachten. Fügt man jedoch „und zu
einem Staat vereint“ hinzu, dann verwenden wir den Begriff Volk im
Sinne von Staatsvolk und übergehen die Spannungen in einigen
Ländern Europas.
8) Das Meinungsbild zu Europa ist nicht
eindeutig:
Die Bundesregierung hat in Auswertung des Eurobarometers vom
Frühjahr 2016 veröffentlicht, dass die „Mehrheit der Europäer
hinter der EU steht“. Demnach begreifen sich zwei Drittel der
Bürgerinnen und Bürger aller EU-Mitgliedsländer als Europäer und
glauben, dass die Stimme der EU in der Welt Gewicht hat. Die Hälfte
der EU-Bürger blickt optimistisch in die Zukunft.
Eine Studie von Pew Research zum Meinungsbild in zehn
EU-Staaten, die im April und im Mai 2016 durchgeführt wurde, soll
jedoch zeigen, dass die Mehrheit der Griechen, Italiener, Spanier
und Franzosen das Gefühl habe, ihre Länder hätten heute weniger
Einfluss in der Welt als noch vor 10 Jahren. Mit dieser
Einschätzung ergebe sich „die Forderung, das eigene Land solle vor
allem seine Probleme lösen und sich nicht um andere Staaten
kümmern“. Das gelte auch für die Briten, Polen, Ungarn und
Niederländer. „Einzig in Deutschland ist die Gruppe derjenigen, die
einen gemeinschaftlichen Ansatz bevorzugen, mehr als doppelt so
groß wie jene der Isolationisten“.
Welche Einschätzung überzeugt mehr?
Das Institut für Demoskopie Allensbach hat im September
dieses Jahres eine Studie in Deutschland zu „Rückhalt für die EU
nach dem Brexit“ erstellt. Hatte 2002 noch die Hälfte der deutschen
Bevölkerung großes oder sehr großes Vertrauen in die EU, so ist es
aktuell nur noch ein Drittel. Auch NATO und UNO haben seit 2002
einen ähnlichen Vertrauensverlust erlitten.
Gleichzeitig halten 84% der deutschen Bevölkerung für
wichtig, dass sich Deutschland besonders um gute Beziehungen zu den
europäischen Nachbarstaaten bemüht. Eine andere Allensbach Studie
zeigt, dass selbst in Deutschland die Besorgnis über den Zustand
der EURO-Zone wächst und sich zugleich die Kritik an der
unzureichenden Handlungsfähigkeit der EU verstärkt. Im Blick der
Deutschen auf die EU stehen Bürokratie (81%) und Geldverschwendung
(66%) im Vordergrund; dem stehen große Wirtschaftskraft (68%) und
ihre Rolle als Garant für den Frieden in Europa (60%) gegenüber.
60% der Deutschen sind überzeugt, dass „innerhalb der EU Gegensätze
und unterschiedliche Interessen dominieren“. Selbst von dem
„europäischen Musterschüler“ Deutschland wird der Bestand an
Gemeinsamkeiten, die Solidarität und der Zusammenhalt sehr kritisch
gesehen: nur ein Fünftel ist hiermit zufrieden!
Trotz aller Probleme ist Europa für 55% der Deutschen die
Zukunft, obwohl nur 27% überzeugt sind, dass die deutsche
Mitgliedschaft in der EU mehr Vorteile als Nachteile mit sich
bringt. (Knapp 40% für Ausgleich von Vor- und Nachteilen).
9) Wenn selbst in Deutschland nur ein Drittel der
Bevölkerung Vertrauen in die EU hat, während 70% dafür sind,
Mitglied in der EU zu bleiben, dann muss der Aussagewert des
Eurobarometers hinterfragt werden. Könnte es sein, dass diese
Auffassung rein formal aus Artikel 9, Satz 2 und 3 des EU-Vertrages
(Lissabon) abgeleitet wurde? Dort steht „Unionsbürger ist, wer die
Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzt. Die
Unionsbürgerschaft tritt zur nationalen Staatsbürgerschaft hinzu,
ersetzt sie aber nicht.“ Sich als Europäer zu begreifen,
kann aber auch Ausdruck einer Wertung sein; nämlich sich mit Europa
zu identifizieren, eine eigene europäische Identität zu fühlen,
sich mit allen anderen Europäern verbunden zu wissen, ein Gefühl
der Zugehörigkeit und ein Bewusstsein des Zusammenhalts, also ein
„Wir-Bewusstsein“ zu haben. Einer so verstandenen Gemeinschaft von
Europäern sollte es leicht fallen, die Europäische Union mit allen
ihren Stärken und Schwächen als die Wirklichkeit der europäischen
Idee zu akzeptieren, die der Reform bedarf!
Wenn das so wäre, dann gäbe es einen Wettbewerb unter den
Regierungschefs der Mitgliedsländer, wer am meisten für Europa
mittels der Europäischen Union tut. Dann wäre es auch
selbstverständlich, dass eine EU freundliche Einstellung das
Schaffen von Problemen durch einzelne Mitgliedsländer oder ihre
regionalen Glieder, wie z.B. die Wallonie bei Ceta, nicht zulässt.
Sonderregelungen zu Gunsten dieser Region, die so erreicht werden,
schaden der EU als Gemeinschaft, ihrer Handlungsfähigkeit und ihrem
internationalen Ansehen. Ein solches Vorgehen beeinträchtigt auch
den Zusammenhalt der Europäer. Denn der Wunsch der Bürger, ernst
genommen zu werden, kann nur allen, aber nicht jedem Einzelnen
erfüllt werden. Wenn 0,7% der EU Bürger ein Vetorecht beanspruchen,
dann wird das von den übrigen 99% wohl kaum als legitim
empfunden!
Der Mangel an Solidarität und an Respekt vor den
EU-Verträgen in Verbindung mit dem Nichteinhalten des Vereinbarten
belastet das Verhältnis der Mitgliedsländer untereinander und das
zur Europäischen Union. Bei diesen Eindrücken wenden sich die
Bürger von der EU ab!
Diese Situation erfordert Reformen! Wenn schon in
Deutschland mit seiner sehr europafreundlichen Bevölkerung drei
Viertel grundlegende politische Reformen in der EU für nötig, aber
nur ein Viertel solche Reformen für wahrscheinlich hält, kann man
auf noch größere Reformskepsis in den anderen EU-Ländern
schließen.
10) Besonders ausgeprägt sind die Meinungsverschiedenheiten
zwischen den Mitgliedsländern im Euro-Währungsgebiet: Die
Maastricht Konvergenzkriterien, nach denen Staatsverschuldung und
Haushaltsdefizit 60% bzw. 3% des BIP nicht überschreiten dürfen,
werden von einigen Ländern als „Austeritäts-Politik“ bekämpft und
nicht eingehalten. Frankreich, Italien, Spanien, Portugal und
Griechenland wollen mit höheren Staatsausgaben in ihren Ländern
„die Konjunktur ankurbeln“, aber zugleich Strukturreformen strecken
oder im Hinblick auf bevorstehende Wahlen möglichst vermeiden. Das
Eintreten Deutschlands für ein Einhalten dieser Kriterien wird als
„Spardiktat“ zurückgewiesen. Die Rücksichtnahme der EU-Kommission
beim Verhängen von Sanktionen gegen Länder, die nicht die
notwendigen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung ergreifen, stellt
die Einhaltung vertraglicher Verpflichtungen in den Bereich der
Beliebigkeit. Herr Draghi, der Präsident der EZB, hat oft darauf
hingewiesen, dass die Geldpolitik der EZB Strukturreformen in den
Ländern erleichtern soll, aber auch voraussetzt. Es versteht sich,
dass die Null-Zins-Politik die hochverschuldeten Länder am
stärksten entlastet und damit in den Haushalten Raum für
Investitionen schafft. Wachstum durch öffentliche
„Konjunkturspritzen“ ist zumeist ein Strohfeuer, während Wachstum
durch Wettbewerbsvorsprung längerfristig wirkt.
Investoren mit langfristiger Perspektive suchen Zielländer
mit sozialer und politischer Stabilität. Der dargestellte Dissens
in der EU beeinträchtigt das Vertrauen von Investoren in die
Stabilität der EU. Das gilt ebenfalls für die Bürger der EU, vor
allem für die Sparer im Euro-Raum! Die Auswirkungen dieser
Null-Zins-Politik für Banken, Lebens- und Krankenversicherungen und
Unternehmen mit Betriebsrenten werden inzwischen ebenfalls
sichtbar.
11) 2015/2016 stellte die Migration, also
die starke Zunahme von Menschen, die in der EU Zuflucht suchten,
die Regeln und die Werte der EU auf eine Probe, deren Ergebnisse
nicht befriedigen können. Die Schwierigkeiten sind Ihnen allen
bekannt. Die Lösungsansätze schaffen zum Teil neue Abhängigkeiten.
Die Verbesserung der Lebenschancen in den Herkunftsländern wird
eine Daueraufgabe! Sie kann nur gelöst werden, wenn dort Frieden
hergestellt wird und funktionierende Staatswesen auf- bzw.
ausgebaut werden.
Die Bereitschaft der EU-Länder, Migranten und Flüchtlinge
aufzunehmen und zu integrieren, zeigt eine Bandbreite von „Null“
bis „ohne Obergrenze“. Weder die Verfahrensregeln noch das
Einfordern von Solidarität allein werden hier Einvernehmen
schaffen. Ein Abwägen von „Solidarität“ und „Freiwilligkeit“ sollte
Kompromisse ermöglichen, die eine Gleichwertigkeit, aber keine
Gleichartigkeit der Beiträge anstreben könnten. Dieser Ansatz muss
allen Europäern vermittelt werden!
12) Auf den ersten Blick wirkt die Europäische Union beim
Thema „Frieden“ harmonischer als beim Thema „Euro“ und
Migration.
Ich bin überzeugt, dass die Frieden stiftende und Frieden
bewahrende Wirkung der EU sich nicht nur in Europa bewährt. Der
Zerfall Jugoslawiens und die darauf folgenden Kriege, die uns die
Brüchigkeit der Friedensordnung Europas schrecklich zeigten,
konnten durch die Nato beendet werden. Denn es gab die Option einer
Aufnahme der entstehenden Länder in die EU mit dem Versprechen von
Frieden, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit und
Wohlstand.
Im Umfeld der EU gibt es zurzeit viele bedrohliche
Auseinandersetzungen: Russland und Ukraine, Türkei und Kurden,
Syrien, Irak, Iran und Saudi-Arabien, Iran und Israel, IS, Libyen,
verbunden mit großen Migrationsbewegungen. „Wir Europäer“ haben
also zu Recht Angst.
Es gibt also viele Aufgaben für die richtige Kombination von
Ordnungsfaktoren im Rahmen der Globalisierung. Ob die „weiche“
Macht der EU in Verbindung mit der militärischen Macht der NATO
ausreicht, bleibt offen. In der Praxis ist die „gemeinsame Außen-
und Sicherheitspolitik“ der EU, also die Rollenverteilung zwischen
der EU und den Nationalstaaten, von Vielstimmigkeit geprägt.
Zurzeit dominieren die Initiativen der Staaten auf diesem Gebiet.
Dieser Zustand kann den Wunsch der Bürger nach Sicherheit kaum
befriedigen.
Ob und in welchem Maße die NATO als wirksamer Garant der
äußeren Sicherheit Europas diese Aufgabe künftig weiter wahrnehmen
wird, ist schwer abzuschätzen. Im Wahlkampf hat der nächste
Präsident der USA eine deutlich isolationistische Richtung gezeigt:
er will Europa auf Eigenverantwortung unter erhöhtem Mitteleinsatz
verpflichten, indem er den Eigeninteressen der USA Vorrang vor
internationaler Verantwortung gibt.
„Wir Europäer“ sind durch Flüchtlinge und Migranten, zu
mittelbar Betroffenen der bewaffneten Konflikte und der Fälle von
Staatsversagen in den angrenzenden Großräumen geworden.
Haben wir den notwendigen Selbstbehauptungswillen, um für
unsere Lebensweise, unsere Freiheit und für unsere Werte auch
außerhalb Europas einzustehen? Wenn die Europäische Union zu dieser
Frage eine gemeinsame Antwort findet, überwiegen die Chancen für
Europa, bei Alleingängen allerdings die Risiken!
Was bedeutet der Brexit für die Sicherheitspolitik? Wird der
Einfluss Europas in der NATO und im Sicherheitsrat der UNO dadurch
geschwächt? Ich befürchte, dass das geschieht. Bei den
Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens sollte der
Sicherheitsaspekt im Verhältnis zum Zugang zum Binnenmarkt
berücksichtigt werden. Politisch und wirtschaftlich ist eine
möglichst enge Beziehung von Europäischer Union und Großbritannien
wünschenswert.
13) Das Wohlstandsversprechen der EU hat sich für
viele Bürger, aber nicht für alle erfüllt. Die Arbeitslosigkeit ist
in den Krisenländern erschreckend hoch und die
Jugendarbeitslosigkeit belastet die Gegenwart und bedroht die
Zukunft. Das Rezept, Finanzhilfen mit der Verpflichtung zu
Strukturreformen zu verbinden, beginnt zu wirken: aber das Wachstum
bleibt bescheiden, zumal viele Reformen nur widerwillig und spät
beschlossen und dann noch zögerlich verwirklicht werden.
Reformkritische Parteien haben in Portugal und Griechenland
Mehrheiten gewonnen und in Spanien die Regierungsbildung lange
verzögert. Das in Italien vorgesehene Referendum und die Wahlen in
Frankreich lassen eine Zunahme der reformkritischen Parteien
erwarten. Denn die Lasten der Reformen werden schon heute gespürt,
die angestrebten Vorteile bei Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum
stellen sich erst in Zukunft ein. Opfer und Gewinner der Reformen
sind häufig nicht identisch. Wer heute Einschnitte bei seinem
Lebensstandard hinnehmen muss, kann hoffen und erwarten, dass er
damit Kindern und Enkeln bessere Lebenschancen verschafft. Dieser
Zusammenhang muss überzeugend erklärt werden! Dann steigen die
Chancen des Gelingens!
Es ist eine schwierige Aufgabe, den Bürgern der
Reformländer zu verdeutlichen, dass das nach europäischen Maßstäben
gute Abschneiden der deutschen Wirtschaft durch die Reformen der
„Agenda 2010“ gefördert wurde, aber vor allem auf
Wertschöpfungsnetzwerken beruht. Diese Wertschöpfungsnetzwerke
umfassen mittelständische und große Unternehmen in Deutschland und
europäischen Nachbarländern sowie gute Positionen in den
wichtigsten Märkten der Welt. Wettbewerbsvorteile sind im
Heimatmarkt Europa erarbeitet worden und werden global genutzt. Die
Rahmenbedingungen für die Tätigkeit dieser Unternehmen werden
politisch bestimmt. Dabei strebt die Politik Deutschlands
gelegentlich eine Vorreiterrolle an, die wie z.B. bei der
„Energiewende“ wenig Nachahmer findet. Der
Handelsbilanzüberschuss Deutschlands führt bei den
Nachbarländern in der EU, bei der EZB und auch in den USA zur
Forderung, Deutschland solle eine Politik zur Verringerung
deutscher Überschüsse verfolgen. Das bedeutet konkret, durch
Erhöhung von Löhnen, Gehältern und Renten soll die Binnennachfrage
gestärkt und durch höhere Investitionen, z.B. in Infrastruktur, die
„Konjunktur angekurbelt“ werden. Als weitere Wirkung einer solchen
Politik wird auch eine Trendzunahme der Inflation in Richtung des
EZB-Zielwertes von nahe bei, aber unter Zwei Prozent p.a.
erwartet.
Die nicht bezweckte, aber wahrscheinliche Nebenwirkung
dieser Politik wäre eine Verschlechterung der globalen
Wettbewerbsfähigkeit.
14) Verunsicherte Menschen suchen ein Weltbild, eine
Orientierung, die sie von den Eliten in Politik, Wissenschaft,
Kultur und Wirtschaft verlangen. Sie wollen, dass die
„Meinungsführer“ ihnen die Welt verständlich erklären. Das gewohnte
Weltbild muss auf den neuesten Stand gebracht werden; den
„Abschieds-Schmerz“ kann man aber nicht allein mit Daten und Fakten
lindern. Wir wollen wissen, wohin die Reise gehen soll; wir wollen
uns aber auch am Zielort wohlfühlen!
Es hilft nicht, die moderne arbeitsteilige Welt im Zeitalter
der Globalisierung kritisch mit der romantisch verklärten „guten
alten Zeit“ zu vergleichen! Der Konstanzer Philosoph Jürgen
Mittelstraß nennt unter Bezug auf Leonardo da Vinci unsere Welt die
„Leonardo-Welt“, weil wir in einer Welt leben, die- mit seinen
Worten – in ihrem heutigen Zustand „das Werk des Menschen
ist“.
Unsere Welt der globalen Arbeitsteilung ist komplex,
schwierig, nicht gerecht, z.B. beim Verbrauch der Ressourcen, und
neigt zu Übertreibungen. Aber in dieser Welt mit raschem
Bevölkerungswachstum haben sich mehr als eine Milliarde Menschen
vom Elend absoluter Armut befreien können! Wir müssen die
Herausforderung aufgreifen, die Lebensbedingungen der vielen
Menschen, die heute noch im Elend existieren, zu verbessern. Statt
an dieser Welt zu verzweifeln, müssen wir die Lebens- und
Gestaltungschancen verantwortlich nutzen! Wir sind aufeinander
angewiesen! Alles hängt mit allem zusammen!
Aber vielen Menschen in Europa fehlt die gewohnte
Geborgenheit bekannter Strukturen. Sie können die Zusammenhänge
nicht erkennen. Das gilt schon für die Welt der Industrie, erst
recht für die beunruhigende Entwicklung der Finanzwirtschaft! Wer
zwischen Ursache und Wirkung keine Verbindung erkennen kann, neigt
dazu, die Ergebnisse einfach hinzunehmen oder das Vertrauen in die
Entscheider zu verlieren. Die Sichtbarkeit wirtschaftlichen
Handelns erleichtert seine Anerkennung. Die internationalen Liefer-
und Leistungsbeziehungen vieler Unternehmen sind dieser
„Sichtkontrolle“ in der Regel nicht zugänglich. Diese Unternehmen
müssen sich daher um das Verständnis der Gesellschaft bemühen,
damit die Gesellschaft anerkennt, dass die unternehmerische
Freiheit verantwortlich genutzt wird. In vielen Fällen kommt
es für die Akzeptanz des Handelns vorrangig auf die Glaubwürdigkeit
der Führungspersönlichkeiten an.
Das „Leitbild für verantwortliches Handeln in der
Wirtschaft“, das in Zusammenarbeit mit dem „Wittenberg Zentrum für
globale Ethik“ entwickelt wurde, ist eine Selbstverpflichtung von
rund sechzig Unternehmen und Institutionen in Deutschland. Es dient
auch dazu, das Verhältnis von Gesellschaft, Politik und Wirtschaft
zu verbessern. Das erste Prinzip dieses Leitbildes lautet: „Die
Wirtschaft muss das Wohl der Menschen fördern“.
15) Das Wohl der Menschen soll auch die Strategie der
Europäischen Union fördern!
Bei der Vorstellung der politischen Leitlinien für diese
Europäische Kommission verglich Jean-Claude Juncker die Maßnahmen
während der Finanz- und Wirtschaftskrise „mit der Reparatur eines
brennenden Flugzeuges während des Fluges“. Er sagte, das
„Schlimmste konnte verhindert werden, Binnenmarkt und die
Integrität des Euro-Währungsraumes konnte gewahrt werden.“ Er
wollte das Vertrauen der europäischen Bürgerinnen und Bürger
zurückgewinnen. Er nannte als seine erste Priorität die Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit Europas und der Belebung der
Investitionstätigkeit, um auf diese Weise neue Arbeitsplätze zu
schaffen.
Aber zwanzig Monate später schreibt BM Schäuble in der FAZ
zu „Europa zwischen Wunsch und Wirklichkeit“: „Die
Herausforderungen für Europa drängen sich zu einem Bündel von
Krisen … In zahlreichen Mitgliedstaaten schwindet die Zustimmung
der Bevölkerung zu Europa, das unfähig scheint, sich zu
einigen“.
Daher ergeben sich zwei Hauptfragen:
- Welche Strategie
verfolgt die EU?
- Überzeugt diese
Strategie? Ermutigt sie die Bürger der EU?
Mich hatte die im Jahr 2000 beschlossene Lissabon-Strategie
mit ihrem Mut beeindruckt, nämlich Europa bis 2010 zur
dynamischsten, wettbewerbsfähigsten wissensbasierten Region der
Welt zu machen.
Mit Stärkung der Innovationsfähigkeit, Reform der
Arbeitsmärkte und Sozialsysteme sowie der Vollendung des
Binnenmarktes waren zwar die richtigen Wachstumstreiber
identifiziert. Doch hätte es auch einer Aufbruchsstimmung bedurft,
die neue Technologien, Produkte und Dienstleistungen weniger als
Risiko und Bedrohung, sondern vielmehr als Chance
betrachtet.
Die 2010 beschlossene Strategie für Beschäftigung und
intelligentes, nachhaltiges sowie integratives Wachstum legt fünf
Ziele fest, die EU und Mitgliedstaaten bis 2020 erreichen
sollen:
- Erhöhung der
Beschäftigungsquote der 20- bis 64-Jährigen auf 75%.
- Erhöhung der
privaten und öffentlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung
auf 3% des BIP.
- Verringerung der
Treibhausgas-Emission im EU-Durchschnitt um 20% gegenüber 1990,
Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energiequellen am Gesamtverbrauch
auf 20% und Steigerung der Energieeffizienz um 20%.
- Senkung der
Schulabbrecherquote auf unter 10% und Erhöhung des Anteils der
Hochschulabsolventen unter den 30 – 34 Jährigen auf mindestens
40%.
- Verringerung der
Zahl der von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffenen oder
bedrohten Menschen um mindestens 20 Mio.
Fragen wir aber, ob eine Strategie richtig sein kann, die
mit einer Vielzahl von Zielen die Bürger eher verwirrt als
inspiriert. Entsteht so eine Aufbruchsstimmung? Wer sagt: „Das
schaffen wir!“?
16) Die Herren Juncker, Schulz, Tusk und Draghi vertreten
die Sache Europas und der EU-Strategie mit hohem persönlichem
Einsatz. Aber erreichen sie die Herzen der EU-Bürger? Ich
bezweifle das! Denn es fehlt ihnen der Resonanzboden einer
europäischen Öffentlichkeit. Es fehlt häufig auch das
Einfühlungsvermögen, das die Sprache bestimmt, die die Herzen der
Bürger erreichen und bewegen kann.
Wo bleiben die Liebeserklärungen an Europa?
Rechenschaftsberichte und Erläuterungen von Plänen sind kein Ersatz
für eine Liebeserklärung! Ich sage gerne: ich liebe Europa! Und
viele meiner Freunde und Bekannten teilen diese
Leidenschaft!
Meine Liebe zu Europa wurde durch die Heirat meiner
Schwester mit Claude Puech verstärkt. Meine Schwester und ihre
Familie haben mir das tägliche Leben in Frankreich mit der guten
Nachbarschaft in der französischen Provinz nahe gebracht. So war
die Schwiegermutter meiner Schwester weniger besorgt, dass sie eine
deutsche Schwiegertochter bekam, aber sehr besorgt, ob meine
Schwester gut kochen könne. Sie konnte und kann es zur allseitigen
Zufriedenheit!
Liebeserklärungen für Europa sind aber nicht gleichzeitig
Liebeserklärungen für die Europäische Union. Nicht Liebe, aber
Wertschätzung wird der EU entgegengebracht. Das kann aber
eigentlich nicht überraschen. Denn wer verliebt sich schon in einen
Binnenmarkt?
17) Die Briten, die für den Brexit stimmten, waren
sicher nicht in den Binnenmarkt verliebt! Nach meiner Einschätzung
ist es der Europäischen Union leider nicht gelungen, ihre Herzen zu
gewinnen. Ich bin überzeugt, dass diese Briten bei ihrer
Entscheidung nicht von einer Kosten- und Nutzenrechnung für die
Mitgliedschaft in der EU gegenüber dem Austritt bestimmt wurden.
Die Mehrheit für den Austritt kam in England zustande. Sie wurde
von vielen Faktoren geprägt, zum Beispiel: einer Empire-Nostalgie;
dem Willen, wieder souverän zu entscheiden mit dem Parlament und
der Queen als höchster Instanz; der Angst vor Überfremdung,
Fremdbestimmung und Identitätsverlust; dem Protest gegen das
Establishment und die Eliten; der Wut, sich als Verlierer zu sehen;
dem Zorn auf die Brüsseler Bürokratie und Gängelei, der
Unzufriedenheit mit der EU-Politik bei der Eurokrise,
Flüchtlingskrise und Haushaltsgestaltung, aber auch der Fülle
unrealistischer Versprechungen der Befürworter des Austritts und
den Schwächen der Kampagne für den Erhalt der
EU-Mitgliedschaft.
18) Risiken und Chancen für die Europäische Union
werden durch die Reaktionen auf das Brexit-Votum geprägt werden:
Priorität sollen Vorhaben genießen, die durch Taten und Erfolge die
EU-Bürger überzeugen, dass Europa wirklich die Zukunft ist. Nicht
die Zielsetzungen für seine ferne Zukunft, sondern pragmatische
Entscheidungen mit rasch sichtbaren Ergebnissen sind erforderlich.
Dabei gilt es, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und auf
manche Ideen für weitere Harmonisierung und Regulierung zu
verzichten, wie das Kommissionspräsident Juncker ja schon
angekündigt hat.
Eine „Neugründung Europas“, wie sie Professor Sinn mit
seinem Buch „Der schwarze Juni“ vorschlägt, bietet für Rat,
Kommission und Europäisches Parlament sowie die Öffentlichkeit ein
„Gedankenexperiment“, um das Wesentliche zu finden. Der
Zusammenhalt der Europäer gehört bestimmt dazu!
Zur Sicherung der Außengrenzen der EU ist mit dem Ausbau von
„Frontex“ eine wichtige Entscheidung getroffen worden. Erfolge
dieser Initiative dürfen auf öffentliches Interesse
rechnen.
Bei der Handhabung der Regeln für Asyl und Migration kann
nur ein Kompromiss gefunden werden, der in der Einigung über die
Gleichwertigkeit der Beiträge, wenn auch nicht der Gleichartigkeit
der Beiträge besteht. Länder, die Flüchtlinge nicht aufnehmen
wollen, müssten zumindest zu den Kosten beitragen. Für die Bürger
ist die Überzeugung, dass EU und Länder die Lage unter Kontrolle
haben, von großer Bedeutung.
Das gilt auch für die Probleme mit der Einhaltung der
Euro-Konvergenzkriterien: eine rasche Entscheidung, selbst wenn es
eine Ausnahme von den Regeln ist, überzeugt mehr als ein
Dauerstreit über finanzpolitische Grundsatzfragen, die eigentlich
durch den Wachstums- und Stabilitätsvertrag entschieden sind. Ein
Überdehnen der Regeln beeinträchtigt das Rechtsbewusstsein der
Bürger.
19) Beiträge der Wirtschaft zum Wachstum ihres
Heimatsmarktes Europa entsprechen ihrem eigenen Interesse. Über die
Gestaltung der Rahmenbedingungen kann im weltweiten
Standortwettbewerb manche Chance gewahrt, aber auch manches Risiko
realisiert werden. Die Wirtschaft in Deutschland und Europa sucht
Wettbewerbsvorteile durch Innovation, braucht also ein
innovationsfreundliches Klima.
Die Wahl der Rechtsform der S. E., also der „Societas
Europäa“ durch die Unternehmen hat symbolischen Wert und stärkt das
Wir-Gefühl. Denn diese Unternehmen bekennen sich damit zu Europa
als ihrer Heimat.
Alle persönlichen Begegnungen in Europa sind geeignet, den
Zusammenhalt zu fördern, zum Beispiel auch das Rekrutieren von
Führungsnachwuchs oder von Auszubildenden aus den
Nachbarländern.
Mir würde gefallen, wenn der 9. Mai, der Europatag der
Europäischen Union, nicht nur im Kosovo ein gesetzlicher Feiertag
wäre, sondern in der ganzen EU!
Risiken ergeben sich aus dem Verpassen der genannten
Gestaltungschancen. Dabei sind nach meiner Einschätzung die
internen Spannungen in der EU die größeren Risiken als die externen
Herausforderungen und Bedrohungen.
20) Der Dreiklang von Heimat, Vaterland und Europäischer
Union wird noch sehr lange unsere Identität bestimmen. Mit den
Worten von Prof. Wieland, des Rektors der Deutsche Universität für
Verwaltungswissenschaften Speyer, kann nur die EU ihren
Mitgliedstaaten Teilhabe an einer Stellung in der Welt vermitteln,
die grundsätzlich gleichrangig mit den Positionen der Großmächte
ist. (Rektoratsrede Nov 2011, S.6). Im internationalen Wettbewerb
um Einfluss auf die Entwicklung unserer Welt kann die EU nur
bestehen, wenn die Bürger diesen Verbund von Staaten
wirklich wollen. Die Fähigkeit der EU, europäische
Lebensweise und Werte weltweit zu vertreten, wächst mit der Stärke
des Zusammenhalts ihrer Bürger. Uns verbindet über die Grenzen von
Ländern und Sprachen hinweg die gemeinsame Geschichte und die
gemeinsame Zukunft, die Freude an der Vielfalt und Dichte der
europäischen Kultur, die Zuneigung zu unseren Nachbarn, der Respekt
voreinander und das Zutrauen zu unserer gemeinsamen Kraft. „Wir
Europäer“ lieben Europa, viele insgeheim, wenige sogar öffentlich.
Wir schätzen die Europäische Union und wollen ihre Reform!
Daher zum Schluss noch der Hinweis auf Salvador de
Madariaga, Karlspreis 1973, und sein Buch „Portrait Europas“
sowie auf Timothy Garton Ash und sein Buch „Jahrhundertwende“:
beide bekennen ihre Liebe zu Europa öffentlich.
Scheuen sie, meine Damen und Herren, sich bitte nicht, Ihre
stille Liebe zu Europa, Ihre Wertschätzung der EU und ihren
Reformwillen öffentlich zu bekennen! Denn damit können Sie aus dem
Fragenzeichen im Titel meiner Rede „Wir Europäer“ ein
Ausrufungszeichen machen! Dann könnte die Europa-Hymne gespielt
werden und wir alle könnten „Freude schöner Götterfunke…“ zur Musik
hinzu denken.
Ich danke Ihnen für ihre Aufmerksamkeit.
16.11.2016
Ein Schatz wechselseitiger Bereicherung
 v.l.: Pfarrer Steffen Schramm, Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Pastor Jochen Wagner, Kirchenpräsident Christian Schad, Ökumenereferent Thomas Stubenrauch
v.l.: Pfarrer Steffen Schramm, Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Pastor Jochen Wagner, Kirchenpräsident Christian Schad, Ökumenereferent Thomas Stubenrauch
„Zusammen wachsen“: Ökumenisch-geistlicher Übungsweg zum
Reformationsjubiläum vorgestellt
Speyer- Einen bundesweit einzigartigen
ökumenisch-geistlichen Übungsweg zum
Reformationsjubiläum/Reformationsgedenken haben die Evangelische
Kirche der Pfalz, das Bistum Speyer und die Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK – Region Südwest) in Speyer vorgestellt.
Unter dem Motto „zusammen wachsen“ gibt der Übungsweg
interessierten Einzelpersonen und Gruppen Impulse für persönliche
Glaubensübungen und
-erfahrungen. Er versteht sich als Beitrag, das
Reformationsjubiläum mit allen Konfessionen als gemeinsames
Christusfest zu begehen und nach dem zu suchen, was die
Konfessionen miteinander verbindet, erklärten Kirchenpräsident
Christian Schad, Bischof Karl-Heinz Wiesemann und der Vorsitzende
der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK – Region
Südwest), Pastor Jochen Wagner.
Im Rahmen des Reformationsjubiläums stehen zentrale Themen wie
Gnade, Rechtfertigung und Versöhnung im Mittelpunkt des Übungswegs,
der für einen Zeitraum von vier Wochen angelegt ist. Als Anregung
für persönliche Meditationen und Gruppentreffen in der Gemeinde
dienen vor allem Texte aus der Bibel. Zu Wort kommen aber auch
Martin Luther und andere Reformatoren, Stimmen aus der gemeinsamen
vorreformatorischen Zeit, aus der katholischen Reformbewegung sowie
aus anderen kirchlichen Traditionen und der Ökumene heute.
„Es zeigt sich, dass diese unterschiedlichen Traditionen ein
Schatz sind, mit dem wir uns wechselseitig bereichern“, sagte
Kirchenpräsident Christian Schad. Der Übungsweg leiste einen
Beitrag dazu, dass Menschen „neu mit Christus – und so auch als
Christen verschiedener Konfessionen untereinander zusammen
wachsen“. Dazu helfe der Blick auf die Grundanliegen der
Reformation, die zu Umkehr und geistlicher Erneuerung der Kirche
aufgerufen haben. „Im Kern ist die Reformation eine Bibelbewegung“,
betonte Schad.
Bischof Karl-Heinz Wiesemann begrüßte die gemeinsame Feier des
Reformationsjubiläums und die gemeinschaftliche Ausarbeitung des
Übungsweges. Auch für die katholische Kirche bestehe „Anlass zur
Dankbarkeit für wichtige und zentrale geistliche Impulse“ durch die
Reformatoren. Dazu gehöre auch die Überzeugung, „dass jeder
Getaufte mit dem gemeinsamen Priestertum beschenkt – und
mitverantwortlich ist für die Sendung der Kirche“, sagte Wiesemann.
Er dankte den Autoren für das „gelungene Werk“, das dabei helfe,
das ökumenische Miteinander in der Region weiter zu vertiefen.
Dass „zusammen wachsen“ den roten Faden vom Ökumenischen
Kirchentag (ÖKT) 2015 in Speyer weiterführe, zeigt nach Auffassung
von Pastor Jochen Wagner, dass es sich nicht um eine „Eventökumene“
gehandelt habe. Durch den Übungsweg werde das deutlich, „was uns
Christen miteinander verbindet: dass wir miteinander beten und
diskutieren“.
Mit dem ökumenisch-geistlichen Übungsweg knüpfen nach Aussage
von Pfarrer Steffen Schramm vom Protestantischen Institut für
kirchliche Fortbildung und Ökumenereferent Thomas Stubenrauch vom
Bistum Speyer die Initiatoren an die Erfahrungen im Vorfeld des ÖKT
an. Unter dem Motto „Aufstehen zum Leben“ hatten sich 28 Kirchen-
und Pfarrgemeinden an den „Exerzitien im Alltag“ beteiligt.
Hinweis: Am 28. Januar 2017 findet im Kloster in Neustadt
eine Einführungsveranstaltung zum ökumenisch-geistlichen Übungsweg
für Interessierte statt. Für Materialien und nähere Informationen
steht das Institut für kirchliche Fortbildung in der Luitpoldstraße
8 in 76829 Landau zur Verfügung.
Mehr zum Thema: http://institut-kirchliche-fortbildung.de/
Text: lk; Foto: Landeskirche/Klaus Landry
15.11.2016
Kirchen unterstützen jüdische Kultusgemeinde bei Anschaffung von zwei Tora-Rollen
 Marina Nikiforova von der Jüdischen Kultusgemeinde erläutert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (links) und Kirchenpräsident Christian Schad die Pläne zur Anschaffung von zwei neuen Tora-Rollen für die Synagogen in Kaiserslautern und Speyer.
Marina Nikiforova von der Jüdischen Kultusgemeinde erläutert Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (links) und Kirchenpräsident Christian Schad die Pläne zur Anschaffung von zwei neuen Tora-Rollen für die Synagogen in Kaiserslautern und Speyer.
Geschäftsführerin der jüdischen Kultusgemeinde traf sich mit
Bischof und Kirchenpräsident
Speyer- Das Bistum Speyer und die
Evangelische Kirche der Pfalz unterstützen die jüdische
Kultusgemeinde der Rheinpfalz bei der Anschaffung von zwei neuen
Tora-Rollen für die Synagogen in Speyer und Kaiserslautern. Bei
einem Treffen informierte Marina Nikiforova, die Geschäftsführerin
der jüdischen Kultusgemeinde, Kirchenpräsident Christian Schad und
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann über das Vorhaben.
Die Tora ist das heilige Buch im Judentum und besteht aus den
fünf Büchern Moses. Die Tora-Rolle wird aus vielen
Pergamentblättern zu einer sehr langen Rolle zusammengenäht.
„Geschrieben wird sie von einem sogenannten Sofer, einem speziell
geschulten Schreiber. Jeder Buchstabe in der gesamten Tora muss mit
Feder und einer speziellen Tinte geschrieben werden“, erläuterte
Marina Nikiforova. Bereits ein fehlender oder missratener Buchstabe
mache die Tora-Rolle unbrauchbar. Für das Schreiben einer
Tora-Rolle benötige der Sofer ungefähr ein Jahr.
Die jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz hatte sich Ende des
vergangenen Jahres zum Erwerb von zwei neuen Tora-Rollen für die
Synagogen in Speyer und Kaiserslautern entschlossen. „Durch den
ständigen Gebrauch sind die vorhandenen Tora-Rollen stark
beschädigt. So kann es jederzeit dazu kommen, dass sie nicht mehr
koscher sind und nach jüdischem Verständnis nicht mehr benutzt
werden dürfen“, erklärte Marina Nikiforova. Eine neue Tora-Rolle
kostet rund 25.000 Euro. Zur Finanzierung tragen eigene Mittel der
jüdischen Kultusgemeinde, mehrere Benefizveranstaltungen sowie die
Unterstützung zahlreicher Institutionen und Einzelpersonen bei. So
hat zum Beispiel der Vorsitzende der jüdischen Kultusgemeinde
Israil Epstein allein 5.000 Euro zum Kauf der neuen Tora-Rollen
beigesteuert.
Das Bistum Speyer und die Evangelische Kirche der Pfalz
beteiligen sich mit jeweils 5.000 Euro an den Anschaffungskosten
für die beiden Tora-Rollen. „Wir wollen damit ein Zeichen setzen,
dass Juden und Christen durch die Heiligen Schriften Israels
bleibend miteinander verbunden sind“, gab Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann als Grund für die Unterstützung an. Der Pentateuch, die
fünf Bücher Mose, seien auch für Christen grundlegend. Beide
Religionen hätten ein reiches gemeinsames geistliches Erbe, wovon
die Heilige Schrift Zeugnis gebe. Dass sich jüdisches Leben in der
Pfalz und in Deutschland neu entfalten könne, erfülle ihn mit
großer Dankbarkeit, sagte Bischof Wiesemann. Bestandteil der
katholischen Lehre sei ein „unwiderrufliches Nein zum
Antisemitismus“, betonte er.
Kirchenpräsident Christian Schad erinnerte daran, dass sich die
Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) auf dem Weg
zum Reformationsjubiläum nicht nur kritisch mit dem Verhältnis
Martin Luthers zu den Juden beschäftigt, sondern ausdrücklich auch
zum Thema der sogenannten „Judenmission“ Stellung genommen habe. In
der Kundgebung vom 9. November 2016 habe die EKD-Synode ein klares
Zeichen gegen die christliche Missionierung von Juden gesetzt,
erklärte Schad, der als Mitglied des Ausschusses „Schrift und
Verkündigung“ wesentlich an dem Papier mitgearbeitet hat. Die
Stellungnahme sei auch von dem Präsidenten des Zentralrats der
Juden, Josef Schuster, gewürdigt worden, der im vergangenen Jahr
eine klare Positionierung der EKD gefordert hatte. Mit der
Kundgebung anerkenne die EKD nun das Leid, das die über
Jahrhunderte praktizierte Zwangskonversion vieler Juden verursacht
habe. Wörtlich heißt es in dem von der Synode in Magdeburg
verabschiedeten Papier: „Christen sind – ungeachtet ihrer Sendung
in die Welt – nicht berufen, Israel den Weg zu Gott und seinem Heil
zu weisen. Alle Bemühungen, Juden zum Religionswechsel zu bewegen,
widersprechen dem Bekenntnis zur Treue Gottes und der Erwählung
Israels.“ is/lk
Spendenkonto zur Anschaffung von zwei neuen Tora-Rollen für
die Synagogen in Speyer und Kaiserslautern:
Jüdische Kultusgemeinde der Rheinpfalz
Sparkasse Vorderpfalz
IBAN DE84 5455 0010 0193 2025 12
Volksbank
IBAN DE94 5479 0000 0001 3813 34
15.11.2016
Gottesdienst mit Bischof Wiesemann zum Abschluss des Heiligen Jahres der Barmherzigkeit
 In Dom und Bistum
gab es zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit eine Reihe besonderer
Angebote für Pilger und Besucher
In Dom und Bistum
gab es zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit eine Reihe besonderer
Angebote für Pilger und Besucher
Speyer- Mit einem Pontifikalamt im Speyerer Dom am
Sonntag, den 13. November, um 10 Uhr wird Bischof
Dr. Karl-Heinz Wiesemann das Heilige Jahr der Barmherzigkeit im
Bistum Speyer abschließen. Es war von Papst Franziskus am 8.
Dezember 2015 ausgerufen worden.
Mit dem Gottesdienst endet auch das Angebot der „Heiligen
Pforte“. Seit dem dritten Adventssonntag im vergangenen Jahr
konnten Besucherinnen und Besucher die Kathedrale durch das
Otto-Portal im Südosten des Domes als „Heilige Pforte“ betreten. Es
ist dem heiligen Bischof Otto von Bamberg gewidmet, der beim Dombau
mitgewirkt hat. Die Heilige Pforte wurde, dem römischen Vorbild
folgend, mit Pflanzengrün geschmückt. Eine Hinweistafel erläuterte
den Besuchern Idee und Sinn des Heiligen Jahres und lud zum
Durchschreiten der Heiligen Pforte ein. Ausgehend von der Pforte
der Barmherzigkeit führte ein „Weg der Barmherzigkeit“ durch den
Dom. Ein Wegweiser bot Orientierung und lud die Besucher dazu ein,
sich eingehender mit der Barmherzigkeit Gottes zu befassen.
"Die Heilige Pforte wird zwar geschlossen, doch die
Barmherzigkeit Gottes geht weiter“, erklärt dazu Domkapitular Franz
Vogelgesang, der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge. Ebenfalls mit
Gottesdiensten am Sonntag werden die Heiligen Pforten in den
Wallfahrtsorten Maria Rosenberg, Blieskastel und
Ludwigshafen-Oggersheim geschlossen. Sie boten Gelegenheit, sich
mit der Bedeutung der Barmherzigkeit für das eigene Leben
auseinanderzusetzen. Eine diözesane Gebetskette zum Heiligen Jahr
der Barmherzigkeit nahm besonders die Werke der Barmherzigkeit in
den Blick.
„Nacht der Barmherzigkeit“ und Rom-Wallfahrt als
Höhepunkte
Ein Höhepunkt des Heiligen Jahres im Dom war die „Nacht der
Barmherzigkeit“ mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 1. Oktober.
Gemeinsam mit Jugendlichen hatte der Bischof zur Feier in den
Speyerer Dom eingeladen. Brüder aus Taizé waren zu Gast und
brachten gemeinsam mit einem Chor aus 200 Jugendlichen Stimmung und
die besondere Spiritualität des französischen Zentrums nach
Speyer.
Vom 8. bis zum 15. Oktober besuchten rund 150 Pilger aus der
Pfalz und der Saarpfalz zentrale Stätten des Glaubens in Rom.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und weitere Speyerer
Diözesanpriester begleiteten die Wallfahrt. Die Pilgergruppe aus
dem Bistum Speyer absolvierte in Rom ein umfangreiches Programm.
Treffen mit Christen aus der ganzen Welt, die ebenfalls der
Einladung von Papst Franziskus nach Rom gefolgt waren, machten die
Weltkirche konkret erfahrbar.
Ein weiterer Bestandteil des Heiligen Jahres waren die sieben
Abende der Barmherzigkeit, die von April bis November im Dom
stattfanden. Diese begannen um 18 Uhr mit einer Abendmesse. Im
Anschluss fand eine Aussetzung des Allerheiligsten und Prozession
in die Afrakapelle statt. Bis jeweils 22 Uhr gab es eine
Anbetungszeit mit Gesang und Lobpreis. Parallel bestand die
Möglichkeit, das Sakrament der Versöhnung zu empfangen. Den
Abschluss bildete ein Nachtgebet.
Ordentliche und außerordentliche Heilige Jahre in der
katholischen Kirche
Das Heilige Jahr ist ein Jubiläumsjahr in der katholischen
Kirche. Es wird regulär alle 25 Jahre begangen. Biblisches Vorbild
ist das Jubeljahr, ein alle 50 Jahre begangenes Erlassjahr. Das
erste Heilige Jahr wurde 1300 von Papst Bonifatius VIII.
ausgerufen. Ursprünglich als Jahrhundertereignis gedacht, wurde es
zunächst im Abstand von 50 und dann 33 Jahren wiederholt. Der
Rhythmus von 25 Jahren besteht seit 1470.
Zentrale Elemente der Heiligen Jahre wurden die Romwallfahrt,
die Heilige Pforte und der Ablass. Zum Ritual gehörte der Besuch
bestimmter Kirchen in Rom. Heute gehören acht Pilgerorte dazu,
darunter der Petersdom, die Lateranbasilika, die Basilika Santa
Maria Maggiore und die Katakomben.
Neben den "ordentlichen" Heiligen Jahren gab es wiederholt
außerordentliche Jubiläen, etwa 1566 angesichts der Bedrohung durch
die Türken, 1605 zum Amtstritt von Papst Paul V., 1983 als
besonderes Gedenkjahr der Erlösung, 1987 mit dem Themenschwerpunkt
Maria und 2008 anlässlich der Geburt des Apostels Paulus vor 2.000
Jahren. Auch das von Papst Franziskus vom 8. Dezember 2015 bis 20.
November 2016 ausgerufene Heilige Jahr der Barmherzigkeit fällt in
diese Kategorie. Um den Gläubigen weltweit die Möglichkeit zu
bieten, durch "Heilige Pforten" zu schreiten, gab es solche auch in
den jeweiligen Diözesen. is
09.11.2016
Familienbund der Katholiken im Bistum Speyer wählt neuen Vorstand
 Manfred Gräf ist
der neue Vorsitzende - Hede Strubel-Metz im Amt bestätigt
Manfred Gräf ist
der neue Vorsitzende - Hede Strubel-Metz im Amt bestätigt
Speyer/Ludwigshafen- Manfred Gräf ist
neuer Vorsitzender des Familienbundes der Katholiken im Bistum
Speyer. Der ehrenamtliche Beigeordnete des Rhein-Pfalz-Kreises,
Bürgermeister a. D. und ehemaliger Förderschullehrer aus
Bobenheim-Roxheim, wurde auf der Mitgliederversammlung des
Familienbundes einstimmig für vier Jahre ins Amt gewählt.
Stellvertretende Vorsitzende des Familienverbandes bleibt Hede
Strubel-Metz aus Ludwigshafen, Unterrichtsschwester der
Kinderkrankenpflege, die für die Kontinuität des Verbandes in den
vergangenen Jahren steht und in der kirchlichen Arbeit hohe
Anerkennung genießt.
Als Beisitzerinnen wurden die gelernte Erzieherin und
sozialpädagogische Familienhelferin Christel Gräf aus
Bobenheim-Roxheim sowie die Erzieherin Bärbel Buschbacher aus
Limburgerhof einstimmig gewählt. Beide kommen aus der kirchlichen
Jugendarbeit, engagieren sich für Kinder und Familien in
verschiedenen Zusammenhängen. Bärbel Buschbacher ist seit 25 Jahren
politisch aktiv in Gemeinderat und Kreistag.
Katharina und Felix Goldinger aus Dudenhofen sind die neuen
Geistlichen Beiräte des Familienbundes im Bistum Speyer. Katharina
Goldinger betreut den Bereich Öffentlichkeitsarbeit in der
Jugendseelsorge, Felix Goldinger ist Initiator der Netzgemeinde
da_zwischen und Referent für Katechese und missionarische Pastoral
im Bistum Speyer. Sie sind Eltern von drei Kindern. Zum ersten Mal
wird ein Ehepaar arbeitsteilig die Position des Geistlichen
Beirates einnehmen. Sie wurden von der Versammlung einstimmig in
ihr Amt gewählt.
In angenehmer und guter Atmosphäre wurde den ausscheidenden
Mitgliedern Helga Schädler, dem geistlichen Beirat Pfr. Bernhard
Linvers, Dr. Susanne Ganster, MdL, Dr. Bernhard Sowodniok und
Jeannette Sommer für langjähriges ehrenamtliches Engagement für den
Familienbund Speyer gedankt. Alle werden auch in der Zukunft dem
Familienbund der Katholiken im Bistum verbunden bleiben.
Der neu gewählte Vorstand kündigte an, dass der Familienbund als
Stimme der Familien auch zukünftig aktiv gegenüber Politik, Kirche
und Gesellschaft für die Interessen der Familien und ein
kinderfreundliches Gemeinwesen eintreten werde.
Dem Familienbund der Katholiken im Bistum Speyer gehören elf
Mitgliedsverbände beziehungsweise Einrichtungen an. Der
Familienbund der Katholiken ist der mitgliederstärkste
Familienverband Deutschlands. Ihm gehören 25 Diözesan-, 10 Landes-
und 15 Mitgliedsverbände auf Bundesebene an.
www.familienbund.org Text:
is; Foto: Manfred Gräf © Familienbund
10.11.2016
Spannende Gespräche mit dem Vatikan
 Kirchenpräsident Schad
erstattet in Magdeburg Bericht zum Stand der Ökumene
Kirchenpräsident Schad
erstattet in Magdeburg Bericht zum Stand der Ökumene
Magdeburg/Speyer- Als „Auftakt zu neuen,
unverkrampften ökumenischen Anstrengungen“ hat der pfälzische
Kirchenpräsident Christian Schad die Feiern zum
Reformationsjubiläum 2017 bezeichnet. Es gehe darum, die Freude an
der Ökumene zu stärken, erklärte Schad bei seinem Bericht über den
Stand der evangelisch-katholischen Gespräche und Beziehungen bei
der gemeinsamen Tagung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen
Kirche Deutschlands (VELKD) und der Union Evangelischer Kirchen
(UEK) in Magdeburg. Schad leitet die evangelische Delegation beim
Kontaktgesprächskreis von EKD und Deutscher Bischofskonferenz sowie
die zwischen der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE) mit dem Päpstlichen Rat zur Förderung der Einheit der
Christen.
Die reformatorischen Grundeinsichten führten geradewegs zu einer
Reformation, die noch ausstehe, sagte Schad. Damit käme eine Kirche
in den Blick, die von begeisterten Männern und Frauen getragen sei;
ebenso von streitbaren, evangelischen Geistlichen, die Predigt und
Unterricht theologisch argumentativ untermauerten. In der
Konzentration auf Gottes unverdiente Gnade, könne die Kirche
liebevoll auf den Nächsten zugehen, und eine Frömmigkeit
praktizieren, die sie in die Welt hinaus ziehe. In ökumenischer
Gemeinschaft solle eine vielstimmige Sprache gefunden werden, „die
aus dem biblischen Wort erwächst und die Herzen der Menschen
erreicht“, so Schad.
Der Kirchenpräsident sieht im Reformationsjubiläum einen
wesentlichen Motor „für eine neu aufbrechende Ökumene“. Das
Grundanliegen der Reformation als Ruf zu Umkehr und geistlicher
Erneuerung würden inzwischen viele katholische Christen mit den
reformatorischen Glaubensgeschwistern teilen. Es sei Zeit, sich von
den Fehlurteilen und Feindbildern der Vergangenheit zu
verabschieden. Dem diene der Buß- und Versöhnungsgottesdienst am
11. März 2017 in Hildesheim unter dem Motto „Erinnerung heilen –
Jesus Christus bezeugen“. Zusammen mit dem Speyerer Bischof
Wiesemann werde er am 12. März 2017 einen solchen Gottesdienst in
der Abteikirche Otterberg mit Vertretern der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen in Deutschland (ACK) feiern, erklärte
Schad.
Spannende Gespräche gibt es nach Auskunft von Schad zwischen der
GEKE und dem Vatikan zum Thema „Kirchengemeinschaft“. Als Ergebnis
der Gespräche erhoffe er sich im Blick auf das Kirchenverständnis
einen „differenzierten Konsens“, also eine Übereinkunft darüber,
trotz aller Verschiedenheit, das Kirchesein des jeweils anderen
anzuerkennen. Dementsprechend sehe der ökumenische Arbeitskreis
evangelischer und katholischer Theologen, dem er angehöre, „die
Pluralität der Konfessionskirchen seit der Reformation auch als
Gewinn und Bereicherung“.
Schad stimmte ausdrücklich dem „Wort der ACK zu 500 Jahre
Reformation“ zu, nach dem die Bibel als Quelle und Norm des Lebens,
die Ausrichtung auf Gottes Gnade und das Priestertum aller
Christinnen und Christen als gemeinsame Grundlage aller ACK-Kirchen
festgestellt wird. Man wolle in „Dankbarkeit für das erreichte
Vertrauen zueinander“ den ökumenischen Weg weitergehen. Text:
lk; Foto: pem
05.11.2016
Katholische Erwachsenenbildung unterstützt Projekt „Stolpersteine“
Neue Initiative für Gedenken an die Opfer des
Nationalsozialismus
Speyer- In die Speyerer Diskussion um die
Verlegung sogenannter Stolpersteine als Erinnerung an die
Verfolgten der Nazi-Diktatur kommt neue Dynamik – dies möchte die
Katholische Erwachsenenbildung mit einem Brief an die
Fraktionsvorsitzenden des Speyerer Stadtrates unterstützen.
Die Katholische Erwachsenenbildung Diözese Speyer (KEB)
engagiert sich nach Angaben von Erhard Steiger (Bildungsreferent
der KEB) in einem breiten Bündnis gemeinsam mit der Arbeitsstelle
Frieden und Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz, der
Jüdischen Kultusgemeinde der Rheinpfalz, der Deutsch-Israelischen
Gesellschaft und der Stadt Speyer für die Erinnerung an die Opfer
des Nationalsozialismus. Im Rahmen der Aktion „Erinnern – Gedenken
– Mahnen“, die 2017 zum zwanzigsten Mal stattfindet, organisiert
die Katholische Erwachsenenbildung in Speyer anlässlich des
Gedenktages für die Opfer des Nationalsozialismus alljährlich rund
um den 27. Januar eine öffentliche Gedenkstunde sowie vertiefende
Ausstellungen und Begleitveranstaltungen.
„Die Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus hat zum
Glück ihren festen Platz im Leben in Speyer. Die Stolpersteine
wären aus unserer Sicht eine wertvolle Ergänzung des
bürgerschaftlichen Engagements und würden dem Gedenken der Opfer
noch eine weitere und öffentliche Form geben“, so Thomas Sartingen
(Bischöflicher Beauftragter für Erwachsenenbildung).
is
04.11.2016
3.297 Jahre gelebte Diakonie
 Mitarbeiterjubiläum der Diakonissen
Speyer-Mannheim
Mitarbeiterjubiläum der Diakonissen
Speyer-Mannheim
Speyer- 139 Mitarbeitende der Diakonissen
Speyer-Mannheim feiern in diesem Jahr ihre mindestens 25jährigen
Dienstjubiläen. Viele von ihnen feierten die runden Jubiläen am 2.
November mit einer Andacht und einem Festakt im Mutterhaus,
darunter auch Mitarbeitende, die bereits auf 40 oder sogar 45 Jahre
Betriebszugehörigkeit zurückblicken.
Mit den Jubilaren und ihren Gästen blickte Vorsteher Pfarrer Dr.
Günter Geisthardt auf ihr Engagement in Einrichtungen für kranke
und alte Menschen, für Kinder, Jugendliche und Menschen mit
Behinderung oder in der Verwaltung zurück. „An ganz
unterschiedlichen Stellen haben sie ihre Gaben eingesetzt im Dienst
für andere, haben damit die Gesellschaft mitgeprägt und verändert,
auch gegen Widerstände.“, betonte er.
Landesdiakoniepfarrer Albrecht Bähr überreichte den Jubilaren
die Kronenkreuze in Gold als höchste Anerkennung der Diakonie
Deutschland mit den Worten: „Überall wo Menschen mit ihren
unterschiedlichen Begabungen, mit Zeit, Kraft und Liebe sich
einsetzten um anderen zu helfen, tragen sie dazu bei, die Würde des
einzelnen zu wahren und im Sinne der Nächstenliebe der
Menschenfreundlichkeit Gottes in der Welt Raum zu geben. Für diesen
wertvollen Dienst dankt die Diakonie allen und zeichnet heute
insbesondere diejenigen aus, die seit vielen Jahren dazu beitragen,
Menschen das Leben zu erleichtern."
Abschließend überbrachte Christel Hauser die Glückwünsche der
Mitarbeitervertretungen der Diakonissen Speyer-Mannheim und ihrer
Gesellschaften, bevor der Abend zu Klängen des Saxophonquartetts
„Sax4Fun“ ausklang. Text und Foto: Diakonissen
Speyer-Mannheim
03.11.2016
Solidarität über eigenen Tellerrand hinaus
.jpg) Gruppenfoto vom Partnerschaftstreffen.
Gruppenfoto vom Partnerschaftstreffen.
Partner aus Ghana, Korea und der Pfalz haben bei Treffen
in Seoul gemeinsame Ziele erarbeitet
Seoul/Landau- Eine intensive Vernetzung
und gegenseitige Solidarität haben die Vertreter der
Presbyterianischen Kirchen von Korea und Ghana sowie der
Evangelischen Kirche der Pfalz bei einem Treffen in der
südkoreanischen Hauptstadt Seoul bekräftigt. Bei der Begegnung
besuchten die Delegationen der seit 2011 bestehenden Trilateralen
Partnerschaft die soziale Einrichtung Urban Industrial Mission
(UIM) des Yeong Dong Po-Kirchenbezirks in Seoul. Zielsetzungen wie
etwa der Ausbau der gemeinsamen Computerschule in Ghana wurden bei
einem Partnerschaftsseminar erarbeitet.
Die Evangelische Kirche der Pfalz verbindet eine lange Tradition
der Solidarität mit der Sozialeinrichtung UIM. Daher hatten die
Delegierten aus Deutschland diesmal auch einen Scheck über 6.000
Euro im Gepäck. „Gemeinsam mit den Armen zu leben, ist unsere
Antwort auf Gottes Auftrag an uns Menschen“, erklärte
UIM-Generalsekreätär Pfarrer Bang Joo Chin. Die pfälzische
Oberkirchenrätin und langjährige Pfarrerin für Weltmission und
Ökumene beim Missionarisch-Ökumenischen Dienst (MÖD), Marianne
Wagner, zeigte sich beeindruckt von der Arbeit: „Ihr Dienst für die
Menschen an den Rändern der Gesellschaft ist ein lebendiges Zeugnis
Jesu Christi.“.jpg)
Die Spende aus der Pfalz werde Menschen, die sich in einer
schwierigen Situation in ihrem Leben befinden, zugute kommen,
versprach der UIM-Generalsekretär. So beispielsweise den
Obdachlosen, die in der Notunterkunft täglich eine warme Mahlzeit
bekommen und einen Platz zum Duschen und Schlafen finden. Seit Ende
der 1950er Jahre setzt sich die Urban Industrial Mission für
Frieden und Gerechtigkeit in der koreanischen Gesellschaft ein.
Pfarrer Florian Gärtner, der 2017 beim
Missionarisch-Ökumenischen Dienst die Nachfolge von Marianne Wagner
antritt, will den Blick über den Tellerrand stärken: „Mein Wunsch
für die Zukunft unserer trilateralen Partnerschaft ist, dass wir es
schaffen, Menschen aus unseren Kirchen zu vernetzen, sodass sie
sich über gemeinsame Interessen, Fragen und auch den Alltag in dem
jeweiligen Land austauschen – das Internet und die Sozialen
Netzwerke machen es möglich.“
.jpg) Die
neuen Medien und die Entwicklungen in der Computerwelt bringen
viele neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich,
stellten die drei Partner mit Blick auf ihre gemeinsame
Computerschule in Ghana fest. Hier müssten neue Ausbildungsgänge
entwickelt und damit die Zukunft des Projekts gesichert werden,
sind sich Pfarrer In Myung-Jin aus Korea und sein ghanaischer
Kollege, Pfarrer Samuel Ayete-Nyampong, einig. „Unser Bemühen, die
Welt ein Stück besser und dadurch Gottes Liebe spürbar zu machen,
vereint uns in unserer ökumenischen Partnerschaft“, so Pfarrer
Samuel Ayete-Nyampong aus Ghana.
Die
neuen Medien und die Entwicklungen in der Computerwelt bringen
viele neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich,
stellten die drei Partner mit Blick auf ihre gemeinsame
Computerschule in Ghana fest. Hier müssten neue Ausbildungsgänge
entwickelt und damit die Zukunft des Projekts gesichert werden,
sind sich Pfarrer In Myung-Jin aus Korea und sein ghanaischer
Kollege, Pfarrer Samuel Ayete-Nyampong, einig. „Unser Bemühen, die
Welt ein Stück besser und dadurch Gottes Liebe spürbar zu machen,
vereint uns in unserer ökumenischen Partnerschaft“, so Pfarrer
Samuel Ayete-Nyampong aus Ghana.
Die Evangelische Kirche der Pfalz unterhält seit 1984
partnerschaftliche Beziehungen zur Presbyterianischen Kirche von
Korea, insbesondere zum Kirchenbezirk Yeong Dong Po. Zu dieser
Partnerschaft kam 2001 noch eine dritte Kirche hinzu: die
Presbyterianische Kirche von Ghana. Christinnen und Christen aus
Korea, Deutschland und Ghana können in dieser Trilateralen
Partnerschaft erleben, was weltumspannendes Christentum
bedeutet.
Text: möd/lk; Foto: MÖD/Corinna Waltz
02.11.2016
Kinder das Bestmögliche bieten
.jpg)
Drei Speyerer Kitas mit dem Evangelischen Gütesiegel BETA
ausgezeichnet
Speyer- Sie sind ausgezeichnete
Kindertagesstätten: Den protestantischen Kitas Kastanienburg, Arche
Noah und Villa Kunterbunt des Kirchenbezirks Speyers ist Ende
September bei einem Festakt das Evangelische Gütesiegel BETA
verliehen worden. Es ist der sichtbare Beleg dafür, dass die Kitas
und ihr Träger die Qualität ihrer Arbeit systematisch sichern und
weiterentwickeln.
„Die Zertifizierung ist kein Endpunkt, sondern ein Meilenstein“,
sagt der Leiter der protestantischen Kindertagesstätte
Kastanienburg, Markus Holländer. Denn Qualitätsmanagement und
–sicherung müsse fortwährend geleistet werden. Der 51Jährige
Pädagoge freut sich sichtlich über die Zertifizierung mit dem
Evangelischen Gütesiegel BETA. „Es ist eine Würdigung unserer
Arbeit und aller Mitarbeitenden“, sagt der Einrichtungsleiter. Das
Gütesiegel zeige sowohl nach außen als auch nach innen, für alle
Mitarbeitende: Die Kita legt Wert auf Qualität und gute Pädagogik
für alle Kinder, die ihr anvertraut sind. Und dies wird nicht nur
intern, sondern bundesweit so gesehen.
Qualitätsmanagement, kurz QM, ist für die evangelischen Kitas
des Kirchenbezirks kein Neuland. Ganz im Gegenteil: „Bereits 2001,
also relativ früh, haben wir uns auf den Weg zum
Qualitätsmanagement gemacht“, erinnert sich Holländer. Mit der
„Qualitätsoffensive Kita + QM“, einem Gemeinschaftsprojekt der
Protestantischen Kirche der Pfalz und des Diakonischen Werks Pfalz,
vertieften die drei protestantischen Kitas, die konzeptionell eng
zusammenarbeiten, diesen Weg.
„Kita + QM hat mit 93 Prozent flächendeckend alle Einrichtungen
erreicht“, freut sich Oberkirchenrat Manfred Sutter und ergänzt:
„Wir haben schon immer Wert darauf gelegt, dass unsere
Einrichtungen mit hoher Qualität arbeiten. Es ist unser Anspruch,
mit hoher Qualität für Kinder, Eltern und Familien zu arbeiten.“ So
lag es nahe, auf dem einmal eingeschlagenen Weg noch einen weiteren
Schritt zu gehen und sich um das bundesweit anerkannte Evangelische
Gütesiegel BETA zu bemühen. „Damit haben wir jetzt deutschlandweit
die Nase vorn“, hebt Manfred Sutter hervor, denn während in
Altenheimen und Krankenhäusern QM schon länger üblich ist, ist es
bei Kitas noch kein Standard. Noch nicht, denn die drei Speyerer
Kitas in Trägerschaft des Kirchenbezirks waren so weit, sich
zertifizieren zu lassen.
Dabei sind mit dem Evangelischen Gütesiegel höhere Anforderungen
als mit „Kita + QM“ verbunden. „Das Kita + QM-Zertifikat war
leichter zu erreichen“, ordnet Markus Holländer die
BETA-Zertifizierung ein. Die drei Kitas mussten dafür zunächst ihr
Qualitäts-Management-Handbuch einsenden. In einem Telefoninterview
mit der Leitung klärten die Auditoren erste Fragen, danach erfolgte
ein ganztägiger Besuch der Auditoren, die mit Erziehern und Eltern
sprachen, um zu prüfen, ob die schriftlichen Qualitätsmaßstäbe in
der Einrichtung auch gelebt werden. Geprüft wurde etwa die
Einarbeitung neuer Kräfte, die Dienst- und Urlaubsplanung, der
Umgang der Erzieher mit den Kindern und die Eingewöhnung neuer
Kinder, aber auch die Gestaltung von Übergängen und pädagogische
Prozesse. Für Holländer war die Auditierung eine große
Wertschätzung und Bestärkung für jeden einzelnen der 21
pädagogischen Mitarbeitenden.
Am Ende des Prozesses stand ein Gutachten – und die Überreichung
der Zertifikate in einer Feierstunde am 26. September. „Das
Evangelische Gütesiegel ist ein Zeichen dafür, dass die Arbeit in
unseren Kindertagesstätten immer wieder neu in den Blick genommen
und überprüft wird, um immer besser zu werden. Und das kommt den
Kindern und Eltern zu Gute“, betont Dekan Markus Jäckle. Nicht zu
vergessen den gesetzlichen Auftrag für das Dekanat als Träger,
Qualität in den eigenen Einrichtungen umzusetzen. „Wir wollen den
Kindern, die zu uns kommen, das Bestmögliche bieten. Das ist unser
Anspruch“, bringt es der Dekan auf den Punkt.
02.11.2016
„Heilige sind Leuchtzeichen der Liebe Gottes“
 Weihbischof Otto Georgens feierte Gottesdienst zu
Allerheiligen im Speyerer Dom
Weihbischof Otto Georgens feierte Gottesdienst zu
Allerheiligen im Speyerer Dom
Speyer- Ein feierliches Pontifikalamt
zelebrierte Weihbischof Otto Georgens am Fest Allerheiligen im
Speyerer Dom. Dabei ging er auf die Bedeutung der Heiligen für die
Kirche in und ermutigte die Gläubigen, selbst ihre Berufung zur
Heiligkeit zu erkennen und zu leben.
„Die Heiligen sind Leuchtzeichen der Liebe Gottes. Sie haben den
Geist Gottes zum Leuchten gebracht“, sagte Georgens in seiner
Predigt zum Evangelium der Seligpreisungen. Ihre Heiligkeit hätten
sie als Geschenk Gottes angenommen. Es verbinde alle Heiligen, dass
sie sich von der Botschaft Jesu haben treffen lassen. „In ihnen
haben die Seligpreisungen Jesu ein Gesicht bekommen.“ Sie hätten
gezeigt, dass die Botschaft Jesu lebbar sei. Weihbischof Georgens
warnte davor, sie zu „Übermenschen“ zu stilisieren. „Sie sind
unsere Brüder und Schwestern, denn wir alle sind eingeladen, das
Heilige in unserem Leben weiter zu entfalten.“ Es gebe so viele
Wege zur Heiligkeit wie es Menschen gibt. „Wir alle sind zur
Heiligkeit berufen, zur Freundschaft mit Gott.“
Für die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes sorgten der
Mädchenchor der Dommusik und die Domsingknaben. Die Orgel spielte
Domorganist Markus Eichenlaub.
Mit dem Fest Allerheiligen gedenkt die Kirche der Menschen, die
die höchste Vollendung ihres Lebens in der Gemeinschaft mit Gott
erreicht haben und als Heilige verehrt werden. In dieses Gedenken
sind auch alle Heiligen eingeschlossen, die nicht heiliggesprochen
wurden. Die Kirche ruft die Heiligen als Fürsprecher an und
betrachtet sie als Wegweiser und Vorbilder im Glauben. Text und
Foto: is
01.11.2016
"Kirche kann nur aus dem Dienen her verstanden werden"
.jpg) Bischof Karl-Heinz Wiesemann weiht Wolfgang Rhein durch Handauflegen und Gebet zum Diakon. Am linken Bildrand Rudolf Schwarz.
Bischof Karl-Heinz Wiesemann weiht Wolfgang Rhein durch Handauflegen und Gebet zum Diakon. Am linken Bildrand Rudolf Schwarz.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann weiht zwei Männer zu
Ständigen Diakonen
Speyer- "Es ist eine besondere Freude für
die Diözese Speyer, dass sie zwei gestandene Männer zu Diakonen
weihen darf." Mit diesen Worten leitete Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann am Samstag die Feier der Diakonweihe im Speyerer Dom ein.
Er spendete Wolfgang Rhein aus der Pfarrei Hl. Franz Xaver,
Lauterecken (Gemeinde St. Franz Xaver, Lauterecken) und Rudolf
Schwarz aus der Pfarrei Hl. Cyriakus, Thaleischweiler-Fröschen
(Gemeinde St. Antonius, Maßweiler), das Sakrament der Diakonweihe.
Beide werden als Ständige Diakone in ihren Heimatpfarreien tätig
sein.
Am Ende des Gottesdienstes spendete die Gemeinde Bischof
Wiesemann Beifall, als er den frisch geweihten Diakonen gratulierte
und ihnen sowie allen anderen Diakonen dankte. Zuvor hatte er in
seiner Predigt deutlich gemacht, wie wichtig der Diakonat für die
Kirche ist. Er verglich ihn mit dem Fundament eines Hauses, auf dem
alles andere aufbaut. Ohne gutes Fundament, kein stabiles Haus. Der
Bischof erinnerte an die dienende Aufgabe der Diakone, die sie
beharrlich erfüllen, ohne im Vordergrund zu stehen.
.jpg) Wiesemann
betonte, die Kirche müsse sich den Zukunftsaufgaben stellen, sich
nicht um sich selbst kümmern, sondern auf die Menschen zugehen und
solidarisch handeln. Der diakonische Dienst sei verknüpft mit
diesem Hinausgehen, sei gleichzeitig ein missionarischer Dienst.
Diakone setzten sich konkret für Menschen vor Ort ein und den
karitativen Auftrag um. Der Bischof stellte gleichzeitig den
grundlegenden Kern von Kirche dar. "Kirche kann nur aus dem Dienen
her verstanden werden", sagte er und rief ins Gedächtnis, welche
Bedeutung die Stola um den Hals von Diakonen, Priestern und
Bischöfen besitzt: "Diese Stola erinnert uns an das Joch, mit dem
wir den Karren Jesu Christi ziehen."
Wiesemann
betonte, die Kirche müsse sich den Zukunftsaufgaben stellen, sich
nicht um sich selbst kümmern, sondern auf die Menschen zugehen und
solidarisch handeln. Der diakonische Dienst sei verknüpft mit
diesem Hinausgehen, sei gleichzeitig ein missionarischer Dienst.
Diakone setzten sich konkret für Menschen vor Ort ein und den
karitativen Auftrag um. Der Bischof stellte gleichzeitig den
grundlegenden Kern von Kirche dar. "Kirche kann nur aus dem Dienen
her verstanden werden", sagte er und rief ins Gedächtnis, welche
Bedeutung die Stola um den Hals von Diakonen, Priestern und
Bischöfen besitzt: "Diese Stola erinnert uns an das Joch, mit dem
wir den Karren Jesu Christi ziehen."
Diese Stola bekamen Rhein und Schwarz zusammen mit der Dalmatik,
dem liturgischen Gewand der Diakone, von ihren Heimatpfarrern nach
der eigentlichen Weihehandlung umgelegt. Zu Beginn des Weiherituals
wurde der Heilige Geist gerufen, ehe die Weihekandidaten ihr
Versprechen abgaben, die Aufgaben und Pflichten des Diakonats zu
erfüllen. Die konkreten Aufgabenfelder liegen sowohl in der
Begleitung der Christen im Alltagsleben als auch in der Feier der
Liturgie und der Verkündigung des Evangeliums. Ständige Diakone
können die Taufe spenden, in der Eucharistiefeier predigen und
Beerdigungen halten.
Zum Ende des Versprechens traten Rhein und Schwarz nacheinander
vor den Bischof und legten ihre Hände in die Wiesemanns. Dieses
Zeichen besiegelt, dass sich die Diakone dem Bischof zur Verfügung
stellen und sich der Bischof wiederum verpflichtet, für sie zu
sorgen. Während der Allerheiligen-Litanei lagen die Weihekandidaten
ausgestreckt auf dem Boden als Zeichen, dass sie sich Gottes Willen
anvertrauen. Die Weihe selbst .jpg) spendete
Bischof Wiesemann durch Handauflegen und Gebet. Das Weiheritual
endete mit dem Überreichen des Evangelienbuchs und dem Umarmen der
neugeweihten Diakone durch Bischof, Konzelebranten und Diakone.
Damit nahmen sie Wolfgang Rhein und Rudolf Schwarz in ihre
Gemeinschaft auf. Anschließend bereiteten die Neugeweihten
gemeinsam mit Wiesemann die Gaben.
spendete
Bischof Wiesemann durch Handauflegen und Gebet. Das Weiheritual
endete mit dem Überreichen des Evangelienbuchs und dem Umarmen der
neugeweihten Diakone durch Bischof, Konzelebranten und Diakone.
Damit nahmen sie Wolfgang Rhein und Rudolf Schwarz in ihre
Gemeinschaft auf. Anschließend bereiteten die Neugeweihten
gemeinsam mit Wiesemann die Gaben.
Bischof Wiesemann erinnerte während der Messe an den langen Weg,
der hinter beiden Männern liegt. Wolfgang Rhein wurde im Jahr 1953
in Sien bei Idar-Oberstein geboren, ist Vater zweier Kinder und
ehemaliger Soldat. Rudolf Schwarz, Jahrgang 1958, ist Ingenieur im
Ruhestand und vierfacher Vater. Er stammt aus dem
südwestpfälzischen Maßweiler, wo er heute noch lebt. Beide haben
zur Vorbereitung auf ihren Einsatz als Diakone den Würzburger
Fernkurs und die diözesane Diakonenausbildung absolviert.
Der Ständige Diakonat wird haupt- oder nebenberuflich ausgeübt
und steht auch verheirateten Männern offen. Im Zentrum der Aufgaben
der Ständigen Diakone, deren Bezeichnung „Diakon“ auf das
griechische Wort für „dienen“ zurückgeht, steht der Dienst am
Menschen. Im Bistum Speyer gibt es derzeit 45 aktive Ständige
Diakone. 21 Ständige Diakone sind im Ruhestand, übernehmen
aber in ihren Pfarreien immer noch vielfältige Aufgaben.
Text/Fotos: Yvette Wagner
30.10.2016
Bistum Speyer veröffentlicht Jahresabschlüsse für 2015
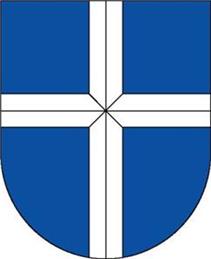 Gute
wirtschaftliche Lage in Deutschland hat positiven Effekt auf die
Kirchensteuer – Auch den Pfarreien und dem Caritasverband stehen
damit mehr Mittel für ihre Arbeit zur Verfügung
Gute
wirtschaftliche Lage in Deutschland hat positiven Effekt auf die
Kirchensteuer – Auch den Pfarreien und dem Caritasverband stehen
damit mehr Mittel für ihre Arbeit zur Verfügung
Speyer- Das Bistum Speyer hat seinen
Jahresabschluss für das Jahr 2015 veröffentlicht und auf der
Internetseite des Bistums für alle Interessierten zugänglich
gemacht.
Der Haushalt des Bistums Speyer weist für das Jahr 2015 eine
Bilanzsumme in Höhe von rund 197 Millionen Euro aus. Das
Jahresergebnis beträgt rund 7,8 Millionen Euro und ist vor allem
auf die Erträge aus der Kirchensteuer zurückzuführen. Sie lagen mit
rund 138 Millionen Euro um rund 18,7 Millionen Euro höher als im
Jahr zuvor. Dafür ist hauptsächlich das so genannte
Clearing-Verfahren verantwortlich, ein komplexes Abrechnungssystem,
mit dem die Finanzbehörden den einzelnen Bistümern die
Kirchensteuern im Nachhinein exakt zuordnen. Aber auch die gute
wirtschaftliche Lage in Deutschland hat sich auf das
Kirchensteueraufkommen positiv ausgewirkt.
Bei den Aufwendungen entfallen rund 39 Prozent auf die
Personalkosten. Den größten Teil der Haushaltsmittel – nämlich rund
83 Millionen Euro oder, in Prozenten ausgedrückt, rund 52 Prozent –
reicht das Bistum Speyer jedoch in Form von Zuschüssen und Umlagen
an die Pfarreien und andere kirchliche Körperschaften weiter. Ihnen
stehen aufgrund der höheren Kirchensteuermittel also ebenfalls mehr
Mittel zur Verfügung. So hat das Bistum Speyer im vergangenen Jahr
die Zuschüsse an die Pfarreien um rund 9,5 Millionen Euro und den
Zuschuss an den Caritasverband um rund 1,5 Millionen Euro
erhöht.
Der Diözesansteuerrat hat den Jahresabschluss des Bistums für
das Jahr 2015 genehmigt und festgelegt, dass das Jahresergebnis
hauptsächlich zum Abbau des Defizits bei der Emeritenanstalt sowie
für Instandsetzungs- und Brandschutzmaßnahmen an Bistumsgebäuden
verwendet werden soll. Zugleich soll eine Rücklage gebildet werden,
um Schwankungen bei den Kirchensteuereinnahmen aus dem
Clearing-Verfahren künftig besser ausgleichen zu können.
Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft MNT führte erstmal eine
Vollprüfung des Jahresabschlusses des Bistums durch und erteilte
einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk. „Die Rechnungslegung
des Bistums Speyer steht in Übereinstimmung zu den Vorschriften des
Handelsgesetzbuches und ist beispielhaft für den gesamten Bereich
der kirchlichen Finanzverwaltung“, stellen die Wirtschaftsprüfer in
ihrem Prüfbericht fest. Sie würdigen damit insbesondere die
Neuorganisation des Rechnungswesens sowie den Einsatz einer neuen
Software für die Finanzbuchhaltung und die Einführung eines
elektronischen Datenmanagementsystems. Gleichzeitig raten sie dem
Bistum Speyer zur weiteren Risikovorsorge: „Eine Abschwächung der
Konjunktur würde sich unmittelbar in Mindereinnahmen bei der
Kirchensteuer bemerkbar machen.“ Auch Diözesanökonom Peter
Schappert mahnt: „Die mittel- und langfristigen Berechnungen zeigen
eindeutig, dass die Kirche in Deutschland und auch das Bistum
Speyer in Zukunft mit weniger Mitteln auskommen müssen.“
Zusammen mit dem Jahresabschluss für das Bistum wurden auch die
Haushalte des Domkapitels, des Bischöflichen Stuhls, der
Pfründestiftung und der Emeritenanstalt veröffentlicht. Auch diese
Abschlüsse sind auf der Internetseite des Bistums für alle
Interessierten zugänglich. is
Weitere Informationen zu den Jahresabschlüssen: http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/finanzen/
30.10.2016
„Der Montagsluther“ startet am Reformationstag
 Wöchentliche
Bilder, Bücher, Medientipps rund um Martin Luther
Wöchentliche
Bilder, Bücher, Medientipps rund um Martin Luther
Speyer- Das Zentralarchiv und die
Bibliothek und Medienzentrale der Evangelischen Kirche der Pfalz in
Speyer bieten zum Auftakt des 500-jährigen Reformationsjubiläums
wöchentlich Lutherbilder und Lutherthemen aus ihrem reichhaltigen
Fundus an.
Zum Reformationstag am Montag, 31. Oktober 2016, startet das
Angebot auf der Homepage der Landeskirche programmatisch mit dem
Thesenanschlag im Lutherfenster der Gedächtniskirche Speyer. Das
Bildprogramm der Fenster liest sich wie ein Bilderbuch des
Protestantismus, wobei Motive aus der Bibel mit der
Reformationsgeschichte in Beziehung gesetzt sind. Weitere Bilder
aus diversen Orten und Zeiten werden jeweils im montäglichen
Wechsel im Internet zu sehen sein.
„Kein Reformator wurde so oft abgebildet wie Luther. Die Motive
und ihr historischer Hintergrund zeigen eindrücklich, wie stark
Luther das Bildgedächtnis der Deutschen geprägt hat“, erklärt
Gabriele Stüber. Die Leiterin des Archivs ist Initiatorin des
Angebots und Mitherausgeberin der Wanderausstellung und des
Katalogs „Lutherbilder aus sechs Jahrhunderten“.
Neuerscheinungen haben Karin Feldner-Westphal und Robert Zobotke
von der Bibliothek und Medienzentrale im Blick. „Beinahe stündlich
erscheinen neue Bücher oder Filme, da fällt es nicht leicht, den
Überblick zu behalten“, stellen die beiden fest und versuchen,
wöchentlich eine anregende Auswahl zu treffen. Ergänzt wird das
Angebot durch Lutherworte, die Pfarrer Ulrich Kronenberg aus
Limburgerhof seinem Zitatenschatz entnommen hat.
Der sogenannte „Montagsluther“ ist auf der Startseite der
Landeskirche www.evkirchepfalz.de sowie auf
der Seite zum Reformationsjahr www.reformation2017.evpfalz.de
zu finden.
Weitere 100 Lutherbilder aus ganz Deutschland enthält die
Publikation von Andreas Kuhn und Gabriele Stüber: „Lutherbilder aus
sechs Jahrhunderten“. Herausgegeben im Auftrag des Verbandes
kirchlicher Archive, Evangelische Kirche in Deutschland, 2016. Sie
ist erhältlich im Buchhandel und über das Zentralarchiv der
Evangelischen Kirche der Pfalz.
Hintergrund: Allein der Glaube. Ein Gedanke, der seit 500
Jahren Menschen bewegt. Allein vor Gott stehen. Wie Martin Luther.
Frei sein. Selber glauben, denken, handeln. Mit Luthers 95 Thesen
1517 in Wittenberg hat die Reformationsbewegung Kirche und Welt
erfasst. Bis heute. Im Jahr 2017 wird national, international und
ökumenisch nach den reformatorischen Kräften in Kirche und
Gesellschaft gefragt. Glaubensfreiheit und Gewissensfreiheit bilden
den Schwerpunkt der Evangelischen Kirche der Pfalz. Der Europäische
Stationenweg gastiert vom 8. bis 11. April 2017 in der Stadt der
Protestation, in Speyer. Neben diesem Höhepunkt sind zahlreiche
weitere Veranstaltungen, Ausstellungen, Aktionen und Gottesdienste
in den Gemeinden geplant. Im Jahr 2018 feiert die Landeskirche ihr
200-jähriges Jubiläum als „Kirche der Union“. Text und Foto:
lk
Mehr zum Thema: www.reformation2017.evpfalz.de;
www.r2017.org und www.luther2017.de.
27.10.2016
Im Erzählen entsteht eine gemeinsame Welt
 Das Foto „Erzählung im Kaisersaal des Domes“ zeigt Michael Rick bei seiner Erzählung
Das Foto „Erzählung im Kaisersaal des Domes“ zeigt Michael Rick bei seiner Erzählung
Schulabteilung des Bistums und Internetportal katholisch.de
präsentieren im Kaisersaal des Domes mit ihrem Video-Projekt „Die
Bibel-Erzähler“ eine spannende Variante moderner
Verkündigung
Speyer- Ein ungewöhnliches Projekt erlebte im
Kaisersaal des Domes Premiere: Die Schulabteilung des Bistums
Speyer und das Internetportal katholisch.de präsentierten gemeinsam
das Video-Projekt „Die Bibel-Erzähler.“
In kurzen Sequenzen von etwa drei bis fünf Minuten schlüpften
die Erzähler in ungewöhnliche Rollen und ermöglichten eine neue
Begegnung mit bekannten biblischen Erzählungen. So berichtete zum
Beispiel Rebecca Burkhart über die Tempelreinigung aus der
Perspektive einer zeitgenössischen Journalistin. Als Arbeiter im
Weinberg machte Michael Rick seinem Ärger über die vermeintlich
ungerechte Behandlung durch den Gutsbesitzer Luft. Daniel in der
Löwengrube wurde von Erzählerin Geraldine Wagner aus der
Perspektive der jüngeren Schwester präsentiert. Stefan
Schwarzmüller ließ eine Begegnung von König Salomo mit dem kleinen
Prinzen vor den Zuhörern entstehen. Die vier Erzähler verkörperten
ihre Figuren mit Temperament und Spannung und nutzten das gesamte
Repertoire der schauspielerischen Möglichkeiten für eine nuancierte
Gestaltung. Die biblischen Geschichten gewinnen so eine ganz neue
Vitalität und Unmittelbarkeit. Sie ziehen den Zuhörer ins Geschehen
hinein, er wird selbst Teil der Geschichte. Markus Schneider
verband die Erzählungen sensibel mit Stücken auf der Gitarre.
Die vier Religionspädagogen haben die Ausbildung zum
Bibelerzähler in der Erzählwerkstatt des Heinrich-Pesch-Hauses in
Ludwigshafen absolviert, die vom Zentrum für Ignatianische
Pädagogik unterstützt wird. Die Bibelstellen für die Videos haben
sie individuell ausgewählt und auch, welche Perspektive sie dafür
einnehmen wollen. Die Aufnahmen wurden, begleitet von Redakteurin
Dr. Madeleine Spendier und Regisseur Joachim Küffner von
katholisch.de, in einem Bonner Theater aufgenommen.
 Die
Bibel auf neue Weise zur Sprache bringen
Die
Bibel auf neue Weise zur Sprache bringen
Für Domkapitular Dr. Christoph Kohl, Leiter der Hauptabteilung
„Schule, Hochschule, Bildung“ des Bischöflichen Ordinariats, ist
das Video-Projekt „Die Bibel-Erzähler“ ein Stück moderner
Verkündigung. "Wir haben gemerkt, wie ansteckend diese Art des
Erzählens ist", berichtet Initiatorin Dr. Irina Kreusch. So könne
ein neuer Zugang zu den jahrtausendealten Erzählungen eröffnet
werden. Um das zum Beispiel im Schulunterricht einsetzen zu können,
sei die Idee entstanden, die Bibelerzähler zu filmen. „Wir sollen
die Bibel mit dem Projekt neu sprachfähig machen“, so Irina
Kreusch.
Ulrike Gentner, stellvertretende Leiterin des
Heinrich-Pesch-Hauses, freut sich, dass aus der Erzähl-Werkstatt
der Anstoß zu dem Video-Projekt hervorgegangen ist. „Erzählen
stiftet Gemeinschaft und Sinn, es vermittelt Werte und lässt eine
gemeinsame Welt entstehen“, beobachtet sie aktuell eine Renaissance
des Erzählens. Die Bibel halte einen großen Schatz von Erzählungen
bereit, die es neu zu entdecken gelte.
Und was hat das Projekt den Erzählern selbst an neuen
Erkenntnissen und Erfahrungen gebracht? „Im Erzählen wird der Text
zur eigenen Geschichte“, berichtet Rebecca Burkhart. „Man
verinnerlicht die Erzählung und gewinnt im Ringen mit dem Stoff
schrittweise eine neue Freiheit, die man sich auch gönnen darf im
Wissen darum, dass jeder biblische Text bereits eine Deutung
enthält“, bekräftigt Stefan Schwarzmüller. Geraldine Wagner findet
es spannend, durch das Erzählen eine neue Sicht auf eine Geschichte
zu gewinnen. „Am Anfang kostet es etwas Überwindung, aber dann
kommt der Punkt, an dem man merkt, dass der Funke überspringt“, hat
Michael Rick beim Erzählen erfahren.
 Link zu
den Bibel-Erzählungen:
Link zu
den Bibel-Erzählungen:
Der Zöllner, erzählt von Rebecca Burkhart:
https://www.youtube.com/watch?v=4pBu9hYwOJ0
Der ungläubige Thomas, erzählt von Stefan Schwarzmüller:
https://www.youtube.com/watch?v=Yq41tEfTkL8
Der barmherzige Samariter, erzählt von Michael Rick:
https://www.youtube.com/watch?v=SqZEctShBnY
David und Goliath, erzählt von Geraldine Wagner:
https://www.youtube.com/watch?v=ZSpExD0awZM
Weitere Informationen:
http://www.katholisch.de/aktuelles/aktuelle-artikel/die-bibel-ganz-personlich
Link zu Angeboten der Erzählwerkstatt des
Heinrich-Pesch-Hauses und des Zentrums für Ignatianische
Pädagogik:
http://heinrich-pesch-haus.de/
http://zip-ignatianisch.org/
Text: Bistum Speyer, Presse Foto: Klaus Landry
26.10.2016
Schwester M. Gisela Bastian ist neue Generalpriorin des Institut St. Dominikus Speyer
 v.l.:Sr. Helga Jörger, Sr. Gertrud Dahl, Sr. M. Gisela Bastian(Generalpriorin), Sr. M. Elisabeth Schloß (Generalvikarin) Sr. M. Gabriele Kuhn, Sr. Annemarie Kirsch
v.l.:Sr. Helga Jörger, Sr. Gertrud Dahl, Sr. M. Gisela Bastian(Generalpriorin), Sr. M. Elisabeth Schloß (Generalvikarin) Sr. M. Gabriele Kuhn, Sr. Annemarie Kirsch
Generalkapitel stellt Weichen für die nächsten fünf
Jahre
Speyer- Vom 14. bis 22. Oktober tagte das
Generalkapitel des Instituts St. Dominikus Speyer, das höchste
Beschluss fassende Gremium des Instituts. In diesem Kapitel wurde
die Leitung der Gemeinschaft neu gewählt. In das Amt der
Generalpriorin wählten die Ordensfrauen Schwester M. Gisela Bastian
und als Generalvikarin (Vertreterin der Generalpriorin) Schwester
Elisabeth Schloß.
Sr. M. Gisela Bastian (Jahrgang 1946) stammt aus Kirchenarnbach.
Nach dem Abschluss der Handelsschule war sie Leiterin eines
Baubüros. 1966 trat sie in das Institut St. Dominikus ein und legte
die erste Profess 1967 ab. Von 1967 bis 1994 war sie Sekretärin am
Nikolaus von Weis Gymnasiums und anschließend Generalsekretärin des
Instituts St. Dominikus. Seit dem Generalkapitel 2006 wirkte sie
als Generalrätin des Institutes, ab 2011 als Generalvikarin.
Heimatort von Sr. M. Elisabeth Schloß (Jahrgang 1949) ist
Jockgrim. Die ausgebildete Erzieherin legte 1971 ihre erste Profess
ab. Von 1973 bis 1979 war sie im Kinderdorf Maria Regina und
von 1979 bis 1987 im Kindergarten St. Markus tätig. Von 1987
bis 1989 absolvierte sie ein Praktikum im Bischöflichen Ordinariat.
Von 1989 bis 2002 arbeitete sie in der Buchhaltung des
Instituts. Ab 2002 machte sie eine Ausbildung in der
Krankenhausseelsorge mit Praktika in verschiedenen Krankenhäusern.
Von 2004 bis 2015 war sie als Krankenhausseelsorgerin in der
Unfallklinik in Ludwigshafen tätig und ab 2015
Krankenhausseelsorgerin im Diakonissenkrankenhaus Speyer.
Den beiden Ordensfrauen stehen die vier „Ratsschwestern“ Sr.
Helga Jörger, Sr. Gertrud Dahl, Sr. M. Gabriele Kuhn und Sr.
Annemarie Kirsch zur Seite, die ebenfalls von den Delegierten beim
Generalkapitel gewählt wurden.
Der Dominikanerorden ist demokratisch aufgebaut. Das oberste
Gremium ist das Generalkapitel. Hier werden die Weichen für die
nächsten fünf Jahre gestellt. Alle Schwestern wählen die
Delegierten für dieses Kapitel. Sie bestimmen, welche Schwester für
das Amt der Generalpriorin in Frage kommt. Die Delegierten sind an
diese Wahlliste gebunden.
Text und Foto: Bistum Speyer, Presse
25.10.2016
„Das Bild von Mission als Einbahnstraße ist überholt“
 Bundesweiter Abschluss der missio-Kampagne am Sonntag der
Weltmission – Pontifikalamt im Dom zu Speyer
Bundesweiter Abschluss der missio-Kampagne am Sonntag der
Weltmission – Pontifikalamt im Dom zu Speyer
Speyer- Mit einem feierlichen
Pontifikalamt im Speyerer Dom feierten heute das Bistum Speyer und
das Internationale Katholische Hilfswerk missio München den
Abschluss der bundesweiten Kampagne zum Monat der Weltmission.
Unter dem Leitwort „… denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt 5,7)
standen in diesem Jahr die Philippinen im Mittelpunkt der
weltweiten Solidaritätsaktion. Gäste aus dem südasiatischen
Inselstaat gestalteten den eindrucksvollen Gottesdienst als
Konzelebranten sowie mit einer Lesung in der Sprache Tagalog,
Liedern, einem philippinischen Lichtertanz mit.
Mit der Wahl von Papst Franziskus seien in der katholischen
Kirche „die Ränder zur Mitte geworden“, erklärte der Speyerer
Bischof Wiesemann in seiner Predigt. „Wir können unseren
Gottesglauben nicht ohne weltweite Solidarität verstehen und leben,
wir können unseren Gottesglauben nicht bezeugen, wenn wir mit ihm
nicht den Schrei der Armen hören und wenn wir deren ‚Reichtum‘, die
Weise, wie sie uns auf einzigartige Weise beschenken, missachten“,
so Wiesemann und verwies auf den Wandel im Missionsverständnis der
Kirche in den letzten Jahrzehnten. „Längst ist das Bild von Mission
als Einbahnstraße überholt. Längst wissen wir, dass wir hier bei
uns schon viel mehr Missionsland sind, als viele der Länder, in die
einst unsere Missionare gegangen sind.“ Mission bedeute ein
gegenseitiges Geben und Beschenktwerden, ein „gemeinsames Erfahren
der Barmherzigkeit Gottes“. Die hiesige Kirche könne neue Impulse
von den sogenannten „armen Kirchen“ erhalten.
 Bischof Wiesemann zeigte sich beeindruckt von dem
Engagement der Gäste aus den Philippinen, die sich aus ihrem tiefen
Glauben heraus für die Verwirklichung ihrer Vision zur Verbesserung
der Lebenssituation der Menschen in ihrer Heimat einsetzen. „Die
Kirche auf den Philippinen steht für die Option für die Armen, für
Friedensarbeit und interreligiösen Dialog, für die bleibende
Verwurzelung und die Rechte der indigenen Bevölkerung, für die
Bewahrung der Schöpfung und den Kampf gegen den Klimawandel, für
die Förderung der Familien und gegen die Ausbeutung von Frauen und
Kindern“, so der Bischof. Die auf den Philippinen gewonnenen
Erfahrungen mit kleinen christlichen Gemeinschaften könnten auch im
Bistum Speyer hilfreich sein.
Bischof Wiesemann zeigte sich beeindruckt von dem
Engagement der Gäste aus den Philippinen, die sich aus ihrem tiefen
Glauben heraus für die Verwirklichung ihrer Vision zur Verbesserung
der Lebenssituation der Menschen in ihrer Heimat einsetzen. „Die
Kirche auf den Philippinen steht für die Option für die Armen, für
Friedensarbeit und interreligiösen Dialog, für die bleibende
Verwurzelung und die Rechte der indigenen Bevölkerung, für die
Bewahrung der Schöpfung und den Kampf gegen den Klimawandel, für
die Förderung der Familien und gegen die Ausbeutung von Frauen und
Kindern“, so der Bischof. Die auf den Philippinen gewonnenen
Erfahrungen mit kleinen christlichen Gemeinschaften könnten auch im
Bistum Speyer hilfreich sein.
„Der Weltmissionssonntag öffnet unseren Horizont auf die ganze
Weltkirche. Hier liegt unsere Zukunft“, sagte Bischof Wiesemann und
betonte, dass - wie im weltlichen Bereich - durch einen Rückzug in
das rein Nationale die globalen Herausforderungen nicht zu bestehen
seien.
Wiesemann warb für die Unterstützung der größten Solidaritätsaktion
der Katholiken durch Gebet und „eine großherzige Kollekte“.
Der Speyerer Bischof zelebrierte den Gottesdienst gemeinsam mit
Kardinal Orlando Quevedo (Cotabato), Bischof Valentin Dimoc
(Bontoc-Lagawe), Weihbischof Broderick Pabillo (Manila),
missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber (München) und
Weihbischof Otto Georgens, der für die Kontakte des Bistums in die
Weltkirche hinein verantwortlich ist. Als Diakon wirkte
Jean-Jacques Kambakamba aus Ludwigshafen mit. In die Liturgie
eingebunden waren auch Jocelyn Hinojales Aquiatan (Mindanao) und
Joseph Guevarra (Manila), die wie die philippinischen
Konzelebranten und Pater Daniel Pilario (Quezon-City) in den
letzten Wochen bei zahlreichen Veranstaltungen im Bistum Speyer und
in den bayrischen Bistümern über die Lage in ihrem Heimatland und
ihr Engagement berichtet hatten.
Sängerin Alvin Soledad Lück sang vor dem Evangelium ein
philippinisches Halleluja. Die Tanzgruppe P.E.A.C.E. (Philippine
European Association für Culture Exchange) aus München tanzte als
Dankhymnus vor dem Abschluss des Gottesdienstes einen Lichtertanz.
Der Ferienchor der Dommusik sang unter der Leitung von
Domkapellmeister Markus Melchiori sowie Domkantor Joachim Weller
und auch Domorganist Markus Eichenlaub begleitete den Gottesdienst
musikalisch an der Orgel.
Beim anschließenden Empfang im Historischen Museum der Pfalz
konnte Weihbischof Otto Georgens zahlreiche Gäste, Vertreterinnen
und Vertreter aus der Politik sowie Unterstützerinnen und
Unterstützer der weltkirchlichen Arbeit im Bistum Speyer begrüßen.
In kurzen Interviews berichteten die Gäste aus den Philippinen von
der Situation in ihrem Heimatland und ihrem Engagement für eine
Verbesserung der Lebenssituation der Menschen in dem
Inselstaat.
Mit Tänzen und Musik gestalteten wiederum die philippinische
Tanzgruppe P.E.A.C.E. (Philippine European Association für Culture
Exchange) und die philippinische Sängerin Alvin Soledad Lück den
Festakt. Besonderen Applaus bekam Kardinal Orlando Quevedo, der
gemeinsam mit der Sängerin ein philippinisches Volkslied vortrug.
Susanne Karl, Tanzleiterin bei der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschland (kfd), animierte zum Abschluss auch das Publikum zum
Mittanzen.
Sonntag der Weltmission
Der Sonntag der Weltmission wurde von Papst Pius XI. am 14.
April 1926 eingeführt und wird in allen Ländern begangen, in denen
Katholiken leben. Er ist die größte Solidaritätsaktion der
katholischen Kirche. In Deutschland wird der Sonntag der
Weltmission immer am vierten Sonntag im Oktober begangen, in den
übrigen Ländern an vorletzten Oktobersonntag. Grund für die in
Deutschland abweichende Tradition ist das Kirchweihfest, das in
Deutschland am dritten Oktobersonntag begangen wird.
Die Kollekte zum Weltmissionssonntag geht in den Solidaritätsfond
der päpstlichen Missionswerke. Während der jährlichen Treffen der
Nationaldirektoren der päpstlichen Missionswerke wird darüber
entschieden, welche Projekte mit diesen Mitteln unterstützt werden.
Weitere Informationen: www.missio.com
Text und Foto: is
23.10.2016
missio-Projektpartner Kardinal Quevedo mahnt zum Dialog mit Muslimen
 Chor der philippinischen Gemeinde Schifferstadt, der zu Beginn der Pressekonferenz ein Lied vortrug.
Chor der philippinischen Gemeinde Schifferstadt, der zu Beginn der Pressekonferenz ein Lied vortrug.
Philippinen im Fokus – Feierlicher Abschluss des Monats der
Weltmission im Bistum Speyer
Speyer/München- Mit einem feierlichen
Pontifikalamt mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und
hochrangigen Gästen aus den Philippinen feiern die Diözese Speyer
und das Internationale Katholische Hilfswerk missio München
am 23. Oktober den Abschluss der bundesweiten Kampagne zum
Monat der Weltmission im Speyerer Dom. Der Gottesdienst
beginnt um 10 Uhr. Im Anschluss findet am 12 Uhr im Historischen
Museum der Pfalz ein Festakt mit prominenten Gästen, Talks,
philippinischen Liedern und Tänzen statt.
Im Mittelpunkt der Solidaritätsaktion des katholischen Hilfswerks
stehen in diesem Jahr die Philippinen. Das Leitwort lautet:
„… denn sie werden Erbarmen finden“ (Mt 5,7).
Eine wichtige und drängende Frage für die Menschen auf den
Philippinen sei der Klimawandel und seine dort schon jetzt deutlich
spürbaren Auswirkungen, betonte Bischof Wiesemann heute in
einer Pressekonferenz zum Aktionsabschluss in Speyer. „Wie gehen
wir mit unserer Schöpfung um, was können wir tun, um nachhaltig zu
wirtschaften und die Folgen von Klimawandel und Armut
einzuschränken?“ – das seien Fragen, die auch die Menschen im
Bistum Speyer beschäftigten. Er verwies auf die Aktion „Gutes
Leben. Für alle!“, die im Bistum Entwicklungs- und
Wandlungsprozesse auf privater, kirchlicher und politischer Ebene
anstößt.
missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber betonte, dass
die katholische Kirche auf den Philippinen dort helfe, wo der Staat
oft wegsehe: „Die Kirche auf den Philippinen setzt sich für den
Zusammenhalt der Familien ein, für den Umweltschutz und die Rechte
der indigenen Bevölkerung. Als Kirche der Armen gibt sie denen eine
Stimme, denen sonst kaum jemand zuhört. missio München ist mit
seinen Projektpartnern auf den Philippinen seit Jahrzehnten
verbunden.“
Der Erzbischof von Cotabato, Orlando Kardinal Quevedo,
hob hervor, dass die Frage nach einem guten Leben für alle auf
seiner Heimatinsel Mindanao auch mit einem friedlichen
Zusammenleben von Christen und Muslimen zusammenhänge. Anfang
September hatte es im Südwesten von Mindanao einen Terroranschlag
gegeben, dem 14 Menschen zum Opfer fielen und zu dem sich die
islamistische Terrororganisation Abu Sayyaf bekannte. „Die
Muslime fordern eine selbstverwaltete Region in diesem umstrittenen
Gebiet. Ich bin überzeugt, dass dieses Zugeständnis ein wichtiger
Schritt in Richtung Frieden wäre“, sagte der Kardinal.
Die aktuellen Pläne des neuen philippinischen Präsidenten
Rodrigo Duterte, die Todesstrafe wieder einzuführen,
bezeichnete Quevedo als „schrecklichen Fehler“. Ebenso seien
die außergerichtlichen Erschießungen von Menschen, die als
Drogenhändler verdächtigt werden, bedingungslos zu verurteilen.
Duterte hatte damit international für Entsetzen gesorgt.
missio unterstützt in dem südostasiatischen Inselstaat
kirchliche Projektpartner, die sich gegen
Menschenrechtsverletzungen, für den Dialog mit Muslimen, für die
Rechte der indigenen Bevölkerung, gegen Umweltzerstörung und
Klimawandel und für kleine christliche Gemeinschaften engagieren.
Die Kollekte am Sonntag der Weltmission am 23. Oktober geht in den
Solidaritätsfond der päpstlichen Missionswerke.
Stichwort: missio – Internationales katholisches
Missionswerk:
Das Internationale Katholische Missionswerk missio in
München wurde es 1838 durch König Ludwig I. von Bayern auf Wunsch
zahlreicher Laien ins Leben gerufen. 1923 wurde es von Papst Pius
XI. zum Päpstlichen Missionswerk erhoben. Allein im Jahr 2015 hat
es 1046 Projekte in
60 Ländern in Afrika,
Asien
und Ozeanien
unterstützt. Im Fokus stehen dabei der Auf- und Ausbau lokaler
kirchlicher Strukturen sowie die Ausbildung kirchlicher
Mitarbeiter. Dieses Netzwerk bildet die Basis für eine nachhaltige
Projektarbeit. Hilfe für Binnenflüchtlinge, Programme für
benachteiligte Frauen, Seelsorge für Waisen und Straßenkinder,
Initiativen für Frieden und Versöhnung in Bürgerkriegsregionen–
missio fördert den vielfältigen Einsatz der Ortskirchen, ideell und
finanziell.
Stichwort: 90 Jahre Sonntag der Weltmission:
Der Sonntag der Weltmission wurde von Papst Pius XI. am 14.
April 1926 eingeführt und wird in allen Ländern begangen, in denen
Katholiken leben. Er ist die größte Solidaritätsaktion der
katholischen Kirche. In Deutschland wird der Sonntag der
Weltmission immer am vierten Sonntag im Oktober begangen, in den
übrigen Ländern an vorletzten Oktobersonntag. Grund für die in
Deutschland abweichende Tradition ist das Kirchweihfest, das in
Deutschland am dritten Oktobersonntag begangen wird. Die Kollekte
zum Weltmissionssonntag geht in den Solidaritätsfond der
päpstlichen Missionswerke. Während der jährlichen Treffen der
Nationaldirektoren der päpstlichen Missionswerke wird darüber
entschieden, welche Projekte mit diesen Mitteln unterstützt
werden.
Weitere Informationen: www.missio.com Text und Foto:
is
21.10.2016
Gesangbücher für Sehbehinderte
Speyer- Am Sonntag den 16.10. 2016, 10
Uhr in der Gedächtniskirche, werden im Gottesdienst zwei
neue „Gesangbücher für Sehbehinderte“, im Format Din A4 mit
Großdruckschrift, vorgestellt.
Die Gesangbücher wurden den Kirchengemeinden von der
Landeskirche zur Verfügung gestellt.
Diese besondere Gesangbuchausgabe ermöglicht nun auch Menschen
mit Sehbehinderung, die Lieder im Gottesdienst mitzulesen und nicht
mehr nur allein auf das Gehör angewiesen zu sein. Damit haben sie
die Möglichkeit, aktiv am Gottesdienstgeschehen teilzunehmen.
Schön, dass es endlich eine solche Ausgabe gibt.
Die neuen Gesangbücher werden in den nächsten Wochen an alle
Gemeinden im Prot. Kirchenbezirk Speyer verteilt, je zwei Exemplare
pro Kirche.
Prot. Dekanat Speyer, Presse
14.10.2016
Diözesanpastoralrat konstituiert sich
 v.l.: Christian Anstäth, Katharina Rothenbacher-Dostert, Dekan Andreas Sturm, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Marius Wingerter und Diakon Johannes Hellenbrand.
v.l.: Christian Anstäth, Katharina Rothenbacher-Dostert, Dekan Andreas Sturm, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Marius Wingerter und Diakon Johannes Hellenbrand.
Wahl des neuen Vorstandes – Beratung unter anderem über
Leitung von Gottesdiensten durch ehrenamtlich Engagierte
Speyer- Am 7. Oktober hat sich der
Diözesanpastoralrat im Bistum Speyer neu konstituiert. Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann dankte den Mitgliedern des Pastoralrates für
die Bereitschaft zum Engagement und wünschte sich durch einen
lebendigen Austausch viele fruchtbare Impulse für die Diözese. Dies
zeigte sich zum Beispiel in der Beratung eines Textentwurfes zur
Leitung von Gottesdiensten durch ehrenamtlich Engagierte in der
Diözese Speyer. Betont wird dabei die Bedeutung von Ehrenamtlichen
bei der Feier von vielfältigen liturgischen Formen. Diese Leiter
und Leiterinnen von Gottesdiensten benötigen für ihren Dienst neben
der persönlichen Eignung und einer fachlichen Einführung auch eine
Beauftragung. Dies gilt unter anderem auch für die Feier des
Sterbesegens, der nach dem neuen Seelsorgekonzept des Bistums „ein
angemessenes religiöses Ritual für die Situation des nahenden
Übergangs vom Leben zum Tod“ sein soll. Die im Konzept
„Gemeindepastoral 2015“ angekündigte liturgische Handreichung zur
Feier des Sterbesegens wird in den nächsten Monaten erscheinen.
Neben dem Vorsitzenden, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann,
gehören zum Vorstand Dekan Andreas Sturm (St. Ingbert), Diakon
Johannes Hellenbrand (Neustadt), Katharina Rothenbacher-Dostert
(Queidersbach), Christian Anstäth (Homburg) und Marius Wingerter
(Geschäftsführer).
Der Pastoralrat ist ein Beratungsgremium, das sich aus Laien und
Geistlichen zusammensetzt, die aus unterschiedlichen pastoralen
Wirkungsbereichen des Bistums stammen. Seine Aufgabe ist es, nach
Vorgabe des "Codex des Kanonischen Rechts" Angelegenheiten zu
prüfen, die sich auf das pastorale Wirken innerhalb des Bistums
beziehen, darüber zu beraten und praktische Folgerungen
vorzuschlagen. Text und Foto: is
Weitere Informationen:
http://www.bistum-speyer.de/2/bistum-speyer/raete-und-kommissionen/dioezesanpastoralrat/
10.10.2016
Statt Hochbeet, Barfußpfad am Freiwilligentag
 „ Month of service „
Einsatz von SAP-Mitarbeitern in der Prot. Kita Villa Kunterbunt
Speyer
„ Month of service „
Einsatz von SAP-Mitarbeitern in der Prot. Kita Villa Kunterbunt
Speyer
Speyer- Gestern am 06.10.2016
haben 15 Freiwillige, freigestellt vom Arbeitgeber SAP
Walldorf im Rahmen des „Month of service“ Projektes in der prot.
Kita Villa Kunterbunt in Speyer mit Herz und Hand ehrenamtlich bei
der Verschönerung der Außenanlage angepackt.
Es wurde ein Barfußpfad angelegt und ein
Spielhäuschen für das Außengelände gezimmert.
Nebenbei haben die SAP - Mitarbeiter 25 cm³
Holzhackschnitzel als Fallschutz für die Sicherheit der Kinder
unter dem Klettergerät und in einer bespielbaren Buschhöhle
verteilt.
Ursprünglich war das Anlegen eines Hochbeetes
angedacht, welches aber erst im Frühjahr folgen soll
Spontan und motiviert haben die, durch
die „FreiwilligenAgentur Heidelberg“ vermittelten, Helfer die neue
Aufgabe angenommen und gut und rasch gelöst. Mit Engagement, Kraft
und Geschicklichkeit wurde gearbeitet und dann das wohlverdiente
Mittagessen gemeinsam verspeist.
Eine Kindergartenbesichtigung und die
Fertigstellung des Holzhäuschens füllten das
Nachmittagsprogramm.
Im Namen des Trägers (Prot. Gesamtkirchengemeinde
Speyer) der 108 Kinder und deren Familien und des Teams hat sich
die Kitaleiterin Doris Neubauer mit einer Urkunde bei den
Helfern herzlich bedankt und sie eingeladen gerne wieder zu
kommen.
Text und Foto:
Dreifaltigkeitskirchengemeinde
07.10.2016
Bischof emeritus Dr. Anton Schlembach feiert diamantenes Priesterjubiläum
 Am 10.
Oktober 1956 in Rom zum Priester geweiht – „Deus salus – Gott ist
das Heil“ lautet sein bischöflicher Wahlspruch
Am 10.
Oktober 1956 in Rom zum Priester geweiht – „Deus salus – Gott ist
das Heil“ lautet sein bischöflicher Wahlspruch
Speyer- Als Dr. Anton Schlembach im
Februar 2007 mit einem feierlichen Gottesdienst im Speyerer Dom aus
seinem Amt als 95. Bischof von Speyer verabschiedet wurde, ging
eine Ära zu Ende: Über 23 Jahre wirkte er als Diözesanbischof. Nur
einer seiner Vorgänger hat in den letzten 100 Jahren das Bistum
länger geleitet, Ludwig Sebastian, der 1943 nach 26 Bischofsjahren
80-jährig starb. In Schlembachs Amtszeit fielen Ereignisse, die
ohne Zweifel zu den Glanzpunkten der Bistumsgeschichte zählen, wie
der Besuch von Papst Johannes Paul II. 1987 in Speyer und die
Seligsprechung des Speyerer Diözesanpriesters Paul Josef Nardini am
22. Oktober 2006.
Am 10. Oktober dieses Jahres begeht Bischof em. Dr. Anton
Schlembach sein diamantenes Priesterjubiläum. Vor 60 Jahren, am 10.
Oktober 1956, ist er in Rom zum Priester geweiht worden. Zum
diamantenen Priesterjubiläum war am 16. Oktober ein feierliches
Pontifikalamt im Dom vorgesehen. Wegen der altersbedingten
gesundheitlichen Einschränkungen des Jubilars ist dies leider nicht
möglich. Bischof em. Dr. Anton Schlembach feiert zusammen mit
seinem Nachfolger Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 16. Oktober
die übliche sonntägliche Eucharistie im Speyerer
Caritas-Altenzentrum St. Martha um 9.30 Uhr als Dankgottesdienst.
Der 16. Oktober ist zugleich der 33. Jahrestag seiner
Bischofsweihe. Anschließend ist ein kleiner Empfang, bei dem man
dem Jubilar begegnen kann. Er bittet darum, von Geschenken
abzusehen.
Bistum Speyer veröffentlicht Online-Präsentation ausgewählter
Bischofsworte
Das Bistum Speyer würdigt seinen emeritierten Bischof durch die
Veröffentlichung einer Online-Präsentation von ausgewählten
Bischofsworten aus den Jahren 1983 bis 2007. Unter der Überschrift
„Im Dienst der Verkündigung des Evangeliums“ bieten die vom
Bistumsarchiv zusammengestellten Texte einen Querschnitt der
Themen, die in seinem Pontifikat bedeutsam waren. Die Hirtenworte
unter anderem zum Rückgang des Glaubens und der Kirchenbindung, zu
Beichte, Eucharistie, Neuevangelisierung und Ordens- und
Priesterberufungen zeugen von seinem Bemühen, das Glaubenserbe in
einem der ältesten deutschen Bistümer zu erhalten und zukunftsfähig
zu machen. „Immer war es ihm ein Anliegen, die Menschen in der
christlichen Hoffnung zu bestärken und die Botschaft Jesu Christi
in der Welt zu verbreiten, denn ohne den Gottesglauben, so seine
Überzeugung, geraten auch die Grundwerte der Gesellschaft in
Gefahr“, schreibt Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in einem
Geleitwort. Sein bischöflicher Wahlspruch „Deus salus – Gott ist
das Heil“ sei der „Fixpunkt seiner Verkündigung“ gewesen und ziehe
sich in immer neuen Konkretisierungen durch alle seine
Hirtenbriefe.
Seine Berufung im Jahr 1983 war für die Pfalz eine echte
Überraschung
Es war für die Katholiken des Bistums Speyer eine echte
Überraschung, als am 25. August 1983 der damals 51-jährige Dr.
Anton Schlembach von Papst Johannes Paul II. zum Bischof von Speyer
ernannt wurde. In dem Dreivierteljahr nach der Berufung Bischof
Wetters zum Erzbischof von München und Freising war in der Pfalz
der damalige Generalvikar der Diözese Würzburg jedenfalls nicht als
Anwärter für den Speyerer Bischofsstuhl "gehandelt" worden. Waren
doch seine vier unmittelbaren Vorgänger alle Pfälzer
beziehungsweise Saarpfälzer gewesen. Auch für ihn selbst, der sich
tief in seiner fränkischen Heimat verwurzelt fühlte, bedeutete der
Wechsel von Würzburg nach Speyer keine leichte Umstellung. Doch in
mehr als 30 Jahren hat der gebürtige Unterfranke in Speyer und der
Pfalz neue Wurzeln geschlagen.
Schlembachs Ursprünge liegen im Bistum Würzburg
Bischof Schlembach stammt aus Großwenkheim, einem Dorf bei
Münnerstadt, wo er am 7. Februar 1932 als ältestes von vier Kindern
einer Landwirtsfamilie geboren wurde. Nach dem Studium in Würzburg
und an der päpstlichen Universität Gregoriana empfing er am 10.
Oktober 1956 in Rom die Priesterweihe, drei Jahre später
promovierte er zum Doktor der Theologie. In seiner Heimatdiözese
wurde er im Anschluss an die Kaplansjahre mit einer Reihe
verantwortungsvoller Aufgaben betraut: Jeweils drei Jahre war er
Direktor des Studienseminars in Aschaffenburg und Regens des
Priesterseminars in Würzburg. Fast zwölf Jahre erteilte er
hauptamtlich Religionsunterricht am Gymnasium in Hammelburg, ehe er
am 1. Juni 1981 zum Domkapitular und schon einen Monat später zum
Generalvikar des Bistums Würzburg ernannt wurde. Am 25. August 1983
folgte die Ernennung zum Bischof von Speyer. Zwei Monate später, am
16. Oktober, weihte ihn sein Vorgänger, Erzbischof Wetter, im Dom
zu Speyer zum Bischof.
Sein Ziel: Dem Verlust an Glauben und Kirchenbindung
entgegenwirken
Die Bemühungen um eine Neuevangelisierung und eine Aktivierung
der Gemeinden sind immer wiederkehrende Grundthemen seiner
Amtszeit. Diesem Anliegen diente auch die Erarbeitung eines
Pastoralplanes, der 1993 in Kraft gesetzt wurde. Eine herausragende
Initiative zur Glaubenserneuerung waren die drei Vorbereitungsjahre
auf das Christus-Jubiläum 2000. Ein dreijähriges geistliches
Programm mit den Schwerpunktthemen "Bibel", "Kirche" und
"Weltverantwortung der Christen" sollte in den Pfarreien mehr
Freude am Glauben und mehr christliches Engagement wecken. Zum
ökumenischen "ChristFest" an Pfingsten 2000 versammelten sich rund
15 000 Christen aus zwölf Kirchen und Gemeinschaften in Speyer.
Das Christentum am Beispiel moderner Glaubensvorbilder
greifbar gemacht
Große Bedeutung im Hinblick auf eine kirchliche Erneuerung maß
Schlembach auch modernen Glaubensvorbildern bei. So versuchte er
von Beginn seiner Amtszeit an mit starkem persönlichem Engagement,
Botschaft und Lebenszeugnis der heiligen Edith Stein, die neun
Jahre in Speyer wirkte, im Bistum lebendig zu halten. Ihre
Seligsprechung 1987 war ihm Anlass, den Papst nach Speyer
einzuladen. Ihr 100. Geburtstag 1991 und ihre Heiligsprechung 1998
wurden im Bistum jeweils mit einer dreitägigen Feier begangen.
Überdies gab Schlembach den Anstoß zur Gründung einer deutschen
Edith-Stein-Gesellschaft, die ihren Sitz in Speyer hat.
In enger Verbindung steht der Name Schlembachs mit Paul Josef
Nardini, der als erster Pfälzer am 22. Oktober 2006 im Speyerer Dom
selig gesprochen wurde. Dass es zu diesem für das Bistum bislang
einmaligen Ereignis kommen konnte, ist ganz wesentlich ihm zu
verdanken. Der Bischof war auf Nardini erstmals 1987 aufmerksam
geworden. Sofort war er von Leben und Wirken des Pfarrers, der
Mitte des 19. Jahrhunderts in Pirmasens gegen die soziale Not
gekämpft hatte, betroffen und fasziniert. Da auch die
"Mallersdorfer Schwestern", Nardinis Ordensgemeinschaft, diesen
Wunsch teilten, konnte er schon drei Jahre später auf Bistumsebene
das formelle Seligsprechungsverfahren eröffnen.
Schlembach bezog für den Schutz des Lebens entschieden
Position
Denselben Stellenwert wie der Verkündigung und dem Gottesdienst
räumt Bischof em. Schlembach dem sozialen Auftrag der Kirche ein.
"Ohne Caritas ist die Kirche unglaubwürdig", so seine Überzeugung.
Fast 20 caritative Einrichtungen, von Altenheimen über
Behindertenwerkstätten bis hin zum Übernachtungsheim für
Nichtsesshafte, hat er in seiner Amtszeit eingeweiht. Ebenso war er
einer der maßgeblichen Impulsgeber für die ökumenische Hospizhilfe,
die 1991 im Bereich von Bistum und Landeskirche gegründet
wurde.
Gerade wenn es um das menschliche Leben geht, um seinen Schutz
und seine Würde, sieht Schlembach die Christen besonders in Pflicht
genommen. So hat er selbst im Streit um die Abtreibungsgesetzgebung
immer wieder in der Öffentlichkeit eine Verbesserung des
rechtlichen Schutzes für die ungeborenen Kinder gefordert. Nicht
weniger deutlich bezog er Stellung gegen die Einführung der aktiven
Sterbehilfe in einigen europäischen Nachbarländern und die Tötung
embryonaler Menschen im Interesse der Forschung. Die "Klarheit des
kirchlichen Zeugnisses für die Unantastbarkeit jedes menschlichen
Lebens" war auch der entscheidende Grund dafür, dass er im Jahr
2000 als einer der ersten deutschen Bischöfe in den
Schwangerenberatungsstellen der Diözese keine Beratungsscheine mehr
ausstellen ließ, die eine straffreie Abtreibung ermöglichen. Umso
stärker war sein Bemühen, das Beratungsangebot für Schwangere in
Not- und Konfliktsituationen aufrecht zu erhalten und die Hilfe der
Kirche noch auszuweiten. Ein wichtiger Schritt dabei war die
Gründung einer "Bischöflichen Stiftung für Mutter und Kind", die
Politik und Öffentlichkeit für den Lebensschutz sensibilisiert und
Projekte des Caritasverbandes für Mütter in Not finanziert.
Gastgeber für Besuch des Papstes 1987 - ein
„Jahrtausendereignis“ für das Bistum
Am 4. Mai 1987 kam Papst Johannes Paul II. während seines
zweiten Deutschlandbesuches nach Speyer und feierte auf dem
Domplatz mit 60 000 Teilnehmern eine heilige Messe - für die Stadt
und das Bistum ein "Jahrtausendereignis". Auch viele internationale
Staatsgäste empfing Bischof Schlembach im Speyerer Dom. Manchem
Regierungschef, den Bundeskanzler Kohl während seiner Amtszeit in
seinen Heimatdom brachte, hat Bischof Schlembach persönlich die
europäische Bedeutung des Bauwerks erläutert: Michail Gorbatschow
und Boris Jelzin ebenso wie George Bush, Vaclav Havel oder König
Juan Carlos von Spanien. In seiner Kathedrale sieht er aber nicht
nur das einmalige Zeugnis europäischer Baukunst und Geschichte.
Entstanden noch vor den großen Glaubensspaltungen, ist der salische
Kaiserdom für ihn ebenso ein Mahnmal zur Einheit der Kirchen. So
führte Schlembach auch von Anfang an die guten ökumenischen
Beziehungen im Bistum konstruktiv weiter.
Wie die meisten Bischöfe nahm auch der Speyerer Bischof Aufgaben
außerhalb seines Bistums wahr, anfangs in der Publizistischen
Kommission und der Ökumene-Kommission der Deutschen
Bischofskonferenz, später in der "Kommission Weltkirche", deren
Unterkommission für Missionsfragen er leitete, und in der
"Kommission für gesellschaftliche und soziale Fragen", deren
stellvertretender Vorsitzender er zehn Jahre lang war. Von1991 bis
2006 war er Großprior der Deutschen Statthalterei des Ritterordens
vom Heiligen Grab zu Jerusalem. Fünf Jahre war er Mitglied im
Päpstlichen Rat für den Dialog mit den Nichtglaubenden; als Leiter
des Dialog-Sekretariates für die Bundesrepublik und die
deutschsprachige Schweiz richtete er wissenschaftliche Symposien in
Speyer, Zagreb und Prag aus. Vier Mal organisierte er als
Delegierter der Deutschen Bischofskonferenz das deutschsprachige
Programm der Eucharistischen Weltkongresse: 1989 in Seoul, 1993 in
Sevilla, 1997 in Breslau und 2000 in Rom.
Schlembach: Christen sollen ihren Glauben entschieden
bezeugen
Wenn Bischof Schlembach auf seine Amtszeit zurückblickt,
klammert er besorgniserregende und schmerzliche Entwicklungen nicht
aus. So konstatiert er durchaus den zahlenmäßigen Rückgang an
Gläubigen und Gottesdienstbesuchern, den Priestermangel oder den in
seinen Augen viel zu schwachen Einsatz der Christen für eine
"Kultur des Lebens von der natürlichen Empfängnis bis zum
natürlichen Sterben". Aber all dies ist für ihn kein Grund zur
Resignation oder gar zum Pessimismus. Im Gegenteil, er sieht auch
im kirchlichen Leben hierzulande viele Hoffnungszeichen und neue
Aufbrüche. "Vieles spricht dafür, dass sich Atheismus, Säkularismus
und Postmoderne totlaufen", schrieb er in seinem letzten
Bischofswort zur österlichen Bußzeit. Diese Entwicklung sei für
Christen eine Ermutigung, täglich neu und noch entschiedener ihren
Gottesglauben zu leben und zu bezeugen.
Weitere Informationen zu Bischof em. Dr. Anton
Schlembach:
www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/leitung/bischof-em/
Lebensdaten und Initiativen:
www.bistum-speyer.de/2/bistum-speyer/leitung/bischof-em/lebensdaten/
Online-Präsentation der Bischofsworte anlässlich des
60-jährigen Priesterjubiläums:
www.bistumsarchiv-speyer.de (Menü „Publikationen“)
oder direkt unter
http://www.bistum-speyer.de/2/erziehung-schule-bildung/bistumsarchiv/publikationen/
Text: is; Foto: Klaus Landry
05.10.2016
Nacht der Barmherzigkeit lockte viele Besucher in den Speyerer Dom
 Jugendnacht spiegelte Vielfalt kirchlicher Gebetspraxis-
Brüder aus Taizé zu Gast im Dom
Jugendnacht spiegelte Vielfalt kirchlicher Gebetspraxis-
Brüder aus Taizé zu Gast im Dom
Speyer- Die „Nacht der Barmherzigkeit“
hat am vergangenen Samstag viele Menschen in den Speyerer Dom
gelockt. Sie folgten der Einladung von Jugendlichen aus dem Bistum
Speyer und Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Vom frühen Abend bis nach
Mitternacht waren Mittelschiff und Apsis in warmes Licht getaucht.
Der Orangeton erinnerte an den Kirchenraum von Taizé in Frankreich,
wo sich jährlich tausende jungen Menschen treffen um gemeinsam zu
leben und zu beten. Ein Höhepunkt der "Nacht der Barmherzigkeit"
war sicher das Taizégebet, zu dem zwei Ordensbrüder aus Frankreich
angereist waren. Sie brachten die Spiritualität des geistlichen
Zentrums für Jugendliche aus aller Welt mit in die Speyerer
Kathedrale. Der romanische Kirchenraum wurde von unzähligen Kerzen
erhellt. Die einfachen Gesänge, für die Taizé berühmt ist, wurden
von einem Chor von mehr als zweihundert meist jugendlichen
Musikerinnen und Musikern interpretiert. Bruder Frank betonte in
einer kurzen Ansprache, das eine Haltung der Barmherzigkeit
Menschen verwandeln könne: „Wenn wir bedenken, dass Gott auch
barmherzig ist, hilft uns das, anders an Gott zu denken. Unser
Verhältnis zu Gott wird verwandelt. Auch unser Verhältnis zu
anderen Menschen wird verwandelt“. Bruder Frank verband den Bericht
seiner persönlichen Erfahrung einer das Denken und Handeln
verändernden Hoffnung mit dem Wunsch, dass eine geistige Verbindung
der Barmherzigkeit zwischen Taizé in Frankreich und den Menschen im
Speyerer Dom erfahrbar werde: „Barmherzigkeit hilft uns, das Leben
um uns herum mit mehr Hoffnung zu leben. Diese Hoffnung wir dadurch
geweckt, dass wir andere treffen- zum Beispiel heute Abend. Das
habe ich erlebt, als ich hier in der Kirche saß“, erklärte er. „Ich
werde diese Erfahrung der Verwandlung mit nach Hause nach Taizé
nehmen, und hoffe, dass auch Sie sie mit nach Hause zu Ihren
Familien und Freunden nehmen.“
Bischof eröffnet Jugendnacht | Jugendverbände betonen Handeln
aus Barmherzigkeit heraus
 Bischof Wiesemann hatte zuvor gemeinsam mit Pfarrer
Carsten Leinhäuser die Nacht der Barmherzigkeit eröffnet. Der
Speyerer Bischof machte deutlich, dass der barmherzige Blick auf
die Mitmenschen dem Ausschluss Einzelner entgegenwirke. Er zitierte
aus der berühmten Rede von Martin Luther King "I have a dream- Ich
habe einen Traum" und betete für den Zusammenhalt der Menschen,
unabhängig von Rasse, Nation oder Weltanschauung.
Bischof Wiesemann hatte zuvor gemeinsam mit Pfarrer
Carsten Leinhäuser die Nacht der Barmherzigkeit eröffnet. Der
Speyerer Bischof machte deutlich, dass der barmherzige Blick auf
die Mitmenschen dem Ausschluss Einzelner entgegenwirke. Er zitierte
aus der berühmten Rede von Martin Luther King "I have a dream- Ich
habe einen Traum" und betete für den Zusammenhalt der Menschen,
unabhängig von Rasse, Nation oder Weltanschauung.
Carsten Leinhäuser leitet die Abteilung Jugendseelsorge, die die
Nacht im Dom verantwortete. Das Gebet sei die eine Seite der
Barmherzigkeit, sagte er. Aus dem Gebet folge aber immer der
Auftrag zu handeln: „Über Barmherzigkeit kann man reden - das ist
die eine Sache. Konkret wird sie aber erst, wenn sie gelebt wird.
Sie ist ganz eng mit unserem Handeln verknüpft. Als Christ handle
ich, indem ich mich für andere Menschen engagiere - und indem ich
für andere Menschen bete. Beides sind Wege, aktiv zu werden und
barmherzig zu handeln. In der "Nacht der Barmherzigkeit" haben wir
die Teilnehmer genau dazu eingeladen: Erst miteinander für Menschen
zu beten, die in einer Notlage sind oder Schwierigkeiten haben, ihr
Leben in den Griff zu bekommen. Und dann auf Menschen im
persönlichen Umfeld zu zugehen, die eine konkrete Unterstützung
brauchen und ihnen diese anzubieten.“ Als Diözesanpräses des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Bistum Speyer
warb er deshalb gemeinsam mit seiner BDKJ-Vorstandskollegin Lena
Schmidt für das Projekt „Zukunftszeit“ des BDKJ. Mit „Zukunftszeit“
setzt der Dachverband der katholischen Kinder- und Jugendverbände
im Vorfeld der Bundestagswahlen im kommenden Jahr ein Zeichen gegen
gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit und für Integration. Die
Gäste im Dom konnten  bereits während der „Nacht der Barmherzigkeit“ ein Zeichen
setzen und die Fotobox nutzen, um sich mit ihrem Gesicht und
Statement stark zu machen für ein buntes Land: „Wir finden:
Zukunftszeit ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit“, erklärte Lena
Schmidt. „Wir wollen nicht, dass Menschen benachteiligt sind oder
ausgeschlossen werden. Wir wollen das nicht, weil Gott so nicht ist
und er uns einen klaren Auftrag gegeben hat, zu helfen, wo Hilfe
gebraucht wird. Das ist ganz unabhängig von Hautfarbe, Herkunft
oder sonstigen Merkmalen.“
bereits während der „Nacht der Barmherzigkeit“ ein Zeichen
setzen und die Fotobox nutzen, um sich mit ihrem Gesicht und
Statement stark zu machen für ein buntes Land: „Wir finden:
Zukunftszeit ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit“, erklärte Lena
Schmidt. „Wir wollen nicht, dass Menschen benachteiligt sind oder
ausgeschlossen werden. Wir wollen das nicht, weil Gott so nicht ist
und er uns einen klaren Auftrag gegeben hat, zu helfen, wo Hilfe
gebraucht wird. Das ist ganz unabhängig von Hautfarbe, Herkunft
oder sonstigen Merkmalen.“
Viele Gebetsformen: Breites Angebot sorgt für Kommen und
Gehen bis Mitternacht
Das gemeinsame Gebet in vielen Facetten war Kern der Jugendnacht
im Dom. So wechselten die Angebote im Verlauf der Abends von Texten
zu Liedern und von Tänzen zu Momenten der Stille. Wer kam, konnte
im Mittelschiff Platz nehmen, zuschauen, mitsingen oder mitbeten.
Das Vocalensemble CREATIV unter Leitung von Pia Knoll verzauberte
die Besucherinnen und Besucher mit sanften, nachdenklichen Tönen,
aber auch mit schwungvollen Neuen Geistlichen Liedern. Wer wollte,
konnte im linken Seitenschiff des Domes mit einem Seelsorger ins
Gespräch kommen und die Beichte, das Sakrament der Versöhnung,
empfangen. Im rechten Seitenschiff erzählte die Fotoausstellung
„Auf den Spuren von Mutter Teresa. Liebe leben. Leben teilen“ von
Kalkutta, der Heimat der kürzlich heilig gesprochene Ordensfrau.
Ihren Spuren ist der Wormser Fotograf Stefan Ahlers gefolgt. Die
weltkirchliche Verbundenheit spielte während der "Nacht der
Barmherzigkeit" eine besonders große Rolle. Das Hilfswerk Missio
war zu  Gast und brachte mit der Tanzgruppe der Philippinischen
Kulturgemeinschaft im Saarland das Land näher, das im Zentrum der
diesjährigen Missio-Kampagne steht. Pater Kenneth Centeno,
Vinzentiner von den Philippinen, lebt derzeit in München. In seinem
Impulstext sagte er: „Die Barmherzigkeit Gottes ist eine Einladung
zum neuen Leben, das eine neue Hoffnung schafft“. Diese bezog er
ganz konkret auf die Lebensituation der Menschen hier und auf den
Philippinen und spannte einen weiten gesellschaftlich- politischen
Bogen von den Ängsten der Menschen in Deutschland bis hin zu den
Folgen des Klimawandels.
Gast und brachte mit der Tanzgruppe der Philippinischen
Kulturgemeinschaft im Saarland das Land näher, das im Zentrum der
diesjährigen Missio-Kampagne steht. Pater Kenneth Centeno,
Vinzentiner von den Philippinen, lebt derzeit in München. In seinem
Impulstext sagte er: „Die Barmherzigkeit Gottes ist eine Einladung
zum neuen Leben, das eine neue Hoffnung schafft“. Diese bezog er
ganz konkret auf die Lebensituation der Menschen hier und auf den
Philippinen und spannte einen weiten gesellschaftlich- politischen
Bogen von den Ängsten der Menschen in Deutschland bis hin zu den
Folgen des Klimawandels.
Anbetung und Lobpreis waren ebenso Elemente der Nacht der
Barmherzigkeit wie die abschließende Komplet, die jahrhundertealte
Gebetskultur der Klöster in die Jugendnacht brachte. Jede
Gebetsform zog andere Besucherinnen und Besucher in ihren Bann und
so herrschte vom frühen Abend bis nach Mitternacht ein Kommen und
Gehen im Dom. Mit der Komplet, die durch Neue Geistliche Lieder
eine „Frischekur“ erfahren hatte, endete die "Nacht der
Barmherzigkeit".
Veranstaltet wurde die "Nacht der Barmherzigkeit" von der
Abteilung Jugendseelsorge des Bischöflichen Ordinariates Speyer.
Die Abteilung koordiniert bistumsweit die Seelsorge für Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene. Der Dachverband Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer ist Kooperationspartner
der Abteilung Jugendseelsorge. Mehr: www.jugend-bistum-speyer.de
bdkj-speyer.de
Text: BDKJ Speyer; Foto: (c) Bistum Speyer / Klaus
Landry
03.10.2016
Würdigung für kirchliches und caritatives Engagement
.jpg) Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann verleiht Pirminius-Plakette an besonders
engagierte Kirchenmitglieder aus der Diözese Speyer
Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann verleiht Pirminius-Plakette an besonders
engagierte Kirchenmitglieder aus der Diözese Speyer
Speyer- Würdigung für großes kirchliches und
karitatives Engagement: Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat 17
Frauen und Männer aus der Diözese am Sonntag, 2. Oktober, im
Priesterseminar St. German in Speyer die Pirminius-Plakette
verliehen. Sie ist die höchste Auszeichnung der Diözese für
besonderen ehrenamtlichen Einsatz für Pfarrei, Dekanat oder gar
Diözese. Benannt ist die bischöfliche Ehrenplakette nach dem
heiligen Abtbischof Pirminius. Er wirkte als Missionar im
südwestdeutschen Raum und gründete das Kloster Hornbach, wo er im
Jahr 753 starb. Der Ehrung vorausgegangen war das Pontifikalamt im
Dom zum 955. Jahrestag der Weihe der romanischen Kathedrale.
Die Geehrten wurden von den Dekanatsräten sowie von Bischof
Wiesemann für die Auszeichnung vorgeschlagen. Die neuen Träger der
Pirminius-Plakette heißen Wilma Brock (St. Ingbert), Theodor Brunck
(Bayerfeld-Steckweiler), Brigitte Dauer (Eußerthal), Ute Dingenouts
(Maxdorf), Karl-Heinz Ebersold (Bexbach), Gertrud Engelbreit
(Frankenthal), Alban Gutting (Lingenfeld), Angela Henigin
(Hatzenbühl), Karl Josef Koch (Dahn), Josefine Lederle
(Ruppertsecken), Franz Leidecker (Kaiserslautern), Hans Lenhart
(Glan-Münchweiler), Elisabeth Mertel (Erlenbach), Thorsten Reinarzt
(Trippstadt), Walter Rusch (Schopp), Agathe Schuck (Niedermoor)
sowie Schwester Ramona Thönnes (Landau). Die Dekanate Bad Dürkheim
und Ludwigshafen hatten keine Vorschläge eingereicht.
In seiner Laudatio verglich Bischof Wiesemann die Kirche mit
einem Gebäude, sprach von einem „lebendigen Bau der Kirche“. Er
betonte: „Die Kirche Jesu Christi ist kein totes Gebilde, sondern
eine Lebenskirche.“ Er dankte den Frauen und Männern, denen er die
Pirminius-Plakette überreichte. Sie seien diejenigen, die am
Gebäude Kirche weiterbauen und es weiterentwickeln, kleine und
große Aufgaben übernähmen. „Ich kann als Bischof nur meinen Kopf
neigen und danke sagen.“ Einige Preisträger konnten aus
gesundheitlichen Gründen die Auszeichnung am Sonntag nicht
persönlich entgegennehmen. „Auch die heute Erkrankten erhalten die
Ehrung“, versicherte der Bischof.
Die Preisträger der Pirminius-Plakette
2016:
Theodor Brunck aus Bayerfeld-Steckweiler
(Pfarrei Hl. Franz von Assisi, Rockenhausen) konnte aus
gesundheitlichen Gründen die Auszeichnung nicht entgegennehmen.
Dekan Markus Horbach wird die Plakette und Urkunde überbringen,
Bischof Wiesemann sprach Theodor Brunck seinen Dank aus: „Er war
über viele Jahre ein zuverlässiger Ansprechpartner für alle
Angelegenheiten, die die Kirche in Bayerfeld betreffen, gewesen.“
Der Nordpfälzer .jpg) unterstützt
seit fast 60 Jahren das Bonifatiuswerk. Seit 1962 kümmert sich der
heute 74-Jährige um Busse des Hilfswerks, wartet und pflegt sie.
Seit vielen Jahrzehnten übernimmt Brunck Sonntag für Sonntag
Fahrdienste und ermöglicht so, dass Gläubige aus den umliegenden
Dörfern den Gottesdienst besuchen können. Daneben war Theodor
Brunck über Jahrzehnte Mitglied und Vorsitzender im
Pfarrgemeinderat, Mitglied im Verwaltungsrat und Lektor. Seit 40
Jahren übernimmt er den Sakristandienst in St. Josef Bayerfeld,
führte ihn trotz schwerer gesundheitlicher Probleme weiter. Ebenso
lange begleitet er die Aktion Dreikönigssingen.
unterstützt
seit fast 60 Jahren das Bonifatiuswerk. Seit 1962 kümmert sich der
heute 74-Jährige um Busse des Hilfswerks, wartet und pflegt sie.
Seit vielen Jahrzehnten übernimmt Brunck Sonntag für Sonntag
Fahrdienste und ermöglicht so, dass Gläubige aus den umliegenden
Dörfern den Gottesdienst besuchen können. Daneben war Theodor
Brunck über Jahrzehnte Mitglied und Vorsitzender im
Pfarrgemeinderat, Mitglied im Verwaltungsrat und Lektor. Seit 40
Jahren übernimmt er den Sakristandienst in St. Josef Bayerfeld,
führte ihn trotz schwerer gesundheitlicher Probleme weiter. Ebenso
lange begleitet er die Aktion Dreikönigssingen.
Zahlreiche Aufgaben hat auch Josefine Lederle aus
Ruppertsecken (Pfarrei Hl. Franz von Assisi, Rockenhausen)
inne. Karl-Heinz Wiesemann würdigte die 63-Jährige für ihr
vielfältiges Engagement. Als Mitglied und Vorsitzende des
Pfarrgemeinderats Ruppertsecken und inzwischen als Vorsitzende des
Pfarreirats der neuen Pfarrei Hl. Franz von Assisi hat sie wichtige
ehrenamtliche Aufgaben in der Pfarrei übernommen, ebenso im
Liturgie- und Ökumeneausschuss. Aktiv ist Josefine Lederle in ihrer
Pfarrei außerdem unter anderem bei der Sternsinger-Aktion, als
Sakristanin und Kommunionshelferin. Seit zwölf Jahren ist sie als
ehrenamtliche Betreuerin in verschiedenen Seniorenheimen im
Donnersbergkreis unterwegs. Seit 15 Jahren liegt die katholische
Erwachsenenbildung im Dekanat Donnersberg in Josefine Lederles
Händen, was Bischof Wiesemann besonders hervorhob: „Sie haben etwas
dazu getan, Bildung möglich zu machen, und haben durch
verschiedenste Themen und Referenten Menschen Anregungen zum Leben
aus dem Glauben gegeben.“
.jpg) Alban
Gutting aus Lingenfeld (Pfarrei Seliger Paul Josef
Nardini, Germersheim) ist seit seiner Kindheit eng mit der
Kirchengemeinde verbunden. „So fällt es schwer, all Ihre Ehrenämter
zu benennen“, bekannte der Bischof. In den 1970er Jahren übernahm
Gutting die Geschäftsführung des Elisabethenvereins, gliederte die
pfarrliche Krankenpflege in die neue Ökumenische Sozialstation
Germersheim-Lingenfeld ein. Bis heute ist er als
Verwaltungsratsmitglied der Sozialstation tätig. Mit großem
Engagement und Verantwortungsbewusstsein kümmerte sich Gutting um
den Neubau eines Schwesternhauses der Niederbronner Schwestern,
einer Kindertagesstätte und war viele Jahre Ansprechpartner für die
Belange des Personals und der Gebäude. Als Lingenfelder
Ortsbürgermeister – das Amt bekleidete er fast zwei Jahrzehnte –
lag sein Augenmerk auf der guten Zusammenarbeit zwischen Orts- und
Kirchengemeinde. Daneben ist der 78-Jährige Mitglied im
Verwaltungsrat sowie seit 50 Jahren Sänger im Lingenfelder
Kirchenchor.
Alban
Gutting aus Lingenfeld (Pfarrei Seliger Paul Josef
Nardini, Germersheim) ist seit seiner Kindheit eng mit der
Kirchengemeinde verbunden. „So fällt es schwer, all Ihre Ehrenämter
zu benennen“, bekannte der Bischof. In den 1970er Jahren übernahm
Gutting die Geschäftsführung des Elisabethenvereins, gliederte die
pfarrliche Krankenpflege in die neue Ökumenische Sozialstation
Germersheim-Lingenfeld ein. Bis heute ist er als
Verwaltungsratsmitglied der Sozialstation tätig. Mit großem
Engagement und Verantwortungsbewusstsein kümmerte sich Gutting um
den Neubau eines Schwesternhauses der Niederbronner Schwestern,
einer Kindertagesstätte und war viele Jahre Ansprechpartner für die
Belange des Personals und der Gebäude. Als Lingenfelder
Ortsbürgermeister – das Amt bekleidete er fast zwei Jahrzehnte –
lag sein Augenmerk auf der guten Zusammenarbeit zwischen Orts- und
Kirchengemeinde. Daneben ist der 78-Jährige Mitglied im
Verwaltungsrat sowie seit 50 Jahren Sänger im Lingenfelder
Kirchenchor.
Bischof Wiesemann würdigte Angela Henigin aus
Hatzenbühl (Pfarrei Mariä Heimsuchung, Rheinzabern) für
ihre „langjährigen und treuen Dienste in der Pfarrei“ und ihr
„ausdauerndes und vom Glauben getragenes Engagement“. Die
77-Jährige ist Mitglied im Pfarreirat, sie ist Sakristanin,
Kommunionhelferin und mitverantwortlich beim Kirchenputz und
Kirchenschmuck. Lange Jahre war Angela Henigin vor Ort zuständig
für die Caritas. „Durch die Verteilung religiöser Schriften haben
Sie Kontakt mit vielen Gemeindemitgliedern, vor allen Dingen alten
und kranken Menschen, mit denen Sie immer wieder über den Glauben
ins Gespräch kommen und so Zeugnis Ihres tiefen Glaubens geben“,
sagte der Bischof und hob ihre liebevolle Sorge um den
Blumenschmuck an den Feldkreuzen rund um Hatzenbühl hervor. Dies
sei Zeugnis der reichen christlichen Tradition der Pfalz.
Thorsten Reinartz aus Trippstadt (Pfarrei Maria
Schutz, Kaiserslautern) ist seit vielen Jahren auf vielfältige
Weise stark in seiner Pfarrei engagiert. Bischof Wiesemann verwies
darauf, dass Reinartz vor über 20 Jahren die Kirchenband
„Community“ gründete, die mit den geistlichen Gesängen in der
heimischen Kirche und im Umland viele Menschen bewegt. Darüber
hinaus ist das Engagement des 45-Jährigen vielfältig: Viele Jahre
war er Vorsitzender des Pfarrgemeinderats und hat nun den Vorsitz
des Gemeindeausschusses von St. Josef inne. Hinzu kommt der Dienst
als Lektor, Kommunionhelfer und Sakristan, die Vorbereitung von
Wortgottesdiensten und Kinderchristmetten, die Organisation von
Pfarrfesten und nicht zuletzt der Vorsitz im Elisabethenverein.
„Manche Ehrenamtliche leisten einen Vollzeitjob“, zollte der
Bischof Anerkennung.
Walter Rusch aus Schopp (Pfarrei Hl. Franz von
Assisi, Queidersbach) ist seit 30 Jahren als Organist und
Chorleiter ehrenamtlich tätig. Karl-Heinz Wiesemann wies auf Ruschs
Kompositionen und Arrangements von Chorstimmen hin. „Dass Ihr Herz
auch für die Ökumene schlägt“, sagte er dem 77-Jährigen, „können
wir daran erkennen, dass Sie während der Krankheit Ihres
protestantischen Pendants über einen längeren Zeitraum die Leitung
des protestantischen Kirchenchores übernahmen.“ Neben seinem
musikalischen Engagement ist Walter Rusch seit mehr als 40 Jahren
im Verwaltungsrat tätig und über das normale Maß hinaus etwa bei
der Erweiterung des Pfarrheims engagiert. Täglich schaute er auf
der Baustelle vorbei. Wiesemann: „Für Ihre Pfarrei sind Sie ein
stets verlässlicher Ansprechpartner und Helfer.“
Hans Lenhart aus Glan-Münchweiler (Pfarrei Hl.
Remigius, Kusel) ist Gründungsmitglied im Kirchenchor,
Mitorganisator und zuverlässiger Helfer bei allen kirchlichen
Festen. Darüber hinaus arbeitet der 73-Jährige seit vielen Jahren
im Verwaltungsrat der Pfarrei mit, ist seit neun Jahren der
stellvertretende Vorsitzende und kümmert sich als Ansprechpartner
um die Liegenschaften der Gemeinde St. Pirminius. „Als
Verantwortlicher für die Kirchenrenovierung haben Sie mit Tatkraft
die Baumaßnahmen begleitet. Auch sind Sie mitverantwortlich für die
Kirchenreinigung und Pflege der kirchlichen Einrichtungen“,
berichtete Bischof Wiesemann. Er bezeichnete Hans Lenhart als
wertvolle Stütze der Pfarrei. Der Glan-Münchweilerer ist außerdem
Mitglied im Führungskreis der Kolpingfamilie und organisiert und
unterstützt Kirchenfeste.
Agathe Schuck aus Niedermoor (vormals Kusel /
Pfarrei Hl. Remigius, Kusel) konnte aus gesundheitlichen Gründen
nicht an der Verleihung teilnehmen. Die Ehrung wird vor Ort durch
Dekan Rudolf Schlenkrich nachgeholt. Gewürdigt wurde die 73-Jährige
für ihre langjährigen ehrenamtlichen Dienste in der Pfarrei. Sie
wirkte als Sakristanin, Lektorin und Kommunionhelferin, war
zuständig für den Kirchenschmuck, nahm sich der Messdiener und
Sternsinger an. Sie ist Vorbeterin bei Fasten- und
Rosenkranzandachten, hält das Totengebet und spendet die
Krankenkommunion.
.jpg) Brigitte
Dauer aus Eußerthal (Pfarrei Hl. Elisabeth, Annweiler)
prägte über 30 Jahre lang die Kirchenmusiktage. In der Pfarrei
unterstützte die heute 80-Jährige eine Zeitlang Pfarrer Rinnert
fürsorglich im Haushalt, übernahm das Schmücken der Kirche und war
unter anderem bei Hochzeiten und Kommunionfeiern mit ihren
Blumenschmuckideen gefragt. Lange Zeit war Brigitte Dauer Mitglied
im Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat und pflegte die Gewänder der
Messdiener. Brigitte Dauer hatte eine Überraschung für den Bischof
mitgebracht: Sie überreichte ihm ein Foto, das ihn beim Fest zum
750. Jubiläum von Eußerthal zeigt.
Brigitte
Dauer aus Eußerthal (Pfarrei Hl. Elisabeth, Annweiler)
prägte über 30 Jahre lang die Kirchenmusiktage. In der Pfarrei
unterstützte die heute 80-Jährige eine Zeitlang Pfarrer Rinnert
fürsorglich im Haushalt, übernahm das Schmücken der Kirche und war
unter anderem bei Hochzeiten und Kommunionfeiern mit ihren
Blumenschmuckideen gefragt. Lange Zeit war Brigitte Dauer Mitglied
im Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat und pflegte die Gewänder der
Messdiener. Brigitte Dauer hatte eine Überraschung für den Bischof
mitgebracht: Sie überreichte ihm ein Foto, das ihn beim Fest zum
750. Jubiläum von Eußerthal zeigt.
Schwester Ramona Thönnes gehört den
Mallersdorfer Schwestern an. Bischof Wiesemann unterstrich: „Mit
dieser Ehrung sollen neben Ihnen auch stellvertretend alle
Mallersdorfer Schwestern, die seit 125 Jahren in der
Kindertagesstätte und Pfarrei Offenbach tätig
waren und deren Ära mit Ihrer Pensionierung nun geendet hat,
gewürdigt werden.“ Er bezeichnete Schwester Ramona als „eine Frau
voller Tatkraft und Stärke“. „Über 30 Jahre waren Sie in Offenbach
geradezu eine Institution.“ Die Liste ihrer Verdienste sei sehr
lang, einen Aufzählung würde scheitern, erklärte der Bischof und
ging dennoch auf einiges ein. Bis vor kurzem leitete Schwester
Ramona die Kindertagesstätte Offenbach. „Sie scheuten keine Arbeit
und hatten immer ein offenes Ohr für Sorgen, Nöte und Anliegen
jeglicher Art“, erklärte Wiesemann. „Mit Charisma, Herz und
Verstand haben Sie Ihre Arbeit ausgefüllt und sind dafür vielen
Mitmenschen ein Vorbild geworden.“ Auch in der Pfarrei war
Schwester Ramona präsent, brachte sich in viele Bereiche ein, unter
anderem als Katechetin, Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, im
Sakristeidienst und beim Besuchsdienst.
Karl Josef Koch aus Dahn (Pfarrei Hl. Petrus,
Dahn) ist laut Bischof Wiesemann „ein Allround-Talent“. Seit seiner
Jugend bereichert der 62-Jährige das Gemeindeleben. Unter anderem
war Koch Gruppenleiter der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG),
hatte 28 Jahre lang den Vorsitz des Pfarrgemeinderats St.
Laurentius inne und leitet nun den Gemeindeausschuss. Die Sakristei
liegt in seinen Händen und auch die Durchführung der
Sternsingeraktion. Karl Josef Koch organisierte zahlreiche
Zeltlager und Freizeiten, begleitete Baumaßnahmen in der Pfarrei,
unter anderem die Renovierung des Jugendhauses, den Aufbau des
Pater-Ingbert-Naab-Hauses.
Für Elisabeth Mertel aus Erlenbach (Pfarrei Hl.
Petrus, Dahn) nahm ihre Tochter stellvertretend die Ehrung
entgegen. „Es gibt immer wieder Menschen, ohne die eine Pfarrei für
viele andere nicht denkbar ist“, sagte Bischof Wiesemann. „So ein
Mensch ist Elisabeth Mertel.“ Die 75-Jährige nahm zahlreiche
Aufgaben wahr: vom Dienst in der Sakristei über die Sorge um den
Kirchenschmuck und die schöne Gestaltung des Fronleichnamsfestes,
hin zur Gestaltung von Andachten, der Mitarbeit im Team des
Gesprächskreises und bei Kranken-, und Geburtstagsbesuchen. Seit
ihrer Jugend engagierte sich Elisabeth Mertel in ihrer Gemeinde.
Wiesemann beeindruckte, dass sie auch nachdem sie schwer erkrankte,
„zuverlässig und uneigennützig ihre Dienste der Gemeinde solange
sie konnte, zur Verfügung stellte“.
Wilma Brock aus St. Ingbert (Pfarrei Hl.
Ingobertus, St. Ingbert) nannte der Bischof „ein Urgestein der
Pfarrei Hl. Ingobertus“, denn die 82-Jährige ist seit 53 in ihrer
Gemeinde St. Josef engagiert und lang ist die Liste der Aufgaben,
die sie in dieser Zeit übernommen hat. Wiesemann hob hervor, dass
Wilma Brock über Jahrzehnte den Haushalt des Pfarrers führte und
gleichzeitig zwei weitere Pfarrer betreute. Wilma Brock ist erste
Vorsitzende des Pfarrhaushälterinnenkreises im Dekanat Saar-Pfalz
und zweite Vorsitzende im Bistum Speyer. Seit 40 Jahren übernimmt
die Saarländerin in der Kolpingfamilie ein Amt im Vorstand, beinahe
ebenso lange ist sie Mitglied der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschland (KFD), dort ebenfalls im Vorstand tätig. Sie ist
langjähriges Mitglied im Pfarrgemeinderat, war viele Jahre
Vorsitzende des Festausschusses und wirkt im Liturgie- und
Caritasausschuss mit. Seit vier Jahrzehnten ist sie Sakristanin in
St. Josef und St. Engelbert, seit 20 Jahren engagiert sie sich in
der Sternsingeraktion.
Karl-Heinz Ebersold aus Bexbach (Pfarrei Hl.
Nikolaus, Bexbach) ist laut Bischof Wiesemann „ein
Organisationstalent und kompetenter und verständnisvoller
Ansprechpartner der Gemeinde St. Martin“. Seit vielen Jahren
organisiert Ebersold Konzerte für die Pfarrei, holte unter anderem
die Münchner Sängerknaben in die Kirche. Als Sakristan kümmert sich
der 80-Jährige seit knapp 20 Jahren um die Sakristei von St. Martin
und außerdem um alle Dinge, die rund um die Pfarrkirche und das
Pfarrheim anfallen. Bei Wind und Wetter begleitet er die
Geistlichen zu Gottesdiensten und Beerdigungen in die
Filialgemeinden Kleinottweiler und Niederbexbach. „Wie sehr Sie in
der Pfarrei geschätzt werden, erkennt man daran, dass Messdiener
und Sternsinger Sie liebevoll ‚Vater Ebersold‘ nennen“, sagte der
Bischof. Daneben übernimmt Karl-Heinz Ebersold viele andere
Aufgaben, ist Mitglied im Liturgie- und Organisationsausschuss und
in der Männerschola sowie Boten-Verantwortlicher für den
Gemeindebrief. Lange Jahre war er Mitglied im Pfarrgemeinderat St.
Martin.
Auch Ute Dingenouts aus Maxdorf (Pfarrei
Hl. Antonius von Padua, Maxdorf) bringt sich seit vielen
Jahrzehnten aktiv in der Pfarrei ein. Seit 40 Jahren ist sie in der
Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (KFD) Maxdorf engagiert
und mit einer kurzen Unterbrechung seit 1979 deren Leiterin. Sie
stellt regelmäßige KFD-Treffs auf die Beine und Spielenachmittage,
Einkehrtage, religiöse Freizeiten, Literaturnachmittage, Vorträge
und meditative Tanzabende. Die 76-Jährige unterstützte stark den
Aufbau der Seniorenarbeit in der Pfarrei. Sie übernimmt
Krankenbesuche, Kommunion- und Firmvorbereitungen und pflegt eine
jahrelange Patenschaft für psychisch Kranke. „Besonders hervorheben
möchte ich auch Ihren aktuell wichtigen Einsatz für Flüchtlinge in
der Pfarrei“, betonte Bischof Wiesemann anlässlich der Verleihung
der Pirminius-Plakette.
Gertrud Engelbreit aus Frankenthal (Pfarrei St.
Dreifaltigkeit, Frankenthal) war mehr als 55 Jahre lang
Kirchenrechnerin. „Für diese wichtige Aufgabe benötigt man eine
verlässliche, engagierte und gut mit Zahlen umzugehen verstehende
Person“, erklärte Wiesemann. „Die Pfarrei Hl. Dreifaltigkeit hatte
in Ihnen eine solche Person gefunden.“ Der Bischof lobte Gertrud
Engelbreits große Gründlichkeit, Zuverlässigkeit und Hingabe für
diese Aufgabe. In ihrer Position als Kirchenrechnerin war die heute
91-Jährige unter anderem für den Bau der Frankenthaler Kirche St.
Paul im Jahr 1967 mitverantwortlich. Die Vorderpfälzerin wachte
zudem als Kassenwartin über die Finanzen der Kolpingfamilie.
.jpg) Auf
Vorschlag des Bischofs wurde Franz Leidecker
aus Kaiserslautern mit der Pirminius-Plakette
geehrt für „ein Engagement in einem besonders wichtigen, aber auch
schmerzlichen Bereich des kirchlichen Lebens“, wie Wiesemann
erklärte. Bis Ende September hatte Leidecker das Amt des
Missbrauchsbeauftragten des Bistums Speyer ausgeübt. Am 1. Oktober
hat Ansgar Schreiner, Direktor des Amtsgerichts Ludwigshafen, diese
Aufgabe übernommen. Franz Leidecker war bis 2011 als leitender
Kriminaldirektor und stellvertretender Polizeipräsident des
Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen tätig. Vor sechs
Jahren hatte er der Diözese seinen Dienst angeboten und sich
bereiterklärt, als Ansprechpartner bei Fällen von sexuellem
Missbrauch zur Verfügung zu stehen – zu jener Zeit, als die
kirchlichen Missbrauchsfälle fast täglich in den Medien
thematisiert wurden. Tag und Nacht sei Leidecker telefonisch
erreichbar gewesen. Der Bischof bescheinigte Leidecker
Verantwortungsbewusstsein und Diskretion, großen juristischen
Sachverstand und ein starkes Maß an Einfühlungsvermögen. „Ihre
unabhängige Stellung, aber auch Ihre souveräne Art haben Sie für
alle Seiten zu einem vertrauenswürdigen Ansprechpartner gemacht.
Wir schulden Ihnen Dank.“, würdigte Bischof Wiesemann die
Verdienste Leideckers.“Ihrer Einschätzung der Situation und Ihren
Vorschlägen zur finanziellen Anerkennung des Leids, die Sie auf
Grund der genauen Kenntnis der Situation abgegeben haben, konnten
wir als Diözese ohne Einschränkung folgen.“
Auf
Vorschlag des Bischofs wurde Franz Leidecker
aus Kaiserslautern mit der Pirminius-Plakette
geehrt für „ein Engagement in einem besonders wichtigen, aber auch
schmerzlichen Bereich des kirchlichen Lebens“, wie Wiesemann
erklärte. Bis Ende September hatte Leidecker das Amt des
Missbrauchsbeauftragten des Bistums Speyer ausgeübt. Am 1. Oktober
hat Ansgar Schreiner, Direktor des Amtsgerichts Ludwigshafen, diese
Aufgabe übernommen. Franz Leidecker war bis 2011 als leitender
Kriminaldirektor und stellvertretender Polizeipräsident des
Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen tätig. Vor sechs
Jahren hatte er der Diözese seinen Dienst angeboten und sich
bereiterklärt, als Ansprechpartner bei Fällen von sexuellem
Missbrauch zur Verfügung zu stehen – zu jener Zeit, als die
kirchlichen Missbrauchsfälle fast täglich in den Medien
thematisiert wurden. Tag und Nacht sei Leidecker telefonisch
erreichbar gewesen. Der Bischof bescheinigte Leidecker
Verantwortungsbewusstsein und Diskretion, großen juristischen
Sachverstand und ein starkes Maß an Einfühlungsvermögen. „Ihre
unabhängige Stellung, aber auch Ihre souveräne Art haben Sie für
alle Seiten zu einem vertrauenswürdigen Ansprechpartner gemacht.
Wir schulden Ihnen Dank.“, würdigte Bischof Wiesemann die
Verdienste Leideckers.“Ihrer Einschätzung der Situation und Ihren
Vorschlägen zur finanziellen Anerkennung des Leids, die Sie auf
Grund der genauen Kenntnis der Situation abgegeben haben, konnten
wir als Diözese ohne Einschränkung folgen.“
Text und Fotos: Yvette Wagner
03.10.2016
Stabwechsel im Amt des Missbrauchsbeauftragten
 v.l.: Sybille Jatzko, Franz Leidecker, Generalvikar Dr. Franz Jung und den neuen Missbrauchsbeauftragten Ansgar Schreiner bei der "Amtsübergabe"
v.l.: Sybille Jatzko, Franz Leidecker, Generalvikar Dr. Franz Jung und den neuen Missbrauchsbeauftragten Ansgar Schreiner bei der "Amtsübergabe"
Franz Leidecker übergibt Aufgabe an Ansgar Schreiner aus
Limburgerhof – Auch Sybille Jatzko beendet Tätigkeit, Nachfolgerin
wird aktuell gesucht
Speyer- Das Amt des
Missbrauchsbeauftragten des Bistums Speyer geht in neue Hände über.
Zum 1. Oktober gibt der bisherige Missbrauchsbeauftragte Franz
Leidecker aus Kaiserslautern die Aufgabe an Ansgar Schreiner aus
Limburgerhof weiter. Auch Sybille Jatzko, seit 2013 zweite
Missbrauchsbeauftragte des Bistums Speyer, beendet ihre Tätigkeit.
Das Bistum Speyer sucht für sie aktuell eine Nachfolgerin.
Franz Leidecker, der bis zum Jahr 2011 als leitender
Kriminaldirektor und stellvertretender Polizeipräsident des
Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen tätig war, hat das Amt
des Missbrauchsbeauftragten im Jahr 2010 übernommen. „Wir sind
Herrn Leidecker für die kompetente Art und Weise, wie er diese
verantwortungsvolle Aufgabe in den letzten Jahren ausgeübt hat,
sehr dankbar“, würdigte Generalvikar Dr. Franz Jung seinen Einsatz.
Sein Nachfolger wird Ansgar Schreiner, Direktor des Amtsgerichts
Ludwigshafen. Er wohnt in Limburgerhof und ist dort auch kirchlich
engagiert, zum Beispiel als Organist bei den Gottesdiensten.
Generalvikar Jung überreichte ihm am Freitag offiziell die
Ernennungsurkunde von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
 Sybille
Jatzko, Psychotherapeutin aus Krickenbach bei Kaiserslautern mit
langjährigen Erfahrungen in der Begleitung traumatisierter
Betroffener, hatte die Aufgabe als zweite Ansprechpartnerin für
Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger im Bistum
Speyer im Oktober 2013 übernommen. „Sybille Jatzko hat sich mit
viel Erfahrung und Herzblut eingebracht“, dankte Generalvikar Jung
auch ihr. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte in der
überarbeiteten Fassung der Leitlinien zum Umgang mit sexuellem
Missbrauch 2013 festgelegt, dass in einer Diözese mindestens zwei
Ansprechpartner für Missbrauchsopfer und wenn möglich eine Frau und
ein Mann benannt werden sollen. Sie stehen Hilfesuchenden in allen
Fällen sexuellen Missbrauchs zur Verfügung.
Sybille
Jatzko, Psychotherapeutin aus Krickenbach bei Kaiserslautern mit
langjährigen Erfahrungen in der Begleitung traumatisierter
Betroffener, hatte die Aufgabe als zweite Ansprechpartnerin für
Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger im Bistum
Speyer im Oktober 2013 übernommen. „Sybille Jatzko hat sich mit
viel Erfahrung und Herzblut eingebracht“, dankte Generalvikar Jung
auch ihr. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte in der
überarbeiteten Fassung der Leitlinien zum Umgang mit sexuellem
Missbrauch 2013 festgelegt, dass in einer Diözese mindestens zwei
Ansprechpartner für Missbrauchsopfer und wenn möglich eine Frau und
ein Mann benannt werden sollen. Sie stehen Hilfesuchenden in allen
Fällen sexuellen Missbrauchs zur Verfügung.
Durch eigene Nachforschungen oder Anzeigen von außen wurden seit
der Einführung der Leitlinien der Deutschen Bischofskonferenz im
Jahr 2010 insgesamt 63 Verdachtsfälle im Bistum Speyer untersucht.
Auch wenn nicht alle Fälle aufgeklärt werden konnten - häufig waren
die Beschuldigten bereits verstorben - so hat das Bistum Speyer
dennoch in 31 Fällen finanzielle Leistungen in Anerkennung des
Leids der Betroffenen übernommen. Die Summe der Leistungen beträgt
229.000 Euro. In drei Fällen wurden Tatverdächtige strafrechtlich
verurteilt. Vier weitere Verfahren sind bei der Staatsanwaltschaft
anhängig, die meisten Fälle sind jedoch strafrechtlich verjährt.
Seit dem Jahr 2010 wurden neun Verdachtsfälle angezeigt, aktuell
werden zwei Fälle untersucht.
Seit dem Jahr 2011 überprüft das Bistum Speyer die
Führungszeugnisse von allen hauptamtlichen Mitarbeitern und seit
dem Jahr 2014 auch von ehrenamtlichen Mitarbeitern, die im Feld der
Kinder- und Jugendhilfe tätig sind. Das Bistum hat sich vor sechs
Jahren eine Präventionsordnung geben und einen
Präventionsbeauftragten eingesetzt. Alle Mitarbeiter in der
Seelsorge und alle Lehrkräfte katholischer Schulen haben seitdem an
Schulungen zur Prävention von sexuellem Missbrauch teilgenommen.
Darüber hinaus wurden 15 Lehrerinnen und Lehrer an katholischen
Schulen zu Fachkräften für Präventionsmaßnahmen ausgebildet. Für
die Jugendarbeit hat der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
einen eigenen Verhaltenskodex ausgearbeitet und eigene Broschüren
und Arbeitsmaterialien veröffentlicht.
Weitere Informationen zum Thema Hilfe bei sexuellem
Missbrauch:
http://www.bistum-speyer.de/2/rat-und-hilfe/hilfe-bei-sexuellem-missbrauch/
Weitere Informationen zum Thema Prävention:
http://www.bistum-speyer.de/2/rat-und-hilfe/praevention-von-sexuellem-missbrauch/
Text und Foto: is
01.10.2016
Interreligiöses Gebet als Zeichen gegenseitigen Respekts
 Vier Religionen und fünf christliche Konfessionen beteten- jeder in der seiner Religion entsprechenden Weise – um Frieden und Gewaltlosigkeit und für eine respektvolle Aufnahme von geflüchteten Menschen.
Vier Religionen und fünf christliche Konfessionen beteten- jeder in der seiner Religion entsprechenden Weise – um Frieden und Gewaltlosigkeit und für eine respektvolle Aufnahme von geflüchteten Menschen.
Gemeinsame Feier zum Tag des Flüchtlings
Ludwigshafen- (is). Rund 150 Menschen fanden
sich am Vorabend des Internationalen Tages des Flüchtlings
innerhalb der Interkulturellen Woche vor dem Rathauscenter zu einer
multireligiösen Gebetsfeier ein. Dekan Alban Meißner und Dekanin
Barbara Kohlstruck erinnerten zu Beginn der Feier daran, dass die
Religionen nicht Ursache für Krieg, Unfrieden und Probleme sind,
sondern deren Lösung, da alle Religionen für den Frieden
stehen.
Es wurde eine eindrucksvolle Feier, zu der vier Religionen und
fünf christliche Konfessionen beitrugen. Musikalisch umrahmt wurde
sie von der Kaiserslauterner Musikgruppe Shaian, die seit März
zusammen Musik macht und in sich ebenfalls verschiedene Kulturen,
Religionen und auch Musikstile vereint.
Mit einem Schriftwort und einen Bekenntnisgebet eröffneten
Kirchenpräsident Christian Schad und Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann die Gebetsfeier. Von  christlicher Seite schlossen sich ein Friedensgebet, ein
Lobpreis und ein Bittgebet an. Vertreter der eritreisch-orthodoxen
sowie der griechisch-orthodoxen Gemeinde sprachen ihre Gebete auch
in ihrer Heimatsprache. Desgleichen bestand der
sunnitisch-muslimische Beitrag aus einer Koranrezitation, die auf
deutsch und arabisch vorgetragen wurde, ebenso wie der
buddhistische Beitrag in deutsch und sanskrit gehalten wurde. Auch
die alevitische Gemeinde war mit einem Gebet vertreten.
christlicher Seite schlossen sich ein Friedensgebet, ein
Lobpreis und ein Bittgebet an. Vertreter der eritreisch-orthodoxen
sowie der griechisch-orthodoxen Gemeinde sprachen ihre Gebete auch
in ihrer Heimatsprache. Desgleichen bestand der
sunnitisch-muslimische Beitrag aus einer Koranrezitation, die auf
deutsch und arabisch vorgetragen wurde, ebenso wie der
buddhistische Beitrag in deutsch und sanskrit gehalten wurde. Auch
die alevitische Gemeinde war mit einem Gebet vertreten.
Zum Ende der Gebetsfeier baten Dekanin Kohlstruck und Dekan
Meißner die Teilnehmer, den Friedensgruß zu tauschen – durch einen
Händedruck, eine Umarmung oder ein freundliches Lächeln. Auch damit
wurde die Veranstaltung zu einem deutlichen Zeichen des
gegenseitigen Respekts. Viele Teilnehmer blieben im Anschluss noch
zum Austausch beieinander.
Text: Brigitte Deiters/Fotos: Horst Heib
30.09.2016
Sabine Eichhorn-Krämer zur neuen Vorsitzenden gewählt
 Führungswechsel bei der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen des Bistums Speyer
Führungswechsel bei der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen des Bistums Speyer
Speyer- Die Diözesane Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen (DiAG-MAV) des Bistums Speyer wählte in
ihrer Mitgliederversammlung am 22.September 2016 in Kirkel Sabine
Eichhorn –Krämer zur neuen Vorsitzenden der Diözesanen
Arbeitsgemeinschaft der MAV (DiAG-MAV).
Der bisherige, langjährige Vorsitzende Wolfgang Schmidt wurde
zum neuen Stellvertreter gewählt.
Die Mitarbeitervertretungen haben in kirchlichen Einrichtungen
die Aufgaben, die denen eines Betriebs- oder Personalrats
entsprechen.
Alle 134 Mitarbeitervertretungen des Bistums schließen sich in
der DiAG-MAV zusammen.
Diese berät ihre Mitglieder in allen Angelegenheiten des
Arbeitsrechts und vertritt die Interessen der ca. 15.000
Beschäftigten gegenüber der Bistumsleitung.
Text und Foto: Bistum Speyer, Presse
24.09.2016
Gerechtigkeit als gesellschaftliche Herausforderung
 Die Vertreterinnen und Vertreter von Frauen- und Gleichstellungsreferaten in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland tagen zurzeit in Speyer. Links im Bild Kirchenpräsident Christian Schad, daneben die Gleichstellungsbeauftragte der pfälzischen Landeskirche, Pfarrerin Belinda Spitz-Jöst.
Die Vertreterinnen und Vertreter von Frauen- und Gleichstellungsreferaten in den Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland tagen zurzeit in Speyer. Links im Bild Kirchenpräsident Christian Schad, daneben die Gleichstellungsbeauftragte der pfälzischen Landeskirche, Pfarrerin Belinda Spitz-Jöst.
Vertreterinnen evangelischer Gleichstellungsstellen
tagen in Speyer
Speyer- (lk). Welche Bedeutung hat die
evangelische Gleichstellungsarbeit für Kirche und Gesellschaft? Wie
muss sie auf gesellschaftliche, politische und persönliche
Herausforderungen von Frauen und Männern reagieren, die sich auch
innerhalb der Kirche in Haupt-, Ehren- und Nebenamt stellen? Mit
diesen und weiteren Fragen befassen sich die Vertreterinnen von
Frauen- und Gleichstellungsreferaten in den Gliedkirchen der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) bei ihrer in Speyer
stattfindenden Konferenz. Zur Eröffnung der Tagung am Montag im
Landeskirchenrat unterstrich die Gleichstellungsbeauftragte der
Evangelischen Kirche der Pfalz, Pfarrerin Belinda Spitz-Jöst, dass
die Arbeit der Beauftragten für Geschlechter- und
Chancengerechtigkeit in der Mitte der Kirche angekommen sei.
Vielfältige Projekte unterstützten diese vor Ort ebenso wie auf den
unterschiedlichen Ebenen der Kirchenleitungsgremien, sagte
Spitz-Jöst.
„Uns geht es darum, Strukturen zu entwickeln, die den
Lebenswirklichkeiten von Männern und Frauen entsprechen und ihnen
ein angemessenes Feld für Engagement eröffnen“, so Spitz-Jöst zu
den Zielen der Konferenz. An den pfälzischen Kirchenpräsidenten
Christian Schad, der auch Vorsitzender der Vollkonferenz der Union
Evangelischer Kirchen in der Evangelischen Kirche in Deutschland
(UEK) ist, richteten die rund zwanzig Tagungsteilnehmerinnen die
Erwartung, dass Geschlechtergerechtigkeit und Gleichstellung auf
allen kirchlichen Ebenen selbstverständlich sein müssen.
Kirchenpräsident Christian Schad verwies auf die Bündelung der
Aufgaben von Gleichstellungs- und Familienfragen in einem Referat
der Kirchenleitung. Damit gerieten Chancengleichheit und
Gleichstellung beider Geschlechter, die Vereinbarkeit von Berufs-
und Privatleben sowie die Stärkung und Unterstützung der Familien
besser in den Blick. Dies gelte zum Beispiel für die mittlere
Altersgruppe der Ende 20- bis Mitte 40-Jährigen, die sich in der
„rush hour des Lebens“ den Herausforderungen von Berufseinstieg und
Karriere ebenso stellen müssten wie der Erziehung der Kinder und
der Betreuung pflegebedürftiger Eltern. Die Aufgaben dürften nicht
zu Lasten eines Partners in einer Ehe oder Lebenspartnerschaft
gehen, erklärte Schad.
Thematische Schwerpunkte der Konferenz sind u.a. die
Aufarbeitung der Geschichte der Frauenordination, die sich erst
seit 1992 in allen Landeskirchen durchgesetzt hat, sowie die
Analyse des Verhältnisses von Männern und Frauen in
Leitungspositionen der evangelischen Kirche. Zudem geht es um die
Vorbereitung einer Tagung am 5. Dezember 2016 in Hamburg, die sich
mit „Besorgnis erregenden Entwicklungen“ zum Thema
Geschlechtergerechtigkeit beschäftigt. „Erschreckend“ sind aus
Sicht der EKD-Gleichstellungsbeauftragten vor allem die Zunahme von
Diffamierungen und der Ton im Netz.
Fragen zur Gleichstellung werden auch im Reformationsjahr 2017
der Evangelischen Kirche in Deutschland thematisiert. So ist u.a.
eine Themenwoche „Familie, Lebensformen und Gender“ vom 9. bis 14.
August in Wittenberg unter der Verantwortung der Frauen- und
Männerarbeit der EKD geplant. Die Konferenz steuere hierzu unter
dem Titel „g-code“ abrufbare Hörbeiträge zum Thema Gerechtigkeit
und Gleichstellung bei, erklärt Spitz-Jöst.
Die „Konferenz der Arbeitsgemeinschaft der Frauenreferate und
Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD“ gibt es seit
1992. Sie dient dem Erfahrungs- und Informationsaustausch sowie der
gemeinsamen Bearbeitung von Problemen, mit denen alle Frauen- und
Genderreferate gleichermaßen konfrontiert sind. Die
Geschäftsführung für die Konferenz liegt im Referat für
Chancengerechtigkeit der EKD.
Hinweis: Die Konferenz der Arbeitsgemeinschaft der
Frauenreferate/Gleichstellungsstellen in den Gliedkirchen der EKD
findet vom 19. bis 21 September im Landeskirchenrat in Speyer,
Domplatz 5, statt. Ansprechpartnerin ist die
Gleichstellungsbeauftragte der Landeskirche, Pfarrerin Belinda
Spitz-Jöst, Telefon 06232/667-242, E-Mail: belinda.spitz-joest@landeskirchenrat.evkirchepfalz.de.
Mehr zum Thema: www.ekd.de/chancengerechtigkeit.
20.09.2016
Wie Habakuk seine Schafe per WhatsApp hütet
 Neue Adventsaktion
für Kindertagesstätten, Pfarreien und Familien im Bistum
Speyer
Neue Adventsaktion
für Kindertagesstätten, Pfarreien und Familien im Bistum
Speyer
Speyer- (is). Habakuk ist ein alter
Hirte aus Bethlehem, der immer dann gefragt ist, wenn ein Schaf
krank, verloren, fremd oder ängstlich ist. Seine Geschichten sind
der Rahmen für eine neue Adventsaktion im Bistum Speyer. Die
Abteilung Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen lädt
Kindertagesstätten, Familien, Gemeinden dazu ein, sich mit Habakuk
durch den Advent führen zu lassen und diese Zeit bis zum
Weihnachtsfest ganz besonders zu gestalten.
Auf der Internetseite www.aktionsseite-kita.de
sind dazu ab sofort Geschichten, Lieder, Gottesdienstvorschläge,
Videos und viele Ideen zur Gestaltung der Advents- und
Weihnachtszeit zu finden. Das Besondere: Wer möchte, kann sich die
Geschichten von Habakuk und seinen Schafe, Impulse und Ideen dazu
auch per WhatsApp direkt auf sein Smartphone schicken lassen. Die
Anmeldung dazu läuft über die Aktionsseite.
„Wir möchten damit Eltern, Großeltern und allen Interessierten die
Möglichkeit geben, ganz unkompliziert mit zu verfolgen, was Habakuk
in seinem Stall erlebt. Es soll einen Anstoß dazu geben, gemeinsam
mit Kindern, Enkeln, ins Gespräch zu kommen und so die Adventszeit
besonders zu gestalten“, erklärt Herbert Adam, Referent für
Seelsorge in Kindertagesstätten. Kooperationspartner bei der Aktion
ist die Netzgemeinde Da_Zwischen in der Diözese Speyer, die auf
Facebook, Instagram, Twitter präsent ist und jede Woche regelmäßig
spirituelle Impulse über WhatsApp an ihre Mitglieder
verschickt.
Weitere Informationen:
www.aktionsseite-kita.de
17.09.2016
Medienzentrale Bistum Speyer mit neuem Angebot online
 Speyer- Der Medienverleih des Bistums Speyer wurde in
den vergangenen Monaten neu organisiert, um Synergien mit den
Angeboten von AVMZ und medien.rlp im gemeinsamen Medienverleih
Mainz optimal zu nutzen. Ab sofort steht das umfangreiche
Serviceangebot der Medienzentrale Speyer (MZSP) unter www.medienzentrale-speyer.de allen Interessenten im
gesamten Bistum Speyer zur Verfügung. Auf der Homepage können
Sie den Newsletter abonnieren, der jeweils über neue Angebote von
aktuellen Kinderfilmen und didaktischen DVDs für die Schule und
Spiel- und Dokumentarfilmen für Erwachsenenbildung und Katechese
informiert.
Speyer- Der Medienverleih des Bistums Speyer wurde in
den vergangenen Monaten neu organisiert, um Synergien mit den
Angeboten von AVMZ und medien.rlp im gemeinsamen Medienverleih
Mainz optimal zu nutzen. Ab sofort steht das umfangreiche
Serviceangebot der Medienzentrale Speyer (MZSP) unter www.medienzentrale-speyer.de allen Interessenten im
gesamten Bistum Speyer zur Verfügung. Auf der Homepage können
Sie den Newsletter abonnieren, der jeweils über neue Angebote von
aktuellen Kinderfilmen und didaktischen DVDs für die Schule und
Spiel- und Dokumentarfilmen für Erwachsenenbildung und Katechese
informiert.
Die MZSP stellt eigene Medien im Verleih bereit, nutzt die
Gemeinschaftsangebote der AVMZ, ergänzt die Angebote der
Religionspädagogischen Arbeitsstellen und vermittelt Medien von
Partnereinrichtungen im außerkirchlichen Bereich. Sie trägt damit
zur Vernetzung aller verfügbaren Angebote an didaktischen AV-Medien
für Nutzer im Bistum Speyer bei.
Auf der Homepage www.medienzentrale-speyer.de können Sie sich
über das Verleihangebot der Medienzentrale Speyer und ihrer
Verleihpartner AVMZ und medien.rlp - Institut für Medien und
Pädagogik e.V. informieren und in der gemeinsamen Datenbank gezielt
nach Titeln suchen. Medien-Bestellungen sind direkt über den
Online-Katalog oder telefonisch beim zentralen Verleih in Mainz
möglich (06131 28788-20, -21 und -22). Unter diesen Nummern beraten
wir Sie auch gerne bei allen Fragen zu unserem Verleih und zur
nichtgewerblichen Medienarbeit. Sollte ein von Ihnen gesuchter Film
nicht in unserem Verleihangebot vorhanden sein, recherchieren wir
für Sie gerne die Möglichkeiten, den gewünschten Titel in der
schulischen oder außerschulischen Bildungsarbeit, im Bereich der
Katechese oder der Erwachsenenbildung einsetzen zu können.
Neben dem DVD-Verleih steht Nutzern aus dem Bistum Speyer eine
große Auswahl an Online-Medien im Medienportal der AVMZ zur
Verfügung. Diese sind mit den erforderlichen Rechten für die
Vorführung in der Bildungsarbeit ausgestattet und können mit
wenigen Klicks aus dem Medienportal auf Ihren Rechner
heruntergeladen werden. Einen entsprechenden Link finden Sie auf
der Website der Medienzentrale Speyer.
Text: Bistum Speyer, Presse
16.09.2016
Florian Gärtner wird neuer Pfarrer für Weltmission und Ökumene
 Partnerschaftsarbeit und interkulturelle Vernetzung im
Blick – Nachfolger von Marianne Wagner
Partnerschaftsarbeit und interkulturelle Vernetzung im
Blick – Nachfolger von Marianne Wagner
Speyer (lk). Florian Gärtner wird
neuer Pfarrer für Weltmission und Ökumene in der Evangelischen
Kirche der Pfalz. Das hat die Kirchenregierung am Mittwoch in
Speyer beschlossen. Der 40-Jährige ist seit 2011 Referent im
Missionarisch-Ökumenischen Dienst (MÖD) der Landeskirche und war
zuvor Pfarrer in der Protestantischen Kirchengemeinde Herxheim bei
Landau.
 Gärtner
wird Nachfolger von Marianne Wagner, die seit 1. September als
Oberkirchenrätin in Speyer tätig ist. Der in Grünstadt geborene
Gärtner hat in Heidelberg, Tübingen und Port Elisabeth (Südafrika)
Theologie studiert und ein Masterstudium „Management von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen“ absolviert. Er ist
verheiratet und hat drei Kinder.
Gärtner
wird Nachfolger von Marianne Wagner, die seit 1. September als
Oberkirchenrätin in Speyer tätig ist. Der in Grünstadt geborene
Gärtner hat in Heidelberg, Tübingen und Port Elisabeth (Südafrika)
Theologie studiert und ein Masterstudium „Management von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen“ absolviert. Er ist
verheiratet und hat drei Kinder.
Im MÖD der Evangelischen Kirche der Pfalz sind das Pfarramt für
Volksmission und das Pfarramt für Weltmission und Ökumene vereint.
Zum Arbeitsbereich Weltmission und Ökumene gehört die
Partnerschaftsarbeit mit den Kirchen in Bolivien, Ghana, Korea und
Papua. Innerhalb der Landeskirche sollen Kirchengemeinden und
Gruppen für die weltweite Dimension christlichen Glaubens
sensibilisiert und motiviert werden, sich gemeinsam mit anderen für
Gerechtigkeit, Frieden und die Bewahrung der Schöpfung einzusetzen.
Der Sitz des MÖD ist in Landau.
Foto: Privat
16.09.2016
Den christlichen Glauben kennenlernen
Kurs-Heft für Menschen anderer Sprache und Herkunft
erschienen
Speyer- „Christlicher Glaube im Gespräch“
– so lautet der Titel eines Glaubenskurses, der sich speziell an
Menschen wendet, die in den vergangenen Jahren aus arabisch- und
persischsprachigen Ländern in die
Bundesrepublik gekommen sind. Das hat der Beauftragte der
Evangelischen Kirche der Pfalz für Christen anderer Sprache und
Herkunft, Pfarrer Arne Dembek, in Speyer mitgeteilt. Das Kursheft
ist ab sofort erhältlich. Mit der Publikation sei man dem Wunsch
von Kirchengemeinden nachgekommen, die entsprechende Kursangebote
durchführen wollen.
Kirchengemeinden und viele ehrenamtlich Tätige engagieren sich
nach Auskunft von Dembek in der Betreuung und Begleitung von
Flüchtlingen. Dabei erlebten sie, dass viele der Flüchtlinge
Kontakt zu Kirchengemeinden finden, den Gottesdienst besuchen oder
die Taufe erbitten. „Der Glaubenskurs will helfen, gemeinsam mit
Menschen aus dem arabisch-persischen Sprachraum den christlichen
Glauben kennenzulernen“, sagt Dembek.
Ziel des Glaubenskurses sei es, „Menschen aus anderen
Kulturkreisen, die sich für unseren Glauben interessieren,
verständliche und verlässliche Informationen zu geben“, sagt der
pfälzische Beauftragte, der den Kurs im Auftrag der Landeskirche
gemeinsam mit der Evangelischen Kirche in Baden entwickelt hat. „Es
geht nicht darum, Angehörige anderer Religionen zu missionieren,
sondern darum, Zeugnis für unseren Glauben zu geben, wenn wir
danach gefragt werden“, so Dembek.
Der Kurs umfasst neun Einheiten wie zum Beispiel „Christen in
Deutschland“, „Jesus – sein Leben und seine Botschaft“, „Der
Gottesdienst“ und besteht aus einem gedruckten Teilnehmer-Heft
(Deutsch-Englisch-Arabisch und Deutsch-Englisch-Persisch) und einer
Homepage mit Kurseinheiten und zusätzlichem Material, das unter
www.interkulturellerglaubenskurs.de
zu finden ist. Die Druckversion ist ab sofort im E-Shop (http://shop.ekiba.de) der badischen
Landeskirche erhältlich und kostet pro Stück 4 Euro (52 Seiten,
dreisprachig). Staffelpreise werden für größere Bestellungen
angeboten. lk
15.09.2016
Die Reformation begreifbar machen
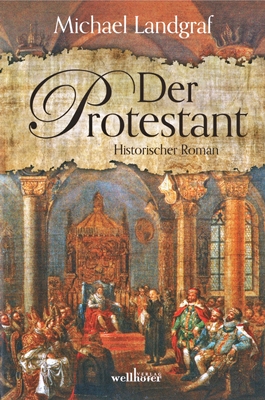 Historischer Roman von Michael Landgraf spielt vor allem
in der Pfalz
Historischer Roman von Michael Landgraf spielt vor allem
in der Pfalz
Neustadt/Speyer- Der neue Roman „Der
Protestant“ des Neustadter Autors Michael Landgraf beleuchtet die
Zeit der Reformation in den Jahren 1500 bis 1529. Auf 420 Seiten
beschreibt das Buch die Ereignisse vor allem im süddeutschen Raum,
aber auch in der Schweiz und im Elsass und ist ein
schriftstellerischer Beitrag zum bevorstehenden
Reformationsjubiläum 2017.
Michael Landgraf legt die gesellschaftlichen Entwicklungen zu
Beginn des 16. Jahrhunderts dar, die überhaupt erst zur Reformation
führen konnten. Durch die Bezüge zum Reichstag in Worms (1521), zu
der Person des Franz von Sickingen und der Burg Nanstein in
Landstuhl sowie der Protestation in Speyer (1529) setzt der
historische Roman mehrere lokale Akzente in der Pfalz und
angrenzenden Regionen.
Der fiktive Protagonist Jakob Ziegler, ein Lateinschüler aus
Neustadt an der Weinstraße, führt den Leser durch das Buch. Durch
Zieglers Reisen und Begegnungen mit Humanisten, Priestern, aber
auch mit Martin Luther und Philipp Melanchthon macht der Autor die
Reformation begreifbar und schlüsselt zentrale Begriffe des
Christentums dieser Zeit auf.
Der Schriftsteller und Theologe Michael Landgraf stammt aus
Ludwigshafen und lebt in Neustadt an der Weinstraße. Der Leiter des
dortigen Religionspädagogischen Zentrums ist Vorsitzender des
Verbandes deutscher Schriftsteller Rheinland-Pfalz und hat bereits
mehrere religionspädagogische Bücher zur Reformation
veröffentlicht.
Hinweis: „Der Protestant“ ist im Wellhöfer Verlag
Mannheim erschienen und mit zahlreichen zeitgenössischen
Holzschnitten ausgestaltet. Das Taschenbuch ist zum Preis von 14,95
Euro im Buchhandel erhältlich. Text und Foto: lk
14.09.2016
Segnung der neuen Unterrichtsorgel
 Domkapitular Franz Vogelgesang bei der Segnung des Instruments.
Domkapitular Franz Vogelgesang bei der Segnung des Instruments.
Instrument wurde in Frankreich gebaut und ermöglicht die
Erarbeitung von einem Großteil der Orgelliteratur – Feierstunde des
Bischöflichen Kirchenmusikalischen Instituts mit Domkapitular Franz
Vogelgesang
Speyer- Im Rahmen einer kleinen Feier
wurde die neue Unterrichtsorgel im Bischöflichen
Kirchenmusikalischen Institut gesegnet. „Wir sind als Menschen
gerufen, in den Lobpreis Gottes einzustimmen. Die Musik gehört zu
der Weise, wie wir Gottes Liebe empfangen und weitergeben“, betonte
Domkapitular Franz Vogelgesang, der die Segnung des Instruments
vollzog.
„Bei einer Orgelweihe wird nicht das Instrument gesegnet, also
nicht die Pfeifen, die Tasten und das Holz, sondern die Menschen,
die daran üben, um mit dem Orgelspiel in den Gottesdiensten dem
großen Ganzen des Volkes Gottes zu dienen“, machte Vogelgesang
deutlich. Ein guter Gottesdienst müsse so gestaltet sein, dass bei
den Menschen etwas in Schwingung kommt. „Die Musik soll die
Menschen anrühren und den festlichen Charakter des Gottesdienstes
unterstreichen.“ Die Dommusik und die Kirchenmusik des Bistums
gingen im Haus der Kirchenmusik im Speyerer Hasenpfuhl eine gute
Verbindung ein. „In diesem Haus tönt beinahe aus jeder Ritze
Musik“, brachte er seine Freude über das neue Instrument zum
Ausdruck. Diözesankirchenmusikdirektor Markus Eichenlaub und die
Dozenten des Bischöflichen Kirchenmusikalischen Instituts ließen
zur Segensfeier im Haus der Kirchenmusik verschiedene Orgelwerke
erklingen.
Die neue Unterrichtsorgel wurde von der Orgelbau-Werkstatt
Koenig aus Sarre-Union im nördlichen Elsass erbaut. Yves Koenig
führt den durch seinen Vater im Jahr 1945 gegründeten Betrieb in
zweiter Generation. Die Orgelbau-Werkstatt Koenig verwirklicht
Neubauten, von der Hausorgel bis zur Kirchen- und Konzertorgel, und
führt Restaurierungen durch.
Das Instrument hat 17 Register auf drei Manualen und Pedal und
ermöglicht so die Erarbeitung und Darstellung von einem Großteil
der Orgelliteratur. Die Orgel dient dem Unterricht,
Schülervorspielen und Prüfungen. Sie ist mit ihrem geschmackvollen,
schlichten Äußeren, das von einem Acht-Fuß-Zinn-Prospekt und einem
Gehäuse aus Roteiche bestimmt wird, das Schmuckstück im nüchternen
Unterrichtsraum.
Die Anschaffung war möglich, da am vorherigen Standort des
Bischöflichen Kirchenmusikalischen Instituts in der Oberen
Langgasse vier Orgeln verkauft wurden, die allesamt
überarbeitsbedürftig waren, darunter drei kleine Übeorgeln. Die
bisherige Konzertorgel der Werkstatt Beckerath (Baujahr 1980) mit
35 Registern war zu groß für den Umzug in das neue Gebäude und
musste ebenfalls verkauft werden. Sie steht jetzt in einer
katholischen Kirche in Manderscheid in der Eifel. In den neuen
Räumen im Haus der Kirchenmusik stehen anstatt vier nun nur noch
zwei Unterrichtsorgeln. Ein gebrauchtes kleineres Instrument konnte
letztes Jahr aufgestellt werden. Text und Foto: is
08.09.2016
Pfarrer müssen keine Einzelkämpfer sein
 v.l.: Pfarrer Thomas Jakubowski, Oberkirchenrätin Mariann Wagner, die Vikarinnen und Vikare Hildrun Mittelstädt, Katharina Küttner, Vera Ettinger, Jasmin Coenen, Simon Krug, Marcel Spitz, Lorenzo Cassolla sowie Kirchenpräsident Christian Schad. Nicht auf dem Foto ist Francesca Brand.
v.l.: Pfarrer Thomas Jakubowski, Oberkirchenrätin Mariann Wagner, die Vikarinnen und Vikare Hildrun Mittelstädt, Katharina Küttner, Vera Ettinger, Jasmin Coenen, Simon Krug, Marcel Spitz, Lorenzo Cassolla sowie Kirchenpräsident Christian Schad. Nicht auf dem Foto ist Francesca Brand.
Oberkirchenrätin Marianne Wagner überreicht neuen
Vikaren die Ernennungsurkunden
Speyer- Acht Theologinnen und Theologen
bereiten sich ab Ende September auf den Pfarrdienst in der
Evangelischen Kirche der Pfalz vor. Oberkirchenrätin Marianne
Wagner hat den Vikaren am Mittwoch im Landeskirchenrat in Speyer
die Ernennungsurkunden überreicht. „Wir haben etwas gemeinsam: Für
uns beginnt ein neuer Dienst, ein neuer Lebensabschnitt. Schön,
dass Sie sich darauf einlassen“, sagte Wagner, die seit 1.
September die neue Personaldezernentin der pfälzischen Landeskirche
ist. Den künftigen Pfarrerinnen und Pfarrern legte sie ans Herz,
den Menschen in ihrer neuen Umgebung mit Offenheit zu begegnen, mit
ihnen Stärken, aber auch Schwächen zu teilen. Pfarrer müssten keine
„Einzelkämpfer“ sein, betonte Wagner. Vielmehr sei es wichtig,
„nicht nur auf sich selbst zu schauen“ und sich einem falschen
Leistungsdruck entziehen zu können.
„Sie sind uns ein reicher und willkommener Schatz“, machte
Kirchenpräsident Christian Schad den Vikaren Mut, im gegenseitigen
Austausch und im Dialog mit Gott Geborgenheit und Halt zu finden.
Dabei seien die Bibel und das Gebet „die Quelle, aus der wir Kraft
schöpfen können“. Anfechtungen und Zweifel, so Schad weiter,
gehörten zum Glauben hinzu: „Sich ihnen zu stellen, hat mit
Ehrlichkeit sich selbst und Gott gegenüber zu tun“, sagte der
Kirchenpräsident und bestätigte damit die Vikare auf ihrem Weg, zu
glaubhaften Zeugen der Christusbotschaft in Kirche und Gesellschaft
zu werden. Der Kirchenpräsident freute sich über den „relativ
großen Kurs“, mit dem er auch in Zukunft das Gespräch und den
gegenseitigen Austausch suchen werde. Er bezeichnete es als große
Chance, dass die Ausbildungszeit der neuen Vikarinnen und Vikare in
die Zeit des Reformationsjubiläums 2017 falle.
Am 26. September beginnt für Francesca Brand, Lorenzo Cassolla,
Jasmin Coenen, Vera Ettinger, Simon Krug, Katharina Küttner,
Hildrun Mittelstädt und Marcel Spitz die Ausbildung am
Protestantischen Predigerseminar in Landau. Im Rahmen ihrer
Ausbildung sammeln sie abwechselnd dort sowie durch Praxisphasen in
Schulen und Gemeinden Erfahrungen. Die Ausbildung gliedert sich in
die drei Abschnitte: Schul- und Gemeindepraktikum sowie ein
Spezialpraktikum, in dem sich die Vikare ein besonderes kirchliches
Handlungsfeld aussuchen können.
Die neuen Vikare werden nach ihrem Schulpraktikum im Sommer 2017
u.a. in den Kirchengemeinden Billigheim-Ingenheim (Kirchenbezirk
Bad Bergzabern), Böhl-Iggelheim (Kirchenbezirk Speyer), Germersheim
(Kirchenbezirk Germersheim), Heiligenmoschel (Kirchenbezirk An
Alsenz und Lauter), Kleinkarlbach (Kirchenbezirk Grünstadt),
Ludwigshafen-Gartenstadt (Kirchenbezirk Ludwigshafen) und
Schifferstadt (Kirchenbezirk Speyer) eingesetzt.
Das Vikariat stellt die Zeit zwischen dem Ersten Theologischen
Examen, also dem Studium – und der abschließenden Prüfung, dem
Zweiten Theologischen Examen, dar. Laut Predigerseminar soll das
Vikariat die Vikare auf die gestiegenen Anforderungen im
Pfarrberuf, aber auch auf die vielfältigen Handlungsfelder
kirchlicher Arbeit vorbereiten.
Im Sommer 2017 werden die Vikarinnen und Vikare in
folgenden Gemeinden eingesetzt: Lorenzo Cassolla: Böhl-Iggelheim;
Jasmin Coenen: Billigheim-Ingenheim; Vera Ettinger: Kleinkarlbach;
Simon Krug: Germersheim; Katharina Küttner: Heiligenmoschel;
Hildrun Mittelstädt: Schifferstadt; Marcel Spitz:
Ludwigshafen-Gartenstadt. Text und Foto: Evangelische
Landeskirche
07.09.2016
Ein Tag der Dankbarkeit
560 Paare feiern Ehejubiläum im Dom zu Speyer – Festlicher
Gottesdienst mit Weihbischof Otto Georgens
Speyer- Blick zurück und nach vorn: Rund
560 Paare waren am Sonntag zur Feier der Ehejubiläen in den Dom
gekommen. Sie erneuerten ihr Eheversprechen, dankten Gott für die
erlebten Ehejahre und baten den Herrn, weiterhin an ihrer Seite zu
stehen und. Im Anschluss an den Gottesdienst, den Weihbischof Otto
Georgens leitete, segneten er und weitere Geistlichen die
Jubelpaare und wechselten persönliche Worte.
"Es gibt kaum einen Gottesdienst, den ich lieber feiere, als den
mit den Ehepaaren, weil Dank zum Ausdruck kommt", erklärte der
Weihbischof bei der Begrüßung. "Sie sind ein Geschenk Gottes, ein
Geschenk für uns, für das Bistum", rief er den Ehegatten zu.
Zum neunten Mal wurde im Dom der Tag der Ehejubiläen gefeiert.
Die Feier ist bei den Paaren äußerst beliebt. „Wir freuen uns sehr
über die große Resonanz“, sagte Rita Höfer, die die Veranstaltung
der Ehe- und Familienseelsorge im Bischöflichen
Ordinariat mitorganisiert. Auch dieses Mal überstieg die Nachfrage
das Platzangebot. Weil der Platz im Dom begrenzt ist, konnte die
Ehe- und Familienseelsorge "nur" 557 einladen. 150 Paare konnten
leider nicht berücksichtigt werden, bedauerte Mitorganisator Rainer
Mäker aus der Abteilung Generationen und Lebenswelten im
Bischöflichen Ordinariat. Im Dom wurden zusätzliche
Sitzgelegenheiten geschaffen. Die Paare nahmen auch in der Apsis
Platz.
 Mehr als die
Hälfte der Jubelpaare ist 50 Jahre und länger verheiratet. 269
Paare feiern in diesem Jahr ihre Goldene Hochzeit. 71 Eheleute
blicken auf einen gemeinsamen Lebensweg von 60 oder mehr Jahren
zurück. Die Paare kamen aus der gesamten Diözese. Manche nahmen
eine weite Anreise in Kauf, kamen gar aus dem saarländischen
Mandelbachtal an den Rhein.
Mehr als die
Hälfte der Jubelpaare ist 50 Jahre und länger verheiratet. 269
Paare feiern in diesem Jahr ihre Goldene Hochzeit. 71 Eheleute
blicken auf einen gemeinsamen Lebensweg von 60 oder mehr Jahren
zurück. Die Paare kamen aus der gesamten Diözese. Manche nahmen
eine weite Anreise in Kauf, kamen gar aus dem saarländischen
Mandelbachtal an den Rhein.
Mathilde Maria und Walfried Vowinkel (79 und 76 Jahre) mussten
weniger weit fahren. Das Paar aus Germersheim besucht den Dom
öfter, die Feier der Ehejubiläen war für beide aber eine Premiere.
"Wir haben die 50 Ehejahre gut überstanden, aber nur mit dem
Glauben", spricht Mathilde Maria Vowinkel gute wie schlechte Zeiten
an, die sie und ihr Mann mit Gottvertrauen meisterten. Am Sonntag
strahlten beide und lobten den gelungenen Gottesdienst. Höhepunkte
waren für Walfried Vowinkel "der Chor und natürlich auch die
Predigt".
 In einer seiner
bewegenden Predigt verglich Weihbischof Otto Georgens die Liebe mit
einem Abenteuer – einem Abenteuer fürs Leben, bei dem Gott mit im
Spiel ist. Er erinnerte daran, dass bei Herausforderungen,
Belastungsproben und Krisen die vor ihm sitzenden Eheleute in Treue
zueinandergestanden haben. "Sie haben auf Gott vertraut, auf den
Dritten im Bund Ihrer Ehe, und das Abenteuer Ihres Lebens nicht nur
erlebt, sondern bestanden." Der Weihbischof versicherte: "Gott ist
treu. Auf die Zusage, dass Gott auch in Zukunft zu Ihnen steht,
dürfen Sie vertrauen." Er sprach die Sehnsucht aller Menschen nach
Liebe und Treue an – einer tief verwurzelten Sehnsucht. Wer Liebe
gefunden hat, muss daran arbeiten. "Das Schließen einer Ehe darf
nicht das Abschließen einer Ehegeschichte sein, die Ehe ist als
Gestaltungsaufgabe zu sehen." Liebe ist laut Georgens Ziel und Weg
zugleich, "weil Gott die Liebe ist und weil die Liebe aus Gott
ist". Sie ist ein Kompass, anspruchsvoll, braucht Mut zur
Veränderung, Sensibilität füreinander und ist nicht billig zu
haben.
In einer seiner
bewegenden Predigt verglich Weihbischof Otto Georgens die Liebe mit
einem Abenteuer – einem Abenteuer fürs Leben, bei dem Gott mit im
Spiel ist. Er erinnerte daran, dass bei Herausforderungen,
Belastungsproben und Krisen die vor ihm sitzenden Eheleute in Treue
zueinandergestanden haben. "Sie haben auf Gott vertraut, auf den
Dritten im Bund Ihrer Ehe, und das Abenteuer Ihres Lebens nicht nur
erlebt, sondern bestanden." Der Weihbischof versicherte: "Gott ist
treu. Auf die Zusage, dass Gott auch in Zukunft zu Ihnen steht,
dürfen Sie vertrauen." Er sprach die Sehnsucht aller Menschen nach
Liebe und Treue an – einer tief verwurzelten Sehnsucht. Wer Liebe
gefunden hat, muss daran arbeiten. "Das Schließen einer Ehe darf
nicht das Abschließen einer Ehegeschichte sein, die Ehe ist als
Gestaltungsaufgabe zu sehen." Liebe ist laut Georgens Ziel und Weg
zugleich, "weil Gott die Liebe ist und weil die Liebe aus Gott
ist". Sie ist ein Kompass, anspruchsvoll, braucht Mut zur
Veränderung, Sensibilität füreinander und ist nicht billig zu
haben.
Die Predigt beeindruckte auch Gerd Hilbert (78 Jahre) aus
Ludwigshafen. Vor 55 Jahren heiratete er seine Frau Gerda (79).
Beide waren anlässlich ihrer Goldenen Hochzeit vor fünf Jahren das
erste Mal bei der Feier der Ehejubiläen und wollen zum 60.
Hochzeitstag wiederkommen. "Es ist sehr schön, in dieser
Gemeinschaft einen Gottesdienst zu feiern, um Gott zu danken – das
ist das Besondere an diesem Tag", erklärte Gerd Hilbert. Für ihn
war die Messe "emotional sehr ansprechend", wie er sagte.
Karin und Erich Hellmann (69 und 74 Jahre) aus dem
südpfälzischen Wörth sind zum Fest gekommen, um ihr Eheversprechen
zu erneuern. Deshalb war dies neben der Kommunion und Segnung durch
den Weihbischof ein Höhepunkt. Beide gehen seit 50 Jahren den Weg
gemeinsam, feierten ihren Hochzeitstag dieses Jahr in Rom. Den
Gottesdienst für die Ehejubilare fanden sie "sehr schön, sehr
feierlich".
Musikalisch wurde der Gottesdienst vom Mädchenchor und
Frauenstimmen des Domchors gestaltet unter Leitung von
Domkapellmeister Markus Melchiori. Die Orgel spielte Domorganist
Markus Eichenlaub. Als kleines Geschenk erhielten die Jubelpaare
jeweils zwei kleine Wasserwaagen. Sie sollen zum einen das Auf und
Ab von glücklichen und weniger glücklichen Zeiten symbolisieren,
zum anderem auf das Abwägen hinweisen, das Austarieren zweier
Menschen.
Die Feier der Ehejubiläen war wieder ein gelungenes Fest mit
vielen strahlenden Gesichtern - aber einem Wermutstropfen: Viele
Paare hatten sich auf den Hochzeitswalzer auf dem Domvorplatz
gefreut, aber der Regen machte einen Strich durch die Rechnung.
Weil das Bodenpflaster durch die Nässe rutschig war, entschieden
die Organisatoren, den Tanz rund um den Domnapf abzusagen.
Text/Fotos: Yvette Wagner
05.09.2016
Christian Eiswirth wird Pfarrer der Pfarrei Heilige Edith Stein in Ludwigshafen
Speyer- Pfarrer Christian Eiswirth,
bisher Kooperator in der Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in
Frankenthal, wird zum 15. November mit der Leitung der Pfarrei
Heilige Edith Stein in Ludwigshafen betraut. Christian Eiswirth
wurde im Jahr 2010 zum Priester geweiht. Als Kaplan wirkte er in
Herxheim und Hettenleidelheim.
Ab dem 1. Oktober wird Pater Dr. Christogonus Keke vom Orden der
„Söhne Mariens, Mutter der Barmherzigkeit“ als Kaplan in der
Pfarrei Heilige Dreifaltigkeit in Frankenthal eingesetzt.
Bereits im Juli hat das Bistum Speyer mitgeteilt, dass der
bisherige Pfarrer der Pfarrei Heilige Edith Stein in Ludwigshafen,
Dr. Georg Müller, nach Schifferstadt wechselt. Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann hat ihm mit Wirkung vom 15. November die
Pfarrei Heilige Edith Stein in Schifferstadt verliehen. Dr. Georg
Müller wird weiterhin im Bischöflichen Offizialat in Speyer
mitarbeiten. is
05.09.2016
Volkskirche im Wandel muss glaubwürdig handeln
 v.l.: Oberkirchenrätin Marianne Wagner, Kirchenpräsident Christian Schad und Gottfried Müller
v.l.: Oberkirchenrätin Marianne Wagner, Kirchenpräsident Christian Schad und Gottfried Müller
Oberkirchenrätin Marianne Wagner ins Amt eingeführt –
Dank für Vorgänger Gottfried Müller
Speyer- Die neue pfälzische
Oberkirchenrätin Marianne Wagner hat sich in ihrer
Einführungspredigt dafür ausgesprochen, dass sich die Landeskirche
noch stärker als „Beteiligungskirche“ entwickelt. Gerade in Zeiten
großer Veränderungen brauche die „Volkskirche im Wandel“ die
Besinnung auf die biblische Botschaft, gute Kommunikation auf allen
Ebenen und klar strukturierte Zusammenarbeit. „Wir sind eine
Einheit – lokal, weltweit und ökumenisch“, sagte Wagner. In einem
Festgottesdienst am Sonntag in der Speyerer Gedächtniskirche führte
Kirchenpräsident Christian Schad die neue Personaldezernentin in
ihr Amt ein und verabschiedete ihren Vorgänger, Oberkirchenrat i.R.
Gottfried Müller. Marianne Wagner ist die erste geistliche
Oberkirchenrätin der Evangelischen Kirche der Pfalz.
Kirchenpräsident Christian Schad bezeichnete Marianne Wagner als
„Brückenbauerin“ und „Motivatorin“, die sowohl Basis- als auch
Leitungserfahrung auf unterschiedlichen kirchlichen Ebenen
mitbringe. So habe Wagner als Vorsitzende des Missionswerks
„Evangelische Mission in Solidarität“ (EMS) den Umbau von einem
traditionell deutschen Missionswerk zu einer internationalen
Missionsgesellschaft gesteuert. Leitung in der Kirche sei, das habe
Wagner immer betont, in erster Linie „geistliche Leitung“. „Und das
ist eine Haltung“, unterstrich der Kirchenpräsident, „die geprägt
ist vom Hören auf die Heilige Schrift, die auf die Kraft des Gebets
vertraut und für eine Kirche eintritt, in der das Christuszeugnis
glaubhaft gelebt wird und die sich als Teil der Mission Gottes in
dieser Welt versteht“.
Den Menschen geistliche Orientierung geben
„Wir leben in Zeiten großer Veränderungen“, sagte Wagner in
ihrer Predigt. Um diese zu gestalten, brauche es „klare Prinzipien,
die uns leiten. Sonst besteht die Gefahr, dass wir den falschen Weg
einschlagen“. Pfarrerinnen und Pfarrer sollten in ihren Gemeinden
„Lust auf die Bibel“ machen können, führte Wagner weiter aus. „Wenn
wir uns zu gesellschaftspolitischen Fragen äußern, dann sollte man
merken, dass wir das als Kirche tun. Wir brauchen und sollen nicht
die besseren Politiker sein.“
Dem scheidenden Oberkirchenrat Gottfried Müller dankte
Kirchenpräsident Christian Schad für sein Engagement und seine
„Fähigkeit zu transparenter Kommunikation und Vertrauensbildung“.
Müller, der nach 41 Jahren im Dienst der pfälzischen Landeskirche,
davon 17 Jahre als theologischer Personaldezernent, am 31. August
in den Ruhestand getreten ist, sei nicht nur Impuls- und
Ideengeber, sondern auch unermüdlicher Moderator und Kommunikator
gewesen. Unter seiner Federführung wurde beispielsweise das
Strategiepapier „Mutig voranschreiten – den Wandel gestalten – Gott
vertrauen“ verwirklicht. Den Wandel mutig zu gestalten und dabei
Gott zu vertrauen, dies sei für Müller tagtägliche Herausforderung
gewesen, sagte der Kirchenpräsident.
Kluge Amtsführung und zukunftsweisende Arbeit
Der Präsident der Synode der Evangelischen Kirche der Pfalz,
Hermann Lorenz, wünschte Oberkirchenrätin Marianne Wagner stets das
Gottvertrauen, um mit Ruhe und Umsicht an der Zukunft der Kirche
mit bauen zu können, aber auch den nötigen Schwung, „Mauern zu
überwinden“. Wagners Amtsvorgänger Gottfried Müller sprach der
Synodalpräsident Anerkennung für seine „kluge Amtsführung und
zukunftsweisende Arbeit“ aus.
Grußworte sprachen außerdem der stellvertretende
rheinland-pfälzische Ministerpräsident Volker Wissing, Vizepräses
Christoph Pistorius von der rheinischen Landeskirche für die
Gliedkirchen der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Generalsekretär Jürgen Reichel für das Missionswerk Evangelische
Mission in Solidarität, Domdekan Christoph Kohl für die Diözese
Speyer und die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen – Region
Südwest, der Speyerer Oberbürgermeister Hansjörg Eger sowie Thomas
Jakubowski für die Pfarrervertretung.
Bei der Einführung assistieren Pfarrerin Elizabeth Aduama,
Ghana, Pfarrer In Myung-Jin, Korea, und Vizepräses Christoph
Pistorius, Düsseldorf. Den musikalischen Rahmen des
Festgottesdienstes gestalteten die Speyerer Kantorei unter der
Leitung von Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger, der
Jugendposaunenchor Pfalz unter der Leitung von Landesposaunenwart
Christian Syperek sowie an der Orgel Landeskirchenmusikdirektor
Jochen Steuerwald und Jaemie Sitzmann. Die Liturgie gestalteten
Dekan Markus Jäckle und die Mitglieder des Landeskirchenrates. Die
Kollekte des Gottesdienstes kommt u.a. einem Hilfsprojekt für
syrische Flüchtlinge zugute.
Zur Person: Marianne Wagner (54) hat Romanische
Philologie und Evangelische Theologie in Mainz und Valencia
studiert. Nach der Zweiten Theologischen Prüfung arbeitete sie von
1997 bis 2002 im Kirchenbezirk Neustadt. 2002 übernahm sie das
Pfarramt für Weltmission im Missionarisch-Ökumenischen Dienst (MÖD)
der Landeskirche. Seit 2008 ist sie Vorsitzende des Missionswerkes
„Evangelische Mission in Solidarität“ (EMS). Seit 2014 vertritt sie
die pfälzische Landeskirche als Delegierte in der Synode der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Zur Nachfolgerin von
Gottfried Müller hatte sie die Landessynode im Juni 2016 gewählt.
Wagner lebt in Neustadt und hat einen erwachsenen Sohn. Text
und Foto: lk
04.09.2016
Protestantische Kitas in Speyer danken den Wanderfreunden

Speyer- Dank der großzügigen Spende der
Wanderfreunde 1980 Speyer e.V. freuen sich die Kinder, Eltern und
Erzieherinnen über neue Spielgeräte im Garten.
Das neu angelegte Außengelände der Prot. Kita Villa Kunterbunt
wird bereichert durch mehrere Sitzgarnituren aus Holz und
schattenspendende Sonnensegel.
Die Prot. Kita Kastanienburg erhält im Zuge der Erneuerung ihrer
Außenanlage ein neues Baumhaus.
Die Prot. Kita Arche Noah bekam neue Fahrzeuge für ihre
Rädchenstrecke und kann den langersehnten Wunsch der Krippenkinder
erfüllen: eine Kleinkindanlage zum Klettern und Rutschen. Zudem
wurde eine alte Vogelnestschaukel repariert und somit wieder
nutzbar gemacht.
Die rund 18.000€ wurden, ganz im Sinne der Wanderfreunde, ins
Außengelände der Kindertagesstätten investiert. Somit wird die
Bewegung und Verweildauer der Kinder in der Natur unterstützt und
gefördert. Text und Foto: Ev Kirche der Pfalz
04.09.2016
Ehrenamt sieht sich vor neuen Herausforderungen
 v.l.: obere Reihe: Rosemarie Schmidt, Regina Mayer-Oelrich, Annekatrin Schwarz, Heike Baier. Mittlere Reihe: Heike Buhles, Bärbel Schäfer, Lothar Mattes, Karl Fischer, Albrecht Bähr, Stefan Behrens. Untere Reihe: Christian Schad, Belinda Spitz-Jöst, Gertrud Welzel, Elke Höpfner-Matheis, Margita Kneipert, Marion Wagner, Luise Friebel, Rüdiger Weiß, Ortrud Schaubel, Anne Müller-Hock, Ernst Bedau, Marianne Blaul.
v.l.: obere Reihe: Rosemarie Schmidt, Regina Mayer-Oelrich, Annekatrin Schwarz, Heike Baier. Mittlere Reihe: Heike Buhles, Bärbel Schäfer, Lothar Mattes, Karl Fischer, Albrecht Bähr, Stefan Behrens. Untere Reihe: Christian Schad, Belinda Spitz-Jöst, Gertrud Welzel, Elke Höpfner-Matheis, Margita Kneipert, Marion Wagner, Luise Friebel, Rüdiger Weiß, Ortrud Schaubel, Anne Müller-Hock, Ernst Bedau, Marianne Blaul.
Vernetzen, reflektieren, weitergeben: Kritische
Bestandsaufnahme am „Runden Tisch“
Speyer- Wie kann das Ehrenamt im Wandel
besser strukturiert werden? So lautete die Frage, mit der sich der
„Runde Tisch Ehrenamt“ der Evangelischen Kirche der Pfalz bei
seinem letzten Zusammentreffen im Mutterhaus der Evangelischen
Diakonissenanstalt in Speyer beschäftigt hat. 22 Haupt- und
Ehrenamtliche aus den vielfältigen Bereichen der pfälzischen
Landeskirche und ihrer Diakonie diskutierten darüber, wie das
Ehrenamt derzeit aufgestellt ist, wie es nach außen hin vertreten
und wahrgenommen wird und wie Ehren- und Hauptamtliche die
bestehenden Strukturen verbessern können. Das Ehrenamt „unter dem
Dach der Kirche“, so die Erkenntnis der Tagung, ist nach wie vor
beliebt, befindet sich aber im Wandel.
Kirchenpräsident Christian Schad und Landesdiakoniepfarrer
Albrecht Bähr nahmen die Ideen und Wünsche der Teilnehmer auf. „So
wichtig der hauptamtliche Dienst in unserer Kirche ist – ihre
Zukunft entscheidet sich auch an der Frage, ob und wie freiwillig
Tätige sich mit dem Glaubensthema und dem Auftrag der Kirche
identifizieren“, bekräftige Kirchenpräsident Christian Schad. Er
dankte den anwesenden Ehren- und Hauptamtlichen für ihr gutes
Miteinander und sagte zu, die Begleitung und Förderung des
Ehrenamts entschieden fortzusetzen, „um ihm die notwendige
Würdigung auch in Zukunft zuteil werden zu lassen“.
Die landeskirchliche Beauftragte für das Ehrenamt, Heike Baier,
konstatierte in ihrer Bestandsaufnahme, dass freiwilliges
Engagement zwar nach wie vor gefragt und am Puls der Zeit sei.
Allerdings würden auch die Anforderungen nach Flexibilität im
(Berufs-)Alltag immer höher. Dadurch bleibe weniger Zeit, sich
regelmäßig zu engagieren. Das habe in den letzten Jahren zu einem
Wandel geführt. Das traditionelle, langfristige Ehrenamt gehe eher
zurück und werde zunehmend von einem „neuen“, eher projektbezogenen
Engagement ergänzt, wie beispielsweise in der Flüchtlingsarbeit.
Indem sie Ehrenamtlichen gute Bedingungen biete, bleibe die Kirche
„als wichtiger Akteur in der Mitte der Gesellschaft erkennbar“,
sagte Baier.
Bei der Tagung wurde deutlich, wie sehr die Ehrenamtlichen
darauf angewiesen sind, dass die Hauptamtlichen ihnen die
notwendigen Informationen weitergeben, die sie für einen geordneten
Arbeitsablauf brauchen. Hierin liege ein wichtiger Beitrag zur
Wertschätzung des Ehrenamtes, stellten die Teilnehmer heraus. Dazu
würden Fortbildungsangebote wesentlich beitragen.
Mehr zum Thema: Runder Tisch Ehrenamt der Evangelischen
Kirche der Pfalz (https://www.evkirchepfalz.de/index.php?id=272);
Ehrenamt und freiwilliges Engagement beim Diakonischen Werk Pfalz
(http://www.diakonie-pfalz.de/ich-moechte-helfen/ehrenamt.html).
Text und Foto: lk
02.09.2016
"Wichtige Impulse für die Ökumene im Bistum"
 v.l.: Ökumenereferent Dr. Thomas Stubenrauch, Dompfarrer Matthias Bender, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Thomas Dittrich (Katholikenrat), Pfarrer Martin Tiator und Pfarrer Friedrich Schmitt. Auf dem Bild fehlt Maria Faßnacht, die als Vorsitzende des Katholikenrats ebenfalls lange Zeit in der Kommission mitgewirkt hat
v.l.: Ökumenereferent Dr. Thomas Stubenrauch, Dompfarrer Matthias Bender, Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Thomas Dittrich (Katholikenrat), Pfarrer Martin Tiator und Pfarrer Friedrich Schmitt. Auf dem Bild fehlt Maria Faßnacht, die als Vorsitzende des Katholikenrats ebenfalls lange Zeit in der Kommission mitgewirkt hat
Bischof Dr. Wiesemann dankt Mitgliedern der
Ökumenekommission
Speyer- Nach sechs Jahren endete der
Berufungszeitraum der Ökumenekommission im Bistum Speyer. Bischof
Dr. Karl-Heinz Wiesemann sprach den bisherigen Mitgliedern seinen
tief empfundenen Dank aus: "Durch Ihre Mitarbeit haben Sie wichtige
Impulse für die Ökumene im Bistum gesetzt."
Beratung des Bischofs in ökumenischen
Fragen
Bereits wenige Jahre nach dem II. Vatikanischen Konzil (1962-1965)
wurde im Bistum Speyer eine Ökumenekommission eingerichtet. Sie
unterstützt den Bischof bei seiner Aufgabe, das ökumenische Leben
im Bistum zu fördern. Seit 2010 gehörten ihr Dompfarrer Matthias
Bender aus Speyer, Pfarrer Friedrich Schmit aus Kaiserslautern und
Pfarrer Martin Tiator aus Grünstadt an. Ihnen überreichte Bischof
Wiesemann als Zeichen des Dankes ein Buchpräsent. Als Vertreterin
des Katholikenrats war Maria Faßnacht bis vor kurzem ebenfalls
Kommissionsmitglied. Bischof Wiesemann würdigte noch einmal das
Wirken der früheren Katholikenratsvorsitzenden und dankte ihr für
ihren "leidenschaftlichen Einsatz für die Ökumene". In
Zukunft wird Thomas Dittrich, Vorstandsmitglied und Delegierter des
Dekanats Donnersberg, die Belange des obersten Laiengremiums in der
Ökumenekommission vertreten. Komplettiert wird die Kommission durch
den Ökumenereferenten des Bistums: bis 2012 Ordinariatsrat Michael
Schmitt, seither Dr. Thomas Stubenrauch.
Ökumenische Meilensteine, die nachwirken
Bischof Wiesemann blickte bei seinen Dankesworten auf wichtige
ökumenische Initiativen der vergangenen Jahre zurück: "Mit dem
Ökumenischen Kirchentag an Pfingsten 2015 und dem ökumenischen
Leitfaden haben wir Meilensteine mit einer großen Nachwirkung für
das Miteinander der Kirchen gesetzt". Vor allem der Leitfaden mit
seiner Bestärkung dessen, was in den Gemeinden ökumenisch gelebt
wird, und seinen Ermutigungen angesichts struktureller
Veränderungen in den Kirchen habe weit über das Bistum hinaus
Beachtung gefunden. Als einen wichtigen spirituellen Beitrag zum
Reformationsgedenken 2017 bezeichnete der Bischof die geplanten
ökumenischen Exerzitien im Alltag zu zentralen Themen der
Reformation. "An all diesen Projekten war die Ökumenekommission
maßgeblich beteiligt", so Wiesemann. Auch nach Meinung der
Kommissionsmitglieder hat die Ökumene in der Pfalz in den
vergangenen Jahren einen höheren Stellenwert erhalten: "Es bewegt
sich was und das kommt in den Gemeinden an." Weitere
Arbeitsschwerpunkte waren die Konzeption einer Arbeitshilfe zu
ökumenischen Gottesdiensten rund um das Pfingstfest sowie die
seelsorgliche Begleitung christlicher Flüchtlinge, die einer
orientalischen Kirche angehören.
Bischof Wiesemann kündigte an, dass im März 2017 die Kommission in
veränderter Zusammensetzung ihre Arbeit fortsetzen wird. Text
und Foto: is
01.09.2016
Bücher aus der NS-Zeit an das Bistumsarchiv zurückgegeben
 v.l.: Dr. Gabriele Dreßing, Dr. Armin Schlechter, Generalvikar Dr. Franz Jung und Archivleiter Dr. Thomas Fandel.
v.l.: Dr. Gabriele Dreßing, Dr. Armin Schlechter, Generalvikar Dr. Franz Jung und Archivleiter Dr. Thomas Fandel.
Pfälzische Landesbibliothek übergibt sechs Bücher, die von
den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden
Speyer- Die Pfälzische Landesbibliothek
hat sechs Bücher, die in der Zeit des Nationalsozialismus aus
katholischen Pfarrbüchereien enteignet wurden, an das Bistum Speyer
zurückgegeben.
„Es handelt sich um belletristische Werke, die Geschichten
erzählen, aber auch selbst eine spannende Geschichte haben“,
erklärte Dr. Armin Schlechter vom Landesbibliothekszentrum
Rheinland-Pfalz. Ein Erlass im Jahr 1940 verfügte, dass sämtliches
nichtkonfessionelles Schrifttum aus den katholischen
Pfarrbüchereien entfernt und für die Ausleihe gesperrt werden
musste. Auf das rein religiöse Schrifttum reduziert, verloren die
Borromäusbüchereien an Attraktivität für die Benutzer, was de facto
einer Ausschaltung gleichkam. „Es handelte sich um den Versuch, das
geistige Leben in Deutschland im Interesse des Nationalsozialismus
zu kontrollieren“, so Schlechter.
Im Kreis Speyer wurden im Frühjahr 1941 Gestapo-Kontrollen in
den Pfarrbüchereien durchgeführt, ob der Erlass befolgt und die
entsprechenden Bücher ausgesondert worden waren. Meist wurde pro
forma eine „mangelhafte“ Ausscheidung festgestellt und die Bücher
beschlagnahmt. Sie mussten zunächst gesondert in einem Schrank
aufbewahrt werden, der von der Gestapo versiegelt wurde. Wie genau
die Bücher in das Landesbibliothekszentrum gelangten, kann nicht
mehr rekonstruiert werden. Es ist davon auszugehen, dass sie im
Zusammenhang mit der so genannten „Rosenbergspende“, einer
Sammelaktion für die deutsche Wehrmacht, in die Hände anderer
Besitzer gelangten.
Generalvikar Dr. Franz Jung konnte sechs Bücher entgegennehmen,
als deren letzter Besitzer vor der Enteignung die Kirchenstiftung
des Bistums Speyer nachweisbar ist. Eines der Bücher stammt laut
Besitzstempel aus der katholischen Pfarrbücherei in Bellheim, die
ebenfalls dem Borromäusverein angeschlossen war. Die fünf anderen
Bücher können keiner konkreten Borromäusbücherei zugeordnet
werden.
Landesbibliothek untersuchte 60.000 Bände
Während der Zeit des Nationalsozialismus erwarb die Pfälzische
Landesbibliothek rund 60.000 Bände durch Ankauf, Geschenke oder
Tausch mit anderen Bibliotheken. Einige dieser Bücher haben eine
besondere Geschichte: Sie gehörten Personen und Körperschaften, die
aus weltanschaulichen oder politischen Gründen verfolgt wurden –
meist Juden, aber auch Kommunisten, Sozialisten, Freimaurer,
Katholiken oder Pazifisten. Insgesamt wurden 2.500 Bücher aus
dieser Zeit als Raubgut identifiziert. 60 davon sind inzwischen an
die rechtmäßigen Eigentümer oder ihre Nachkommen zurückgegeben
worden.
Im Jahr 2012 startete das Landesbibliothekszentrum ein Projekt
zur Provenienzforschung, um seine Bestände am Standort Speyer auf
NS-Raubgut zu untersuchen. Das Landesbibliothekszentrum war damit
die erste Einrichtung in Rheinland-Pfalz, die sich an der
nationalen Aufgabe der Recherche nach NS-Raubgut beteiligte.
Zunächst wurden die zwischen 1933 und 1950 erworbenen Bestände auf
nationalsozialistisches Raubgut überprüft. Bei den Recherchen
stellte sich heraus, dass dieses Haus tatsächlich NS-Raubgut
erworben hatte, in erster Linie aus regionalen Bezugsquellen.
„Buch als Medium hat für Christentum entscheidende
Bedeutung“
Generalvikar Dr. Franz Jung dankte der Pfälzischen
Landesbibliothek für die bemerkenswerte Untersuchung und Rückgabe
der Bücher. „Ihre Beschlagnahmung stand seinerzeit für den Versuch,
die Volksbildung in Deutschland gleichzuschalten und im Sinne der
nationalsozialistischen Ideologie in den Griff zu bekommen.“ Er
erinnerte daran, dass dem Buch als Medium im Christentum eine
entscheidende Bedeutung zukommt. Als wertvollen Beitrag zur
Aufarbeitung des Nationalsozialismus würdigte der Leiter des
Bistumsarchivs, Dr. Thomas Fandel, das Restitutionsprojekt der
Pfälzischen Landesbibliothek. Dr. Gabriele Dreßing, die Leiterin
der Fachstelle für die katholischen öffentlichen Büchereien,
beleuchtete die Rückgabe der Bücher vor dem Hintergrund der
Geschichte der katholischen Büchereiarbeit. Der Borromäusverein
wurde 1845 gegründet. „Im Jahr 1933 gab es in Deutschland rund
5.300 öffentliche Büchereien mit zehn Millionen Ausleihen, wobei
jedes dritte Buch in einer Bücherei des Borromäusvereins
ausgeliehen wurde“, so Dreßing.
Der Borromäusverein wurde 1944 nicht aufgelöst. „Er besteht bis
heute und ist noch immer von der Idee getragen, über Bücher die
Herzen und Köpfe der Menschen zu erreichen“, so Dreßing. „Auch im
21. Jahrhundert haben unsere katholischen öffentlichen Büchereien
ihren Platz in den Pfarreien und in der Gesellschaft.“ So befindet
sich derzeit etwa ein Drittel der öffentlichen Büchereien in
kirchlicher Trägerschaft. An rund 130 Standorten im Bistum Speyer
werden pro Jahr etwa 200.000 Besucher und 566.000 Ausleihen
gezählt. Dank der Mithilfe von rund 960 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kann ein Bestand von rund 370.000
Titeln vorrätig gehalten werden. Text und Foto: is
01.09.2016
Sommerliches Jahresfest mit Programm für Groß und Klein
 Gottesdienst unter freiem Himmel: Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt und Oberin Sr. Isabelle Wien
Gottesdienst unter freiem Himmel: Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt und Oberin Sr. Isabelle Wien
Ausnahmsweise bereits am letzten Sonntag im August haben
die Diakonissen Speyer-Mannheim bei hochsommerlichen Temperaturen
ihr traditionelles Jahresfest im Park beim Mutterhaus
gefeiert
Speyer- Etwa 400 Gäste, darunter Vertreter aus
Politik, Landeskirche und Ökumene, trotzten der Hitze und
kamen zum Gospelgottesdienst unter freiem Himmel, den erstmals
Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt hielt. Er ging in seiner
Predigt auf die christliche Sicht der Menschenwürde und ihre
Bedeutung für die aktuellen Herausforderungen in Gesellschaft und
Diakonie ein.
Für die musikalische Begleitung sorgten der Schwegenheimer
Spiritualchor Spirit of Sound und der Posaunenchor des CVJM aus
Schifferstadt. Die Kollekte in Höhe von 1.235 Euro kommt dem
Förderverein Hospiz in Landau für die geplante Errichtung eines
Hospizes für Landau und die Südliche Weinstraße zugute.
Über eine Spende in Höhe von 2.665 Euro freut sich das Speyerer
Hospiz im Wilhelminenstift: Es erhält den Erlös aus dem Flohmarkt,
den die Diakonische Gemeinschaft auf dem Jahresfest veranstaltet
hat.
Nicht nur der Flohmarkt war gut besucht: Im Anschluss an den
Gottesdienst nutzten zahlreiche Gäste die Gelegenheit, um sich an
Ständen der Einrichtungen der Diakonissen Speyer-Mannheim über
deren Angebote zu informieren. Besonders beliebt waren natürlich
Spiele, Rätsel und Bastelspaß für die kleinen Besucher, aber auch
für die Erwachsenen war mit Gesundheits- und Hygienecheck und
Informationen und Mitmachaktionen von Einrichtungen für Senioren
und Menschen mit Behinderung, Jugendhilfe und Krankenhäusern sowie
Ausbildungsstätten, Hospiz und Grünen Damen für jeden etwas dabei.
Groß und Klein ließen das Fest mit Leckereien vom Grill, Kaffee und
Kuchen im Mutterhaus-Park ausklingen. „Wir freuen uns, dass so
viele Menschen zu unserem erweiterten Familienfest gekommen sind“,
so Oberin Diakonisse Isabelle Wien.
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
29.08.2016
Fit ins neue Schuljahr
 Bistum Speyer
stellt Kalender für neues Schuljahr vor.
Bistum Speyer
stellt Kalender für neues Schuljahr vor.
Speyer- „Aktiv gegen Not“ vorgehen, „Methoden,
die zur Stille führen“ kennenlernen, Bräuche und Traditionen von
Festtagen und Kirchenjahr verstehen: Für Schulen bietet das Bistum
Speyer zum neuen Schuljahr Fortbildungen und Begleitungen an.
Orientiert an Bedarfen um gesellschaftliche Fragen und religiöse
Bildung finden Lehrerinnen und Lehrer und Pädagogische Fachkräfte
Unterstützung für sich und den Schulalltag. Vermehrt werden auch
direkte Schülerprojekte, wie zum Beispiel ein buchbarer Tag
„Klosterleben“, angeboten; hier schlüpfen Schüler in die Rolle von
Mönchen, um diese kulturell-geistliche Prägung nacherleben zu
können.
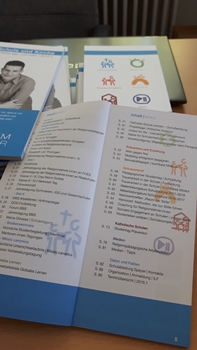 Die rund 50
unterschiedlichen Angebote im Kalender „Schule und Kirche“ umfassen
die Bereiche Religionspädagogik, Globales Lernen, Erziehung und
Prävention sowie Schulpastoral und Medien. Die Veranstaltungen
finden regional im Bistum statt, von St. Ingbert, Pirmasens, Landau
und Speyer, ebenso in Kaiserslautern und Ludwigshafen.
Die rund 50
unterschiedlichen Angebote im Kalender „Schule und Kirche“ umfassen
die Bereiche Religionspädagogik, Globales Lernen, Erziehung und
Prävention sowie Schulpastoral und Medien. Die Veranstaltungen
finden regional im Bistum statt, von St. Ingbert, Pirmasens, Landau
und Speyer, ebenso in Kaiserslautern und Ludwigshafen.
Kalender bestellen oder Downloaden:
HA II Schulen, Hochschulen und Bildung
Gr. Pfaffengasse 13
67346 Speyer
Tel. 06232-102-121
ru-fortbildung@bistum-speyer.de
www.bistum-speyer.de
Erziehung Schule Bildung
Text und Foto: Bistum speyer, Presse
26.08.2016
Entscheidung im Künstlerwettbewerb für Seminarkirche St. German
 Gestaltungskonzept von Bernhard Mathäss überzeugt Jury,
Verwaltungsrat, Kunstbeirat und Bischof – Innenrenovierung der
Seminarkirche beginnt voraussichtlich im Oktober
Gestaltungskonzept von Bernhard Mathäss überzeugt Jury,
Verwaltungsrat, Kunstbeirat und Bischof – Innenrenovierung der
Seminarkirche beginnt voraussichtlich im Oktober
Speyer- Die Entscheidung im
Künstlerwettbewerb für die Seminarkirche des Priesterseminars St.
German in Speyer ist gefallen: Bernhard Mathäss, Künstler und
Bildhauer aus Neustadt-Duttweiler, wird den Chorraum der Kirche neu
gestalten. Sein Entwurf wurde aus insgesamt 82 Bewerbungen
ausgewählt.
Die Aufgabenstellung war alles andere als einfach. Die in den
50er-Jahren erbaute Seminarkirche bringt als klassische Wegekirche
das Liturgieverständnis vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil zum
Ausdruck. „Alles läuft auf den Hochaltar mit dem Tabernakel zu. Der
Weg dorthin führt in eine immer größere Weite und immer mehr zum
Licht“, erklärt der Regens des Priesterseminars Markus Magin. Er
sieht in der Kirche ein besonderes Beispiel für die Theologie und
die Architektur dieser Zeit.
Zweites Vatikanisches Konzil soll in neuer Raumgestaltung
Ausdruck erhalten
Mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil – es dauerte von 1962 bis
1965 – wandelten sich die Form der Messe und das
Liturgieverständnis. „Der Altar als Zeichen für Christus rückt
gleichsam in die Mitte des Raumes: In der Feier der Eucharistie
versammelt sich die Gemeinde um den Altar“, erläutert Magin den
grundlegenden Wandel im theologischen Denken und seine Konsequenzen
für die bauliche Gestaltung. In der Kirche St. German hatte man
dieser Entwicklung zunächst auf eher provisorische Weise Rechnung
getragen: Seit den 70er-Jahren diente ein einfacher Holztisch als
Hauptaltar. „Das entspricht weder den liturgischen Vorgaben, noch
bildet der Altar mit den anderen Elementen der liturgischen
Ausstattung - zum Beispiel Ambo und Priestersitz - eine erkennbare
Einheit“, weist Markus Magin auf die Schwachpunkte der bisherigen
Lösung hin.
Mit dem Raumkonzept von Bernhard Mathäss soll das Zweite
Vatikanische Konzil auch in der Seminarkirche St. German Einzug
halten. Indem er die sechseckige Grundform der Decke des Chorraums
auf den Boden spiegelt, entsteht ein neues Zentrum. Der Altarraum
ruht auf einem sechseckigen Steinboden, der von zwei Fugen in Form
eines Kreuzes, dem Grundsymbol des Christentums, durchzogen wird.
Im Schnittpunkt beider Linie der Altar, ebenfalls ganz aus Stein.
Der Altarfuß steht gegenüber der Altarplatte an den Seiten etwas
über – „Zeichen dafür, dass die Feier der Eucharistie über sich
hinausweist und die Liebe Gottes uns immer dazu drängt, das
Empfangene weiterzugeben“, so Magin.
Die stärkste Veränderung erfährt der Raum durch eine Stelenwand,
die zwischen dem Altarraum und dem Hochaltar eingezogen wird.
„Damit werden das Christus-Relief, der Hochaltar und der Tabernakel
präsent gehalten, gleichzeitig bekommt der Raum jedoch eine neue
Mitte“, ist Magin von der in seinen Augen geradezu „genialen Idee“
des Künstlers begeistert. Die Wand, besteht aus zwölf Steinstelen,
nimmt die mehrfach im Raum anzutreffende Zahlensymbolik auf und
kann als Hinweis auf die zwölf Apostel verstanden werden, die im
letzten Buch der Bibel als Grundsteine des himmlischen Jerusalem
bezeichnet werden. Sie verbindet - gleichsam als klassischer
Altarsockel – den Altarraum mit der Darstellung des himmlischen
Christus und der Engel der sieben Gemeinden auf der hinteren
Wand.
Am Germansberg liegen die Wurzeln des Christentums in
Speyer
Die Entscheidung für den Stein als Material lässt sich als
Hinweis auf die geschichtliche Bedeutung des Ortes verstehen. „Hier
am Germansberg treffen wir auf die ältesten Zeugnisse des
Christentums in Speyer“, weist Magin darauf hin, dass der erste
namentlich bekannte Bischof von Speyer, Bischof Jesse, in der Mitte
des vierten Jahrhunderts wahrscheinlich hier gelebt habe. Für das
Ende des vierten oder den Anfang des fünften Jahrhunderts sei
bereits eine Steinkirche bezeugt. „An diesem Ort liegen die
Fundamente des christlichen Glaubens in der Stadt Speyer“,
veranschaulicht Magin, warum die Gestaltungselemente im Entwurf von
Bernhard Mathäss fast so wirken, als würden sie als steinerne
Zeugen der Vergangenheit aus dem Boden herauswachsen.
Der Ambo rückt näher zur Gemeinde, ebenso die aus dem 15.
Jahrhundert stammende Marienfigur. Die Muttergottes, manchmal auch
als „Schwester der Menschen“ bezeichnet, wird so stärker als
Mittlerin zwischen den Menschen und Christus erfahrbar. Einen
weiteren Akzent setzt das Kreuz, das aus Blickrichtung der Gemeinde
vorne rechts angeordnet wird. Auffällig ist der verlängerte
Querbalken, der mit dem ausgestreckten Arm des himmlischen Christus
auf der hinteren Wand korrespondiert. „Auch hier wieder ein Symbol,
das über sich hinausweist und deutlich macht, dass der Tod am Kreuz
nur im Zusammenhang mit der Auferstehung zu begreifen ist“, so
Magin.
Die Platzierung des ebenfalls aus Stein gearbeiteten
Priestersitzes hinter dem Hauptaltar – auf beiden Seiten von
Sitzelementen zum Beispiel für weitere Zelebranten und Ministranten
flankiert – soll ebenfalls dazu beitragen, dass die Eucharistie als
Feier und Geschehen inmitten der Gemeinde erlebbar wird. „Bernhard
Mathäss gestaltet einen neuen Mittelpunkt in und mit dem Raum“,
bringt Regens Markus Magin auf den Punkt, warum sich sowohl die
Jury als auch der Verwaltungsrat des Priesterseminars, der
Kunstbeirat des Bistums und Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann für
das Konzept des 53-jährigen Künstlers aus Neustadt-Duttweiler
entschieden haben. Dieser hat schon mehrfach in Kirchen gearbeitet,
zum Beispiel bei der Gestaltung der Emmauskapelle in seiner
Heimatstadt oder bei der Gedenkplatte für die Verdienste von
Alt-Bundeskanzler Helmut Kohl in der Vorhalle des Domes.
Die Innenrenovierung der Seminarkirche beginnt voraussichtlich
im Oktober. Als Termin für die Altarweihe und die Indienstnahme des
umgebauten Priesterseminars ist der vierte Ostersonntag des
nächsten Jahres angezielt, zugleich Weltgebetstag für die
geistlichen Berufe. Die Kosten für die Außen- und Innenrenovierung
der Seminarkirche sind auf etwa eine Million Euro berechnet. Davon
entfallen etwa 100.000 Euro auf die Steinarbeiten bei der
Neugestaltung des Chorraums. Text und Foto: is
17.08.2016
„Blick hinein in den Himmel“
 Pontifikalamt zu
Mariä Himmelfahrt im Speyerer Dom mit Bischof Dr. Wiesemann
Pontifikalamt zu
Mariä Himmelfahrt im Speyerer Dom mit Bischof Dr. Wiesemann
Speyer- Am 15. August feierten an die
tausend Menschen mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann einen
festlichen Pontifikalgottesdienst. Das Hochfest der in den Himmel
aufgenommenen Gottesmutter Maria – bekannt als Mariä Himmelfahrt -
ist zugleich Patronatsfest des Bistums und der Kathedrale.
Bereits bei seiner Begrüßung stellt Bischof Wiesemann die
Bedeutung dieses Festtages heraus: Er gewähre den Menschen „einen
Blick hinein in den Himmel, in eine erlöste Welt“. In seiner
Predigt legte er dar, dass das Fest der mit Leib und Seele in den
Himmel aufgenommenen Gottesmutter Maria der Tag sei, um angesichts
der Schrecken von Krieg und Terror sich des Heilsversprechens
Gottes zu erinnern. „Wir brauchen keine Gemeinschaft des
Entsetzens, sondern eine Gemeinschaft des Mutes und der Visionen“,
so Bischof Wiesemann. Maria sei eine Frau des Mutes gewesen, die
auch unter dem Kreuz die Hoffnung nicht verloren habe. Ihre
Aufnahme mit Leib und Seele in den Himmel sei aber kein
„Himmelfahrtskommando“. Die Aufnahme Mariens in den Himmel bedeute
keine Entwertung des irdischen, die einen fanatischen Glauben
aufleben lasse. Vielmehr nehme Gott sich unserer an - „so wie ich
bin, wie ich verwundet werde und heile.“ Dabei führe er uns im
irdischen Leben nicht wie Kleinkinder an der Hand, sondern gäbe uns
Freiheit, auch eine Freiheit der abgründigen Verwundbarkeit. Dies
sei möglich, weil das ewig Leben schon in uns sei, auch wenn wir
gedemütigt würden.
Viele Dombesucher hatten Sträuße mit Kräutern und Blumen
mitgebracht, die von Bischof Wiesemann im Gottesdienst gesegnet
wurden. Einer alten Tradition entsprechend sollen sie deutlich
machen, dass die ganze Schöpfung unter dem Segen Gottes und der
Verheißung der österlichen Vollendung steht. Zum Abschluss des
Gottesdienstes spendete Bischof Wiesemann den päpstlichen Segen.
Für die musikalische Gestaltung des Pontifikalamtes sorgten der
Ferienchor der Dommusik und die Dombläser unter der Leitung von
Domkapellmeister Markus Melchiori Die Orgel spielte Domorganist
Markus Eichenlaub.
 Bei der
Marienfeier am Abend predigte Privatdozent Dr. Joachim Reger, der
Maria als „Mutter der Barmherzigkeit“ in den Mittelpunkt seiner
Betrachtung stellte. Barmherzig sein werde nicht selten mit
Nachgiebigkeit, Inkonsequenz und Schwäche gleichgesetzt. Der
Einwand verdeutliche, dass Barmherzigkeit auch gefährlich sein
kann, „wenn sie aus Schwäche geschieht.“ Bloße Gerechtigkeit führe
zu einer Gesellschaft der Kälte, die den Brüchen eines jeden Lebens
nicht gerecht wird. Eine menschenwürdige Gesellschaft aber lasse
sich mit dieser Haltung nicht aufbauen. „Wahre Barmherzigkeit ist
daher keine Haltung der Schwäche, sondern der Stärke. Sie erwächst
aus einer Liebe, die so stark ist, dass sie sich wirklich auf den
Nächsten einlassen kann“, betonte Reger. Barmherzigkeit fordere die
Stärke, über sich selbst hinauszuwachsen und frei zu werden für
andere Menschen. Anschließend zogen die Gläubigen in einer
stimmungsvollen Lichterprozession durch den Domgarten. Die
musikalische Gestaltung der abendlichen Liturgie lag in den Händen
des Chors der Dompfarrei und der Dombläser. Text: Friederike
Walter, Fotos: Klaus Landry
Bei der
Marienfeier am Abend predigte Privatdozent Dr. Joachim Reger, der
Maria als „Mutter der Barmherzigkeit“ in den Mittelpunkt seiner
Betrachtung stellte. Barmherzig sein werde nicht selten mit
Nachgiebigkeit, Inkonsequenz und Schwäche gleichgesetzt. Der
Einwand verdeutliche, dass Barmherzigkeit auch gefährlich sein
kann, „wenn sie aus Schwäche geschieht.“ Bloße Gerechtigkeit führe
zu einer Gesellschaft der Kälte, die den Brüchen eines jeden Lebens
nicht gerecht wird. Eine menschenwürdige Gesellschaft aber lasse
sich mit dieser Haltung nicht aufbauen. „Wahre Barmherzigkeit ist
daher keine Haltung der Schwäche, sondern der Stärke. Sie erwächst
aus einer Liebe, die so stark ist, dass sie sich wirklich auf den
Nächsten einlassen kann“, betonte Reger. Barmherzigkeit fordere die
Stärke, über sich selbst hinauszuwachsen und frei zu werden für
andere Menschen. Anschließend zogen die Gläubigen in einer
stimmungsvollen Lichterprozession durch den Domgarten. Die
musikalische Gestaltung der abendlichen Liturgie lag in den Händen
des Chors der Dompfarrei und der Dombläser. Text: Friederike
Walter, Fotos: Klaus Landry
16.08.2016
Trauerarbeit mit Russlanddeutschen
 75. Jahrestag
des Stalin-Erlasses zur Deportation der Wolgadeutschen
75. Jahrestag
des Stalin-Erlasses zur Deportation der Wolgadeutschen
Speyer- Dass die Integration von Menschen
aus anderen Staaten in der bundesrepublikanischen Gesellschaft
langen Atem braucht, hat der Vorsitzende der Konferenz der
Aussiedlerseelsorge der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD),
Reinhard Schott, in Speyer betont. Aus Anlass des
75. Jahrestages des Stalin-Erlasses zur Deportation der
Wolgadeutschen am 28. August 1941, erklärte Schott, dass politische
Verfolgung, Mord und Denunziation„Traumata in den Familien
hervorriefen, unter denen die Nachfahren heute noch leiden, obwohl
sie längst in Deutschland leben und die jüngeren unter ihnen hier
geboren wurden“.
Es gäbe keine russlanddeutsche Familie, für die der 28. August
1941 nicht schicksalhaft gewesen sei, sagt Schott, der heute
Integrationsbeauftragter der Evangelischen Kirche der Pfalz und des
Diakonischen Werkes Pfalz ist. Durch den Erlass über die
Zwangsumsiedlung der Wolgadeutschen seien fast eine halbe Million
Menschen in Güterwaggons aus den westlichen Teilen der Sowjetunion,
aus Georgien und Aserbaidschan nach Sibirien und Mittelasien
deportiert worden. Als sogenannte Volksfeinde habe man Männer und
Frauen zur Zwangsarbeit eingezogen, die Kinder sich selbst
überlassen. Viele seien an Krankheiten, Unterernährung und
Erschöpfung gestorben. „Wir haben geschwiegen wie die Fische“ sagt
ein heute 79-Jähriger Russlanddeutscher. „Die Angst vor Übergriffen
war unser ständiger Begleiter.“
Reinhard Schott, dessen Eltern 1941 selbst aus der Ukraine nach
Nord-Kasachstan deportiert wurden, erinnert daran, dass mehr als
vier Millionen Deutsche aus der ehemaligen Sowjetunion in den
letzten Jahrzehnten in die Bundesrepublik gekommen sind. „Etwa die
Hälfte von ihnen bekennt sich zum evangelischen Glauben“, erläutert
Schott, der seine Kindheit in Nord-Kasachstan verbracht hat. Heute
bildeten die „Russlanddeutschen“ rund zwölf Prozent der Mitglieder
in der EKD und der Pfälzischen Landeskirche. Sie seien damit die
größte Zuwanderergruppe. Trauerarbeit mit Russlanddeutschen ist
nach Auffassung des Vorsitzenden der Aussiedlerseelsorge noch lange
nötig. Die Kirchengemeinden trügen eine große Mitverantwortung,
„damit aus dem mutigen Aufbruch nach Deutschland auch gelingende
Lebensläufe und eine gute, aktive Partizipation in Kirche und
Gesellschaft werden“, sagte Schott.
Für Reinhard Schott, dessen Vater in den Gulag nach Workuta
geschickt und erst nach Stalins Tod begnadigt wurde, ist das
eigene Familienschicksal Motivation, sich um Zuwanderer und die
Integration von Aussiedlern und Migranten zu kümmern. In Folge der
Ost-Verträge durfte seine Familie im Dezember 1972 in die
Bundesrepublik ausreisen. Da sein Schulabschluss nur
teilweise anerkannt wurde, machte er zunächst eine Ausbildung im
Postdienst und holte seinen Schulabschluss in der Abendschule nach.
Schott besuchte das Theologische Seminar St. Chrischona in der
Schweiz und wurde zum Prediger im Evangelischen
Gemeinschaftsverband der Pfalz berufen. Seit 1988 ist er
Beauftragter der Landeskirche für die Aussiedlerseelsorge; sein
Tätigkeitsfeld umfasst heute die Bereiche Asylsuchende, Flüchtlinge
und Migranten.
Text: lk; Foto: Diakonisches Werk der Pfalz
10.08.2016
Die „Steine des Domes zum Sprechen“ bringen
 Die ARC-Domführer in Speyer v.l.n.r.: Miriam Lücke, Annelise Knitter, Alice Alexandre, Mateo Vicent Fanconi
Die ARC-Domführer in Speyer v.l.n.r.: Miriam Lücke, Annelise Knitter, Alice Alexandre, Mateo Vicent Fanconi
Junge Leute aus Deutschland, Frankreich, USA und
Spanien bieten Führungen in ihrer jeweiligen Landessprache
an
Speyer- Im Sommer können Besucher im Dom
zu Speyer einen besonders herzlichen Empfang erwarten. Vom 6. bis
28. August begleiten Miriam Lücke (Deutschland), Alice Alexandre
(Frankreich), Annelise Knitter (USA) und Mateo Vicent Fanconi
(Spanien) Besucher aus aller Welt in ihrer jeweiligen Landessprache
durch die romanische Kathedrale. Sie kommen über die ökumenische
Organisation ARC nach Speyer. „Steine zum Sprechen bringen“ ist das
Motto der Organisation. Dabei geht es mindestens ebenso sehr um die
interkulturelle und überkonfessionelle Verständigung untereinander
und mit den Dombesuchern aus aller Welt. Die Führungen sind
kostenlos, Spenden zu Gunsten von ARC sind willkommen. Den
Aufenthalt in Speyer inklusive Rahmenprogramm organisiert und
finanziert das Domkapitel.
Die ARC-Domführer am Dom zu Speyer bieten kostenlose Führungen
in Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch an. Das Angebot
besteht täglich außer dienstags, jeweils von 10–12:30 Uhr und
14:30-17:30 Uhr, sonntags nach der Messe ab ca. 11:30–12:30 Uhr und
14:30-17:30 Uhr. Besucher können das Angebot ohne Voranmeldung je
nach Verfügbarkeit in Anspruch nehmen. Treffpunkt ist die
Vorhalle.
Die ARC-Teilnehmer 2016
Annelise Knitter (20) stammt aus
Nord-Californien. Derzeit studiert sie an der University of St
Andrews in Schottland Psychologie und Philosophie. Vom ARC Projekt
erfuhr sie in ihrer Universitätsgemeinde.
Die Französin Alice Alexandre (20) kommt aus
Niort, Poitou-Charentes und wird nach dem Sommer ihr Studium der
modernen Literatur in La Rochelle beginnen. Ihre Großmutter hat ihr
von ARC erzählt. Sie war schon öfter in Deutschland und
interessiert sich sehr für das Land. Speyer hat sie sich
ausgesucht, da sie die Stadt noch nicht kennt. Sie freut sich
darauf, den Dom und die Umgebung zu erkunden.
Madrid ist die Heimat von Mateo Vicent Fanconi
(20). Er studiert dort spanische Philologie. Die Idee des
ARC-Projektes „Steine zum Sprechen zu bringen“ findet er wunderbar.
Für ihn bietet es die Chance zur Evangelisierung gleichzeitig als
Möglichkeit, die Kultur weiter zu geben. Er hat sich bewusst für
die Teilnahme in Speyer entschieden.
Miriam Lücke (18) hat in diesem Jahr am
Tegernseer Gymnasium ihr Abitur gemacht. Ab dem Wintersemester wird
sie katholische Theologie in München studieren. Den Zeitraum
dazwischen nutzt sie nun, um sich mit den Themen Kultur und
Religion auseinander zu setzen und außerdem junge Menschen aus
anderen Ländern kennen zu lernen. Im Internet war sie auf das
ARC-Projekt gestoßen. Speyer kennt die Abiturientin von einem
früheren Besuch. Da ihr die Stadt gut gefiel, bewarb sie sich für
die Teilnahme am Dom.
Leben als internationale, christliche Gemeinschaft
Die vier jungen Leute eint nicht nur ihre Tätigkeit am Dom. Sie
leben als internationale, christliche Gemeinschaft in einer
Unterkunft und verbringen ihre Freizeit miteinander – auch dies ist
Teil der Grundidee des Programms. Das Besuchermanagement des Doms
organisiert aus diesem Grund verschiedene gemeinsame Aktivitäten.
So stehen in diesem Jahr eine Weinprobe in Kallstadt und ein
Ausflug nach Heidelberg auf dem Programm.
Zur Vorbereitung erhielten die jungen Leute vorab Informationen
über den Speyerer Dom. Während ihrer Zeit in der Pfalz werden sie
selbst an Führungen teilnehmen, etwa durch den Domschatz, die Stadt
Speyer aber auch durch Sehenswürdigkeiten in der Umgebung.
ARC
ARC ist eine internationale ökumenische Organisation, die in den
Sommermonaten Führungen an bedeutenden europäischen Kathedralen
organisiert. Die drei Buchstaben ARC stehen für die französischen
Wörter „Accueil“ (Empfang), „Rencontre“ (Begegnung) und
„Communauté“ (Gemeinschaft). ARC gibt es auch in Belgien, den
Niederlanden, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien.
Jedes Land entsendet Teilnehmer zu den einzelnen
Kirchenführerprojekten – so entstehen kleine ARC-Gruppen mit jungen
Menschen aus verschiedenen Ländern. Außer in Speyer engagieren sich
ARC-Führer europaweit an vielen großen Kathedralen, etwa in Florenz
und Venedig, in Bordeaux und Rouen, in London und Oxford, in
Luxemburg sowie im belgischen Gent. In Deutschland sind sie 2016
noch in Erfurt, Münster, Konstanz und Berlin (Kapelle der
Versöhnung) im Einsatz.
Weitere Informationen: www.dom-zu-speyer.de
www.arc-deutschland.de
Text und Foto: is
05.08.2016
Gutes Spendenergebnis für Brot für die Welt
 Evangelisches Hilfswerk legt Jahresbilanz für 2015 vor –
über 1 Million Euro Spenden aus der Pfalz
Evangelisches Hilfswerk legt Jahresbilanz für 2015 vor –
über 1 Million Euro Spenden aus der Pfalz
Speyer- Die Menschen in der Pfalz und der
Saarpfalz haben im vergangenen Jahr 1.030.258 Millionen Euro für
Brot für die Welt gespendet. In dieser Summe sind Kollekten und
Spenden, die in Kirchengemeinden gesammelt wurden, sowie direkte
Überweisungen an das evangelische Hilfswerk zusammengefasst.
Das Spendenaufkommen bewegt sich trotz eines leichten Rückgangs
auf dem Niveau des Vorjahres (1.037.445). Die meisten
Spenden gingen mit 2,37 Euro pro Kirchenmitglied im
Kirchenbezirk Bad Dürkheim ein, gefolgt vom Kirchenbezirk
Frankenthal mit 1,58 Euro pro Kirchenmitglied und dem
Kirchenbezirk Donnersberg mit 1,53 Euro pro
Kirchenmitglied.
„Ich danke allen Spenderinnen und Spendern sowie allen
Sammlerinnen und Sammlern herzlich für ihre Treue und Verantwortung
gegenüber unseren Geschwistern in der Einen Welt“, sagt
Kirchenpräsident Christian Schad.
Im Zentrum der Arbeit von Brot für die Welt und seinen
Partnerorganisationen standen die Überwindung von Hunger und
Mangelernährung, die Förderung von Bildung und Gesundheit sowie der
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und die Wahrung der
Menschenrechte. „Die Projekte von Brot für die Welt nehmen damit
auch die Ursachen für weltweite Fluchtbewegungen in den Blick und
helfen Menschen dabei, ihren Lebensraum zu erhalten und ein Leben
in Würde zu führen“, betont Schad.
Neu bewilligt wurden im vergangenen Jahr 553 Projekte in 79
Ländern. Die meisten Mittel (33 Prozent) flossen nach Afrika.
Bundesweit haben Spenderinnen und Spender die Arbeit von Brot
für die Welt im vergangenen Jahr mit 57,5 Millionen Euro
unterstützt. Das sind 1,8 Millionen Euro mehr als im Vorjahr (55,7
Mio.). Neben Spenden und Kollekten erhielt Brot für die Welt 2015
Mittel des Kirchlichen Entwicklungsdienstes und Beiträge Dritter,
vor allem aus dem Bundesministerium für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Insgesamt standen dem
Hilfswerk der evangelischen Kirchen und Freikirchen 255,4 Millionen
Euro zur Verfügung. Die Gesamtausgaben für Projekte betrugen 238
Millionen Euro oder 94,3 Prozent der Mittel. Für Werbe- und
Verwaltungsaufgaben wurden 5,7 Prozent eingesetzt. Das Deutsche
Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) bewertet die Werbe- und
Verwaltungsausgaben an den Gesamtausgaben als niedrig.
Brot für die Welt ist das weltweit tätige Hilfswerk der
evangelischen Landes- und Freikirchen. Gegründet 1959, fördert das
Werk heute in mehr als 90 Ländern Projekte zur Überwindung von
Hunger, Armut und Ungerechtigkeit.
Weitere Informationen finden Sie auf unseren Seiten im Internet:
http://www.diakonie-pfalz.de/aktuelles/nachrichten/detail/ueber-1-million-euro-spenden-aus-der-pfalz.html
Text und Foto: dwp
04.08.2016
"Eine wunderbare Erfahrung"

Jugendliche aus dem Bistum Speyer sind mit vielen Eindrücken
vom Weltjugendtag aus Krakau zurückgekehrt
Krakau/Speyer- Weltjugendtag: Hass,
Krieg, Gewalt? Es geht auch anders! - Davon sind die 1,5 Millionen
Jugendlichen, die sich in Krakau zum Weltjugendtag getroffen haben,
überzeugt. Unter ihnen waren etwa 200 junge Pilgerinnen und Pilger,
die in mehreren Gruppen aus der Diözese Speyer nach Polen gereist
sind.
 "Meet the world" (Triff die Welt) war der Titel, unter den
die Abteilung Jugendseelsorge im Bistum Speyer ihre Fahrt mit 41
Jugendlichen gestellt hatte. Schon bei der Ankunft am 20. Juli
wurden die Speyerer Pilgerinnen und Pilger von der weltweiten
Dimension dieser Reise beeindruckt. Die erste von zwei Wochen
verbrachten sie in der Gemeinde Ledziny. Mehrere Tausend junge
Menschen aus Deutschland, Bosnien, Polen und Tschechien füllten die
ländliche Region in der Nähe von Kattowitz mit Leben. Untergebracht
waren sie in kleinen Gruppen bei Gastfamilien. "In einem fremden
Land von fremden Menschen so herzlich aufgenommen zu werden, war
eine wunderbare Erfahrung" erinnert sich Anna Berenz (Frankenthal).
Höhepunkte der Woche waren ein Treffen mit Jugendbischof Wiesemann
und ein Festival mit etwa 12000 Jugendlichen aus aller Welt auf
einem Flugplatz in Kattowitz.
"Meet the world" (Triff die Welt) war der Titel, unter den
die Abteilung Jugendseelsorge im Bistum Speyer ihre Fahrt mit 41
Jugendlichen gestellt hatte. Schon bei der Ankunft am 20. Juli
wurden die Speyerer Pilgerinnen und Pilger von der weltweiten
Dimension dieser Reise beeindruckt. Die erste von zwei Wochen
verbrachten sie in der Gemeinde Ledziny. Mehrere Tausend junge
Menschen aus Deutschland, Bosnien, Polen und Tschechien füllten die
ländliche Region in der Nähe von Kattowitz mit Leben. Untergebracht
waren sie in kleinen Gruppen bei Gastfamilien. "In einem fremden
Land von fremden Menschen so herzlich aufgenommen zu werden, war
eine wunderbare Erfahrung" erinnert sich Anna Berenz (Frankenthal).
Höhepunkte der Woche waren ein Treffen mit Jugendbischof Wiesemann
und ein Festival mit etwa 12000 Jugendlichen aus aller Welt auf
einem Flugplatz in Kattowitz.
Zur zweiten Woche des Weltjugendtages reisten die Pilgergruppen
aus ganz Polen nach Krakau und verdoppelten damit deren
Einwohnerzahl. Jugendliche aus 180 Ländern überfluteten das Zentrum
der Stadt mit Musik und guter Laune - und brachten die öffentlichen
Nahverkehrsmittel trotz etlicher Sonderbusse an die Grenze ihrer
Belastbarkeit. Im Lauf der Woche gab es mehrere Großveranstaltungen
mit jeweils 500.000 bis 750.000 Teilnehmerinnen. "Einfach nur
unglaublich, diese Gemeinschaft zwischen den Jugendlichen zu
spüren. Mit jedem reden und sich über verschiedenen Kulturen hinweg
austauschen zu können" war für Leonie Scherer aus Queidersbach eine
unvergessliche Erfahrung.
 Zur Abschlussveranstaltung am 30. und 31. August
pilgerten die Speyerer Jugendlichen zu Fuß zum "Campus
Misericordiae", einem Feld in den Sumpfgebieten im Osten Krakaus.
Bei strahlendem Sonnenschein warteten sie gemeinsam mit etwa 1,5
Millionen Jugendlichen auf Papst Franziskus, mit dem sie eine Vigil
(Nachtgebet) feierten. Einfachste Umstände und extreme Hitze
brachten die jungen Menschen nicht davon ab, bis spät in die Nacht
zu feiern und zu beten. Nach einer Übernachtung unter freiem Himmel
endete der Weltjugendtag mit einem großen Abschlussgottesdienst -
und einem 8 Kilometer langen Fußmarsch durch Gewitterregen.
Zur Abschlussveranstaltung am 30. und 31. August
pilgerten die Speyerer Jugendlichen zu Fuß zum "Campus
Misericordiae", einem Feld in den Sumpfgebieten im Osten Krakaus.
Bei strahlendem Sonnenschein warteten sie gemeinsam mit etwa 1,5
Millionen Jugendlichen auf Papst Franziskus, mit dem sie eine Vigil
(Nachtgebet) feierten. Einfachste Umstände und extreme Hitze
brachten die jungen Menschen nicht davon ab, bis spät in die Nacht
zu feiern und zu beten. Nach einer Übernachtung unter freiem Himmel
endete der Weltjugendtag mit einem großen Abschlussgottesdienst -
und einem 8 Kilometer langen Fußmarsch durch Gewitterregen.
"Der bewegendste Moment war für mich, als sich eine Million
Jugendliche die Hände reichten und in absoluter Stille für den
Frieden auf der Welt beteten. Dieses Bild macht so viel Hoffnung.
Es zeigt eine Generation, die sich erhebt und Brücken baut, statt
Grenzen zu ziehen." sagt Pfarrer Carsten Leinhäuser, der als
Diözesanjugendseelsorger die Reise begleitet hat. Seine Antwort auf
die Frage nach der wichtigsten Erkenntnis, welche die Jugendlichen
mit nach Hause nehmen: "Der Papst hat uns eine Sache in aller
Deutlichkeit klar gemacht: Dass die Welt junge Menschen braucht,
die aufstehen und sich für ein friedliches Miteinander stark
machen. Die gegen Ausbeutung und Hass rebellieren. Die nicht nur
von der frohen Botschaft Jesu reden, sondern sie in die Tat
umsetzen."
Der nächste Weltjugendtag wird 2019 in Panama stattfinden.
"Dafür wird auf jeden Fall gespart." So viel steht für Eva Kurz aus
Kaiserslautern und für viele begeisterte und müde Jugendliche auf
der Heimfahrt von Krakau nach Speyer heute schon fest.
Text und Fotos: Pfr. Carsten Leinhäuser,
Diözesanjugendseelsorger
02.08.2016
Mit vielen Eindrücken vom Weltjugendtag zurückgekehrt- Bilderalbum
Der „Grüne Gockel“ im Landeskirchenrat
 Das Umweltteam (von links): Julian Pollini, Sibylle Wiesemann, Ralf Göring, Ursula Klüting, Peter Höfer, Christel Brech, Carl-Ludwig Krüger (externer Umweltauditor), Stephan Arbogast, Bernd Fuchs
Das Umweltteam (von links): Julian Pollini, Sibylle Wiesemann, Ralf Göring, Ursula Klüting, Peter Höfer, Christel Brech, Carl-Ludwig Krüger (externer Umweltauditor), Stephan Arbogast, Bernd Fuchs
Umweltmanagement für die Verwaltungsgebäude in Speyer –
Zertifizierung 2017 angestrebt
Speyer- Für eine bessere Umwelt wollen die
Mitarbeiter des Landeskirchenrates an einem Strang ziehen – dazu
soll der „Grüne Gockel“ in den vier Verwaltungsgebäuden der
Evangelischen Kirche der Pfalz in Speyer Einzug halten. Das
kirchliche Umweltmanagementsystem ist Teil der
Klimaschutzinitiative der Landeskirche, deren Ziel es ist, bis 2020
den Ausstoß des klimaschädlichen Gases Kohlenstoffdioxid (CO₂) um
40 Prozent – gemessen am Basisjahr 2005 – zu reduzieren. Bis 2050
will die Landeskirche das Klima bilanziell möglichst gar nicht mehr
belasten, erklärt der Umweltdezernent der Landeskirche,
Oberkirchenrat Michael Gärtner.
Kernaufgabe der Evangelischen Kirche sei es, das Handeln in der
Welt nach christlichen Grundsätzen zu gestalten. Aber „es geht um
mehr als um die Bewahrung der Schöpfung. Es geht auch um
Gerechtigkeit“, heißt es dazu in den vom Landeskirchenrat
beschlossenen Umweltleitlinien. Dazu zählten u.a. eine effektive
Gebäudebewirtschaftung, umweltfreundliches Mobilitätsverhalten,
nachhaltiges Einkaufen, aber auch die Vereinbarung von Umweltschutz
und Wirtschaftlichkeit. Die Mitarbeiter des Landeskirchenrates
wollen „zur stetigen Verbesserung des betrieblichen Umweltschutzes
beitragen und damit unseren ökologischen Fußabdruck kontinuierlich
verkleinern.“ Um die Einhaltung der Leitlinien kümmert sich ein
achtköpfiges Umweltteam unter der Leitung von Ursula Klüting.
Oberkirchenrat Dieter Lutz, zu dessen Dezernat u.a. der Bereich
Gebäudeverwaltung gehört, unterstreicht: „Wir haben bisher schon
viele Einzelmaßnahmen zur Energieeinsparung umgesetzt. Mit der
systematischen Herangehensweise des Grünen Gockels ist es möglich,
neue Einsparpotentiale zu erschließen.“
 Der
„Grüne Gockel“ hilft kirchlichen Einrichtungen,
Energieeinsparpotenziale zu erkennen, sich energiesparend zu
verhalten und sinnvolle Investitionen zu planen. Erfahrungen von
zertifizierten Kirchengemeinden hätten gezeigt, dass der
Ressourcenverbrauch allein durch Veränderung des Nutzerverhaltens
dauerhaft um zehn bis 20 Prozent gesenkt werden könne, sagt die
Umweltbeauftragte der Landeskirche, Bärbel Schäfer. Die
Umweltauswirkungen in den Bereichen Energieverbrauch, Mobilität,
Beschaffung und Abfall systematisch zu erfassen und Möglichkeiten
des Einsparens zu erkennen und zu bewerten seien u.a. wichtige
Bausteine des Umweltmanagements.
Der
„Grüne Gockel“ hilft kirchlichen Einrichtungen,
Energieeinsparpotenziale zu erkennen, sich energiesparend zu
verhalten und sinnvolle Investitionen zu planen. Erfahrungen von
zertifizierten Kirchengemeinden hätten gezeigt, dass der
Ressourcenverbrauch allein durch Veränderung des Nutzerverhaltens
dauerhaft um zehn bis 20 Prozent gesenkt werden könne, sagt die
Umweltbeauftragte der Landeskirche, Bärbel Schäfer. Die
Umweltauswirkungen in den Bereichen Energieverbrauch, Mobilität,
Beschaffung und Abfall systematisch zu erfassen und Möglichkeiten
des Einsparens zu erkennen und zu bewerten seien u.a. wichtige
Bausteine des Umweltmanagements.
Barbara Klüting und die landeskirchliche Klimaschutzmanagerin
Sibylle Wiesemann, die auch im Umweltteam ist, unterstreichen, dass
der Prozess bis zur Zertifizierung mit dem Grünen Gockel von Anfang
an auf Beteiligung setze. „Energiesparendes Verhalten gelingt
gerade dann, wenn alle mitmachen.“ Im Herbst will der
Landeskirchenrat ein Umweltprogramm mit konkreten Maßnahmen
auflegen und ein „Grüne-Gockel-Forum“ für die Mitarbeiter
durchführen. Im Dezember soll eine Umwelterklärung folgen, die
Zertifizierung durch einen externen Umweltprüfer sei für Anfang
2017 vorgesehen.
Hinweis: Der „Grüne Gockel“ ist eine für Kirchengemeinden
und kirchliche Einrichtungen entwickelte Form des Umweltmanagements
auf den Grundlagen der EU-Verordnung „emas“ (Eco Management and
Audit Scheme). Mehr zum Thema im Internet unter www.frieden-umwelt-pfalz.de
(Umwelt und Klimaschutz) und www.gruener-gockel.de.
Text und Foto: lk
01.08.2016
Bistums- und Heimatkalender für Pfalz und Saarpfalz erschienen
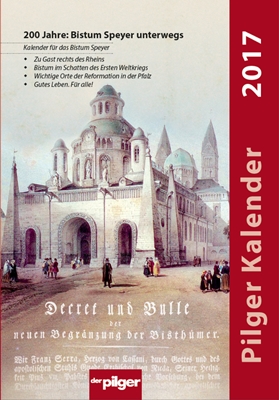 „Pilger-Kalender“ spannt weiten Themenbogen –
Bistumsneugründung vor 200 Jahren ein Schwerpunkt
„Pilger-Kalender“ spannt weiten Themenbogen –
Bistumsneugründung vor 200 Jahren ein Schwerpunkt
Speyer- Um Zukunft zu gestalten, muss man die
Vergangenheit kennen. Das ist eine wichtige Erfahrung. Daher
beleuchtet der jetzt vorliegende “Pilger-Kalender 2017” nicht nur
die Vergangenheit, sondern widmet sich einem Zukunftsthema der
Menschheit. "Gutes Leben. Für alle!" lautete das Motto einer
Kampagne, mit der die kirchlichen Initiatoren bewusstes und
nachhaltiges Leben in den Blick rücken und fördern wollen. Der
Pilger-Kalender beleuchtet aus verschiedenen Perspektiven diese
Kampagne sowie ihre Ziele und verbindet dies mit konkreten
Beispielen und Vorschlägen. Der Speyerer Bischof Karl-Heinz
Wiesemann schlägt in einem Beitrag den Bogen zu Papst Franziskus
und seiner Umwelt-Enzyklika "Laudato si".
Den Blick in die Geschichte wendet der Pilger-Kalender zunächst
“500 Jahre Reformation in der Pfalz” zu. Der evangelische
Oberkirchenrat a. D. Klaus Bümlein beschreibt, wie die Reformation
das Gesicht dieser Region veränderte. Weil das heutige Bistum
Speyer im nächsten Jahr sein 200-jähriges Bestehen feiern kann,
legt der Kalender mit mehreren Beiträgen einen Schwerpunkt darauf.
Hans Ammerich, früherer Leiter des Bistumsarchivs, schildert die
Umstände der Bistumsneugründung in den Jahren nach 1817. Die
Situation vor 100 Jahren, mitten im Weltkrieg, beleuchtet
Priesterkandidat Dominik Schindler mit dem Beitrag "Das Bistum
Speyer im Ersten Weltkrieg". Zum großen Themenbogen des
Pilger-Kalenders 2017 gehört außerdem ein Essay von Friedrich
Kardinal Wetter, dem früheren Speyerer und Münchener (Erz-)Bischof,
in dem er der Frage nachgeht: Wo ist Heimat?
Der Pilger-Kalender erscheint 2017 bereits im 96. Jahrgang. Er
gehört damit zu den traditionsreichsten Veröffentlichungen in der
Pfalz und Saarpfalz. Der Pilger-Kalender für 2017 wurde wieder
unter dem Dach der Peregrinus GmbH von der Redaktion “der pilger”,
der Speyerer Bistumszeitung, erstellt. Der Kalender zählt mehr als
140 Seiten, enthält viele farbige Illustrationen sowie ein
informatives Kalendarium.
Bestellt werden kann er für 4,80 Euro (zzgl. Porto und
Verpackung) bei Peregrinus GmbH, Hasenpfuhlstraße 33, 67346 Speyer,
Telefon 06232/31830, E-Mail: info@pilger-speyer.de.
19.07.2016
Die Zeichen stehen auf „ökumenisch“
 Gisela Scherer, Christoph Resch, das neue ökumenische Team für Schule und Kirche in Kaiserslautern
Gisela Scherer, Christoph Resch, das neue ökumenische Team für Schule und Kirche in Kaiserslautern
Kooperation von Bistum und Landeskirche für Schule und
Fortbildung
Speyer- Die Religionspädagogische Arbeitsstelle
(RPA) in Maria Schutz in der Bismarckstraße Kaiserslautern hat zum
Ende des Schuljahres ihre Türen geschlossen und beginnt die
Zusammenarbeit mit dem evangelischen Religionspädagogischen Zentrum
in der Innenstadt. Oberstudienrat im Kirchendienst Christoph Resch,
Leiter der RPA, arbeitet für das Bistum Speyer nun mit der
Evangelischen Landeskirche der Pfalz zusammen. In Kaiserslautern
soll ein gemeinsames Projekt für die Religionspädagogik
wachsen.
Die Zeichen stehen auf „ökumenisch“, so die beiden
Verantwortlichen vor Ort, Gisela Scherer, auf evangelischer Seite
und Christoph Resch katholischerseits. Viele Kundinnen und Kunden
der kirchlichen Arbeitsstellen kennen und nutzen bereits beide
Angebote, Bücher auszuleihen, sich für den Unterricht beraten zu
lassen, Material für Kinder- oder Schulgottesdienste zu sichten.
Regionale Fortbildungstermine des Bistums und der Landeskirche
werden nun ab dem neuen Schuljahr 2016/17 im Heinz-Wilhelmy-Haus in
Kaiserslautern stattfinden. Die beiden Lehrer Scherer und Resch
erhoffen sich durch die Zusammenarbeit vor allem einen Gewinn für
die Kunden, wozu langfristig vielleicht auch erweiterte
Öffnungszeiten gehören könnten.
Die Schulabteilungen der Diözese Speyer und der Evangelischen
Landeskirche der Pfalz starten damit einen Prozess ökumenischer
Zusammenarbeit. Die Verantwortlichen haben Wunsch und Willen zu
weiterer Kooperation auf dem Gebiet der Fortbildungen und auch in
der Planung und Aufstellung der Unterstützungszentren von beiden
Seiten geäußert und unterstrichen. Oberkirchenrat Dr. Michael
Gärtner und Domdekan Dr. Christoph Kohl sehen als Verantwortliche
darin einen wegweisenden Schritt.
Auch in Ludwigshafen stehen Veränderungen an: Das evangelische
Religionspädagogische Zentrum verlässt im Herbst 2016 Ludwigshafen,
wo unter Federführung der Diözese eine Religionspädagogische
Arbeitsstelle (RPA) als ökumenisches Projekt öffnen wird.
RPAs gibt es dann an vier Standorten in Pfalz und Saarpfalz,
evangelischerseits sieben Religionspädagogische Zentren im gleichen
Gebiet. Kaiserslautern und Ludwigshafen sollen in Zukunft gemeinsam
angegangen werden, „in einem detaillierten und kreativen Prozess
unter Mitwirkung der Beteiligten, die ihre Arbeit selbst am besten
kennen“, fassen Kirchenrat Thomas Niederberger und Schulrätin Dr.
Irina Kreusch, als Projektleitende zusammen. Dies sei eine große
Chance, da das Gebiet von Landeskirche und Bistum deckungsgleich
sei, ein Alleinstellungsmerkmal im deutschlandweiten
Vergleich. Text und Foto: is
16.07.2016
Kirchenpräsident ruft zum Gebet für die Anschlagsopfer von Nizza auf
 Solidarität gilt den Angehörigen – Tränen sind die äußeren
Zeichen unseres Mitgefühls
Solidarität gilt den Angehörigen – Tränen sind die äußeren
Zeichen unseres Mitgefühls
Speyer- Der Anschlag in Nizza erschüttert mich
tief. An dem Tag, an dem unsere Nachbarn und Freunde in Frankreich
die Errungenschaften der Freiheit, der Gleichheit und der
Brüderlichkeit gefeiert haben, wurden 84 Menschen getötet, mehrere
hundert verletzt. Sie wurden Opfer einer barbarischen Tat. Als
Christen tragen wir unsere Klage vor Gott.
Unsere Trauer macht uns stumm. Unsere Tränen sind die äußeren
Zeichen unseres Mitgefühls. Unsere Solidarität gilt den Angehörigen
der Opfer. Mögen ihnen Menschen zur Seite stehen, die helfen,
trösten, zuhören oder einfach nur mit weinen.
Das Kreuz Christi hilft uns Glaubenden, trotz dieses
entsetzlichen Mordens weiterzuleben und die Hoffnung nicht zu
verlieren. Es erinnert an die Zusage Jesu, ganz besonders in den
schweren Stunden des Lebens bei uns zu sein. Kommen wir zusammen
und beten wir für die Opfer und ihre Angehörigen.
Fürbitte:
Kein Wort, das das Entsetzen ausdrücken kann.
Über 80 ermordete Menschen in Nizza, hunderte Verletzte.
Hasserfüllte Gewalt.
Ewiger Gott,
wir beten für die Toten.
Lass sie geborgen sein bei dir.
Sei bei den Betroffenen, den Trauernden und Verzweifelten.
Gib ihnen Halt, Kraft und Liebe.
Schenke ihnen Menschen,
die in ihrem Schmerz und in ihrer Trauer bei ihnen sind.
Wir bitten um Stärke für die Krankenschwestern,
die Ärztinnen und Ärzte und Helfer,
die sich um sie kümmern.
Öffne die Menschen in Europa dafür,
sich nicht vom Hass spalten zu lassen,
sondern für den Frieden zusammen zu stehen.
Schenke den Politikern und Verantwortlichen
die Klugheit, die Herzensbildung und Weitsicht,
dem Frieden und dem Leben der Menschen zu dienen.
Gott, wir haben Angst.
Der Terror hört nicht auf.
Schütze uns auf unseren Straßen und Plätzen,
auf unseren Reisen und Wegen.
Schütze unsere Kinder,
die uns ihre Lebensfreude schenken.
Schütze unsere Jugendlichen,
die mit Zuversicht und Tatkraft die Weichen in ihrem Leben
stellen.
Schütze Frauen und Männer,
die jeden Tag ihr Bestes geben.
Gott,
wir bitten dich für die, die vom Hass zerfressen sind:
Reiß die Mauern um die Herzen der Menschen ein,
die verlernt haben, zu lieben,
die verlernt haben, die Würde der Menschen zu achten,
die verlernt haben, dem Leben zu dienen.
Gott des Friedens und der Liebe, bleib bei uns,
bleib bei denen, die deinen Trost in ihrer Trauer jetzt ganz
besonders nötig haben.
Amen.
Text und Foto: EVANGELISCHE KIRCHE DER PFALZ
15.07.2016
Tod und Begräbnis Rudolfs von Habsburg vor 725 Jahren
 Epitaph Rudolfs von Habsburgs im Dom zu Speyer
Epitaph Rudolfs von Habsburgs im Dom zu Speyer
Grabstätte und zahlreiche bildliche Darstellungen im Dom zu
Speyer
Speyer- Am 15. Juli 1291 starb Rudolf von
Habsburg in Speyer. Ein Relief am Bronzeportal des Speyerer Doms
zeigt ihn, wie er gebeugt auf seinem Pferd sitzt. Er befand sich in
Germersheim, als ihm die Ärzte seinen nahen Tod verkündeten und
ritt selbst nach Speyer, wo er im Dom begraben sein wollte. Damit
wurde die Grablege der Salier um den Begräbnisplatz eines
Herrschers aus dem Hause Habsburg erweitert und wurde in der Folge
zur transdynastischen Reichsgrablege.
Das Begräbnis Rudolfs von Habsburg fand am 18. Juli 1291 im Dom
statt. In unmittelbarer Nähe seines Grabes befindet sich heute ein
Epitaph, also ein Grabdenkmal, mit einer lebensnahen Darstellung
Rudolfs. Es wurde vermutlich schon vor seinem Tod angefertigt und
zeigt den König mit seinen Insignien Krone, Zepter und Reichsapfel
– stehend auf einem Löwen, dem Symbol der Macht. Das Gesicht zeigt
die für die Habsburger charakteristische markante Nase und ist vom
Alter und von den Sorgen des Herrschers gezeichnet. Im Mittelalter
waren solche lebensgetreuen Darstellungen unüblich; in der Regel
zeigten Herrscherbilder den Typ des jugendlichen Königs in der
Blüte seiner Jahre ohne persönliche Erkennungsmerkmale. Daher ist
diese lebensgetreue Darstellung ein ganz besonderes Bildzeugnis
eines mittelalterlichen Herrschers.
In der Vorhalle des Doms befindet sich ein großes Standbild des
Königs aus weißem Marmor, geschaffen von Ludwig Schwanthaler im
Jahr 1843. Daneben ist dort eine Nischenskulptur Rudolfs sowie drei
Lunettenreliefs zu finden, die Szenen aus dem Leben des Herrschers
zeigen. Text: is; Foto: Renate Deckers-Matzko © Domkapitel
Speyer
15.07.2016
Mehr öffentliche Domführungen in Speyer
 Zweiter Termin am
Samstag aufgrund starker Nachfrage
Zweiter Termin am
Samstag aufgrund starker Nachfrage
Speyer- Seit rund zwei Jahren gibt es am Dom zu
Speyer das Angebot einer öffentlichen Domführung. Aufgrund der
großen Nachfrage wird dieses Angebot nun ausgeweitet:
Individualbesucher, Paare und Familien sind eingeladen, samstags um
11 Uhr oder neu auch um 14 Uhr gemeinsam die romanische Kathedrale
und UNESCO-Welterbestätte zu erkunden. Der Rundgang in der
Begleitung eines versierten Domführers dauert etwa eine Stunde. Als
Kostenbeitrag werden 7,50 Euro, ermäßigt 4 Euro, erhoben. Der
Eintritt zur Krypta und den Kaisergräbern ist darin enthalten.
Treffpunkt ist am Dom-Besucherzentrum im südlichen Domgarten, wo am
Tag der Führung ein Ticket erhältlich ist. Vorreservierungen sind
nicht möglich. Führungen für Gruppen können vorab über das Büro für
Domführungen gebucht werden.
Führungsangebote rund um den Speyerer Dom
Jährlich besuchen rund eine Million Menschen den Speyerer
Dom. Das Domkapitel bietet diesen Besuchern verschiedene
Möglichkeiten, die Kathedrale kennen zu lernen. Etwa 1200
Domführungen finden jährlich für angemeldete Gruppen statt. Neben
einer Führung durch Dom und Krypta gibt es eine Anzahl weiterer
Angebote, wie einer Führung durch den Kaisersaal oder
Kombiführungen Dom und Stadt, sowie Dom und Domschatzkammer.
Weitere Informationen zum Führungsangebot sind im
Dom-Besucherzentrum oder unter www.dom-zu-speyer.de erhältlich.
Text: is; Foto: spk Archiv
14.07.2016
Dazu beitragen, dass Leben gelingt
 Die Erzieherinnen und Erzieher mit Lehrkräften und Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter (vorn rechts).
Die Erzieherinnen und Erzieher mit Lehrkräften und Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter (vorn rechts).
Examen an der Fachschule für Sozialwesen
Speyer- 114 Schülerinnen und Schüler der
Diakonissen Fachschule für Sozialwesen haben in dieser Woche ihre
Abschlüsse in den Bildungsgängen Sozialpädagogik und Höhere
Berufsfachschule Sozialassistenz gefeiert.
90 Erzieherinnen und Erzieher haben am 12. Juli ihre Examen an
der Diakonissen Fachschule für Sozialwesen gefeiert, bereits einen
Tag zuvor erhielten 24 staatlich geprüfte Sozialassistentinnen und
–assistenten ihre Zeugnisse. Elf von ihnen haben zugleich ihre
Fachhochschulreife erlangt.
In der zweijährigen Ausbildung zum Sozialassistenten bzw. der
dreijährigen Erzieherausbildung hätten sich die Schülerinnen und
Schüler dem Abenteuer des Lernens hingegeben und seien in ihrer
Persönlichkeit gewachsen, so Schulleiter Pfarrer Matthias Kreiter.
Nun seien sie bereit, „Menschenkinder stark zu machen und zum
erfüllten Leben zu befähigen“, erklärte Kreiter: „Sie wollen
anderen Menschen zugetan sein, ihnen helfen zu leben, zu lernen,
menschlich zu sein.“
 Der
Schulleiter bedankte sich bei den Diakonissen Speyer-Mannheim als
Träger der Fachschule: „Damit eine gute Ausbildung gelingen kann,
ist es wichtig, im Hintergrund einen Träger zu wissen, der die
Bedeutung von Ausbildung und Schule kennt und seine Schule fördert
und unterstützt.“ Im Namen des Trägers gratulierte Vorsteher
Pfarrer Dr. Günter Geisthardt den Absolventinnen und Absolventen.
Sie könnten als Erzieherinnen und Sozialassistenten „dazu
beitragen, dass Leben gelingt: Ihr eigenes und das anderer“,
betonte Geisthardt. Im Rahmen der Veranstaltung dankte er gemeinsam
mit Kollegen und Schülern dem Leiter des Ausbildungszentrums
Michael Wendelken für sein jahrelanges Engagement für die Schulen
der Diakonissen Speyer-Mannheim: Er wird künftig für die
Personalentwicklung Gesundheit und Soziales im Unternehmen
verantwortlich sein.
Der
Schulleiter bedankte sich bei den Diakonissen Speyer-Mannheim als
Träger der Fachschule: „Damit eine gute Ausbildung gelingen kann,
ist es wichtig, im Hintergrund einen Träger zu wissen, der die
Bedeutung von Ausbildung und Schule kennt und seine Schule fördert
und unterstützt.“ Im Namen des Trägers gratulierte Vorsteher
Pfarrer Dr. Günter Geisthardt den Absolventinnen und Absolventen.
Sie könnten als Erzieherinnen und Sozialassistenten „dazu
beitragen, dass Leben gelingt: Ihr eigenes und das anderer“,
betonte Geisthardt. Im Rahmen der Veranstaltung dankte er gemeinsam
mit Kollegen und Schülern dem Leiter des Ausbildungszentrums
Michael Wendelken für sein jahrelanges Engagement für die Schulen
der Diakonissen Speyer-Mannheim: Er wird künftig für die
Personalentwicklung Gesundheit und Soziales im Unternehmen
verantwortlich sein.
Für den Förderverein der Fachschule gratulierte seine
Vorsitzende Hannelore Heidelberger, die die Erzieherinnen Laura
Sponheimer und Janina Guckuk sowie Sozialassistentin Theresa
Moßbacher für die besten Zeugnisse auszeichnete. Informationen zur
Ausbildung: www.diakonissen.de
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
14.07.2016
Protestantische Kindertagesstätten erhalten Klimasiegel
Klima-Kita: Große Bühne für kleine Umweltschützer
Speyer/Frankenthal- „Kleiner Daumen –
große Wirkung“: 15 protestantische Kindertagesstätten im Bereich
der Evangelischen Kirche der Pfalz werden am Donnerstag, 14. Juli,
für ihre Teilnahme am Projekt Klimaschutz im Kindergarten von der
Energieagentur Rheinland-Pfalz und der Metropolregion Rhein-Neckar
mit dem Klimasiegel „Wir machen mit!“ ausgezeichnet.
Während der Projektphase von Februar bis Juli konnten die Kinder
spielerisch lernen, wie sie durch ihr Alltagsverhalten in der Kita
oder zu Hause das Klima schützen können, erklärt Sibylle Wiesemann
von der landeskirchlichen Arbeitsstelle Frieden und Umwelt. Die
Teilnahme an dem Projekt ist Teil der Klimaschutzinitiative der
Landeskirche, wonach der Ausstoß des klimaschädlichen Gases
Kohlendioxid (CO₂) bis 2020 um 40 Prozent (gemessen am Basisjahr
2005) reduziert werden soll.
Umweltfreundlich mobil sein, Wasser und Energie sparen: Nicht
nur die Kleinen, auch die Großen wurden in Sachen Klimaschutz
geschult: „Klimaschutz funktioniert überall. Zum Beispiel kann mit
Verhaltensänderungen und einer richtig eingestellten Heizungsanlage
in den meisten Kindergärten sicherlich 20 Prozent Energie
eingespart werden“, sagt Klimaschutzmanagerin Wiesemann, die im
Rahmen des Projekts für die Weiterbildung der Erzieherinnen und
Erzieher zuständig war.
Folgende Kitas im Bereich der Landeskirche erhalten das
Klimasiegel:
Beindersheim: Arche Noah
Bockenheim: Evangelische Kindertagesstätte
Ellerstadt: Protestantische Kindertagesstätte Regenbogen
Hochdorf-Assenheim: Protestantisches Haus für Kinder
Kaiserslautern: Protestantische Kindertagesstätte Lämmchesberg;
Protestantische Kita Kindergartenstraße; Protestantische
Kindertagesstätte Betzenberg
Ludwigshafen-Friesenheim: Protestantischer
Paulus-Kindergarten
Offenbach: Protestantische Kindertagesstätte
Rodenbach: Protestantischer Kindergarten
Waldsee: Protestantische Integrative Kita Regenbogen
Weisenheim am Sand: Protestantische Kindertagesstätte
Wörth: Johann-Friedrich Oberlin Kindergarten;
Friedenskindergarten
Zweibrücken: Evangelische Kita und Hort Rimschweiler
Hinweis: Die Abschlussveranstaltung des Projekts „kleiner
Daumen – große Wirkung: Klimaschutz im Kindergarten“ mit Verleihung
des Klimaschutzsiegels findet am 14. Juli, ab 17 Uhr in der
Städtischen Kindertagesstätte Haydnstraße in Frankenthal statt.
lk
13.07.2016
Kaiserliche Ehejubiläen
 Grabkrone der Kaiserin Gisela, Kupfer
Grabkrone der Kaiserin Gisela, Kupfer
Am 13. Juli 2016 jährt sich die Eheschließung von Kaiserin
Bertha und Kaiser Heinrich IV. zum 950. Mal – Kaiserin Gisela und
Kaiser Konrad II. 2016 1000 Jahre lang verheiratet
Speyer- Neben den bekannten Kaisern und Königen
sind im Dom zu Speyer auch drei Kaiserinnen begraben. Zwei von
ihnen, Gisela von Schwaben und Bertha von Savoyen, feiern 2016
runde Ehejubiläen. Nicht nur deshalb lohnt ein Blick auf diese
bedeutenden, aber oft vergessenen Frauen.
Zum 950. Mal jährt sich am 13. Juli die Hochzeit von Heinrich
IV. mit Bertha von Savoyen. Heinrich IV., der Enkel von Gisela und
Konrad II., wurde schon 1155 im Alter von fünf Jahren mit der
damals dreijährigen Bertha verlobt; am 13. Juli 1066 fand in
Würzburg die Hochzeit statt.
Während Bertha ihrem Mann von Beginn an treu zur Seite stand,
begegnete Heinrich, dem eine einigermaßen ausschweifende Jugend
nachgesagt wird, seiner Frau zunächst nur mit Widerwillen und
strebte schließlich sogar die Ehescheidung an. Dabei gab er als
Begründung an, Abneigung gegen seine Ehefrau zu empfinden und die
Ehe mit ihr daher noch nicht vollzogen zu haben. Erst als der Papst
mit Exkommunikation und der Verweigerung der Kaiserkrönung drohte,
lenkte Heinrich ein und scheint sich dann offenbar in sein
Schicksal gefügt zu haben, denn in den nächsten Jahren wurden in
rascher Folge vier Kinder geboren. Fortan war Bertha meist an
Heinrichs Seite und begleitete ihren Mann im Winter 1076/77 auch
auf seinem beschwerlichen und gefährlichen Weg über die Alpen nach
Canossa. Ein zeitgenössischer Chronist berichtet, dass Bertha und
die anderen Damen ihres Gefolges auf Kuhhäuten die vereisten Hänge
herabgezogen wurden – wo Heinrich mit seinem berühmten Bußgang
Papst Gregor VII. dazu bewegte, den über ihn verhängten Kirchenbann
zu lösen.
Am Ostersonntag 1084 wurde Bertha an der Seite ihres Mannes in
Rom zur Kaiserin gekrönt. Zwei Jahre später erblickte noch ein
Nachzügler, der später Kaiser Heinrich V., das Licht der Welt; 1087
verstarb Bertha in Mainz. Da der Speyerer Dom seit 1082 auf
Initiative Heinrichs IV. grundlegend umgebaut wurde, wurde Bertha
zunächst im Mainzer Dom bestattet. Erst 1090 wurde sie nach Speyer
überführt und in der Grablege im Speyerer Dom beigesetzt.
Vor 1000 Jahren heiratete Gisela von Schwaben Konrad
II.
Im Jahr 1016, also vor 1000 Jahren, heiratete Gisela von
Schwaben den späteren Kaiser und Begründer des Doms zu Speyer,
Konrad II. Das genaue Datum der Eheschließung ist nicht bekannt.
Umstritten ist auch Giselas Geburtsjahr, doch geht die Forschung
heute davon aus, dass sie um das Jahr 990 geboren wurde. Damit war
sie etwa gleich alt wie ihr Gatte, doch war sie zum Zeitpunkt der
Hochzeit bereits zum zweiten Mal verwitwet und Mutter von
mindestens drei Kindern. Gisela stammte aus einer hochadeligen
Familie und Zeitgenossen rühmen ihre hohe Bildung ebenso wie ihre
außergewöhnliche Schönheit. Die Ehe mit der vermögenden und aus
bestem Haus stammenden Gisela bedeutete für Konrad, dessen Krönung
zum König damals noch nicht abzusehen war, eine glänzende Partie,
wenngleich die Verbindung aufgrund der zu nahen Verwandtschaft –
beide hatten mit Heinrich I. einen gemeinsamen Vorfahren –
kirchenrechtlich anfechtbar war. 1024 wurde Gisela als Konrads
Gattin zur Königin und 1027 in Rom zur Kaiserin gekrönt und nahm
fortan an den Regierungsgeschäften ihres Mannes lebhaften Anteil.
An Bildung war sie ihrem Mann, von dem sein eigener
Hofgeschichtsschreiber sagte, er sei Zeit seines Lebens ein König
ohne Kenntnis der letterae, der Buchstaben, geblieben,
vermutlich deutlich überlegen. So verwundert es nicht, dass sie als
eine seiner einflussreichsten Beraterinnen gilt. Auch an der
Erziehung und Ausbildung ihres 1017 geborenen und schon als Kind
zum Thronfolger designierten Sohnes Heinrich III. war Gisela
entscheidend beteiligt. Zudem setzte ihr Onkel Rudolf III. von
Burgund durch ihre Vermittlung Konrad II. zu seinem Erben ein, so
dass nach dessen kinderlosen Tod auch Burgund an das Reich fiel und
Konrad II. und Gisela fortan über Deutschland, Italien und Burgund
herrschten.
Gisela starb 1043 in Goslar und wurde im Dom zu Speyer
beigesetzt. Die kupferne Grabkrone, eine beschriftete Bleiplatte
aus ihrem Grab sowie einige blonde Haarsträhnen der Kaiserin sind
heute in der Domschatzkammer im Historischen Museum der Pfalz zu
sehen.
Die Gräber der beiden Kaiserinnen sind von der Krypta des Doms
aus zugänglich. Anlässlich der Jahrestage ihrer Eheschließungen
werden ihre Gräber am 13. Juli mit einem besonderen Blumenschmuck
versehen.
Text: Friederike Walter Foto: Domschatz im
Historischen Museum der Pfalz, H.-G. Merkel
11.07.2016
40 Kundschafter verreisen im Auftrag des Bistums
 Auf der Suche nach neuen pastoralen Impulsen
weltweit
Auf der Suche nach neuen pastoralen Impulsen
weltweit
Speyer- 40 haupt- und ehrenamtlich Aktive
werden in diesem und nächsten Jahr als Kundschafter im Auftrag des
Bistums verreisen. Ihre Ziele sind Nicaragua, die Philippinen,
Südafrika und England. Jetzt haben sie sich erstmals getroffen und
wurden von der Arbeitsgemeinschaft „Lokale Kirchenentwicklung“ über
den Ablauf der Reisen, ihre Intentionen und die damit verbundenen
Aufgaben informiert.
Domkapitular Franz Vogelgesang berichtete zunächst von seinen
persönlichen Erlebnissen auf den Philippinen und in England und wie
er dort gespürt habe: „Da ist was anders, eine große Freude und
Fröhlichkeit.“ Das habe ihn neugierig gemacht auf das, was
dahintersteckt. Als wichtige Elemente habe er unter anderem den
Dialog und die partizipative Kirche ausgemacht. Aufgabe der
„Kundschafter“ bei ihren Reisen sei es daher, mehr über das
kirchliche Leben in den vier Ländern zu erfahren, es zu
reflektieren und anschließend einzubringen für die weitere
Entwicklung des Bistums. Denn die Kundschafterreisen, das machte
Vogelgesang deutlich, sind „ganz eng verbunden mit der
Gemeindepastoral 2015.“
Die 40 Reisenden bestehen aus 20 Tandems, diese jeweils aus
einem Haupt- und einem Ehrenamtlichen aus einer Pfarrei oder einer
kirchlichen Einrichtung. Sie kommen aus allen Teilen des Bistums
und haben ähnliche Motivationen dafür, dass sie sich als
Kundschafter beworben haben: Sie wollen lebendige Kirche erleben,
Ideen und neue pastorale Impulse finden und sind natürlich auch
neugierig auf die anderen Länder. Dass ihre Reise ganz sicher keine
„Urlaubsreise“ wird, das machte Dr. Peter Hundertmark, der die
Reisegruppe nach England begleiten wird, in seinen Ausführungen
deutlich. Er stimmte die Kundschafter darauf ein, dass sie
vielfältige Eindrücke sammeln werden, die nicht einfach auf die
Situation im Bistum übertragbar sein werden. In der Gruppe der
England-Reisenden bereitete er unter anderem darauf vor, „dass Sie
genauso viel von Scheitern und Problemen hören werden wie von
Erfolgen.“
Bei allen Gruppen werde es einen strukturierten
Tagesablauf geben: beginnend mit einem Morgenimpuls, der den Fokus
auf ein Thema richten wird, das in diesem Tag wichtig ist. Am Abend
wird der Prozess der Reflexion und des Transfers in Kleingruppen
stattfinden, aber jeder einzelne Teilnehmer wird auch ein
Lerntagebuch führen. „Rechnen Sie damit, dass Sie für diese Arbeit
jeden Tag gut eineinhalb Stunden aufwenden müssen“, bereitete
Hundertmark die Teilnehmer vor.
Damit die Ergebnisse der Reisen am Ende nicht nur aus Memos und
Reisetagebüchern bestehen, wird es weitere Treffen geben: Ende Mai
2017 mit allen Kundschaftern, wenn alle Ergebnisse gebündelt
vorgestellt und diskutiert werden – unter dem Aspekt, welche
Inhalte in Pfarreien oder in der Diözese umgesetzt werden können.
Beim Pastoraltag im November 2017 werden die Kundschafter ebenfalls
von ihren Erfahrungen berichten und sie mit den pastoralen
Mitarbeitern des Bistums diskutieren.
Ein Teil des ersten Treffens der Kundschafter bestand natürlich
auch aus organisatorischen Fragen: Wie sieht es mit Versicherungen
aus, welche Impfungen sind notwendig, wie organisiert das Bistum
die Reisen? Die einzelnen Reisegruppen werden sich noch einmal
treffen für weitere Vorbereitungen und Hintergrundinformationen.
Die erste Gruppe bricht bereits in diesem Jahr auf: Ende November
nach Nicaragua.
Weitere Informationen zu den Kundschafterreisen:
http://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?tx_ttnews[tt_news]=1290&cHash=51fc315ebdc558299220654d9dffb263
Text und Foto: Brigitte Deiters
11.07.2016
Aussendung in den seelsorglichen Dienst
 Vor Beginn des Aussendungsgottesdienstes in der Domsakristei (von links): Melanie Müller, Katrin Ziebarth, Weihbischof Otto Georgens, Christoph Raupach, Katja Kirsch und Diözesanreferent Matthias Zech.
Vor Beginn des Aussendungsgottesdienstes in der Domsakristei (von links): Melanie Müller, Katrin Ziebarth, Weihbischof Otto Georgens, Christoph Raupach, Katja Kirsch und Diözesanreferent Matthias Zech.
Beauftragungsfeier für vier Pastoralassistenten mit
Weihbischof Georgens im Speyerer Dom
Speyer: Im Rahmen eines feierlichen
Gottesdienstes im Speyerer Dom hat Weihbischof Otto Georgens am
heutigen Sonntag drei Frauen und einen Mann zum pastoralen Dienst
im Bistum Speyer beauftragt: Katja Kirsch aus Hochspeyer, Katrin
Ziebarth aus Weingarten, Melanie Müller aus Landau und Christoph
Raupach aus Rohrbach. Sich in den Dienst der Kirche, in den
pastoralen Dienst des Bistums zu stellen, bedeute, sich in den
Dienst Gottes zu stellen, erklärte Weihbischof Georgens zu Beginn
des Gottesdienstes. Er forderte die Pastoralassistenten dazu auf,
„Botinnen und Boten der Barmherzigkeit Gottes“ zu sein.
 In
seiner Predigt erinnerte Georgens daran, dass in allen großen
Religionen Gott nicht am Menschen vorbei handele, sondern
„Mitliebende“ brauche und Menschen „für sich in Dienst“ nehme. Der
Weihbischof verwies auf das Evangelium vom barmherzigen Samariter.
Die Frage eines Schriftgelehrten nach dem richtigen Weg zum ewigen
Leben beantworte Jesus mit dieser Geschichte über ein Beispiel
tatkräftiger Nächstenliebe. Er mache damit deutlich, dass es in
jeder Situation darum gehe, barmherzig zu handeln. „Das heißt, es
kommt entscheidend auf dich selbst an. Du musst die Augen
aufmachen, dann wirst du lauter Menschen entdecken, die deine Hilfe
brauchen", so der Weihbischof. Und es stecke auch „eine gehörige
Portion Kirchenkritik“ in dem Gleichnis, wenn beschrieben werde,
dass gerade Priester und Levit keine Hilfe leisteten. Georgens
warnte deshalb davor „den kirchlichen Betrieb und seine
reibungslose Abwicklung für das Wichtigste zu halten“ und deswegen
den Kern der Botschaft Jesu zu vergessen: „Die erbarmende Liebe,
das Mitleiden mit allen Gequälten, die spontane Bereitschaft zur
Hilfe“. Ob ein Christ fromm sei oder nicht entscheide sich in
seinem Umgang mit demjenigen, dem er begegne und der ihn
brauche.
In
seiner Predigt erinnerte Georgens daran, dass in allen großen
Religionen Gott nicht am Menschen vorbei handele, sondern
„Mitliebende“ brauche und Menschen „für sich in Dienst“ nehme. Der
Weihbischof verwies auf das Evangelium vom barmherzigen Samariter.
Die Frage eines Schriftgelehrten nach dem richtigen Weg zum ewigen
Leben beantworte Jesus mit dieser Geschichte über ein Beispiel
tatkräftiger Nächstenliebe. Er mache damit deutlich, dass es in
jeder Situation darum gehe, barmherzig zu handeln. „Das heißt, es
kommt entscheidend auf dich selbst an. Du musst die Augen
aufmachen, dann wirst du lauter Menschen entdecken, die deine Hilfe
brauchen", so der Weihbischof. Und es stecke auch „eine gehörige
Portion Kirchenkritik“ in dem Gleichnis, wenn beschrieben werde,
dass gerade Priester und Levit keine Hilfe leisteten. Georgens
warnte deshalb davor „den kirchlichen Betrieb und seine
reibungslose Abwicklung für das Wichtigste zu halten“ und deswegen
den Kern der Botschaft Jesu zu vergessen: „Die erbarmende Liebe,
das Mitleiden mit allen Gequälten, die spontane Bereitschaft zur
Hilfe“. Ob ein Christ fromm sei oder nicht entscheide sich in
seinem Umgang mit demjenigen, dem er begegne und der ihn
brauche.
 Mit einem
Handschlag und der Überreichung der Heiligen Schrift sandte
Weihbischof Georgens die vier Beauftragten an ihre erste Stelle
aus, die sie zum 1. August antreten. Katja Kirsch (28), die ihre
Praktikumszeit während des zweijährigen Pastoralkurses in der
Pfarrei Heiliger Bruder Konrad in Martinshöhe absolvierte, wird als
Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Remigius in Kusel tätig
sein. Melanie Müller (30) wird in der Pfarrei Heilige Katharina von
Alexandria in Hauenstein arbeiten. Sie war während der
pastoralpraktischen Ausbildung in der Gemeinde Kaiserslautern St.
Maria und – unterbrochen durch ein Jahr Elternzeit – in Neustadt
St. Marien tätig. Für Katrin Ziebarth (38) beginnt der Einsatz im
pastoralen Dienst nach ihrer Praktikumszeit, die sie in der Pfarrei
Heilig Kreuz in Gersheim absolvierte, jetzt in der ehemaligen
Projektpfarrei Franz von Assisi in Queidersbach. Die Wirkungsstätte
von Christoph Raupach (52), der während seines Praktikums in der
Pfarrei Heiliger Christophorus in Wörth arbeitete, wird die Pfarrei
Seliger Paul Josef Nardini in Pirmasens sein.
Mit einem
Handschlag und der Überreichung der Heiligen Schrift sandte
Weihbischof Georgens die vier Beauftragten an ihre erste Stelle
aus, die sie zum 1. August antreten. Katja Kirsch (28), die ihre
Praktikumszeit während des zweijährigen Pastoralkurses in der
Pfarrei Heiliger Bruder Konrad in Martinshöhe absolvierte, wird als
Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Remigius in Kusel tätig
sein. Melanie Müller (30) wird in der Pfarrei Heilige Katharina von
Alexandria in Hauenstein arbeiten. Sie war während der
pastoralpraktischen Ausbildung in der Gemeinde Kaiserslautern St.
Maria und – unterbrochen durch ein Jahr Elternzeit – in Neustadt
St. Marien tätig. Für Katrin Ziebarth (38) beginnt der Einsatz im
pastoralen Dienst nach ihrer Praktikumszeit, die sie in der Pfarrei
Heilig Kreuz in Gersheim absolvierte, jetzt in der ehemaligen
Projektpfarrei Franz von Assisi in Queidersbach. Die Wirkungsstätte
von Christoph Raupach (52), der während seines Praktikums in der
Pfarrei Heiliger Christophorus in Wörth arbeitete, wird die Pfarrei
Seliger Paul Josef Nardini in Pirmasens sein.
Alle vier Pastoralassistenten haben an der Universität Mainz
Theologie studiert.
 Musikalisch gestaltet
wurde der Gottesdienst vom Mädchenchor, den Domsingknaben und dem
Domchor unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller. An der Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub.
Musikalisch gestaltet
wurde der Gottesdienst vom Mädchenchor, den Domsingknaben und dem
Domchor unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller. An der Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub.
Konzelebranten der feierlichen Messe waren Generalvikar Dr. Franz
Jung, Domdekan Dr. Christoph Kohl, Domkapitular Josef Szuba, Regens
Markus Magin, Spiritual Markus Horbach und Neupriester Walter
Höcky. Aus den Praktikumspfarreien der vier Pastoralassistenten
nahmen zahlreiche Ministrantinnen und Ministranten teil sowie
Kolleginnen und Kollegen der Beauftragten.
Insgesamt gibt es im Bistum Speyer zurzeit 108
Pastoralassistenten/-referenten. Etwa die Hälfte ist in der
Pfarrseelsorge tätig, rund ein Drittel als Religionslehrerin oder
Religionslehrer, die übrigen arbeiten in der außerordentlichen
Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen oder als
Bildungsreferenten und in der kirchlichen Verwaltung. Die
Pastoralassistenten erhalten ihre Ausbildung im Theologiestudium an
einer Universität und in einem zweijährigen pastoralpraktischen
Kurs im Priesterseminar in Speyer. Nach der Beauftragung folgt
zunächst eine dreijährige Tätigkeit als Pastoralassistent, bevor
ihnen nach der zweiten Dienstprüfung der Titel Pastoralreferent
verliehen wird. Text und Foto: is:
10.07.2016
Über 1.600 Besucher bei der Ausstellung Flucht weltweit
 Land, Kommunen und Kirche vereint zum Thema Flucht und Integration: (v.l.n.r.) missio-Begleiter Tété Agbodan, Schulrätin Irina Kreusch, Ministerpräsidentin Annette Kramp-Karrenbauer, Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer, Dekan Andreas Sturm, Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener, Gertrud Fickinger (KEB), Steffen Glombitza, AK Asyl, Sandy Will, kommunale Frauenbeauftragte und Michael Krischer, missio.
Land, Kommunen und Kirche vereint zum Thema Flucht und Integration: (v.l.n.r.) missio-Begleiter Tété Agbodan, Schulrätin Irina Kreusch, Ministerpräsidentin Annette Kramp-Karrenbauer, Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer, Dekan Andreas Sturm, Bürgermeisterin Annelie Faber-Wegener, Gertrud Fickinger (KEB), Steffen Glombitza, AK Asyl, Sandy Will, kommunale Frauenbeauftragte und Michael Krischer, missio.
Bistum Speyer und Caritasverband ziehen positive Bilanz zu
zweiwöchiger Tour des Missio Trucks durch die Pfalz und den
Saarpfalzkreis
Speyer- 14 Tage, 10 Standorte, über 1.600 Besucherinnen und
Besucher – das ist die rein zahlenmäßige Bilanz der Aktion „Flucht
weltweit“ im Bistum Speyer, die am Freitagabend in Neustadt zu Ende
gegangen ist. Vom 25. Juni bis 8. Juli war der missio-Truck, eine
multimediale Ausstellung des Internationalen Katholischen
Hilfswerks Missio, im gesamten Bistum unterwegs. Vor allem Schüler-
und Jugendgruppen besuchten die Mit-Mach-Ausstellung und
informierten sich damit über Fluchtursachen. Regionale Angebote der
Caritas und örtliche Arbeitskreise unterstützten die Aktion.
Der große Truck war für manchen Schulhof und Innenstadt eine
Herausforderung. Umso größer war das Staunen der Schüler, wenn sie
morgens vor Schulbeginn den LKW vor ihrer Schule stehen sahen.
Direkt waren die pädagogischen Begleiter, Caritas-Mitarbeiter und
Gruppen im Gespräch vor der Landkarte, die an der Truck-Tür stand.
Wo ist der Kongo, wo Syrien? Manche Jugendliche, die selbst
geflüchtet waren, zeigten ihren Weg der Flucht. Andere waren
erstaunt, wieviel das Leben woanders mit dem eigenen zu tun hat,
zum Beispiel durch das eigene Konsumverhalten und Handy, dessen
Wertstoffe durch Sklavenarbeit im Kongo gewonnen werden. „Das hätte
ich nicht gedacht, dass eine Flucht so schlimm ist. Ich kann mir
das einfach nicht vorstellen“ berichtet eine Schülerin aus
Otterberg.
Ziel der Aktion war es, mit Menschen zum Thema Flucht und
Integration ins Gespräch zu kommen und zu sensibilisieren. „Viele
Fragen, Sorgen und Ängste kommen zum Vorschein, wenn man mit
Interessierten und Neugierigen dazu spricht“, erklärt Bernward
Hellmanns, der als Caritas-Experte zum Thema seit langem genau
diese Fragen kennt.
In der Eröffnung in Speyer betonte Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann, dass Menschen hinter den Zahlen stünden. Dass der Truck
und die Aktion auch politisch hohe Aufmerksamkeit fanden, erfreut
die Initiatorin des Projektes Dr. Irina Kreusch von der
Bischöflichen Schulabteilung besonders: „Wir konnten in Speyer die
neue Integrationsministerin Anne Spiegel begrüßen, die ihre
Hochachtung vor dem kirchlichen Einsatz aussprach.“ Die kirchlichen
Angebote des Projekts „Flucht weltweit“ sind an den Schulen sehr
gut angenommen worden, neue Kontakte und Aktionen sind entstanden.
Auch der Besuch der saarländischen Ministerpräsidentin Annegret
Kramp-Karrenbauer in Blieskastel gemeinsam mit dem
Caritas-Vorsitzenden Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer und ihr Dank
an die Ehrenamtlichen ermutigte viele Engagierte. Bildung zeige
sich als Lebensorientierung und geschehe von Mensch zu Mensch, zog
auch Erhard Steiger von der Katholischen Erwachsenenbildung positiv
Bilanz.
Der Dank der Organisatoren - der Bischöflichen Schulabteilung,
der Caritas und der Katholischen Erwachsenenbildung – geht an alle
Beteiligten, die den Truck vor Ort begleitet haben, ebenso wie an
die beiden Fahrer Christian Janson und Martin Wasem, beide
Mitarbeiter von Mercedes Benz, die den Truck ehrenamtlich gefahren
und damit die Aktion „Flucht weltweit“ in die Pfalz und den
Saarpfalzkreis gebracht haben. „Der schwergewichtige
Publikumsmagnet Missio-Truck zu einem schweren Thema hat damit vor
der Haustür zum Besuch eingeladen“, so Irina Kreusch, die von
intensiven Gesprächen und vielen neuen Anstößen in den zwei Wochen
der Tour berichtet. So habe eine Besucherin aus Speyer nach dem
Besuch der Ausstellung direkt gefragt: „Was kann ich tun?“
Weitere Informationen: www.teile-und-helfe.de
Text: is; Foto: Daum
09.07.2016
Flüchtlinge auf der Suche nach einer neuen Heimat – auch im Glauben
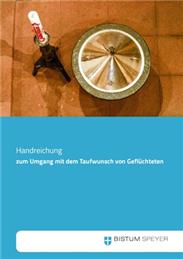 Bischöfliches Ordinariat gibt Handreichung zum
Umgang mit dem Taufwunsch von Geflüchteten heraus
Bischöfliches Ordinariat gibt Handreichung zum
Umgang mit dem Taufwunsch von Geflüchteten heraus
Speyer- In den Pfarreien des Bistums
Speyer fragen zurzeit verstärkt Menschen mit Fluchterfahrung nach
der Taufe. Das Bischöfliche Ordinariat hat jetzt für die Pfarreien
eine Handreichung zum Umgang mit dem Taufwunsch von Geflüchteten
herausgegeben. „Sie soll den Pfarrern und den pastoralen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine erste Orientierung bieten“,
erklärt der Leiter der Hauptabteilung Seelsorge Domkapitular Franz
Vogelgesang.
.jpg) Gab es in den
vergangenen Jahren nur vereinzelt muslimische Taufbewerber, so ist
ihre Zahl inzwischen angestiegen. „Viele Flüchtlinge sind auf der
Suche nach einer neuen Heimat – auch im Glauben“, erklärt
Vogelgesang. Für manche von ihnen gehörte der im Herkunftsland
nicht realisierbare Wunsch, sich taufen zu lassen und erkennbar als
Christ zu leben, zu den Gründen, die Heimat zu verlassen. In den
Pfarreien sorge das Interesse am christlichen Glauben einerseits
für Freude. Andererseits bestehe die Angst, „etwas falsch zu machen
oder in den Verdacht zu geraten, die Situation der Flüchtlinge mit
meist muslimischem Hintergrund ausnutzen oder sie gar bekehren zu
wollen.“ Neben den sprachlichen und kulturellen Hürden gebe es auch
rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Taufe, die nicht
leicht zu beantworten seien.
Gab es in den
vergangenen Jahren nur vereinzelt muslimische Taufbewerber, so ist
ihre Zahl inzwischen angestiegen. „Viele Flüchtlinge sind auf der
Suche nach einer neuen Heimat – auch im Glauben“, erklärt
Vogelgesang. Für manche von ihnen gehörte der im Herkunftsland
nicht realisierbare Wunsch, sich taufen zu lassen und erkennbar als
Christ zu leben, zu den Gründen, die Heimat zu verlassen. In den
Pfarreien sorge das Interesse am christlichen Glauben einerseits
für Freude. Andererseits bestehe die Angst, „etwas falsch zu machen
oder in den Verdacht zu geraten, die Situation der Flüchtlinge mit
meist muslimischem Hintergrund ausnutzen oder sie gar bekehren zu
wollen.“ Neben den sprachlichen und kulturellen Hürden gebe es auch
rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Taufe, die nicht
leicht zu beantworten seien.
.jpg) Das Bistum
Speyer und seine Pfarreien bewerteten den Taufwunsch von
Flüchtlingen grundsätzlich nicht anders als den Taufwunsch jedes
anderen Erwachsenen, macht Vogelgesang deutlich. „Wer im
Erwachsenenalter Christ werden möchte, hat in einer
Vorbereitungszeit von etwa einem Jahr die Möglichkeit, schrittweise
in den christlichen Glauben hineinzuwachsen.“ Dabei werden auch die
Beweggründe für den Übertritt und die Konsequenzen dieser
Entscheidung reflektiert. Die Vorbereitung findet in einer
Katechumenatsgruppe oder in Einzelgesprächen mit einem Seelsorger
statt. Den Höhepunkt bildet die Tauffeier, häufig in der
Osternacht, in der der Taufbewerber durch die Spendung der
Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie in die volle
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wird.
Das Bistum
Speyer und seine Pfarreien bewerteten den Taufwunsch von
Flüchtlingen grundsätzlich nicht anders als den Taufwunsch jedes
anderen Erwachsenen, macht Vogelgesang deutlich. „Wer im
Erwachsenenalter Christ werden möchte, hat in einer
Vorbereitungszeit von etwa einem Jahr die Möglichkeit, schrittweise
in den christlichen Glauben hineinzuwachsen.“ Dabei werden auch die
Beweggründe für den Übertritt und die Konsequenzen dieser
Entscheidung reflektiert. Die Vorbereitung findet in einer
Katechumenatsgruppe oder in Einzelgesprächen mit einem Seelsorger
statt. Den Höhepunkt bildet die Tauffeier, häufig in der
Osternacht, in der der Taufbewerber durch die Spendung der
Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie in die volle
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wird.
„Mit unserer Handreichung wollen wir Mut machen, Interessenten
auf ihrem Weg zu einer fundierten Entscheidung zu unterstützen und
sie bei der Vorbereitung auf die Taufe zu begleiten“, hebt
Vogelgesang hervor. Auf rund 30 Seiten werden unter anderem die
wichtigsten Schritte auf dem Weg zur Taufe beschrieben und auch
rechtliche Fragen beantwortet. Außerdem bietet die Broschüre
Informationen zur Flüchtlingshilfe im Bistum Speyer sowie eine
Übersicht der verschiedenen Ansprechpartner.
Ansprechpartner für die Themen Erwachsenentaufe und
Katechumenat:
Bischöfliches Ordinariat
Hauptabteilung Seelsorge
Felix Goldinger und Walburga Wintergerst
Webergasse 11
67346 Speyer
Telefon: 06232 / 102-286 und -171
E-Mail: katechese@bistum-speyer.de
Bestelladresse für die „Handreichung zum Umgang mit dem
Taufwunsch von Geflüchteten“:
Bischöfliches Ordinariat
Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen
Webergasse 11
67346 Speyer
Telefon: 06232 / 102-314
E-Mail: seelsorge@bistum-speyer.de
Text und Foto: is
08.07.2016
Freiwilligendienste sind für alle ein Gewinn
 Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer schneidet bei Erhebung
sehr gut ab
Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer schneidet bei Erhebung
sehr gut ab
Speyer- Freiwillige, die bundesweit ein
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder einen
Bundesfreiwilligendienst (BFD) über einen der rund 40 katholischen
diözesanen bzw. überregionalen Träger ableisten, sind mit diesem
Dienst in hohem Maße zufrieden. Dies hat die jährliche Befragung
der Freiwilligen sowie der Einsatzstellen im katholischen Bereich
festgestellt. „In der Beurteilung des Freiwilligendienstes
insgesamt zeigt sich besonders, dass der Nutzen für die
Einrichtungen sehr hoch ist und der BDKJ Speyer als Träger eine
hohe Qualität der Bildungsseminare vorzuweisen hat“, erläutert
BDKJ-Diözesanvorsitzende Lena Schmidt.
Hohe Qualität der Begleitung und Organisation des
Freiwilligendienstes in Trägerschaft des BDKJ Speyer
Die Zufriedenheit der Einsatzstellen mit Organisation und
Begleitung durch den Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)
Speyer war besonders groß. Positiv bewerteten die Einsatzstellen
dabei etwa die schnelle Rückmeldung auf Anfragen, die positive
Wirkung der vom BDKJ Speyer angebotenen Bildungsseminare auf die
Entwicklung der Freiwilligen sowie das Konzept des FSJ als
Bildungs- und Orientierungsjahr. Für die Freiwilligen sind die
gesammelten Erfahrungen bedeutende Schritte auf dem weiteren
Lebensweg. Und auch die katholischen Einsatzstellen profitieren
nachweislich von dem freiwilligen Engagement der vielen Menschen.
Dienste und Einrichtungen, die neben ihren hauptberuflichen Kräften
auch Freiwillige einsetzen, bewerten deren Einsatz und Mitwirkung
als außerordentlich bereichernd.
Die Teilnahme an einem Freiwilligendienst ermöglicht Einblicke
in die vielfältigen Felder sozialer Arbeit. Der Anteil der
Freiwilligen, die durch ihren Freiwilligendienst den sozialen und
gemeinwohlorientierten Bereich als späteres Berufsfeld entdecken,
ist signifikant hoch. So beginnen fast 40 Prozent der Freiwilligen
eine Berufsausbildung oder ein Studium im sozialen Bereich.
Individuelle Begleitung von Freiwilligen im Hospiz durch
Referentin für Trauer- und Hospizseelsorge
Dabei setzt der BDKJ Speyer zunehmend auf Einsatzstellen, die
die klassischen Felder von Kindergarten, Schule und Krankenpflege
ergänzen. So freut sich etwa das Team der Hospizes Elias in
Ludwigshafen auf Unterstützung durch Freiwillige. Die Plätze hier
stehen bereits seit einigen Jahren zur Verfügung. Allerdings hatten
bislang nur wenige jungen Menschen die Arbeit in einem Haus für
Sterbende für sich entdecken können. Nun kooperiert der BDKJ in der
Begleitung junger Freiwilliger im Hospiz mit Kerstin Fleischer,
Referentin für Trauer- und Hospizarbeit im Bistum Speyer. „Wir
freuen uns, dass unsere Freiwilligen hier beste Unterstützung und
Begleitung erfahren dürfen. Sie sind in einem Jahr Hospizarbeit
immer auch mit dem eigenen Leben und Sterben konfrontiert. Das
konnten die Freiwilligen, die sich hier bislang ausprobiert haben
für sich nicht bewältigen und haben das Jahr abgebrochen. In der
individuellen Begleitung der Freiwilligen durch Kerstin Fleischer
sehen wir die große Chance, das FSJ für junge Menschen auch und
gerade im Hospiz zu einem Jahr werden zu lassen, in dem sie reifen
und ihren Platz in der Welt finden“, sagt Olivia Auer, Referentin
für Freiwilligendienste beim BDKJ. Sie ist sich sicher, dass das
Hospiz ein guter Ort für junge Freiwillige ist. Davon erzählt auch
Laura. Die 20-jährige aus Lingenfeld hat ihr FSJ bei einem
Jugendverband im BDKJ absolviert und in dieser Zeit einen Tag im
Hospiz Elias verbracht. Von ihren Eindrücken erzählt sie in einem
kurzen Film, mit dem der BDKJ Speyer in den Sozialen Netzwerken auf
die Möglichkeit eines FSJ im Hospiz aufmerksam machen will. Laura
sagt: „Ich habe gemerkt, dass man im Hospiz keine Angst haben muss.
Das ist eher ein Ort, an dem ganz viel gelacht wird.“
Der zweiminütige Film "Zwischen Leben, Sterben und
Lachen" wird aktuell in den Sozialen Netzwerken verbreitet und
steht auf unserer Homepage zur Ansicht bereit: http://www.jugend-bistum-speyer.de/fachreferate/freiwilligendienste.html
Info:
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) und der
Deutsche Caritasverband (DCV) sind bundeszentrale Träger des FSJ
bzw. des BFD. Durch sie und die 39 ihnen angeschlossenen diözesanen
und überregionalen Träger werden derzeit jährlich mehr als 10.000
Freiwillige aller Altersgruppen im Bundesgebiet in einen
Freiwilligendienst vermittelt und während der Dienstzeit fachlich
und pädagogisch begleitet. Einer dieser Träger ist der BDKJ Speyer,
der in Rheinland-Pfalz und im Saarland als Dachverband von sieben
Kinder- und Jugendverbänden die Interessen von 8.000 Mitgliedern in
Kirche, Politik und Gesellschaft vertritt. Mehr: www.bdkj-speyer.de
| freiwilligendienste.bdkj-speyer.de . Das Referat
Trauer- und Hospizarbeit im Bistum Speyer berät, unterstützt und
begleitet haupt- und ehrenamtlich Tätige und schult Multiplikatoren
in der Trauerarbeit. Mehr: http://www.bistum-speyer.de/seelsorge-und-spiritualitaet/hospiz-und-trauerseelsorge/
BDKJ Speyer, Presse
07.07.2016
Bistum veröffentlicht Seelsorgekonzept als Broschüre
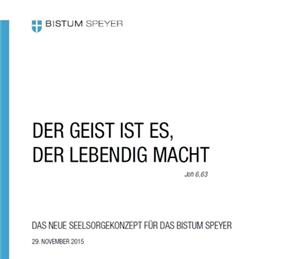 Konzept ist
Ergebnis des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“, der im Jahr 2009
begonnen wurde und zum Jahresende 2015 seinen Abschluss gefunden
hat
Konzept ist
Ergebnis des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“, der im Jahr 2009
begonnen wurde und zum Jahresende 2015 seinen Abschluss gefunden
hat
Speyer- Insgesamt sechs Jahre war daran
gearbeitet worden, am ersten Advent 2015 wurde es in Kraft gesetzt:
Das neue Seelsorgekonzept des Bistums Speyer. Das Bischöfliche
Ordinariat hat es jetzt als Broschüre veröffentlicht. Auf rund 150
Seiten kann man die Ergebnisse des Prozesses „Gemeindepastoral
2015“ jetzt im Detail und in gedruckter Form nachlesen.
„Vernetzung und Transparenz durch Kommunikation sind für eine
kontinuierliche und qualitative Weiterentwicklung unseres Bistums
von größter Bedeutung“, schreibt Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
im Vorwort der Broschüre. Er nennt das Bistum eine „lernende
Gemeinschaft“. Mit dem neuen Seelsorgekonzept beginne der Weg in
die Zukunft. „Ich bin zuversichtlich, dass sich die Mühe dieser
Arbeit lohnen wird“, ermutigt der Bischof die Pfarreien, die nun
ebenfalls pastorale Konzepte ausarbeiten werden.
Das Seelsorgekonzept des Bistums gliedert sich in fünf Kapitel.
Zunächst richtet sich der Blick auf die gegenwärtige Situation
sowie auf die maßgeblichen Entwicklungen in Gesellschaft und Kirche
(Erster Kapitel). Es folgt eine theologische Grundlegung, in der
unter anderem der Sendungsauftrag der Kirche näher beschrieben wird
(Zweites Kapitel). Der visionäre Kern des Konzepts steckt in den
vier leitenden Perspektiven, an der sich die Seelsorge in den
kommenden Jahren ausrichten soll (Drittes Kapitel). Zu ihrer
Umsetzung bedarf es veränderter Strukturen und einer stärkeren
Vernetzung (Viertes Kapitel). Als Orientierung bei der Entwicklung
pastoraler Konzepte in den 70 neuen Pfarreien werden abschließend
Standards für die Seelsorge im Bistum Speyer festgelegt (Fünftes
Kapitel). Dem Text ist ein umfangreiches Quellen- und
Literaturverzeichnis beigegeben. In Form von Anhängen kann man sich
über die neuen Berufsgruppenprofile für die Pfarrseelsorge,
Eckdaten zu den neuen Pfarreien und die Standards für die zentralen
Pfarrbüros informieren.
Unter der Überschrift „Gemeindepastoral 2015“ hatte das Bistum
Speyer im Jahr 2009 einen Erneuerungsprozess begonnen. In insgesamt
sieben Diözesanen Foren haben die diözesanen Räte gemeinsam über
die künftige Ausrichtung der Seelsorge beraten. Mit der
inhaltlichen Erneuerung gingen auch veränderte Strukturen einher.
Zum Beginn des Jahres wurden aus den bisher 346 Pfarrgemeinden 70
neue Pfarreien gebildet. Das Bistum Speyer setzte dabei auf das
Modell der „Pfarrei in Gemeinden“. Die Pfarrei bietet dabei den
größeren Rahmen, in dem die Gemeinschaft im Glauben erfahrbar
wird.
Kontakt für Bestellungen:
Bischöfliches Ordinariat
Kleine Pfaffengasse 16
67346 Speyer
Telefon 06232 / 102-213
info@bistum-speyer.de
Weitere Informationen: www.bistum-speyer.de
Text und Foto: is
05.07.2016
Telefonseelsorge: Rückbesinnung auf die Wurzeln
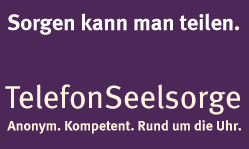 Pfälzische
Einrichtung nimmt an bundesweitem Jubiläum und Weltkongress
teil
Pfälzische
Einrichtung nimmt an bundesweitem Jubiläum und Weltkongress
teil
Kaiserslautern/Berlin/Aachen- Die von der
evangelischen und katholischen Kirche getragene Telefonseelsorge in
Deutschland wird 60 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums findet der
diesjährige Weltkongress der Telefonseelsorge (IFOTES) in
Deutschland statt: Vom 19. bis 22. Juli kommen in Aachen 1.500
Ehrenamtliche aus 28 Ländern zusammen. Darunter ist auch die
ökumenische Telefonseelsorge Pfalz, die sich unter dem Motto „For
life to go on“ (sinngemäß übersetzt „weitermachen für das Leben“)
in Vorträgen und Workshops mit den Möglichkeiten zur Hilfe und
Unterstützung von Menschen in suizidalen Krisen beschäftigt.
Mit dieser Schwerpunktsetzung kehre die Telefonseelsorge
programmatisch zu ihren Wurzeln zurück, nämlich Suizid als
gesellschaftlich verdrängtes Problem aufzugreifen, erklärt Pfarrer
Peter Annweiler von der Telefonseelsorge Pfalz. Die Einrichtung mit
Sitz in Kaiserslautern besteht seit 37 Jahren. Gegründet 1979, wird
sie von der Evangelischen Kirche der Pfalz und der Diözese Speyer
gemeinsam getragen. Mehr als 80 ehrenamtliche Mitarbeiter sorgen
für ein kostenfreies Beratungsangebot, das anonym und rund um die
Uhr erreichbar ist. Pfarrer Peter Annweiler (Evangelische Kirche
der Pfalz) sowie die Pädagogin Astrid Martin und die Psychologin
und Theologin Ursula Adam (Diözese Speyer) leiten die
Telefonseelsorge Pfalz.
Unter dem Namen „Ärztliche Lebensmüdenberatung“ startete 1956 in
Berlin ein Beratungsangebot, das sich bundesweit zu einem
ökumenischen Netzwerk mit über 100 Telefonseelsorge-Stellen
entwickelt hat. Mit sorgfältig ausgewählten und ausgebildeten
ehrenamtlichen Mitarbeitern bietet die Telefonseelsorge als einzige
Organisation ihre Dienste 24 Stunden als sofort erreichbares und
niedrigschwelliges Angebot an. Seit über 20 Jahren sind auch über
Mail und Chat Beratungen zu erhalten.
Das 60. Jubiläum der Telefonseelsorge in Deutschland wird im
Anschluss an den Weltkongress am 23. Juli 2016 mit einem
ökumenischen Gottesdienst im Aachener Dom und einem Festakt im
Krönungssaal des Rathauses gefeiert.
Hinweis: Ein neuer Ausbildungskurs für ehrenamtliche
Mitarbeiter der Telefonseelsorge Pfalz beginnt im Frühjahr 2017.
Dazu findet am 17. Januar 2017 um 19 Uhr ein Informationsabend
statt. Interessenten wenden sich an die Telefonseelsorge Pfalz,
E-Mail: info@telefonseelsorge-pfalz.de.
Mehr zum Thema: www.telefonseelsorge-pfalz.de
und www.ifotescongress2016.org.
Gebührenfreies Notruftelefon: 0800 111 0 111 und 0800 111 0 222.
Text: lk/is; Foto: Telefonseelsorge Pfalz
04.07.2016
Für die gleiche Würde jedes Menschen
 Kirchenpräsident Schad hat im Berliner Dom gepredigt –
Thema: Taufe und neues Leben
Kirchenpräsident Schad hat im Berliner Dom gepredigt –
Thema: Taufe und neues Leben
Berlin- Der pfälzische Kirchenpräsident
und Vorsitzende der Union Evangelischer Kirchen (UEK), Christian
Schad, hat die Christen dazu aufgerufen, Verantwortung zu
übernehmen und sich – auch angesichts des Votums für den Brexit in
Großbritannien – gegen wachsenden Nationalismus und ein Klima
menschlicher Kälte zu wenden.
Mit der Taufe komme es zu einer Schicksalsgemeinschaft mit
Christus. Sie lasse uns schon jetzt Funken zukünftigen
Auferstehungslebens entdecken: „Wann immer wir Liebe erfahren, wann
immer ein Lächeln uns berührt, eine Umarmung, eine streichelnde
Hand, streift uns eine Sekunde lang die Ewigkeit.“ So werde Gottes
Geist spürbar, der verwandelt und beflügelt. Als Konsequenz sei den
Christen auch die Achtung vor dem „Anderssein des Anderen“
aufgetragen, sagte Schad im Gottesdienst im Berliner Dom. „Bezeugen
wir den Geist der Liebe und der Gerechtigkeit, der uns mit der
Taufe geschenkt ist.“ Als Vorsitzender der UEK ist Christian Schad
„Hausherr“ der größten Kirche Berlins.
In den Mittelpunkt seiner Predigt stellte der Kirchenpräsident
einen Abschnitt aus dem Brief des Apostels Paulus an die Römer
(Kapitel 6, Verse 3-8), in dem es inhaltlich um Taufe und neues
Leben geht. „Die Zuwendung Gottes, aus der wir leben, macht uns
frei. Sie ruft auf zur Wachsamkeit gegenüber falschen, allzu
einfachen Parolen und zum Einsatz für die gleiche Würde jedes
Menschen“, sagte der Kirchenpräsident. Öffentlich würden derzeit
Menschen, die anders sind, unter Generalverdacht gestellt und
angegriffen. Er erinnerte an Attacken gegen Flüchtlinge und
Asylbewerber sowie die öffentliche Herabsetzung von Migranten.
Diskriminierung und Rassismus seien aber gerade keine Alternative
für Deutschland: „Wenn die Mehrheit zu leise ist, wird die
Minderheit zu laut. Widersetzen wir uns der beginnenden
Unbarmherzigkeit, den Schutzzäunen zwischen den Grenzen und den
wachsenden Mauern in den Köpfen.“
Die Liturgie des Gottesdienstes gestaltete Dompredigerin Petra
Zimmermann. Die Berliner Domkantorei unter der Leitung von
Domkantor Tobias Brommann sowie Domorganist Andreas Sieling führten
die Bachkantate „Die Himmel erzählen die Ehre Gottes“ auf. Der
Berliner Dom ist eine der bedeutendsten protestantischen Kirchen
Deutschlands. Neben regelmäßigen Gottesdiensten und Andachten,
zentralen kirchlichen Fest- und Gedenkveranstaltungen und Feiern
aus politischen Anlässen finden in dem im klassizistischen Stil
errichteten Gebäude auch vielfältige kulturelle Veranstaltungen
statt. lk
03.07.2016
Weihbischof Otto Georgens sendet vier Pastoralassistenten aus
 Die angehenden Pastoralreferenten im Bistum Speyer (von links): Katja Kirsch, Katrin Ziebarth, Melanie Müller und Christoph Raupach.
Die angehenden Pastoralreferenten im Bistum Speyer (von links): Katja Kirsch, Katrin Ziebarth, Melanie Müller und Christoph Raupach.
Beauftragungsfeier am 10. Juli im Dom zu
Speyer
Speyer- Weihbischof Otto Georgens wird am
Sonntag, 10. Juli, die drei Pastoralassistentinnen Katja Kirsch,
Melanie Müller und Katrin Ziebarth und den Pastoralassistenten
Christoph Raupach in den seelsorglichen Dienst im Bistum Speyer
aussenden. Die Beauftragung erfolgt im Rahmen eines feierlichen
Gottesdienstes, der um 10 Uhr beginnt, im Speyerer Dom.
Katja Kirsch stammt aus Hochspeyer und engagierte sich schon als
Jugendliche in der Pfarrei St. Maria in Kaiserslautern unter
anderem als Ministrantin, Lektorin und Kommunionhelferin. Nach dem
Abitur studierte die 28-Jährige Theologie in Mainz. Ihre
Praktikumszeit während des zweijährigen Pastoralkurses absolvierte
sie in der Pfarrei Heiliger Bruder Konrad in Martinshöhe. Ab dem 1.
August wird sie als Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger
Remigius in Kusel tätig sein.
Melanie Müller wurde in Bad Dürkheim geboren. Auch sie
engagierte sich bereits in ihrer Kindheit und Jugend in ihrer
Heimatpfarrei St. Margaretha im Bad Dürkheimer Stadtteil Grethen
als Messdienerin und bei der Katholischen Jungen Gemeinde (KJG) als
Gruppen- und Pfarrleiterin sowie auf Diözesanebene. Auch in der
Firmvorbereitung und im Pfarrgemeinderat brachte sich die heute
30-Jährige ein. Ihr Theologie-Studium schloss sie ebenfalls an der
Universität Mainz ab. Die pastoralpraktische Ausbildung absolvierte
sie in der Gemeinde Kaiserslautern St. Maria und – unterbrochen
durch ein Jahr Elternzeit – in Neustadt St. Marien. Ab 1. August
arbeitet die Mutter eines zweijährigen Sohnes und einer
siebenjährigen Tochter, die mit ihrer Familie in Landau lebt, in
der Pfarrei Heilige Katharina von Alexandria in Hauenstein.
Katrin Ziebarth aus Weingarten absolvierte nach dem Abitur
zunächst ein duales Theorie-Praxis-Studium an der Berufsakademie in
Mannheim. Sie arbeitete anschließend beim CJD in Dortmund, später
in der Buchhaltung des St. Marien-Krankenhauses in Ludwigshafen und
danach als Verwaltungsleiterin in der ökumenischen Sozialstation in
Landau. Ehrenamtlich engagierte sie sich als Firm- und
Kommunionkatechetin und als Lektorin in ihrer Pfarrei. Ab 2010
studierte sie in Mainz Theologie. Ihre Praktikumszeit verbrachte
die 38-Jährige in der Pfarrei Heilig Kreuz in Gersheim. Im August
beginnt ihr Einsatz in der ehemaligen Projektpfarrei Franz von
Assisi in Queidersbach.
Der gebürtige Ingelheimer Christoph Raupach wohnt in Rohrbach.
Bis 2009 war der verheiratete Vater zweier erwachsener Töchter als
Rechtsanwalt mit eigener Kanzlei tätig. Ehrenamtlich engagierte er
sich in seiner Heimatpfarrei im Pfarrgemeinde- und Verwaltungsrat
und in der Firmvorbereitung. Nach dem Entschluss zum Berufswechsel
absolvierte Raupach in Mainz sein Theologiestudium. In seiner
Praktikumszeit während des zweijährigen Pastoralkurses war der
52-jährige Jurist in der Pfarrei Heiliger Christophorus in Wörth
tätig. Ab dem 1. August ist seine Wirkungsstätte die Pfarrei
Seliger Paul Josef Nardini in Pirmasens.
Insgesamt gibt es im Bistum Speyer zurzeit 108
Pastoralassistenten/-referenten. Etwa die Hälfte ist in der
Pfarrseelsorge tätig, rund ein Drittel als Religionslehrerin oder
Religionslehrer, die übrigen arbeiten in der außerordentlichen
Seelsorge in Krankenhäusern und Gefängnissen oder als
Bildungsreferenten und in der kirchlichen Verwaltung. Die
Pastoralassistenten erhalten ihre Ausbildung im Theologiestudium an
einer Universität und in einem zweijährigen pastoralpraktischen
Kurs im Priesterseminar in Speyer. Nach der Beauftragung folgt
zunächst eine zweijährige Tätigkeit als Pastoralassistent, bevor
ihnen nach der zweiten Dienstprüfung der Titel Pastoralreferent
verliehen wird.
Außerdem sind im Bistum zurzeit 124 Gemeindeassistenten/-referenten
tätig. Gemeindeassistenten studieren drei Jahre an einer Hochschule
für Praktische Theologie oder an einer Fachakademie und absolvieren
ein Praxisjahr in einer Gemeinde.
Interessenten an den beiden pastoralen Berufen erhalten Auskünfte
bei der Beratungs- und Informationsstelle "Berufe
der Kirche", Pfarrer Ralf Feix, Telefon 0 62 32/10 23 37, sowie
im Bischöflichen Ordinariat Speyer bei den Verantwortlichen für die
beiden Berufsgruppen, Matthias Zech (Pastoralreferent(inn)en),
Telefon 0 62 32/10 23 54, und Marianne Steffen
(Gemeindereferent(inn)en), Telefon 0 62 32/10 23 22. Text:
is; Foto: Klaus Landry
01.07.2016
„Barmherzigkeit kennt keine Obergrenze“
Leitungsgremien der Evangelischen Kirche der Pfalz und des
Bistums Speyer treffen sich zu jährlichem Austausch in Ludwigshafen
– Impulsreferat von Weihbischof Ulrich Boom aus Würzburg

Ludwigshafen- (is/lk). Am 28. Juni
sind die Leitungsgremien der Evangelischen Kirche der Pfalz und des
Bistums Speyer zu ihrem jährlichen Austausch zusammengekommen. Im
Mittelpunkt des Treffens im Heinrich-Pesch-Haus in Ludwigshafen
stand das Thema Barmherzigkeit.
„Barmherzigkeit ist der Schlüssel, um unsere verhärteten Herzen
aufzuschließen“, betonte Weihbischof Ulrich Boom aus Würzburg, der
als Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für das Heilige
Jahr der Barmherzigkeit ein Impulsreferat hielt. Die Barmherzigkeit
umschrieb er als das „Bauchgefühl Gottes“. Barmherzigkeit und
Gerechtigkeit stünden nicht im Gegensatz, sondern seien
Geschwister: „Gott ist der Vater, der nicht richtet, sondern
aufrichtet.“ Seine Barmherzigkeit werde vor allem in Jesus
offenbar. Er weise den Menschen „den kleinen Weg zur großen
Heiligkeit“. Dabei gehe es vorrangig um Aufmerksamkeit in
alltäglichen Dingen, nicht um „große Heldentaten“. Papst Franziskus
habe mit dem Stichwort Barmherzigkeit einen „Nerv der Zeit“
getroffen. Angesichts weltweiter Ungerechtigkeiten und
Fluchtbewegungen unterstrich Boom: „Barmherzigkeit kennt keine
Obergrenze.“
Barmherzigkeit ist ein Schlüsselwort für die Gesellschaft, ein
notwendiges Korrektiv zu Tendenzen der Verhärtung und der
„Tribunalisierung“: Darin waren sich die Leitungsgremien beider
Kirchen einig. Zugleich sei sie ein Anstoß, um über die Gestalt von
Kirche nachzudenken. Der Austausch führte zu der Frage, wie nicht
nur der einzelne Christ, sondern wie die Kirche als Ganzes
barmherzig sein kann.
Im Blick auf den ökumenischen Dialog wurde eine große Nähe
zwischen der Barmherzigkeit und dem Kern der Rechtfertigungslehre
gesehen. „Die Menschenwürde muss nicht verdient werden, sondern ist
ursprünglich gegeben“, hob Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hervor.
Damit stelle das Heilige Jahr der Barmherzigkeit eine gute Brücke
zur Erinnerung an den Beginn der Reformation vor 500 Jahren dar.
„Das Reformationsjubiläum im kommenden Jahr wollen wir als
Christusfest im ökumenischen Geist begehen“, lud Kirchenpräsident
Christian Schad die Christen anderer Konfessionen zum Mitfeiern
ein. Dazu werde es eine Reihe von Veranstaltungen geben, unter
anderem einen ökumenischen Versöhnungsgottesdienst in der
Abteikirche von Otterberg am 12. März 2017 unter dem Leitwort
„Healing of memories – Die Erinnerungen heilen“.
30.06.2016
Lasst uns gemeinsam feiern
 Speyer- Unter diesem Motto hat letztes Wochenende
die katholische Gemeinde St. Konrad in Speyer Nord zum
traditionellen Gemeindefest eingeladen.
Speyer- Unter diesem Motto hat letztes Wochenende
die katholische Gemeinde St. Konrad in Speyer Nord zum
traditionellen Gemeindefest eingeladen.
Pünktlich um 18.00 Uhr mit Beginn des Eröffnungsgottesdienstes,
hatte das Wetter ein einsehen. Der Regen hörte auf und so
konnten die Bänke und Tische trocknen.
Der Eröffnungsgottesdienst wurde musikalisch gestaltet vom
Kirchenchor St. Konrad, der u.a. die Messe in F-Dur für Chor und
Orgel von Joseph Friedrich Hummel sowie die Motette „Wie lieblich
sind deine Wohnungen“ von Johann Herrmann Schein sang. Kaplan
Christoph Hartmüller wurde von Diakon Klaus Hilzensauer und Don
Giuliano Gandini aus der Diözese Verona unterstützt, der die
anwesende Gruppe des Freundeskreises Speyer-Pomposa begleitete.
 Nach dem
Gottesdienst erfreuten sich alle Gäste an dem reichhaltigen
Angebot. Bei Bratwurst, Spießbraten, Pommes Frites und weiteren
Pfälzer Spezialitäten wurde Geselligkeit gelebt. Auf Empfehlung der
Bierprofis Speyer, zum ersten Mal eine große Auswahl an
verschiedenen Biersorten angeboten. Die Bierprofis sind aus einer
Gruppenstunde der Pfarrei St. Konrad entstanden und testen seit
1989 weltweit Biere. Aktuell bereits über 7950 Stück. Ihre
Empfehlungen, alles Biere mit Bestnoten, kamen bei den Besuchern
sehr gut an. Der Cocktailstand erfreute sich großer Beliebtheit.
Der italienische Rotwein, der vom Freundeskreis Ravenna angeboten
wurde, war nicht nur bei den Italienischen Gästen aus Pomposa auf
den Tischen zu finden.
Nach dem
Gottesdienst erfreuten sich alle Gäste an dem reichhaltigen
Angebot. Bei Bratwurst, Spießbraten, Pommes Frites und weiteren
Pfälzer Spezialitäten wurde Geselligkeit gelebt. Auf Empfehlung der
Bierprofis Speyer, zum ersten Mal eine große Auswahl an
verschiedenen Biersorten angeboten. Die Bierprofis sind aus einer
Gruppenstunde der Pfarrei St. Konrad entstanden und testen seit
1989 weltweit Biere. Aktuell bereits über 7950 Stück. Ihre
Empfehlungen, alles Biere mit Bestnoten, kamen bei den Besuchern
sehr gut an. Der Cocktailstand erfreute sich großer Beliebtheit.
Der italienische Rotwein, der vom Freundeskreis Ravenna angeboten
wurde, war nicht nur bei den Italienischen Gästen aus Pomposa auf
den Tischen zu finden.
Der zweite Teil des Gemeindefestes am Sonntagmorgen wurde mit
einem Festgottesdienst eröffnet, der thematisch unter dem
Regenbogen stand. Der vom Musikprojekt laudes aus Maxdorf
begleitete Gottesdienst begeisterte im vollbesetzten Gotteshaus
nicht nur die Pfadfinder, die an diesem Tag auch ihren Stammestag
feierten.
 Im Anschluss an
den Gottesdienst feierten die Besucher bei sonnigem Wetter im
Pfarrhof weiter. Jung und Alt informierte sich im Garten des
Pfarrhauses über die Geschichte, Arbeit und Angebote der
Pfadfinder. Für Kinder boten diese ein interessantes Stationsspiel,
welches viel Anklang fand. Am Nachmittag sang sich Rainbow, ein
Chor der Chorgemeinschaft Speyer, in die Herzen der Besucher. Bei
Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Gartenbroten und weiteren
Leckereien von der Frauengemeinschaft, Spießbraten, gebackenem
Schafskäse und weiteren Spezialitäten verlebten die Gäste einen
sonnigen und unterhaltsamen Nachmittag.
Im Anschluss an
den Gottesdienst feierten die Besucher bei sonnigem Wetter im
Pfarrhof weiter. Jung und Alt informierte sich im Garten des
Pfarrhauses über die Geschichte, Arbeit und Angebote der
Pfadfinder. Für Kinder boten diese ein interessantes Stationsspiel,
welches viel Anklang fand. Am Nachmittag sang sich Rainbow, ein
Chor der Chorgemeinschaft Speyer, in die Herzen der Besucher. Bei
Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Gartenbroten und weiteren
Leckereien von der Frauengemeinschaft, Spießbraten, gebackenem
Schafskäse und weiteren Spezialitäten verlebten die Gäste einen
sonnigen und unterhaltsamen Nachmittag.
Pfarrer Bender dankte den vielen Helferinnen und Helfer, der
Gruppierungen sowie den Sponsoren, die dieses Fest in dieser Form
überhaupt erst möglich gemacht hatten. Text: Frank Ableiter;
Foto: Oliver Häusler
29.06.2016
Notfallseelsorge: „Die richtige Geste und das gute Wort“
 Im
Aussendungsgottesdienst neben- und ehrenamtliche Notfallseelsorger
beauftragt
Im
Aussendungsgottesdienst neben- und ehrenamtliche Notfallseelsorger
beauftragt
Speyer/Ludwigshafen- (lk). Mit der
Ernennung von 26 nebenamtlichen und sechs ehrenamtlichen neuen
Notfallseelsorgern ist nach den Worten von Oberkirchenrat Gottfried
Müller eine gute Versorgung der Notfallseelsorge in der Pfalz
gewährleistet. In einem Aussendungsgottesdienst für die Pfarrer und
Ehrenamtlichen am Montag in der Ludwigshafener Apostelkirche wiesen
Müller und die Pfarrerin für Polizei- und Notfallseelsorge,
Annegret Henning, auf die funktionierende Zusammenarbeit mit den
Kriseninterventionsteams der Rettungsdienste und der Feuerwehr und
mit der Notfallseelsorge der Diözese Speyer hin.
Notfallseelsorge lasse sich nicht „nach Schema F“ abarbeiten.
„Wichtiger als jeder einstudierte Gesprächsverlauf sind unsere
innere Haltung und das Gespür für die richtige Geste, das gute Wort
oder das solidarische Schweigen im rechten Moment“, hob Henning in
ihrer Predigt hervor. Der Gottesdienst wurde mitgestaltet von
Mitgliedern des Beirats Polizeiseelsorge und dem Beauftragten für
Polizei- und Notfallseelsorge der Diözese Speyer, Patrick Stöbener,
sowie musikalisch von Bezirkskantor Tobias Martin. Grußworte
sprachen der Leiter der Ludwigshafener Berufsfeuerwehr, Peter
Friedrich, sowie Susanne Laun, Leiterin der Abteilung Besondere
Seelsorgebereiche des Bistums Speyer.
Henning ist seit Dezember 2015 hauptamtlich für Polizei- und
Notfallseelsorge in der pfälzischen Landeskirche zuständig. Zu
ihren Aufgaben gehört auch die Fort- und Weiterbildung in der
Notfallseelsorge. Eine Achtsamkeitstagung hat sie neu eingeführt.
Damit versuche sie, auf die Belastungen zu reagieren, denen die
Notfallseelsorger ausgesetzt seien. Für das Ausbildungskonzept
arbeitet Henning eng mit ihrem katholischen Kollegen Patrick
Stöbener zusammen. Dabei gehe es nicht nur um „typische“
Einsatzthemen wie z.B. plötzlicher Kindstod, erfolglose
Reanimation, Suizid oder den Umgang mit Großschadenslagen, erklärt
die Pfarrerin. „Für uns ist auch wichtig, dass die
Notfallseelsorger eine innere Haltung entwickeln, die es ihnen
ermöglicht, in unsicheren und unerwarteten Situationen noch
besonnen denken und handeln zu können.“
Mit den neu Beauftragten sind nach Hennings Angaben in der
pfälzischen Landeskirche nun rund 80 evangelische neben- und
ehrenamtliche Notfallseelsorger in elf Notfallseelsorgesystemen
tätig. Diese könnten noch Verstärkung gebrauchen.
Folgende Personen wurden mit dem Dienst in der
Notfallseelsorge beauftragt:
Ehrenamtlich: Edith Bendl (Grünstadt), Constanze Bruhn
(Ludwigshafen), Dr. Martin Cierjacks (Ludwigshafen), Dennis Erwin
(Eulenbis), Tanja Schraß-Dietrich (Otterbach) und Anna Zeiser
(Enkenbach-Alsenborn).
Nebenamtlich: Pfarrerin Martina Abel (Kaiserslautern),
Pfarrerin Isabell Aulenbacher (Kaiserslautern), Pfarrer Uwe Beck
(Pirmasens), Pfarrerin Reinhild Burgdörfer (Ludwigshafen),
Pfarrerin Susanne Dietrich (Münchweiler), Dekanin Sieglinde
Ganz-Walther (Frankenthal), Pfarrer Tilmann Grabinski
(Kaiserslautern), Pfarrerin Martina Gutzler (Pirmasens), Pfarrer
Hansdieter Heck (Bexbach), Dekan Armin Jung (Neustadt), Pfarrerin
Matthias Jung (Kaiserslautern), Pfarrer Michael Köhl
(Ludwigshafen), Dekanin Barbara Kohlstruck (Ludwigshafen), Pfarrer
Wulf Pippart (Vinningen), Pfarrer Bernd Renner (Pirmasens), Pfarrer
Martin Risch (Landau), Pfarrer Heiko Schipper (Mutterstadt),
Pfarrer Carsten Schulze (Frankenthal), Dekan Matthias Schwarz
(Otterbach), Dekan Lars Stetzenbach (Kusel), Pfarrerin Elke
Wedler-Krüger (Freimersheim), Pfarrerin Corinna Weissmann
(Ludwigshafen), Pfarrerin Katharina Westrich (Kaiserslautern),
Dekanin Dorothee Wüst (Kaiserslautern) und Dekanin Waltraud
Zimmermann-Geisert (Pirmasens).
Mehr zum Thema:
www.evkirchepfalz.de/begleitung-und-hilfe/seelsorge/notfallseelsorge.
28.06.2016
“Die Kirche wird in ihrer Haltung nicht weichen“
 Domdekan Christoph Kohl eröffnet die Podiumsdiskussion im Historischen Museum zum Thema „Flucht. Von weltweit bis in das Bistum Speyer. Ansichten und Aussichten“
Domdekan Christoph Kohl eröffnet die Podiumsdiskussion im Historischen Museum zum Thema „Flucht. Von weltweit bis in das Bistum Speyer. Ansichten und Aussichten“
“Die Kirche wird in ihrer Haltung nicht weichen“
Podiumsdiskussion zum Thema Flucht macht die
Herausforderungen der Integration deutlich – Politik und Kirche
beklagen Verlust von Debattenkultur
Speyer- “Die Kirchen haben sich in der
Flüchtlingsdebatte eindeutig positioniert. Wir stehen an der Seite
geflüchteter Menschen – und natürlich gibt es gegen diese Haltung
auch Widerstände aus den eigenen Reihen.“ Der Speyerer Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemannbekräftigte bei der Podiumsdiskussion zum Thema
„Flucht. Von weltweit bis in das Bistum Speyer. Ansichten und
Aussichten“ am Samstagabend im Historischen Museum Speyer die
Solidarität der Kirche mit Menschen auf der Flucht. Gleichzeitig
äußerte er seine Sorge vor einer Spaltung der deutschen
Gesellschaft.
Integrationsministerin Anne Spiegel, Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann, Dr. Oliver Müller, Leiter von Caritas international und
Torsten Jäger vom Initiativausschuss für Migrationspolitik in
Rheinland-Pfalz stellten sich bei der Diskussion den Fragen der
Moderatorin Dr. Christiane Florin vom Deutschlandfunk. Initiiert
wurde die Veranstaltung im Rahmen des Auftaktes der Tour des
Missio-Trucks von der Schulabteilung des Bischöflichen
Ordinariates, von der Abteilung Katholische Erwachsenenbildung und
vom Caritasverband für die Diözese Speyer.
„Es gibt Ängste in der Gesellschaft und auch innerhalb unserer
Kirche zum Thema Flüchtlinge“, sagte Bischof Wiesemann. „Es
sprechen ja auch nicht alle Kirchen in Europa mit einer Stimme“,
verwies er auf die Kirche in Polen. „Die so genannten
christlich-abendländischen Werte werden als völkisch verkauft, auch
in der innerkirchlichen Debatte.“ Die Kirche in Deutschland habe
sich aber eindeutig an die Seite der geflüchteten Menschen gestellt
und werde in dieser Haltung nicht weichen.
„Wie ehrlich können Sie bei den Kosten der Integration
eigentlich sein, wenn die AfD im Landtag sitzt?“, wollte Florin von
Integrationsministerin Spiegel wissen. Spiegel plädierte für eine
offene und ehrliche Debatte. „Die Menschen sind misstrauisch, sie
stellen berechtigte Fragen. Nur Offenheit führt zu einer
Versachlichung der Diskussion“, so Spiegel. „Fakten scheinen
derzeit aber schwer zu finden zu sein“, wandte Florin ein. „Lehrer
und Erzieher klagen über zu wenig Unterstützung bei der Integration
der Flüchtlingskinder. Die Menschen sind nun schon fast ein Jahr im
Land und die Politik hat noch keine Konzepte zur Integration
vorgelegt.“ Das sah Torsten Jäger anders: „Es gibt schon einen
Wettstreit der Konzepte. Es werden Ideen zum Zugang zu Bildung und
Arbeitsmarkt diskutiert, ob zuerst Willkommensklassen gebildet
werden, oder ob es besser ist, die Kinder gleich in die normalen
Klassen zu integrieren.“ Jäger plädierte eindrücklich dafür, dem
Satz der Bundeskanzlerin Angela Merkel zu folgen. „Wir haben die
Heimatvertriebenen integriert, wir haben die Gastarbeiter
integriert, wir haben die Bosnienflüchtlinge integriert. Wir sind
ein reiches Land und wir schaffen das!“
Die Frage, worin dieses Schaffen bestehe, beantwortete Wiesemann
so: „Es braucht ein Grundvertrauen in die Solidarität unserer
Gesellschaft und das Engagement ihrer Bürger. Und die Menschen
müssen sich berühren lassen von den Schicksalen der geflüchteten.
Der Zuwachs an Ehrenamtlichen, auch in den Pfarreien, macht
Hoffnung.“ Sorge bereite ihm aber die Übernahme populistischer
Paradigmen in der Politik. „Wir müssen uns um Entmythologisierung
bemühen, denn Mythen werden geboren um die Wahrnehmung der Menschen
psychologisch zu verschieben.“ Das sei zum Beispiel geschehen, als
es vor einigen Monaten, als täglich rund 1000 Menschen nach
Rheinland-Pfalz gekommen sind, immer hieß, die Ehrenamtlichen seien
an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen.
Auch die Frage, wieviel Zuwanderung Europa verkrafte, werde
emotional und nicht sachlich geführt. „Was ist denn die Alternative
zur Einwanderung? Wollen wir wirklich, dass die Außengrenzen
Europas zu Gräbern werden, zu Orten, an denen Menschen sterben?“
Ministerin Spiegel sagte, sie wünsche sich ein Einwanderungsgesetz,
dass es Menschen ermöglicht, auf legalem Weg nach Deutschland
einzuwandern, ohne Asyl zu beantragen. Ein Asylrecht, dass
politisch und religiös verfolgte Menschen gegen
Wirtschaftsflüchtlinge abgrenzt, halte sie für problematisch.
„Dass bedeutet aber doch, dass man Menschen nach ihrer Nützlichkeit
sortiert“, wandte Moderatorin Florin ein. Dem widersprach Jäger:
„Ein Einwanderungsgesetz hebelt ja nicht die Genfer
Flüchtlingskonvention aus.“
Zum Thema Fluchtursachen sagte Müller von Caritas international:
„Fluchtursachenbekämpfung als Schlagwort mag ich nicht, weil das
eher transportiert, dass die Flüchtlinge bekämpft werden. Wir
beobachten, dass Flüchtlinge mittlerweile zur Währung werden, mit
denen Regierungen die internationale Gemeinschaft unter Druck
setzen.“ Milliardenschwere Programme sorgten mittlerweile dafür,
dass Binnenflüchtlinge und in Nachbarstaaten geflohene Menschen
eine Bleibeperpektive bekommen. „Aber wir haben große Sorge vor
einem Nachlassen dieser internationalen Bemühungen.“
Auch der Bischof zeigte sich am Ende der Diskussion eher
besorgt. „Die Debattenkultur in unserem Land hat sich
verschlechtert. Manche Diskussionen kann man gar nicht mehr führen,
weil Menschen sich gegen Argumente immunisiert haben. Es fehlt der
Wille zum demokratischen Diskurs. Demokratie ist aber mehr, als nur
wählen.“
In einem waren sich die Podiumsteilnehmer einig: Die Integration
der Flüchtlinge ist die größte politische Herausforderung der
kommenden Jahre und weder Politik noch Kirche dürfen in ihrem
Bemühen darum nachlassen.
Text / Fotos: Caritasverband für die Diözese Speyer /
Bischöfliches Ordinariat
27.06.2016
Tour des Missio-Trucks durch das Bistum Speyer eröffnet
 Gehörten zu den ersten Besuchern der Mitmach-Ausstellung "Menschen auf der Flucht" im Missio-Truck vor dem Speyerer Dom: (untere Reihe von links) Torsten Jäger, Domdekan Dr. Christoph Kohl, Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber, Dr. Oliver Müller, (dahinter von links) Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Caritasdirektor Vinzenz du Bellier, Integrationsministerin Anne Spiegel, Oberbürgermeister Hansjörg Eger und ein Mitarbeiter des Hilfswerks "Missio".
Gehörten zu den ersten Besuchern der Mitmach-Ausstellung "Menschen auf der Flucht" im Missio-Truck vor dem Speyerer Dom: (untere Reihe von links) Torsten Jäger, Domdekan Dr. Christoph Kohl, Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber, Dr. Oliver Müller, (dahinter von links) Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann, Caritasdirektor Vinzenz du Bellier, Integrationsministerin Anne Spiegel, Oberbürgermeister Hansjörg Eger und ein Mitarbeiter des Hilfswerks "Missio".
Bischof Wiesemann, Integrationsministerin Spiegel,
Caritasdirektor du Bellier, Oberbürgermeister Eger und
Missio-Präsident Huber sind erste Besucher der
Mitmach-Ausstellung
Speyer- (is). Ab sofort rollt er durch
das Bistum Speyer: Die Tour des Missio-Trucks mit der
Mitmach-Ausstellung „Menschen auf der Flucht“ an Bord wurde am
Samstag vor dem Speyerer Dom gestartet. Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann, die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne
Spiegel, Caritasdirektor Vinzenz du Bellier, der Speyerer
Oberbürgermeister Hansjörg Eger und Missio-Präsident Monsignore
Wolfgang Huber gaben gemeinsam den Startschuss für die zweiwöchige
Tour. Die Ausstellung wird bis zum 8. Juli an insgesamt zwölf
Standorten in der Pfalz und im Saarpfalzkreis zu sehen sein.
„Beim Thema Flüchtlinge geht nicht um Zahlen, sondern um
Menschen“, betonte Bischof Wiesemann in seiner Eröffnung. „Es ist
wichtig, diese Menschen verstehen zu können, von ihnen zu wissen,
was sie erlebt haben und vor allem auch, warum sie sich auf den Weg
gemacht haben.“ Er erinnerte daran, dass Jesus selbst mit seiner
Familie flüchten musste, und appellierte an alle in der
Gesellschaft, jeden Flüchtling würdig zu behandeln. „Wir wollen
nicht, dass die europäische Grenze eine Todesgrenze ist. Niemand
darf in eine Situation zurückgeschickt werden, in der Krieg und
Verfolgung auf ihn warten.“ Den Christen sei aufgetragen,
füreinander und für Hilfesuchende da zu sein: „Wenn du Christ bist,
dann öffne Deine Tür.“
Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel
zeigte sich von der Ausstellung beeindruckt. „Der Missio-Truck
stellt das Themenfeld Flucht und Asyl multimedial und lebendig dar.
Dadurch bringt er seine Besucherinnen und Besucher ganz nah an die
Schicksale von Menschen heran, die bei uns um Zuflucht bitten“,
erklärte sie. „Ich danke allen Ehren- und Hauptamtlichen, die das
Projekt begleiten und unterstützen, die sich der Flüchtlinge
annehmen und Ihnen ein Ankommen in unserem Land erleichtern.“
„Wir müssen darauf achten, dass Benachteiligte nicht
gegeneinander ausgespielt werden“, unterstrich Caritasdirektor
Vinzenz du Bellier. Teilhabegerechtigkeit sei ein hoher Anspruch.
„Neiddiskussionen“ hingegen zerstörten auf die Dauer die Basis des
Gemeinwesens. Mit der Ausstellung verband er den Wunsch, dass sie
zu einer „inhaltlichen Vertiefung und damit auch zur Versachlichung
der für unsere Gesellschaft so wichtigen Fragen von Flucht und
Migration“ beiträgt.
Flüchtlinge nicht als anonyme, Angst einflößende Masse, sondern
als individuelle Menschen wahrzunehmen: Darin liegt aus Sicht des
Speyerer Oberbürgermeister Hansjörg Eger gegenwärtig die zentrale
Herausforderung, auch im Blick auf die in England vor dem „Brexit“
geführte Debatte. Die Begegnung mit individuellen Einzelschicksalen
ziehe der Angst vor dem zum „Monstrum“ gemachten Thema Flüchtlinge
den Schleier weg.
Beim abschließenden Friedensgebet, gestaltet vom Bund der
Deutschen Katholischen Jugend, richtete sich der Blick nicht nur
auf die Flüchtlinge, sondern auch auf die Menschen, die in ihren
Heimatländern keinen Frieden und keine Perspektiven finden. „Es
wird zu viel über Flüchtlinge geredet, anstatt den Versuch zu
unternehmen, das Geschehen mit ihren Augen zu sehen“, begrüßte die
BDKJ-Vorsitzende Lena Schmidt den Missio-Truck als gute
Möglichkeit, „uns für die Erfahrungen und Sichtweisen der
geflüchteten Menschen die Augen zu öffnen“.
Die Ausstellung setzt stark auf eigene Erfahrung, indem sie die
Besucher in die Lebensgeschichten von acht exemplarisch
ausgewählten Flüchtlingen eintauchen lässt. So muss man zum
Beispiel innerhalb einer Minute entscheiden, welche Gegenstände man
mitnimmt und welche man zurücklässt. Für den Rundgang durch die
sechs Räume der Ausstellung sollte man etwa zwanzig Minuten
einkalkulieren. Man kann den Missio-Truck einzeln oder in Gruppen
besuchen. Schulklassen sind besonders eingeladen. Beim Gang durch
die Ausstellung stehen den Besuchern pädagogische Begleiter von
„missio“ zur Seite.
Diözesane Hilfsaktion „Teile und helfe“ findet großen
Zuspruch
Das Bistum Speyer und sein Caritasverband haben bereits vor zwei
Jahren einen Flüchtlingshilfefonds mit rund 1,5 Millionen Euro
Grundkapital und inzwischen rund 700.000 Euro an weiteren Spenden
eingerichtet. Mit dem Geld wurden beispielsweise 20 zusätzliche
Stellen in der Migrations- und Integrationsberatung geschaffen
sowie rund 60 Sprachkurse finanziert. Rund 2000 Menschen
engagierten sich in der Flüchtlingsarbeit der Pfarreien, von der
Sprachpatenschaft für Kinder, der Begleitung zu Ärzten und Ämtern
bis hin zu internationalen Kochfesten und Fahrradwerkstätten.
Qualifiziert werden die ehrenamtlich Engagierten durch die
Caritas-Zentren in den Dekanaten, wo Flüchtlinge auch durch
hauptamtliche Fachleute vielfältige Hilfe auf dem Weg der
Integration erhalten. Ein Schwerpunkt des Caritasverbandes liegt in
der Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge im Raum
Kaiserslautern und im Landkreis Bad Dürkheim. So haben zum Beispiel
im „Wilensteiner Hof“ bei Trippstadt sieben junge Flüchtlinge
Unterkunft und Beschäftigung gefunden und besuchen inzwischen die
Schule. Zur Unterbringung von Flüchtlingen haben das Bistum Speyer
und seine Pfarreien den Kommunen rund 50 kirchliche Gebäude zur
Verfügung gestellt. Für rund 380 Flüchtlingen konnte dadurch eine
Unterkunft bereitgestellt werden.
Weitere Informationen:
www.bistum-speyer.de
www.teile-und-helfe.de
www.missio.de
Die Tour des Missio-Trucks durch das Bistum Speyer
Die Tour des missio-Trucks durch das Bistum umfasst insgesamt
zwölf Stationen. Für Schulklassen sind Anmeldungen erbeten.
Ansonsten steht der Truck jedem zum Besuch offen. Der Besuch ist
kostenlos.
Speyer
Standort:
Domvorplatz
Öffnungszeiten:
25. Juni, 17:00 Uhr bis 19:00 Uhr
26. Juni, 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr
27. Juni, 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit schulischem Begleitprogramm am
Truck
Frankenthal
Standort:
Berufsbildende Schule, Petersgartenweg 9
Öffnungszeiten:
28. Juni, 7:30 Uhr bis 14:30 Uhr
Rodalben
Standort:
Berufsbildende Schule, Gabelsbergerstraße 6
Öffnungszeiten:
29. Juni, 7:50 Uhr bis 15:00 Uhr
Homburg
Standort:
Johanneum, Kardinal-Wendel-Straße 12
Öffnungszeiten:
30. Juni, Schulzeiten
Otterberg
Standort:
Integrierte Gesamtschule
Schulstraße 2
Öffnungszeiten:
1. Juli, Schulzeiten
Landau
Standort:
Grundschule Arzheim
2. Juli, Aktionstag der Katholischen Jugendzentrale, keine
öffentliche Besichtigung möglich
Blieskastel
Standort:
Parkplatz Ecke Bahnhofstr./Florianstr.
Öffnungszeiten:
3. Juli, 10:00 Uhr bis 17:00 Uhr mit dem Besuch der saarländischen
Ministerpräsidentin um 16:00 Uhr
Zweibrücken
Standort:
Mannlich Realschule plus
Zeilbäumerstraße 8a
Öffnungszeiten:
4. Juli, 7:35 Uhr bis 14:30 Uhr
Pirmasens
Standort:
Zeppelinstr. 11 Parkplatz Wasgauhalle
Öffnungszeiten:5.Juli, 8:00 Uhr bis 17:00 Uhr
Schönenberg-Kübelberg
Standort:
Integrierte Gesamtschule, St. Wendeler-Straße 16
Öffnungszeiten:
6. Juli, 7:40 Uhr bis 12:40 Uhr, weitere Termine nach
Vereinbarung;
Germersheim
Standort:
Geschwister-Scholl-Realschule, Römerweg 2
Öffnungszeiten: 7. Juli, 7:45 Uhr bis 17:00 Uhr
Neustadt
Standort:
Hauptbahnhof, Bahnhofsvorplatz
Öffnungszeiten:
8. Juli, 9:00 Uhr bis 16:00 Uhr
26.06.2016
„Stell Dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes“
.jpg) Weihekandidat Walter Höcky vor dem Bischof
Weihekandidat Walter Höcky vor dem Bischof
Diakon Walter Höcky wurde von Bischof Wiesemann im
Speyerer Dom zum Priester geweiht
Speyer- (is). Die Flaggen vor dem
Speyerer Dom zeigten es weithin: Es ist ein besonderer Tag für das
Bistum Speyer. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat Diakon Walter
Höcky zum Priester geweiht. "Walter Höcky wird ein Priester sein,
der den Menschen zuhört", versprach der Bischof. Er
charakterisierte den 45-Jährigen aus der Gemeinde St. Peter und
Paul in Edesheim als tiefgründigen Menschen. "Die Kirche von Speyer
hat heute allen Grund, den Lobeshymnus anzustimmen", sagte der
Bischof zu Beginn des Gottesdienstes und dankte dem Herrn, dass er
"wieder einen Arbeiter in den Weinberg schickt". Es sei immer
wieder bewegend, wenn „jemand seine Hände in die Hände Gottes
legt."
.jpg) Walter
Höcky kam auf Umwegen zum Priesteramt. Wiesemann erinnerte in
seiner Predigt daran, dass der Weihekandidat bereits als Messdiener
Gottes Kraft und Liebe gespürt habe. Der Weg hin zum Priesteramt
verlief aber nicht geradlinig. Höcky engagierte sich stark in
seiner Heimatgemeinde in Edesheim. Nach Abitur und Wehrdienst
studierte er aber zunächst Politikwissenschaft, Soziologie und
Psychologie. Gleichzeitig besuchte Höcky damals schon
Theologievorlesungen. Erst im reiferen Alter, blickte Wiesemann
zurück, nahm der Weihekandidat tatsächlich ein Theologiestudium
auf. In seiner pastoralpraktischen Ausbildung war Walter Höcky in
der Pfarrei Heiliger Petrus in Bobenheim-Roxheim tätig. Wiesemann
dankte Höckys Wegbegleitern, seinen Freunden und Verwandten,
Mitgliedern von Höckys Heimatgemeinde und seiner Diakonatspfarrei.
Sie hatten den 45-Jährigen zu seiner Weihe in den Dom begleitet.
Ebenso erinnerte der Bischof an Höckys verstorbene Eltern.
Walter
Höcky kam auf Umwegen zum Priesteramt. Wiesemann erinnerte in
seiner Predigt daran, dass der Weihekandidat bereits als Messdiener
Gottes Kraft und Liebe gespürt habe. Der Weg hin zum Priesteramt
verlief aber nicht geradlinig. Höcky engagierte sich stark in
seiner Heimatgemeinde in Edesheim. Nach Abitur und Wehrdienst
studierte er aber zunächst Politikwissenschaft, Soziologie und
Psychologie. Gleichzeitig besuchte Höcky damals schon
Theologievorlesungen. Erst im reiferen Alter, blickte Wiesemann
zurück, nahm der Weihekandidat tatsächlich ein Theologiestudium
auf. In seiner pastoralpraktischen Ausbildung war Walter Höcky in
der Pfarrei Heiliger Petrus in Bobenheim-Roxheim tätig. Wiesemann
dankte Höckys Wegbegleitern, seinen Freunden und Verwandten,
Mitgliedern von Höckys Heimatgemeinde und seiner Diakonatspfarrei.
Sie hatten den 45-Jährigen zu seiner Weihe in den Dom begleitet.
Ebenso erinnerte der Bischof an Höckys verstorbene Eltern.
"Stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes", rief der
Bischof in seiner Predigt dem Weihekandidaten zu. Dies solle der
Deutungsschlüssel für das ganze Leben sein. Das Geheimnis des
Kreuzes sei weder von weltlichen Maßstäben wie Erfolg bestimmt,
noch von solchen, die in früher Zeit galten. Das Geheimnis des
Kreuzes sei "das Geheimnis einer Liebe, die alles loslässt – selbst
das eigene Leben". Diese Liebe habe die Fruchtbarkeit der Kirche
bis heute begründet. Das Zölibat sei die Antwort auf diese Liebe,
die sich verschenke und loslasse. Wiesemann bezog Höckys
Primizspruch des Propheten Jeremia, der mit einem Rinderjoch durch
die Straßen zog, in seine Predigt ein. "Dieses Joch ist in der
Stola des Priesters gegenwärtig", sagte er. Es erinnere daran, dass
das Leben unter das Geheimnis des Kreuzes gestellt ist.
.jpg) Nach
der Predigt nahm Bischof Wiesemann dem Edesheimer das
Weiheversprechen ab. Während der Litanei lag der Weihekandidat zum
Zeichen seiner Hingabe ausgestreckt auf dem Boden. Anschließend
legte der Bischof – so wie es schon die Apostel taten – schweigend
dem Weihekandidaten die Hände auf sowie anschließend alle
anwesenden Priester.
Nach
der Predigt nahm Bischof Wiesemann dem Edesheimer das
Weiheversprechen ab. Während der Litanei lag der Weihekandidat zum
Zeichen seiner Hingabe ausgestreckt auf dem Boden. Anschließend
legte der Bischof – so wie es schon die Apostel taten – schweigend
dem Weihekandidaten die Hände auf sowie anschließend alle
anwesenden Priester.
Die musikalische Gestaltung des Gottesdienstes übernahmen die
Domsingknaben, der Mädchenchor und Sänger des Domchores sowie die
Dombläser. An der Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub. Die
musikalische Leitung hatten Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller inne.
Die Primiz, seine erste Heilige Messe, feiert der Neupriester am
Sonntag, 26. Juni, um 10 Uhr in Edesheim. Anschließend feiert die
Gemeinde rund um ihre Kirche. Die Primizvesper mit Primizsegen um
17 Uhr beschließt den Tag. Am Dienstag, 28. Juni, 18 Uhr, feiert
Walter Höcky in der Kirche des Priesterseminars St. German in
Speyer die Heilige Messe. Anschließend erteilt er den Primizsegen.
Text und Foto: Yvette Wagner
26.06.2016
Speyerer Bischöfe freuen sich über Weinzehnt aus Kirrweiler
-01.jpg) Delegation aus dem Weinort übergibt „Weinzehnt“ vor dem
Dom – Bischof Wiesemann verweist auf Erlebnistag Deutsche
Weinstraße unter dem Motto „Himmlische Pfalz“
Delegation aus dem Weinort übergibt „Weinzehnt“ vor dem
Dom – Bischof Wiesemann verweist auf Erlebnistag Deutsche
Weinstraße unter dem Motto „Himmlische Pfalz“
Speyer- (is). Er soll – nach der
Beschreibung von Winzer Anton - mit seiner fruchtige Art an Ananas
bis hin zu Mango erinnern und eine fein ausgewogene Säurestruktur
und mineralische Note haben: der edle Tropfen, den heute Nachmittag
bei strahlendem Sonnenschein eine Delegation aus Kirrweiler als
„Weinzehnt“ vor dem Dom den Speyerer Bischöfen übergab.
Zum sechsten Mal hatten die Südpfälzer eine Weinfuhre von ihrer
Heimat aus per Traktor und auf dem letzten Stück traditionsgemäß
mit Pferdefuhrwerk zur Kathedrale in der Domstadt transportiert.
Begleitet wurde die Kutsche mit dem -01.jpg) Wein
von einer Abordnung der Ortsgemeinde mit dem Kirrweiler
Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Janine I. und den beiden
Pfarrern Marco Richtscheid und Dr. Gerd Babelotzky sowie dem
Venninger „Essigmacher“ Georg Wiedemann.
Wein
von einer Abordnung der Ortsgemeinde mit dem Kirrweiler
Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Janine I. und den beiden
Pfarrern Marco Richtscheid und Dr. Gerd Babelotzky sowie dem
Venninger „Essigmacher“ Georg Wiedemann.
Von seinen Bischofskollegen werde er sehr um dieses schon zur
Tradition gewordene Geschenk beneidet, erklärte Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann bei der Begrüßung. Er und Weihbischof Otto
Georgens bedankten sich voller Freude für die Weinlieferung. Sie
umfasst zweimal 142 Flaschen mit insgesamt 213 Liter 2015er
Grauburgunder classic, der in diesem Jahr aus dem Weinhaus Ralph
Anton stammt.
-01.jpg) In
seiner kurzen Ansprache erinnerte Bürgermeister Metzger an die
jahrhundertelangen Verbindungen zwischen seiner Gemeinde und den
Speyerer Bischöfen. Zu Feudalzeiten war Kirrweiler Oberamt und
Sommerresidenz der Fürstbischöfe des Bistums Speyer, denen die
Winzer ihren „Weinzehnten“ ablieferten. Auch heute noch gehört
innerhalb der Gemarkung Kirrweiler ein Weinberg dem bischöflichen
Stuhl.
In
seiner kurzen Ansprache erinnerte Bürgermeister Metzger an die
jahrhundertelangen Verbindungen zwischen seiner Gemeinde und den
Speyerer Bischöfen. Zu Feudalzeiten war Kirrweiler Oberamt und
Sommerresidenz der Fürstbischöfe des Bistums Speyer, denen die
Winzer ihren „Weinzehnten“ ablieferten. Auch heute noch gehört
innerhalb der Gemarkung Kirrweiler ein Weinberg dem bischöflichen
Stuhl.
In diesem Jahr feiere die Gemeinde außerdem die Verleihung der
Stadtrechte vor 500 Jahren und das Gedenken an die Geburt des
Kurpfälzer Kanzlers Florenz von Venningen in Kirrweiler ebenfalls
vor 500 Jahren, so Metzger. Der Bürgermeister hatte 2011 -
anlässlich des 950-jährigen Domweihjubiläums – die Idee, an die
alte Tradition des „Weinzehnts“ neu anzuknüpfen.
-01.jpg) Weihbischof Georgens, zünftig gekleidet mit Winzerkittel,
zitierte mit Augenzwinkern eine Predigt des Mainzer Weihbischofs
Valentin Heimes (1741-1806). Unter dem Motto „Der Missbrauch aber
schließt den Gebrauch nicht aus“ hatte der für einen maßvollen
Genuss des Weins geworben: „denn der Wein erfreut des Menschen
Herz!“.
Weihbischof Georgens, zünftig gekleidet mit Winzerkittel,
zitierte mit Augenzwinkern eine Predigt des Mainzer Weihbischofs
Valentin Heimes (1741-1806). Unter dem Motto „Der Missbrauch aber
schließt den Gebrauch nicht aus“ hatte der für einen maßvollen
Genuss des Weins geworben: „denn der Wein erfreut des Menschen
Herz!“.
Georgens kündigte an, einige Flaschen des „Weinzehnt“- Weins im
Oktober zum Fest am Sonntag der Weltmission am 23. Oktober mit den
dann im Bistum weilenden Gästen aus den Philippinen zu teilen.
Als „Symbol, der Himmel und Erde verbindenden Liebe Gottes“
beschrieb Weinprinzessin Janine I. die Weinberge und betonte
„fröhliche Menschen und guter Wein sollten stets zusammen
sein“.
-01.jpg) Bischof
Wiesemann zeigte sich beeindruckt davon, wie intensiv sich die
Kirrweiler mit ihrer Geschichte beschäftigten. Er verweis darauf,
dass in diesem Jahr der Erlebnistag Deutsche Weinstraße unter dem
Motto „Himmlische Pfalz“ steht und gemeinsam mit den Kirchen
veranstaltet wird und überreichte dem Kirrweiler Bürgermeister das
gelbe Plakat, mit dem für den Erlebnistag geworben wird.
Bischof
Wiesemann zeigte sich beeindruckt davon, wie intensiv sich die
Kirrweiler mit ihrer Geschichte beschäftigten. Er verweis darauf,
dass in diesem Jahr der Erlebnistag Deutsche Weinstraße unter dem
Motto „Himmlische Pfalz“ steht und gemeinsam mit den Kirchen
veranstaltet wird und überreichte dem Kirrweiler Bürgermeister das
gelbe Plakat, mit dem für den Erlebnistag geworben wird.
Auch Kirrweiler wird – obwohl es nicht direkt an der Weinstraße
liegt – bei dem Erlebnistag vertreten sein: Vor der Kirche in
Maikammer wird eine Stele des Kirrweiler Weinpfades in
Originalgröße aus Holz aufgebaut und so für den biblischen
Weinlehrpfad in dem südpfälzischen Ort werben. Außerdem wird zu
bestimmten Uhrzeiten in der Kirche ein Tonbild zu einigen Stelen
bzw. Themen des Weinpfades laufen. Pfarrer Gerd Babelotzky lud bei
der Weinzehnt-Übergabe dazu ein, die zwölf Stationen entlang
des Kirrweiler Weinpfades einmal zu besuchen. Foto:
dak
25.06.2016
Touristische Attraktionen in Speyer gebündelt
 Kombiangebote für Dom und Domschatz im Historischen Museum
der Pfalz
Kombiangebote für Dom und Domschatz im Historischen Museum
der Pfalz
Der Dom und das Historische Museum der Pfalz gehören zu den
bedeutendsten Sehenwürdigkeiten in Speyer. Ab sofort können beide
Häuser mit einem kombinierten Ticket besichtigen werden. Neben dem
Besuch der Dom-Krypta, des Kaisersaals und der Aussichtsplattform
ist die Besichtigung des Domschatzes im Historischen Museum der
Pfalz in der Karte enthalten.
Gleichzeitig gibt es ab sofort eine kombinierte Führung, die im
Dom zu Speyer beginnt und Hintergrundinformationen zur
historischen, kunstgeschichtlichen und geistlichen Bedeutung des
Gotteshauses gibt. Im Historischen Museum der Pfalz stehen dann die
Funde aus den Gräbern der salischen Kaiser im Mittelpunkt sowie
kostbare liturgische Geräte und Gewänder.
 „Ich freue mich,
dass wir nach der kombinierten Dom-Stadtführung nun auch ein
Kombiprodukt zusammen mit dem Historischen Museum der Pfalz
anbieten, zumal das Museum und der Dom sich in direkter
Nachbarschaft befinden,“ erklärte Domkustos Peter Schappert.
Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert ergänzte:
„Ich freue mich,
dass wir nach der kombinierten Dom-Stadtführung nun auch ein
Kombiprodukt zusammen mit dem Historischen Museum der Pfalz
anbieten, zumal das Museum und der Dom sich in direkter
Nachbarschaft befinden,“ erklärte Domkustos Peter Schappert.
Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert ergänzte:
„Viele Dom-Besucher wollen ihre Eindrücke mit der geführten
Besichtigung des Domschatzes abrunden. In unserem Hause zählt
dieser Bereich, mit Spitzenexponaten wie den Kronen aus den
Kaisergräbern, mit dem Königsmantel Philipps von Schwaben oder mit
sakralen Goldschmiedearbeiten, zu den großen Höhepunkten“
 Das Kombiticket und die Kombiführung sind ausschließlich
im Dom-Besucherzentrum am Domplatz erhältlich. Die Führung dauert
etwa eindreiviertel Stunden und kann dienstags bis samstags
zwischen 9 und 16 Uhr sowie sonntags zwischen 12 und 16
gebucht werden (Führungsbeginn).
Das Kombiticket und die Kombiführung sind ausschließlich
im Dom-Besucherzentrum am Domplatz erhältlich. Die Führung dauert
etwa eindreiviertel Stunden und kann dienstags bis samstags
zwischen 9 und 16 Uhr sowie sonntags zwischen 12 und 16
gebucht werden (Führungsbeginn).
Teilnehmen können maximal 25 Personen. E-Mail-Anfragen an:
info@dom-zu-speyer.de
Kosten
Kombiticket: 15 Euro, ermäßigt 7 Euro
Kombiführung: 199 Euro
Text: Bistum Speyer, Presse Foto: spk, archiv
24.06.2016
Gemeinde St. Joseph feiert ihre Kirchenmusikerin
 Speyer- Gleich dreifachen Grund zum Feiern hat
die Pfarrgemeinde St. Joseph am Samstag, 2.Juli:
Speyer- Gleich dreifachen Grund zum Feiern hat
die Pfarrgemeinde St. Joseph am Samstag, 2.Juli:
Beim Festgottesdienst um 18 Uhr und anschließenden Pfarrfest
steht Marie-Theres Brand im Blickpunkt, denn sie hat an diesem
Tag Geburtstag und feiert zudem ein stolzes Jubiläum -
35 Jahre Kirchenmusikerin an St. Joseph Speyer.
Im Sommer 1981 übernahm Marie Theres Brand den Kirchenchor und
die Stelle als Organistin an St. Joseph. Die Kirchenmusik an St.
Joseph ist durch ihr Wirken in diesen Jahren besonders geprägt
worden. Außer dem Kirchenchor leitet sie auch den Spatzenchor
(musikalische Früherziehung für Kinder), den Jungen Chor Speyer und
den Motettenchor Speyer.
Kirchenchor und Junger Chor werden den Gottesdienst mitgestalten
und ihrer engagierten Chorleiterin bei der abendlichen
Pfarrfest-Feier auf der Wiese hinterm Ägidienhaus zu deren Jubiläen
gebührend gratulieren. Text: ws Foto: www.speyer.de
21.06.2016
Gönne dir den Weg in die Stille
Speyer- Ab 27.Juni trifft sich eine offene
Meditationsgruppe jeden Montag in der
Auferstehungskirche, Am Renngraben, von 18.00h bis
19.15h.
Nach einer Einführung sitzen wir in der Stille.
Dies führt zu mehr Achtsamkeit und zur Verlangsamung des Lebens
sowie zur Vertiefung geistlicher Erfahrung.
Wer die Stille erfahren hat, wird im Leben präsent sein; wird
verändert wahrnehmen und handeln.
Im Raum befinden sich Stühle. Falls Sie auf einem
Meditationshocker oder einem Sitzkissen sitzen möchten, bringen Sie
sich bitte dies und eine Unterlage mit.
Verantwortlich für diese Gruppe ist Pfarrerin Daniela Körber
(06232/658370) Dani_Koerber@web.de
Text: Prot. Dekanat Speyer, Presse
21.06.2016
Mit Smartphone und Tablet im Speyerer Dom unterwegs
.jpg) Domkustos Peter Schappert (2. von links) übernahm die Führung durch den Speyerer Dom
Domkustos Peter Schappert (2. von links) übernahm die Führung durch den Speyerer Dom
Erster Instawalk in der Kathedrale ermöglichte neue Ein- und
Ausblicke
Speyer- (is). Fotografieren und Handys
ausdrücklich erlaubt: Sieben Teilnehmer haben am Donnerstagabend
den Dom auf eine ganz andere, eine ganz neue Art erkundet. Die
Netzgemeinde DA_ZWISCHEN und das Kulturmanagement am Speyerer Dom
hatten zum ersten Instawalk eingeladen. Domkustos Peter Schappert
übernahm die Führung. Er wies auf spannende Details hin und führte
die Gruppe zu Stellen, die sonst für Besucher nicht zugänglich
sind. Mit Smartphones und Tablets hielten die Instawalker alles im
Bild fest. Ihre Bilder veröffentlichten sie unter dem Hashtag
#instadomspeyer auf der Internetplattform Instagram.
.jpg) Mit einem
kleinen Sektempfang begrüßte Felix Goldinger die Teilnehmer. Der
Referent für Missionarische Pastoral im Bistum hatte den Anstoß zum
Instawalk gegeben. Kirche trifft Netz-Community: Das passt für
Goldinger gut zur neuen Netzgemeinde DA_ZWISCHEN, die vor drei
Monaten gegründet wurde. Sie ist ein spirituelles Angebot der
Diözese Speyer in den sozialen Netzwerken und bei WhatsApp. Unter
dem Titel #instakirche öffnen bundesweit Kirchen ihre Türen für
Instagram-Fotografen. Nach Instawalks durch den Osnabrücker Dom,
das Bonner Münster, den Essener Dom und die Probsteikirche Leipzig
war der Speyerer Dom die fünfte Station.
Mit einem
kleinen Sektempfang begrüßte Felix Goldinger die Teilnehmer. Der
Referent für Missionarische Pastoral im Bistum hatte den Anstoß zum
Instawalk gegeben. Kirche trifft Netz-Community: Das passt für
Goldinger gut zur neuen Netzgemeinde DA_ZWISCHEN, die vor drei
Monaten gegründet wurde. Sie ist ein spirituelles Angebot der
Diözese Speyer in den sozialen Netzwerken und bei WhatsApp. Unter
dem Titel #instakirche öffnen bundesweit Kirchen ihre Türen für
Instagram-Fotografen. Nach Instawalks durch den Osnabrücker Dom,
das Bonner Münster, den Essener Dom und die Probsteikirche Leipzig
war der Speyerer Dom die fünfte Station.
Kustos Peter Schappert machte sowohl die enorme bauliche und
geistliche Dimension des Doms deutlich. Er zeigte aber auch
interessante Reliefs und Bilder, Inschriften und Grabplatten –
Einzelheiten, die häufig übersehen werden. Beim Instawalk waren sie
die Stars, wie das faule Schwein. Die kleine Figur am Hauptportal
stellt eine der Todsünden dar.
Im Westen das Weltliche, im Osten das Göttliche. Diesen Weg
stellt der Dom dar, erläuterte Schappert im Dom, während die
Instawalker stehend und in der Hocke die richtige Perspektive fürs
Foto suchten. "Bewegen Sie sich frei!", forderte er und verwies auf
die Seitenschiffe, in denen dieser Weg noch sichtbarer wird.
.jpg) Für
Kristijan Nujic aus Ludwigshafen ist der Instawalk ein Erlebnis:
"Ich war schon oft ihm Dom, aber nie mit dem Handy und nie so
allein." Die Instawalker hatten die Kathedrale ganz für sich
allein. Die Führung fand außerhalb der Öffnungszeiten statt.
Deshalb konnte Peter Schappert die Gruppe auch in den Altarraum und
die Apsis führen und eröffnete damit neue Ein- und Ausblicke. Die
Teilnehmer spürten, wie der Bischof auf die Gemeinde blickt, wenn
er vor dem Hochaltar predigt. Sie streiften durch Katharinen- und
Taufkapelle, immer auf der Suche nach einem guten Motiv. Sie
mussten nicht lange suchen, fingen prächtige Reliquiare und
Säulenkapitelle ein. Sie erlebten die Krypta und die Grablege der
Kaiser und Könige. Zum Schluss ging's zum Endspurt die Treppen
hinauf in den Kaisersaal und auf die Chorempore. Hier eröffnet sich
ein einmaliger Blick auf die Fresken, die das Hauptschiff schmücken
und in den Dom. Diese Gelegenheit ließen sich die Instawalker
natürlich nicht entgehen, machen an dieser Stelle sogar
Panoramaaufnahmen und Selfies.
Für
Kristijan Nujic aus Ludwigshafen ist der Instawalk ein Erlebnis:
"Ich war schon oft ihm Dom, aber nie mit dem Handy und nie so
allein." Die Instawalker hatten die Kathedrale ganz für sich
allein. Die Führung fand außerhalb der Öffnungszeiten statt.
Deshalb konnte Peter Schappert die Gruppe auch in den Altarraum und
die Apsis führen und eröffnete damit neue Ein- und Ausblicke. Die
Teilnehmer spürten, wie der Bischof auf die Gemeinde blickt, wenn
er vor dem Hochaltar predigt. Sie streiften durch Katharinen- und
Taufkapelle, immer auf der Suche nach einem guten Motiv. Sie
mussten nicht lange suchen, fingen prächtige Reliquiare und
Säulenkapitelle ein. Sie erlebten die Krypta und die Grablege der
Kaiser und Könige. Zum Schluss ging's zum Endspurt die Treppen
hinauf in den Kaisersaal und auf die Chorempore. Hier eröffnet sich
ein einmaliger Blick auf die Fresken, die das Hauptschiff schmücken
und in den Dom. Diese Gelegenheit ließen sich die Instawalker
natürlich nicht entgehen, machen an dieser Stelle sogar
Panoramaaufnahmen und Selfies.
Die Premiere kam gut an. "Es ist genau das richtige Angebot für
junge Erwachsene", lobte Kristijan Nujic, "es war sehr
interessant." Maria Lajin war von den Stellen fasziniert, die sonst
tabu sind. "Es war schön, im Altarraum zu stehen." Auch Referent
Felix Goldinger ist zufrieden und will weiterhin Instawalks
anbieten. Neue Termine sind allerdings noch nicht festgelegt.
Instwalks kann sich Goldinger nicht nur im Dom, sondern auch in
anderen Kirchen im Bistum vorstellen. "Es gibt ja viele
schöne."
Weitere Infos:
Die Bilder des Abends sind unter https://walls.io/instakirche abrufbar.
Netzgemeinde DA_ZWISCHEN: www.netzgemeinde-dazwischen.de
Instawalks bundesweit: http:/j.mp/instakirche
Text und Fotos: Yvette Wagner
17.06.2016
Bischof Wiesemann setzt Dekane in ihr Amt ein
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Bildmitte) mit den neu eingesetzten Dekanen, von links: Michael Janson (Dekanat Bad Dürkheim), Steffen Kühn (Kaiserslautern), Peter Nirmaier (Speyer), Andreas Sturm (Saarpfalz), Axel Brecht (Landau), Jörg Rubeck (Germersheim), Markus Horbach (Donnersberg), Rudolf Schlenkrich (Kusel), Alban Meißner (Ludwigshafen) und Johannes Pioth (Pirmasens).
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann (Bildmitte) mit den neu eingesetzten Dekanen, von links: Michael Janson (Dekanat Bad Dürkheim), Steffen Kühn (Kaiserslautern), Peter Nirmaier (Speyer), Andreas Sturm (Saarpfalz), Axel Brecht (Landau), Jörg Rubeck (Germersheim), Markus Horbach (Donnersberg), Rudolf Schlenkrich (Kusel), Alban Meißner (Ludwigshafen) und Johannes Pioth (Pirmasens).
Zehn Dekane im Februar von Dekanatsversammlungen gewählt –
Amtszeit beträgt sechs Jahre
Speyer- (is). Im Rahmen der
konstituierenden Sitzung des Priesterrates hat Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann die Dekane der zehn Dekanate des Bistums
Speyer eingesetzt. Sie waren im Februar von den
Dekanatsversammlungen gewählt worden. Bischof Wiesemann dankte den
neuen Dekanen für die Bereitschaft zur Übernahme der zusätzlichen
Verantwortung: „Darin drückt sich ein großes Stück aktiver Mitsorge
für unser Bistum aus.“ Im Anschluss an das Gebet der Terz in der
Kirche des Priesterseminars St. German überreichte er den Dekanen
die Ernennungsurkunden. Ihre Amtszeit beträgt sechs Jahre.
Der neu konstituierte Priesterrat berät den Bischof in allen
wichtigen Fragen der Seelsorge und des priesterlichen Dienstes. Die
Mitglieder werden von den Priestern des Bistums gewählt oder
zusätzlich in das Gremium berufen. Zu den geborenen Mitgliedern
gehören mehrere Vertreter der Bistumsleitung. Außerdem sind alle
Dekane Mitglieder des Priesterrates.
Weitere Informationen zu den Dekanaten:
http://www.bistum-speyer.de/1/bistum-speyer/dekanate-und-pfarreien/
Weitere Information zum Priesterrat und seinen
Mitgliedern:
http://www.bistum-speyer.de/bistum-speyer/raete-und-kommissionen/priesterrat/
17.06.2016
Bischöfe nehmen Weinzehnt in Empfang
 Lieferung aus Kirrweiler kommt am 24. Juni nach Speyer –
Zug mit der Pferdekutsche von der Stadthalle zum Dom
Lieferung aus Kirrweiler kommt am 24. Juni nach Speyer –
Zug mit der Pferdekutsche von der Stadthalle zum Dom
Speyer- (is). Zum sechsten Mal in der
Geschichte des 1817/21 wieder errichteten Bistums Speyer wird ein
fürstbischöflicher „Weinzehnt" den Weg von Kirrweiler nach Speyer
nehmen – zuerst mit Traktor und Anhänger, dann mit Pferden und
Fuhrwerk.
-01-01.jpg) Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto
Georgens werden die Weinfuhre am Freitag, 24. Juni, gegen 15 Uhr
vor dem Speyerer Dom in Empfang nehmen. Begleitet wird die Kutsche
mit dem Wein von einer Delegation der Ortsgemeinde mit dem
Kirrweiler Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Janine I. und
den beiden Pfarrern Marco Richtscheid und Dr. Gerd Babelotzky. Der
Zug mit der Pferdekutsche wird von der Stadthalle über die
Bahnhofstraße zum Altpörtel und dann über die Maximilianstraße
zum Dom führen.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto
Georgens werden die Weinfuhre am Freitag, 24. Juni, gegen 15 Uhr
vor dem Speyerer Dom in Empfang nehmen. Begleitet wird die Kutsche
mit dem Wein von einer Delegation der Ortsgemeinde mit dem
Kirrweiler Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Janine I. und
den beiden Pfarrern Marco Richtscheid und Dr. Gerd Babelotzky. Der
Zug mit der Pferdekutsche wird von der Stadthalle über die
Bahnhofstraße zum Altpörtel und dann über die Maximilianstraße
zum Dom führen.
Der Weinort Kirrweiler an der Südlichen Weinstraße war zu
Feudalzeiten Oberamt und Sommerresidenz der Fürstbischöfe des alten
Bistums Speyer. Auf Anregung von Bürgermeister Metzger wurde 2011 -
anlässlich des 950-jährigen Domweihjubiläums - an die alte
Tradition des „Weinzehnts“ neu angeknüpft, bei der dem
bischöflichen Landesherrn der „Zehnte“ des Weinertrages abgeliefert
werden musste. Auch heute noch gehört innerhalb der Gemarkung
Kirrweiler ein Weinberg dem bischöflichen Stuhl.
In diesem Jahr stammt der „Zehnt-Wein“, ein 2015er Grauburgunder
classic, aus dem Kirrweiler Weinhaus Ralph Anton. Die zweimal
142 Flaschen mit insgesamt 213 Liter Wein werden als Geschenk der
Gemeinde Kirrweiler an die Speyerer Bischöfe übergeben.
16.06.2016
Ein Sprachgenie auf dem Speyerer Bischofsstuhl
 Bischof Daniel Bonifaz von Haneberg leitete das Bistum Speyer von 1872 bis 1876.
Bischof Daniel Bonifaz von Haneberg leitete das Bistum Speyer von 1872 bis 1876.
Daniel Bonifaz von Haneberg wurde vor 200 Jahren
geboren
Speyer (is). Er war der gelehrteste
Speyerer Bischof des 19. Jahrhunderts: Daniel Bonifaz von Haneberg,
dessen Geburtstag sich am 17. Juni zum 200. Mal jährt. Obwohl
Haneberg nur knapp vier Jahre Amtszeit vergönnt waren, hinterließ
das Sprachgenie als Seelsorgebischof tiefsten Eindruck bei den
Gläubigen im Bistum Speyer und weit darüber hinaus. Nach seinem Tod
im Mai 1876 schrieb die Bistumszeitung „Der christliche Pilger“:
„Der Schmerz und die Theilnahme war eine so allgemeine, wie wir sie
noch niemals beim Tode eines Menschen wahrgenommen
haben.“
Haneberg kam 1816 im Allgäu als Sohn eines Bauern auf die Welt.
In der Schulzeit zeigte sich seine außergewöhnliche Begabung. Schon
als Gymnasiast besuchte der spätere Bischof zusätzlich die
Universität. Er beherrschte neben Latein, Griechisch, Englisch,
Französisch, Italienisch und Portugiesisch acht orientalische
Sprache und konnte sich auch auf Chinesisch verständigen. Nach der
Priesterweihe machte Haneberg schnell akademische Karriere, wurde
Professor an der Münchener Universität. Er unterrichtete die Fächer
Altes Testament und Orientalische Sprachen.
1850 trat Haneberg in die Benediktinerabtei St. Bonifaz in
München ein. 1854 wurde er zum Abt gewählt, lehrte aber weiterhin
an der Universität. Nachdem der 1866 in den Adelsstand Erhobene
zuvor einige Berufungen auf Bischofsstühle abgelehnt hatte, nahm er
1872 die Ernennung zum Bischof von Speyer an. In der Zeit des
Kulturkampfes zwischen Staat und katholischer Kirche bot sich eine
liberal gesinnte und zugleich fest zur Kirche stehende
Persönlichkeit wie Haneberg als Leiter eines Bistums besonders
an.
Der Geistliche gewann bereits bei seinem Amtsantritt die Herzen
der Menschen, indem er zum Dialog aufforderte. In seinem ersten
Hirtenbrief schrieb er: „Es ermuthigt mich, von vielen gehört, ja
zum Theil selbst erfahren zu haben, daß es zu den vorherrschenden
Eigenschaften der Bewohner dieser schönen Gauen gehört, einen
offenen, freien Meinungsaustausch zu lieben.“
Trotz seines professoralen Hintergrundes verkörperte Haneberg
nach der Einschätzung des Kirchenhistorikers Hans Ammerich einen
Bischofstyp, der ganz in der Seelsorge aufging. Als 1873 die
Cholera in Speyer ausbrach und viele Todesopfer forderte, pflegte
der Bischof mit seinen Mitarbeitern trotz höchsten
Ansteckungsrisikos persönlich die Kranken in den Wohnungen und
Spitälern. Auch bei seinen Visitationsreisen nahm Haneberg keine
Rücksicht auf seine schwache gesundheitliche Konstitution. Sein
früher Tod war eine Folge dieses unermüdlichen Einsatzes. Foto:
Bistumsarchiv Speyer
16.06.2016
Unternehmerischer Erfolg muss geteilt werden
 Ebernburger Tischgespräche mit Manager Andreas Barner –
Ökonomische Impulse der Reformation
Ebernburger Tischgespräche mit Manager Andreas Barner –
Ökonomische Impulse der Reformation
Bad Münster am Stein / Ebernburg-
(ekhn/lk). In der Familie Martin Luthers gehörte es einst
zum guten protestantischen Ton, bei gutem Essen und reichlich
Getränken eine zünftige Debatte vom Zaun zu brechen. Diese
Tradition der Tischreden haben die Evangelische Kirche der Pfalz,
die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau sowie die Evangelische
Kirche im Rheinland gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz neu
aufleben lassen. Seit drei Jahren laden sie prominente Gäste auf
die Evangelische Familienbildungsstätte Ebernburg an der Nahe ein –
zu gutem Essen und einer guten Diskussion.
Tischredner der jüngsten Veranstaltung war der Vorsitzende der
Unternehmensleitung des Pharmakonzerns Boehringer Ingelheim,
Andreas Barner. Sein Thema: „Reformation und Wirtschaft“. Barner
warnte in seinem Beitrag vor einer Gesellschaft, die weiter
unverdrossen auf Wirtschaftswachstum setzt. Selbst die
Null-Zins-Politik etwa der Europäischen Zentralbank sorge für keine
Impulse in der Wirtschaft mehr. Hinzu komme eine neue Generation
von Jüngeren, die ihr Heil nicht mehr im persönlichen Zuwachs an
Reichtum sehe. „Wir müssen uns von einer Gesellschaft mit hohen
Zuwächsen zu einer Gesellschaft, die teilen lernt, entwickeln“, so
Barner.
Auch die Unternehmen sieht der Manager in der Pflicht. Sie
müssten das „Teilen des Erfolges“ mitberücksichtigen. Nur so sei
eine Firma auf lange Sicht erfolgreich. Barners Credo lautet:
Ökonomische Werte müssen „hartnäckig am Lebenszusammenhang der
Menschen orientiert werden“. Damit wiedersprach er der
neuzeitlichen Wirtschaftstheorie, nach denen Menschen nur an ihrem
„maximalen Eigeninteresse“ interessiert seien, was dann wiederum
die Wirtschaft antreibe. Nach Ansicht Barners hat Egoismus in
Wirtschaftszusammenhängen ausgedient und langfristig keine
Chance.
Dabei könnten auch Impulse aus der christlichen Tradition zu
einer Neuorientierung der Ökonomie beitragen, erklärte Barner. So
habe beispielsweise der Reformator Martin Luther zwar mit der
Förderung des Individualismus und seiner Hochschätzung der
beruflichen Arbeit wichtige Impulse für ein neues Verständnis von
Wirtschaftszusammenhängen gegeben. Gleichzeitig habe er aber auch
dafür plädiert, dass die Staatsmacht letztlich für Ordnungen und
eine faire Verteilung sorgen müsse, so Barner, der auch Mitglied im
Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) ist und im
vergangenen Jahr Präsident des Deutschen Evangelischen Kirchentags
in Stuttgart war.
Bei dem diesjährigen Ebernburger Tischgespräch war der
hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung Gastgeber. Er
begrüßte neben Barner den Rheinland-Pfälzischen Landtagspräsidenten
Hendrik Hering sowie den Reformationsbeauftragten des Landes,
Professor Gerhard Robbers und den Kirchenpräsidenten der Pfalz,
Christian Schad sowie den Präses der rheinischen Kirche, Manfred
Rekowski. Musikalisch begleitete das „Duo Camillo“ mit Fabian Vogt
und Martin Schultheiß den Abend. Text: Evangelischen Kirche der
Pfalz (Protestantische Landeskirche), Presse
15.06.2016
Gespräch zwischen Dr. Hissnauer und Domkapitular Schappert
 Speyer- Wie Ihnen sicher noch in Erinnerung ist,
hat Dr. Wolfgang Hissnauer zum Jahresende 2015 seinen Rücktritt vom
Amt des Vorsitzenden des Speyerer Dombauvereins erklärt. Als Grund
nannte er Differenzen mit Domkustos Peter Schappert.
Speyer- Wie Ihnen sicher noch in Erinnerung ist,
hat Dr. Wolfgang Hissnauer zum Jahresende 2015 seinen Rücktritt vom
Amt des Vorsitzenden des Speyerer Dombauvereins erklärt. Als Grund
nannte er Differenzen mit Domkustos Peter Schappert.
Wie der „Dom-Kurier“, das Mitteilungsblatt des Dombauvereins
Speyer, in seiner jüngsten Ausgabe berichtet, haben sich Dr.
Wolfgang Hissnauer und Domkustos Peter Schappert Ende Mai zu einem
Gespräch getroffen und haben über den Konflikt gesprochen.
In einer Entschuldigung bedauerte Domkustos Peter Schappert den
Verlauf des Konflikts und das Ende der Zusammenarbeit. Er brachte
zum Ausdruck, dass ihm all seine Anteile leidtun, die ein gutes
Miteinander erschwert haben. Er schätze die hervorragende Arbeit
Dr. Wolfgang Hissnauers als langjähriger Vorsitzender des
Dombauvereins und danke ihm für sein wertvolles Engagement.
Text: Bistum Speyer, Presse
15.06.2016
Katholiken im Bistum Speyer spenden 160.000 Euro für die Diaspora
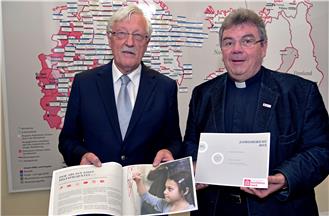 Monsignore Georg Austen und Heinz Paus stellen den Jahresbericht 2015 des Bonifatiuswerkes vor.
Monsignore Georg Austen und Heinz Paus stellen den Jahresbericht 2015 des Bonifatiuswerkes vor.
Bonifatiuswerk veröffentlicht Jahresbericht 2015 –
Fördersumme um 1,1 Millionen Euro im Vergleich zum Vorjahr
gestiegen
Speyer/Paderborn- Mit 15,7 Millionen Euro hat
das Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken im Jahr 2015 insgesamt
891 Projekte in der Diaspora Deutschlands, Nordeuropas und des
Baltikums gefördert. Im Vergleich zum Vorjahr (14,6 Millionen Euro)
ist dies ein Anstieg um 1,1 Millionen Euro. Die katholischen
Christen aus dem Bistum Speyer haben 160.000 Euro in Kollekten und
Einzelspenden für die Diaspora gespendet.
Diese Zahlen gehen aus dem Jahresbericht 2015 des Hilfswerkes
hervor. Das Bonifatiuswerk unterstützt Katholiken überall dort, wo
sie in einer extremen Minderheitensituation ihren Glauben leben,
und fördert so die Seelsorge in den Bereichen der Deutschen und
Nordischen Bischofskonferenz (Schweden, Norwegen, Dänemark,
Finnland und Island) sowie in den Ländern Estland und Lettland.
Bei der traditionellen Kollekte zum Diaspora-Sonntag wurden im
Bistum Speyer 56.000 Euro und bundesweit 2,3 Millionen Euro
gesammelt. Erstkommunionkinder und Firmbewerber sammelten 43.000
Euro und 11.000 Euro für Kinder und Jugendliche in der Diaspora. Im
Bistum Speyer unterstützte das Bonifatiuswerk Projekte in Höhe von
29.000 Euro. 24.000 Euro flossen in den Bereich der Bauhilfe, 5.000
in die Glaubenshilfe.
Der Jahresbericht 2015 zeigt mehrere positive Entwicklungen. So
stiegen die Spenden um 16 Prozent auf 3,1 Millionen Euro. Ein
positiver Trend zeigte sich bei den Kollekten, die um 200.000 Euro
auf 4,87 Millionen Euro gestiegen sind. Die Anzahl der geförderten
Projekte blieb im vergangenen Jahr stabil, dafür konnten
zukunftsweisende Projekte mit einer höheren Fördersumme bedacht
werden. Auch die Kinder- und Jugendhilfe hat von dieser Entwicklung
profitiert. Der Förderbetrag stieg um 100.000 Euro. Im Bereich der
Glaubensbildung konnte das Bonifatiuswerk seine Arbeit durch
unterstützende Materialien für die Gemeinde- und Katechesearbeit
intensivieren.
„Diese Entwicklung zeigt sich auch in unserer 2015
durchgeführten Spenderbefragung, die uns dabei hilft,
Förderprojekte zielgerichteter zu adressieren. Zudem sind wir
sicher, dass unsere kontinuierliche Bildungsarbeit und unsere
pastoralen Hilfen dazu beitragen, dass die Inhalte und der Auftrag
des Bonifatiuswerkes bei unseren Spendern positiv wahrgenommen
werden“, sagte der Präsident des Bonifatiuswerkes, Heinz Paus.
 Das
Bonifatiuswerk förderte Projekte im Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz mit 6,1 Millionen Euro, in Norwegen, Schweden,
Dänemark Finnland und Island mit 1,4 Millionen Euro und in Estland
und Lettland mit 860.000 Euro. In dieser Förderung enthalten sind
77 Bauprojekte mit 3,35 Millionen Euro, 728 Projekte der Kinder-
und Jugendhilfe mit 2,1 Millionen Euro und 39 Projekte der
Glaubenshilfe mit 612.000 Euro. Durch die Verkehrshilfe konnte die
Anschaffung von 47 BONI-Bussen und Gemeindefahrzeugen für mehr als
880.000 Euro unterstützt werden. In missionarische Projekte und
Initiativen zur Neuevangelisierung sowie in die religiöse
Bildungsarbeit flossen 2,3 Millionen Euro, in die Projektbetreuung
und- begleitung rund 396.000 Euro. Aus den Mitteln des
Diaspora-Kommissariats wurden 4,6 Millionen Euro an Projekte in
Nordeuropa weitergeleitet.
Das
Bonifatiuswerk förderte Projekte im Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz mit 6,1 Millionen Euro, in Norwegen, Schweden,
Dänemark Finnland und Island mit 1,4 Millionen Euro und in Estland
und Lettland mit 860.000 Euro. In dieser Förderung enthalten sind
77 Bauprojekte mit 3,35 Millionen Euro, 728 Projekte der Kinder-
und Jugendhilfe mit 2,1 Millionen Euro und 39 Projekte der
Glaubenshilfe mit 612.000 Euro. Durch die Verkehrshilfe konnte die
Anschaffung von 47 BONI-Bussen und Gemeindefahrzeugen für mehr als
880.000 Euro unterstützt werden. In missionarische Projekte und
Initiativen zur Neuevangelisierung sowie in die religiöse
Bildungsarbeit flossen 2,3 Millionen Euro, in die Projektbetreuung
und- begleitung rund 396.000 Euro. Aus den Mitteln des
Diaspora-Kommissariats wurden 4,6 Millionen Euro an Projekte in
Nordeuropa weitergeleitet.
Insgesamt weist der Jahresbericht Einnahmen von 24 Millionen
Euro aus. Neben den oben genannten Projektförderungen wurden 4,5
Millionen Euro Rücklagen gebildet, 1,8 Millionen Euro ergeben sich
aus vermögenswirksamen Ausgaben und für die Öffentlichkeitsarbeit
und die Verwaltung wurden 1,9 Millionen Euro aufgebracht. 8,13
Prozent der Einnahmen verwendete das Bonifatiuswerk für Werbung und
Verwaltung – das ist nach Kriterien des Deutschen Zentralinstituts
für soziale Fragen, die als Maßstab angelegt werden – sehr
niedrig.
Gerade nach der Rückkehr vom 100. Katholikentag in der Diaspora
Leipzigs berichtete der Generalsekretär des Bonifatiuswerkes,
Monsignore Georg Austen, dass er bei seinen Begegnungen immer
wieder erfahren habe, wie sehr die Arbeit des Diaspora-Hilfswerks
geschätzt werde. „Für Katholiken in der Minderheit sind wir dank
unserer Spender ein verlässlicher Partner. Mit unserer
Unterstützung möchten wir eine Zukunft mitgestalten, in der unser
christlicher Glaube und unsere Werte erfahren und erlebt
werden.“
Der gesamte Jahresbericht 2015 unter: www.bonifatiuswerk.de oder hier
als PDF 
Text: Bonifatiuswerk der deutschen Katholiken, Presse Foto:
Patrick Kleibold
14.06.2016
Katholische Kirche in Beindersheim vor 100 Jahren geweiht
-01.jpg) Pontifikalamt zum Jubiläum mit Weihbischof Otto Georgens
am 19. Juni
Pontifikalamt zum Jubiläum mit Weihbischof Otto Georgens
am 19. Juni
Beindersheim- (is). Seit fast 100
Jahren begleitet die Kirche Hl. Kreuz, St. Peter und St. Nikolaus
die katholische Gemeinde in Beindersheim durch die Zeit. Noch
während des ersten Weltkrieges, am 19. Juni 1916, weihte der
damalige Bischof von Speyer, Michael von Faulhaber, das im
neobarocken Stil errichtete Gebäude. Auf den Tag genau 100 Jahre
später begeht die Pfarrei am 19. Juni ihr großes Jubiläumsfest. Um
10.30 Uhr feiert Weihbischof Otto Georgens mit Pfarrer Andreas
Rubel ein Pontifikalamt in der Kirche, in dessen Rahmen die
spätromantische Kämmerer-Orgel von 1927 nach aufwendiger und
liebevoller Restaurierung wieder in Betrieb genommen wird. Die
musikalische Umrahmung des Gottesdienstes übernehmen außerdem der
Kirchenchor, Blechbläser aus der Pfarrei sowie das Ensemble
Quintuno.
Im Anschluss an den Gottesdienst findet rings um die Kirche ein
großes Pfarrfest für die ganze Familie statt. Wer sich für die
Geschichte der Kirche interessiert, kann eine aus Fotografien und
persönlichen Leihgaben zusammengestellte Ausstellung besichtigen.
Weiterhin werden Orgelführungen sowie ein Jubiläums- und
Kräutermarkt angeboten. Ebenso ist ein Programm für Kinder und
Jugendliche geplant. Seinen offiziellen Abschluss findet der
Jubiläumstag mit der gemeinsamen Vesper um 17 Uhr in der
Kirche.
Auf das Jubiläum haben sich die Gemeindemitglieder fast ein
ganzes Jahr lang vorbereitet. Nahezu jeden Monat gab es eine
zentrale Veranstaltung, an denen alle Gruppen aus der Gemeinde
mitwirkten - so gab es zum Beispiel die Aktion „Kirche im Licht“
mit der Kolpingsfamilie, den Evensong der Chöre im Advent als
ökumenischen Schwerpunkt sowie ein gemeinsames Essen mit
Flüchtlingsfamilien und viele weitere Aktionen. Foto:
dak
13.06.2016
Ehrliche Begegnung mit kritischen Fragen
 Visitation des Kirchenbezirks Zweibrücken – Gespräche in
schwieriger Situation
Visitation des Kirchenbezirks Zweibrücken – Gespräche in
schwieriger Situation
Zweibrücken- (lk). Visitation heißt,
dass man sich wechselseitig gestattet, auch kritische Fragen zu
stellen. Unter diesem Leitwort steht nach Ansicht von
Kirchenpräsident Christian Schad der Besuch der Kirchenleitung der
Evangelischen Kirche der Pfalz im Kirchenbezirk Zweibrücken. In den
fünf Tagen biete sich die Chance, „dass wir alle voneinander lernen
und uns wechselseitig bereichern; dass wir unsere Talente und
Begabungen so einsetzen, dass sie dem Auftrag der Kirche
entsprechen und wir gemeinsam neue Impulse für die Arbeit und das
christliche Leben vor Ort entdecken“, sagte Schad vor rund 240
Besuchern des „Abends der Begegnung“ im Foyer des
Oberlandesgerichts in Zweibrücken.
Die Visitation, die von einem geschäftlichen Teil über Gespräche
mit Mitarbeitern bis zu einem externen Betriebsbesuch reiche, sei
eine „ehrliche Begegnung“, erklärte der Kirchenpräsident. Dies
setze voraus, dass sich Besuchende und Besuchte als Partner
verstünden und dazu bereit seien, sich in die Lage des jeweils
Anderen zu versetzen. „Es soll nicht so sein, dass die Besuchenden
meinen, alles besser zu wissen, und die Besuchten ihre Haltung als
die einzig richtige ansehen“, sagte Schad. Es solle spürbar werden:
„Wir gehören zusammen: die einzelnen Kirchengemeinden und Dienste,
der Kirchenbezirk und die Landeskirche insgesamt.“
Landrat Hans Jörg Duppré, der für den Landkreis Südwestpfalz und
die Stadt Zweibrücken sprach, erinnerte an die gemeinsamen Aufgaben
der Kommunen und Kirchen. Dies gelte nicht nur für die
Zusammenarbeit in den Bereichen der Kindertagesstättenarbeit oder
die Zusammenarbeit in sozial-diakonischen Beratungsstellen.
Angesichts der Ängste der Mitarbeiter und Bürger im Blick auf die
Situation des Evangelischen Krankenhauses und der Sorge, dass in
der Region „die Lichter ausgehen“, erinnerte Duppré an ähnliche
Situationen vor 37 Jahren, als die Schuhindustrie in der
Südwestpfalz in einer Umstrukturierungsphase gewesen sei. Damals
habe man vergeblich auf Hilfe von Außen gewartet. Die Lichter seien
jedoch nicht ausgegangen, „weil die Menschen hier zusammen
gestanden haben“, sagte der Landrat.
Theophil Gallo, Landrat des Saarpfalz-Kreises, betonte, dass die
sich schnell verändernden Rahmenbedingungen gerade im
Gesundheitsbereich diakonische Träger und Kommunen vor schwere
Entscheidungen stellten. Die Zusammenarbeit von „Kirche und Welt“
sei von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Dekan Johannes Pioth von
der katholischen Kirche unterstrich die gemeinsamen
Herausforderungen im Blick auf die oft als bedrohlich empfundenen
Veränderungen, die das Leben der Menschen prägten. Das alte
kirchliche Argument, „wir machen es so, weil es halt schon immer so
war“, reiche nicht mehr. „Wir müssen gemeinsam Projekte angehen, um
die Probleme anzugehen“, sagte Pioth.
Humorvoll schloss der Vizepräsident des Oberlandesgerichts (OLG)
Zweibrücken und „Schlossherr“, Jörg Hoffmann, den Reigen der
Grußwortredner mit einem Abriss über die Geschichte des Zweibrücker
Schlosses. Die kirchliche Veranstaltung im Gebäude des OLG erinnere
daran, „dass auch wir weltlichen Richter uns einmal in der Hoffnung
auf milde Behandlung vor dem Jüngsten Gericht zu verantworten
haben“, sagte Hoffmann schmunzelnd.
Zum Abend der Begegnung waren in den Festsaal des Zweibrücker
Schlosses rund 240 Vertreter des öffentlichen Lebens gekommen,
darunter der ehemalige Zweibrücker Landtagsabgeordnete Fritz Presl,
Professor Michael Hüttenhoff von der Fachrichtung Theologie an der
Universität des Saarlandes sowie der Leiter des
Dienstleistungszentrums Zweibrücken der Bundeswehr, Hans-Helmut
Lenzen. Unter den Gästen waren aus den benachbarten rheinischen
Kirchenkreisen die beiden Superintendenten Gerhard Koepke und
Christian Weyer anwesend. Die künstlerische Gestaltung des Abends
hatte Jakob Seel mit klassischer und zeitgenössischer Musik am
Violoncello übernommen.
Zu Beginn des zweiten Visitationstages besuchte die Kommission
unter Leitung von Kirchenpräsident Christan Schad die
Maschinenfabrik Pallmann. Firmenchef Hartmut Pallmann erläuterte
dabei die Herausforderungen eines mittelständischen Unternehmens.
Die Firma verbinde seit 100 Jahren Tradition und Innovation und sei
in der Lage die Innovationen dank qualifizierter Mitarbeiter
schnell in anspruchsvolle, marktgerechte Produkte umzusetzen. Nur
so könne man sich auf dem Weltmarkt behaupten.
Der Protestantische Kirchenbezirk Zweibrücke erstreckt sich über
die Landesgrenzen des Saarlandes und Rheinland-Pfalz von St.
Ingbert im Westen bis Rieschweiler im Osten. Der Kirchenbezirk hat
36.238 Gemeindemitglieder in 36 Kirchengemeinden. In ihm arbeiten
allein im Kindertagesstättenbereich rund 400 Mitarbeiterinnen.
12.06.2016
Gesundheitsversorgung muss gesichert bleiben
 13.000
Unterschriften für den Erhalt des Evangelischen Krankenhauses
Zweibrücken übergeben
13.000
Unterschriften für den Erhalt des Evangelischen Krankenhauses
Zweibrücken übergeben
Zweibrücken- (lk). Eine von rund
13.000 Bürgern unterzeichnete Unterschriftenliste zum Erhalt der
Arbeitsplätze im Evangelischen Krankenhauses Zweibrücken haben
Vertreter der Mitarbeitervertretung an Kirchenpräsident Christian
Schad übergeben. Zu Beginn eines „Abends der Begegnung“ im Rahmen
der Visitation des Kirchenbezirks Zweibrücken erklärte der
stellvertretende Vorsitzende der Mitarbeitervertretung, Thomas
Stauder, die Liste belege die Verwurzelung des Krankenhauses in
Stadt und Region. „Wir Mitarbeiter leisten seit vielen Jahren gute
Arbeit und tragen dazu bei, dass sich die Patienten im
‚Evangelischen‘ gut aufgehoben fühlen“, sagte Stauder.
In Arztpraxen, Geschäften und bei Veranstaltungen habe die
Unterschriftenliste ausgelegen. Sie drücke die Solidarität,
Anerkennung und Wertschätzung der Bürger „für unsere Arbeit aus“,
erläuterte Stauder. Das Krankenhaus sei ein wertvoller
Standortfaktor, die Gesundheitsversorgung in Zweibrücken müsse auch
künftig gesichert bleiben. Mitarbeitervertreterin Susann Carius
schilderte an ihrem persönlichen Beispiel die Existenzängste der
Belegschaft. Sie selbst sei seit 38 Jahren am Evangelischen
Krankenhaus, „nun wird alles zerstört“.
Carius erinnerte an die vom Landesverein für Innere Mission
(LVIM) erstellten Leitlinien, in denen unter anderen der Satz stehe
„Der Nächste ist Mensch“. „Wir haben uns an die Leitlinien
gehalten, der Träger LVIM hat sie mit Füßen getreten“, sagte
Carius. Es sei „unchristlich und beschämend“, was mit den
Mitarbeitern geschehe. „Wir werden zur Schlachtbank geführt“,
erklärte Susann Carius vor den Gästen des Begegnungsabends und den
still protestierenden Mitarbeitern.
Kirchenpräsident Schad betonte bei der Entgegennahme der
Unterschriftenliste, er habe gleich zu Beginn den Fokus auf die
Probleme des Landesvereins richten wollen, „um deutlich zu machen,
dass uns in Speyer die Situation hier wohl bewusst ist“. Er wisse,
wie viel Vertrauen in den letzten Monaten verloren gegangen sei.
Darum habe er sich bereits während der Demonstration für den Erhalt
des Krankenhauses am 23. April den Vorwürfen der Bürgerinnen und
Bürger gestellt. „Ich habe sehr genau gespürt, dass das
Evangelische Krankenhaus für viele von Ihnen wirklich eine
Herzenssache ist“, sagte Schad.
Der Kirchenpräsident war gemeinsam mit Diakoniedezernent Manfred
Sutter am Vortag zum Gespräch mit der Mitarbeitervertretung und der
Ärzteschaft zusammen gekommen. Dabei versicherten beide in ihrer
Funktion als Vorsitzende der Verwaltungsräte der Diakonissen
Speyer-Mannheim und des Landesvereins für Innere Mission, dass sie
sich für eine Fusion beider diakonischer Träger stark machten, um
so „die übrigen 1.400 Arbeitsplätze des Landesvereins zu sichern,
ohne die 4.500 Stellen bei den Diakonissen Speyer-Mannheim zu
gefährden“. Damit sei auch im Altenhilfezentrum
Johann-Hinrich-Wichern-Haus die Arbeit gesichert.
Im Blick auf die beiden Optionen, einer gemeinsamen Lösung mit
dem Nardini-Klinikum für den Bereich der Inneren Medizin oder einer
Investorenlösung, werde der Landesverein für nahezu alle
Mitarbeiter des Evangelischen Krankenhauses Zweibrücken adäquate
Arbeitsplätze in der Region vermitteln. Für die übrigen sollen
soziale Härten abgefedert werden, sagte Schad.
12.06.2016
BFD-Stellen für Flüchtlinge – Jetzt bewerben!
 Speyer-
(dwp). Die Diakonie Pfalz hat noch freie Plätze für
Flüchtlinge im Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die Plätze
stammen aus dem Sonderprogramm der Bundesregierung
"Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug". „Wir ermutigen
Flüchtlinge, diese Chance zu ergreifen und sich bei uns zu
bewerben. Wir bitten auch Haupt- und Ehrenamtliche in der
Flüchtlingshilfe, die Flüchtlinge auf diese Möglichkeit aufmerksam
zu machen“, sagt Erika Münzer-Siefert, Leiterin des Referats
Freiwilligendienste bei der Diakonie Pfalz.
Speyer-
(dwp). Die Diakonie Pfalz hat noch freie Plätze für
Flüchtlinge im Bundesfreiwilligendienst (BFD). Die Plätze
stammen aus dem Sonderprogramm der Bundesregierung
"Bundesfreiwilligendienst mit Flüchtlingsbezug". „Wir ermutigen
Flüchtlinge, diese Chance zu ergreifen und sich bei uns zu
bewerben. Wir bitten auch Haupt- und Ehrenamtliche in der
Flüchtlingshilfe, die Flüchtlinge auf diese Möglichkeit aufmerksam
zu machen“, sagt Erika Münzer-Siefert, Leiterin des Referats
Freiwilligendienste bei der Diakonie Pfalz.
Um Flüchtlingen im BFD den Einstieg zu erleichtern, gibt es ein
besonderes Begleitkonzept, zu dem neben der Vorbereitung auf die
Arbeit in der Einsatzstelle auch Sprachkurse und Unterstützung bei
Alltagsfragen gehören. Voraussetzung für den Antritt einer
BFD-Stelle und die damit verbundene intensive Betreuung ist die
Registrierung als Flüchtling. Prinzipiell stehen den Flüchtlingen
alle Einsatzstellen offen, die die Diakonie Pfalz anbietet.
„Natürlich prüfen wir wie bei allen unseren Freiwilligen, ob die
Interessen und Fähigkeiten der Bewerber mit den Anforderungen der
Stelle übereinstimmen. Das ist fester Bestandteil aller
Bewerbungsverfahren“, erläutert Münzer-Siefert.
Auf die Diakonie Pfalz entfallen 20 Plätze aus dem
Sonderprogramm. BFD-Stellen mit Flüchtlingsbezug sind einerseits
Stellen, in denen Freiwillige mit Flüchtlingen arbeiten,
andererseits BFD-Stellen für Flüchtlinge. Viele
Stellen für die Arbeit mit Flüchtlingen sind bereits besetzt.
Im Bundesfreiwilligendienst erhalten Freiwillige monatlich ein
Taschengeld von rund 330 Euro sowie die Fahrtkosten vom Wohnort zur
Arbeitsstelle. Im Sonderprogramm müssen die Bewerberinnen und
Bewerber 18 Jahre alt sein und aus „nicht sicheren
Herkunftsländern“ stammen. Das Diakonische Werk Pfalz hat sich aber
entschlossen, auch minderjährigen Flüchtlingen und Menschen aus
sogenannten „sicheren Herkunftsländern“ den Freiwilligendienst zu
ermöglichen „Das heißt, wir bieten ihnen außerhalb dieses
Sonderkontingents einen Platz im Bundesfreiwilligendienst oder ein
Freiwilliges Soziales Jahr an“, sagt Münzer-Siefert. Dabei können
volljährige Freiwillige zeitnah in den Freiwilligendienst starten,
bei den Minderjährigen sind ab Sommer wieder Plätze frei.
Bewerbungen bitte online über die Homepage
www.diakonie-pfalz.de/ich-moechte-helfen/bundesfreiwilligendienst.html.
Rückfragen und weitere Auskünfte gibt es per Mail an fsj@diakonie-pfalz.de oder
telefonisch unter 06232 664-291.
Text: Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche der Pfalz,
Presse
09.06.2016
Nachhaltig handeln und die Schöpfung bewahren
 Klimaschutzinitiative: Zehn „Vorbildgemeinden 2016“
ausgezeichnet
Klimaschutzinitiative: Zehn „Vorbildgemeinden 2016“
ausgezeichnet
Speyer- (lk). Ob cleveres
Energiemanagement, energetische Gebäudesanierung, die Einführung
des Umweltmanagementsystems „Grüner Gockel“ oder ein die Umwelt
schonendes Mobilitätsverhalten – im Rahmen der
Klimaschutzinitiative der pfälzischen Landeskirche zeigen
protestantische Kirchengemeinden in der Pfalz und Saarpfalz, wie
nachhaltiges Handeln funktioniert. Die Evangelische Kirche der
Pfalz hat auch in diesem Jahr wieder zehn „Vorbildgemeinden“
ausgezeichnet, die mit finanzierbaren und technisch durchdachten
Projekten und Maßnahmen zur Bewahrung der Schöpfung beitragen. Eine
von der landeskirchlichen Arbeitsstelle Frieden und Umwelt
herausgegebene Broschüre stellt die Kirchengemeinden vor.
 „Vorbildgemeinden 2016“ sind Altenglan,
Bruchhof-Sanddorf, Dierbach, Essingen-Dammheim-Bornheim, die
Gedächtniskirchengemeinde in Speyer, Gries, Haßloch, die
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Hochspeyer, die Lutherkirchengemeinde
in Frankenthal und die Johannes-Kirchengemeinde Mußbach. Diese
Kirchengemeinden hätten u.a. dazu beigetragen, dass die pfälzische
Landeskirche bis zum Jahr 2015 das Ziel erreicht habe, im
Gebäudebereich 25 Prozent des klimaschädlichen Gases
Kohlenstoffdioxid (CO₂) einzusparen, erklärt Kirchenpräsident
Christian Schad in seinem Vorwort zu der Broschüre. Jeder Schritt
bringe die Weltgemeinschaft dem Ziel näher, die Erderwärmung zu
begrenzen. Entsprechend einem Beschluss der Frühjahrssynode
unterstützt die Landeskirche auch das auf Ebene der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) vereinbarte Ziel, den CO₂-Ausstoß bis
2020 um 40 Prozent (gemessen am Basisjahr 2005) zu reduzieren.
„Vorbildgemeinden 2016“ sind Altenglan,
Bruchhof-Sanddorf, Dierbach, Essingen-Dammheim-Bornheim, die
Gedächtniskirchengemeinde in Speyer, Gries, Haßloch, die
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Hochspeyer, die Lutherkirchengemeinde
in Frankenthal und die Johannes-Kirchengemeinde Mußbach. Diese
Kirchengemeinden hätten u.a. dazu beigetragen, dass die pfälzische
Landeskirche bis zum Jahr 2015 das Ziel erreicht habe, im
Gebäudebereich 25 Prozent des klimaschädlichen Gases
Kohlenstoffdioxid (CO₂) einzusparen, erklärt Kirchenpräsident
Christian Schad in seinem Vorwort zu der Broschüre. Jeder Schritt
bringe die Weltgemeinschaft dem Ziel näher, die Erderwärmung zu
begrenzen. Entsprechend einem Beschluss der Frühjahrssynode
unterstützt die Landeskirche auch das auf Ebene der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) vereinbarte Ziel, den CO₂-Ausstoß bis
2020 um 40 Prozent (gemessen am Basisjahr 2005) zu reduzieren.
Insgesamt wurden bisher im Rahmen der Klimaschutzinitiative der
pfälzischen Landeskirche 20 Vorbildgemeinden ausgezeichnet. Auch
für 2017 sind wieder Bewerbungen bei der Arbeitsstelle Frieden und
Umwelt der Evangelischen Kirche der Pfalz möglich. Für gelungen
umgesetzte Konzepte werden 1000 Euro ausgelobt.
Klimaschutzmanagerin Sibylle Wiesemann und Umweltbeauftragte Bärbel
Schäfer bieten Bewerbern u.a. technische Beratung, Weiterbildung,
Vermittlung von Fördergeldern und persönliche Begleitung an. „Von
der Kirchengemeinde über die Kitas bis zur Verwaltung – alle
kirchlichen Ebenen werden aktiv für die Bewahrung der
Schöpfung.“
Hinweis: Die Broschüre „Vorbildgemeinden 2016“ sowie
weitere Informationen sind erhältlich bei der Arbeitsstelle Frieden
und Umwelt, Große Himmelsgasse 3, 67346 Speyer, Telefon
06232/6715-14, E-Mail: umwelt@frieden-umwelt-pfalz.de.
Mehr zum Thema: www.frieden-umwelt-pfalz.de.
Oder lesen Sie die Broschüre hier als PDF

07.06.2016
»Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer« startet neue Informationsplattform rund um das UNESCO-Weltkulturdenkmal
 Gelungene Premiere: Unter www.stiftung-kaiserdom.de ist ab sofort der neue Internetauftritt der »Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer« online erreichbar.
Gelungene Premiere: Unter www.stiftung-kaiserdom.de ist ab sofort der neue Internetauftritt der »Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer« online erreichbar.
Speyer– Um auf die vielfältigen Aktivitäten für das
UNESCO-Weltkulturdenkmal Kaiserdom zu Speyer aufmerksam zu machen,
nutzt die »Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer« ab sofort eine
neue Internetseite. Unter www.stiftung-kaiserdom.de
finden Interessenten aktuelle Termine und Veranstaltungshinweise,
Informationen über die gemeinnützige Arbeit der Stiftung sowie
Unterstützungsmöglichkeiten für deren Aktionen.
Aktuelle Onlineangebote sollen – analog zum Stiftungsauftrag
– dazu beitragen, die Kathedrale ins Bewusstsein der Menschen zu
bringen …
Analog zum Auftrag und dem Engagement der »Europäischen Stiftung
Kaiserdom zu Speyer« soll auch der neue Webauftritt dazu beitragen,
die Kathedrale und seine Geschichte ins Bewusstsein der Menschen zu
bringen. Besonderer Wert wurde auf eine übersichtliche Struktur der
neuen Internetseite gelegt. Parallel zu der am 18. Juni beginnenden
Jahresaktion „Die Pfalz liest für den Dom“ werden die
unterschiedlichen Patenschaftsangebote für Steine, Säulen und
Projekte der Stiftung vorgestellt. So können sich beispielsweise
Interessenten über eine Planzeichnung verfügbare freie
Steinpatenschaften ansehen. Informationen über Zustiftungen und
Spenden runden das Angebot für Unterstützer ab.
Downloadmöglichkeit für Online-Spiel „Geheimnisse des
Kaiserdomes“
Baugeschichtlich Interessierte finden – ergänzend zu einer
kurzgefassten Geschichte des Kaiserdomes – eine Chronik sowie
aktuelle Publikationen der »Europäischen Stiftung Kaiserdom zu
Speyer«. Als weiteres Extra kann das Online-Spiel „Geheimnisse des
Kaiserdomes. Die Heiligen der Dom-Ausmalung von Johann Schraudolph
im 19. Jahrhundert“ kostenlos heruntergeladen werden. Dieses wurde
von der „Dietmar Hopp Stiftung“ ermöglicht.
Aktuelle Nachrichten der Stiftung werden mit Inhalten aus dem
Bistum und der Bistumszeitung „der pilger“ als Zusatzinformationen
ergänzt. Dies geschieht, um weitere Informationen rund um den
Kaiserdom zu bieten und den Newswert für regelmäßige Besucher der
Stiftungsseiten zu erhöhen. Im Sinne einer bestmöglichen Vernetzung
nutzt www.stiftung-kaiserdom.de
die technische Basis der modular erweiterbaren „Webseiten-Familie“
im Bistum Speyer. Diese umfasst bereits zahlreiche Pfarreien,
Dekanate und auch die offizielle Webseite des Bistums Speyer.
Die Projektverantwortlichen wurden bei der technischen Umsetzung
des Internet-Redaktionssystems begleitet. Die Konzeptentwicklung
zur Erstellung der Webseiten-Familie verantwortet die Peregrinus
GmbH, der Verlag, in dem die Bistumszeitung „der pilger“
erscheint.
Interessenten und Förderer finden unter www.stiftung-kaiserdom.de
ab sofort vielfältige Informationen über gemeinnützige
Stiftungsarbeit und deren Aktionen
Text: Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer, Presse Foto:
Peregrinus GmbH, Presse
06.06.2016
100.000 Besucherin im Kaisersaal des Speyerer Doms begrüßt
 Elli Zimpelmann aus
Limburgerhof freute sich über Blumen und einen Katalog aus der Hand
des Domkustos Peter Schappert
Elli Zimpelmann aus
Limburgerhof freute sich über Blumen und einen Katalog aus der Hand
des Domkustos Peter Schappert
Speyer- „Ich freue mich sehr, dass ich heute
die 100.000 Besucherin im Kaisersaal willkommen heißen darf“,
so Domkapitular Peter Schappert. Elli Zimpelmann aus
Limburgerhof nahm am Freitag, 3. Juni, überrascht und erfreut die
Glückwünsche des Domkustos entgegen. Die Presbyterin der
Protestantischen Kirchengemeinde Limburgerhof besuchte zusammen mit
ihren Presbyteriumskolleginnen und -kollegen sowie Pfarrer Martin
Grimm den Kaisersaal im Rahmen einer Führung.
Zimpelmann war es auch, die Idee zu dem Besuch im Kaisersaal
hatte: „Wir machen jedes Jahr einen gemeinsamen Ausflug und da ich
selbst schon im Kaisersaal war, habe ich den Vorschlag zum Besuch
dort gemacht.“ Als 100.000 Besucherin seit der Eröffnung des
Kaisersaals im November 2012 erhielt Elli Zimpelmann neben einem
Blumenstrauß auch der Katalog zur Präsentation der
Schraudolph-Fresken, die seit 2012 im Kaisersaal zu sehen ist.
 „Von Beginn an ist
die Öffnung von Kaisersaal und Aussichtsplattform eine
Erfolgsgeschichte.“, freute sich Domkapitular Peter Schappert. „Im
direkten Kontakt mit den Besuchern und über unsere
Besucherbefragung bekommen wir sehr viel positiven Zuspruch. Gelobt
werden hier vor allem die Freundlichkeit unserer Besucherbegleiter
und die eindrucksvolle Gestaltung des Raums“.
„Von Beginn an ist
die Öffnung von Kaisersaal und Aussichtsplattform eine
Erfolgsgeschichte.“, freute sich Domkapitular Peter Schappert. „Im
direkten Kontakt mit den Besuchern und über unsere
Besucherbefragung bekommen wir sehr viel positiven Zuspruch. Gelobt
werden hier vor allem die Freundlichkeit unserer Besucherbegleiter
und die eindrucksvolle Gestaltung des Raums“.
Im November 2012 wurden Kaisersaal und die Aussichtsplattform
auf dem Südwestturm erstmals öffentlich zugänglich gemacht. Seither
haben während der Sommermonate Touristen und Einheimische die
Gelegenheit, den über der Vorhalle gelegenen Saal mit einer
Präsentation monumentaler Fresken des 19. Jahrhunderts zu
besichtigen. Von dort aus geht es hinauf zur Turmspitze, von wo aus
sich ein einmaliger Rundblick über die Stadt und das Umland bietet.
Pro Saison, die von April bis Oktober geht, besuchen
durchschnittlich 30.000 Menschen die beiden Attraktionen im Westbau
des Speyerer Doms. Text: Bistum Speyer, Presse Foto:
dak
04.06.2016
Generalvikar Dr. Franz Jung vollendet das 50. Lebensjahr
 Speyer- (is). Seinen 50. Geburtstag
feiert heute, am Samstag, den 4. Juni, der Speyerer Generalvikar
Dr. Franz Jung. Der aus Ludwigshafen stammende Geistliche hat in
Rom und München studiert und wurde 1992 in Rom zum Priester
geweiht. Seit dem Jahr 2009 leitet er als Generalvikar das
Bischöfliche Ordinariat des Bistums Speyer und ist damit der engste
Mitarbeiter des Speyerer Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
Speyer- (is). Seinen 50. Geburtstag
feiert heute, am Samstag, den 4. Juni, der Speyerer Generalvikar
Dr. Franz Jung. Der aus Ludwigshafen stammende Geistliche hat in
Rom und München studiert und wurde 1992 in Rom zum Priester
geweiht. Seit dem Jahr 2009 leitet er als Generalvikar das
Bischöfliche Ordinariat des Bistums Speyer und ist damit der engste
Mitarbeiter des Speyerer Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
Mit der Entwicklung eines neuen Seelsorgekonzepts und der
Erneuerung der Pfarreienstruktur im Rahmen des Prozesses
„Gemeindepastoral 2015“ wurden in dieser Zeit wichtige
Richtungsentscheidungen für die kommenden Jahre getroffen.
Zum Bistum Speyer, das sich über die gesamte Pfalz und den
Saarpfalzkreis erstreckt, zählen rund 550.000 Katholikinnen und
Katholiken.
Vor seiner Berufung zum Generalvikar hatte Jung die Abteilung
Gemeindeseelsorge des Bischöflichen Ordinariats geleitet und war
zugleich Referent für die klösterlichen Verbände. Seit dem Jahr
2008 gehört Franz Jung als Domkapitular dem Speyerer Domkapitel
an.
04.06.2016
125 Jahre Verbot der Sonntagsarbeit
 DGB und Kirchen in
Rheinland-Pfalz setzen sich für den Sonntagsschutz ein
DGB und Kirchen in
Rheinland-Pfalz setzen sich für den Sonntagsschutz ein
Mainz- Im Juni 1891, vor 125 Jahren, trat
das Verbot der Sonntagsarbeit in Kraft – ein sozialpolitischer und
arbeitsrechtlicher Meilenstein. Die Industrialisierung hatte zuvor
den durch Kaiser Konstantin 321 eingeführten Sonntag als
verbindlichen Feiertag ausgehebelt. In den vergangenen Jahren wurde
erneut die Sonntagsruhe durch die Feiertagsgesetzgebung und die
Novellierung der Ladenschlussgesetze in vielen Fällen aufgeweicht.
Schon jetzt arbeiten rund elf Millionen Beschäftigte in Deutschland
auch an Sonn- und Feiertagen. In Rheinland-Pfalz setzen sich der
Deutsche Gewerkschaftsbund und die Kirchen gemeinsam dagegen
ein.
„Wir dürfen nicht weiter auf dem Weg in die
7-Tage-24-Stunden-Gesellschaft gehen. Immer mehr Flexibilisierung,
Arbeit an Wochenenden – das greift in das Privat- und Familienleben
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein. Deshalb ist eine immer
weitere Aufweichung der Sonntagsruhe für die Beschäftigten
unzumutbar. Einen Tag in der Woche können und müssen die Geschäfte
geschlossen bleiben", so Dietmar Muscheid, Vorsitzender des DGB
Rheinland-Pfalz / Saarland.
In gemeinsamen Bündnissen – wie beispielsweise die Allianz für
den freien Sonntag – engagieren sich Kirchen und DGB-Gewerkschaften
vielerorts gegen eine Ausweitung der Sonntagsarbeit und verweisen
dabei auch darauf, dass die staatliche Schutzgarantie für Sonn- und
Feiertage sogar Verfassungsrang genießt (Art. 140 GG).
„Der arbeitsfreie Tag, der zur jüdisch-christlichen Tradition
gehört, erinnert daran, dass Menschen nicht nur zur Arbeit
geschaffen sind und unsere Würde nicht an unserer Leistung hängt“,
sagen der pfälzische Oberkirchenrat Gottfried Müller und die
stellvertretende Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in
Hessen und Nassau, Ulrike Scherf. „Der Sonntag sorgt für eine
gemeinschaftliche Unterbrechung des Arbeitsalltags. Das tut dem
Menschen gut – jedem Einzelnen und der Gesellschaft im Ganzen“, so
Dr. Johann Weusmann, Vizepräsident der Evangelischen Kirche im
Rheinland. Der Sonntag biete dem Menschen Raum, sich auf das
Wesentliche im Leben zu besinnen sowie Zeit für gemeinsame
kulturelle Veranstaltungen, Sport, den Besuch der Gottesdienste
aber auch die Pflege von freundschaftlichen und familiären
Kontakten.
Hans-Georg Orthlauf-Blooß vom Referat Berufs- und Arbeitswelt
des Bistum Mainz, Regionalstelle Rheinhessen ergänzt: „Immer wieder
erleben wir Vorstöße von Politik und Wirtschaft, die darauf
gerichtet sind, den arbeitsfreien Sonntag weiter auszuhöhlen. Wir
erleben eine Ökonomisierung aller Lebensbereiche, stattdessen
sollte man sich im gesamtgesellschaftlichen Interesse aber wieder
auf den Sonntag als echten Ruhetag besinnen“. dgb/lk
01.06.2016
Wahl der Landauer Landessynodalen bestätigt
Das Verfassungs- und Verwaltungsgericht weist die
Anfechtung ab
Speyer / Neustadt- Die Vertreter des
Kirchenbezirks Landau in der Landessynode der Evangelischen Kirche
der Pfalz sind rechtmäßige Mitglieder der Landessynode. Der
Landauer Pfarrer Friedhelm Hans hat ihre Wahl ohne Erfolg
angefochten. Seine Klage wurde jetzt vom Verfassungs- und
Verwaltungsgericht der Evangelischen Kirche der Pfalz abgewiesen.
Der Entscheidung ging eine mündliche Verhandlung voraus. Eine
Urteilsbegründung liegt noch nicht vor.
Die Wahl des geistlichen Vertreters, Dekan Volker Janke, und der
beiden weltlichen Vertreter, Chefarzt Eberhard Rau und
Politikwissenschaftler Ulrich Sarcinelli, waren von Pfarrer Hans
u.a. mit der Begründung angefochten worden, die beiden weltlichen
Vertreter gehörten keinem Presbyterium an und dies sei in der
Wahlsitzung nicht bekannt gewesen. Das entspreche nicht dem Wesen
der pfälzischen Landeskirche, die sich von unten nach oben
aufbaue.
Sowohl Landeskirchenrat als auch Kirchenregierung hatten zuvor
den Einspruch des Landauer Pfarrers als unbegründet zurückgewiesen.
Die drei betroffenen Synodalen wurden nach einem Beschluss des
Verfassungs- und Verwaltungsgerichts vom Juli 2015 bereits
vorläufig zur Landessynode zugelassen. Gegen diese Entscheidung
hatte Hans beim Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in
Deutschland (EKD) Beschwerde erhoben. Der Gerichtshof hatte im
November 2015 die Beschwerde verworfen. lk
31.05.2016
"Barmherzigkeit verändert die Welt"
 Fronleichnamsprozession: Bischof Wiesemann ruft zu
Solidarität auf / Rund 1000 Gläubige begleiten den Weg
Fronleichnamsprozession: Bischof Wiesemann ruft zu
Solidarität auf / Rund 1000 Gläubige begleiten den Weg
Speyer- Von der Zentralkirche St. Joseph
der Großpfarrei "Pax Christi" aus zogen gestern Morgen rund 1000
Gläubige nach einem Pontifikalamt über die Gilgenstraße und die
Maximilianstraße in Richtung Dom, um dort gemeinsam den feierlichen
Abschluss der Prozession zu Fronleichnam zu begehen. Das Leitwort
des Jahres, "Barmherzigkeit verändert die Welt", wurde den Christen
von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ans Herz gelegt. Er rief dazu
auf, den "Rigorismus in der Lehre und den Laxismus im Leben"
auszugleichen durch das Begehen des göttlichen Herzensraumes.
Schon beim Pontifikalamt in St. Joseph hatte Wiesemann,
konzelebriert von Weihbischof Otto Georgens und den Pfarrern der
Speyerer Gemeinden, die Gläubigen dazu angehalten, Unbarmherziges
im Leben versöhnlich zu machen. In der Abschlussfeier im Dom
weitete er den Aufruf aus und sprach von einer zweiten Chance, die
jeder Mensch verdient habe, wenn er Unrecht bereut. Dazu
gehöre, den mittleren Weg zu finden zwischen Strenge und
Nachsicht.
 "Dieser Weg dazwischen ist der anspruchsvollere,
schwierigere, es ist der Weg der Seelsorge", sagte Wiesemann und
wies auf die Liebe Gottes hin, die sich aber selbst für das Leiden
nicht zu schade ist. "Das Mitgehen mit dem Schicksal der einzelnen,
die Solidarität des Mitleidens bei einer Schuld - das ist die
mütterliche Kirche", betonte der Bischof mit Verweis auf die
Gottesmutter und das schützende Dach des Speyerer Mariendomes.
"Dieser Weg dazwischen ist der anspruchsvollere,
schwierigere, es ist der Weg der Seelsorge", sagte Wiesemann und
wies auf die Liebe Gottes hin, die sich aber selbst für das Leiden
nicht zu schade ist. "Das Mitgehen mit dem Schicksal der einzelnen,
die Solidarität des Mitleidens bei einer Schuld - das ist die
mütterliche Kirche", betonte der Bischof mit Verweis auf die
Gottesmutter und das schützende Dach des Speyerer Mariendomes.
Angelehnt an das Leitwort der Fronleichnamsprozession machte
Wiesemann deutlich, wie wichtig und wegweisend das gemeinsame
Suchen und Finden ist. "Das eucharistische Geheimnis der Kirche ist
der Herzenswunsch", stellte er heraus und lenkte den Blick auf die
versöhnende Aufgabe der Gläubigen in Kirche und Gesellschaft,
gerade in Zeiten der Zerrissenheit. "Das ist ein Weg", so
Wiesemann, "bei dem ich nicht nur Worte machen kann, sondern
eingebunden bin."
 Schon die
Prozession, die in vier Abschnitte - zuhören, hinsehen, hingehen
und handeln - unterteilt war, wurde getragen vom Anstoß der
Christen, es dem Herrn gleich zu tun und für die Menschen in der
konkreten Situation der Zeit da zu sein. Prozession als Gegenwart,
Bewegung und Ausrichtung auf ein Ziel wurde den Menschen ins
Bewusstsein gerufen. Die Texte, Gebete, Bibelverse und Lieder waren
vom Liturgieausschuss der Pfarrei Pax Christi entsprechend des
Leitwortes zusammengestellt worden. Sichtbares Zeichen des Glaubens
war die Monstranz mit der Hostie, die unter dem Himmel durch die
Straßen und von Wiesemann schließlich in den Dom getragen
wurde.
Schon die
Prozession, die in vier Abschnitte - zuhören, hinsehen, hingehen
und handeln - unterteilt war, wurde getragen vom Anstoß der
Christen, es dem Herrn gleich zu tun und für die Menschen in der
konkreten Situation der Zeit da zu sein. Prozession als Gegenwart,
Bewegung und Ausrichtung auf ein Ziel wurde den Menschen ins
Bewusstsein gerufen. Die Texte, Gebete, Bibelverse und Lieder waren
vom Liturgieausschuss der Pfarrei Pax Christi entsprechend des
Leitwortes zusammengestellt worden. Sichtbares Zeichen des Glaubens
war die Monstranz mit der Hostie, die unter dem Himmel durch die
Straßen und von Wiesemann schließlich in den Dom getragen
wurde.
Der Blumenteppich auf dem dortigen Vorplatz griff die
Barmherzigkeit in vielen Symbolen auf, in einem Herz, einer Taube
oder dem guten Hirten. Mit dem sakramentalen Segen wurden die
Gläubigen durch Wiesemann verabschiedet, nicht ohne die
Verlautbarung im Herzen, ein Zeichen zu setzen und das Gottesbild
eines barmherzigen Vaters weiter zum Leuchten zu bringen.
Die musikalische Gestaltung des Fronleichnamsfestes hatten der
Mädchenchor am Dom, die Speyerer Domsingknaben, die Frauen des
Domchores und die Dombläser übernommen. Die Orgel spielte
Domorganist Markus Eichenlaub. Domkapellmeister Markus Melchiori
und Domkantor Joachim Weller hatten die Gesamtleitung.
Der gemeinsame Abschluss fand bei einer Reunion in der Gemeinde
St. Joseph statt.
Text und Fotos: Susanne Kühner
27.05.2016
„Ort der persönlichen Begegnung“
-01.jpg) Dom-Besucherzentrum in Speyer feierlich eingeweiht –
hunderte Menschen besuchten bei Sonnenschein den Festakt und nutzen
die verschiedenen Angebote rund um den Dom
Dom-Besucherzentrum in Speyer feierlich eingeweiht –
hunderte Menschen besuchten bei Sonnenschein den Festakt und nutzen
die verschiedenen Angebote rund um den Dom
Speyer- Der gute Draht nach oben sorgte
für das gute Wetter: Bei strahlendem Sonnenschein und sommerlichen
Temperaturen wurde am Sonntag, den 22. Mai das neue
Dom-Besucherzentrum in Speyer feierlich eingeweiht. Weihbischof und
Dompropst Otto Georgens begrüßte die Gäste bevor er nach weiteren
Reden ein Segensgebet sprach und die Räume einweihte. Für den
feierlichen musikalischen Rahmen sorgten die Dombläser. Offen ist
die neue Anlaufstelle für Dom-Besucher schon seit dem 21. März. Die
Feier musste warten, bis wärmere Witterung auch eine Nutzung des
Außenbereichs erlaubte.
-01.jpg) Weihbischof Georgens erläuterte zu Beginn kurz die
Entstehungsgeschichte des Dom-Besucherzentrums. Die Idee dazu habe
es bereits vor zwanzig Jahren gegeben, so Georgens. Verschiedene
Pläne wurden gemacht und wieder verworfen. Umso glücklicher sei er,
dass mit der Eröffnung des Dom-Besucherzentrums nun eine echte
Lücke geschlossen werde: „Ich bin froh, dass es nun eine ständige
personelle Präsenz am Dom gibt. Ein Ort der persönlichen Begegnung,
wo alle, die etwas über den Dom wissen wollen, einen
Anknüpfungspunkt finden", freute sich der Speyerer Weihbischof.
Weihbischof Georgens erläuterte zu Beginn kurz die
Entstehungsgeschichte des Dom-Besucherzentrums. Die Idee dazu habe
es bereits vor zwanzig Jahren gegeben, so Georgens. Verschiedene
Pläne wurden gemacht und wieder verworfen. Umso glücklicher sei er,
dass mit der Eröffnung des Dom-Besucherzentrums nun eine echte
Lücke geschlossen werde: „Ich bin froh, dass es nun eine ständige
personelle Präsenz am Dom gibt. Ein Ort der persönlichen Begegnung,
wo alle, die etwas über den Dom wissen wollen, einen
Anknüpfungspunkt finden", freute sich der Speyerer Weihbischof.
Domkapitular Peter Schappert, der als Domkustos für die bauliche
Erhaltung und auch für die touristische Erschließung des Doms
zuständig ist, betonte ebenfalls, wie wichtig der persönliche
Empfang sei. „Ohne die Menschen, die unsere Besucher begrüßen und
ihnen den Dom als Kirche und Denkmal näher bringen, ist es nur ein
großer Sandsteinbau“. Vor dem Hintergrund der langen
Entstehungsgeschichte dankte der Domkustos den -01.jpg) Unterstützern des Vorhabens, ein Dom-Besucherzentrum
einzurichten. Hier hob er insbesondere die finanzielle
Unterstützung durch die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer
hervor, die das Projekt mit 140.000 Euro unterstützt hatte.
Domkapitular Schappert würdigte aber auch die gute Zusammenarbeit
mit der Stadt und Nachbarinstitutionen, wie dem Historischen Museum
der Pfalz, dem Technikmuseum und dem Sea Life.
Unterstützern des Vorhabens, ein Dom-Besucherzentrum
einzurichten. Hier hob er insbesondere die finanzielle
Unterstützung durch die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer
hervor, die das Projekt mit 140.000 Euro unterstützt hatte.
Domkapitular Schappert würdigte aber auch die gute Zusammenarbeit
mit der Stadt und Nachbarinstitutionen, wie dem Historischen Museum
der Pfalz, dem Technikmuseum und dem Sea Life.
Die gute Nachbarschaft und die gute Zusammenarbeit wurde auch
vom Oberbürgermeister der Stadt Speyer, Hansjörg Eger, betont. Er
sprach von einer „deutlichen Verbesserung des Angebots für die
Besucher der Stadt Speyer“, die mit der Eröffnung des
Dom-Besucherzentrums einhergehe. Eger lobte das gute Zusammenwirken
zwischen den Gästeführern der Stadt und den Domführern, das dazu
beitrage, die Menschen in Speyer freundlich willkommen zu heißen.
Dr. -01.jpg) Manfred Fuchs, Vorstandsvorsitzender der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer, zeigte sich in seinem Grußwort
erfreut von der Art und Weise, wie das Projekt Dom-Besucherzentrum
umgesetzt worden sei und lobte dessen Gestaltung.
Manfred Fuchs, Vorstandsvorsitzender der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer, zeigte sich in seinem Grußwort
erfreut von der Art und Weise, wie das Projekt Dom-Besucherzentrum
umgesetzt worden sei und lobte dessen Gestaltung.
Im Anschluss an den Festakt gab es ein Festprogramm. In
halbstündigem Abstand begannen kostenlose Domführungen zu
wechselnden Themen. Während des gesamten Nachmittags führte der
Steinmetz und Archäologe Arne Trautmann die Techniken zur
Gestaltung einer Inschrift in Sandstein vor und erläutert die
Arbeitsweise eines mittelalterlichen Dombaumeisters. Der
Dombauverein war mit einem Infostand präsent und veranstaltete ein
Dom-Quiz. Das Highlight des Tages war um 14 Uhr das Mailiedersingen
mit den Nachwuchschören der Dommusik. Für das leibliche Wohl
sorgte der Dommusik-Förderverein Speyer mit einem reichhaltigen
Kuchenangebot. Wer wollte, konnte mit einem Dom-Sekt auf das Wohl
des Gotteshauses anstoßen und damit gleichzeitig einen Beitrag für
die Erhaltung der UNESCO-Welterbestätte leisten. Text:
Friederike Walter; Foto: dak
23.05.2016
Buntes Glaubensfest in vielen Sprachen
.jpg) Zahlreiche Gläubige bei Wallfahrt der muttersprachlichen
Gemeinden im Dom
Zahlreiche Gläubige bei Wallfahrt der muttersprachlichen
Gemeinden im Dom
Speyer- Sie wurde zu einem bunten Fest des
Glaubens. Christen verschiedener Nationalitäten, darunter Kroaten,
Polen, Italiener, Portugiesen, Nigerianer und Vietnamesen, waren
heute, am Dreifaltigkeitssonntag, in den Speyerer Dom zur Wallfahrt
der muttersprachlichen Gemeinden gekommen. Einige von ihnen hatten
sich in ihre traditionellen Gewänder gehüllt und zogen so viele
neugierige Blicke der zahlreichen Gottesdienstbesucher auf sich.
Bereits vor dem Pontifikalamt, das Weihbischof Otto Georgens mit
Domkapitular Franz Vogelgesang sowie mit Priestern und Diakonen der
muttersprachlichen Gemeinden hielt, stimmten sich die Chöre der
verschiedenen Nationalitäten gesanglich auf den Gottesdienst
ein.
Die mehrsprachige Eucharistiefeier begann im Freien, vor der
Heiligen Pforte an der Südseite des Domes, unweit des „Ölberges“.
„Ich freue mich, dass Sie in so großer Zahl gekommen sind“,
begrüßte Georgens die Angehörigen der verschiedenen Kulturen. „Wir
gehen durch die Heilige Pforte, denn wir sind mitten im Jahr der
Barmherzigkeit, das Papst Franziskus ausgerufen hat“, erläuterte
der Weihbischof. Dies sei ein Zeichen. Jesus habe gesagt: „Ich bin
die Tür. Wer durch mich geht, wird das Leben finden. Ich bin
gekommen, dass Ihr es in Fülle habt.“ Den Gläubigen rief Georgens
zu: „Wir stehen gemeinsam in der Weltkirche in einer Gemeinschaft
zusammen.“
.jpg) In
seiner Predigt stellte der Weibischof die Gottlosigkeit im Leben
der Menschen in den Mittelpunkt. Gott tauche im Alltag nicht mehr
auf, beklagte Georgens. Er habe sich in den Raum der religiösen
Sprache, in den Kirchenraum zurückgezogen, komme in
Sonntagspredigten und in der Bistumszeitung vor. Die Aufgabe der
Christen bestehe darin, Gott in unserer Welt einen Platz zu
sichern. Wenn der christliche Glaube von Gott spreche, dann sei
Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeint, betonte Georgens und nahm
damit Bezug auf den Dreifaltigkeitssonntag, der alljährlich am
Sonntag nach Pfingsten gefeiert wird. „Die Wallfahrt der
muttersprachlichen Gemeinden zum Dom sei ein eindrucksvolles
Bekenntnis zum dreifaltigen Gott. Menschen unterschiedlicher
Sprache und Herkunft – in einem Geist vereint – beten und singen
miteinander und geben so Zeugnis von ihrem gemeinsamen Glauben.“ So
zeige sich Kirche im Bild des dreieinigen Gottes: Sie bewahre das
Wertvolle der einzelnen Völker und stifte zugleich eine neue große
Einheit.
In
seiner Predigt stellte der Weibischof die Gottlosigkeit im Leben
der Menschen in den Mittelpunkt. Gott tauche im Alltag nicht mehr
auf, beklagte Georgens. Er habe sich in den Raum der religiösen
Sprache, in den Kirchenraum zurückgezogen, komme in
Sonntagspredigten und in der Bistumszeitung vor. Die Aufgabe der
Christen bestehe darin, Gott in unserer Welt einen Platz zu
sichern. Wenn der christliche Glaube von Gott spreche, dann sei
Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeint, betonte Georgens und nahm
damit Bezug auf den Dreifaltigkeitssonntag, der alljährlich am
Sonntag nach Pfingsten gefeiert wird. „Die Wallfahrt der
muttersprachlichen Gemeinden zum Dom sei ein eindrucksvolles
Bekenntnis zum dreifaltigen Gott. Menschen unterschiedlicher
Sprache und Herkunft – in einem Geist vereint – beten und singen
miteinander und geben so Zeugnis von ihrem gemeinsamen Glauben.“ So
zeige sich Kirche im Bild des dreieinigen Gottes: Sie bewahre das
Wertvolle der einzelnen Völker und stifte zugleich eine neue große
Einheit.
Im Anschluss an die Eucharistiefeier hatte die vietnamesische
Gemeinde zu einer Begegnung im südlichen Domgarten eingeladen.
Dabei konnten die Gottesdienstbesucher an einem aufgebauten Buffet
zahlreiche verschiedene kulinarische Spezialitäten der
vietnamesischen Küche kosten. „Von mir stammen die mit Hackfleisch
gefüllten Blätterteigteilchen“, verriet Loan Tran aus Schwetzingen.
Die Organisation sei ganz einfach gewesen: Jede Familie habe
zuhause etwas vorbereitet und mitgebracht. Die Bandbreite der
Geschmacksrichtungen reichte von herzhaft bis süß. Die 40-Jährige
und zahlreiche weitere vietnamesische Christen aus der näheren und
weiteren Umgebung von Speyer feiern jeden zweiten Monat mit einem
Priester, der aus ihrer Heimat stammt, in Mannheim einen
Gottesdienst. Zudem kann sich die vietnamesische Gemeinde über
einen eigenen Chor freuen, dem auch Loan Tran angehört.
Auch Weihbischof Georgens hatte sich nach dem Gottesdienst unter
das Kirchenvolk gemischt. „Ich freue mich immer, wenn ich mit
Menschen aus anderen Ländern zusammenkomme. Da spüre ich einen
Hauch von Weltkirche“, betonte er. Deshalb verreise er auch gerne.
In diesem Jahr stehen auf dem Besuchsprogramm des Weihbischofs, der
im Bistum für weltkirchliche Aufgaben zuständig ist, die
Philippinen und das afrikanische Land Togo.
Die Wallfahrt der muttersprachlichen Gemeinden endete mit einem
internationalen Rosenkranzgebet im Kloster St. Magdalena.
Text/Fotos: Petra Derst
22.05.2016
Reformator & Co.: Junge Talente rocken die Bühne
 Hauptrollen des Musical-Projekts „Luther – Mensch zwischen
Gott und Teufel“ sind besetzt
Hauptrollen des Musical-Projekts „Luther – Mensch zwischen
Gott und Teufel“ sind besetzt
Speyer/Kaiserslautern- (lk). Die
Hauptrollen sind verteilt, die Besetzung steht bis auf eine
Ausnahme, Jonas Klamroth und Lea Siegfried vom Verein Talent-Acker
sind zufrieden und erleichtert: Ihr Musicalprojekt „Luther – Mensch
zwischen Gott und Teufel“ ist der Bühnenreife einen beachtlichen
Schritt näher. Im April 2017 – 500 Jahre nach dem Beginn der
Reformation mit dem Thesenanschlag Martin Luthers an die Tür der
Schlosskirche in Wittenberg – bringen der Kaiserslauterer Verein
und die Evangelische Kirche der Pfalz die wichtigsten Stationen im
Leben Martin Luthers als Rock-Musical auf die Bühne der Speyerer
Stadthalle.
Die Hauptrollen des Musicals werden laut Talent-Acker wie
folgt besetzt:
Luther – das ist auf der Bühne Benjamin Link aus
Ludwigshafen. Der 16-Jährige – Stimmlage Bariton – ist
öffentliche Auftritte gewöhnt: Er hat beim Bundeswettbewerb „Jugend
musiziert“ und bei „Vocal Heroes – die Pfalz sucht die Junge
Stimme“ gesiegt. In die Rolle von Luthers Frau Katharina von Bora
schlüpft Melanie Schlüter. Die 18 Jahre junge Frankentalerin
mit der ausgebildeten Sopranstimme ist u.a. Gewinnerin des
Europäischen Jugend Musical Festivals 2013 und singt in der
Lutherband der Frankenthaler Lutherkirche.
Ave, Freundin von Katharina, wird dargestellt von Svenja Lesch
aus Landau. Die 24-Jährige studiert Darstellendes Spiel und
singt im Sopran. Den Reformator Philipp Melanchthon mimt Christoph
Schmith. Der 26-Jährige aus Kaiserslautern, Stimmlage Tenor,
ist Mitglied mehrerer Chöre, u.a. am Pfalztheater Kaiserslautern.
Der Profi-Schauspieler Michael Marwitz mimt den Papst. Der
60-Jährige, der in der Südpfalz lebt, hat an der Folkwang
Universität der Künste (Essen) studiert und ist Preisträger des
Europäischen Filmfestivals Barcelona als bester männlicher
Hauptdarsteller („Zugzwang“, 1989). Marwitz verfügt über 30 Jahre
Theater-, Film- und Musical-Erfahrung, u.a. als Darsteller des Kurt
Sperling in der Kultserie „Lindenstraße“. Im Luther-Musical singt
er in der Stimmlage Tenor.
Das stumme Waisenkind Maggy wird dargestellt von Anna Siedow aus
Kaiserslautern. Den jüngeren Bruder Luthers, Jakob, spielt
Tobias Zapp, ebenfalls aus Kaiserslautern. Der 23-jährige
Radiomoderator mit der Stimmlage Bariton hatte in dem zuletzt von
Talent-Acker inszenierten Musical „Orestie“ die Hauptrolle des
Orest. Katharina Saulheimer aus Rehweiler im Landkreis
Kusel spielt Jakobs Freundin Liesl und Anführerin der
Aufrührerischen. Saulheimer ist 24 Jahr alt, ausgebildet in Gesang
(Stimmlage Alt) und als Mitglied mehrerer Chöre auch
bühnenerfahren. Ebenso wie die 19-jährige Nora Beisel aus
Speyer, die den Teufel, Luthers Gegenspieler, mimt. Beisel
hat klassischen Gesangsunterricht und singt ebenfalls im Alt. Offen
ist noch die Rolle des Kardinals. Der ursprüngliche Kandidat,
Andreas Neigel aus Kaiserslautern, habe kurzfristig wegen einer
anstehenden Schauspielausbildung absagen müssen, teilen die
Organisatoren von Talent-Acker mit. Das Musical-Projekt hat rund 40
aktive Mitwirkende.
Der Besetzung der wichtigsten Rollen waren mehrere Castings
vorausgegangen, bei denen Lea Siegfried und Jonas Klamroth von
Talent-Acker, die das Stück komponiert und geschrieben haben, eine
Auslese unter vielen theaterbegeisterten jungen Leuten aus
Rheinland-Pfalz treffen mussten. Aufgabe der Bewerber war es, sich
singend, tanzend und spielend in die spannenden Charaktere von
Luther & Co hineinzuversetzen. „Wir haben uns die Auswahl nicht
leicht gemacht. Gewonnen haben wir wirklich talentierte Darsteller
– sowohl in gesanglicher als auch in schauspielerischer
Hinsicht.“
Bis 2017 stehen mehrere Probenwochenenden an, Kostüme und
Bühnenbild werden weiter entwickelt. Siegfried und Klamroth freuen
sich auf das Zusammenspiel mit dem Team. „Wenn wir dann in Speyer
am 8. und 9. April 2017 die Bühne der Stadthalle in Speyer rocken
und zeigen, was sich daraus ergeben hat, gibt das sicher ein
Gänsehautgefühl.“
Mehr zum Thema: http://talent-acker.de; www.reformation2017.evpfalz.de.
21.05.2016
Syrischer Flüchtlingsjunge baut Speyerer Dom nach
 Mohamed Wakas ( vierter von links) übergibt sein selbst gebasteltes Dommodell an Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ( zweiter von rechts)
Mohamed Wakas ( vierter von links) übergibt sein selbst gebasteltes Dommodell an Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ( zweiter von rechts)
Übergabe des Modells an Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann
Speyer- Der 13-jährige Mohamed Wakas fand
den Speyerer Dom derart beeindruckend, dass er ihn aus Papier
nachbaute. Zusammen mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren
Geschwistern war Mohamed Anfang des Jahres von Syrien nach
Deutschland geflohen. In der Erstaufnahmeeinrichtung für
Asylbewerber in Speyer bastelte er auf eigene Initiative hin rund
zwei Wochen an seiner Nachbildung des Doms. Sein Dommodell hat er
heute an Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann übergeben. Dieser zeigte
sich beeindruckt von den Fähigkeiten des Jungen. Für ihn ist der
Miniatur-Dom ein „wunderbares Zeichen der Integration, ein Zeichen,
dass Mohamed das Land erkunde und sich dafür interessiere“. Bischof
Wiesemann war überrascht von der Größe und der Genauigkeit des
Modells: „Dass die vorderen Türme schlanker sind als die hinteren,
nehmen nicht viele Menschen wahr und Mohamed hat das genau
abgebildet“.
Oliver Nagel-Schwab, Leiter der Aufnahmestelle, die das Deutsche
Rote Kreuz betreut, berichtete, dass Mitarbeiter von Mohamed immer
wieder um neuen Fotos des Doms aus verschiedenen Perspektiven
gebeten wurden. Zu allererst habe Mohamed den Dom auf dem Stadtplan
gesehen, so Nagel-Schwab. Mohamed selbst fand das Gebäude einfach
schön. Dass es eine christliche Kirche sei habe er gewusst,
schließlich gebe es in seiner Heimat Syrien auch christliche
Kirchen, gibt er Auskunft. Am schwierigsten nachzubauen, war die
runde Vierungskuppel, berichtet der 13-jährige. Sein Berufswunsch:
Architekt. Ausdrücklich lobt er seine Erzieherin, Melissa Müller.
Sie habe ihm sehr bei dem Nachbau des Doms geholfen, indem sie alle
erforderlichen Bastelmaterialien besorgt habe.
Mohameds Wunsch für die nahe Zukunft ist es, dass er bald sein
eigenes Zimmer hat und das Modell dort dann seinen Platz findet. In
der Zwischenzeit wird der Miniaturdom in der Geschäftsstelle des
Dombauvereins gezeigt. Dessen stellvertretende Vorsitzende Dr.
Barbara Schmidt-Nechl übergab Mohamed eine getreue Nachbildung des
Doms in etwas kleinerem Maßstab in Form einer Dom-Spardose.
Außerdem bekam er ein Exemplar des vom Dombauverein herausgegebenen
Kinderdomführers geschenkt und ein kleines Dombuch für seine
Eltern. „Als UNESCO-Welterbe hat der Dom schließlich für die ganze
Welt eine Bedeutung“, so Dr. Schmidt-Nechl. Mohamed hat inzwischen
den Dom auch zusammen mit seiner Familie besucht. Thomas Mann,
Schulrat i. K. und Pastoralreferent, begleitete diesen Besuch.
Text: is; Foto: © Domkapitel
19.05.2016
Karl Kardinal Lehmann zum 80. Geburtstag
 Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Brückenbauer, Vorbild und
Quelle der Inspiration
Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Brückenbauer, Vorbild und
Quelle der Inspiration
Mainz- „Seit mehr als fünf Jahrzehnten setzt
Karl Kardinal Lehmann Impulse für die Gestaltung der katholischen
Kirche in unserer Gesellschaft, gibt entscheidende Denkanstöße und
treibt Reformen voran. Dabei ist das Wohl der Menschen Mittelpunkt
und Antrieb seines Handelns“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer
anlässlich des 80. Geburtstages von Kardinal Lehmann am 16.
Mai.
Karl Kardinal Lehmann habe in den vielen Jahren seines Wirkens
als Bischof entscheidende Weichen für den Dialog zwischen den
christlichen Konfessionen, zwischen Andersgläubigen und
Nichtgläubigen gestellt. Sein Einsatz für die Ökumene sei
unermüdlich und trage reiche Früchte. „Grenzen überwinden, einander
verstehen lernen, Brücken bauen, das zeichnet sein
außergewöhnliches Lebenswerk aus“, so die Ministerpräsidentin.
Karl Kardinal Lehmann habe ein offenes Ohr für die Sorgen und
Anliegen der Menschen. Für ihn gelte der Grundsatz, dass die Kirche
dort mitanpacke, wo Hilfe gebraucht werde. „Kardinal Lehmann hat
mit seinem großen Engagement für Flüchtlinge, gerade in den
vergangenen Monaten, Maßstäbe für Nächstenliebe gesetzt. Er ist für
viele Generationen ein Vorbild und eine Quelle der Inspiration“,
sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
„Ich schätze Kardinal Lehmann als einen zuverlässigen,
humorvollen Gesprächspartner. Ich erinnere mich gerne an unsere
zahlreichen Begegnungen und persönlichen Gespräche und bin dankbar
für unseren vertrauensvollen Austausch“, sagte die
Ministerpräsidentin anlässlich des runden Geburtstags.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer gratulierte Karl Kardinal
Lehmann an seinem Geburtstag am Pfingstmontag beim feierlichen
Pontifikalamt im Mainzer Dom und beim anschließenden Festakt
persönlich: „Kardinal Lehmann ist fest in Mainz verwurzelt. Er
gehört zu unserer Landeshauptstadt, wie die Fastnacht und der Dom.
Als warmherziger Seelsorger ist er bei Menschen aller Konfessionen
beliebt. Er wird uns als Bischof von Mainz fehlen.“ Text:
stk-rlp; Foto: is
16.05.2016
„Der Heilige Geist ist auf Verständigung und Versöhnung ausgerichtet“
 Pontifikalamt zum Pfingstsonntag mit Bischof Wiesemann im
Dom zu Speyer
Pontifikalamt zum Pfingstsonntag mit Bischof Wiesemann im
Dom zu Speyer
Speyer- Mit einem festlichen Gottesdienst
voller Musik hat Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am Pfingstsonntag
mit Gläubigen die Sendung des Heiligen Geistes gefeiert. Im
vollbesetzten Speyerer Dom verurteilte er „kleinkarierten
Nationalismus“. „Der Heilige Geist ist auf Verständigung und
Versöhnung ausgerichtet“, rief er den Katholiken zu. Der Geist
Gottes stehe für eine vielschichtige Betrachtung, betonte der
Bischof und mahnte plumpes Schwarz-Weiß-Denken ganz klar ab.
Der Bischof knüpfte in seiner Predigt an die Lesung aus der
Apostelgeschichte an. Sie berichtet von den vielsprachigen
Feuerzungen, die mit lautem Brausen vom Himmel herabkamen. Wegen
diesem Sprachenwunder konnten sich alle Menschen aus verschiedenen
Völkern auf einmal untereinander verstehen, rief Wiesemann ins
Gedächtnis und stellte fest: „Die erste Gabe des Heiligen Geistes
ist die Überwindung des Nationalismus.“ Damit schlug er den Bogen
in die heutige Zeit. „Alles, was nationalistisch angehaucht ist,
ist gegen den Heiligen Geist.“ Christen dürften stolz auf ihr Land
sein, aber dieser Stolz dürfe sich nicht gegen andere richten.
Wir kennen einander, wir verstehen einander: Darin sieht
Wiesemann die Grundlage des menschlichen Zusammenlebens. „Wir
Menschen sind in unsere Vielfalt eins.“ Alles andere komme später,
so der Bischof und bezog sich auf die Ausgrenzung von Fremden und
auf Streit zwischen Völkern. „Alle Unterschiede werden uns
eingeredet.“ Es gelte, Hilfesuchenden Hilfe zu leisten. „Wir sind
in der Verantwortung füreinander.“
Karl-Heinz Wiesemann erteilte dem Schwarz-Weiß-Denken eine klare
Absage. Die Welt könne nicht auf diese Weise eingeteilt werden. Der
Heilige Geist lehre, viele Schattierungen des Lebens zu erkennen.
„Vor einfachen Parolen sollten wir uns überall hüten“, mahnte der
Bischof und gestand, immer wieder darüber zu erschrecken, wie viele
diesen Schwarz-Weiß-Parolen folgen.
 Er beendete seine Predigt mit Lob und Dank an
Domkapellmeister Markus Melchiori, das Domorchester, den Domchor
und Domorganisten Markus Eichenlaub. Sie führten unter anderem
Franz Schuberts Messe in Es-Dur auf, die einen Großteil des
Gottesdienstes einnahm. Würde die Kirche schwarz-weiß denken, so
Wiesemann, dürfte dieses Werk hier nicht erklingen. Denn Schubert
habe mit Gott gehadert, im Credo das Bekenntnis zum allmächtigen
Vater ausgelassen. Die Messe in Es-Dur spiegle die Zerrissenheit
und Suche des Komponisten wider und wirke nicht zuletzt deshalb
lebendig.
Er beendete seine Predigt mit Lob und Dank an
Domkapellmeister Markus Melchiori, das Domorchester, den Domchor
und Domorganisten Markus Eichenlaub. Sie führten unter anderem
Franz Schuberts Messe in Es-Dur auf, die einen Großteil des
Gottesdienstes einnahm. Würde die Kirche schwarz-weiß denken, so
Wiesemann, dürfte dieses Werk hier nicht erklingen. Denn Schubert
habe mit Gott gehadert, im Credo das Bekenntnis zum allmächtigen
Vater ausgelassen. Die Messe in Es-Dur spiegle die Zerrissenheit
und Suche des Komponisten wider und wirke nicht zuletzt deshalb
lebendig.
Lebendig ist auch der Heilige Geist, betonte Bischof Wiesemann.
Er sei kein Mysterium, nichts Abstraktes, sondern „mitten im bunten
und manchmal so abgründigen Leben von uns Menschen“. „Der Heilige
Geist ist Leben“, rief er den Gläubigen zu. Gottes Geist treibe die
Liebe hervor, auf das der Mensch lebe.
An das Pontifikalamt im Dom schloss sich am Nachmittag eine
Pontifikalvesper mit Bischof Wiesemann an sowie eine heilige Messe
am frühen Abend. Im Pontifikalamt am Pfingstmontag wird Weihbischof
Otto Georgens 29 Jugendlichen aus der Speyerer Pfarrei Pax Christi
im Dom das Sakrament der Firmung spenden. Der Gottesdienst beginnt
um 10 Uhr.
An Pfingsten feiern die Christen das Fest des Heiligen Geistes, der
auf die Apostel herabkam, als diese in Jerusalem versammelt waren
(Apostelgeschichte 2). Der Heilige Geist ist nach kirchlicher Lehre
in die Welt gesandt, um Person, Wort und Werk Jesu Christi in der
Geschichte lebendig zu erhalten. Das Fest wird 50 Tage nach Ostern
begangen - von daher lässt sich auch das Wort "Pfingsten" erklären:
Es leitet sich von "pentekoste" ab, dem griechischen Begriff für
"fünfzig".
Text und Foto: Yvette Wagner
16.05.2016
Diakonische Gemeinschaft mit Leben gefüllt: Diakonissen Schwesternjubiläum
 Die Jubilarinnen und Jubilare mit (hintere Reihe) Pfarrer Dr. Günter Geisthardt (l.) und Oberin Sr. Isabelle Wien (r.) mit ihrer Referentin.
Die Jubilarinnen und Jubilare mit (hintere Reihe) Pfarrer Dr. Günter Geisthardt (l.) und Oberin Sr. Isabelle Wien (r.) mit ihrer Referentin.
Eine doppelte Premiere feierte das Jubiläum der
Schwestern und Brüder bei den Diakonissen Speyer-Mannheim in diesem
Jahr
Speyer- Erstmals hielt bei der Feier an Christi
Himmelfahrt Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt den
Festgottesdienst – und erstmals wurden neben Diakonissen und
Diakonischen Schwestern auch Diakonische Brüder für ihre 40jährige
Zugehörigkeit zur Gemeinschaft geehrt. Georg Abraham, Helmut
Fiebrich und Hans Oellingrath, die 1976 im Mannheimer Mutterhaus in
die Gemeinschaft aufgenommen wurden, seien Pioniere gewesen,
erklärte Oberin Sr. Isabelle Wien: Im Kaiserswerther Verband
deutscher Diakonissen-Mutterhäuser seien erst in den folgenden
Jahren Männer in die Gemeinschaft eingetreten, in Speyer etwa
vergingen bis dahin noch 20 Jahre.
Bereits seit 65 Jahren ist Diakonische Schwester Irmgard Heil in
der Gemeinschaft, Diakonisse Gerda Feig und Diakonische Schwester
Hannelore Lötz seit 60 Jahren, und Helene Fünkner blickte immerhin
auf 50 Jahre als Diakonische Schwester zurück.
Den Jubilarinnen und Jubilaren dankte Pfarrer Dr. Günter
Geisthardt in einem Festgottesdienst „für alles, was Sie für andere
bewirkt haben.“ Die Diakonische Gemeinschaft sei dem stetigen
Wandel unterworfen, so Geisthardt, Grund genug, anlässlich des
Jubiläums für Vergangenes zu danken und einen Blick auf die
künftige Entwicklung zu werfen: „Engagierte, fachlich qualifizierte
haupt- und ehrenamtlich Mitarbeitende führen den Dienst am Nächsten
in neuen Formen der Gemeinschaft fort.“
In einem anschließenden Festakt würdigten Pfarrer Dr. Günter
Geisthardt und Oberin Sr. Isabelle Wien das Engagement der
Jubilarinnen und Jubilare in den unterschiedlichsten
Arbeitsbereichen in Krankenhäusern, Seniorenzentren, Kitas und der
Gemeindekrankenpflege: „Sie haben Diakonische Gemeinschaft mit
Leben gefüllt“, so Geisthardt.
Der Gottesdienst wurde musikalisch begleitet vom Chor der
Diakonissen Speyer-Mannheim unter Leitung von Kantorin Ruth
Zimbelmann und Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger an der
Orgel, die Kollekte geht an den Verein „Operieren in Afrika“, in
dem sich auch Ärzte aus dem Mannheimer Diakonissenkrankenhaus
engagieren. „Der Verein ist mehr denn je auf Spenden angewiesen, um
nach einem tragischen Unglücksfall seine wichtige Arbeit
weiterführen zu können“, erklärte Sr. Isabelle Wien.
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
06.05.2016
Luisa Fischer ist neue Vorsitzende des Katholikenrates im Bistum Speyer
 Künftig
steht eine junge Frau aus dem Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) an der Spitze des höchsten Laiengremiums im Bistum
Speyer
Künftig
steht eine junge Frau aus dem Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) an der Spitze des höchsten Laiengremiums im Bistum
Speyer
Kaiserslautern- Mit großer
Mehrheit wurde heute Luisa Fischer im Rahmen der Vollversammlung
des Katholikenrates im Bistum Speyer zur neuen Vorsitzenden
gewählt. Die 27-jährige, die seit vier Jahren den Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer im höchsten
Laiengremium des Bistums vertritt, folgt auf Maria Faßnacht, die
für eine erneute Kandidatur nicht mehr zur Verfügung stand. Mit
Luisa Fischer steht eine Frau an der Spitze, die langjährige
Erfahrungen in der Verbände- und Rätestruktur in den Katholikenrat
einbringt. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin an der
katholisch-theologischen Fakultät der Universität Mainz hat ihre
jugendverbandliche Heimat in der Katholischen jungen Gemeinde
(KjG). Fischer nahm zunächst Gruppenleitung im Verband wahr, war
dann aber auch in der Bezirksleitung sowie in verschiedenen Gremien
auf Diözesanebene tätig. Zudem unterstützt die
BDKJ-Dekanatsvorsitzende im Dekanat Donnersberg die Arbeit des BDKJ
auf diözesaner Ebene im Ausschuss Politik.
Fischer lebt in Katzenbach, ist verheiratet und hat
ihr Magisterstudium in Soziologie, Pädagogik und katholischer
Theologie abgeschlossen. Derzeit arbeitet sie an ihrer
soziologischen Promotion zu familialen Mehrgenerationenbeziehungen.
Für ihre Kandidatur zur Vorsitzenden haben die Erfahrungen
gesprochen, die sie in der vergangenen Legislaturperiode im
Katholikenrat habe sammeln können. Das Laiengremium sei immer
Stimme der Kirche in die Gesellschaft hinein gewesen: "Der
Katholikenrat hat beispielsweise mit der Kampagne „Gutes Leben für
alle!“, den diözesanen Gesprächsforen und vielen Veranstaltungen
zum Thema Altersarmut in die Gesellschaft hinein gewirkt. Dieses
Engagement sollten wir weiter ausbauen, um uns als starke Stimme in
den Diskurs über eine gerechte Gestaltung der Gesellschaft
einzubringen", sagt Fischer. Zudem möchte sie der Kirche mit ihrer
Person ein junges, weibliches Gesicht geben: "Ich hoffe, dass dem
Laiengremium das Gesicht einer jungen Frau gut tut. Vielleicht
gelingt es so, nach außen zu signalisieren, dass Kirche Zukunft
hat." Diese Zukunft in die Hand zu nehmen ist für Luisa Fischer
nicht nur vorrangiges Ziel, sondern Lebensmotto. In ihrem
Engagement in der Jugendverbandsarbeit habe sie gelernt, gemeinsam
mit anderen Verantwortung zu übernehmen, um Positionen zu ringen
und diese dann auch zu vertreten. "Es ist wichtig, sich in
gesellschaftspolitische und kirchliche Diskurse einzumischen", sagt
Fischer und ergänzt: "Das ist immer mit viel Freude verbunden, aber
auch eine Herausforderungen. Vor allem von der für mich immer
wieder beeindruckenden Diskussionskultur in den Jugendverbänden und
dem BDKJ kann unsere Kirche auf der Suche nach einer neuen
Beziehungskultur etwas lernen." Daraus ergeben sich für Fischer
auch klare Zielsetzungen ihrer Arbeit im Katholikenrat: Neben dem
Anliegen, dem Pastoralkonzept "Gemeindepastoral 2015" Leben
einzuhauchen, hat sie sich der Etablierung einer Diskussionskultur
auf Augenhöhe innerhalb der Kirche verschrieben: "Wir sollten an
die Erfahrungen anknüpfen, die wir mit den Diözesanen Foren gemacht
haben. Damit ist natürlich auch die Hoffnung
verbunden, dass wir Laien noch stärker als bisher in Entscheidungen
eingebunden werden, die Auswirkungen auf Pfarreien oder Verbände
haben", betont Fischer.
Der Katholikenrat repräsentiert auf
Diözesanebene die katholische Laienschaft des Bistums in ihrer
ganzen Vielfalt. Deshalb gehören dem Gremium Vertreter aller
Dekanatsräte sowie der katholischen Verbände an. Außerdem werden
bei der Konstituierung des Rates auch einzelne Personen zur
Mitgliedschaft berufen. Als vom Bischof anerkanntes Organ zur
Koordinierung des Laienapostolats nimmt der Katholikenrat unter
anderem folgende Aufgaben wahr: Beobachtung von Entwicklungen des
gesellschaftlichen, staatlichen und kirchlichen Lebens, Vertretung
der Anliegen des Katholikenrates in der Öffentlichkeit,
Stellungnahme zu aktuellen Entwicklungen in Kirche, Staat und
Gesellschaft, Weitergabe von Anregungen an den Pastoralrat,
Förderung der Arbeit der kirchlichen Gruppen und Verbände
Die Amtszeit des Katholikenrates beträgt vier
Jahre. www.katholikenrat-speyer.de
Der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ) Speyer ist Dachverband von acht Kinder- und Jugendverbänden
in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Er vertritt die Anliegen von
8.500 Mitgliedern in Kirche, Politik und
Gesellschaft. www.bdkj-speyer.de
Lesen Sie hier das Interview mit Luisa
Fischer
- Was motiviert dich, den Vorsitz des Katholikenrats im
Bistum Speyer zu übernehmen?
In den letzten vier Jahren habe ich die Arbeit im Katholikenrat
sehr schätzen gelernt. Gemeinsam mit engagierten Katholikinnen und
Katholiken aus den Dekanaten, sowie Jugend- und
Erwachsenenverbänden unseres Bistums konnten wir Kirche und
Gesellschaft mitgestalten. Und ich hoffe, dass dem Laiengremium das
Gesicht einer jungen Frau gut tut. Vielleicht gelingt es so, nach
außen zu signalisieren, dass Kirche Zukunft hat.
- Was sind deine Ziele für die Amtszeit?
Innerkirchlich sind wir gerade daran, dem Konzept
Gemeindepastoral 2015 den Geist einzuhauchen, der es lebendig
macht. Diesen Weg gilt es auch mit dem Katholikenrat zu begleiten.
Gleichzeitig sollten wir an die Erfahrungen anknüpfen, die wir mit
den Diözesanen Foren gemacht haben: Wir sollten uns einbringen,
wenn es um die Etablierung einer neuen Beziehungskultur geht. Damit
ist natürlich auch die Hoffnung verbunden, dass wir Laien noch
stärker als bisher in Entscheidungen eingebunden werden, die
Auswirkungen auf Pfarreien oder Verbände haben. Es ist meine
Überzeugung, dass wir so auch besser gemeinsam in Gesellschaft
hineinwirken können. In der letzten Legislaturperiode ist dem
Katholikenrat das beispielsweise mit der Kampagne „Gutes Leben für
alle!“, mit den diözesanen Gesprächsforen für Jugendliche und den
vielen Veranstaltungen zum Thema Altersarmut gelungen. Dieses
Engagement sollten wir weiter ausbauen, um uns als starke Stimme in
den Diskurs über eine gerechte Gestaltung der Gesellschaft
einzubringen.
- Was bringt dir dabei der jugendverbandliche
Hintergrund?
Durch die Jugendverbandsarbeit habe ich vieles gelernt. Sie hat
mich nicht nur in meiner Persönlichkeit tief geprägt und mir ein
Gefühl von Heimat in Kirche vermittelt. Im Engagement für die
Jugendverbandsarbeit habe ich gelernt, was es heißt, gemeinsam
Verantwortung zu übernehmen, um Entscheidungen zu ringen und diese
dann auch zu vertreten. Es ist wichtig, sich in
gesellschaftspolitische und kirchliche Diskurse einzumischen. Das
ist immer mit viel Freude verbunden, aber auch eine
Herausforderungen. Vor allem von der für mich immer wieder
beeindruckenden Diskussionskultur – auf dem Fundament gemeinsam
geteilter Werte und Grundhaltungen – in den Jugendverbänden und dem
BDKJ kann unsere Kirche auf der Suche nach einer neuen
Beziehungskultur etwas lernen.
- Wie nimmst du Kirche weltweit / Kirche im Bistum Speyer
wahr?
Die weltweite(n) Wirklichkeit(en) von Kirche einzufangen, kann
mir hier wohl angesichts derer Vielfältigkeit nicht gelingen. Da
gibt es unter anderem Kirche als „global player“, die ganz im Sinne
der Pastoralkonstitution des II. Vatikanischen Konzils für ein
solidarisches Miteinander aller Menschen und für eine gerechte
Gestaltung gesellschaftlicher Zusammenhänge einsteht. Gleichzeitig
ist Kirche weltweit in ganz unterschiedlichen (Kultur-)Räumen
verortet, wird von Wandlungsprozessen sowie der Pluralität der
Lebenswirklichkeiten immer wieder neu herausgefordert – etwa in
Bezug auf Ehe und Familie. Kirche muss dabei lernende Gemeinschaft
sein, die das Potential hat, sich auf der Grundlage ihres Kerns,
ihrer zentralen Botschaft, weiter zu entwickeln. Auch die Kirche im
Bistum Speyer steht vor der Herausforderung, mit gesellschaftlichen
und kirchlichen Entwicklungen kreativ und zukunftsweisend umgehen
zu müssen – und es freut mich, dabei zu sein, wenn Klerus und Laien
diese gemeinsam angehen…
- Was sind Themen, die dich bewegen?
Das sind gerade vor allem Themen, die die Frage nach
gesellschaftlichem Zusammenhalt betreffen: So macht mich das
Schicksal der vielen Menschen betroffen, die sich auf der Suche
nach einer lebenswerten Zukunft auf die Flucht begeben (müssen),
Hilfe suchen und dabei auf ganz unterschiedliche Reaktionen
treffen. Auch das in diesem Kontext an Aktualität gewinnende Ringen
der europäischen Länder um eine Identität als Wertegemeinschaft
treibt mich um. Auf einer anderen Ebene sind das mit dem
demographischen Wandel verbundene Herausforderungen wie die Fragen
nach Generationengerechtigkeit sowie familialer und außerfamilialer
Generationensolidarität.
- Ist Kirche zukunftsfähig?
Vor zwei Jahren haben wir als BDKJ-Dekanatsvorstand Donnersberg
eine Veranstaltung zur Zukunftsfähigkeit kirchlicher Jugendarbeit
unter den Titel „Was bleiben will, muss sich ändern“ gestellt. Das
ist ja auch das, was Johannes XXIII. mit „Aggiornamento“ meinte und
was zum Leitmotiv des II. Vatikanischen Konzils wurde. Franziskus
lehrt uns aktuell, was es heißt, sich der Welt und den Menschen
gegenüber zu öffnen. Es ist meine tiefe Überzeugung, dass Kirche
mit einer solchen Haltung zukunftsfähig ist.
- Wie lebst du deinen Glauben?
Zum einen durch mein ehrenamtliches Engagement in Kirche und in
der Gemeinschaft mit anderen, die ich dabei erfahre. Darüber hinaus
in meinem Beruf, durch die Sensibilisierung meiner Studierenden für
die sozialethischen Herausforderungen unserer Zeit und die
Vermittlung von Weisen ethischer Urteilsbildung. Aber auch in
meinen persönlichen Beziehungen versuche ich meinen Glauben zu
leben. Und dann gibt es natürlich noch die ganz persönliche Seite
meines Glaubens – im Gebet, beim Lesen eines Buches, das mich
bewegt, oder bei einer Wanderung durch die Natur, von der ich mich
immer wieder aufs Neue begeistern lassen kann.
Text: BDKJ Speyer; Foto: Privat
04.05.2016
Sonderbriefmarke zum 100. Katholikentag erschienen
.jpg) Leipzig- Anlässlich des 100. Deutschen
Katholikentags hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) ein
Sonderpostwertzeichen herausgegeben.
Leipzig- Anlässlich des 100. Deutschen
Katholikentags hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) ein
Sonderpostwertzeichen herausgegeben.
Erstdrucke der Marke wurden heute durch BMF-Staatssekretär
Werner Gatzer an die Stadt Leipzig und die Veranstalter des
Katholikentags überreicht. Die Alben wurden von Burkhard Jung,
Oberbürgermeister der Stadt Leipzig, Dr. Stefan Vesper,
Generalsekretär des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Dr.
Martin Stauch, Geschäftsführer des Katholikentags, sowie an
Generalvikar Andreas Kutschke, Diözesanadministrator für das Bistum
Dresden-Meißen entgegengenommen.
Staatsekretär Gatzer erläuterte, dass jede Marke "ein kleiner
Kulturbotschafter sei, der in die Welt trage, was uns wichtig ist"
und forderte die Anwesenden auf: "Nutzen Sie das Postwertzeichen,
um es in alle Welt zu verschicken, damit die Menschen wissen, dass
in Leipzig der 100. Katholikentag stattfindet."
Burkhard Jung nahm die Briefmarke für die Bürger der Stadt
Leipzig entgegen. Er brachte erneut seine Vorfreude auf den
anstehenden Katholikentag zum Ausdruck und betonte die Bedeutung
für die Stadt: "Wir freuen uns auf die Katholikinnen und
Katholiken. Kirche und Stadt gehören zusammen. Ich hoffe, dass wir
die Botschaft des Leitworts des Katholikentags 'Seht, da ist der
Mensch' mit dieser Briefmarke aus Leipzig hinaustragen können."
ZdK-Generalsekretär Stefan Vesper erinnerte bei der
Entgegennahme der Alben an die große Bandbreite
gesellschaftspolitischer Themen, die Katholikentage seit über 160
Jahren abdecken, und unterstrich die kommunikative Bedeutung der
Briefmarke. Das Sonderpostwertzeichen sei ein "Bote für Nachrichten
und stellt somit auch Verbindungen zwischen Menschen her".
Gestaltet wurde die Briefmarke, die ein Kreuz zeigt, dessen
Umrisse sich von einem Punktehintergrund abheben, von den Grafikern
Prof. Iris Utikal und Prof. Michael Gais aus Köln. Die Marke weist
ein Porto von 70 Cent auf und ist ab sofort in den Verkaufsstellen
der Deutschen Post AG erhältlich sein.
Der 100. Deutsche Katholikentag ist eine christliche
Großveranstaltung. Er findet vom 25. bis 29. Mai 2016 in Leipzig
unter dem Leitwort "Seht, da ist der Mensch" statt. Erwartet werden
mehrere Zehntausend Gäste. Podiumsdiskussionen, Workshops,
Beratungsangebote, Ausstellungen, Mitmachaktivitäten, Konzerte,
Feste - über 1.000 Einzelveranstaltungen sind an über 80
Schauplätzen geplant. Katholikentage werden vom Zentralkomitee der
deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle zwei Jahre an
wechselnden Orten veranstaltet. Der 99. Deutsche Katholikentag fand
2014 in Regensburg statt.
Text und Foto: 100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016
e.V.
04.05.2016
Frühlingshimmel geht über Diakonissen Frühlingsfest auf
 Gemeinsames Spiel unter dem Motto „Bunt ist unsere Welt“
Gemeinsames Spiel unter dem Motto „Bunt ist unsere Welt“
Rechtzeitig zum ersten interkulturellen Frühlingsfest
bei den Diakonissen Speyer-Mannheim am 30. April stellte sich auch
Frühlingswetter ein und sorgte bei über 200 Gästen für einen rundum
gelungenen Nachmittag.
Speyer- Flüchtlinge aus zahlreichen Ländern,
ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe Tätige, Mitarbeitende der
Diakonissen Speyer-Mannheim und Speyerer Bürger begrüßten Vorsteher
Pfarrer Dr. Günter Geisthardt und Oberin Diakonisse Isabelle Wien
im Park vor dem Mutterhaus. Nach Grußworten durch Vertreter aus
Politik und Kirche nutzten Kinder und Erwachsene an den
vielfältigen Info-Ständen und Spiele-Möglichkeiten im Park die
Gelegenheit zum Austausch – zum Teil „mit Händen und Füßen“, aber
auch tatkräftig unterstützt von Flüchtlingen, die übersetzten.
 Neben Informationen des Arbeitskreises Asyl Speyer und
der Diakonissen Hebammenschule, die seit einigen Monaten in der
Elternschule eine Sprechstunde für schwangere Flüchtlingsfrauen
anbietet, erfreuten sich die Spiele, die unter anderem die
Diakonissen Fachschule für Sozialwesen und die Diakonissen Kitas
vorbereitet hatten, vor allem bei den vielen kleinen Besuchern
großer Beliebtheit.
Neben Informationen des Arbeitskreises Asyl Speyer und
der Diakonissen Hebammenschule, die seit einigen Monaten in der
Elternschule eine Sprechstunde für schwangere Flüchtlingsfrauen
anbietet, erfreuten sich die Spiele, die unter anderem die
Diakonissen Fachschule für Sozialwesen und die Diakonissen Kitas
vorbereitet hatten, vor allem bei den vielen kleinen Besuchern
großer Beliebtheit.
Das Fest endete mit einem interreligiösen Gebet, bevor Kinder
Luftballons mit einem Symbol für Frieden zum Lied „Der Himmel geht
über allen auf“ aufsteigen ließen.
„Unser Fest ist ein Beispiel dafür, wie das Jesuswort ‚Ich bin
ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen‘ (Matthäus
25,35b) gelebt werden kann“, erklärte Pfarrerin Corinna Kloss,
Referentin von Oberin Diakonisse Isabelle Wien.
Text und Foto: Diakonissen Speyer-Mannheim
03.05.2016
Aufbruch zu mehr Solidarität!
 v.l.: Staatssekretärin Margit Gottstein, Christian Schad, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, DGB-Bezirksvorsitzender Dietmar Muscheid, Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und Vizepräses Christoph Pistorius von der Evangelischen Kirche im Rheinland.
v.l.: Staatssekretärin Margit Gottstein, Christian Schad, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche der Pfalz, DGB-Bezirksvorsitzender Dietmar Muscheid, Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) und Vizepräses Christoph Pistorius von der Evangelischen Kirche im Rheinland.
Spitzengespräch von DGB-Gewerkschaften und evangelischen
Kirchen in Rheinland-Pfalz
Mainz- Vertreterinnen und Vertreter von
DGB-Gewerkschaften und den evangelischen Kirchen in RheinlandPfalz
trafen sich zu einem Spitzengespräch. Die Teilnehmenden waren sich
darin einig, dass es einen politischen und gesellschaftlichen
Aufbruch für mehr Solidarität und soziale Gerechtigkeit geben muss.
Dazu gehöre auch die Steuergerechtigkeit, um die Aufgaben des
Staates zum Erhalt der öffentlichen Infrastruktur – von der Bildung
bis zum sozialen Wohnungsbau – zu finanzieren.
Miteinander und das Füreinander müssen gestärkt werden. Dazu
gehört ein Steuermodell, bei dem die starken Schultern wieder mehr
tragen, als die schwachen. Damit könnten die Folgen der
Schuldenbremse zumindest abgemildert werden, die vieles, was im
Land dringend angegangen werden müsste, unter
Finanzierungsvorbehalt stellt. Wir setzen uns für mehr Solidarität
zwischen den arbeitenden Menschen, den Generationen, Einheimischen
und Flüchtlingen, Schwachen und Starken ein. Und ich freue mich,
dass wir mit den Kirchen in diesem Ansinnen eine gute Partnerschaft
pflegen“, so Dietmar Muscheid, Vorsitzender DGB Rheinland-Pfalz /
Saarland. Für Kirchen und Gewerkschaften stehen nach Auffassung von
Vizepräses Christoph Pistorius von der Evangelischen Kirche im
Rheinland die Bedürfnisse der Menschen im Mittelpunkt, „derer, die
hier bei uns Schutz suchen aber auch derer, die schon lange hier
leben und es schwer haben in unserer Gesellschaft“. Nächstenliebe
und Solidarität ließen sich nicht gegeneinander ausspielen.
Kirchenpräsident Christian Schad von der Evangelischen Kirche
der Pfalz erinnerte im Blick auf den Einzug der
rechtspopulistischen AfD in den Landtag daran, dass sich Kirchen
und Gewerkschaft zusammen mit weiteren zivilgesellschaftlichen
Organisationen und Verbänden bereits vor der Wahl entschieden
gegen Populismus und Rassismus gewandt hätten. „Wir tolerieren
nicht, dass mit menschenfeindlichen, rassistischen,
diskriminierenden Parolen Politik gemacht wird“, erklärte Schad. Er
forderte eine inklusive Sozialpolitik, die gemeinsam mit den
Flüchtlingen auch benachteiligte Einheimische im Blick habe.
Ein Schwerpunktthema der Gespräche war die Situation von
Flüchtlingen in Rheinland-Pfalz. Zur Willkommenskultur kommen jetzt
verstärkt Fragen der Integration hinzu. Nach einem fachlichen Input
von Margit Gottstein, Staatssekretärin im Ministerium für
Integration, Familie, Kinder, Jugend und Frauen, diskutierte die
Runde im Besonderen die Arbeitsmarktintegration von
Flüchtlingen.
Der Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und
Nassau (EKHN), Volker Jung wandte sich gegen eine Wohnsitzauflage
für Geflüchtete. Von einheimischen Arbeitssuchenden werde Mobilität
und die Bereitschaft zum Umzug im gefordert, um in die
Erwerbsarbeit eintreten zu können. Dies könne bei Flüchtlingen
nicht ins Gegenteil verkehrt werden. Jung forderte auch eine
einfachere Anerkennung von beruflichen Fähigkeiten. Oft hätten die
Hilfesuchenden besondere Begabungen aber nicht die damit in
Deutschland verbundenen Abschlüsse. Hier könnten auch die
Gewerkschaften unterstützend wirken, um besondere Kompetenzen der
Einzelnen herauszuarbeiten.
„Arbeit und Ausbildung haben nicht nur einen wirtschaftlichen
Wert, sondern sind auch Wertschätzung. Wir müssen die
Rahmenbedingungen schaffen, damit Kompetenzen erfasst und Sprache
erlernt werden kann. Hierbei bleibt insbesondere der Bund in
finanzieller Verantwortung. So kann der Weg in Arbeit für möglichst
viele geebnet werden und Integration gelingen“, so Dietmar
Muscheid.
In diesem Jahr hatte der DGB in das Julius-Lehlbach-Haus nach
Mainz eingeladen. Auf der Tagesordnung ebenfalls ganz oben: Der
Sonntagsschutz. Kirchen und DGB-Gewerkschaften setzen sich in
gemeinsamen Bündnissen beispielsweise in der Allianz für den freien
Sonntag bereits vielerorts gegen eine Ausweitung der Sonntagsarbeit
ein.
Die Stellvertretende Kirchenpräsidentin der EKHN, Ulrike
Scherf, erklärte, dass der arbeitsfreie Tag nicht nur zur
jüdisch-christlichen Tradition gehöre, sondern eine politische
Aufgabe im Interesse der Beschäftigten sei, deren Arbeitszeiten
nicht unbegrenzt flexibilisiert werden sollten. Der arbeitsfreie
Sonntag diene dazu, „einen lebensverträglichen Rhythmus der
gesamten Gesellschaft zu gewährleisten und gemeinsame freie Zeiten
zu ermöglichen", sage Scherf. „Wenn die Sonntagsruhe immer mehr
aufgeweicht wird, begeben wir uns damit auf den Weg in die
7-Tage-24-Stunden-Gesellschaft.
Das ist für die Beschäftigten unzumutbar", so Dietmar Muscheid.
Text und Foto: DGB Rheinland-Pfalz
25.04.2016
Sparkassenchef Langenfeld: Zahlen und Werte gehören zusammen
 Leipzig- Die Sorge ums Gemeinwohl gehört für
Harald Langenfeld zum "genetischen Code" einer Sparkasse. "Seit 190
Jahren ist die Sparkasse hier zu Hause und genauso lange setzen wir
uns schon für die positive Entwicklung unserer Region ein", sagt
der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Leipzig im Gespräch mit
www.100tage100menschen.de,
der Storytelling-Website des 100. Deutschen Katholikentags. "Wir
unterstützen große Projekte genauso engagiert wie die vielen
kleinen Initiativen. Unser Förderengagement ist in gewisser Weise
eine indirekte Dividende an die Menschen der Region", so
Langenfeld.
Leipzig- Die Sorge ums Gemeinwohl gehört für
Harald Langenfeld zum "genetischen Code" einer Sparkasse. "Seit 190
Jahren ist die Sparkasse hier zu Hause und genauso lange setzen wir
uns schon für die positive Entwicklung unserer Region ein", sagt
der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Leipzig im Gespräch mit
www.100tage100menschen.de,
der Storytelling-Website des 100. Deutschen Katholikentags. "Wir
unterstützen große Projekte genauso engagiert wie die vielen
kleinen Initiativen. Unser Förderengagement ist in gewisser Weise
eine indirekte Dividende an die Menschen der Region", so
Langenfeld.
Doch nicht nur die Sparkasse engagiert sich. Auch Langenfeld
selbst ist in vielfältiger Weise ehrenamtlich aktiv. Eines dieser
Ehrenämter hat unmittelbar mit dem Katholikentag zu tun: Der
56-Jährige ist Vorsitzender des Katholikentags e.V., des
Rechtsträgers des Großveranstaltung. "Ich finde Katholikentage
etwas Großartiges, gemeinsam über den Glauben zu reflektieren und
gemeinsam zu feiern. Hier lasse ich mich gern in die Pflicht
nehmen", begründet Langenfeld sein Engagement. Es sei wichtig,
"dass sich die Gesellschaft immer wieder vergewissert, was
glaubende Katholiken für sie bedeuten und wie sie aktiv an den
gesellschaftlichen Diskursen mitwirken", betont der
Vorstandsvorsitzende.
 Das
Porträt von Harald Langenfeld gibt es ab 23. April auf www.100tage100menschen.de.
Es ist Teil eines Multimediaprojekts des Deutschen Katholikentags,
das 100 Tage lang Geschichten von Menschen erzählt, die mit dem
Katholikentag in Leipzig in Verbindung stehen oder in Berührung
kommen werden.
Das
Porträt von Harald Langenfeld gibt es ab 23. April auf www.100tage100menschen.de.
Es ist Teil eines Multimediaprojekts des Deutschen Katholikentags,
das 100 Tage lang Geschichten von Menschen erzählt, die mit dem
Katholikentag in Leipzig in Verbindung stehen oder in Berührung
kommen werden.
Der 100. Deutsche Katholikentag ist eine christliche
Großveranstaltung. Er findet vom 25. bis 29. Mai 2016 in Leipzig
statt. Erwartet werden mehrere Zehntausend Gäste aus dem gesamten
Bundesgebiet sowie der Region. Katholikentage werden vom
Zentralkomitee der deutschen Katholiken (ZdK) in der Regel alle
zwei Jahre an wechselnden Orten veranstaltet. Der 99. Deutsche
Katholikentag fand 2014 in Regensburg statt.
Text: 100. Deutscher Katholikentag Leipzig 2016 e.V.,
Presse
23.04.2016
Reformation als Lehrbeispiel für das Zusammenwachsen der Welt
Vertreter von Kirche, Politik, Kultur und Medien
diskutieren über Protestantismus in der Einen Welt
Berlin- (lk). Weltweit verbinden über
400 Millionen Menschen ihren Glauben mit der Reformation. Über
deren globale Dimension in der Einen Welt diskutierten der
ARD-Fernsehjournalist und Auslandskorrespondent Klaus Scherer, der
rheinland-pfälzische Justizminister Gerhard Robbers und
Kirchenpräsident Christian Schad in der Landesvertretung
Rheinland-Pfalz in Berlin.
Als großen Gewinn bezeichnete Gerhard Robbers das
Zusammenwachsen der Welt. Wie dabei die Vielfalt der Kulturen
erhalten und konstruktiv aufeinander bezogen werden könne, zeige
die Reformation als Lehrbeispiel auf. So lerne man von ihr, „dass
Glaubensfreiheit auch für diejenigen durchgesetzt werden muss, mit
denen man selbst nicht übereinstimmt“, sagte Robbers.
Für Kirchenpräsident Christian Schad schließen sich Christsein
und Homogenität aus. Er sei im Blick auf rechtspopulistische
Parolen erschrocken, wie Vereinheitlichung als Ideal angesehen
werde. Christen lebten von einer lebendigen Vielfalt und vom
fruchtbaren Ringen unterschiedlicher Meinungen um den richtigen
Weg. Dabei gelte es, die Position des anderen zu respektieren und
die eigene Stärke für die anderen einzusetzen.
Aus der Erfahrung seiner Korrespondententätigkeit in den USA und
in Asien hat Klaus Scherer die Erkenntnis mitgebracht, dass „wir
uns aufgrund der Komplexität der Welt daran gewöhnen müssen, dass
nicht alles so einfach ist, wie sich die Menschen das wünschen“.
Auch sollten sich Medien und Politik eingestehen, dass man zum
Beispiel in internationalen Konflikten nicht immer wisse, was zu
tun sei. Als Auslandkorrespondent habe er nicht die Aufgabe, zu
sagen, „so sind die Amerikaner oder die Japaner“, vielmehr gelte
es, zu differenzieren und auch Widersprüche aufzuzeigen. Die
Chance, die ein Betrachter von außen habe, läge darin „vieles zu
sehen, was Einheimische als Betriebsblinde nicht mehr sehen“. Aber
auch als Rückkehrer ins eigene Land gewinne man einen neuen Blick
auf das vermeintlich Bekannte.
Mit Blick auf die aktuelle Flüchtlingsdebatte steht der
rheinland-pfälzische Justizminister einer gesetzlich geregelten
Integration von Menschen anderer Religionen oder Kulturen skeptisch
gegenüber. Die aktuelle Situation zeige, dass die meisten Menschen
bereit seien, die geltenden Normen und Werte auch ohne Druck zu
akzeptieren, sagte Robbers. Für ihn ist „der beste Anstoß zur
Integration die Freiwilligkeit“. Dem stimmte Klaus Scherer zu: Mit
einer Debatte über einen „Zwang“ zur Integration werde nur auf
Stimmungen reagiert.
Kirchenpräsident Christian Schad plädierte für das evangelische
Modell der „Einheit in versöhnter Verschiedenheit“, das auch zum
globalen Vorbild werden könne. Das bedeute Vielfalt und
Dialogbereitschaft statt nationalstaatlich verengter Sichtweise.
Pluralität sei daher nicht als Mangel, sondern als Gewinn zu
verstehen. Als Beispiel nannte Schad evangelische
Kindertagesstätten mit einem überwiegenden Anteil muslimischer
Kinder. Diese seien Lernorte, in denen früh interkulturelle
Kompetenz eingeübt werde.
Im Schwerpunktjahr „Reformation und die Eine Welt“ der
Reformationsdekade 2008 bis 2017 erinnert die Evangelische Kirche
in Deutschland daran, dass reformatorisches Handeln im 21.
Jahrhundert heißt, die Vielfältigkeit des Menschseins anzunehmen.
Insofern sei die Reformation kein abgeschlossenes Ereignis, sagte
Harald Asel vom Rundfunk Berlin-Brandenburg, der das Forum
moderierte. Staatssekretärin Heike Raab, Bevollmächtigte des Landes
beim Bund und für Europa, erinnerte in ihrer Begrüßung an die
Stätten der Reformation in Rheinland-Pfalz wie Worms und Speyer.
Mit ihnen bringe man Zivilcourage, Vielfalt sowie Glaubens- und
Gewissensfreiheit in Verbindung. Diese Werte hätten an Bedeutung
nicht verloren.
Die Evangelische Kirche der Pfalz mit Sitz in Speyer ist mit
zahlreichen Projekten und Veranstaltungen an dem von der
Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der Gemeinschaft
Europäischer Kirchen (GEKE) ausgerufenen Reformationsjubiläum
beteiligt. Sie ist Mitgastgeberin auf dem europäischen Stationenweg
und beteiligt sich an der Weltausstellung Reformation in
Wittenberg. Mehr Informationen zum Thema gibt es unter dem Logo
„Reformation 2017“ auf www.evkirchepfalz.de.
Mit der Veranstaltung haben die Landesvertretung Rheinland Pfalz
und die Evangelische Kirche der Pfalz ihre Reihe mit
Gesprächsrunden in der Reformationsdekade fortgesetzt.
Vorausgegangen waren „Reformation und Toleranz“ (2012),
„Reformation und Politik“ (2014) und „Die Macht der Medien“ (2015).
Die Reihe soll nach Auskunft von Staatssekretärin Heike Raab im
Jubiläumsjahr der Reformation 2017 fortgesetzt werden.
Mehr zum Thema: www.evkirchepfalz.de; www.ekd.de/reformationstag/.
23.04.2016
Große Spende für den Speyerer Dom
 Freude bei der Übergabe des Schecks an den Dombauverein (v.l.): Organisator des Konzerts Udo Heidt, Domdekan Dr. Christoph Kohl, Dombauvereinsvorsitzender Dr. Gottfried Jung, Dombaumeister Mario Coletto, Chorleiter Wolfgang Tropf, Dr. Barbara Schmidt-Nechl, stellvertretende Dombauvereinsvorsitzende und Franz Dudenhoeffer, Beisitzer im Vorstand des Dombauvereins.
Freude bei der Übergabe des Schecks an den Dombauverein (v.l.): Organisator des Konzerts Udo Heidt, Domdekan Dr. Christoph Kohl, Dombauvereinsvorsitzender Dr. Gottfried Jung, Dombaumeister Mario Coletto, Chorleiter Wolfgang Tropf, Dr. Barbara Schmidt-Nechl, stellvertretende Dombauvereinsvorsitzende und Franz Dudenhoeffer, Beisitzer im Vorstand des Dombauvereins.
Organisator von „Baden schaut über den Rhein“ Udo Heidt
überreicht Dombauverein Scheck über rund 7 700 Euro für den Erhalt
der Kathedrale
Speyer- (is). Zum 13. Mal hatte
Dombauvereinsmitglied Udo Heidt am 17. April das Benefizkonzert für
den Speyerer Dom unter dem Motto „Baden schaut über den Rhein“
organisiert. An dem Konzert hatten 650 Sängerinnen und Sänger aus
zehn badischen Chören mitgewirkt.
Den Scheck in Höhe des Erlöses von genau 7 674,45 Euro
überreichte Heidt heute gemeinsam mit dem Leiter der Nordbadischen
Chorvereinigung, Wolfgang Tropf, vor dem Domnapf in Speyer an den
Vorsitzenden des Dombauvereins, Dr. Gottfried Jung. Das Geld kommt
dem Erhalt der Kathedrale zugute.
Bei der Scheckübergabe mit dabei waren auch Dr. Barbara
Schmidt-Nechl, stellvertretende Dombauvereinsvorsitzende, Franz
Dudenhoeffer, Beisitzer im Vorstand des Dombauvereins,
Dombaumeister Mario Coletto und Domdekan Dr. Christoph Kohl.
22.04.2016
Hilfe für die Erdbebenopfer in Ecuador
Bistum Speyer und Evangelische Kirche der Pfalz stellen
20.000 Euro Soforthilfe zur Verfügung – Aufruf zu weiteren
Spenden
Speyer- (is/lk). Das Bistum Speyer und
die Evangelische Kirche der Pfalz rufen gemeinsam mit ihren
Hilfswerken Caritas und Diakonie zur Hilfe für die Erdbebenopfer in
Ecuador auf. Die beiden Kirchen haben heute 20.000 Euro Soforthilfe
zur Verfügung gestellt.
Mit dem Geld wird die Versorgung der Erdbebenopfer mit
Lebensmitteln, Trinkwasser und Notunterkünften unterstütz. Laut
Regierungsangaben handelt es sich um das schwerste Beben seit 1979.
Vorläufigen Angaben zufolge wurden rund 500 Menschen getötet und
Hunderte verletzt. Ein Anstieg der Zahl der Toten und Verletzten
wird befürchtet. Viele Menschen der betroffenen Regionen haben aus
Angst vor Nachbeben die Nacht im Freien verbracht. Die Regierung
erklärte den Ausnahmezustand.
Am schwersten betroffen ist die Küstenregion der Provinz
Esmeraldas, wo auch das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 7,8
lag. Die Provinz Esmeraldas sowie das Anden-Hochland der
angrenzenden Provinz Imbambura zählten schon in der Vergangenheit
zu den am stärksten von Erdbeben gefährdeten Regionen Ecuadors. Um
die Anfälligkeit der Bevölkerung gegenüber Naturkatastrophen zu
verringern, hatten die kirchlichen Hilfswerke dort in den
vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort mehrere
Katastrophenvorsorge-Projekte gestartet. Unter anderem waren an
Schulen Notfall- und Evakuierungspläne erarbeitet sowie in mehreren
Gemeinden Katastrophenpräventionskomitees aufgebaut worden.
Ecuador gehört zu den Ländern in Lateinamerika, die am
anfälligsten für Naturkatastrophen sind. Die Anfälligkeit
resultiert insbesondere aus geologischen Risiken wie Erdbeben,
Tsunamis und Vulkanausbrüche sowie klimatischen Risiken wie
Überschwemmungen, Erdrutschen und Dürreperioden. Mehr als zwanzig
Prozent der Bevölkerung Ecuadors leben unterhalb der nationalen
Armutsgrenze, 11 Prozent gelten als unterernährt.
Spendenkonten:
Caritas international, Freiburg
IBAN: DE88 6602 0500 0202 0202 02
Bank für Sozialwirtschaft Karlsruhe
BIC: BFSWDE33KRL
oder online unter www.caritas-international.de
Diakonie Katastrophenhilfe, Berlin
IBAN: DE68 5206 0410 0000 5025 02
Evangelische Bank eG
BIC GENODEF1EK1
oder online unter www.diakonie-katastrophenhilfe.de/spenden/
22.04.2016
Einen Schlussstrich unter die Geschichte darf es nicht geben
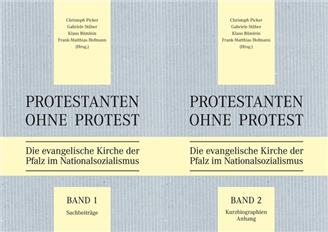 Landeskirche und Evangelische Akademie stellen
Handbuch „Protestanten ohne Protest“ vor
Landeskirche und Evangelische Akademie stellen
Handbuch „Protestanten ohne Protest“ vor
Speyer- Die Selbstanpassung des
pfälzischen Protestantismus an das Nazi-Regime bleibt nach den
Worten von Kirchenpräsident Christian Schad belastendes Erbe und
dauerhafte Mahnung. Einen Schlussstrich unter die Geschichte könne
es nicht geben, führten Schad und der Direktor der Evangelischen
Akademie der Pfalz, Christoph Picker, bei der Vorstellung des
Handbuches „Protestanten ohne Protest“ am Montag im Historischen
Museum in Speyer aus. „Vergangenheit kann verblassen, aber sie
lässt uns nicht los. Die Jahre 1933 bis 1945 gehören genauso zur
Identität unserer Kirche wie die Reformation, wie die Speyerer
Protestation und wie die Union von 1818.“
Zugleich wiesen sie auf die über den Bereich der Kirche hinaus
aktuelle Bedeutung des Buches hin. „Unsere Erinnerung liefe ins
Leere, wenn wir sie nicht mit der Frage nach der praktischen
Solidarität verbänden“, sagte Kirchenpräsident Schad vor Gästen aus
Politik, Kirche und Gesellschaft. Herausgeber des Handbuches zur
Rolle der Landeskirche während des Nationalsozialismus sind
Akademiedirektor Picker, die Leiterin des Zentralarchivs der
pfälzischen Landeskirche, Gabriele Stüber, Oberkirchenrat i.R.
Klaus Bümlein und Kirchenrat Frank Matthias Hofmann. Im Auftrag der
Landeskirche und unter Federführung der Evangelischen Akademie der
Pfalz haben 60 Autoren an dem zweibändigen Werk mitgewirkt.
„Rheinpfalz“-Chefredakteur Michael Garthe bezeichnete
„Protestanten ohne Protest“ als „herausragendes, wichtiges Werk für
die Pfalz“, in dem vieles neu, interessant und erschütternd sei. Es
stifte über die konfessionelle Betrachtung hinaus Geschichts- und
Heimatbewusstsein der Pfälzer insgesamt und mache viele
Zeitgenossen zu „Alphabeten der Geschichte“, obwohl viele Menschen
bei der Betrachtung der NS-Zeit lieber Analphabeten geblieben
wären.
Aus der Geschichte lernen bedeute für die bundesrepublikanische
Gegenwart, dass Christen mehr denn je ein Bollwerk gegen
Fremdenhass, Militarismus, Zensur und Nationalismus sein müssten.
„Alles, was zum Faschismus und Nationalsozialismus geführt hat,
darf es in unserer Gesellschaft nicht mehr geben“, erklärte Garthe.
Für die Pfalz und die Pfälzer im 21. Jahrhundert bedeute dies, mit
den ausländischen Mitbürgern und den europäischen Nachbarn
friedlich und offen miteinander zu leben. „Heimatbewusstsein
stiftet Identität, aber die eigene Identität kann nur im Gegenüber
anderer entstehen”, sagte Garthe. Heimatliebe und Fremdenhass
schlössen einander aus.
Nicht nur für die Protestantische Landeskirche sei die „Lehre
aus der NS-Geschichte“, dass die Kirche nicht im Dienst der Politik
stehen und kein Erfüllungsgehilfe der Regierung sein dürfe. Die
Kirche habe eine gesellschaftliche Aufgabe und keine staatliche
Gewalt, ergreife Partei ohne eine Partei zu sein.
„Wer aus der Geschichte lernen will, der kommt um die intensive
Beschäftigung mit ihr nicht herum“, führte Akademiedirektor
Christoph Picker aus. Indes sei „Protestanten ohne Protest“ kein
moralisches Buch. „Beabsichtigt war nicht so etwas wie eine
Abrechnung mit den Verfehlungen und Versäumnissen früherer
Generationen. Aber wir kommen zu dem Fazit, dass der pfälzische
Protestantismus in der NS-Zeit seinem Selbstverständnis und seinem
Bekenntnis nicht gerecht geworden ist.“ Ausnahmen habe es
gleichwohl gegeben: Der Thaleischweiler Pfarrer Heinz Wilhelmy, der
die aggressive Außenpolitik des Regimes kritisiert habe; Pfarrer
Johannes Bähr, der im Schulunterricht die Novemberpogrome offen
verurteilt habe, der Pirmasenser Pfarrer Oswald Damian, der vor dem
Rassismus, dem Militarismus und der Christentums-Feindlichkeit der
Nationalsozialisten gewarnt habe.
Unter dem Schwerpunktthema „Protestanten ohne Protest – die
evangelische Kirche der Pfalz im Nationalsozialismus“ beschäftigt
sich auch die Frühjahressynode der Landeskirche mit der
Aufarbeitung ihrer Geschichte. Die Tagung findet vom 1. bis 4. Juni
im Martin-Butzer-Haus in Bad Dürkheim statt.
Hinweis: Das Handbuch „Protestanten ohne Protest. Die
evangelische Kirche der Pfalz im Nationalsozialismus“ ist zum Preis
von 59,90 Euro erhältlich beim Verlagshaus Speyer, Telefon
06232/24926, E-Mail: info@verlagshaus-speyer.de.
Foto: Verlagshaus Speyer
19.04.2016
Benefizkonzert für den Dom voller Erfolg
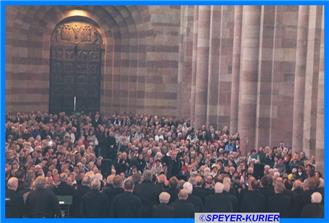 7.700 Euro bei „Baden schaut über den Rhein“
ersungen
7.700 Euro bei „Baden schaut über den Rhein“
ersungen
Speyer- Die 900 Sitzplätze im Dom reichten
bei weitem nicht aus, so dass viele Menschen dem Konzert „Baden
schaut über den Rhein“ im Stehen lauschten. 7.700 Euro
konnten dabei für den Domerhalt gesammelt werden. Das sind rund
2.500 Euro mehr als im vergangenen Jahr.
Das Konzertereignis hat Tradition. Am 17. April 2016 musizierten
und sangen bereits zum 13. Mal badische Musiker und Chöre im Dom
und für den Dom. Die 650 Sängerinnen und Sänger der Nordbadischen
Chorvereinigung, die „Tropfchöre“, erfüllten die Kathedrale mit
ihrem Gesang.
 Zu Beginn erklang ein Instrumentalstück. Das Prelude aus
dem „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, bekannt als Fanfare bei
Fernseh-Übertragungen im Rahmen der Eurovision, spielten
Holger Becker an der Chororgel und Frédéric Messner an der
Trompete. Zunächst nach Männer- und Frauenstimmen getrennt kamen
danach die unterschiedlichsten Werke zu Gehör. Unter der Leitung
von Wolfgang Tropf erklangen, neben dem „Vater unser“ und „Dona
Maria“, auch Titel wie „Über 7 Brücken“ oder „Conquest of Paradise,
welches alle Chöre gemeinsam sangen.
Zu Beginn erklang ein Instrumentalstück. Das Prelude aus
dem „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, bekannt als Fanfare bei
Fernseh-Übertragungen im Rahmen der Eurovision, spielten
Holger Becker an der Chororgel und Frédéric Messner an der
Trompete. Zunächst nach Männer- und Frauenstimmen getrennt kamen
danach die unterschiedlichsten Werke zu Gehör. Unter der Leitung
von Wolfgang Tropf erklangen, neben dem „Vater unser“ und „Dona
Maria“, auch Titel wie „Über 7 Brücken“ oder „Conquest of Paradise,
welches alle Chöre gemeinsam sangen.
Zu den besonderen Konzertmomenten gehörte sicher das
„Hallelujah“ von Leonard Cohen, bei dem Uschi Tropf und der
Kinderchor Frohsinn aus Neudorf Solopartien übernahmen. Zur
instrumentalen Begleitung kamen im Verlauf des Konzertes Saxophone,
Querflöten, ein E-Piano und sogar zwei Dudelsäcke zum Einsatz,
letztere gespielt von Herbert Pföhler und Werner Sommer.
 Den traditionellen Schluss- und Höhepunkt bildete das
gemeinsame Singen des Chorals „Großer Gott wir loben dich“, bei dem
2.000 Stimmen zu hören gewesen sein dürften. Unter den Sängern
waren auch der Bischof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann sowie
der emeritierte Bischof Dr. Anton Schlembach.
Den traditionellen Schluss- und Höhepunkt bildete das
gemeinsame Singen des Chorals „Großer Gott wir loben dich“, bei dem
2.000 Stimmen zu hören gewesen sein dürften. Unter den Sängern
waren auch der Bischof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann sowie
der emeritierte Bischof Dr. Anton Schlembach.
Organisiert wurde das Musikereignis auch in diesem Jahr vom
Dombauvereinsmitglied Udo Heidt. Der Vorsitzende
des Dombauvereins, Dr. Gottfried Jung, würdigte Heidt als einen
Menschen, der für die Musik lebe und dem es gelinge, viele andere
Menschen mit seiner Begeisterung anzustecken. Er freue sich, dass
eine Veranstaltung, die so viel Spaß mache, gleichzeitig so viel
Gutes bewirke. Gedankt wurde den Mitwirkenden direkt nach dem
Konzert auch von Domdekan Dr. Christoph Kohl, der für die Liturgie
und damit auch für die Musik in der romanischen Kathedrale
verantwortlich ist.
Text: is; Foto: pem; Domkapitel Speyer
18.04.2016
Bundesweite Renovabis-Pfingstaktion in Speyer eröffnet
 Perspektiven für Jugendliche in Osteuropa notwendig -
Justizminister Robbers dankt für breit gefächertes Engagement der
katholischen Kirche
Perspektiven für Jugendliche in Osteuropa notwendig -
Justizminister Robbers dankt für breit gefächertes Engagement der
katholischen Kirche
Speyer- Mit einem feierlichen
Pontifikalamt im Speyerer Dom wurde heute die 24.
Renovabis-Pfingstaktion bundesweit eröffnet. Sie steht unter dem
Leitwort „Jung, dynamisch, chancenlos?“ und richtet den Blick auf
Jugendliche und junge Erwachsene in den Ländern Mittel- und
Osteuropas.
„Die Schatten der Vergangenheit sind noch lange nicht
abgeschüttelt. Viele junge Menschen in Mittel- und Osteuropa haben
den Eindruck, dass man an ihnen gar nicht interessiert ist“, sagte
der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann im Blick auf die
Jugendarbeitslosigkeit, die in manchen Ländern Osteuropas bei rund
60 Prozent liegt. „Das muss uns alarmieren“, forderte er eine
visionäre Veränderung. „Echte Vision hat immer den Bezug zur
Wirklichkeit, aber sie sieht in der Wirklichkeit noch etwas, das
sonst nicht wahrgenommen wird: die Chance zur Wandlung.“ Der Glaube
bedeute vielen jungen Menschen in Osteuropa sehr viel. „Er ist
mitten in Enttäuschungen und Hoffnungslosigkeiten die entscheidende
Kraft, nicht an der Wirklichkeit zu verzweifeln, sondern den Mut zu
finden, an einer besseren Zukunft mitzubauen.“ Es müsse „höchste
politische und gesellschaftliche Priorität“ haben, dass es „keine
verlorenen Generationen gibt und geben darf“. Das Hilfswerk
Renovabis sei 1993 von den deutschen Katholiken im Bewusstsein
gegründet worden, „wie vielen wir unsere neue Chance nach dem
Desaster des Zweiten Weltkriegs verdanken.“ Auch persönlich sei ihm
erst nach und nach aufgegangen, „mit welch positivem Startkapital
meine Generation, die Nachkriegsgeneration, ins Leben getreten ist
und es entfalten konnte.“ Die junge Generation in Osteuropa brauche
„Visionen, die die Wirklichkeit verändern, und die Erfahrung von
Menschen, die Leuchttürme hoffnungsvoller Perspektiven
errichten.“
 Bischof Wiesemann zelebrierte den Gottesdienst gemeinsam
mit Erzbischof Duro Hranić (Dakovo), Weihbischof Pero Sudar
(Sarajevo) und Weihbischof Otto Georgens, der für die Kontakte des
Bistums Speyer in die Weltkirche hinein verantwortlich ist. Das
Thema Osteuropa wurde im Gottesdienst auf verschiedene Weise
aufgegriffen. Zum Beispiel wurde die zweite Lesung in litauischer
Sprache vorgetragen. Die Kollekte war für das Projekt „Ältere
Schwester – älterer Bruder“ des Vereins „Narko Ne“ (Nein zu Drogen)
aus Bosnien und Herzegowina bestimmt. Eine Band mit
Roma-Jugendlichen aus Ardud in Rumänien knüpfte eine musikalische
Verbindung und ergänzte die Dommusik, die zusammen mit dem
Orchester der städtischen Musikschule eine Messe von Leo Delibes
aufführte. Beim anschließenden Empfang im Haus Trinitatis
erläuterten die Renovabis-Gäste in kurzen Interviews ihre Arbeit.
Der rheinland-pfälzische Justizminister Gerhard Robbers dankte der
katholischen Kirche und ihrem Hilfswerk Renovabis für ihr breit
gefächertes Engagement in den Ländern Mittel- und Osteuropas.
Bischof Wiesemann zelebrierte den Gottesdienst gemeinsam
mit Erzbischof Duro Hranić (Dakovo), Weihbischof Pero Sudar
(Sarajevo) und Weihbischof Otto Georgens, der für die Kontakte des
Bistums Speyer in die Weltkirche hinein verantwortlich ist. Das
Thema Osteuropa wurde im Gottesdienst auf verschiedene Weise
aufgegriffen. Zum Beispiel wurde die zweite Lesung in litauischer
Sprache vorgetragen. Die Kollekte war für das Projekt „Ältere
Schwester – älterer Bruder“ des Vereins „Narko Ne“ (Nein zu Drogen)
aus Bosnien und Herzegowina bestimmt. Eine Band mit
Roma-Jugendlichen aus Ardud in Rumänien knüpfte eine musikalische
Verbindung und ergänzte die Dommusik, die zusammen mit dem
Orchester der städtischen Musikschule eine Messe von Leo Delibes
aufführte. Beim anschließenden Empfang im Haus Trinitatis
erläuterten die Renovabis-Gäste in kurzen Interviews ihre Arbeit.
Der rheinland-pfälzische Justizminister Gerhard Robbers dankte der
katholischen Kirche und ihrem Hilfswerk Renovabis für ihr breit
gefächertes Engagement in den Ländern Mittel- und Osteuropas.
Weitere Informationen: www.renovabis.de Text: is;
Fotos: Klaus Landry
17.04.2016
Eröffnung der Renovabis-Pfingstaktion 2016 im Bistum Speyer
 „Jung, dynamisch, chancenlos?“
„Jung, dynamisch, chancenlos?“
Freising/Speyer- Sie sind jung,
motiviert, oft aber auch ziemlich ratlos, was ihre Zukunft angeht,
denn ihre Heimatländer bieten ihnen kaum Perspektiven. Viele
Jugendliche und junge Erwachsene im Osten Europas kehren ihrem Land
deshalb den Rücken. Korruption, Arbeitslosigkeit, Armut und die
damit einhergehende Chancenlosigkeit sind nur einige der Gründe
dafür. Unter dem Leitwort „Jung, dynamisch, chancenlos? Jugendliche
im Osten Europas brauchen Perspektiven“ greift die katholische
Solidaritätsaktion Renovabis dieses Thema im Rahmen ihrer
bundesweiten Pfingstaktion auf. Zum Auftakt der Kampagne vom 14.
bis 17. April ist das Hilfswerk mit zahlreichen Gästen aus
Osteuropa im Bistum Speyer in Schulen, Bildungshäusern und
Pfarreien zu Gast. Die feierliche Eröffnung der Pfingstaktion
findet im Rahmen eines Gottesdienstes am Sonntag, 17.
April, im Speyerer Kaiserdom statt.
Die Jugend als „Wächter auf den Morgen“
Der gastgebende Bischof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann,
wies in der Pressekonferenz zur Aktionseröffnung auf ein Wort des
Hl. Papstes Johannes Paul II. hin. Dieser habe den jungen Menschen
in Kirche und Gesellschaft eine prophetische Aufgabe zugeschrieben.
Sie seien „die Wächter auf den Morgen“, auf eine neue, humane
Zivilisation nach den Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. Der
Glaube, so Bischof Wiesemann, sei für viele Jugendliche auch in
Osteuropa eine wichtige Kraft, um sich trotz täglicher Erfahrungen
von Armut, Korruption und Arbeitslosigkeit für eine Veränderung
einzusetzen und Perspektiven zu schaffen.
 Angesichts aktueller Zahlen, z. B. aus Litauen oder
Bosnien und Herzegowina scheinen solche Veränderungen auch dringend
nötig zu sein. Die litauische Sozialarbeiterin Roberta
Daubaraitė-Randė berichtete aus ihrer Heimat, dass rund 60 Prozent
der Jugendlichen vom Auswandern träumten. In Bosnien seien es sogar
70 Prozent, sagte Weihbischof Pero Sudar, der in Bosnien die
multi-ethnischen Europa-Schulen initiiert hat. Beide sind im Rahmen
der Renovabis-Pfingstaktion in Speyer zu Gast und berichten bei
zahlreichen Veranstaltungen über die Situation in ihren
Heimatländern.
Angesichts aktueller Zahlen, z. B. aus Litauen oder
Bosnien und Herzegowina scheinen solche Veränderungen auch dringend
nötig zu sein. Die litauische Sozialarbeiterin Roberta
Daubaraitė-Randė berichtete aus ihrer Heimat, dass rund 60 Prozent
der Jugendlichen vom Auswandern träumten. In Bosnien seien es sogar
70 Prozent, sagte Weihbischof Pero Sudar, der in Bosnien die
multi-ethnischen Europa-Schulen initiiert hat. Beide sind im Rahmen
der Renovabis-Pfingstaktion in Speyer zu Gast und berichten bei
zahlreichen Veranstaltungen über die Situation in ihren
Heimatländern.
Die Abwanderung ist eine echte Bedrohung für die
osteuropäischen Staaten
 „Die aktuelle Entwicklung ist eine große
Herausforderung“, betont auch der Geschäftsführer von Renovabis,
Dr. Gerhard Albert. Es sei wichtig, die zuständigen Regierungen und
Politiker nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Nicht nur für
die Jugendlichen sei die Situation oft dramatisch, so Albert, „denn
die anhaltende Abwanderung junger Leute stellt auch für die
Entwicklung der osteuropäischen Staaten eine echte Bedrohung dar“.
Für Renovabis gehe es im Rahmen der diesjährigen Pfingstaktion
darum, auf diese Situation aufmerksam zu machen und um Solidarität
mit jungen Menschen im Osten Europas zu werben.
„Die aktuelle Entwicklung ist eine große
Herausforderung“, betont auch der Geschäftsführer von Renovabis,
Dr. Gerhard Albert. Es sei wichtig, die zuständigen Regierungen und
Politiker nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Nicht nur für
die Jugendlichen sei die Situation oft dramatisch, so Albert, „denn
die anhaltende Abwanderung junger Leute stellt auch für die
Entwicklung der osteuropäischen Staaten eine echte Bedrohung dar“.
Für Renovabis gehe es im Rahmen der diesjährigen Pfingstaktion
darum, auf diese Situation aufmerksam zu machen und um Solidarität
mit jungen Menschen im Osten Europas zu werben.
Das Ensemble „Big-Band“ aus Rumänien: Die Jugendliche der
Roma-Minderheit in Ardud umrahmten die Pressekonferenz
musikalisch.
Weitere Informationen: www.renovabis.de Text: is;
Foto: gc
16.04.2016
Vier Bewerber für Oberkirchenratswahl

Nachfolge für Gottfried Müller steht erneut auf der
Tagesordnung der Landessynode
Speyer- Vier Theologen sind von der
Kirchenregierung der Evangelischen Kirche der Pfalz als geeignete
Bewerber für das Amt eines geistlichen Oberkirchenrats
vorgeschlagen worden. Das hat der Pressesprecher der Landeskirche,
Kirchenrat Wolfgang Schumacher, am Donnerstag in Speyer bekannt
gegeben. Oberstudiendirektor Steffen Jung, Kirchenrat Michael
Löffler, Pfarrer Martin Schuck und Pfarrerin Marianne Wagner wollen
Nachfolger von Oberkirchenrat Gottfried Müller werden, der Ende
August 2016 in den Ruhestand geht. Die Wahl erfolgt durch die
Landessynode, die vom 1. bis 4. Juni in Bad Dürkheim tagt.
Steffen Jung ist seit 2011 Leiter des Evangelischen
Trifelsgymnasiums in Annweiler. Der 55-Jährige aus dem
saarländischen Altstadt war zuvor Landesjugendpfarrer und Pfarrer
am Saarpfalz-Gymnasium in Homburg. Michael Löffler ist 52 Jahre und
seit 2013 theologischer Abteilungsleiter im Personalreferat der
Badischen Landeskirche in Karlsruhe. Der in Neustadt an der
Weinstraße lebende Theologe war zuvor Leiter des Bischofsbüros und
Pfarrer in Leimen bei Heidelberg. Martin Schuck ist seit 2009
Leiter des Verlagshauses Speyer GmbH. Der promovierte Theologe
arbeitete elf Jahre als wissenschaftlicher Referent beim
Konfessionskundlichen Institut in Bensheim. Gemeindepfarrer war der
in Obermoschel aufgewachsene 54-Jährige in Zweibrücken und
Ludwigshafen-Oppau. Marianne Wagner ist seit 2002 Pfarrerin im
Missionarisch-Ökumenischen Dienst der Landeskirche in Landau und
vertritt schwerpunktmäßig den Arbeitsbereich Weltmission und
Ökumene. Die 54-Jährige arbeitete zuvor im Kirchenbezirk
Neustadt.
Die Stelle des geistlichen Oberkirchenrats war erstmals im
Frühjahr 2015 ausgeschrieben worden. Bei der Wahl durch die
Landessynode im November 2015 hatten die beiden Bewerber, Dekan
Armin Jung (Neustadt) und Verlagsleiter Martin Schuck (Speyer),
nicht die erforderliche Mehrheit erreicht. Die Stelle wurde daher
im Januar 2016 erneut ausgeschrieben. Dabei wurde ausdrücklich
darauf hingewiesen, dass sich alle ordinierten Pfarrerinnen und
Pfarrer im Dienst einer der 20 Landeskirchen bewerben können. In
der Nachfolge von Gottfried Müller wären die Kandidaten als
Dezernenten für die Pfarrer und Vikare zuständig sowie für die
theologische Fort-und Weiterbildung, die Jugendarbeit und Planungs-
und Strukturfragen.
Im Zusammenhang mit der anstehenden Wahl erinnerte die
Kirchenregierung daran, dass das Bewerbungsverfahren und die Wahl
streng nach geltendem Recht und Gesetz zu erfolgen haben. Dies
verlange der Respekt vor der Synode und diene dem
Persönlichkeitsschutz der Bewerber. Öffentliche Mutmaßungen und
mediale Spekulationen könnten nicht die Verfassung und die
Wahlgesetze ersetzen oder außer Kraft setzen, so die
Kirchenregierung.
Oberkirchenräte werden in der Pfälzischen Landeskirche auf die
Dauer von sieben Jahren gewählt, Wiederwahlen sind möglich. Sie
leiten die einzelnen Dezernate des Landeskirchenrats, der obersten
Behörde der Landeskirche. Den Vorsitz im Kollegium führt der
Kirchenpräsident. Er ist auch für die Geschäftsverteilung
zuständig. Text und Foto: lk
15.04.2016
Spende an den Bauverein der Gedächtniskirche
 Spende des „Clubs Deutscher Drehorgelfreunde e.V.“ und des
„Pfälzer Drehorgelstammtisches“
Spende des „Clubs Deutscher Drehorgelfreunde e.V.“ und des
„Pfälzer Drehorgelstammtisches“
Speyer- Der Erlös des Konzertes der
Drehorgelkonzertes vom vergangenen Samstag, den 9.4.2016, 11 Uhr in
der Gedächtniskirche betrug: 917,46 €.
Der Eintritt war frei, es wurde um Spenden für den „Bauverein
der Gedächtniskirche“ gebeten.
Herr Martin Junger, der das Konzert moderierte, hat den
Betrag Dekan Jäckle in der Gedächtniskirche überreicht.
Verabschiedungsgottesdienst Pfr. Weinerth an der
Gedächtniskirche:
Verabschiedungsgottesdienst von Pfr. Weinerth am Sonntag, den
17. April, 10 Uhr Gedächtniskirche
Pfr. Weinerth wird die Predigt halten,
im Anschluss an den GD findet ein Umtrunk im
Martin-Luther-King-Haus statt.
Am 1. Mai tritt Pfr. Weinerth die Pfarrstelle der
Auferstehungskirchengemeinde in Speyer an.
Der Einführungsgottesdienst dort ist am 8. Mai 2016 um 10
Uhr.
15.04.2016
Bischof Wiesemann weiht Altar in der Kapelle der Maria-Ward-Schule
 Festgottesdienst mit Schülerinnen, Lehren und Gästen –
Martin Schöneich gestaltete neuen Altar, Ambo und
Tabernakel
Festgottesdienst mit Schülerinnen, Lehren und Gästen –
Martin Schöneich gestaltete neuen Altar, Ambo und
Tabernakel
Landau- „Acht Tage lang feierten sie die
Altarweihe, brachten mit Freuden Brandopfer dar und schlachteten
Heils- und Dankopfer … Im Volk herrschte große Freude“ (1 Makk 4) –
ganz so ausgiebig, wie die Makkabäer im Alten Testament den Sieg
über Gorgias und den Neuaufbau ihres von Feindeshand entweihten
Altars feierten, konnte das Pontifikalamt zur Altarweihe in der
Maria-Ward-Schule in Landau, dem diese Lesung vorangestellt war,
freilich nicht werden. Aber zu jenem „geradezu archaischen, ganz
besonderen Erlebnis“, das Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
versprach, wurde der Festgottesdienst für die Schüler und Lehrer,
die am Dienstagnachmittag in der neu restaurierten Kapelle Platz
fanden, tatsächlich.
Vorfreude und knisternde Spannung lagen schon zu Beginn der
Messfeier in der Luft und der Bischof ließ sich spürbar anstecken
von dieser heiter angeregten, auch ein bisschen aufgeregten
Stimmung, die zum fruchtbaren Nährboden für seine Botschaft wurde:
„Feuer in der Kirche – endlich!“ befeuerte er auch mit Worten das
Geschehen am Altar. „Feuer, wie beim brennenden Dornbusch wird zur
Gegenwart – lebendig - hier und heute - inmitten der
Glaubensgemeinde,“ spannte er den Bogen vom alten Testament zur
neuen Kapelle. So, wie das Chrisamöl zu Beginn der Altarweihe auf
die Steinplatte „nicht eingepaukt, sondern eben eingebrannt“ werde,
so solle auch der Glaube seine Spuren in der Festgemeinschaft
hinterlassen, damit die Schülerinnen und Lehrer Feuer und Flamme
für die Botschaft Gottes sind.
 Schon
zu Urzeiten hätten die Menschen Opfer dargebracht, um Schuld zu
tilgen und Gott gnädig zu stimmen. Dann aber opferte Gott seinen
eigenen Sohn, um seine grenzenlose Liebe zu den Menschen zu zeigen.
Fortan, so Wiesemann, sollen Christen immer daran erinnert werden,
„dass die Liebe das Wichtigste ist und das Einzige, das Zukunft
bringt“. Durch die Auferstehung habe Christus nicht nur den eigenen
Tod überwunden, sondern - leiblich wie geistig – auch Grenzen
überwunden. So, wie sich der Auferstandene durch verschlossene
Türen und verängstigte Herzen den Weg zu den Emmaus-Jüngern bahnte,
so, wie er mit ihnen das Brot brach, „so entsteht Kirche – so
entsteht Gemeinde – so kommt Jesus in die Mitte“.
Schon
zu Urzeiten hätten die Menschen Opfer dargebracht, um Schuld zu
tilgen und Gott gnädig zu stimmen. Dann aber opferte Gott seinen
eigenen Sohn, um seine grenzenlose Liebe zu den Menschen zu zeigen.
Fortan, so Wiesemann, sollen Christen immer daran erinnert werden,
„dass die Liebe das Wichtigste ist und das Einzige, das Zukunft
bringt“. Durch die Auferstehung habe Christus nicht nur den eigenen
Tod überwunden, sondern - leiblich wie geistig – auch Grenzen
überwunden. So, wie sich der Auferstandene durch verschlossene
Türen und verängstigte Herzen den Weg zu den Emmaus-Jüngern bahnte,
so, wie er mit ihnen das Brot brach, „so entsteht Kirche – so
entsteht Gemeinde – so kommt Jesus in die Mitte“.
Eine Mitte, die sich in der Maria Ward Kapelle nach Wunsch des
Schulseelsorgers Martin Olf und in Zusammenarbeit mit Claus
Sternberger vom bischöflichen Bauamt auch sinnbildlich durch die
mutige Neugestaltung zeigt. Denn die von Bildhauer Martin Schöneich
geschaffenen sakralen Objekte Ambo, Altar und Tabernakel sind nach
dem Konzept der „Orientierten Versammlung“ als zentrale Mittelachse
angelegt, die im ovalen Bogen von der Glaubensgemeinschaft
umschlossen wird. Der Werkstoff Glas, aus dem auch der Korpus des
Altars geschichtet ist, symbolisiert Licht, Transzendenz und
Durchlässigkeit und damit die Existenz Gottes „mitten unter uns.“
Mit sichtbarer Freude hat Bischof Wiesemann diese modernen
Objekte mit dem alten Ritus verbunden und die Altarweihe -
mitzelebriert von Schulseelsorger Martin Olf, Domdekan Christoph
Kohl und dem früheren Dekan Klaus Armbrust - als fast
mystisch-sakralen Höhepunkt lebendig werden lassen: die
Allerheiligenlitanei bildete dabei die Einleitung des genau
festgelegten Brauchs, bei dem zunächst eine Reliquie der früheren
Märtyrerkirche in den Altar eingelassen wird. Es folgten die
Salbung der Tischplatte mit heiligem Chrisam und das Entzünden des
Feuers an allen vier Ecken und der Mitte des Altars. Lange dauert
der Augenblick, bis sich die Flammen verzehren und so lange währte
auch die besondere Ergriffenheit der Gläubigen, die andachtsvoll
staunten und in das musikalische „Veni Sancte Spiritus“
einstimmten: „Komm heiliger Geist, entzünde in uns das Feuer deiner
Liebe“. Noch immer lag der Duft des Chrisamöls in der Luft, als der
Altar  schließlich gereinigt, eingedeckt und beweihräuchert wurde
und die Messfeier mit besonders feierlicher Musik fortgesetzt
wurde. Orgel (Manuel Cordel) und Trompete (Michael Hammer),
Klavier (Ulrike Sauerhöfer) und ein Streichquartett (Leitung: Agnes
Hoffmann) sowie der Kammerchor der Maria Ward Schule, verstärkt
durch den Lehrerchor, intonierten ein vielseitiges geistliches
Repertoire und boten einen breiten Klangteppich für die
singfreudige Gemeinde.
schließlich gereinigt, eingedeckt und beweihräuchert wurde
und die Messfeier mit besonders feierlicher Musik fortgesetzt
wurde. Orgel (Manuel Cordel) und Trompete (Michael Hammer),
Klavier (Ulrike Sauerhöfer) und ein Streichquartett (Leitung: Agnes
Hoffmann) sowie der Kammerchor der Maria Ward Schule, verstärkt
durch den Lehrerchor, intonierten ein vielseitiges geistliches
Repertoire und boten einen breiten Klangteppich für die
singfreudige Gemeinde.
Eingebunden in den Gottesdienst war ein Grußwort von Schwester
Dolores von der Kongregation der Englischen Fräulein, die auch
durch Schwester Eleonore und Schwester Rigoberta vertreten waren.
Sie freuten sich besonders über das bei der Renovierung der Kapelle
wiederentdecke Symbol „des aufblühenden Kreuzes mit den vier
Balkenenden in Form einer Blattknospe“, das zum Wappen der
Ward-Familie gehörte und heute als weltweit verbindendes Zeichen
gilt, in den Anfängen des Ordens aber geheim gehalten werden
musste. Schulleiter Klaus Neuberger dankte dem Bischof für seinen
erinnerungswürdigen Besuch mit der Seite einer Schulbibel und der
Einladung zu einem Umtrunk mit allen Gottesdienstbesuchern. Text
und Fotos: Brigitte Schmalenberg
14.04.2016
Querdenker suchen in der Kirche Antworten auf aktuelle Fragen
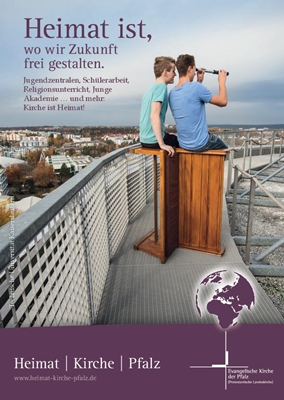 Schüler des
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums Neustadt gestalten Plakatmotiv der
Öffentlichkeitsarbeit
Schüler des
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums Neustadt gestalten Plakatmotiv der
Öffentlichkeitsarbeit
Neustadt- Mit einer neuen Plakatreihe
setzt die Evangelische Kirche der Pfalz ihre
Öffentlichkeitsinitiative Heimat | Kirche | Pfalz fort. Für die
siebte Reihe der im Jahr 2010 gestarteten Initiative haben
Schülerinnen und Schüler des Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums (KRG) in
Neustadt ein Motiv geplant und mit den Profis aus Landeskirche und
Werbeagentur umgesetzt. Kirchenpräsident Christian Schad übergab
die ersten Druckexemplare in Neustadt an die Schüler des
Grundkurses Evangelische Religion der 12. Jahrgangsstufe des KRG
sowie Schulleiter Hartmut Loos und Schulpfarrerin Ute
Friedberg.
Ausgangspunkt für das Projekt sei ein Treffen im
Landeskirchenrat in Speyer gewesen, bei dem die Schüler ihre
konstruktive Kritik an den damaligen Motiven geäußert hätten.
Vor allem habe ihnen der Bezug zur jüngeren Generation gefehlt,
resümierte Schad. Zugleich hätten die Schüler eigene Motiventwürfe
mitgebracht. So sei die Idee entstanden, die Gruppe „zu einem
Workshop mit der von uns beauftragten Werbeagentur Antares
einzuladen“. Nach zahlreichen Diskussionen auch unter der
Schülergruppe sei dann das Motiv unter dem Slogan „Heimat ist, wo
wir Zukunft gestalten“ entstanden.
Das Motiv, aufgenommen auf dem Dach des Verwaltungsgebäudes der
Technischen Universität Kaiserslautern, zeigt zwei junge Männer,
die auf einer hochkannt gekippten Kirchenbank sitzend mit einem
Fernrohr den Horizont absuchen. „Unser Blick und unser Denken gehen
nicht nur geradeaus, sondern auch oft quer“, erklären die Schüler
ihre Idee. Jonathan Mauß und Nikolas Arens sind die
Protagonisten, die sich „ins Bild setzen ließen“. Die Kirchenbank
verdeutliche das gemeinsame Fundament des Glaubens und die
Geschichte. Zugleich erinnere die Gesamtkonzeption des Bildes, dass
„wir auch auf unsere aktuellen Fragen Antworten brauchen“, so die
Schüler. Als Beispiel nannten sie die Möglichkeit der Segnung
gleichgeschlechtlicher Paare.
Kirchenrat Wolfgang Schumacher, Öffentlichkeitsreferent der
Landeskirche, stellte zugleich die drei weiteren Motive der
diesjährigen Reihe zum Thema „Reformation und die Eine Welt“ vor.
Diese zeigen die Bibliothek des Fachbereichs Translations-, Sprach-
und Kulturwissenschaft der Johannes Gutenberg Universität in
Germersheim („Heimat ist, wo du mit Sprache Brücken baust“)
und die deutsch-französische Grenze bei Neulauterburg und
Lauterbourg („Heimat ist, wo Grenzen verbinden“). Das Thema Flucht
und Integration greift ein Bild aus der geplanten
Erstaufnahmeeinrichtung in Herxheim bei Landau auf („Heimat ist, wo
du Fremden hilfst“).
Schad und Schumacher wiesen darauf hin, dass Motive und Themen
vor allem bei kirchlich Distanzierten Interesse wecken würden. Es
werde wahrgenommen, „dass die pfälzische Landeskirche in der Region
fest verwurzelt und nahe bei den Menschen ist mit deren Fragen,
Sorgen und Nöten, ihrem Stolz und ihrer Freude“. Dass die Motive
den Betrachter herausfordern, wie die Kritik der Schülerinnen und
Schüler aus Neustadt gezeigt habe, sei durchaus gewollt.
Die Motive der aktuellen Reihe „Heimat | Kirche | Pfalz“ können
über das Öffentlichkeitsreferat der Landeskirche unter oeffentlichkeitsreferat@evkirchepfalz.de
bestellt werden. Text und Foto: lk
13.04.2016
Teilnehmer-Tandems für Kundschafterreisen stehen fest
Bewerbungsphase erfolgreich abgeschlossen – Erstes
Vorbereitungstreffen am 8. Juli
Speyer- Das Bistum Speyer unternimmt in
diesem und dem kommenden Jahr vier so genannte
„Kundschafterreisen“. Sie führen nach England, Nicaragua, Südafrika
und auf die Philippinen. Jeweils eine ehren- und eine hauptamtliche
Person aus einer Pfarrei konnten sich gemeinsam als Team bewerben.
Inzwischen stehen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der vier
Kundschafterreisen fest. „Die Resonanz aus den Pfarreien auf das
Angebot war sehr ermutigend. Vor allem bei der Kundschafterreise
nach Südafrika hatten wir deutlich mehr Bewerbungen als Plätze“,
berichtet Domkapitular Franz Vogelgesang, Leiter der Hauptabteilung
Seelsorge des Bischöflichen Ordinariats. Die Bewerbungsphase sei
damit erfolgreich abgeschlossen.
Das Ziel der ein- bis zweiwöchigen Reisen unter dem Motto
„Lernen von der Weltkirche“ besteht darin, die seelsorgliche Arbeit
in anderen Ländern wahrzunehmen und Anregungen für die
Kirchenentwicklung im Bistum Speyer zu erhalten. „Es geht um ein
Kennenlernen von pastoralen Ansätzen in verschiedenen Ländern, um
in der Folge zu überlegen, was uns bereichern kann für das konkrete
Leben unserer Gemeinden oder Gemeinschaften in den neuen, größeren
Pfarreien“, so Franz Vogelgesang, der die Kundschafterreisen vor
allem als Ausdruck der leitenden Perspektiven im neuen
Seelsorgekonzept des Bistums Speyer versteht. Neben der
persönlichen, menschlichen und geistlichen Weiterentwicklung der
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist ihm die spirituelle und
theologische Reflexion der während der Reise gewonnenen Erfahrungen
und Erkenntnisse ein zentrales Anliegen. Sie sollen für die
pastorale Weiterentwicklung in den Pfarreien und im Bistum
fruchtbar gemacht werden, unter anderem beim Pastoraltag im
kommenden Jahr. Am 8. Juli treffen sich die Teilnehmer der
Kundschafterreisen zu einem ersten Vorbereitungstreffen auf Maria
Rosenberg.
Angebot „Summerschool“ gibt Impulse für lokale
Kirchenentwicklung
Einen weiteren Impuls, um von den Erfahrungen der Kirche in
anderen Ländern zu lernen, bietet die „Summerschool“, zu der das
Bischöfliche Ordinariat vom 9. bis 14. September in die
Bildungsstätte Heilsbach einlädt. Es richtet sich an Teams,
bestehend aus drei bis fünf Hauptberuflichen und Ehrenamtlichen,
und bietet ihnen Raum für ein gemeinsames Lernen und die
Entwicklung eines gemeinsamen Zukunftsbildes. „Wir werden uns
gemeinsam und auf kreative Weise mit Themen wie Vision, Hören auf
das Wort Gottes, Sozialraum, Leitung, Evaluation und Kirchenbild
beschäftigen“, kündigt Abteilungsleiter Dr. Thomas Kiefer an. Die
„Summerschool“ nehme dabei sowohl Bezug auf das Seelsorgekonzept
der Diözese als auch auf das in den Pfarreien zu erarbeitende
pastorale Konzept. „Ziel der Speyerer Summerschool ist, die
Grundhaltung und das Grundkonzept der Lokalen Kirchenentwicklung
anfanghaft erlebbar zu machen“, so Kiefer.
Priester aus der Weltkirche und Teilnehmer früherer Reisen
teilen ihre Erfahrungen mit
Ein weiterer Ansatz des Lernens von der Weltkirche soll darin
bestehen, die Erfahrungen der Priester aus der Weltkirche, die
hauptsächlich aus Indien und verschiedenen afrikanischen Ländern
stammen und im Bistum Speyer als Kapläne oder Kooperatoren
eingesetzt sind, breiter bekannt und damit für die pastorale
Entwicklung nutzbar zu machen. Dazu ist im Mai ein erstes Treffen
mit den ausländischen Priestern vorgesehen. Außerdem wird das
Bischöfliche Ordinariat in den Erfahrungsaustausch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter einbinden, die in den vergangenen Jahren bei
Auslandsreisen der kirchlichen Hilfswerke Einblick in die Situation
und Handlungsansätze der Kirche in anderen Ländern erhalten
haben.
Weitere Informationen zu den Kundschafterreisen:
http://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?tx_ttnews[tt_news]=1290&cHash=51fc315ebdc558299220654d9dffb263
Weitere Informationen zum Angebot „Summerschool“:
http://www.bistum-speyer.de/news/nachrichten/?tx_ttnews[tt_news]=1590&cHash=695dd2f55f3b2b07936806fd1250d326
Text: is
12.04.2016
Beeindruckt vom Zusammenspiel von Mensch und Technik
.jpg) Werksführung mit Betriebsratsvorsitzendem Lothar Sorger (links neben Bischof Wiesemann)
Werksführung mit Betriebsratsvorsitzendem Lothar Sorger (links neben Bischof Wiesemann)
Bischof Wiesemann besuchte Opel-Werk Kaiserslautern
Kaiserslautern- Einen Ausflug in die
Wirtschaftswelt hat Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 6. April
unternommen und dem Opelwerk in Kaiserslautern einen Besuch
abgestattet. Die mehrstündige Betriebsführung war ein
Streifzug durch die 50-jährige Geschichte des Standorts, gab
Einblicke in die Produktion mit modernsten Technologien und einen
Ausblick auf die Zukunft. Vor allem aber nutzte der Speyerer
Bischof die Gelegenheit, um sich mit dem Betriebsrat und
Arbeitnehmern sowie der Werksleitung auszutauschen.
„Ich möchte nicht nur den Standort kennenlernen“, formulierte
Wiesemann seine Erwartungen, „sondern auch die Arbeitsbedingungen
und das Zeitmanagement.“ Nach schweren Krisenzeiten befindet sich
der Autobauer wieder im Aufwind. „Unser Werk ist derzeit gut
ausgelastet, in jedem neuen Astra steckt Technologie aus der
Pfalz“, zeigte sich Werksleiter Manfred Gellrich zuversichtlich,
dass „Opel den Turnaround meistert.“
Im Anschluss an eine erste Informationsrunde führte ein Rundgang
durch die vier Kompetenzzentren des Werks – die Motorenfertigung,
das Presswerk, die Chassis- und Sitzfertigung sowie die
Karosseriekomponenten-Produktion. Begleitet von den beiden
Betriebsseelsorgern im Bistum Speyer Thomas Eschbach und Andreas
Welte sowie Vertretern der örtlichen Kirchengemeinden, darunter
Dekan Steffen Kühn, konnte sich der Bischof über die verschiedenen
Produktionsstätten informieren. Vom Presswerk bis zur
Motorenfertigung, die es seit 1979 auf weit mehr als neun Millionen
Motoren gebracht hat. „Wobei jeder einzelne sorgsam überprüft,
dokumentiert und freigegeben wird“, gab der zuständige Area-Manager
Ralph Görig Auskunft.
Wiesemann zeigte sich beeindruckt von dem Zusammenspiel von
Mensch und Technik und „der Verantwortung, die jeder einzelne in
dem Unternehmen trägt, das für die Stadt und die Region von großer
Bedeutung ist.“ Rund 2.300 Mitarbeiter sorgen dafür, dass der
Betrieb teilweise in drei Schichten, rund um die Uhr läuft. „Um dem
steigenden Auftragsvolumen zu begegnen, wurde die Belegschaft um
370 externe Arbeitskräfte, überwiegend Leiharbeiter, aufgestockt“,
erklärte der Betriebsratsvorsitzende Lothar Sorger. Sie zu
integrieren und in ein dauerhaftes Beschäftigungsverhältnis direkt
bei Opel zu bringen, sei Ziel der Betriebsratspolitik. Die setzt
auf ein „Team mit Herz, Hand und Verstand“, stärkeres
Mitspracherecht der Arbeitnehmer, weniger Druck, dafür mehr
menschlicher Spielraum und ein Miteinander auf Augenhöhe. Dazu eine
bestmögliche Qualifikation durch die Berufsausbildung. Ein Aspekt,
der dem Bischof als Vorsitzender der Jugendkommission der Deutschen
Bischofskonferenz besonders am Herzen liegt. „Mich interessiert,
welche Anliegen die Jugendlichen haben, wo sie der Schuh drückt und
was sie sich für ihr Leben wünschen.“
.jpg) In
persönlichen Begegnungen wurde schnell deutlich: gleich, welchen
Schulabschluss sie auch mitbringen, jeder von ihnen will die Chance
nutzen, beruflich einen erfolgreichen Weg zu gehen. Und trotz
weltweiter Krisen der Zukunft optimistisch entgegensehen. „Man muss
an einem Strang ziehen, dann kriegt man auch große Probleme in den
Griff“, brachte es ein Azubi auf den Punkt und lobte das
Zusammengehörigkeitsgefühl im Betrieb. Und welche Wünsche haben sie
an die Kirche, wollten die Speyerer Gäste wissen. „Sie soll
moderner werden“, waren sich Befragten einig, und der Bischof
versprach, die Anregungen zu beherzigen.
In
persönlichen Begegnungen wurde schnell deutlich: gleich, welchen
Schulabschluss sie auch mitbringen, jeder von ihnen will die Chance
nutzen, beruflich einen erfolgreichen Weg zu gehen. Und trotz
weltweiter Krisen der Zukunft optimistisch entgegensehen. „Man muss
an einem Strang ziehen, dann kriegt man auch große Probleme in den
Griff“, brachte es ein Azubi auf den Punkt und lobte das
Zusammengehörigkeitsgefühl im Betrieb. Und welche Wünsche haben sie
an die Kirche, wollten die Speyerer Gäste wissen. „Sie soll
moderner werden“, waren sich Befragten einig, und der Bischof
versprach, die Anregungen zu beherzigen.
Der Nachwuchsförderung komme eine große Bedeutung zu, nicht
zuletzt angesichts des demografischen Wandels, betonte Lothar
Sorger. „In den kommenden Jahren scheiden etwa 1000 Mitarbeiter
altersbedingt aus, deshalb brauchen wir ein gutes
Bildungsmanagement und qualifizierte Leute, wobei man auch
Beschäftigungsmöglichkeiten für gering qualifizierte anbieten
möchte.“ Ein Spagat, der nicht leicht, aber unverzichtbar sei, um
dem Wettbewerb standhalten und das Unternehmen erfolgreich in die
Zukunft führen zu können. Trotz zunehmender Automatisierung in Form
von Robotern, messe das Werk dem menschlichen Faktor einen hohen
Stellenwert zu. So stehe das gegenseitige Vertrauen an erster
Stelle einer gemeinsam entwickelten Unternehmenskultur.
„Wir sind uns der sozialen Verantwortung bewusst und tun unser
Bestes für ein gutes Betriebsklima“, so der
Betriebsratsvorsitzende. Dazu gehöre es auch, Mitarbeiter in
Projekte einzubinden, Transparenz walten zu lassen, miteinander zu
kommunizieren und zusammen Lösungen zu finden. „Es ist zu spüren,
dass hier der Dialog gepflegt wird“, lobte Bischof Wiesemann am
Ende seines Besuchs und ermutigte die Verantwortlichen, auch
weiterhin den Menschen ins Zentrum zu stellen. „Denn trotz aller
Herausforderungen sollte das Humanum das Maß der Dinge bleiben.“
Text und Fotos: Friederike Jung
08.04.2016
Sich etwas von der Seele schreiben
 Pastoralreferentin Gabriele Bamberger ist
Internetseelsorge-Beauftragte im Bistum Speyer
Pastoralreferentin Gabriele Bamberger ist
Internetseelsorge-Beauftragte im Bistum Speyer
Speyer/Klingenmünster- Sorgen, die einem
nicht loslassen, von der Seele schreiben zu können - ohne dass Name
oder Gesicht bekannt werden: Seit einigen Wochen erhält
Pastoralreferentin Gabriele Bamberger aus Klingenmünster E-Mails
von Menschen, die ihr oftmals bislang Ungesagtes im Schutz der
Anonymität anvertrauen. Häufig sind es lange Mails, manchmal in der
Nacht geschrieben, denn da empfinden Menschen ihr Alleinsein mit
Nöten und Konflikten vielfach besonders belastend.
Gabriele Bamberger arbeitet seit Mitte Januar 2016 im
überdiözesanen Beratungsteam von internetseelsorge.de mit. Unter
dieser Webadresse haben sich Internetseelsorgerinnen und
-seelsorger aus den Bistümern Mainz, Freiburg, Würzburg, Aachen,
Erfurt zusammengeschlossen, die Menschen in schwierigen Lebens- und
Glaubenssituationen beratend über E-Mail zur Verfügung stehen.
Unabhängig von Wohnort, Religionszugehörigkeit oder Weltanschauung
und kostenfrei.
Bamberger war zuvor zwanzig Jahre als Klinikseelsorgerin im
Pfalzklinikum für Psychiatrie und Neurologie in Klingenmünster
tätig. Die Theologin bringt für ihre neue Aufgabe eine fundierte
Ausbildung in Seelsorgeberatung, Kommunikativer Theologie und
Erwachsenenpädagogik mit.
"Innerhalb kurzer Zeit haben sich überraschend viele Menschen
gemeldet. Manchmal mit einer religiösen Frage, die sich in zwei bis
drei Mails hat klären lassen. Andere stecken mittendrin in einer
Lebenskrise und suchen über einen längeren Mailwechsel hinweg
Unterstützung, eine neue Sichtweise“, berichtet Bamberger von ihren
ersten Erfahrungen. „Je nach Situation kann weiterführend auch an
eine professionell spezialisierte Stelle verwiesen werden.
Insgesamt scheinen viele der Schreibenden erstmals Worte für ihre
schmerzhaften Erlebnisse zu finden. Sie berichten über die
entlastende Erfahrung, dass ihr Schreiben Ängste lindert, Gedanken
ordnen und Gefühle klären hilft.“
Im Dialog mit den Internetseelsorgerinnen und Seelsorgern kann
man völlig anonym bleiben, auch eine Angabe der E-Mail-Adresse ist
nicht nötig. Aus Datenschutzgründen wird die E-Mail über einen
besonders gesicherten Server umgehend zum Internetseelsorger
übertragen, den sich der Ratsuchende zuvor selbst auf
Internetseelsorge.de ausgesucht hat. Selbstverständlich werden alle
Anfragen absolut vertraulich behandelt und unterliegen der
seelsorgerlichen Schweigepflicht.
Das seelsorgerliche Online-Beratungsangebot ist nicht ganz neu:
Seit Jahren bieten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Telefonseelsorge bereits E-Mail- und Chat-Beratung an. Aufgrund des
zunehmenden Bedarfs hat sich die Bistumsleitung in Speyer dazu
entschlossen, mit dem Einsatz der Internetseelsorge-Beauftragten
ergänzend bei Internetseelsorge.de mitzuwirken, einer Abteilung der
Katholischen Arbeitsstelle für missionarische Pastoral e. V. (KAMP)
der Deutschen Bischofskonferenz.
Weitere Informationen unter:
http://www.bistum-speyer.de/seelsorge-und-spiritualitaet/internetseelsorge/
Text: is; Foto (privat): Gabriele Bamberger
07.04.2016
Ein Brückenbauer zwischen West und Ost
 Paul Neumann aus
Römerberg steht mit den Menschen in Polen, Weißrussland und
Russland in engem Kontakt – Kinder aus Tschernobyl kommen jedes
Jahr zur Erholung in die Pfalz
Paul Neumann aus
Römerberg steht mit den Menschen in Polen, Weißrussland und
Russland in engem Kontakt – Kinder aus Tschernobyl kommen jedes
Jahr zur Erholung in die Pfalz
Speyer- Die Länder Osteuropas spielen im Leben
von Paul Neumann eine zentrale Rolle. Er stammt selbst aus
Ostpreußen und kam Ende der 50er-Jahre als Flüchtling in die Pfalz.
Genauer gesagt: nach Berghausen, in die Pfarrgemeinde St.
Pankratius. Dort hat er eine neue Heimat gefunden, mit jedem Tag,
mit jedem Jahr etwas mehr. Durch vielfältige Formen des Engagements
hat er dafür gesorgt, dass die Verbindung in seine alte Heimat –
noch unter den Vorzeichen des Kalten Krieges und des Eisernen
Vorhangs - erhalten bleibt und gestärkt wird. Der lebendige
Austausch zu den Menschen in den osteuropäischen Ländern wurde ihm
zu einer Lebensaufgabe.
Über Hilfsgütertransporte der Pfarrgemeinde St. Pankratius in
Berghausen in Zusammenarbeit mit dem Caritasverband war er Anfang
der 80er-Jahre mit der Dompfarrei Heiligkreuz in Oppeln in Kontakt
gekommen. Die Hilfsgüter waren das eine, „doch das Entscheidende
waren und sind die menschlichen Begegnungen“, erinnert sich Paul
Neumann, der polnisch und russisch spricht und als Übersetzer in
einer Patentanwaltskanzlei in Ludwigshafen gearbeitet hat. 1985
reiste er mit einer Gruppe der Katholischen Jungen Gemeinde nach
Oppeln. „Die Jugendlichen, die zum ersten Mal hinter dem Eisernen
Vorhang waren, überraschte die Herzlichkeit und die
Gastfreundschaft, die uns entgegengebracht wurden.“ Der Gegenbesuch
im Jahr darauf war noch durch politische Schikanen erschwert. „Es
war nicht möglich, als kirchliche Gruppe zu reisen. Die polnischen
Jugendlichen mussten angeben, dass sie einzeln und auf persönliche
Einladung in den Westen unterwegs waren. Im Zug haben sich dann
ganz ‚zufällig‘ getroffen.“ Man musste einfallsreich sein in diesen
Zeiten. „Der Steg, der damals errichtet wurde, ist mit den Jahren
zu einer tragfähigen Brücke ausgebaut worden, die Menschen in Ost
und West verbindet“, berichtet Paul Neumann. Die Besuche weiteten
sich auf weitere Gruppen und die Chöre beider Gemeinden aus, später
wurde daraus eine Partnerschaft der beiden Landkreise. Alle zwei
Jahre finden seitdem Bürgerreisen statt, mal in die eine, mal in
die andere Richtung. Im September 2016 werden in der Pfalz wieder
die Freunde und Familien aus dem polnischen Oppeln erwartet. „Die
Beziehungen, die aus dem regelmäßigen Kontakt erwachsen sind,
erfüllen uns alle mit großer Dankbarkeit, zumal wir im christlichen
Glauben eine gemeinsame Basis haben, die alle Ländergrenzen
überwindet.“
Hilfe für die Kinder von Tschernobyl
1986 ereignete sich die Reaktor-Katastrophe von Tschernobyl. In
den verstrahlten Gebieten um den Reaktor kann auch heute niemand
mehr wohnen. Vor allem Kinder werden durch die Radioaktivität
schnell geschwächt. In dieser Situation entschloss sich die
Pfarrgemeinde St. Pankratius, jedes Jahr eine Gruppe von rund 30
bis 40 Kindern im Alter zwischen zehn und zwölf Jahren zu einem
dreiwöchigen Erholungsaufenthalt in die Pfalz zu holen. „Das
Immunsystem unserer kleinen Feriengäste wird so gestärkt, dass sie
nach dem Urlaub viel weniger anfällig für Infektionen sind. Das
bestätigen uns Eltern, Ärzte und Behörden in Weißrussland immer
wieder.“ Die Kinder und ihre Betreuer sind im Pfarrheim
untergebracht und verbringen die Wochenenden bei Gastfamilien. Die
Pfarrgemeinde St. Pankratius in Berghausen ist die älteste, aber
nicht die einzige Tschernobyl-Initiative in Deutschland. Zum 26sten
Mal werden in diesem Sommer wieder Kinder aus der Umgebung von
Tschernobyl erwartet. „Ich würde mir wünschen, dass Jüngere
einsteigen und das Engagement in die Zukunft tragen“, erklärt Paul
Neumann, der als Vorsitzender des Sprecherrates den
Tschernobyl-Initiativen in Rheinland-Pfalz Gesicht und Stimme
gibt.
Menschen begegnen sich, wo einst Panzer aufeinander
geschossen haben
Ein drittes Betätigungsfeld von Paul Neumann liegt in der
russischen Stadt Kursk, auf halbem Weg zwischen Moskau und der
Krim. Ein Großteil der Stadt wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört,
insbesondere während der Schlacht im Jahr 1943, der größten
Panzerschlacht der Weltgeschichte. Seit 1989 besteht eine
Städtepartnerschaft zwischen Speyer und Kursk. „Wir bieten jedes
Jahr eine Bürgerreise an, die im Wechsel nach Speyer und nach Kursk
führt. Im September werden wir wieder mit einer Gruppe nach
Russland aufbrechen“, kündigt Paul Neumann an, der dem
Freundeskreis der beiden Partnerstädte vorsteht und die Bürgerreise
leitet.
Mit der Situation der Jugendlichen in Osteuropa ist er schon
seit vielen Jahren eng vertraut. Er empfindet es als große Chance,
dass Renovabis mit seiner Pfingstaktion „Jung, dynamisch,
chancenlos?“ auf die mangelnden Perspektiven für junge Menschen im
Osten Europas aufmerksam macht. Die bundesweite Aktion wird am 17.
April in Speyer eröffnet. „In Osteuropa fehlt vielen Jugendlichen
eine tragfähige Perspektive“, hat Paul Neumann auf seinen Reisen
oft erfahren. „Korruption, Arbeitslosigkeit, Armut und die damit
einhergehende Chancenlosigkeit sind nur einige der Gründe, warum
sie dort keine Zukunft mehr sehen.“ Als Solidaritätsaktion der
deutschen Katholiken unterstützt das Hilfswerk Renovabis die
ehemals sozialistischen Länder Mittel- und Osteuropas bei der
Erneuerung von Kirche und Gesellschaft.
Paul Neumann engagiert sich bewusst aus christlicher
Verantwortung. „Als gläubiger Christ es meine Pflicht, Menschen in
Not zu helfen“, ist er überzeugt. Motivation schöpft er aus den
menschlichen Begegnungen und den Momenten, die auch ihm unter die
Haut gehen. „Wenn im Sommer die Kinder aus Weißrussland nach drei
Wochen in der Pfalz munter und gut erholt in ihre Heimat
aufbrechen, bedeutet das eine solche Freude und Genugtuung, die mit
nichts auf der Welt aufzuwiegen ist.“
Weitere Informationen zu den Tschernobyl-Initiativen in
Rheinland-Pfalz:
http://www.sprecherrat-tschernobyl-initiativen-rlp.de/
Weitere Informationen zur Pfingstaktion von
Renovabis:
https://www.renovabis.de/veranstaltungen/pfingstaktion
Text und Foto: is
02.04.2016
Saisonstart am Speyerer Dom
 Dom-Besucherzentrum
als neue Anlaufstelle für Touristen – Kaisersaal und Turm öffnen
nach Winterpause wieder
Dom-Besucherzentrum
als neue Anlaufstelle für Touristen – Kaisersaal und Turm öffnen
nach Winterpause wieder
Speyer- Mit dem 1. April beginnt am Dom zu
Speyer die touristische Saison. Mit dem Frühling kommen wieder mehr
Menschen in die Stadt und zur romanischen Kathedrale. Der Dom ist
daher zwei Stunden länger geöffnet, Kaisersaal und Turm sind wieder
zu begehen. Neu ist in diesem Jahr das Dom-Besucherzentrum als
Anlaufstelle für alle Gäste aus nah und fern. Ihnen bietet das
Besucherzentrum an zentraler Stelle Informationen rund um den
Dombesuch sowie Eintrittskarten und Audioguides. Auch ein kleines
Warenangebot bestehend aus Literatur, Devotionalien und Postkarten
wartet dort auf Einheimische und Touristen.
Neu: Das Dom-Besucherzentrum
Geschätzte 1 Million Menschen besuchen jährlich den Dom. Seit
dem 21. März steht Ihnen das Dom-Besucherzentrum als zentrale
Anlaufstelle für Informationen zur Verfügung. Es wurde eröffnet, um
die Menschen am Dom willkommen zu heißen und ihnen alles zu bieten,
was den Aufenthalt in der Kirche und UNESCO-Welterbestätte zu einem
rundum gelungenen Erlebnis macht. 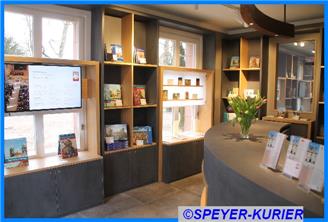
Eingerichtet wurde das Dom-Besucherzentrum in einem kleinen,
kubusartigen Sandsteingebäude auf der Südseite der Kathedrale. Im
Inneren werden die Gäste von Mitarbeitern des Besucherservices
begrüßt. An den Wänden des nur 80 Quadratmeter großen Raumes sind
Flyerständer und Regale für Verkaufswaren untergebracht. Auch die
Fensterflächen werden teilweise genutzt: vier elektronische
Displays zeigen wechselnde Informationen und sind auch von außen
einsehbar. Sie zeigen Informationen zum Konzertprogramm der
Dommusik und zu kommenden Gottesdiensten. Alle seelsorglichen
Angebote bleiben in der Kirche selbst verortet. Im
Dom-Besucherzentrum stellen die Mitarbeiter gerne den persönlichen
Kontakt her, beispielsweise zur Dompfarrei Pax Christi.
Das Dom-Besucherzentrum ist barrierefrei zugänglich. Auch die
Empfangstheke verfügt über einen Abschnitt, der auch mit dem
Rollstuhl gut anzusteuern ist. Geöffnet ist die Anlaufstelle für
Dombesucher ganzjährig während der regulären Domöffnungszeiten. Das
bedeutet, dass es den Besuchern auch dann offen steht, wenn der Dom
wegen eines besonderen Gottesdienstes oder einer Veranstaltung
nicht besichtig werden kann.
Nach der Winterpause wieder geöffnet: Kaisersaal und
Turm
 Ab dem 1. April
öffnen Kaisersaal und Turm wieder für Besucher. Während der kalten
Jahreszeit bleiben die beiden Bereiche geschlossen. Der über der
Vorhalle des Doms gelegene Kaisersaal beherbergt eine
Dauerausstellung mit neun monumentalen Fresken des Malers Johann
Baptist Schraudolph. Sie zeigen Szenen von Heiligen, die für den
Dom eine besondere Bedeutung haben. Ursprünglich waren die Fresken
an den Wänden der Seitenschiffe des Domes angebracht. Von dort
wurden sie im Zuge der großen Domrestaurierung der 1950er-Jahre
entfernt. Seit 2012 sind sie im Kaisersaal zu bestaunen.
Ab dem 1. April
öffnen Kaisersaal und Turm wieder für Besucher. Während der kalten
Jahreszeit bleiben die beiden Bereiche geschlossen. Der über der
Vorhalle des Doms gelegene Kaisersaal beherbergt eine
Dauerausstellung mit neun monumentalen Fresken des Malers Johann
Baptist Schraudolph. Sie zeigen Szenen von Heiligen, die für den
Dom eine besondere Bedeutung haben. Ursprünglich waren die Fresken
an den Wänden der Seitenschiffe des Domes angebracht. Von dort
wurden sie im Zuge der großen Domrestaurierung der 1950er-Jahre
entfernt. Seit 2012 sind sie im Kaisersaal zu bestaunen.
Über den Kaisersaal gelangt man zur Aussichtplattform im
Südwestturm des Doms. In rund 60 Metern Höhe erwartet die Besucher
ein einzigartiger Rundblick über die Stadt Speyer, die Vorderpfalz
und in die badische Nachbarschaft. An Tagen mit guter Fernsicht
überblickt man eine Entfernung von mehr als 50 Kilometern. Der
Blick reicht vom Pfälzer Wald im Westen bis zu Odenwald und
Schwarzwald im Osten. Besonders reizvoll ist der Blick auf die
Maximiliansstraße, die Fußgängerzone im Herzen von Speyer, die in
einer leicht geschwungenen Linie den Dom und das mittelalterliche
Stadttor „Altpörtel“ miteinander verbindet. Text: is; Foto:
spk-Archiv
29.03.2016
„Ostern ist das Fest des Sieges des Lebens über den Tod“
 Mehrere tausend Gläubige besuchen an den Osterfeiertagen
festlich gestaltete Gottesdienste
Mehrere tausend Gläubige besuchen an den Osterfeiertagen
festlich gestaltete Gottesdienste
Speyer- Mehrere tausend Gläubige besuchten
an den Ostertagen die festlich gestalteten Ostergottesdienste im
Speyerer Dom. In der Osternacht feierten sie die Auferstehung Jesu
als Höhepunkt des Karwoche und des gesamten Kirchenjahres.
„Ostern ist das Fest des Sieges des Lebens über den Tod, der
Liebe über den Hass, der Hoffnung und des Mutes über die Angst“,
betonte Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in seiner Predigt am
Ostersonntag auch im Blick auf die Terroranschläge in Brüssel.
„Ostern ist die größte Ermutigung, die es geben kann, dem Terror
der Gewalt und der Macht des Todes zu widerstehen.“
Der Terror ziele darauf ab, „uns in unseren Lebensgrundlagen zu
erschüttern und unsere zivilisierte Gesellschaft in der Wurzel zu
destabilisieren“, beschrieb Wiesemann die Strategie der
Terroristen. Der Terror wolle Menschen radikalisieren, alle Räume
der Verständigung, der Versöhnung, der Offenheit verschließen und
Menschen durch die Unberechenbarkeit der Anschläge in einen
permanenten Zustand der Unsicherheit und Angst versetzen. „Diese
Strategie geht auf, wenn auch bei uns die Angst zum politisch
bestimmenden Faktor wird. Wenn auch wir in unserer Gesellschaft,
die aus unterschiedlichen Kulturen und Religionszugehörigkeiten
zusammengesetzt ist, uns gegenseitig unter Generalverdacht
stellen“, warnte Wiesemann.
Zwar gebe es viele Menschen, die die Werte unserer Gesellschaft
verteidigten und sich nicht in die Logik der Angst, des Hasses und
der Gewalt hineinzwingen lassen wollten. Trotzdem gebe es aber auch
die „Angst der Menschen, die wir sehr ernst nehmen müssen – und sie
nicht denen überlassen dürfen, die daraus Profit ziehen wollen“, so
der Bischof.
In den Osterberichten des Neuen Testamentes würden Angst,
Schmerz und Trauer der Menschen nicht überspielt, sondern ernst
genommen. Der auferstandene Jesus dringe jedoch jedes Mal „in den
aus Angst verschlossenen, im Schmerz verfangenen, in der Verwundung
durch den Hass blind gewordenen Raum des Herzens vor“, trotz aller
Widerstände. „Er dringt dorthin vor, wo die menschlichen
Zwischenräume durch die Macht des Todes ganz klein und starr
geworden sind“, erklärte Wiesemann.
 Viele
Menschen lebten aus dieser Kraft des Auferstandenen. Beispiel dafür
seien die Ärzte ohne Grenzen und die humanitären Helfer, die sich
um der Menschen willen in die Todeszonen dieser Welt wagten, die
sich nicht einschüchtern ließen, „sondern auch den Abgründen dieser
Welt ein menschliches Angesicht geben“ oder Journalisten, die um
der Wahrheit willen ihr Leben wagten, Polizisten und
Sicherheitskräfte, „die unsere Freiheit schützen sowie die
Soldaten, die nicht Krieg schüren, sondern mit ihrem Lebenseinsatz
die Spielräume des Dialoges, der Möglichkeit für Versöhnung und
Frieden sichern helfen und seien sie noch so klein“, erläuterte
Bischof Wiesemann.
Viele
Menschen lebten aus dieser Kraft des Auferstandenen. Beispiel dafür
seien die Ärzte ohne Grenzen und die humanitären Helfer, die sich
um der Menschen willen in die Todeszonen dieser Welt wagten, die
sich nicht einschüchtern ließen, „sondern auch den Abgründen dieser
Welt ein menschliches Angesicht geben“ oder Journalisten, die um
der Wahrheit willen ihr Leben wagten, Polizisten und
Sicherheitskräfte, „die unsere Freiheit schützen sowie die
Soldaten, die nicht Krieg schüren, sondern mit ihrem Lebenseinsatz
die Spielräume des Dialoges, der Möglichkeit für Versöhnung und
Frieden sichern helfen und seien sie noch so klein“, erläuterte
Bischof Wiesemann.
Er drückte seine Bewunderung und Anerkennung für dieses
Engagement aus: “Was für eine Liebe zum Menschen, zu seiner Würde
lebt hier! Was für eine Kraft, sich nicht den Todesmächten zu
beugen! Für mich ist es die Kraft des Auferstandenen, der immer
wieder todesmutig in die Todeszonen der Menschen tritt und jene
Zwischenräume der Menschlichkeit aufrichtet, in denen das Leben,
die Liebe und die Würde siegen, so lange bis einst diese
Zwischenzeit beendet ist und als letzter Feind der Tod vollends
entmachtet wird und Gericht gehalten wird über diese Welt “,
bekannte Wiesemann.
Das Pontifikalamt am Sonntag wurde musikalisch vom Mädchenchor,
den Domsingknaben, dem Domchor und den Dombläsern unter der Leitung
von Domkapellmeister Markus Melchiori gestaltet. Sie spielten und
sangen die Missa „Salve Regina“ von Jean Langlais und Liedsätze von
Robert Jones und Gregor Aichinger. An der Orgel musizierte
Domorganist Markus Eichenlaub.
In der Taufe wird der Auferstandene im Leben der Menschen
sichtbar
In seiner Predigt in der Osternacht sagte Bischof Wiesemann, die
Auferstehung Jesu Christi sei durch die Entmachtung des Todes das
entscheidende Ereignis der Weltgeschichte. Der Auferstandene habe
sich in die Todeszone des Menschen hineinbegeben, in der die
Angst so groß sei, dass der Mensch sich vor allem
verschließe. Der Bischof verwies auf die Jünger Jesu, die nach
dessen Tod zunächst ganz von Angst erfüllt gewesen seien. Doch die
Begegnung mit dem Auferstandenen habe zu einer grundlegenden
Veränderung geführt. Die Apostel seien aus dieser Erfahrung heraus
bereit gewesen, ihr Leben für die Botschaft Jesu zu wagen.
Der Bischof betonte, in der Taufe werde der Auferstandene in
seiner Kraft sichtbar in unserem Leben. Er führe durch Angst und
Finsternis in das Licht. Deshalb war es für Bischof Wiesemann eine
besondere Freude, dass er im Rahmen der nächtlichen Feier einem
Kommunionkind das Sakrament der Taufe spenden konnte.
Begonnen hatte der Gottesdienst in der Domvorhalle. Am
Osterfeuer entzündete der Bischof die Osterkerze, anschließend
wurde das Licht an alle Gläubigen in der voll besetzten Kathedrale
weitergegeben.
Für die musikalische Gestaltung des Pontifikalamtes in der
Osternacht sorgten unter der Gesamtleitung von Domkapellmeister
Markus Melchiori die Schola Cantorum Saliensis unter Leitung von
Christoph Keggenhoff, Mitglieder des Domchores Speyer, die Capella
Spirensis, die Dombläser Speyer sowie Domorganist Markus
Eichenlaub. Text: is; Foto: Klaus Landry
27.03.2016
„Ostern ist ein Aufstand gegen die Gräber“
 Im
Ostergottesdienst spricht sich Kirchenpräsident Schad gegen eine
Politik der Grenzzäune aus
Im
Ostergottesdienst spricht sich Kirchenpräsident Schad gegen eine
Politik der Grenzzäune aus
Speyer- Der pfälzische Kirchenpräsident
Christian Schad hat dazu aufgerufen, angesichts der
Flüchtlingsdramen, die sich im Mittelmeer, in den Flüchtlingslagern
des Nahen Ostens und an den Grenzen Südeuropas abspielen, die
Spirale von Gewalt und Tod in der Welt zu durchbrechen. Das
Ostergeschehen zeige, dass sich auch in Zeiten kollektiver
Verzweiflung Hoffnung Bahn brechen könne, sagte der
Kirchenpräsident im Ostergottesdienst in der Speyerer
Gedächtniskirche. Die Auferstehung Jesu hebe alles Dunkle auf:
„Ostern ist ein Aufstand gegen die Gräber.“
„Welche Gräber aber füllen sich zurzeit in unseren dunklen
Tagen? Wir denken in dieser Stunde an die Opfer von Brüssel. Welche
Gräber füllen sich zudem in Syrien, im Irak, in Eritrea?“, fragte
Kirchenpräsident Schad. Mit Blick auf die Flüchtlingskrise sprach
sich der Kirchenpräsident in seiner Predigt gegen Grenzzäune und
eine Politik der Abschottung aus. Schad appellierte an die
Christen, die von Krieg und Gewalt verfolgten Menschen nicht
abzuweisen: „Wir stellen uns an die Seite der Opfer, leisten
dumpfen Parolen Widerstand, mobilisieren Gegenkräfte, um persönlich
zu helfen, wo immer wir können.“
Auferstehung heiße, dass der Mensch bei Gott nicht nur seinen
letzten Augenblick wiederfinde, sondern seine ganze Geschichte,
führte der Kirchenpräsident aus. „Alles, was wir waren und sind,
formt sich um in alles, was wir erwarten und hoffen können.“ Gott
selbst schenke die Kraft und den Mut, sich dieser österlichen
Lebensperspektive zu öffnen, die durch Leiden und Sterben hindurch
und über den Tod hinaus trage. „Gott hat zu Ostern damit begonnen,
das Unmögliche möglich zu machen, indem er Gewalt und Tod
durchbrochen hat. Das beansprucht einen radikalen Neuansatz in
unserem Denken, Fühlen, Hoffen und Bewerten.“
Die Liturgie des Ostergottesdienstes in der Speyerer
Gedächtniskirche gestaltete Dekan Markus Jäckle, die Kantorei
Speyer-Germersheim, das Kammerorchester an der Gedächtniskirche
sowie Vokalsolisten führten unter der Leitung von
Kirchenmusikdirektor Robert Sattelberger die Osterkantate „Heut
triumphieret Gottes Sohn“ von Dietrich Buxtehude auf.
lk
Predigt von Kirchenpräsident Christian Schad am
Ostersonntag, dem 27. März 2016, 10.00 Uhr, in der Gedächtniskirche
zu Speyer
Predigttext: Markus 16, 1-8
Liebe Gemeinde!
Sabbatruhe nach den letzten zwölf Stunden des Lebens Jesu. Sein
Leichnam liegt unversorgt in einem Felsengrab. Drei treue und
mutige Frauen, sie versuchen, wieder Boden unter die Füße zu
bekommen. Sie halten sich: an das Gewohnte, die Sitte, die Ordnung.
Sie halten sich an Riten, die einem verstörten Leben Halt geben,
ohne groß nachdenken, analysieren und alles verstehen zu müssen.
Sie tun, was dran ist – sie tun, was hilft.
„Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria von Magdala und
Maria, die Mutter des Jakobus und Salome wohlriechende Öle, um
hinzugehen und den Leichnam Jesu zu salben. Und sie kamen zum Grab,
am ersten Tag der Woche, sehr früh, als die Sonne aufging.“
Das hilft den Frauen. Beerdigungsriten geben uns eine
Orientierungshilfe in unserem noch nicht verarbeiteten Schmerz.
Gewohnheit und Sitte vermitteln Sicherheit, lenken ab von lähmender
Angst und Trauer.
Die Frauen, sie wollen ihrer Treue und Verbundenheit mit Jesus –
über den Tod hinaus – Ausdruck verleihen. Das Salben des
zerschlagenen Körpers mit wohlriechendem Öl: das ist Ausdruck einer
Liebe, die sich durch den Tod nicht zerstören lässt!
„Und die Frauen sprachen untereinander: ‚Wer wälzt uns den Stein
von des Grabes Tür?‘ Und sie sahen hin und wurden gewahr, dass der
Stein weggewälzt war; denn: er war sehr groß.“
Das Stein-Problem, liebe Gemeinde, ist gelöst. Das Grab steht
offen. Der Weg zu Jesus ist frei. Und dann kommt diese
weltverändernde Botschaft: die Botschaft, die unser menschliches
Denken, Fühlen und Planen so radikal in Frage stellt, dass zunächst
nur Entsetzen unsere Herzen erfüllt. Gottes Bote spricht zu den
Frauen:„Entsetzt euch nicht! Ihr sucht Jesus von Nazareth, den
Gekreuzigten? Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht: die
Stätte ist leer, an der sie seinen Leichnam hinlegten.“ Und die
Frauen flohen von dem Grab, „denn Zittern und Entsetzen hatte sie
ergriffen. Und sie sagten niemandem etwas; denn: sie fürchteten
sich.“
„Der Gekreuzigte lebt“, liebe Schwestern und Brüder! Wer diesen
Osterruf an sich heranlässt, dem brechen zunächst alle vertrauten,
von Verstand und Gewohnheit getragenen Lebenssicherheiten weg.
Dieser Ruf durchbricht alle Regeln des Gewohnten – beansprucht
einen radikalen Neuansatz in unserem Denken, Fühlen, Hoffen und
Bewerten.
Eine Perspektive, die – durch Leiden und Sterben hindurch – und
über den Tod hinaus trägt, weil wir das Leben – selbst jenseits der
letzten Grenze – von Gott bewahrt wissen. Dass Leib und Seele, dass
alles, was hell war in unserem Leben – aber auch alles Dunkle
aufgehoben wird von Gott, hineinverwandelt in eine neue
Wirklichkeit, das ist Auferstehung! Von unserer Geburt an bis in
den Tod findet unser Leben mit all seinen Bewegungen, all den
erfüllten Erwartungen und verlorenen Wünschen, vor Gott eine neue
Gestalt. Die Hoffnungen, die uns wachhalten, die Ängste, die uns
begleiten, der Schmerz, der nicht weichen will: Alles da, alles
präsent vor Gott! Auferstehung heißt, dass der Mensch bei Gott
nicht nur seinen letzten Augenblick wiederfindet, sondern: seine
ganze Geschichte! Alles, was wir waren und sind, formt sich um in
alles, was wir erwarten und hoffen können. Ostern sind wir
Verwandelte im Angesicht Gottes.
Vielleicht, liebe Gemeinde, bricht sich diese atemberaubende
Hoffnung ja eher Bahn – in Zeiten kollektiver Verzweiflung. In der
Zeit unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erzählt der
Schriftsteller Wolfgang Borchert folgende Geschichte: Drei Soldaten
der deutschen Wehrmacht sprengen Löcher in den gefrorenen Boden, um
dort Leichen zu vergraben. Einer der drei testet, ob die Gräber
groß genug sind. Er muss sich in jedes einzelne Loch legen und mit
seinem eigenen Körper für das Ausmessen der Gräber herhalten. Seine
Vorgesetzten haben ihm den Namen „Jesus“ gegeben. Doch, es kommt
zum Konflikt, als Jesus den täglichen Umgang mit den Toten, den
immer sich wiederholenden Grabestest nicht mehr aushält. Er weigert
sich fortan, in die Löcher hinabzusteigen, verweigert den Befehl.
„Jesus macht nicht mehr mit“, so lautet der Titel dieser Erzählung.
„Sollte man das ganze Leben so unbequem liegen …nein, den ganzen
Tod hindurch?“, fragt er sich. Schließlich steht er auf: „Ich mach
nicht mehr mit … Nein“, sagt Jesus noch immer ebenso leise, „ich
kann das nicht mehr.“ Der Unteroffizier macht derweil eine neue
Sprengladung für das nächste Grab fertig und denkt: „Melden muss
ich ihn, das muss ich, denn Gräber müssen ja sein.“
Ostern, liebe Gemeinde, ist ein Aufstand gegen die Gräber. Die
müssen nicht sein. „Seht: die Stätte ist leer, an der sie seinen
Leichnam hinlegten. Er ist nicht hier, er ist auferstanden!“,
erfahren die Jünger an Jesu Grab am Morgen, als die Sonne
aufging.
Welche Gräber aber füllen sich zur Zeit in unseren dunklen
Tagen? Wir denken in dieser Stunde an die Opfer von Brüssel.
Entsetzliches Leid ist über unzählige Menschen gekommen. Sie
beweinen ihre Toten, bangen um die Schwerverletzten und wir fragen
mit ihnen: „Warum?“
Wir alle haben Angst. Hört der Terror denn niemals auf? Müssen
wir jeden Morgen aufwachen mit der Sorge: „Was wird heute wieder an
Schlimmem passieren?“ Bewahre uns davor: Gott!
Welche Gräber füllen sich zudem: in Syrien, im Irak, in Eritrea?
Im Mittelmeer, auf der Flucht aus Libyen und Tunesien? In den
Flüchtlingslagern des Nahen Ostens, wo Menschen unter erbärmlichen
Bedingungen ihr Leben fristen oder auf dem Weg nach Europa hin- und
hergeschoben werden? Weil immer mehr europäische Staaten Zäune
errichten – Grenzen schließen – sich abschotten!
Welche Gräber füllen sich, weil Menschen, aus der Bahn geworfen,
Hass brüllen und auffordern, allem Fremden zu widerstehen und die
Opfer von Krieg und Gewalt abweisen?
Welche Gräber füllen sich? Und: Welche Gräber erinnern wir? Die
Gräber auf unseren Friedhöfen – mit den Namen, die wir alle kennen
…
Gräber aber, liebe Gemeinde, müssen nicht auf ewig sein.
Christen widerstehen der gewohnt-verzweifelten Akzeptanz des Todes.
Wir fliehen nicht, wir schweigen nicht, sondern stellen uns an die
Seite der Opfer, verurteilen Hass und Gewalt im Namen einer
Religion als Gotteslästerung – und leisten dumpfen Parolen
Widerstand. Wir mobilisieren Gegenkräfte,
um persönlich zu helfen, wo immer wir können.
Gott hat zu Ostern damit begonnen, das Unmögliche möglich zu
machen. Gott hat durchbrochen: Gewalt und Tod.
Die Spötter schweigen. Und das Gelächter der Skeptiker
verstummt. Das Motto heißt nicht länger: „Wir können eh’ nichts
machen, so ist es eben!“ Das Motto heißt: „Nichts ist unmöglich
dem, der da glaubt!“
Gott schenke uns die Kraft und den Mut, uns dieser neuen, dieser
österlichen Lebensperspektive zu öffnen!
Amen.
27.03.2016
Kreuzestod Jesu gibt Kraft für ein Leben ohne Gewalt
 Kirchenpräsident predigt im Karfreitags-Gottesdienst in
der Grünstadter Martinskirche
Kirchenpräsident predigt im Karfreitags-Gottesdienst in
der Grünstadter Martinskirche
Grünstadt- Liebe statt Gewalt,
Bereitschaft zum Teilen statt Habsucht, Freiheit für Andere statt
Zwang: Nach den Worten von Kirchenpräsident Christian Schad haben
sich seit Jesu Tod am Kreuz Religion und Gewalt ein für allemal
auszuschließen. Umso erschütternder sei es, wenn man an die
Terroranschläge in Brüssel denke. „Entsetzliches Leid ist über
unzählige Menschen gekommen. Sie beweinen ihre Toten, bangen um die
Schwerverletzten und wir fragen mit ihnen – wie Jesus am Kreuz –
‚Warum?‘“, sagte Schad im Karfreitags-Gottesdienst in der
Grünstadter Martinskirche. In der Ohnmacht des Gekreuzigten jedoch
seien die humanen und die Frieden stiftenden religiösen
Kraftquellen aufzudecken, die alle Menschenfeindlichkeit überwinden
könnten.
Mit Jesu Tod sei etwas Ungeheures passiert: „Dass der
allmächtige Gott sich in seinem Sohn selbst offenbart, dass er in
einem Menschen zu uns kommt, der am Kreuz endet, geschieht zum Heil
für die ganze Welt“, sagte Kirchenpräsident Schad in seiner
Predigt. In vielen Teilen der Welt herrsche Terror und Gewalt. Der
sogenannte „Islamische Staat“ gehe mit unvorstellbarer Grausamkeit
gegen Jesiden, Christen und Angehörige anderer Volksgruppen vor.
Der „IS“ dehne seinen Machtbereich ohne Rücksicht auf die
elementaren Menschenrechte aus. Demgegenüber stehe das Kreuz Jesu:
„Es schärft uns ein, dass es ein Ende haben soll mit dem bösen
Gemisch von Religion und Gewalt.“
Jesus habe sein Leben hingegeben, weil er den tödlichen
Kreislauf von Gewalt und Gegengewalt durchbrochen hat, so der
Kirchenpräsident. Eindeutiger könne der Protest gegen alle Gewalt
nicht sein „Die Geschichte vom Kreuz spricht mitten in unsere
Wirklichkeit hinein. In ihr begegnet uns Gott in Menschengestalt.
Sie öffnet die Augen gegenüber denen, die einsam sind, und
gegenüber denen, die Schutz, Hilfe und Asyl suchen. Sie gibt Kraft
für ein Leben ohne Gewalt“, sagte Schad.
Die Liturgie des Abendmahls-Gottesdienstes in der Martinskirche
in Grünstadt gestaltete Dekan Stefan Kuntz, die Kantorei Grünstadt
umrahmte die Feier musikalisch.
Predigt am Karfreitag von Kirchenpräsident Christian Schad
am 25. März 2016, 10.00 Uhr, in der Prot. Martinskirche
Grünstadt
Predigttext: Hebräer 9, 15- 28
Liebe Gemeinde!
Die Worte aus dem Hebräerbrief sind fremde Worte. Vieles davon
wirkt auf den ersten Blick schwer verständlich. Und doch ist es
gut, dass wir heute, am Karfreitag des Jahres 2016, etwas erfahren
über dieses Geheimnis, was der Tod Jesu für uns und für diese Welt
bedeutet. Denn es ist ein Geheimnis, es ist etwas Ungeheures, was
die Bibel da berichtet. Dass der allmächtige Gott, der Schöpfer des
Himmels und der Erde, die Urkraft des Lebens, der Lenker der Welt,
sich in seinem Sohn: Jesus von Nazareth selbst offenbart, dass er
in einem Menschen zu uns kommt, der am Kreuz endet, der stirbt:
verspottet von seinen Mitmenschen, das ist wirklich etwas
Ungeheuerliches. Nicht etwas ungeheuer Bedrohendes, sondern etwas,
das geschieht zu unserem Heil und zum Heil für die ganze Welt.
Denn es heißt doch zunächst dies: Wir dürfen an diesem
Karfreitagmorgen hierher kommen und alles mitbringen, was uns
bedrückt. Wir müssen nicht immer: die erfolgreichen und fröhlichen,
die optimistischen und glaubensgewissen Mustermenschen sein. Wir
brauchen das, was wir an Angst und Betrübnis in uns spüren und in
uns tragen, nicht wegzuwischen; sondern wir dürfen all das
mitbringen – und es in Gottes Hand legen, weil sie eine Hand ist,
die unser menschliches Leiden kennt; eine Hand, die selbst die
Wundmale der Kreuzigung in sich trägt: in diese Hand dürfen wir all
das legen, was uns Angst macht und bedrängt.
Die Geschichte vom Kreuz, liebe Gemeinde, ist nicht deswegen so
anziehend, weil Leiden etwas Schönes wäre. Sie ist anziehend, weil
sie mitten in unsere Wirklichkeit hinein spricht. Weil sie das
Leiden in der Welt und auch in unserem ganz persönlichen Leben
nicht hinter irgendwelchen religiösen Wellnessformeln versteckt;
sondern von einem Gott erzählt, der selbst gelitten und Ohnmacht
erfahren hat; und der mich trotzdem – oder gerade deswegen – hält
und trägt und uns frei machen will von dem, was uns beschwert.
Die Worte aus dem Hebräerbrief, sie sprechen genau davon: durch
den Tod Jesu, „der geschehen ist zur Erlösung von den Übertretungen
unter dem ersten Bund, sollen die Berufenen das verheißene, ewige
Erbe empfangen.“ Und dann kommt ein Begriff, der auch unter uns
sehr unterschiedliche Gefühle hervorruft. Christus, so heißt es da,
„ist ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde
aufzuheben.“
Dass Christus als Opfer für unsere Sünde gestorben ist, ruft
heute gewichtige Fragen hervor: Muss Jesus hier als Opfer sterben,
damit Andere gerettet werden? Und was ist das für ein Gott, der ein
Menschenopfer zur eigenen Versöhnung nötig hat?
Lange Zeit wurde in der Tat der Tod Jesu als ein Opfer gesehen,
mit dem der Zorn Gottes über die Sünde der Menschen gesühnt werden
sollte. Gott opferte seinen Sohn, um die Sünden der Menschen zu
sühnen. Aber Gott als Urheber von Gewalt? Das wäre am Ende eine
fürchterliche Vorstellung! Doch der entscheidende Punkt wird dabei
gerade verfehlt! In dem Geschehen am Kreuz opfert nicht der
grausame göttliche Vater seinen Sohn; sondern in Christus erfährt
Gott selbst das äußerste Leiden, das Menschen erfahren können. In
Christus begegnet uns Gott in Menschengestalt!
Wenn wir zu Gott, zu Jesus Christus und zum Heiligen Geist
beten, dann beten wir nicht zu drei Göttern, sondern zu dem einen
Gott, der uns geschaffen hat und der uns Tag für Tag erhält. Dieser
Gott ist es, der am Kreuz stirbt. Und er stirbt nicht, weil er sich
selber umbringt, sondern: weil die Menschen ihn umbringen! Weil die
Menschen Gewalt ausüben! Weil sie ihn foltern, weil sie einen
Sündenbock brauchen, um ihre Macht zu sichern! Und er – er
durchleidet die ganze Verzweiflung, die uns auch in den
Gewaltopfern unserer Tage begegnet und die uns zuweilen selbst zu
erfassen droht, wenn wir uns ihr Schicksal nahe gehen lassen.
Jesus stirbt am Kreuz, weil das „Trachten des Menschen böse ist
von Jugend an“, wie es schon in der Urgeschichte heißt. Aber Gott
wehrt sich nicht. Er antwortet nicht mit Gegengewalt. Er gibt sein
Leben hin, weil er den tödlichen Kreislauf von Gewalt und
Gegengewalt durchbrechen will, weil er durch seine Hingabe eine
neue Wirklichkeit setzt, nämlich der Gewalt – die Liebe – entgegen
setzt: das ist der Gott, an den wir glauben!
Wie, liebe Gemeinde, kann Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit
zusammengehen? Auf diese Frage will unser Text eine Antwort geben.
Die Gerechtigkeit kann ja nicht über das Unrecht der Menschen
einfach hinweggehen, schon: wegen der Opfer des Unrechts nicht.
Denn wenn Unrecht ungesühnt bliebe, dann triumphierten die Täter
ein zweites Mal über ihre Opfer. Aber wie soll dann die notwendige
Strafe mit der Liebe Gottes einhergehen?
Die Antwort, die Gott gibt, lautet: Unrecht muss tatsächlich
gesühnt werden. Aber ich nehme die Strafe, die eigentlich Euch
Menschen gelten müsste, auf mich. Weil Ihr meine Geschöpfe seid,
und weil ich nicht Euer Verderben – sondern Euer Leben will.
Das Unrecht aufzuheben, darum geht es. Ein für allemal soll
Schluss sein mit den Opfern. Es soll Schluss sein mit der Gewalt
unter Menschen – im Kleinen, wie im Großen: dort, wo ein Einzelner
die Hand gegen den Anderen erhebt, ebenso, wie dort, wo Staaten
ihre Konflikte mit Waffengewalt zu lösen versuchen.
Wer auf Jesus schaut, der nicht zurückgeschlagen – sondern die
Gewalt der Menschen auf sich genommen hat, der verändert sich. Der
geht den Weg Jesu mit. Der setzt an die Stelle der Gewalt die
Liebe. Setzt an die Stelle der Habsucht die Bereitschaft zum
Teilen. Der findet den Weg aus dem Gefangensein in sich selbst
hinaus in die Freiheit für den Anderen.
Religion und Gewalt schließen sich seit Jesu Tod ein für allemal
aus! Gott durchbricht in Jesus Christus die Spirale von Gewalt und
Gegengewalt. Sie hat sich im Tod Jesu förmlich aus-gewirkt,
aus-getobt, im Sinne von: erschöpft! Eindeutiger könnte der Protest
gegen alle Gewalt nicht sein!
Genau sie aber erleiden heute so viele Menschen. Uns verschlägt
es die Sprache, wenn wir an die Terroranschläge in dieser Woche in
Brüssel denken. Entsetzliches Leid ist über unzählige Menschen
gekommen. Sie beweinen ihre Toten, bangen um die Schwerverletzen
und wir fragen mit ihnen – wie Jesus am Kreuz –: „Warum?“
Wir alle haben Angst. Hört der Terror denn niemals auf? Müssen
wir jeden Morgen aufwachen mit der Sorge: „Was wird heute wieder an
Schlimmem passieren?“ Bewahre uns davor: Gott!
Wir denken heute aber auch an die Menschen in Syrien und im
Irak. Seit Monaten wütet dort der Terror der Organisation
„Islamischer Staat“. Mit unvorstellbarer Grausamkeit geht er gegen
Jesiden, gegen Christen und Angehörige anderer Volksgruppen vor und
dehnt seinen Machtbereich aus: ohne Rücksicht auf die elementaren
Menschenrechte. Darüber hinaus zerstören die apokalyptischen
Krieger jahrtausendealte Kulturschätze. Sie bekunden damit: „Wir
können nicht nur in der Gegenwart töten, sondern auch die
Vergangenheit vernichten. Wir sind die Herren über Raum und Zeit.“
Expansion auch: in die vierte Dimension, das ist das Ziel dieses
Kalifats.
Demgegenüber schärft uns das Kreuz Jesu heute ein: Es soll ein
Ende haben mit dem bösen Gemisch von Religion und Gewalt! Wer
Terror ausübt und Hass und Gewalt predigt im Namen einer Religion,
der lästert Gott! In der Ohnmacht des Gekreuzigten entdecken
wir vielmehr: die humanen, die Frieden stiftenden Kraftquellen, die
alle Menschenfeindlichkeit überwinden können.
Liebe Gemeinde, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Christus
uns hört, wenn wir jetzt gleich miteinander singen: „Christe, du
Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich unser!“
Und wenn wir dann das Mahl feiern, das Jesus – im Angesicht des
Todes – mit seinen Jüngern gehalten hat, dann sind wir dessen
gewiss: Er ist in Brot und Wein mitten unter uns. Wir erinnern uns
an das Leiden unseres Heilands, denken daran, dass er unsere
Beschwernis mit in seinen Tod genommen und uns so befreit und neu
gemacht hat. Im Abendmahl erfahren wir, dass er für uns zur Kraft
des Lebens geworden ist.
Und diese Kraft verbindet uns schon jetzt zu einer Gemeinschaft
von Menschen, die sich untereinander in ihrer Verschiedenheit
annehmen, und die ihr neues Herz und ihren neuen Geist in der Welt
sichtbar werden lassen wollen: durch offene Augen gegenüber denen,
die einsam sind, durch ein Leben, das ohne Gewalt auskommt, durch
den Einsatz für Menschen, die Unrecht und Verfolgung erleiden und
hier bei uns Schutz und Hilfe und Asyl suchen.
Die Geschichte vom Leiden und Sterben Jesu ist eine
Heilandsgeschichte, weil sie vom Tod des Todes erzählt. Deswegen
fällt auf sie schon jetzt ein Vorschein von Licht und Wärme, von
Trost und Leben. Und es wird spürbar, dass Ostern nicht mehr fern
ist.
Amen.
25.03.2016
Dom-Besucherzentrum öffnet Türen
 Neue Anlaufstelle für Dombesucher direkt neben der
Kathedrale
Neue Anlaufstelle für Dombesucher direkt neben der
Kathedrale
Speyer- Für alle Dom-Besucher und
Dom-Interessierten gibt es zukünftig eine neue Anlaufstelle. Direkt
neben der romanischen Kathedrale öffnet das neue
Dom-Besucherzentrum rechtzeitig vor Ostern seine Türen.
Informationen, Eintrittskarten zu Krypta und Turm, Audioguides und
ein kleines Warenangebot erwarten dort die Gäste.
„Mit der Eröffnung des Dom-Besucherzentrums geht für uns ein
großer Wunsch in Erfüllung“, so der Domkustos, Domkapitular Peter
Schappert. „Schon länger gab es die Idee, eine solche Anlaufstelle
für Besucher zu schaffen, um diese willkommen zu heißen und zu
informieren. Jetzt ist es soweit und wir freuen uns sehr auf die
Resonanz. Ein Highlight wird sicher auch die feierliche Eröffnung
am 22. Mai, wo wir bei hoffentlich gutem Wetter ein Programm rund
um den Dom planen.“
Kompakt, nah, barrierefrei
 Eingerichtet wurde das Dom-Besucherzentrum in einem
kleinen, kubusartigen Sandsteingebäude auf der Südseite des Doms.
Beim Betreten fällt der Blick zunächst auf eine große, runde
Empfangstheke. Hier werden die Besucher willkommen geheißen und
erhalten Auskunft über Zeiten, Wege und Veranstaltungen. Noch sind
die Regale nicht fertig eingeräumt und es riecht nach Farbe. „Seit
Montag haben wir geöffnet“, so der Leiter des Besuchermanagements,
Bastian Hoffmann. „Wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken um
das Konzept gemacht und sind gespannt, ob alles so wirkt und
funktioniert, wie wir es uns wünschen. Die ersten Reaktionen sind
durchweg begeistert.“
Eingerichtet wurde das Dom-Besucherzentrum in einem
kleinen, kubusartigen Sandsteingebäude auf der Südseite des Doms.
Beim Betreten fällt der Blick zunächst auf eine große, runde
Empfangstheke. Hier werden die Besucher willkommen geheißen und
erhalten Auskunft über Zeiten, Wege und Veranstaltungen. Noch sind
die Regale nicht fertig eingeräumt und es riecht nach Farbe. „Seit
Montag haben wir geöffnet“, so der Leiter des Besuchermanagements,
Bastian Hoffmann. „Wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken um
das Konzept gemacht und sind gespannt, ob alles so wirkt und
funktioniert, wie wir es uns wünschen. Die ersten Reaktionen sind
durchweg begeistert.“
An zentraler Stelle in der Mitte des Raums befindet sich ein
großes Kreuz. „Das Kreuz ist sehr schmal, wirkt aber durch die
Vergoldung. Es verdeutlicht die Bestimmung des Doms als Kirche“,
erklärt Dombaumeister Mario Colletto. „Mit der  Einrichtung und der Farbgebung wurde eine moderne
Architektur geschaffen. Außerdem finden sich im Dom-Besucherzentrum
auch Materialien wieder, die auch bei der Möblierung des Doms
Verwendung fanden, wie Eiche oder rostiger Stahl, der im Dom bei
den Windfängen, beim Besucherzentrum bei der Beleuchtung verwendet
wurde.“
Einrichtung und der Farbgebung wurde eine moderne
Architektur geschaffen. Außerdem finden sich im Dom-Besucherzentrum
auch Materialien wieder, die auch bei der Möblierung des Doms
Verwendung fanden, wie Eiche oder rostiger Stahl, der im Dom bei
den Windfängen, beim Besucherzentrum bei der Beleuchtung verwendet
wurde.“
An den Wänden des nur 80 Quadratmeter großen Raumes sind
Flyerständer und Regale untergebracht. Auch die Fensterflächen
werden teilweise genutzt: vier elektronische Displays zeigen
wechselnde Informationen und sind auch von außen einsehbar. Sie
zeigen Informationen zum Konzertprogramm der Dommusik oder zu
kommenden Gottesdiensten. Alle seelsorglichen Angebote bleiben in
der Kirche selbst verortet. Im Dom-Besucherzentrum stellen die
Mitarbeiter gerne den persönlichen Kontakt her, beispielsweise zur
Dompfarrei Pax Christi.
 Das Dom-Besucherzentrum ist barrierefrei zugänglich. Auch
die Empfangstheke verfügt über einen Abschnitt, der auch mit dem
Rollstuhl gut anzusteuern ist. Geöffnet ist die Anlaufstelle für
Dombesucher ganzjährig während der regulären Domöffnungszeiten. Das
bedeutet, dass es den Besuchern auch dann offen steht, wenn der Dom
wegen eines besonderen Gottesdienstes oder einer Veranstaltung
nicht besichtig werden kann.
Das Dom-Besucherzentrum ist barrierefrei zugänglich. Auch
die Empfangstheke verfügt über einen Abschnitt, der auch mit dem
Rollstuhl gut anzusteuern ist. Geöffnet ist die Anlaufstelle für
Dombesucher ganzjährig während der regulären Domöffnungszeiten. Das
bedeutet, dass es den Besuchern auch dann offen steht, wenn der Dom
wegen eines besonderen Gottesdienstes oder einer Veranstaltung
nicht besichtig werden kann.
Im Gegensatz zu der vormaligen Nutzung als Verkaufsraum wird es
im Dom-Besucherzentrum kein gastronomisches Angebot geben, da hier
auf Grund des begrenzten Platzes ein anderer Schwerpunkt gesetzt
wurde.
 Im Obergeschoss wurden in einem Großraumbüro vier
Arbeitsplätze und ein Bereich für Besprechungen eingerichtet. Das
Büro für Domführungen, Besucher- und Kulturmanagement werden
künftig von hier aus arbeiten.
Im Obergeschoss wurden in einem Großraumbüro vier
Arbeitsplätze und ein Bereich für Besprechungen eingerichtet. Das
Büro für Domführungen, Besucher- und Kulturmanagement werden
künftig von hier aus arbeiten.
Der Umbau und seine Kosten
Die Planung und Durchführung der Baumaßnahme lag in den Händen
des Dombaumeisters Mario Colletto, der in diesem Fall mit dem
Planungsbüro s-quadrate aus Oftersheim zusammen arbeitete. Bei der
Entwurfsplanung spielten, neben dem Nutzungsprofil, die baulichen
Gegebenheiten eine zentrale Rolle. „Konkret bestand die
Herausforderung darin, dass auf sehr kleinem Raum viele
verschiedene Nutzungen unterzubringen waren. Die Grundfläche
beträgt gerade mal 80 Quadratmeter, eingeschränkt durch das
zentrale Rund des Treppenhauses“, erklärt Dombaumeister Mario
Colletto.
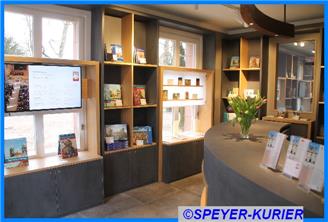 Nach Übergabe des Gebäudes im November 2015 wurde
zunächst mit dem Rückbau des bisherigen Innenausbaus begonnen und
alle Einbauten und Zwischenwände entfernt. In den folgenden
dreieinhalb Monaten wirkten ein Sanitärbetrieb, Elektriker, Boden-
und Fliesenleger, Maler und Schreiner in dem kleinen Gebäude. Dabei
wurde der Bauzeitenplan komplett eingehalten, so dass nach dieser
denkbar kurzen Umbauzeit das Dom-Besucherzentrum noch vor Ostern
2016 in Betrieb genommen werden konnte. „Mit dem Verlauf und dem
Ergebnis der Baumaßnahme bin ich sehr zufrieden“, so Dombaumeister
Colletto.
Nach Übergabe des Gebäudes im November 2015 wurde
zunächst mit dem Rückbau des bisherigen Innenausbaus begonnen und
alle Einbauten und Zwischenwände entfernt. In den folgenden
dreieinhalb Monaten wirkten ein Sanitärbetrieb, Elektriker, Boden-
und Fliesenleger, Maler und Schreiner in dem kleinen Gebäude. Dabei
wurde der Bauzeitenplan komplett eingehalten, so dass nach dieser
denkbar kurzen Umbauzeit das Dom-Besucherzentrum noch vor Ostern
2016 in Betrieb genommen werden konnte. „Mit dem Verlauf und dem
Ergebnis der Baumaßnahme bin ich sehr zufrieden“, so Dombaumeister
Colletto.
188.000 Euro waren für den Umbau des Innenraums
veranschlagt.Dazu kommen Kostenfür das Inventar, im wesentlichen
Möbel und Technik. „Den Kostenrahmen konnten wir einhalten“, stellt
Dombaumeister Colletto fest. Finanziert wurde das Bauvorhaben mit
Hilfe der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer, die sich mit
einer Zuwendung in Höhe von 85.000 Euro an den Kosten beteiligte.
„Unser Dank geht an die Europäische Stiftung, welche die
Realisation des Dom-Besucherzentrums von Anfang an gefördert hat“,
betont Domkustos Peter Schappert.
Was noch aussteht, sind Veränderungen im Außenbereich wie eine
Reinigung der Sandsteinfassade und eine Kennzeichnung des Gebäudes.
Um mit der räumlich überschaubaren Fläche sinnvoll umzugehen, wird
in der Folge die Außenfläche neu gestaltet und die Pflasterung
teilweise erneuert und erweitert. 40.000 Euro sind hierfür
vorgesehen. Diese Veränderungen müssen aber warten, da zunächst
Bodenarbeiten rund um den Dom geplant sind, um dort eine
Glasfaserleitung zu verlegen, von der Licht-, Ton- und
Sicherheitstechnik profitieren sollen.
Vorgeschichte
Pläne für ein Besucherzentrum gibt es konkret seit 2012.
Zunächst war dabei eine Umwandlung ehemaliger Wohnräume im
Vikarienhof auf der der dem Dom gegenüberliegenden Straßenseite
vorgesehen. 2015 wurde dann vom Domkapitel beschlossen, das bisher
als „Dompavillon“ bekannte und als verpachteter Verkaufsraum
genutzte Gebäude direkt neben der Kathedrale zum
Dom-Besucherzentrum umzuwandeln. Errichtet wurde der kleine Bau aus
Sandstein in den Jahren 1989/1990 nach einem Entwurf des
Architekten Oswald Matthias Ungers, der auch den gesamten Domplatz
gestaltet hatte. In der Folgezeit war das Gebäude verpachtet und
wurde als Verkaufsraum genutzt. Mit der Pächterin wurde in einem
Vertrag die vorzeitige Beendigung des Pachtvertrages zum November
2015 vereinbart. Nicht mal vier Monate später wurde das
Dom-Besucherzentrum nun in Betrieb genommen. Die feierliche
Eröffnung ist für den 22. Mai geplant. An diesem Tag findet ein
kleines Festprogramm rund um den Dom statt. Text is; Foto: is;
pem
23.03.2016
Angesichts der Terroranschläge lädt Kirchenpräsident Christian Schad ein zum Gebet
 Gebet für die Opfer von Brüssel
Gebet für die Opfer von Brüssel
Speyer- Am Flughafen in Brüssel hat es am 22.
März 2016 zwei Explosionen gegeben.
Eine weitere Explosion ereignete sich in der Brüsseler
Innenstadt an einer Metro-Station. Nach derzeitigem Erkenntnisstand
(22. März, 14 Uhr) starben dabei mindestens 26 Menschen, viele
wurden schwer verletzt. In Belgien herrscht der Ausnahmezustand,
die Behörden gehen von terroristischen Anschlägen aus.
Angesichts des Unfassbaren lädt Kirchenpräsident Christian Schad
ein zum Gebet:
Unser Gott,
Entsetzen und Trauer sind in uns.
Fassungslos stehen wir vor dir und fragen „Warum?“.
Unzählige Menschen beweinen ihre Toten,
Bangen um die Schwerverletzten.
Nimm du die Toten auf in dein Reich
und steh denen bei,
die unendliches Leid zu tragen haben.
Hilf ihnen auszuhalten,
was kaum auszuhalten ist,
und stelle ihnen Menschen zur Seite,
die das Unfassbare mittragen.
Wir alle haben Angst und Furcht.
Zieh in die verirrten Herzen und Köpfe ein
und bewege sie zur Umkehr.
Vertreibe den Ungeist der Rache und Vergeltung
und schenke uns deinen Geist:
den Geist der Kraft und der Liebe und der
Besonnenheit.
Du bist ein Gott des Friedens.
Stärke alle Menschen guten Willens,
stärke die Glaubenden in allen Religionen,
stärke uns, dass wir uns mit ihnen einsetzen
für Gemeinschaft und Versöhnung.
Amen
Speyer, den 22. März 2016
22.03.2016
Christine Lambrich als neue Dozentin im Priesterseminar eingeführt
 Christine Lambrich und Thomas Kiefer
Christine Lambrich und Thomas Kiefer
Dr. Thomas Kiefer nach sieben Jahren Lehrtätigkeit
verabschiedet
Speyer- Seit Anfang des Jahres ist
Pastoralreferentin Christine Lambrich als neue Dozentin für
Pastoraltheologie im Priesterseminar Speyer tätig. Im Rahmen einer
kleinen Feier wurde sie am Freitagabend offiziell an ihrer neuen
Arbeitsstelle eingeführt. Lambrich hat die Aufgabe von Dr. Thomas
Kiefer übernommen, der nach sieben Jahren als Dozent im
Priesterseminar verabschiedet wurde. Kiefer hatte die Lehrtätigkeit
lange neben seinen vielfältigen Verpflichtungen als Leiter der
Abteilung „Seelsorge in Pfarrei und Lebensräumen“ im Bischöflichen
Ordinariat erfüllt.
Im Priester- und Pastoralseminar St. German absolvieren die
Priesteramtskandidaten der Diözesen Bamberg, Eichstätt, Würzburg
und Speyer sowie die Pastoralreferentinnen und Pastoralreferenten
aus dem Bistum Speyer die zweite Ausbildungsphase nach dem
Abschluss ihres Theologiestudiums.
„Thomas Kiefer war maßgeblich an der Ausarbeitung der
'verheutigten' Ausbildungs-konzepte für die Priesteramtskandidaten
und Pastoralreferenten beteiligt“, hob Regens Markus Magin, Leiter
des Seminars, hervor. Es sei ihm immer darum gegangen, die
Ausbildung so gestalten, dass sie den heutigen Anforderungen in der
Seelsorge gerecht werde. „Er hat wichtige Impulse gesetzt“, betonte
der Regens. So habe er sich zum Beispiel dafür eingesetzt, dass
Projekte während der Ausbildung auch missionarisch ausgerichtet
sein sollen und katechetisches Arbeiten dazu gehöre. Magin bedankte
sich ausdrücklich auch im Namen des Bischofs für die Bereitschaft
Kiefers, bis zum Arbeitsbeginn seiner Nachfolgerin die
Lehrtätigkeit trotz seiner großen Arbeitsbelastung als
Abteilungsleiter zu erfüllen.
Er zeigte sich überzeugt, dass Christine Lambrich sehr viele
Erfahrungen und Qualifikationen für die neue Aufgabe mitbringt und
dankte für ihre Bereitschaft, die herausfordernde Aufgabe zu
übernehmen.
Lambrich, die mit ihrer Familie in Neustadt/Weinstr. wohnt, hat
in Mainz und Fribourg/Schweiz katholische Theologie studiert. Nach
ihrem Diplom absolvierte sie den Pastoralkurs im Priesterseminar in
Speyer und arbeitete einige Jahre als Pastoralreferentin in der
Pfarreiengemeinschaft Waldmohr, Breitenbach, Dunzweiler und in der
Pfarreiengemeinschaft Haßloch. Von 2004 bis 2012 war sie als
Diözesanreferentin für Katechese im Bischöflichen Ordinariat in
Speyer tätig. In den drei darauf folgenden Jahren trug sie als
Referentin für missionarische Pastoral und Projektleiterin die
Verantwortung für das Programm „Himmelgrün“ – Kirche auf der
Landesgartenschau Landau. Die 48-jährige Theologin absolvierte in
den letzten Jahren Weiterbildungen im Bereich Moderation und
Coaching und war Mitglied in den Arbeitsgruppen „Standards“ und
„Leitende Perspektiven“ im Rahmen des Reformprozesses
„Gemeindepastoral 2015“ im Bistum Speyer. Sie ist ausgebildete
Gemeindeberaterin und ist in diesem Bereich mit 50 Prozent ihrer
Arbeitszeit weiterhin tätig. Text und Foto: is
20.03.2016








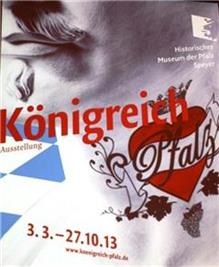



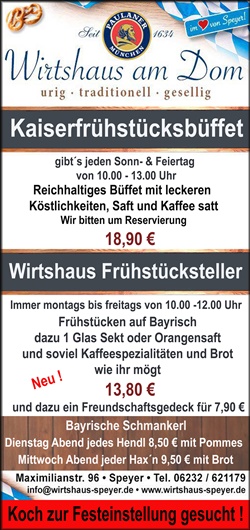
.jpg)



.png)

 Speyer/Berlin- Anlässlich der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements vom 8. bis 17. September setzt sich
die Diakonie dafür ein, das Sonderprogramm
"Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit Flüchtlingsbezug" auch nach
2018 fortzuführen. BFD-Stellen mit Flüchtlingsbezug sind einerseits
Stellen, in denen Freiwillige mit Flüchtlingen arbeiten,
andererseits BFD-Stellen für Flüchtlinge. Der
Bundesfreiwilligendienst steht auch Menschen über 27 Jahren
offen.
Speyer/Berlin- Anlässlich der Woche des
bürgerschaftlichen Engagements vom 8. bis 17. September setzt sich
die Diakonie dafür ein, das Sonderprogramm
"Bundesfreiwilligendienst (BFD) mit Flüchtlingsbezug" auch nach
2018 fortzuführen. BFD-Stellen mit Flüchtlingsbezug sind einerseits
Stellen, in denen Freiwillige mit Flüchtlingen arbeiten,
andererseits BFD-Stellen für Flüchtlinge. Der
Bundesfreiwilligendienst steht auch Menschen über 27 Jahren
offen. Diözesanversammlung soll künftig die Funktion des
Diözesanpastoralrats übernehmen / Forumsmitglieder plädieren für
Fortsetzung der Katholikentage in veränderter Form
Diözesanversammlung soll künftig die Funktion des
Diözesanpastoralrats übernehmen / Forumsmitglieder plädieren für
Fortsetzung der Katholikentage in veränderter Form
 Mit der Einführung
des neuen Seelsorgekonzepts im Jahr 2016 war die Entscheidung für
einen zentralen Gottesdienstort in jeder Pfarrei verbunden: In
dieser Kirche wird an jedem Sonntag oder Feiertag immer zur
gleichen Zeit die Eucharistie als Hauptgottesdienst der Pfarrei
gefeiert. Das Diözesane Forum schloss sich der Überzeugung an, dass
eine Antragstellung zur Verlegung des zentralen Gottesdienstortes
frühestens ab Januar 2019 und nur bei Vorliegen schwerwiegender
pastoraler Gründe möglich sein soll. Es bedürfe dazu einer
ausführlichen Diskussion in den Gremien der Pfarrei. Entscheidet
sich der Pfarreirat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die
Verlegung, soll der Antrag dem Bischof zur Genehmigung vorgelegt
werden.
Mit der Einführung
des neuen Seelsorgekonzepts im Jahr 2016 war die Entscheidung für
einen zentralen Gottesdienstort in jeder Pfarrei verbunden: In
dieser Kirche wird an jedem Sonntag oder Feiertag immer zur
gleichen Zeit die Eucharistie als Hauptgottesdienst der Pfarrei
gefeiert. Das Diözesane Forum schloss sich der Überzeugung an, dass
eine Antragstellung zur Verlegung des zentralen Gottesdienstortes
frühestens ab Januar 2019 und nur bei Vorliegen schwerwiegender
pastoraler Gründe möglich sein soll. Es bedürfe dazu einer
ausführlichen Diskussion in den Gremien der Pfarrei. Entscheidet
sich der Pfarreirat mit einer Zwei-Drittel-Mehrheit für die
Verlegung, soll der Antrag dem Bischof zur Genehmigung vorgelegt
werden. Deutsche
Kaiserin und Englische Regentin – Ahnherrin von Richard
Löwenherz
Deutsche
Kaiserin und Englische Regentin – Ahnherrin von Richard
Löwenherz
 Viele von ihnen kamen schon zum Gospel-Gottesdienst mit
Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt, der musikalisch begleitet
wurde vom Posaunenchor CVJM Schifferstadt und dem Schwegenheimer
Gospelchor „Spirit of Sound“. Die Kollekte in Höhe von 1.206 Euro
sowie Spenden in Höhe von 1.706 Euro kommen zu gleichen Teilen dem
Hospiz im Wilhelminenstift Speyer, den geplanten Hospizen in Bad
Dürkheim und Landau sowie der im Aufbau befindlichen ambulanten
Palliativarbeit der Diakonissen Speyer-Mannheim zugute.
Viele von ihnen kamen schon zum Gospel-Gottesdienst mit
Vorsteher Pfarrer Dr. Günter Geisthardt, der musikalisch begleitet
wurde vom Posaunenchor CVJM Schifferstadt und dem Schwegenheimer
Gospelchor „Spirit of Sound“. Die Kollekte in Höhe von 1.206 Euro
sowie Spenden in Höhe von 1.706 Euro kommen zu gleichen Teilen dem
Hospiz im Wilhelminenstift Speyer, den geplanten Hospizen in Bad
Dürkheim und Landau sowie der im Aufbau befindlichen ambulanten
Palliativarbeit der Diakonissen Speyer-Mannheim zugute.-04.jpg) Rund 1,21
Millionen Euro kamen bei der Aktion Dreikönigssingen zu Beginn des
Jahres im Bistum Speyer zusammen
Rund 1,21
Millionen Euro kamen bei der Aktion Dreikönigssingen zu Beginn des
Jahres im Bistum Speyer zusammen-04.jpg) Das
Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), die Träger der Aktion, danken allen Sternsingern und
Begleitenden für dieses große Engagement. „Wir sind dankbar, dass
wir als Hilfswerk der Sternsinger an der Seite dieser vielen
begeisternden Mädchen und Jungen, Jugendlichen und Erwachsenen
stehen dürfen, die sich Jahr für Jahr in den Dienst der guten Sache
stellen“, so Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des
Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘. „Immer wieder überraschen
uns die Sternsinger aufs Neue mit einem tollen Sammelergebnis.
Rekorde und Superlative sind uns sicherlich nicht wichtig, aber
jeder gesammelte Euro, jeder gesammelte Cent ist ein Stück Hilfe
für benachteiligte Kinder in der Einen Welt.“
Das
Kindermissionswerk und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend
(BDKJ), die Träger der Aktion, danken allen Sternsingern und
Begleitenden für dieses große Engagement. „Wir sind dankbar, dass
wir als Hilfswerk der Sternsinger an der Seite dieser vielen
begeisternden Mädchen und Jungen, Jugendlichen und Erwachsenen
stehen dürfen, die sich Jahr für Jahr in den Dienst der guten Sache
stellen“, so Prälat Dr. Klaus Krämer, Präsident des
Kindermissionswerks ‚Die Sternsinger‘. „Immer wieder überraschen
uns die Sternsinger aufs Neue mit einem tollen Sammelergebnis.
Rekorde und Superlative sind uns sicherlich nicht wichtig, aber
jeder gesammelte Euro, jeder gesammelte Cent ist ein Stück Hilfe
für benachteiligte Kinder in der Einen Welt.“ Gemeinsame Studienfahrt der theologischen Fakultät der
Universität Landau und der Hochschulabteilung des Bistums
Speyer
Gemeinsame Studienfahrt der theologischen Fakultät der
Universität Landau und der Hochschulabteilung des Bistums
Speyer Evangelisches Hilfswerk legt Jahresbilanz für 2016 vor –
über 1 Million Euro Spenden aus der Pfalz
Evangelisches Hilfswerk legt Jahresbilanz für 2016 vor –
über 1 Million Euro Spenden aus der Pfalz Bischof
Wiesemann sendet vier junge Frauen in den seelsorglichen Dienst im
Bistum Speyer aus
Bischof
Wiesemann sendet vier junge Frauen in den seelsorglichen Dienst im
Bistum Speyer aus In den Lesungen
des Tages stand Petrus im Zentrum der Betrachtung. Auf ihn verwies
Bischof Wiesemann als Vorbild für die pastoralen Mitarbeiter. Zum
einen sei es Petrus gewesen, der das Christusbekenntnis
ausgesprochen habe. Des Weiteren berichte die Bibel darüber, dass
Petrus Christus verleugnet und danach bitterlich geweint habe.
Emotionalität sei wichtig für den Dienst am Menschen, um „mitgehen
zu können, nicht zu verdecken, zu vertuschen oder zu überhöhen“.
Zuletzt wies der Bischof darauf hin, dass Petrus bis zum Schluss
„nicht fertig“ gewesen sei. Es sei wichtig, dass Kirche lerne und
sich nicht verenge. Die im Kirchendienst Tätigen müssten „Mut zur
Entwicklung haben, sich auf die Herausforderungen der jeweiligen
Zeit und die Menschen einzulassen, um im Christusbekenntnis zu
bleiben“.
In den Lesungen
des Tages stand Petrus im Zentrum der Betrachtung. Auf ihn verwies
Bischof Wiesemann als Vorbild für die pastoralen Mitarbeiter. Zum
einen sei es Petrus gewesen, der das Christusbekenntnis
ausgesprochen habe. Des Weiteren berichte die Bibel darüber, dass
Petrus Christus verleugnet und danach bitterlich geweint habe.
Emotionalität sei wichtig für den Dienst am Menschen, um „mitgehen
zu können, nicht zu verdecken, zu vertuschen oder zu überhöhen“.
Zuletzt wies der Bischof darauf hin, dass Petrus bis zum Schluss
„nicht fertig“ gewesen sei. Es sei wichtig, dass Kirche lerne und
sich nicht verenge. Die im Kirchendienst Tätigen müssten „Mut zur
Entwicklung haben, sich auf die Herausforderungen der jeweiligen
Zeit und die Menschen einzulassen, um im Christusbekenntnis zu
bleiben“.  Am Ende des
Gottesdienstes ergriffen Nina Bender, Dominique Haas, Kerstin Humm
und Amanda Wrzos selbst das Wort. Sie dankten dem Bischof, ihren
Ausbildern sowie den anwesenden Familienmitgliedern, Freunden und
den Kurskollegen. Ein besonderer Dank ging in die Heimat- und die
Praktikumspfarreien. Die versammelte Gemeinde gratulierte den vier
Beauftragten mit anhaltendem Applaus.
Am Ende des
Gottesdienstes ergriffen Nina Bender, Dominique Haas, Kerstin Humm
und Amanda Wrzos selbst das Wort. Sie dankten dem Bischof, ihren
Ausbildern sowie den anwesenden Familienmitgliedern, Freunden und
den Kurskollegen. Ein besonderer Dank ging in die Heimat- und die
Praktikumspfarreien. Die versammelte Gemeinde gratulierte den vier
Beauftragten mit anhaltendem Applaus. Rund 650 Messdiener aus der Pfalz und dem Saarland waren
als "Agenten" unterwegs | Rätselspiel verknüpft Wissen und
Kreativität mit Spaß und Action
Rund 650 Messdiener aus der Pfalz und dem Saarland waren
als "Agenten" unterwegs | Rätselspiel verknüpft Wissen und
Kreativität mit Spaß und Action  Die große Agentenausbildung begann mit Workshops, die vom
Bau einer Brücke aus Holzteilen bis zu einem Sportparcours in der
Turnhalle reichten. Sie fand auf den Gelände von Maria Schutz,
ebenso wie rund um das Edith-Stein-Haus, die Kirche St. Martin und
das St.-Franziskus-Gymnasium statt. Zu den Angeboten zählte auch
die Abseilaktion am Treppengeländer von Maria Schutz, die auf dem
Plan der Ludwigshafener Gruppe stand. Neben dem sportlichen durften
die Messdiener aber auch kreatives Geschick zeigen und mit bunten
Farben große Stoffsegel bemalen. Sie schmückten während des
Abschlussgottesdienstes den Kirchenraum. Außerdem entstanden im
Pfarrgarten von Maria Schutz so genannte "Ich-Boxen", bunt
gestaltete Kisten, mit deren Hilfe das eigenen Leben betrachtet
wird. Finja (10) aus Dunzweiler erklärte: "Das ist eine Box, die
mein Leben darstellt. Außen klebe ich auf, was Menschen von außen
ausmacht. Dafür haben wir hier Papier und Zeitungsausschnitte.
Innen kleben wir die Dinge hinein, die in uns sind. Ich habe meine
Geheimnisse eingeklebt." In einem weiteren Kreativ-Workshop
bildeten die Nachwuchagenten "Quadratologos". Die quadratischen
Farbflächen bilden, je nach Zusammensetzung, verschieden bunte
Bilder. Es entstanden Kunstwerke, die in ihrer Farbenpracht für die
Vielfalt der Gesellschaft stehen. In einem Workshopbereich der
"Young Caritas" mussten die Messdiener ihre Teamfähigkeit unter
Beweis stellen: An insgesamt neun Stationen kam es darauf an,
gemeinsam Punkte zu sammeln. Für den Weg durch das Labyrinth aus
Zurufen fand nur, wer sich zuvor in seinem Team gut abgestimmt
hatte. Auch der Würfelturm war nur als Gemeinschaftsproduktion zu
meistern. Die Pappkästchen mussten so aufeinander gestapelt werden,
dass eine möglichst große Höhe erreicht wurde ohne dabei den Turm
zu stützen oder zum Einsturz zu bringen.
Die große Agentenausbildung begann mit Workshops, die vom
Bau einer Brücke aus Holzteilen bis zu einem Sportparcours in der
Turnhalle reichten. Sie fand auf den Gelände von Maria Schutz,
ebenso wie rund um das Edith-Stein-Haus, die Kirche St. Martin und
das St.-Franziskus-Gymnasium statt. Zu den Angeboten zählte auch
die Abseilaktion am Treppengeländer von Maria Schutz, die auf dem
Plan der Ludwigshafener Gruppe stand. Neben dem sportlichen durften
die Messdiener aber auch kreatives Geschick zeigen und mit bunten
Farben große Stoffsegel bemalen. Sie schmückten während des
Abschlussgottesdienstes den Kirchenraum. Außerdem entstanden im
Pfarrgarten von Maria Schutz so genannte "Ich-Boxen", bunt
gestaltete Kisten, mit deren Hilfe das eigenen Leben betrachtet
wird. Finja (10) aus Dunzweiler erklärte: "Das ist eine Box, die
mein Leben darstellt. Außen klebe ich auf, was Menschen von außen
ausmacht. Dafür haben wir hier Papier und Zeitungsausschnitte.
Innen kleben wir die Dinge hinein, die in uns sind. Ich habe meine
Geheimnisse eingeklebt." In einem weiteren Kreativ-Workshop
bildeten die Nachwuchagenten "Quadratologos". Die quadratischen
Farbflächen bilden, je nach Zusammensetzung, verschieden bunte
Bilder. Es entstanden Kunstwerke, die in ihrer Farbenpracht für die
Vielfalt der Gesellschaft stehen. In einem Workshopbereich der
"Young Caritas" mussten die Messdiener ihre Teamfähigkeit unter
Beweis stellen: An insgesamt neun Stationen kam es darauf an,
gemeinsam Punkte zu sammeln. Für den Weg durch das Labyrinth aus
Zurufen fand nur, wer sich zuvor in seinem Team gut abgestimmt
hatte. Auch der Würfelturm war nur als Gemeinschaftsproduktion zu
meistern. Die Pappkästchen mussten so aufeinander gestapelt werden,
dass eine möglichst große Höhe erreicht wurde ohne dabei den Turm
zu stützen oder zum Einsturz zu bringen.  Für jede besuchte Workshopstation erhielten die
Nachwuchagenten einen Stempel in ihrem Agentenausweis. Die Ausweise
dienten bei Erreichen der dritten Workshopstation als "Lösegeld".
In Verbindung mit einem Tipp in Form eines Fotos des gestohlenen
Gegenstandes konnten die Teilnehmer die gestohlenen Gegenstände
zurück erhalten. Dafür reichte die Zeit von der Ankunft am
Vormittag bis zum späten Nachmittag gerade eben aus. Um 16.30 Uhr
wurde Bischof Wiesemann zum Abschlussgottesdienst erwartet. Es war
erklärtes Ziel der Messdiener-Agenten, bis zu diesem Zeitpunkt alle
Gegenstände für die Feier des Gottesdienstes wieder in der Kirche
zur Verfügung zu haben. Um Punkt 16.30 Uhr hatten sie ihr Ziel
erreicht: Mit allen nötigen Gegenständen ausgestattet begrüßten die
Messdiener Bischof Wiesemann und feierten gemeinsam mit ihm
Gottesdienst. Dabei wurde auch das Motto des Tages genauer unter
die Agenten-Lupe genommen: Als "Service", als "Dienst" verstehen
die Messdiener ihr Tun während der Gottesdienste in den Gemeinden
des Bistums. Bischof Wiesemann sagte in seiner Predigt: "Ihr Minis
gebt das Geheimnis unseres Glaubens durch euren Dienst weiter. In
diesem Sinne seid ihr Agentinnen und Agenten Gottes, die seinem
Geheimnis auf der Spur sind." Die Mädchen und Jungen nehmen ihren
Dienst - für den der Diözesane Minitag auch ein großer Dank sein
soll - sehr ernst. Sie sind aber auch mit viel Spaß dabei.
"Ich liebe messdienen!", sagte Anton (9) aus Kaiserslautern und
erklärt auch gleich, warum das so ist: "Weil das viel Spaß macht!
Da kann ich die Fürbitten vorlesen und das ist cool! Außerdem
treffe ich da viele Freunde." Sein Klassenkamerad Tim, ebenfalls 9
Jahre alt, stimmte ihm zu: "Ich sehe das genauso wie Anton." Marie
aus Hochspeyer ging es um etwas anders. Die Neunjährige antwortet
auf die Frage, warum sie Messdienerin sei: "Weil ich da im
Gottesdienst ganz viel helfen kann!"
Für jede besuchte Workshopstation erhielten die
Nachwuchagenten einen Stempel in ihrem Agentenausweis. Die Ausweise
dienten bei Erreichen der dritten Workshopstation als "Lösegeld".
In Verbindung mit einem Tipp in Form eines Fotos des gestohlenen
Gegenstandes konnten die Teilnehmer die gestohlenen Gegenstände
zurück erhalten. Dafür reichte die Zeit von der Ankunft am
Vormittag bis zum späten Nachmittag gerade eben aus. Um 16.30 Uhr
wurde Bischof Wiesemann zum Abschlussgottesdienst erwartet. Es war
erklärtes Ziel der Messdiener-Agenten, bis zu diesem Zeitpunkt alle
Gegenstände für die Feier des Gottesdienstes wieder in der Kirche
zur Verfügung zu haben. Um Punkt 16.30 Uhr hatten sie ihr Ziel
erreicht: Mit allen nötigen Gegenständen ausgestattet begrüßten die
Messdiener Bischof Wiesemann und feierten gemeinsam mit ihm
Gottesdienst. Dabei wurde auch das Motto des Tages genauer unter
die Agenten-Lupe genommen: Als "Service", als "Dienst" verstehen
die Messdiener ihr Tun während der Gottesdienste in den Gemeinden
des Bistums. Bischof Wiesemann sagte in seiner Predigt: "Ihr Minis
gebt das Geheimnis unseres Glaubens durch euren Dienst weiter. In
diesem Sinne seid ihr Agentinnen und Agenten Gottes, die seinem
Geheimnis auf der Spur sind." Die Mädchen und Jungen nehmen ihren
Dienst - für den der Diözesane Minitag auch ein großer Dank sein
soll - sehr ernst. Sie sind aber auch mit viel Spaß dabei.
"Ich liebe messdienen!", sagte Anton (9) aus Kaiserslautern und
erklärt auch gleich, warum das so ist: "Weil das viel Spaß macht!
Da kann ich die Fürbitten vorlesen und das ist cool! Außerdem
treffe ich da viele Freunde." Sein Klassenkamerad Tim, ebenfalls 9
Jahre alt, stimmte ihm zu: "Ich sehe das genauso wie Anton." Marie
aus Hochspeyer ging es um etwas anders. Die Neunjährige antwortet
auf die Frage, warum sie Messdienerin sei: "Weil ich da im
Gottesdienst ganz viel helfen kann!"




 Verabschiedung von
Peter Ruffra, langjähriger Leiter des Referates „Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz“ im Bistum Speyer
Verabschiedung von
Peter Ruffra, langjähriger Leiter des Referates „Arbeitssicherheit
und Gesundheitsschutz“ im Bistum Speyer
 Feier der
Ehejubiläen mit Bischof Wiesemann im Dom zu Speyer
Feier der
Ehejubiläen mit Bischof Wiesemann im Dom zu Speyer "Ihre
Dankbarkeit steht im Mittelpunkt dieser Feier", betonte Bischof
Karl-Heinz Wiesemann zu Beginn des Gottesdienstes, den er an beiden
Tagen leitete. In einer langen Ehezeit steckten viel Liebe, Treue,
Glauben, vielleicht auch Tränen und Schmerz, sagte er und fügte mit
Blick nach vorn hinzu: "In unserem Dom sollen Sie mit einem
besonderen Segen gestärkt werden."
"Ihre
Dankbarkeit steht im Mittelpunkt dieser Feier", betonte Bischof
Karl-Heinz Wiesemann zu Beginn des Gottesdienstes, den er an beiden
Tagen leitete. In einer langen Ehezeit steckten viel Liebe, Treue,
Glauben, vielleicht auch Tränen und Schmerz, sagte er und fügte mit
Blick nach vorn hinzu: "In unserem Dom sollen Sie mit einem
besonderen Segen gestärkt werden." Nach der
Kommunion folgte ein weiterer Höhepunkt: Alle Ehepartner sprachen
gemeinsam und jeweils zueinander gewandt das Gebet der Jubilare,
das mit der Erneuerung des Eheversprechens endete. Wie immer setzte
die Einzelsegnung der Paare durch Bischof, Mitglieder des
Domkapitels, Priester und Diakone den Schlusspunkt des
Gottesdienstes – ein weiterer bewegender Moment für die Paare. Hier
wechselten sie auch einige persönliche Worte mit den Geistlichen
und mehr noch beim anschließenden Sektempfang.
Nach der
Kommunion folgte ein weiterer Höhepunkt: Alle Ehepartner sprachen
gemeinsam und jeweils zueinander gewandt das Gebet der Jubilare,
das mit der Erneuerung des Eheversprechens endete. Wie immer setzte
die Einzelsegnung der Paare durch Bischof, Mitglieder des
Domkapitels, Priester und Diakone den Schlusspunkt des
Gottesdienstes – ein weiterer bewegender Moment für die Paare. Hier
wechselten sie auch einige persönliche Worte mit den Geistlichen
und mehr noch beim anschließenden Sektempfang.

 Bischof
Wiesemann predigt zum Patronatsfest Mariä Himmelfahrt in voll
besetztem Dom - Weitere Gottesdienste am Nachmittag und
Abend
Bischof
Wiesemann predigt zum Patronatsfest Mariä Himmelfahrt in voll
besetztem Dom - Weitere Gottesdienste am Nachmittag und
Abend Marienfrömmigkeit weise darauf hin, „dass wir uns
wiedersehen können, dass Gott unser Heil in Leib und Seele will“.
Seit der Auferstehung Christi gehöre das Leibliche zum Göttlichen.
Diese Leiblichkeit komme ebenfalls in den Marienbildern zum
Ausdruck. Bischof Wiesemann forderte, Menschen auch in ihrer
Leiblichkeit Würde zu geben. Er verurteilte medizinische
Experimente mit Embryos und den nachlässigen Umgang mit alten,
gebrechlichen Menschen.
Marienfrömmigkeit weise darauf hin, „dass wir uns
wiedersehen können, dass Gott unser Heil in Leib und Seele will“.
Seit der Auferstehung Christi gehöre das Leibliche zum Göttlichen.
Diese Leiblichkeit komme ebenfalls in den Marienbildern zum
Ausdruck. Bischof Wiesemann forderte, Menschen auch in ihrer
Leiblichkeit Würde zu geben. Er verurteilte medizinische
Experimente mit Embryos und den nachlässigen Umgang mit alten,
gebrechlichen Menschen. Polizeiseelsorgerin Anne Henning spricht über die
momentanen Stresssituationen der Polizei und über die
Herausforderungen, die sich dadurch für sie als Seelsorgerin
ergeben
Polizeiseelsorgerin Anne Henning spricht über die
momentanen Stresssituationen der Polizei und über die
Herausforderungen, die sich dadurch für sie als Seelsorgerin
ergeben
 Dort mündete sie in die Aufführung des "Psalm 2016". Im
Mittelpunkt des Oratoriums steht eine neue Vertonung der Psalmen,
die als Spiegel der menschlichen Lebenserfahrungen gedeutet werden.
Nicht umsonst gilt das Buch der Psalmen Juden, Muslimen und
Christen gemeinsam als Heilige Schrift. Die Beschäftigung mit den
Textvertonungen war für die Teilnehmer auch eine Auseinandersetzung
mit ihren Glaubensüberzeugungen. "Psalm 2016" lebt aber nicht
alleine von der Vertonung, sondern insbesondere vom Schauspiel. Das
Oratorium stellt zwei Menschen in die direkte Begegnung miteinander
und mit der Frage "Was zerstört (meine) Welt?“. Alma Gildenast und
Thorsten Brunow gaben durch ihre beeindruckende Interpretation den
beiden Charakteren Gestalt. Die Psalmen und Lieder klangen vor
diesem Hintergrund wie eine Kommentierung der Gedanken und eine
Fortführung des Geschehens.
Dort mündete sie in die Aufführung des "Psalm 2016". Im
Mittelpunkt des Oratoriums steht eine neue Vertonung der Psalmen,
die als Spiegel der menschlichen Lebenserfahrungen gedeutet werden.
Nicht umsonst gilt das Buch der Psalmen Juden, Muslimen und
Christen gemeinsam als Heilige Schrift. Die Beschäftigung mit den
Textvertonungen war für die Teilnehmer auch eine Auseinandersetzung
mit ihren Glaubensüberzeugungen. "Psalm 2016" lebt aber nicht
alleine von der Vertonung, sondern insbesondere vom Schauspiel. Das
Oratorium stellt zwei Menschen in die direkte Begegnung miteinander
und mit der Frage "Was zerstört (meine) Welt?“. Alma Gildenast und
Thorsten Brunow gaben durch ihre beeindruckende Interpretation den
beiden Charakteren Gestalt. Die Psalmen und Lieder klangen vor
diesem Hintergrund wie eine Kommentierung der Gedanken und eine
Fortführung des Geschehens. Die Musikwallfahrt bot einen ungewöhnlichen Rahmen für die
Probenwoche des Projektchores. Probenzeiten wechselten mit
Wanderzeiten ab. Die ersten Probeneinheiten fanden im Jugendhaus
St. Christophorus in Bad Dürkheim statt. Von dort aus führten
Tagestouren mit weiteren Einheiten zunächst wieder nach Bad
Dürkheim zurück, bevor die Teilnehmer die größeren Etappen
meisterten. Am Donnerstag führte sie der Weg von Bad Dürkheim nach
Haßloch. Am Freitag folgte die Schlussetappe von Haßloch nach
Speyer.
Die Musikwallfahrt bot einen ungewöhnlichen Rahmen für die
Probenwoche des Projektchores. Probenzeiten wechselten mit
Wanderzeiten ab. Die ersten Probeneinheiten fanden im Jugendhaus
St. Christophorus in Bad Dürkheim statt. Von dort aus führten
Tagestouren mit weiteren Einheiten zunächst wieder nach Bad
Dürkheim zurück, bevor die Teilnehmer die größeren Etappen
meisterten. Am Donnerstag führte sie der Weg von Bad Dürkheim nach
Haßloch. Am Freitag folgte die Schlussetappe von Haßloch nach
Speyer.




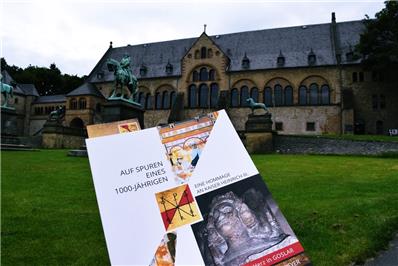 Informationen zu Veranstaltungen und Geschichte –
Kooperation mit Speyer
Informationen zu Veranstaltungen und Geschichte –
Kooperation mit Speyer Grußworten bei. Die beiden Städte haben durch die
Initiative von Unternehmensberater Reiner Dressler für das
Heinrich-III-Jubiläum eine Marketingzusammenarbeit geschlossen:
Besucher des Doms in Speyer erhalten gegen Vorlage ihrer Tickets
Ermäßigung in Goslar und umgekehrt. Als Sponsor für das Magazin
konnte die Meisterküchen GmbH gewonnen werden.
Grußworten bei. Die beiden Städte haben durch die
Initiative von Unternehmensberater Reiner Dressler für das
Heinrich-III-Jubiläum eine Marketingzusammenarbeit geschlossen:
Besucher des Doms in Speyer erhalten gegen Vorlage ihrer Tickets
Ermäßigung in Goslar und umgekehrt. Als Sponsor für das Magazin
konnte die Meisterküchen GmbH gewonnen werden.



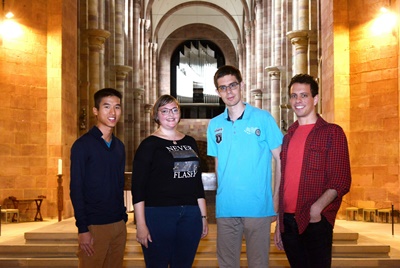

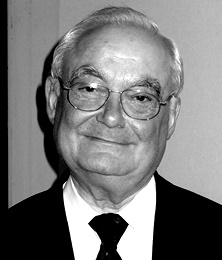 Ehemaliger
Leiter der Hauptabteilung "Schulen und Hochschulen" im
Bischöflichen Ordinariat Speyer und Verantwortlicher für die Orden
im Bistum
Ehemaliger
Leiter der Hauptabteilung "Schulen und Hochschulen" im
Bischöflichen Ordinariat Speyer und Verantwortlicher für die Orden
im Bistum Größte Bronzeglocke der Pfalz ist Dank zweier neuer
Läutemaschinen wieder betriebsfähig
Größte Bronzeglocke der Pfalz ist Dank zweier neuer
Läutemaschinen wieder betriebsfähig Referent für Weltkirche im Bistum Speyer nimmt im Trikot
von Renovabis an Radrennen quer durch Europa teil
Referent für Weltkirche im Bistum Speyer nimmt im Trikot
von Renovabis an Radrennen quer durch Europa teil

 BDKJ-Team
beteiligt sich mit einem Workshop zu Toleranz und Weltoffenheit
aktuell an ökumenischen Jugendtreffen in Taizé
BDKJ-Team
beteiligt sich mit einem Workshop zu Toleranz und Weltoffenheit
aktuell an ökumenischen Jugendtreffen in Taizé
 Insgesamt
sind derzeit knapp 3000 junge Leute aus 60 Ländern in Taizé.
Während des BDKJ-Workshops gesten fanden parallel noch diverse
andere Workshops statt. Auf das Stundenkonto der Aktion
"Zukunftszeit" konnte der BDKJ Speyer mit dem Workshopangebot 66
Stunde verbuchen. Das fiktive Stundenkonto zählt Projektstunden der
Verbände für Toleranz und Weltoffenheit. Ursprünglich sollten bis
zur Bundestagswahl im September 35.000 Stunden gesammelt werden.
Das Ziel ist zwischenzeitlich bereits weit übertroffen worden.
Aktuell beläuft sich der Zählerstand auf 96.876 Stunden.
Insgesamt
sind derzeit knapp 3000 junge Leute aus 60 Ländern in Taizé.
Während des BDKJ-Workshops gesten fanden parallel noch diverse
andere Workshops statt. Auf das Stundenkonto der Aktion
"Zukunftszeit" konnte der BDKJ Speyer mit dem Workshopangebot 66
Stunde verbuchen. Das fiktive Stundenkonto zählt Projektstunden der
Verbände für Toleranz und Weltoffenheit. Ursprünglich sollten bis
zur Bundestagswahl im September 35.000 Stunden gesammelt werden.
Das Ziel ist zwischenzeitlich bereits weit übertroffen worden.
Aktuell beläuft sich der Zählerstand auf 96.876 Stunden. ---Kopie.jpg) Bistum stellt Statistik für das vergangene Jahr vor –
Abnahme der Kirchenaustritte, doch zugleich sinkt die Quote der
regelmäßigen Gottesdienstbesucher
Bistum stellt Statistik für das vergangene Jahr vor –
Abnahme der Kirchenaustritte, doch zugleich sinkt die Quote der
regelmäßigen Gottesdienstbesucher.jpg)
.jpg)
 Speyer/Landau- Das Bistum Speyer überträgt Jutta
Kruppenbacher zu Beginn des neuen Schuljahres die Leitung der
Maria-Ward-Schule in Landau. Sie folgt als neue Schulleiterin auf
Klaus Neubecker, der zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand
getreten ist.
Speyer/Landau- Das Bistum Speyer überträgt Jutta
Kruppenbacher zu Beginn des neuen Schuljahres die Leitung der
Maria-Ward-Schule in Landau. Sie folgt als neue Schulleiterin auf
Klaus Neubecker, der zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand
getreten ist.
 Das
„Glaubensfeuer“ kombinierte biblische Texte, Lichteffekte,
Farbstimmungen und Musik. Im Mittelpunkt der knapp einstündigen
Präsentation standen die christlichen Symbole Wasser, Licht und
Feuer. „Die Menschen erlebten den Kirchenraum mit allen Sinnen auf
eine neue, ungewöhnliche und unerwartete Weise“, so Generalvikar
Jung.
Das
„Glaubensfeuer“ kombinierte biblische Texte, Lichteffekte,
Farbstimmungen und Musik. Im Mittelpunkt der knapp einstündigen
Präsentation standen die christlichen Symbole Wasser, Licht und
Feuer. „Die Menschen erlebten den Kirchenraum mit allen Sinnen auf
eine neue, ungewöhnliche und unerwartete Weise“, so Generalvikar
Jung.-01.jpg) Eines der größten Marienheiligtümer der Welt –
Buswallfahrt als „pilger“-Leserreise
Eines der größten Marienheiligtümer der Welt –
Buswallfahrt als „pilger“-Leserreise-01.jpg)

 der Welt an. Wir nehmen Abschied von einem wahrhaft
großen Staatsmann, der seine pfälzische Heimat und sein deutsches
Vaterland liebte und aus einem weiten, universalen Horizont heraus
lebte und handelte“, würdigte der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann die politische Lebensleistung Helmut Kohls. Er feierte
das Requiem gemeinsam mit dem Apostolischen Nuntius in Deutschland
Erzbischof Nikola Eterović, dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising, Reinhard
Kardinal Marx, Friedrich Kardinal Wetter (Bischof von Speyer von
1968 bis 1982), Bischof em. Dr. Anton Schlembach (Bischof von
Speyer von 1983 bis 2007) und Weihbischof Otto Georgens.
der Welt an. Wir nehmen Abschied von einem wahrhaft
großen Staatsmann, der seine pfälzische Heimat und sein deutsches
Vaterland liebte und aus einem weiten, universalen Horizont heraus
lebte und handelte“, würdigte der Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann die politische Lebensleistung Helmut Kohls. Er feierte
das Requiem gemeinsam mit dem Apostolischen Nuntius in Deutschland
Erzbischof Nikola Eterović, dem Vorsitzenden der Deutschen
Bischofskonferenz und Erzbischof von München und Freising, Reinhard
Kardinal Marx, Friedrich Kardinal Wetter (Bischof von Speyer von
1968 bis 1982), Bischof em. Dr. Anton Schlembach (Bischof von
Speyer von 1983 bis 2007) und Weihbischof Otto Georgens. „Die deutsche Einheit, fest eingebunden in die Europäische
Gemeinschaft, wird zu Recht immer mit Helmut Kohls Namen verbunden
bleiben“, so der Bischof. Das „Zusammentreffen der Gunst der Stunde
mit dem Menschen, der sie ergreift“ sei das „Geheimnis der
Geschichte“. Helmut Kohl sei in den Speyerer Dom immer auch als
Beter gekommen. Das „befruchtende Zueinander des Politikers und des
gläubigen Christen“ habe Helmut Kohl zu einem herausragenden
Staatsmann und zu einer weltweit geachteten Persönlichkeit werden
lassen. Den Gottesdienst feierte Bischof Wiesemann in „ökumenischer
Verbundenheit und in Verbundenheit mit allen Menschen, gleich
welcher Religion oder Weltanschauung, die Anteil nehmen am Tod von
Helmut Kohl und ihrer Dankbarkeit Ausdruck verleihen wollen,
insbesondere für das große Geschenk der deutschen Einheit.“
„Die deutsche Einheit, fest eingebunden in die Europäische
Gemeinschaft, wird zu Recht immer mit Helmut Kohls Namen verbunden
bleiben“, so der Bischof. Das „Zusammentreffen der Gunst der Stunde
mit dem Menschen, der sie ergreift“ sei das „Geheimnis der
Geschichte“. Helmut Kohl sei in den Speyerer Dom immer auch als
Beter gekommen. Das „befruchtende Zueinander des Politikers und des
gläubigen Christen“ habe Helmut Kohl zu einem herausragenden
Staatsmann und zu einer weltweit geachteten Persönlichkeit werden
lassen. Den Gottesdienst feierte Bischof Wiesemann in „ökumenischer
Verbundenheit und in Verbundenheit mit allen Menschen, gleich
welcher Religion oder Weltanschauung, die Anteil nehmen am Tod von
Helmut Kohl und ihrer Dankbarkeit Ausdruck verleihen wollen,
insbesondere für das große Geschenk der deutschen Einheit.“_100.jpg)









_100.jpg)













_100.jpg)


_100.jpg)

_100.jpg)








_100.jpg)







 Entwicklung, das Wachsen von Menschen zu
selbstbewussten, geliebten und wertgeschätzten Individuen ist eine
zentrale Aufgabe Ihres Berufes.“ Erzieher und Sozialassistenten
hätten davon profitiert, dass in der Diakonissen Fachschule für
Sozialwesen als kirchlicher Privatschule der Wert von Bildung für
den Menschen in seiner Ganzheit, seinem Körper, seinem Geist und
seiner Seele gelebt werde, sagte Kreiter auch mit Blick auf die
guten Voraussetzungen, die der Träger geschaffen habe.
Entwicklung, das Wachsen von Menschen zu
selbstbewussten, geliebten und wertgeschätzten Individuen ist eine
zentrale Aufgabe Ihres Berufes.“ Erzieher und Sozialassistenten
hätten davon profitiert, dass in der Diakonissen Fachschule für
Sozialwesen als kirchlicher Privatschule der Wert von Bildung für
den Menschen in seiner Ganzheit, seinem Körper, seinem Geist und
seiner Seele gelebt werde, sagte Kreiter auch mit Blick auf die
guten Voraussetzungen, die der Träger geschaffen habe.
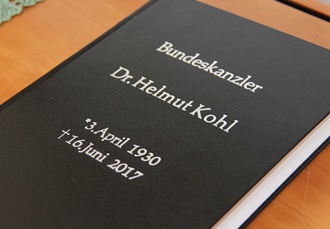 Speyer- Das
Kondolenzbuch des Bistums Speyer für Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut
Kohl liegt ab Donnerstag, den 29. Juni, im Friedrich-Spee-Haus in
Speyer aus. Im Foyer des Pfarrbüros der Dompfarrei Pax Christi
haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Gefühle und Gedanken
angesichts des Todes von Helmut Kohl in Worte zu fassen.
Speyer- Das
Kondolenzbuch des Bistums Speyer für Bundeskanzler a.D. Dr. Helmut
Kohl liegt ab Donnerstag, den 29. Juni, im Friedrich-Spee-Haus in
Speyer aus. Im Foyer des Pfarrbüros der Dompfarrei Pax Christi
haben Interessierte die Möglichkeit, ihre Gefühle und Gedanken
angesichts des Todes von Helmut Kohl in Worte zu fassen.
 Andere Orte möchte der BDKJ Speyer in den kommenden zwei
Jahren auch mit dem Tourbus erreichen. Die Versammlung beschloss
ein entsprechendes Projekt, das mit einem mobilen Angebot die
Themen der Jugendverbände an ungewohnte Orte bringen wird. Der Bus
wird mit Material zu politische Themen, aber auch Fragen zu Gott
und Welt unterwegs auf Festivals und Großveranstaltungen, vor Kinos
und in Fußgängerzonen sein. Er wird von einem Planungsteam und
Jugendlichen aus den Verbänden betreut werden. So besteht für jeden
der sieben Mitgliedsverbände auch die Möglichkeit, das je eigene
Verbandsprofil deutlich zu machen. Der Tourbus soll spielerisch
Einblick insbesondere in die politische Arbeit des BDKJ geben. Eine
digitale Vernetzung der Tourbusangebote mit den
Social-Media-Plattformen der Jugendverbände ist angedacht. So soll
gewährleistet werden, dass das regionale Angebot des Tourbus auch
eine überregionale Beteiligung ermöglicht. Leinhäuser fasst die
Projektidee zusammen: "Mit dem bunten BDKJ-Tourbus werden wir
in den nächsten beiden Jahren quer durch die Pfalz und das Saarland
tingeln. Ziel ist es, den BDKJ und die Jugendverbände zu Kindern
und Jugendlichen zu bringen - zu den Orten, wo sie sich aufhalten
und wohlfühlen."
Andere Orte möchte der BDKJ Speyer in den kommenden zwei
Jahren auch mit dem Tourbus erreichen. Die Versammlung beschloss
ein entsprechendes Projekt, das mit einem mobilen Angebot die
Themen der Jugendverbände an ungewohnte Orte bringen wird. Der Bus
wird mit Material zu politische Themen, aber auch Fragen zu Gott
und Welt unterwegs auf Festivals und Großveranstaltungen, vor Kinos
und in Fußgängerzonen sein. Er wird von einem Planungsteam und
Jugendlichen aus den Verbänden betreut werden. So besteht für jeden
der sieben Mitgliedsverbände auch die Möglichkeit, das je eigene
Verbandsprofil deutlich zu machen. Der Tourbus soll spielerisch
Einblick insbesondere in die politische Arbeit des BDKJ geben. Eine
digitale Vernetzung der Tourbusangebote mit den
Social-Media-Plattformen der Jugendverbände ist angedacht. So soll
gewährleistet werden, dass das regionale Angebot des Tourbus auch
eine überregionale Beteiligung ermöglicht. Leinhäuser fasst die
Projektidee zusammen: "Mit dem bunten BDKJ-Tourbus werden wir
in den nächsten beiden Jahren quer durch die Pfalz und das Saarland
tingeln. Ziel ist es, den BDKJ und die Jugendverbände zu Kindern
und Jugendlichen zu bringen - zu den Orten, wo sie sich aufhalten
und wohlfühlen."
 Auf die Historie Kirrweilers ging Bürgermeister Metzger
in seiner Ansprache ein. Der Ort habe sich in den letzten Jahren
stark auf seine Geschichte besonnen, erklärte er. Dazu gehöre auch
der Weihnzehnt, den die Kirrweiler vom Mittelalter bis 1793 dem
Bischof von Speyer ablieferten. Denn der südpfälzische Ort war bis
dahin Sommerresidenz der Fürstbischöfe und noch immer besteht hier
ein bischöflicher Weinberg. Nachdem das Bistum Speyer 1817 neu
begründet wurde, gab es zunächst keine Weinzehnt-Abgabe, bei der
dem bischöflichen Landesherrn ein Zehntel des Weinertrages
abgeliefert werden musste. Erst vor sieben Jahren belebten die
Kirrweiler die Tradition anlässlich des 950. Domweihe-Jubiläums
neu. Von da an handele es sich um eine freiwillige Abgabe, betonte
Metzger.
Auf die Historie Kirrweilers ging Bürgermeister Metzger
in seiner Ansprache ein. Der Ort habe sich in den letzten Jahren
stark auf seine Geschichte besonnen, erklärte er. Dazu gehöre auch
der Weihnzehnt, den die Kirrweiler vom Mittelalter bis 1793 dem
Bischof von Speyer ablieferten. Denn der südpfälzische Ort war bis
dahin Sommerresidenz der Fürstbischöfe und noch immer besteht hier
ein bischöflicher Weinberg. Nachdem das Bistum Speyer 1817 neu
begründet wurde, gab es zunächst keine Weinzehnt-Abgabe, bei der
dem bischöflichen Landesherrn ein Zehntel des Weinertrages
abgeliefert werden musste. Erst vor sieben Jahren belebten die
Kirrweiler die Tradition anlässlich des 950. Domweihe-Jubiläums
neu. Von da an handele es sich um eine freiwillige Abgabe, betonte
Metzger. blaues Winzerhemd übergestreift und gab ausgesuchte Zeilen
zum Besten. Dabei warf er wie Bürgermeister Metzger einen Blick in
die Geschichte und zitierte aus der Wein-Epistel von Pfarrer Carl
Theodor Schultz, die dieser 1964 für seine Kirrweiler Winzer
geschrieben hatte. Mit dem Zitat verdeutlichte Georgens, wie die
Bibel den Wein huldigt, aber auch zum maßvollen und bewussten
Genuss mahnt. Daran schloss er ein französisches Gebet des Winzers
an.
blaues Winzerhemd übergestreift und gab ausgesuchte Zeilen
zum Besten. Dabei warf er wie Bürgermeister Metzger einen Blick in
die Geschichte und zitierte aus der Wein-Epistel von Pfarrer Carl
Theodor Schultz, die dieser 1964 für seine Kirrweiler Winzer
geschrieben hatte. Mit dem Zitat verdeutlichte Georgens, wie die
Bibel den Wein huldigt, aber auch zum maßvollen und bewussten
Genuss mahnt. Daran schloss er ein französisches Gebet des Winzers
an.



























































 Besucher der Kathedrale können persönlich Abschied nehmen
und ihre Trauer in Worte fassen
Besucher der Kathedrale können persönlich Abschied nehmen
und ihre Trauer in Worte fassen Tag
der Freude und des Dankes: Bischof Wiesemann weiht fünf neue
Priester im Speyerer Dom
Tag
der Freude und des Dankes: Bischof Wiesemann weiht fünf neue
Priester im Speyerer Dom Eben
diese Hingebung drückten die Weihekandidaten aus. Mit fester Stimme
sicherten sie zu, künftig zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs
sein zu wollen. Die jahrelange Vorbereitung auf die Priesterweihe
verdichtete sich schon zu Beginn des Gottesdienstes in einem
deutlich hörbaren "Hier bin ich" der Kandidaten im voll besetzten
Dom. Das Gotteshaus war aus Anlass des Jubeltages mit feierlichen
Fanfarenklängen, innigen Chorälen und klangvollem Orgelspiel
gefüllt.
Eben
diese Hingebung drückten die Weihekandidaten aus. Mit fester Stimme
sicherten sie zu, künftig zuverlässige Mitarbeiter des Bischofs
sein zu wollen. Die jahrelange Vorbereitung auf die Priesterweihe
verdichtete sich schon zu Beginn des Gottesdienstes in einem
deutlich hörbaren "Hier bin ich" der Kandidaten im voll besetzten
Dom. Das Gotteshaus war aus Anlass des Jubeltages mit feierlichen
Fanfarenklängen, innigen Chorälen und klangvollem Orgelspiel
gefüllt. "Das
ist ein Tag der Freude und des Dankes für unser Bistum", stellte
Wiesemann heraus. Nicht alleine, dass sich junge Männer dem Dienst
Gottes mit brennendem Herzen verschrieben, sondern dass sie dabei
in eine neue, notwendig gewordene Mobilität des Geistes finden
wollten, bezeichnete der Bischof als bewundernswert. "Gott selbst
vollende nun das gute Werk, das er an dir begonnen hat", gab er den
neugeweihten Priestern mit auf den Weg, nachdem diese ihre neue
Aufgabe mit einem deutlichen Ja angenommen hatten.
"Das
ist ein Tag der Freude und des Dankes für unser Bistum", stellte
Wiesemann heraus. Nicht alleine, dass sich junge Männer dem Dienst
Gottes mit brennendem Herzen verschrieben, sondern dass sie dabei
in eine neue, notwendig gewordene Mobilität des Geistes finden
wollten, bezeichnete der Bischof als bewundernswert. "Gott selbst
vollende nun das gute Werk, das er an dir begonnen hat", gab er den
neugeweihten Priestern mit auf den Weg, nachdem diese ihre neue
Aufgabe mit einem deutlichen Ja angenommen hatten.
 Die Statio vor dem Eingang der Kathedrale gestalteten
Kommunionkinder der Speyerer Gemeinden mit. Das Leitwort der
Fronleichnamsfeier wurde auch in dem bunten Blumenteppich am Dom
als Schriftzug aufgegriffen. Ein weiteres Motiv war eine
Darstellung der Dreifaltigkeit („Die wahre Dreiheit in der wahren
Einheit“) aus dem Scivias-Kodex von Hildegard von Bingen.
Die Statio vor dem Eingang der Kathedrale gestalteten
Kommunionkinder der Speyerer Gemeinden mit. Das Leitwort der
Fronleichnamsfeier wurde auch in dem bunten Blumenteppich am Dom
als Schriftzug aufgegriffen. Ein weiteres Motiv war eine
Darstellung der Dreifaltigkeit („Die wahre Dreiheit in der wahren
Einheit“) aus dem Scivias-Kodex von Hildegard von Bingen.




.jpg)
.jpg) Vordergründig geht für die Diakonissen neuer Form mit
diesem Umbruch einher, dass sie keine Tracht mehr tragen, außerdem
nicht mehr Ehelosigkeit und Gehaltsverzicht versprechen. So ist
Pfarrerin Corinna Kloss, die Pfingsten als Diakonisse eingesegnet
wurde, berufstätige verheiratete Mutter von drei Kindern. Der
Dreiklang von Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft beinhalte
für sie vieles, das ihr im Glaubensleben wichtig sei, begründet die
38jährige ihren Beitritt. Dieser liegt bei Oberin Sr. Isabelle Wien
bereits 25 Jahre zurück. Seinerzeit zählte die Gemeinschaft noch
über 140 Speyerer Diakonissen, heute leben noch 22 Diakonissen aus
Speyer und Mannheim im Mutterhaus – alle außer der Oberin bereits
im Feierabend. „Wenn sich eine Situation wie die der zu Ende
gehenden Gemeinschaft der Diakonissen bisheriger Form wandelt,
Leben sich verändert, sind wir aufgerufen, uns aktiv oder passiv zu
verhalten, entweder noch einmal zu versuchen, Mutterhausdiakonie
neu zu gestalten oder sie enden zu lassen“, sagt die 45jährige über
den Transformationsprozess: „Die Mutterhausdiakonie geht weiter –
nur anders“, ist Sr. Isabelle überzeugt. Im Herbst startet ein
erster Kurs für Männer und Frauen, die in den Kreis der Diakonissen
und Diakone der Diakonissen Speyer-Mannheim eintreten möchten.
Vordergründig geht für die Diakonissen neuer Form mit
diesem Umbruch einher, dass sie keine Tracht mehr tragen, außerdem
nicht mehr Ehelosigkeit und Gehaltsverzicht versprechen. So ist
Pfarrerin Corinna Kloss, die Pfingsten als Diakonisse eingesegnet
wurde, berufstätige verheiratete Mutter von drei Kindern. Der
Dreiklang von Glaubens-, Lebens- und Dienstgemeinschaft beinhalte
für sie vieles, das ihr im Glaubensleben wichtig sei, begründet die
38jährige ihren Beitritt. Dieser liegt bei Oberin Sr. Isabelle Wien
bereits 25 Jahre zurück. Seinerzeit zählte die Gemeinschaft noch
über 140 Speyerer Diakonissen, heute leben noch 22 Diakonissen aus
Speyer und Mannheim im Mutterhaus – alle außer der Oberin bereits
im Feierabend. „Wenn sich eine Situation wie die der zu Ende
gehenden Gemeinschaft der Diakonissen bisheriger Form wandelt,
Leben sich verändert, sind wir aufgerufen, uns aktiv oder passiv zu
verhalten, entweder noch einmal zu versuchen, Mutterhausdiakonie
neu zu gestalten oder sie enden zu lassen“, sagt die 45jährige über
den Transformationsprozess: „Die Mutterhausdiakonie geht weiter –
nur anders“, ist Sr. Isabelle überzeugt. Im Herbst startet ein
erster Kurs für Männer und Frauen, die in den Kreis der Diakonissen
und Diakone der Diakonissen Speyer-Mannheim eintreten möchten.

 Bischof Wiesemann segnet generalsaniertes Priesterseminar
und weiht Altar in der Seminarkirche
Bischof Wiesemann segnet generalsaniertes Priesterseminar
und weiht Altar in der Seminarkirche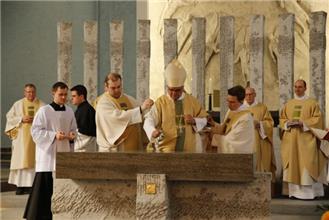 Der Speyerer Oberhirte zeigte sich erfreut über das Ende
der Umbau- und Renovierungsarbeiten auf dem Germansberg, die
insgesamt 12,5 Millionen Euro kosten. Seit dem Zweiten
Vatikanischen Konzil gelte das Priesterseminar als Herz der
Diözese, „und ich bin froh, dass wir die Operation am offenen
Herzen in guter Weise abschließen können“. Das lateinische Wort
„Seminarium“ bedeute Pflanzstätte, und in diesem Sinne sei das
Priesterseminar „die Pflanzstätte der Diözese, ein Raum des
Wachsens und der Entwicklung aus der Kraft des Wortes Gottes und
der Berufung, die uns Christus schenkt“. Als Pastoralseminar stehe
es allen kirchlichen Berufsgruppen – Priestern, Diakonen, Pastoral-
und Gemeindereferenten – aber auch Ehrenamtlichen in Aus- und
Fortbildung offen. „Somit wollen wir das Priesterseminar als Haus
für die ganze Diözese wiedereröffnen.“ Wiesemann sprach auch die
Belastungen der vergangenen beiden Jahre während der Umgestaltung
an und dankte allen, die sich engagiert hätten, um das Projekt zu
einem guten Abschluss zu bringen. Gleichzeitig erinnerte er an den
geschichtsträchtigen Boden, auf dem sich das Priesterseminar
befinde. „Hier sind die ältesten Spuren des Christentums in Speyer
zu finden“, betonte der Bischof und verwies auf Keltengräber, einen
Friedhof und auf ein frühes Kloster.
Der Speyerer Oberhirte zeigte sich erfreut über das Ende
der Umbau- und Renovierungsarbeiten auf dem Germansberg, die
insgesamt 12,5 Millionen Euro kosten. Seit dem Zweiten
Vatikanischen Konzil gelte das Priesterseminar als Herz der
Diözese, „und ich bin froh, dass wir die Operation am offenen
Herzen in guter Weise abschließen können“. Das lateinische Wort
„Seminarium“ bedeute Pflanzstätte, und in diesem Sinne sei das
Priesterseminar „die Pflanzstätte der Diözese, ein Raum des
Wachsens und der Entwicklung aus der Kraft des Wortes Gottes und
der Berufung, die uns Christus schenkt“. Als Pastoralseminar stehe
es allen kirchlichen Berufsgruppen – Priestern, Diakonen, Pastoral-
und Gemeindereferenten – aber auch Ehrenamtlichen in Aus- und
Fortbildung offen. „Somit wollen wir das Priesterseminar als Haus
für die ganze Diözese wiedereröffnen.“ Wiesemann sprach auch die
Belastungen der vergangenen beiden Jahre während der Umgestaltung
an und dankte allen, die sich engagiert hätten, um das Projekt zu
einem guten Abschluss zu bringen. Gleichzeitig erinnerte er an den
geschichtsträchtigen Boden, auf dem sich das Priesterseminar
befinde. „Hier sind die ältesten Spuren des Christentums in Speyer
zu finden“, betonte der Bischof und verwies auf Keltengräber, einen
Friedhof und auf ein frühes Kloster. Regens Markus Magin läutete den Festakt am Nachmittag im
wahrsten Sinne des Wortes mit einer kleinen Glocke ein. Ihr Klang
habe für ihn eine besondere Bedeutung, denn Ende August 2009 habe
sein Vorgänger, Pfarrer Dieter Rottenwöhrer, ihm dieses kleine
Instrument überreicht und damit symbolisch auch das Amt als
Direktor des Bistumshauses St. Ludwig übergeben. „Für mich war
damals klar, dass die Glocke erst dann wieder läuten wird, wenn das
Bistumshaus St. Ludwig renoviert und das Priesterseminar in die
Einrichtung integriert ist.“ Dass die Entwicklung eine andere
Wendung nehmen würde, hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen
können. Acht Jahre später werde nun das Priesterseminar St. German
wieder in Dienst gestellt, und die Glocke läute das Ende der
Bauphase ein. Diese ließ Magin, untermalt mit einigen Bildern und
einer gehörigen Brise Humor, noch einmal Revue passieren. Dabei
ging er nicht nur auf die zeitliche Abfolge der Ereignisse ein,
angefangen von der Entscheidung der Bistumsleitung im Jahr 2014,
sich vom Bistumshaus St. Ludwig mit der dazugehörigen Kirche St.
Ludwig zu trennen und stattdessen das Priesterseminar general zu
sanieren, bis zur Renovierung und liturgischen Umgestaltung der
Seminarkirche in den vergangenen Monaten. Er beschrieb auch
anschaulich die Widrigkeiten wie Staub und Lärm während der
umfangreichen Arbeiten.
Regens Markus Magin läutete den Festakt am Nachmittag im
wahrsten Sinne des Wortes mit einer kleinen Glocke ein. Ihr Klang
habe für ihn eine besondere Bedeutung, denn Ende August 2009 habe
sein Vorgänger, Pfarrer Dieter Rottenwöhrer, ihm dieses kleine
Instrument überreicht und damit symbolisch auch das Amt als
Direktor des Bistumshauses St. Ludwig übergeben. „Für mich war
damals klar, dass die Glocke erst dann wieder läuten wird, wenn das
Bistumshaus St. Ludwig renoviert und das Priesterseminar in die
Einrichtung integriert ist.“ Dass die Entwicklung eine andere
Wendung nehmen würde, hätte er zu diesem Zeitpunkt nicht ahnen
können. Acht Jahre später werde nun das Priesterseminar St. German
wieder in Dienst gestellt, und die Glocke läute das Ende der
Bauphase ein. Diese ließ Magin, untermalt mit einigen Bildern und
einer gehörigen Brise Humor, noch einmal Revue passieren. Dabei
ging er nicht nur auf die zeitliche Abfolge der Ereignisse ein,
angefangen von der Entscheidung der Bistumsleitung im Jahr 2014,
sich vom Bistumshaus St. Ludwig mit der dazugehörigen Kirche St.
Ludwig zu trennen und stattdessen das Priesterseminar general zu
sanieren, bis zur Renovierung und liturgischen Umgestaltung der
Seminarkirche in den vergangenen Monaten. Er beschrieb auch
anschaulich die Widrigkeiten wie Staub und Lärm während der
umfangreichen Arbeiten. Den Reigen der Grußworte eröffnete der stellvertretende
Vorsitzende der Deutschen Regentenkonferenz, Dr. Christian Heß. Es
habe für ihn drei gute Gründe gegeben, hier zu den Feierlichkeiten
in die Domstadt zu kommen, unterstrich der Leiter des
Priesterseminars der Diözese Freiburg, der aus Bruchsal stammt.
„Ich bin mit Speyer aufgewachsen, denn über der Tür des Pfarrhauses
meines Heimatortes hängt das Wappen der Fürstbischöfe von Speyer“,
so Heß, der damit ins Bewusstsein rief, dass weite Teile des
rechtsrheinischen badischen und württembergischen Gebietes bis zu
seinem Untergang im Jahr 1801 zum Fürstbistum Speyer gehörten.
Darüber hinaus überbrachte Heß die Glück- und Segenswünsche des
Vorsitzenden der Deutschen Regentenkonferenz, Helmut Niehues aus
Münster, und nicht zuletzt machte er deutlich, dass die
südwestdeutschen Regenten einen regelmäßigen Kontakt pflegen.
Den Reigen der Grußworte eröffnete der stellvertretende
Vorsitzende der Deutschen Regentenkonferenz, Dr. Christian Heß. Es
habe für ihn drei gute Gründe gegeben, hier zu den Feierlichkeiten
in die Domstadt zu kommen, unterstrich der Leiter des
Priesterseminars der Diözese Freiburg, der aus Bruchsal stammt.
„Ich bin mit Speyer aufgewachsen, denn über der Tür des Pfarrhauses
meines Heimatortes hängt das Wappen der Fürstbischöfe von Speyer“,
so Heß, der damit ins Bewusstsein rief, dass weite Teile des
rechtsrheinischen badischen und württembergischen Gebietes bis zu
seinem Untergang im Jahr 1801 zum Fürstbistum Speyer gehörten.
Darüber hinaus überbrachte Heß die Glück- und Segenswünsche des
Vorsitzenden der Deutschen Regentenkonferenz, Helmut Niehues aus
Münster, und nicht zuletzt machte er deutlich, dass die
südwestdeutschen Regenten einen regelmäßigen Kontakt pflegen. „Ich freue mich, dass auf dem Germansberg das
Priesterseminar neu gegründet und zukunftsfest gemacht wird“,
unterstrich der Speyerer Oberbürgermeister Hansjörg Eger.
Bildungseinrichtungen seien das Herz einer Gesellschaft, „weil dort
Wertevermittlung geschieht“. Im Jahr der 200-jährigen Neugründung
des Bistums sei dies ein gutes Zeichen für den Bildungsstandort
Speyer. Das Stadtoberhaupt erwähnte in diesem Zusammenhang auch die
mehr als 140 Wohnungen für alle Schichten der Bevölkerung, die neu
geschaffen werden können. Denn zur Mitfinanzierung der
Generalsanierung des Priesterseminars wurde eine Teilfläche seines
Grundstücks verkauft. Eger wünschte dem Lehrpersonal und den
Lernenden viel Geduld und Gelassenheit im Bewusstsein, dass hier
Bildung zum Wohl der Gesellschaft vermittelt werde.
„Ich freue mich, dass auf dem Germansberg das
Priesterseminar neu gegründet und zukunftsfest gemacht wird“,
unterstrich der Speyerer Oberbürgermeister Hansjörg Eger.
Bildungseinrichtungen seien das Herz einer Gesellschaft, „weil dort
Wertevermittlung geschieht“. Im Jahr der 200-jährigen Neugründung
des Bistums sei dies ein gutes Zeichen für den Bildungsstandort
Speyer. Das Stadtoberhaupt erwähnte in diesem Zusammenhang auch die
mehr als 140 Wohnungen für alle Schichten der Bevölkerung, die neu
geschaffen werden können. Denn zur Mitfinanzierung der
Generalsanierung des Priesterseminars wurde eine Teilfläche seines
Grundstücks verkauft. Eger wünschte dem Lehrpersonal und den
Lernenden viel Geduld und Gelassenheit im Bewusstsein, dass hier
Bildung zum Wohl der Gesellschaft vermittelt werde. Schließlich kamen auch diejenigen zu Wort, für die das
Priesterseminar in erster Linie bestimmt ist: Vertreter der
Bewerberkreise für die pastoralen Berufe. Auf unterhaltsame, aber
auch tiefgründige Weise sprachen der Priesteramtskandidat Peter
Heinke und die Pastoralassistentin Nina Bender über ihre eigene
Berufung, nannten in baulicher Hinsicht die „Highlights“ ihrer
sanierten Ausbildungsstätte, etwa „der ästhetisch ansprechende
Sakralraum der Nardinikapelle“, und lobten die Möglichkeiten, die
das Haus ihnen bietet, ihre vorhandenen Potenziale zu
verwirklichen, indem sie beispielsweise lernten, zu
unterrichten.
Schließlich kamen auch diejenigen zu Wort, für die das
Priesterseminar in erster Linie bestimmt ist: Vertreter der
Bewerberkreise für die pastoralen Berufe. Auf unterhaltsame, aber
auch tiefgründige Weise sprachen der Priesteramtskandidat Peter
Heinke und die Pastoralassistentin Nina Bender über ihre eigene
Berufung, nannten in baulicher Hinsicht die „Highlights“ ihrer
sanierten Ausbildungsstätte, etwa „der ästhetisch ansprechende
Sakralraum der Nardinikapelle“, und lobten die Möglichkeiten, die
das Haus ihnen bietet, ihre vorhandenen Potenziale zu
verwirklichen, indem sie beispielsweise lernten, zu
unterrichten.



















.jpg) Wallfahrt muttersprachlicher Gemeinden: Bischof ruft zu
Mut für Begegnung auf
Wallfahrt muttersprachlicher Gemeinden: Bischof ruft zu
Mut für Begegnung auf.jpg) Angelehnt an das Evangelium aus Johannes 10 sprach
Bischof Wiesemann in seiner Predigt den schmalen Grat zwischen
Vertrauen und Vorsicht an, den die meisten Menschen heute gehen.
Dass oft die Angst vor Fremdem dominiere und der Eintritt ins Haus
als Sinnbild der eigenen Persönlichkeit verwehrt werde, sei nicht
zuletzt verletzenden Begebenheiten geschuldet. „Die Menschheit ist
an der Türschwelle bereits verwundet“, sagte Wiesemann. Auf das
Evangelium bezogen verwies er jedoch auf Jesus als „Tür zu den
Schafen“. Einen Hirten wie ihn zu haben, der die Menschen selbst
über die sensibelste Stelle des eigenen Lebens führt, sei eine
Gewissheit des Glaubens.
Angelehnt an das Evangelium aus Johannes 10 sprach
Bischof Wiesemann in seiner Predigt den schmalen Grat zwischen
Vertrauen und Vorsicht an, den die meisten Menschen heute gehen.
Dass oft die Angst vor Fremdem dominiere und der Eintritt ins Haus
als Sinnbild der eigenen Persönlichkeit verwehrt werde, sei nicht
zuletzt verletzenden Begebenheiten geschuldet. „Die Menschheit ist
an der Türschwelle bereits verwundet“, sagte Wiesemann. Auf das
Evangelium bezogen verwies er jedoch auf Jesus als „Tür zu den
Schafen“. Einen Hirten wie ihn zu haben, der die Menschen selbst
über die sensibelste Stelle des eigenen Lebens führt, sei eine
Gewissheit des Glaubens.
 "Eine sehr gute Mischung zwischen Information und
authentischen Glaubensvertretern"
"Eine sehr gute Mischung zwischen Information und
authentischen Glaubensvertretern" "Glauben zum Erleben – Mit Gott auf du und du" war der
Titel des Workshops, der neu ins Programm kam. Christian Knoll,
Referent für religiöse Bildung beim Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) Speyer, suchte mit Jugendlichen das Gespräch über
persönliche Glaubensfragen – so persönlich, dass Lehrer gebeten
wurden, nicht dabei zu sein. Ebenfalls ohne Lehrer lief "Dein
Leben, dein Weg", bei dem Schüler wie Workshop-Leiter intensive
Erfahrungen machten. "Gott hat für jeden einen Plan", formulierte
Pfarrer Ralf Feix die These. "Dafür wollen wir sensibilisieren."
Feix, Pastoralreferentin Sandra Petrollo-Shahtout und Schwester
Carla haben in den Gesprächen die Qual der Wahl gespürt, die
Jugendliche umtreibt. Nach dem Abitur stehen viele Wege offen, aber
welcher ist der richtige? Sehr offen sprachen die Schüler über ihre
Situation und den Druck, den sie sich selbst machen.
Entscheidungsfreiheit macht nicht glücklich, stellten die
Workshop-Leiter fest.
"Glauben zum Erleben – Mit Gott auf du und du" war der
Titel des Workshops, der neu ins Programm kam. Christian Knoll,
Referent für religiöse Bildung beim Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) Speyer, suchte mit Jugendlichen das Gespräch über
persönliche Glaubensfragen – so persönlich, dass Lehrer gebeten
wurden, nicht dabei zu sein. Ebenfalls ohne Lehrer lief "Dein
Leben, dein Weg", bei dem Schüler wie Workshop-Leiter intensive
Erfahrungen machten. "Gott hat für jeden einen Plan", formulierte
Pfarrer Ralf Feix die These. "Dafür wollen wir sensibilisieren."
Feix, Pastoralreferentin Sandra Petrollo-Shahtout und Schwester
Carla haben in den Gesprächen die Qual der Wahl gespürt, die
Jugendliche umtreibt. Nach dem Abitur stehen viele Wege offen, aber
welcher ist der richtige? Sehr offen sprachen die Schüler über ihre
Situation und den Druck, den sie sich selbst machen.
Entscheidungsfreiheit macht nicht glücklich, stellten die
Workshop-Leiter fest. Weiterer Höhepunkt im Tagesprogramm: das Gespräch
mit der Bistumsleitung. Neben Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
stellten sich die Domkapitulare Franz Vogelgesang und Josef Damian
Szuba den kritischen Fragen. Ein Thema sprachen die Schüler jedem
Tag an: Warum können Frauen in der Kirche nicht die gleichen Ämter
wie Männer übernehmen? Bischof Wiesemann erläuterte den Ursprung
des Priestertums, dass Jesus es an seine Jünger übertragen hat.
Daneben habe es in der Kirche stets sehr aktive Frauen gegeben, die
großen Einfluss nahmen. Bei der Diskussion um Diakoninnen "tut sich
die Kirche schwer", räumte der Bischof ein und betonte: "Was die
Würde betrifft, gibt es in der Kirche keinen Unterschied zwischen
Frau und Mann." Bei der Frage nach dem Zölibat erläuterte er
ebenfalls die Hintergründe, wie das Gebot der Ehelosigkeit entstand
und blickte nach vorn: "Es kann sein, dass sich am Pflichtzölibat
etwas tut." Er erklärte die Haltung der Kirche gegenüber
Homosexualität und diskutierte mit den Schülern über das Thema
Missbrauch in der Kirche. Er erklärte wie Vorsorge getroffen wird,
um künftig solchen Taten vorzubeugen, und wie Aufklärung betrieben
wird. Er versicherte: "Wir nehmen jeden Fall ernst". Der Bischof
gewährte den Schülern Einblicke in sein privates Leben, etwa als er
die Frage nach seiner Berufung beantwortete. Lehrerin Doris Eichert
vom Siebenpfeiffer-Gymnasium aus Kusel zollte dem Bischof Respekt:
"Er hat sich bei theologischen Themen sehr kritisch und zeitgemäß
gezeigt und ist offen auf die Fragen der Schüler eingegangen."
Weiterer Höhepunkt im Tagesprogramm: das Gespräch
mit der Bistumsleitung. Neben Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann
stellten sich die Domkapitulare Franz Vogelgesang und Josef Damian
Szuba den kritischen Fragen. Ein Thema sprachen die Schüler jedem
Tag an: Warum können Frauen in der Kirche nicht die gleichen Ämter
wie Männer übernehmen? Bischof Wiesemann erläuterte den Ursprung
des Priestertums, dass Jesus es an seine Jünger übertragen hat.
Daneben habe es in der Kirche stets sehr aktive Frauen gegeben, die
großen Einfluss nahmen. Bei der Diskussion um Diakoninnen "tut sich
die Kirche schwer", räumte der Bischof ein und betonte: "Was die
Würde betrifft, gibt es in der Kirche keinen Unterschied zwischen
Frau und Mann." Bei der Frage nach dem Zölibat erläuterte er
ebenfalls die Hintergründe, wie das Gebot der Ehelosigkeit entstand
und blickte nach vorn: "Es kann sein, dass sich am Pflichtzölibat
etwas tut." Er erklärte die Haltung der Kirche gegenüber
Homosexualität und diskutierte mit den Schülern über das Thema
Missbrauch in der Kirche. Er erklärte wie Vorsorge getroffen wird,
um künftig solchen Taten vorzubeugen, und wie Aufklärung betrieben
wird. Er versicherte: "Wir nehmen jeden Fall ernst". Der Bischof
gewährte den Schülern Einblicke in sein privates Leben, etwa als er
die Frage nach seiner Berufung beantwortete. Lehrerin Doris Eichert
vom Siebenpfeiffer-Gymnasium aus Kusel zollte dem Bischof Respekt:
"Er hat sich bei theologischen Themen sehr kritisch und zeitgemäß
gezeigt und ist offen auf die Fragen der Schüler eingegangen." Bistum feiert Jubiläum seiner Neugründung vor 200
Jahren
Bistum feiert Jubiläum seiner Neugründung vor 200
Jahren „Seht, ich mache alles neu“ (Off 21,5) – unter
dieses Leitwort haben die Verantwortlichen des Bistums diese
zentrale Feier am Pfingstmontag gestellt, die genau 200 Jahre nach
der Unterzeichnung des Bayerischen Konkordats stattfinden wird, mit
dem das Bistum Speyer 1817 in den Grenzen des bayerischen
„Rheinkreises“ wieder errichtet worden war. Zuvor schon war das
frühere Fürstbistum Speyer in der Folge der Französischen
Revolution im Jahr 1801 untergegangen.
„Seht, ich mache alles neu“ (Off 21,5) – unter
dieses Leitwort haben die Verantwortlichen des Bistums diese
zentrale Feier am Pfingstmontag gestellt, die genau 200 Jahre nach
der Unterzeichnung des Bayerischen Konkordats stattfinden wird, mit
dem das Bistum Speyer 1817 in den Grenzen des bayerischen
„Rheinkreises“ wieder errichtet worden war. Zuvor schon war das
frühere Fürstbistum Speyer in der Folge der Französischen
Revolution im Jahr 1801 untergegangen. Im Mittelalter markierte die steinerne Schüssel die Grenze
zwischen der Freien Reichsstadt und dem Hochstift Speyer, in dem
bischöfliches Recht galt. Ein in der Reichsstadt Verurteilter
konnte so also Zuflucht im Herrschaftsbereich des Bischofs suchen
und auf dessen Gnade hoffen. Für ihn wurde der Domnapf also auch zu
einer Art Freiheitssymbol – ein frühes, gerade heute wieder heftig
diskutiertes „Kirchenasyl“.
Im Mittelalter markierte die steinerne Schüssel die Grenze
zwischen der Freien Reichsstadt und dem Hochstift Speyer, in dem
bischöfliches Recht galt. Ein in der Reichsstadt Verurteilter
konnte so also Zuflucht im Herrschaftsbereich des Bischofs suchen
und auf dessen Gnade hoffen. Für ihn wurde der Domnapf also auch zu
einer Art Freiheitssymbol – ein frühes, gerade heute wieder heftig
diskutiertes „Kirchenasyl“. Zu Zeiten des Fürstbistums Speyer durften sich die
Speyerer letztmals im Januar 1611 über eine Domnapffüllung freuen,
als der neue Bischof Philipp Christoph von Sötern in die
Stadt einzog. Anschließend verhinderten dann wohl Kriege wie der
„Dreißigjährige Krieg“ und der „Pfälzische Erbfolgekrieg“ und die
damit einhergehenden Zerstörungen größere Feiern. 1794 wurde der
Domnapf von den französischen Revolutionstruppen gar ganz entfernt
und durch den besagten „Freiheitsbaum“ ersetzt. Nach dem Anschluss
der linksrheinischen deutschen Gebiete an Frankreich wurde das
Fürstbistum schließlich säkularisiert. Doch schon um das Jahr 1822
rückte der Domnapf wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit,
berichtete der Weihbischof weiter. Zunächst südlich vom Dom
platziert erhielt „die Dumschissel“ - so der Kosenamen der Speyerer
für „ihren Domnapf“ - im Rahmen der 900 Jahr Feier der
Grundsteinlegung des Domes im Jahr 1930 wieder ihren angestammten,
zentralen Platz vor der Kathedrale, wenige Meter nur von der Stelle
entfernt, an der er schon im Mittelalter stand. Anlässe für
Domnapffüllungen in den vergangenen zehn Jahren waren die
Amtseinführung von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 2.
März 2008 sowie das 950. Weihejubiläum des Domes am 20. Oktober
2011.
Zu Zeiten des Fürstbistums Speyer durften sich die
Speyerer letztmals im Januar 1611 über eine Domnapffüllung freuen,
als der neue Bischof Philipp Christoph von Sötern in die
Stadt einzog. Anschließend verhinderten dann wohl Kriege wie der
„Dreißigjährige Krieg“ und der „Pfälzische Erbfolgekrieg“ und die
damit einhergehenden Zerstörungen größere Feiern. 1794 wurde der
Domnapf von den französischen Revolutionstruppen gar ganz entfernt
und durch den besagten „Freiheitsbaum“ ersetzt. Nach dem Anschluss
der linksrheinischen deutschen Gebiete an Frankreich wurde das
Fürstbistum schließlich säkularisiert. Doch schon um das Jahr 1822
rückte der Domnapf wieder ins Blickfeld der Öffentlichkeit,
berichtete der Weihbischof weiter. Zunächst südlich vom Dom
platziert erhielt „die Dumschissel“ - so der Kosenamen der Speyerer
für „ihren Domnapf“ - im Rahmen der 900 Jahr Feier der
Grundsteinlegung des Domes im Jahr 1930 wieder ihren angestammten,
zentralen Platz vor der Kathedrale, wenige Meter nur von der Stelle
entfernt, an der er schon im Mittelalter stand. Anlässe für
Domnapffüllungen in den vergangenen zehn Jahren waren die
Amtseinführung von Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am 2.
März 2008 sowie das 950. Weihejubiläum des Domes am 20. Oktober
2011. Die historische Bedeutung des Domnapfs erklärt auch eine
Inschrift in lateinischer Sprache auf dem wulstartigen, bronzenen
Reif am oberen Rand des Domnapfs; eine Bronzetafel zu Füssen des
Steintrogs erklärt den Domnapf in einer zeitgemäßen Sprache, die
Weihbischof Georgens, ein durchaus begabter Dichter, in eine
feinsinnig gereimte Form gegossen hat.
Die historische Bedeutung des Domnapfs erklärt auch eine
Inschrift in lateinischer Sprache auf dem wulstartigen, bronzenen
Reif am oberen Rand des Domnapfs; eine Bronzetafel zu Füssen des
Steintrogs erklärt den Domnapf in einer zeitgemäßen Sprache, die
Weihbischof Georgens, ein durchaus begabter Dichter, in eine
feinsinnig gereimte Form gegossen hat. Den Ausschank des Weines am Pfingstmontag übernehmen auch
in diesem Jahr wieder Mitglieder des Verkehrsvereins Speyer e.V.,
die, so ihr Vorsitzender Uwe Wöhlert, es „als eine große
Ehre verstehen, diesen Dienst anlässlich des Bistumsjubiläums
leisten zu dürfen“.
Den Ausschank des Weines am Pfingstmontag übernehmen auch
in diesem Jahr wieder Mitglieder des Verkehrsvereins Speyer e.V.,
die, so ihr Vorsitzender Uwe Wöhlert, es „als eine große
Ehre verstehen, diesen Dienst anlässlich des Bistumsjubiläums
leisten zu dürfen“.



















 Am 4. Mai
1987 besuchte Papst Johannes Paul II. Speyer – Erinnerung bis heute
lebendig
Am 4. Mai
1987 besuchte Papst Johannes Paul II. Speyer – Erinnerung bis heute
lebendig Bei der
Eucharistiefeier in Speyer trug der Papst ein Messgewand, das
eigens zu diesem Zweck in Rom gefertigt worden war. Dieses Gewand
ist derzeit in der Ausstellung „Weltbühne Speyer - Die Ära der
großen Staatsbesuche“ im Historischen Museum in Speyer zu sehen.
Auf die goldfarbene Kasel sind drei rote Kreuze aufgestickt, die
beidseitig auf dem Stab des Gewandes zu sehen sind. Unter den roten
Kreuzen ist auf der Rückenseite das päpstliche Wappen eingestickt.
Im rechten unteren Wappenfeld verweist der Buchstabe M auf die
Gottesmutter Maria. Ihr und dem heiligen Stephanus ist der Speyerer
Dom geweiht. Da Johannes Paul II. am 27. April 2014
heiliggesprochen wurde, ist das Gewand ebenso wie das Messbuch, aus
dem der Papst während der Messe vor dem Kaiserdom las, eine
Berührungsreliquie.
Bei der
Eucharistiefeier in Speyer trug der Papst ein Messgewand, das
eigens zu diesem Zweck in Rom gefertigt worden war. Dieses Gewand
ist derzeit in der Ausstellung „Weltbühne Speyer - Die Ära der
großen Staatsbesuche“ im Historischen Museum in Speyer zu sehen.
Auf die goldfarbene Kasel sind drei rote Kreuze aufgestickt, die
beidseitig auf dem Stab des Gewandes zu sehen sind. Unter den roten
Kreuzen ist auf der Rückenseite das päpstliche Wappen eingestickt.
Im rechten unteren Wappenfeld verweist der Buchstabe M auf die
Gottesmutter Maria. Ihr und dem heiligen Stephanus ist der Speyerer
Dom geweiht. Da Johannes Paul II. am 27. April 2014
heiliggesprochen wurde, ist das Gewand ebenso wie das Messbuch, aus
dem der Papst während der Messe vor dem Kaiserdom las, eine
Berührungsreliquie..jpg) Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann predigt am Ostersonntag und in der Osternacht
im Dom zu Speyer
Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann predigt am Ostersonntag und in der Osternacht
im Dom zu Speyer.jpg) Die Welt
befinde sich aktuell in einer „gefährlich unvollendeten,
abgebrochenen Globalisierung mit nur gemeinsam und global zu
lösenden, hochexplosiven Problemen wie Terrorismus, nuklearem
Wahnsinn, Korruption, Flüchtlingselend, Ausbeutung der Armen und
Schwachen.“ Diese Situation rufe nach einer „geistigen und
moralischen Kraft, die eine Vision in sich trägt, wie gemeinsames
Leben ohne ständige gegenseitige Verwundung und Demütigung möglich
wäre“. Die Christen hätten zu lernen, „in der Kraft der
Auferstehung ihre Sendung für die Welt gemeinsam zu begreifen und
anzugehen.“
Die Welt
befinde sich aktuell in einer „gefährlich unvollendeten,
abgebrochenen Globalisierung mit nur gemeinsam und global zu
lösenden, hochexplosiven Problemen wie Terrorismus, nuklearem
Wahnsinn, Korruption, Flüchtlingselend, Ausbeutung der Armen und
Schwachen.“ Diese Situation rufe nach einer „geistigen und
moralischen Kraft, die eine Vision in sich trägt, wie gemeinsames
Leben ohne ständige gegenseitige Verwundung und Demütigung möglich
wäre“. Die Christen hätten zu lernen, „in der Kraft der
Auferstehung ihre Sendung für die Welt gemeinsam zu begreifen und
anzugehen.“.jpg) In seiner
Predigt in der Osternacht sprach Bischof Wiesemann von „drei
Symbolen, die in die Wirklichkeit der Auferstehung hineintreffen
und in der Feier der Osternacht inszeniert werden: Licht, Wasser
und der Jubel – das Halleluja“. Das Symbol des Lichtes könne gegen
die große Finsternis aufleuchten und sie vertreiben, so Wiesemann.
Dabei bezog er die Dunkelheit auf die Angst der Menschen und
erinnerte an die Attentate auf die koptischen Christen vor wenigen
Tagen in Ägypten. „Wenn sie Osternacht feiern, dann lassen sie sich
dennoch nicht von der Angst bezwingen.“ Die Bedeutung des Wassers
werde bei der Taufe deutlich, sagte der Bischof und zeigte sich
erfreut über eine Erwachsenentaufe im Anschluss an die Predigt. Bei
dem jungen Mann, der getauft wurde, handelte es sich um einen
Erzieher in einem katholischen Kindergarten, dessen Eltern aus
Vietnam stammen.
In seiner
Predigt in der Osternacht sprach Bischof Wiesemann von „drei
Symbolen, die in die Wirklichkeit der Auferstehung hineintreffen
und in der Feier der Osternacht inszeniert werden: Licht, Wasser
und der Jubel – das Halleluja“. Das Symbol des Lichtes könne gegen
die große Finsternis aufleuchten und sie vertreiben, so Wiesemann.
Dabei bezog er die Dunkelheit auf die Angst der Menschen und
erinnerte an die Attentate auf die koptischen Christen vor wenigen
Tagen in Ägypten. „Wenn sie Osternacht feiern, dann lassen sie sich
dennoch nicht von der Angst bezwingen.“ Die Bedeutung des Wassers
werde bei der Taufe deutlich, sagte der Bischof und zeigte sich
erfreut über eine Erwachsenentaufe im Anschluss an die Predigt. Bei
dem jungen Mann, der getauft wurde, handelte es sich um einen
Erzieher in einem katholischen Kindergarten, dessen Eltern aus
Vietnam stammen. Kirchenpräsident Christian Schad: Die Ostergeschichte kann
den Blick auf die Welt verändern
Kirchenpräsident Christian Schad: Die Ostergeschichte kann
den Blick auf die Welt verändern Ministerpräsidentin Malu Dreyer dankt Benedikt XVI. für
seinen Dienst in Kirche und Welt
Ministerpräsidentin Malu Dreyer dankt Benedikt XVI. für
seinen Dienst in Kirche und Welt

 Teil der Liturgie am Palmsonntag ist die Lesung der
Matthäus Passion. Diese trug Bischof Wiesemann im Wechsel mit zwei
Lektoren vor.
Teil der Liturgie am Palmsonntag ist die Lesung der
Matthäus Passion. Diese trug Bischof Wiesemann im Wechsel mit zwei
Lektoren vor. Die Dommusik Speyer gestaltete das Pontifikalamt an
Palmsonntag mit Gesang, Bläser- und Orgelklang. Unter der Leitung
von Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori
musizierten der Mädchenchor am Dom zu Speyer, die Speyerer
Domsingknaben und der Domchor Speyer sowie die Dombläser Speyer. An
der Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub. Der Auszug zum
Schluss des Gottesdienstes erfolgte traditionsgemäß in Stille.
Die Dommusik Speyer gestaltete das Pontifikalamt an
Palmsonntag mit Gesang, Bläser- und Orgelklang. Unter der Leitung
von Domkantor Joachim Weller und Domkapellmeister Markus Melchiori
musizierten der Mädchenchor am Dom zu Speyer, die Speyerer
Domsingknaben und der Domchor Speyer sowie die Dombläser Speyer. An
der Orgel spielte Domorganist Markus Eichenlaub. Der Auszug zum
Schluss des Gottesdienstes erfolgte traditionsgemäß in Stille. Fünf Mitglieder
des BDKJ Speyer zu Gast beim Bürgerempfang in Mainz - Dank der
Ministerpräsidentin für Engagement für Demokratie und ein einiges
Europa
Fünf Mitglieder
des BDKJ Speyer zu Gast beim Bürgerempfang in Mainz - Dank der
Ministerpräsidentin für Engagement für Demokratie und ein einiges
Europa Dreyer hatte
zum fünften Bürgerempfang 260 ehrenamtlich engagierte
Rheinland-Pfälzer geladen, die sich in besonderer Weise für
Demokratie und ein einiges Europa einsetzen. Sie seien, so die
Ministerpräsidentin, Heldinnen und Helden des Alltags. „Ich finde
es schön und es ist mir wichtig, so viele interessante Menschen
kennenzulernen, die sich mit großem Einsatz ihrem persönlichen
Herzensprojekt widmen“, sagte Dreyer. „Ohne ihre tatkräftige
Unterstützung würde dieses Land nicht so gut funktionieren.
Deswegen danke ich ihnen von ganzem Herzen“, sagte die
Ministerpräsidentin. BDKJ-Diözesanpräses Carsten Leinhäuser nutzte
gemeinsam mit Verbandlern aus den Bistümern Trier und Mainz die
Gelegenheit, Dreyer die bundesweite BDKJ-Aktion „Zukunftszeit“
vorzustellen. Mit der Aktion sammelt der BDKJ deutschlandweit bis
zur Bundestagswahl 35000 Stunden für Toleranz und Weltoffenheit.
Die Stunden kommen durch Projekte der Ehrenamtlichen in den
BDKJ-Mitgliedsverbänden zusammen und bilden in der Summe die
Stundenzahl der kommenden Legislaturperiode des Bundestages ab. Die
Aktion wirbt für ein weltoffenes Deutschland in den kommenden
Jahren. Carsten Leinhäuser freute sich, Dreyer vom Engagement der
Jugendverbände mit „Zukunftszeit“ berichten zu können. „Besonders
gefreut hat mich, dass die Ministerpräsidentin das politische
Engagement der Jugendverbände und ihren Einsatz gegen
Rechtspopulismus sehr wertschätzt“, sagte er.
Dreyer hatte
zum fünften Bürgerempfang 260 ehrenamtlich engagierte
Rheinland-Pfälzer geladen, die sich in besonderer Weise für
Demokratie und ein einiges Europa einsetzen. Sie seien, so die
Ministerpräsidentin, Heldinnen und Helden des Alltags. „Ich finde
es schön und es ist mir wichtig, so viele interessante Menschen
kennenzulernen, die sich mit großem Einsatz ihrem persönlichen
Herzensprojekt widmen“, sagte Dreyer. „Ohne ihre tatkräftige
Unterstützung würde dieses Land nicht so gut funktionieren.
Deswegen danke ich ihnen von ganzem Herzen“, sagte die
Ministerpräsidentin. BDKJ-Diözesanpräses Carsten Leinhäuser nutzte
gemeinsam mit Verbandlern aus den Bistümern Trier und Mainz die
Gelegenheit, Dreyer die bundesweite BDKJ-Aktion „Zukunftszeit“
vorzustellen. Mit der Aktion sammelt der BDKJ deutschlandweit bis
zur Bundestagswahl 35000 Stunden für Toleranz und Weltoffenheit.
Die Stunden kommen durch Projekte der Ehrenamtlichen in den
BDKJ-Mitgliedsverbänden zusammen und bilden in der Summe die
Stundenzahl der kommenden Legislaturperiode des Bundestages ab. Die
Aktion wirbt für ein weltoffenes Deutschland in den kommenden
Jahren. Carsten Leinhäuser freute sich, Dreyer vom Engagement der
Jugendverbände mit „Zukunftszeit“ berichten zu können. „Besonders
gefreut hat mich, dass die Ministerpräsidentin das politische
Engagement der Jugendverbände und ihren Einsatz gegen
Rechtspopulismus sehr wertschätzt“, sagte er. Ein- und Ausblicke in bisherige Arbeit und in Pläne für
das Jahr 2017
Ein- und Ausblicke in bisherige Arbeit und in Pläne für
das Jahr 2017 Für den Speyerer Juristen Prof. Dr. Gottfried
Jung, bis zu seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik Ende 2016
Fraktionsvorsitzender der CDU im Speyerer Stadtrat, der bei der
Mitgliederversammlung 2016 außerplanmäßig zum Nachfolger von Dr.
Hissnauer ins Amt des Vorstandes des Dombauvereins gewählt worden
war, bedeutete dies, dass er sich erstmals einer planmäßigen Wahl
stellen musste. Und diese bestand er überzeugend: Nachdem sich die
Versammlung unter der Leitung des früheren Speyerer Bürgermeisters
Hanspeter Brohm einstimmig für eine offene Wahl der
Vorstandschaft ausgesprochen hatte, wurde Prof. Dr. Jung bei einer
Enthaltung – der eigenen – erneut zum Vorstand des Dombauvereins
Speyer e.V. gewählt. Mit ihm wurden auch sämtliche Mitglieder des
bisherigen Geschäftsführenden Vorstands der Vereinigung –
Stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin und Schatzmeister
sowie fünf weitere Beisitzer in ihren Ämtern ohne Gegenstimme
bestätigt. Lediglich für Dr. Roman Raether, der sich nicht erneut
zur Wahl stellte, rückte Carmen Gahmig neu in die
Vorstandschaft ein.
Für den Speyerer Juristen Prof. Dr. Gottfried
Jung, bis zu seinem Rückzug aus der Kommunalpolitik Ende 2016
Fraktionsvorsitzender der CDU im Speyerer Stadtrat, der bei der
Mitgliederversammlung 2016 außerplanmäßig zum Nachfolger von Dr.
Hissnauer ins Amt des Vorstandes des Dombauvereins gewählt worden
war, bedeutete dies, dass er sich erstmals einer planmäßigen Wahl
stellen musste. Und diese bestand er überzeugend: Nachdem sich die
Versammlung unter der Leitung des früheren Speyerer Bürgermeisters
Hanspeter Brohm einstimmig für eine offene Wahl der
Vorstandschaft ausgesprochen hatte, wurde Prof. Dr. Jung bei einer
Enthaltung – der eigenen – erneut zum Vorstand des Dombauvereins
Speyer e.V. gewählt. Mit ihm wurden auch sämtliche Mitglieder des
bisherigen Geschäftsführenden Vorstands der Vereinigung –
Stellvertretende Vorsitzende, Schriftführerin und Schatzmeister
sowie fünf weitere Beisitzer in ihren Ämtern ohne Gegenstimme
bestätigt. Lediglich für Dr. Roman Raether, der sich nicht erneut
zur Wahl stellte, rückte Carmen Gahmig neu in die
Vorstandschaft ein. Grußworte entboten danach der Speyerer
Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann sowie der Vorstandsvorsitzende der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer, Prof. Dr. Peter Frankenberg,
der nach dem Ausscheiden von Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs
Anfang des Jahres 2017 neu ins Amt gewählt wurde. Sie alle lobten
die wichtige Arbeit des Dombauvereins und die Verdienste seiner
Mitglieder für den Erhalt der Kathedrale. Ein weiterer gemeinsamer
Punkt aller Ansprachen: die Symbolkraft des Doms, die für ein
gutes, versöhnliches Miteinander stehe.
Grußworte entboten danach der Speyerer
Oberbürgermeister Hansjörg Eger, Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann sowie der Vorstandsvorsitzende der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer, Prof. Dr. Peter Frankenberg,
der nach dem Ausscheiden von Dr. Dr. h.c. Manfred Fuchs
Anfang des Jahres 2017 neu ins Amt gewählt wurde. Sie alle lobten
die wichtige Arbeit des Dombauvereins und die Verdienste seiner
Mitglieder für den Erhalt der Kathedrale. Ein weiterer gemeinsamer
Punkt aller Ansprachen: die Symbolkraft des Doms, die für ein
gutes, versöhnliches Miteinander stehe. Der Bischof von Speyer Dr. Karl-Heinz Wiesemann
sprach von seinem Besuch in der Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im
Historischen Museum der Pfalz. Bei der Schau, die der Ära der
großen Staatsbesuche in Speyer gewidmet ist, stehe der Dom im
Mittelpunkt. Er strahle eine große geistige und geistliche Kraft
aus, sei Zeichen für Versöhnung, Friede und Einheit. Den
engagierten Mitgliedern und dem engagierten Vorstand dankte der
Bischof für ihren Beitrag zum Erhalt „einer der schönsten
Kathedralen der Welt“.
Der Bischof von Speyer Dr. Karl-Heinz Wiesemann
sprach von seinem Besuch in der Ausstellung „Weltbühne Speyer“ im
Historischen Museum der Pfalz. Bei der Schau, die der Ära der
großen Staatsbesuche in Speyer gewidmet ist, stehe der Dom im
Mittelpunkt. Er strahle eine große geistige und geistliche Kraft
aus, sei Zeichen für Versöhnung, Friede und Einheit. Den
engagierten Mitgliedern und dem engagierten Vorstand dankte der
Bischof für ihren Beitrag zum Erhalt „einer der schönsten
Kathedralen der Welt“. Der frühere baden-württembergische Staatsminister für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und Rektor der Universität
Heidelberg, Prof. Dr. Peter Frankenberg, betonte die
europäische Dimension des Doms, der ihm selbst dank seiner
familiären Verbindungen nach Speyer von „Kindesbeinen an“ vertraut
sei.
Der frühere baden-württembergische Staatsminister für
Wissenschaft, Forschung und Kunst und Rektor der Universität
Heidelberg, Prof. Dr. Peter Frankenberg, betonte die
europäische Dimension des Doms, der ihm selbst dank seiner
familiären Verbindungen nach Speyer von „Kindesbeinen an“ vertraut
sei. Der nachfolgende Bericht des Vorsitzenden des Vorstands,
Prof. Dr. Jung, bot sodann einen detaillierten Überblick über die
Arbeit des Vereins. Neue Mitglieder zu gewinnen, nannte Dr. Jung
dabei als eines der wichtigsten Ziele. Um diesem näher zu kommen,
habe man eine Auswertung der bisherigen Mitgliederstruktur
vorgenommen. Auch der Flyer des Vereins, mit dem neue Mitglieder
gewonnen werden, werde derzeit neu gestaltet. Um künftig noch mehr
Geld für den Erhalt des Doms zu erwirtschaften, überarbeite man
zudem die als „Dombausteine“ bezeichneten Verkaufsprodukte des
Vereins. Hierzu hob Dr. Jung die Bedeutung des neuen
Dom-Besucherzentrums hervor, das er als „Erfolgsstory“ bezeichnete,
habe es doch zu einer deutlichen Verkaufssteigerung
beigetragen.
Der nachfolgende Bericht des Vorsitzenden des Vorstands,
Prof. Dr. Jung, bot sodann einen detaillierten Überblick über die
Arbeit des Vereins. Neue Mitglieder zu gewinnen, nannte Dr. Jung
dabei als eines der wichtigsten Ziele. Um diesem näher zu kommen,
habe man eine Auswertung der bisherigen Mitgliederstruktur
vorgenommen. Auch der Flyer des Vereins, mit dem neue Mitglieder
gewonnen werden, werde derzeit neu gestaltet. Um künftig noch mehr
Geld für den Erhalt des Doms zu erwirtschaften, überarbeite man
zudem die als „Dombausteine“ bezeichneten Verkaufsprodukte des
Vereins. Hierzu hob Dr. Jung die Bedeutung des neuen
Dom-Besucherzentrums hervor, das er als „Erfolgsstory“ bezeichnete,
habe es doch zu einer deutlichen Verkaufssteigerung
beigetragen. Schatzmeister Winfried Szkutnik berichtete von der
zufriedenstellenden Ertragslage des Vereins. Die Einnahmen aus
Mitgliederbeiträgen, den Dombausteinen, Spenden, Veranstaltungen
und Zinserträgen beliefen sich auf stolze 193.000 Euro. Damit lagen
die Einnahmen zwar leicht unter denen des Vorjahres. Da jedoch auch
die Ausgaben geringer ausfielen als im Jahr 2015 habe sich das
Ergebnis insgesamt verbessert, so Szkutnik. In der kommenden
Vorstandssitzung werde der Vorstand über die jährliche
satzungsgemäße Abführung an das Domkapitel abstimmen. Hierfür seien
in diesem Jahr 135.000 vorgesehen. Rechnungsprüfer Martin
Brilla, der dem Schatzmeister eine untadelige Kasssenführung
attestierte, empfahl schließlich, den Vorstand zu entlasten, was
dann auch ohne Gegenstimmen geschah.
Schatzmeister Winfried Szkutnik berichtete von der
zufriedenstellenden Ertragslage des Vereins. Die Einnahmen aus
Mitgliederbeiträgen, den Dombausteinen, Spenden, Veranstaltungen
und Zinserträgen beliefen sich auf stolze 193.000 Euro. Damit lagen
die Einnahmen zwar leicht unter denen des Vorjahres. Da jedoch auch
die Ausgaben geringer ausfielen als im Jahr 2015 habe sich das
Ergebnis insgesamt verbessert, so Szkutnik. In der kommenden
Vorstandssitzung werde der Vorstand über die jährliche
satzungsgemäße Abführung an das Domkapitel abstimmen. Hierfür seien
in diesem Jahr 135.000 vorgesehen. Rechnungsprüfer Martin
Brilla, der dem Schatzmeister eine untadelige Kasssenführung
attestierte, empfahl schließlich, den Vorstand zu entlasten, was
dann auch ohne Gegenstimmen geschah.



















.jpg)
.jpg) Durch
einen Kontakt zwischen Franz Vogelgesang und Karl-Peter Denzer,
Fachlehrer für Metalltechnik an der Berufsbildenden Schule Südliche
Weinstraße, kam das Gemeinschaftsprojekt „Pilgerboxen“ ins Rollen.
Die jungen Erwachsenen, vor allem Geflüchtete, gewannen durch die
handwerkliche Arbeit etwas Abwechslung vom Sprachförderunterricht,
berichtet Fachpraxislehrer Wolfgang Trauthwein, der gemeinsam mit
dem angehenden Lehrer Rüdiger Ullrich die jungen Leute angeleitet
hat. Viele Stunden waren zu sägen, bohren, entgraten, schweißen und
feilen, bis aus einem Vierkantmetallstück, einem Scharnier, einigen
Nieten sowie einem Blechstück eine Stempelbox entstanden war – eine
schöne handwerkliche Arbeit, die wetter- und vandalismusfest
ist.
Durch
einen Kontakt zwischen Franz Vogelgesang und Karl-Peter Denzer,
Fachlehrer für Metalltechnik an der Berufsbildenden Schule Südliche
Weinstraße, kam das Gemeinschaftsprojekt „Pilgerboxen“ ins Rollen.
Die jungen Erwachsenen, vor allem Geflüchtete, gewannen durch die
handwerkliche Arbeit etwas Abwechslung vom Sprachförderunterricht,
berichtet Fachpraxislehrer Wolfgang Trauthwein, der gemeinsam mit
dem angehenden Lehrer Rüdiger Ullrich die jungen Leute angeleitet
hat. Viele Stunden waren zu sägen, bohren, entgraten, schweißen und
feilen, bis aus einem Vierkantmetallstück, einem Scharnier, einigen
Nieten sowie einem Blechstück eine Stempelbox entstanden war – eine
schöne handwerkliche Arbeit, die wetter- und vandalismusfest
ist.
.jpg) Rahmenbedingungen für die Instandhaltung des Doms
Rahmenbedingungen für die Instandhaltung des Doms.jpg) In einer
Rückschau zeigte Domkapitular Schappert zunächst, welche Maßnahmen
zum Domerhalt in den vergangenen Jahren umgesetzt worden waren. Das
Spektrum reichte dabei von der Sanierung der Seitenschiffe bis hin
zur Instandsetzung des Nordwestturms.
In einer
Rückschau zeigte Domkapitular Schappert zunächst, welche Maßnahmen
zum Domerhalt in den vergangenen Jahren umgesetzt worden waren. Das
Spektrum reichte dabei von der Sanierung der Seitenschiffe bis hin
zur Instandsetzung des Nordwestturms. Auch an der
Elektrik und der Beleuchtung im Mittelschiff wird 2017 weiter
gearbeitet. Die Grundbeleuchtung wurde bereits auf LED umgestellt.
Nun sollen auch die Strahler entsprechend erneuert werden. Die
elektrischen Leitungen im Dom stammen aus den 60er und 80er Jahren.
Zum Teil sind sie noch älter. Im Mittelschiff sollen sie 2017
zusammen mit den Strahlern erneuert werden. Dabei werden die
Leuchten individuell steuerbar. Die neue Technik wird auch dazu
beitragen, den Energieverbrauch auf etwa ein Fünftel der bisherigen
Leistung zu senken. Die in der Apsis 2016 bereits probeweise
installierte Beleuchtung wird 2017 komplett installiert. Hierfür
sind Steinmetz- und Stahlschlosserarbeiten notwendig. Ebenso werden
die Querhauskapellen neu beleuchtet.
Auch an der
Elektrik und der Beleuchtung im Mittelschiff wird 2017 weiter
gearbeitet. Die Grundbeleuchtung wurde bereits auf LED umgestellt.
Nun sollen auch die Strahler entsprechend erneuert werden. Die
elektrischen Leitungen im Dom stammen aus den 60er und 80er Jahren.
Zum Teil sind sie noch älter. Im Mittelschiff sollen sie 2017
zusammen mit den Strahlern erneuert werden. Dabei werden die
Leuchten individuell steuerbar. Die neue Technik wird auch dazu
beitragen, den Energieverbrauch auf etwa ein Fünftel der bisherigen
Leistung zu senken. Die in der Apsis 2016 bereits probeweise
installierte Beleuchtung wird 2017 komplett installiert. Hierfür
sind Steinmetz- und Stahlschlosserarbeiten notwendig. Ebenso werden
die Querhauskapellen neu beleuchtet. Eröffnungsfeier am 6. und 7. Mai – Nutzung für Aus- und
Weiterbildung von Ehrenamtlichen und pastoralen
Mitarbeitern
Eröffnungsfeier am 6. und 7. Mai – Nutzung für Aus- und
Weiterbildung von Ehrenamtlichen und pastoralen
Mitarbeitern
 Ausreinigung
der „Königin der Instrumente“ auf dem Königschor im Speyerer
Dom
Ausreinigung
der „Königin der Instrumente“ auf dem Königschor im Speyerer
Dom Hauptquelle
für die Verschmutzung sind dabei die Textilfasern die von der
Kleidung der Besucher stammen. Durch thermische Bewegungen im
riesigen Raumvolumen der Speyerer Kathedrale gelangen sie auch in
die beiden Orgeln des Doms. Über die Zeit können diese Fasern mit
dem in der Luft befindlichen Kerzenwachs verkleben. Außerdem
besteht die Gefahr von Schimmelbildung. „Wenn die Wollmäuse in der
Orgel dunkler werden, ist es Zeit für eine Ausreinigung“, erklärt
Keggenhoff. Beim Nachstimmen gehen er und Domorganist Markus
Eichenlaub regelmäßig in das Innere der Orgel und können so auch
die Belastung durch Schmutz kontrollieren.
Hauptquelle
für die Verschmutzung sind dabei die Textilfasern die von der
Kleidung der Besucher stammen. Durch thermische Bewegungen im
riesigen Raumvolumen der Speyerer Kathedrale gelangen sie auch in
die beiden Orgeln des Doms. Über die Zeit können diese Fasern mit
dem in der Luft befindlichen Kerzenwachs verkleben. Außerdem
besteht die Gefahr von Schimmelbildung. „Wenn die Wollmäuse in der
Orgel dunkler werden, ist es Zeit für eine Ausreinigung“, erklärt
Keggenhoff. Beim Nachstimmen gehen er und Domorganist Markus
Eichenlaub regelmäßig in das Innere der Orgel und können so auch
die Belastung durch Schmutz kontrollieren.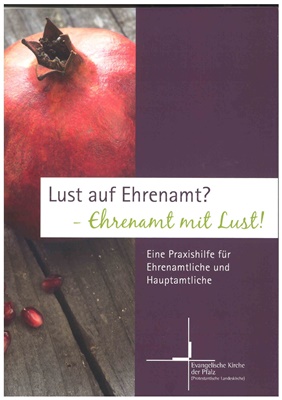 Überarbeitete Praxishilfe möchte Lust auf freiwilliges
Engagement machen
Überarbeitete Praxishilfe möchte Lust auf freiwilliges
Engagement machen Kirchen spenden 45.000 Euro für den von humanitärer
Katastrophe betroffenen Südsudan
Kirchen spenden 45.000 Euro für den von humanitärer
Katastrophe betroffenen Südsudan
 Schatzinsel-Gruppe
will Kinder stärken und unterstützen
Schatzinsel-Gruppe
will Kinder stärken und unterstützen
 Bischof Wiesemann warnt in seinem Hirtenwort zur
Fastenzeit vor Erstarken von Eigen- und Nationalinteressen / Absage
an Forderung nach Wende in deutscher Erinnerungskultur
Bischof Wiesemann warnt in seinem Hirtenwort zur
Fastenzeit vor Erstarken von Eigen- und Nationalinteressen / Absage
an Forderung nach Wende in deutscher Erinnerungskultur Nach der
Winterpause öffnen Kaisersaal und Aussichtsplattform für Besucher –
Zwerggalerie während der warmen Monate begehbar
Nach der
Winterpause öffnen Kaisersaal und Aussichtsplattform für Besucher –
Zwerggalerie während der warmen Monate begehbar Seit rund einem Jahr
bietet das Dom-Besucherzentrum im südlichen Domgarten Informationen
rund um den Dombesuch. Ebenso sind dort Eintrittskarten und
Audioguides erhältlich. Mit dem Kauf der sogenannten „Dombausteine“
des Dombauvereins lässt sich ein schönes Andenken an den Dom
erwerben und zugleich dem Bauwerk etwas Gutes tun.
Seit rund einem Jahr
bietet das Dom-Besucherzentrum im südlichen Domgarten Informationen
rund um den Dombesuch. Ebenso sind dort Eintrittskarten und
Audioguides erhältlich. Mit dem Kauf der sogenannten „Dombausteine“
des Dombauvereins lässt sich ein schönes Andenken an den Dom
erwerben und zugleich dem Bauwerk etwas Gutes tun.
 Letzte
Kundschafterreise des Bistums Speyer führt nach England
Letzte
Kundschafterreise des Bistums Speyer führt nach England Pfarrer Stefan Meißner ist Mitglied der Konferenz
landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden
Pfarrer Stefan Meißner ist Mitglied der Konferenz
landeskirchlicher Arbeitskreise Christen und Juden
-Asche.jpg)
BischofWiesemann.jpg) Der Bischof erläuterte, was im Leben wirklich Wert
besitzt und was es gilt zu erneuern. In seiner Predigt
verdeutlichte Wiesemann das an einer Begebenheit, die ihm auf der
Kundschafterreise im Februar "unter die Haut gegangen ist", wie er
gestand. Die Reise führte auf die Philippinen, ein armes Land, das
immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Besonders hart
traf es das Inselvolk im November 2013. Taifun Yolanda fegte mit
Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometern über
den Pazifik und die Philippinen. Auf dem Inselstaat verursachte der
tropische Wirbelsturm die größten Schäden.
Der Bischof erläuterte, was im Leben wirklich Wert
besitzt und was es gilt zu erneuern. In seiner Predigt
verdeutlichte Wiesemann das an einer Begebenheit, die ihm auf der
Kundschafterreise im Februar "unter die Haut gegangen ist", wie er
gestand. Die Reise führte auf die Philippinen, ein armes Land, das
immer wieder von Naturkatastrophen heimgesucht wird. Besonders hart
traf es das Inselvolk im November 2013. Taifun Yolanda fegte mit
Spitzengeschwindigkeiten von mehr als 300 Stundenkilometern über
den Pazifik und die Philippinen. Auf dem Inselstaat verursachte der
tropische Wirbelsturm die größten Schäden.Aschekreuz.jpg) ihnen nicht nehmen können. Die Menschen seien lebendig und
sich bewusstgeworden, was der Taifun nicht zerstören konnte, fasste
Wiesemann zusammen und knüpfte an die österliche Bußzeit an: Das
Aschekreuz sei ein Symbol dafür, "dass uns alles genommen werden
kann". Asche zu Asche, Staub zu Staub. Dieser Gedanke sei aber kein
Grund, bedrückt zu sein. Vielmehr gelte es in diesen 40 Tagen das
zu erneuern, was nicht zerstört werden könne, was einem nicht
genommen werden könne. Der Bischof machte den Gläubigen Mut, auf
Gott zu vertrauen. "Die österliche Bußzeit will uns die Herzen
öffnen für das, was von Gott kommt."
ihnen nicht nehmen können. Die Menschen seien lebendig und
sich bewusstgeworden, was der Taifun nicht zerstören konnte, fasste
Wiesemann zusammen und knüpfte an die österliche Bußzeit an: Das
Aschekreuz sei ein Symbol dafür, "dass uns alles genommen werden
kann". Asche zu Asche, Staub zu Staub. Dieser Gedanke sei aber kein
Grund, bedrückt zu sein. Vielmehr gelte es in diesen 40 Tagen das
zu erneuern, was nicht zerstört werden könne, was einem nicht
genommen werden könne. Der Bischof machte den Gläubigen Mut, auf
Gott zu vertrauen. "Die österliche Bußzeit will uns die Herzen
öffnen für das, was von Gott kommt."


 Bischöfe aus
Speyer und Würzburg, Allgemeiner Geistlicher Rat, Domkapitel und
zahlreiche Weggefährten feierten den 85. Geburtstag von Bischof em.
Dr. Anton Schlembach
Bischöfe aus
Speyer und Würzburg, Allgemeiner Geistlicher Rat, Domkapitel und
zahlreiche Weggefährten feierten den 85. Geburtstag von Bischof em.
Dr. Anton Schlembach Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann übermittelte dem Jubilar die Glück- und
Segenswünsche des gesamten Bistums und dankte ihm für sein
segensreiches Wirken. „Mit großer Treue hast Du Deinen Dienst
versehen und in uns die Hoffnung gestärkt, dass es für einen
Christen im letzten keinen Grund gibt zu verzagen“, sagte er im
Blick auf die fast 24 Jahre Schlembachs im Amt des Speyerer
Bischofs. „Mit Deinem ganzen Leben bist Du für uns ein Zeuge des
lebendigen Gottes geworden“, so Wiesemann und dankte ihm auch
persönlich: „Du hast es mir einfach gemacht, Dein Nachfolger zu
sein. Von Anfang an bist Du mir mit großer Herzlichkeit begegnet
und warst mit immer ein guter Ratgeber.“
Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann übermittelte dem Jubilar die Glück- und
Segenswünsche des gesamten Bistums und dankte ihm für sein
segensreiches Wirken. „Mit großer Treue hast Du Deinen Dienst
versehen und in uns die Hoffnung gestärkt, dass es für einen
Christen im letzten keinen Grund gibt zu verzagen“, sagte er im
Blick auf die fast 24 Jahre Schlembachs im Amt des Speyerer
Bischofs. „Mit Deinem ganzen Leben bist Du für uns ein Zeuge des
lebendigen Gottes geworden“, so Wiesemann und dankte ihm auch
persönlich: „Du hast es mir einfach gemacht, Dein Nachfolger zu
sein. Von Anfang an bist Du mir mit großer Herzlichkeit begegnet
und warst mit immer ein guter Ratgeber.“

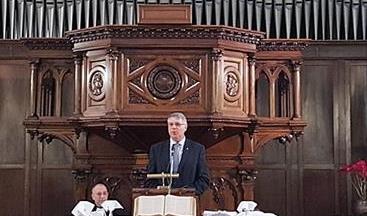 Die
Waldenser seien schon lange vor der Reformation „evangelisch“
gewesen, unterstrich Schad in seinem Grußwort bei dem Empfang der
Chiesa Evangelica Valdese. Dazu gehörten Merkmale wie die Stärkung
der Ehrenamtlichen, das Predigtamt für Frauen, das
Abendmahlsverständnis und die Abkehr von Ablasshandel und
Heiligenverehrung. Mit etwa 100 Gemeinden und fast 30.000
Gemeindemitgliedern seien die Waldenser gut vernetzt und
eingebunden in die weltweite Christenheit. Unter anderem gehören
sie dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖKR), dem Reformierten
Weltbund (RWB) und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE) an.
Die
Waldenser seien schon lange vor der Reformation „evangelisch“
gewesen, unterstrich Schad in seinem Grußwort bei dem Empfang der
Chiesa Evangelica Valdese. Dazu gehörten Merkmale wie die Stärkung
der Ehrenamtlichen, das Predigtamt für Frauen, das
Abendmahlsverständnis und die Abkehr von Ablasshandel und
Heiligenverehrung. Mit etwa 100 Gemeinden und fast 30.000
Gemeindemitgliedern seien die Waldenser gut vernetzt und
eingebunden in die weltweite Christenheit. Unter anderem gehören
sie dem Ökumenischen Rat der Kirchen (ÖKR), dem Reformierten
Weltbund (RWB) und der Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa
(GEKE) an. Am 7.
Februar 1932 wurde er in Großwenkheim in Unterfranken geboren –
Sein bischöflicher Wahlspruch lautet: „Deus salus – Gott ist das
Heil“
Am 7.
Februar 1932 wurde er in Großwenkheim in Unterfranken geboren –
Sein bischöflicher Wahlspruch lautet: „Deus salus – Gott ist das
Heil“

 Seit 25 Jahren
Schwerpunktveranstaltung für die Verbreitung Neuer Geistlicher
Lieder im Bistum Speyer
Seit 25 Jahren
Schwerpunktveranstaltung für die Verbreitung Neuer Geistlicher
Lieder im Bistum Speyer.jpg) Ökumenischer
Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen im
Speyerer Dom
Ökumenischer
Gottesdienst zur Gebetswoche für die Einheit der Christen im
Speyerer Dom.jpg) Bischof
Wiesemann verwies auf das Motto der Gebetswoche. Das Leitwort
führe in das Zentrum der Frohen Botschaft. Durch seinen Tod und
seine Auferstehung habe Jesus Christus die trennende Wand der
Feindschaft niedergerissen. „Von seinem Geist geführt, können wir
bekennen, dass wir Sünder und aneinander schuldig geworden sind,
dass aber die Gnade Gottes unendlich größer ist und alles Trennende
überwinden kann.“ Angesichts von Hass und Unfrieden, Intoleranz,
Ungerechtigkeit, Hunger und Armut weltweit rief der Bischof die
Christen dazu auf „Diener der Versöhnung für die ganze Welt zu
sein“ und „das Antlitz des liebenden Gottes“ sichtbar werden zu
lassen.
Bischof
Wiesemann verwies auf das Motto der Gebetswoche. Das Leitwort
führe in das Zentrum der Frohen Botschaft. Durch seinen Tod und
seine Auferstehung habe Jesus Christus die trennende Wand der
Feindschaft niedergerissen. „Von seinem Geist geführt, können wir
bekennen, dass wir Sünder und aneinander schuldig geworden sind,
dass aber die Gnade Gottes unendlich größer ist und alles Trennende
überwinden kann.“ Angesichts von Hass und Unfrieden, Intoleranz,
Ungerechtigkeit, Hunger und Armut weltweit rief der Bischof die
Christen dazu auf „Diener der Versöhnung für die ganze Welt zu
sein“ und „das Antlitz des liebenden Gottes“ sichtbar werden zu
lassen..jpg) Mitwirkende des
Gottesdienstes waren der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) – Region Südwest, Pastor Dr. Jochen
Wagner, Argirios Giannios als Vertreter der Griechisch-Orthodoxen
Kirche, Pastor Jörg-Michael Grassau vom Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), die Speyerer
Ortsgeistlichen, Pfarrerin Christine Gölzer und Dompfarrer Matthias
Bender, sowie der Synodalpräsident der Evangelischen Kirche der
Pfalz, Hermann Lorenz, und die Katholikenratsvorsitzende Luisa
Fischer. In den Gebeten und Fürbitten baten sie um Vergebung für
das Leid, dass sich Christen gegenseitig zugefügt haben und baten
um Versöhnung und Frieden für alle Menschen auf der Erde. Als
sichtbares Zeichen der Versöhnung entzündeten sie ein Licht an der
Osterkerze und reichten es mit kleinen Kerzen an die
Gottesdienstbesucher weiter.
Mitwirkende des
Gottesdienstes waren der Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft
Christlicher Kirchen (ACK) – Region Südwest, Pastor Dr. Jochen
Wagner, Argirios Giannios als Vertreter der Griechisch-Orthodoxen
Kirche, Pastor Jörg-Michael Grassau vom Bund
Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden (Baptisten), die Speyerer
Ortsgeistlichen, Pfarrerin Christine Gölzer und Dompfarrer Matthias
Bender, sowie der Synodalpräsident der Evangelischen Kirche der
Pfalz, Hermann Lorenz, und die Katholikenratsvorsitzende Luisa
Fischer. In den Gebeten und Fürbitten baten sie um Vergebung für
das Leid, dass sich Christen gegenseitig zugefügt haben und baten
um Versöhnung und Frieden für alle Menschen auf der Erde. Als
sichtbares Zeichen der Versöhnung entzündeten sie ein Licht an der
Osterkerze und reichten es mit kleinen Kerzen an die
Gottesdienstbesucher weiter.
 Mainz/Speyer/Meckenheim- „Die Sternsinger
kommen!“ hieß es am 12.Januar in der Staatskanzlei in Mainz. Mit
dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ brachten Kinder und Jugendliche aus
der Pfarrei Hl. Michael in Meckenheim den Segen zu
Ministerpräsidentin Malu Dreyer.
Mainz/Speyer/Meckenheim- „Die Sternsinger
kommen!“ hieß es am 12.Januar in der Staatskanzlei in Mainz. Mit
dem Kreidezeichen „20*C+M+B+17“ brachten Kinder und Jugendliche aus
der Pfarrei Hl. Michael in Meckenheim den Segen zu
Ministerpräsidentin Malu Dreyer.  Die Mädchen und Jungen warteten gespannt auf
Ministerpräsidentin Dreyer: "Ich erwarte mir von der
Ministerpräsidentin, dass sie mit ihren Kolleg_innen in der Politik
umsetzt, was wir ihr gleich berichten werden, wofür die diesjährige
Sternsingeraktion steht - und ich wünsche mir, dass es der
Ministerpräsidentin gesundheitlich gut geht", sagte Jessica (10)
vor dem Treffen in der Staatskanzlei.
Die Mädchen und Jungen warteten gespannt auf
Ministerpräsidentin Dreyer: "Ich erwarte mir von der
Ministerpräsidentin, dass sie mit ihren Kolleg_innen in der Politik
umsetzt, was wir ihr gleich berichten werden, wofür die diesjährige
Sternsingeraktion steht - und ich wünsche mir, dass es der
Ministerpräsidentin gesundheitlich gut geht", sagte Jessica (10)
vor dem Treffen in der Staatskanzlei. Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte
Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not
engagieren. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die
Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Jährlich können mit den gesammelten Spenden mehr als 1.500 Projekte
für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien
und Osteuropa unterstützt werden.
Inzwischen ist das Dreikönigssingen die weltweit größte
Solidaritätsaktion, bei der sich Kinder für Kinder in Not
engagieren. Die Aktion wird getragen vom Kindermissionswerk ‚Die
Sternsinger‘ und vom Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ).
Jährlich können mit den gesammelten Spenden mehr als 1.500 Projekte
für Not leidende Kinder in Afrika, Lateinamerika, Asien, Ozeanien
und Osteuropa unterstützt werden.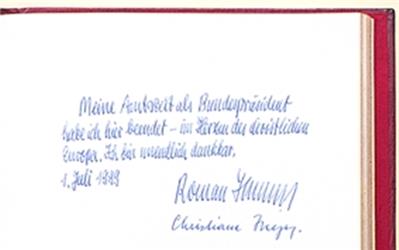

 Gemeinsames Wort der Kirchen in Baden, in
Elsass-Lothringen und in der Pfalz zum Wahljahr 2017
Gemeinsames Wort der Kirchen in Baden, in
Elsass-Lothringen und in der Pfalz zum Wahljahr 2017
 Regionale Sternsingeraussendung mit Weihbischof Georgens
in Landau
Regionale Sternsingeraussendung mit Weihbischof Georgens
in Landau In diesem Jahr fand keine bistumsweite, zentrale
Aussendungsfeier statt. Die Sternsinger werden aber vor Ort in
ihren Pfarreien ausgesendet, Gruppen in und um Landau nutzten die
regionale Veranstaltung dort für eine gemeinsame
Aussendungsfeier.
In diesem Jahr fand keine bistumsweite, zentrale
Aussendungsfeier statt. Die Sternsinger werden aber vor Ort in
ihren Pfarreien ausgesendet, Gruppen in und um Landau nutzten die
regionale Veranstaltung dort für eine gemeinsame
Aussendungsfeier. 






 Pontifikalamt zum Fest Erscheinung des Herrn im Speyerer
Dom – Generalvikar gibt bei Empfang Ausblick unter anderem auf die
Feier des 200-jährigen Jubiläums der Neugründung des
Bistums
Pontifikalamt zum Fest Erscheinung des Herrn im Speyerer
Dom – Generalvikar gibt bei Empfang Ausblick unter anderem auf die
Feier des 200-jährigen Jubiläums der Neugründung des
Bistums Sternsinger
sind in den Pfarreien des Bistums Speyer wieder unterwegs – Rund
3.500 Kinder und Jugendliche engagieren sich in der Pfalz und im
Saarpfalzkreis für die Sternsinger-Aktion
Sternsinger
sind in den Pfarreien des Bistums Speyer wieder unterwegs – Rund
3.500 Kinder und Jugendliche engagieren sich in der Pfalz und im
Saarpfalzkreis für die Sternsinger-Aktion
 Die
Präsentation „Glaubensfeuer“ wird am Abend des Pfingstsonntags (4.
Juni 2017) im Speyerer Dom dreimal in Folge gezeigt, jeweils im
Abstand einer vollen Stunde. Die einzelnen Präsentationen beginnen
um 21 Uhr, um 22 Uhr und um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Die
Präsentation „Glaubensfeuer“ wird am Abend des Pfingstsonntags (4.
Juni 2017) im Speyerer Dom dreimal in Folge gezeigt, jeweils im
Abstand einer vollen Stunde. Die einzelnen Präsentationen beginnen
um 21 Uhr, um 22 Uhr und um 23 Uhr. Der Eintritt ist frei. Bischof Wiesemann predigt zum Jahresabschluss im Speyerer
Dom und ruft dazu auf, sich trotz vieler Unsicherheiten nicht von
Angst lähmen zu lassen
Bischof Wiesemann predigt zum Jahresabschluss im Speyerer
Dom und ruft dazu auf, sich trotz vieler Unsicherheiten nicht von
Angst lähmen zu lassen Als
Gegenbeispiel für mangelndes Vertrauen führte er den Ausspruch "Wir
schaffen das" von Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Dieser Satz
"dient nicht zum Moralappell", erklärte Bischof Wiesemann. Merkels
Satz funktioniere nicht ohne ein tiefes Vertrauen. Dagegen könnten
Gläubige auf Gott bauen, der alles zusammenhalte, so dass die Welt
nicht entgleite. "Gott ist da, der Glaube kann tragen, helfen,
verwandeln, Schicksal in Freiheit wandeln." Jeden Tag feiere die
katholische Kirche mit der Eucharistie eine Wandlung, verdeutlichte
der Bischof. Mit Vertrauen in Gott sollten die Gläubigen den
Jahreswechsel begehen, sagte er und bekräftigte zum Schluss seiner
Predigt: "Gott ist stärker als alle anderen Mächte dieser
Welt."
Als
Gegenbeispiel für mangelndes Vertrauen führte er den Ausspruch "Wir
schaffen das" von Bundeskanzlerin Angela Merkel an. Dieser Satz
"dient nicht zum Moralappell", erklärte Bischof Wiesemann. Merkels
Satz funktioniere nicht ohne ein tiefes Vertrauen. Dagegen könnten
Gläubige auf Gott bauen, der alles zusammenhalte, so dass die Welt
nicht entgleite. "Gott ist da, der Glaube kann tragen, helfen,
verwandeln, Schicksal in Freiheit wandeln." Jeden Tag feiere die
katholische Kirche mit der Eucharistie eine Wandlung, verdeutlichte
der Bischof. Mit Vertrauen in Gott sollten die Gläubigen den
Jahreswechsel begehen, sagte er und bekräftigte zum Schluss seiner
Predigt: "Gott ist stärker als alle anderen Mächte dieser
Welt." Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ruft in seiner
Weihnachtspredigt dazu auf, sich mit allen Opfern sinnloser Gewalt
zu solidarisieren – Erinnerung an die mehr als 5000 Flüchtlinge,
die in diesem Jahr im Mittelmeer umgekommen sind
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann ruft in seiner
Weihnachtspredigt dazu auf, sich mit allen Opfern sinnloser Gewalt
zu solidarisieren – Erinnerung an die mehr als 5000 Flüchtlinge,
die in diesem Jahr im Mittelmeer umgekommen sind wie die
Welt vor Aleppo und den dortigen Gräuel versagt hat“, betonte der
Bischof in Erinnerung an Robert Schumann, der 1950 visionär
gefordert hatte, dass das wirtschaftliche Zusammengehen in Europa
von einem großen Ziel getragen sein müsse, der Hebung des
Lebensstandards in der gesamten Welt und der Förderung des
Friedens. „Das ist nie wirklich eingelöst worden“, stellte
Wiesemann fest. Vieles von solchen Versäumnissen räche sich jetzt.
„Europa war und ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“
wie die
Welt vor Aleppo und den dortigen Gräuel versagt hat“, betonte der
Bischof in Erinnerung an Robert Schumann, der 1950 visionär
gefordert hatte, dass das wirtschaftliche Zusammengehen in Europa
von einem großen Ziel getragen sein müsse, der Hebung des
Lebensstandards in der gesamten Welt und der Förderung des
Friedens. „Das ist nie wirklich eingelöst worden“, stellte
Wiesemann fest. Vieles von solchen Versäumnissen räche sich jetzt.
„Europa war und ist viel zu sehr mit sich selbst beschäftigt.“ Weihnachten 2016 (Hochamt)
Weihnachten 2016 (Hochamt)
 Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Domkustos Peter
Schappert bereiten Altkanzler Kohl und seiner Frau einen warmen
Empfang mit Orgelmusik
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Domkustos Peter
Schappert bereiten Altkanzler Kohl und seiner Frau einen warmen
Empfang mit Orgelmusik




 Neue Beleuchtung für den Dom zu Speyer -
Gotteshaus und UNESCO-Welterbestätte erstrahlt in neuem
Licht
Neue Beleuchtung für den Dom zu Speyer -
Gotteshaus und UNESCO-Welterbestätte erstrahlt in neuem
Licht Zu verdanken sei dies zum einen der finanziellen
Unterstützung durch die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer
und den beiden großzügigen Einzelspendern Isolde
Laukien-Kleiner und Dr. Manfred Fuchs, zum anderen der
Stadt Speyer und ihren Stadtwerken SWS, bei der Präsentation der
neuen Beleuchtungsanlage im „Blauen Salon“ des Bischöflichen
Ordinariats, vertreten durch Oberbürgermeisters Hansjörg
Eger und SWS-Geschäftsführer Wolfgang
Bühring, dem Schappert insbesondere für das gute Einvernehmen
über die Kosten des Unterhalts der Anlage sowie für die
Unterstützung bei der technischen Realisierung des Projekts
dankte.
Zu verdanken sei dies zum einen der finanziellen
Unterstützung durch die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer
und den beiden großzügigen Einzelspendern Isolde
Laukien-Kleiner und Dr. Manfred Fuchs, zum anderen der
Stadt Speyer und ihren Stadtwerken SWS, bei der Präsentation der
neuen Beleuchtungsanlage im „Blauen Salon“ des Bischöflichen
Ordinariats, vertreten durch Oberbürgermeisters Hansjörg
Eger und SWS-Geschäftsführer Wolfgang
Bühring, dem Schappert insbesondere für das gute Einvernehmen
über die Kosten des Unterhalts der Anlage sowie für die
Unterstützung bei der technischen Realisierung des Projekts
dankte. Die Gesamtkosten für Anschaffung und Aufbau der Anlage
lägen bei 380.000 Euro, so der Domkustos weiter. Die Initiative zu
Anschaffung und Aufbau der Anlage sei ein Förderprojekt der
„Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ gewesen, welche die
neue Außenbeleuchtung mit einer Zuwendung in Höhe von 300.000 Euro
ermöglicht habe. Diese Summe setze sich aus zwei Einzelspenden aus
den Reihen der Stifter und aus Stiftungserträgen zusammen. „Das
Domkapitel ist den beiden Spendern, Isolde Laukien-Kleiner und dem
Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Dr. Manfred
Fuchs, für ihre finanzielle Unterstützung zu großem Dank
verpflichtet“, so Domkustos Peter Schappert bei der Vorstellung des
neuen Beleuchtungskonzepts weiter. Die Stadt Speyer schließlich
gewähre für die Maßnahme eine Zuwendung in Höhe von 80.000
Euro.
Die Gesamtkosten für Anschaffung und Aufbau der Anlage
lägen bei 380.000 Euro, so der Domkustos weiter. Die Initiative zu
Anschaffung und Aufbau der Anlage sei ein Förderprojekt der
„Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ gewesen, welche die
neue Außenbeleuchtung mit einer Zuwendung in Höhe von 300.000 Euro
ermöglicht habe. Diese Summe setze sich aus zwei Einzelspenden aus
den Reihen der Stifter und aus Stiftungserträgen zusammen. „Das
Domkapitel ist den beiden Spendern, Isolde Laukien-Kleiner und dem
Vorstandsvorsitzenden der Stiftung, Dr. Manfred
Fuchs, für ihre finanzielle Unterstützung zu großem Dank
verpflichtet“, so Domkustos Peter Schappert bei der Vorstellung des
neuen Beleuchtungskonzepts weiter. Die Stadt Speyer schließlich
gewähre für die Maßnahme eine Zuwendung in Höhe von 80.000
Euro. Mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung der Kathedrale
und „UNESCO-Welterbestätte Dom zu Speyer“ würden zugleich mehrere
Ziele erreicht, so der Geschäftsführer der bauausführender Firma
Bamberger, Diplom-Ingenieur Werner Bamberger in seiner
Vorstellung des Projekts. Zum einen ermögliche es die neue
Beleuchtung, die plastische Wirkung des romanischen Baukörpers
stärker heraus zu arbeiten. Dies werde durch Bodenstrahler und
Flächenleuchten im Außenbereich und innerhalb der Türme erreicht.
Die im Außenbereich positionierten Strahler haben aus Rasterfolien
geschnittene Masken erhalten, so dass der Scheinwurf individuell
auf den jeweiligen Bereich des Doms angepasst ist. „Der Dom erhält
damit eine für ihn maßgeschneiderte Beleuchtung“, so Bamberger. Die
moderne LED-Beleuchtung und die Vernetzung der einzelnen Strahler
ermögliche zum anderen eine dynamische, das heißt
den Nachtzeiten und Lichtverhältnissen angepassten Steuerung
der Beleuchtung. Dies diene dann auch dem dritten Ziel des neuen
Beleuchtungskonzepts: Durch die Erneuerung der in die Jahre
gekommenen technischen Infrastruktur werde die Energieeffizienz
erhöht und damit der Stromverbrauch verringert.
Mit der Erneuerung der Außenbeleuchtung der Kathedrale
und „UNESCO-Welterbestätte Dom zu Speyer“ würden zugleich mehrere
Ziele erreicht, so der Geschäftsführer der bauausführender Firma
Bamberger, Diplom-Ingenieur Werner Bamberger in seiner
Vorstellung des Projekts. Zum einen ermögliche es die neue
Beleuchtung, die plastische Wirkung des romanischen Baukörpers
stärker heraus zu arbeiten. Dies werde durch Bodenstrahler und
Flächenleuchten im Außenbereich und innerhalb der Türme erreicht.
Die im Außenbereich positionierten Strahler haben aus Rasterfolien
geschnittene Masken erhalten, so dass der Scheinwurf individuell
auf den jeweiligen Bereich des Doms angepasst ist. „Der Dom erhält
damit eine für ihn maßgeschneiderte Beleuchtung“, so Bamberger. Die
moderne LED-Beleuchtung und die Vernetzung der einzelnen Strahler
ermögliche zum anderen eine dynamische, das heißt
den Nachtzeiten und Lichtverhältnissen angepassten Steuerung
der Beleuchtung. Dies diene dann auch dem dritten Ziel des neuen
Beleuchtungskonzepts: Durch die Erneuerung der in die Jahre
gekommenen technischen Infrastruktur werde die Energieeffizienz
erhöht und damit der Stromverbrauch verringert. Dank der neuen LED-Lampen liege der Stromverbrauch heute
nur noch bei einem Drittel der vorherigen Energiemenge, obwohl die
Anzahl der Strahler um das Fünffache erhöht worden sei, berichtete
Dombaumeister Mario Coletto. Die neue Beleuchtung solle
damit sowohl dem Gotteshaus als auch dem Denkmal besser gerecht
werden, indem markante Bauteile und theologisch wichtige
Gestaltungselemente wie die Heiligenfiguren über dem Hauptportal
stärker betont werden.
Dank der neuen LED-Lampen liege der Stromverbrauch heute
nur noch bei einem Drittel der vorherigen Energiemenge, obwohl die
Anzahl der Strahler um das Fünffache erhöht worden sei, berichtete
Dombaumeister Mario Coletto. Die neue Beleuchtung solle
damit sowohl dem Gotteshaus als auch dem Denkmal besser gerecht
werden, indem markante Bauteile und theologisch wichtige
Gestaltungselemente wie die Heiligenfiguren über dem Hauptportal
stärker betont werden.
















 Kirchenpräsident besucht Wohngruppe unbegleiteter
Jugendlicher in Pirmasens
Kirchenpräsident besucht Wohngruppe unbegleiteter
Jugendlicher in Pirmasens Mit hoher moralischer Integrität und eigenem Stil
„Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ geprägt
Mit hoher moralischer Integrität und eigenem Stil
„Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ geprägt Dr. Gölter erinnerte sich bei diesem Anlass noch einmal
daran, wie er 2007 bei einer musikalischen Veranstaltung im Dom
zufällig neben Dr. Fuchs zu sitzen kam und diesen dann vorsichtig
anfragte, ob er sich vorstellen könne, die Nachfolge des damals
schon so schwer erkrankten Dr. Theo Spettmann anzutreten,
der zu diesem Zeitpunkt krankheitsbedingt bereits seinen Rückzug
vom Amt des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung angekündigt hatte.
Spontan, und für ihn unerwartet, habe ihm Dr. Fuchs eine Absage mit
der Begründung erteilt, er habe seiner Frau versprochen, kein
Ehrenamt mehr anzunehmen, das ihn zeitlich zu sehr in Anspruch
nehme. Um so überraschter sei er aber dann gewesen, als sich Dr.
Fuchs schon kurz darauf telefonisch bei ihm gemeldet habe, um ihm
mitzuteilen, 'dass ihn seine Frau von diesem Versprechen entbunden
habe' „Damit muss unser erster Dank heute eigentlich Ihnen,
verehrte Frau Fuchs gelten“, so Dr. Gölter, der diesen Dank in ein
prachtvolles Blumengebinde kleidete.
Dr. Gölter erinnerte sich bei diesem Anlass noch einmal
daran, wie er 2007 bei einer musikalischen Veranstaltung im Dom
zufällig neben Dr. Fuchs zu sitzen kam und diesen dann vorsichtig
anfragte, ob er sich vorstellen könne, die Nachfolge des damals
schon so schwer erkrankten Dr. Theo Spettmann anzutreten,
der zu diesem Zeitpunkt krankheitsbedingt bereits seinen Rückzug
vom Amt des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung angekündigt hatte.
Spontan, und für ihn unerwartet, habe ihm Dr. Fuchs eine Absage mit
der Begründung erteilt, er habe seiner Frau versprochen, kein
Ehrenamt mehr anzunehmen, das ihn zeitlich zu sehr in Anspruch
nehme. Um so überraschter sei er aber dann gewesen, als sich Dr.
Fuchs schon kurz darauf telefonisch bei ihm gemeldet habe, um ihm
mitzuteilen, 'dass ihn seine Frau von diesem Versprechen entbunden
habe' „Damit muss unser erster Dank heute eigentlich Ihnen,
verehrte Frau Fuchs gelten“, so Dr. Gölter, der diesen Dank in ein
prachtvolles Blumengebinde kleidete. Der Bischof würdigte Dr. Fuchs damit als eine
Persönlichkeit, welche die wirtschaftlichen Qualitäten eines
hervorragenden Unternehmers ebenso in sich trage, wie hohe
künstlerische Qualitäten: „Da kommen zwei Gehirnhälften zusammen,
was überaus selten ist“, so der Bischof. Daraus erkläre sich
womöglich auch die Faszination, mit der der Speyerer Dom mit seinen
unterschiedlichen Dimensionen – kunsthistorische, historische
ebenso wie politische – Dr. Fuchs erfasst habe und die ihn bis
heute antreibe, mit außergewöhnlichem persönlichen Engagement als
Vorstandsvorsitzender für die Sache des Domes einzutreten. Als
Beispiel für die soziale Gesinnung Dr. Fuchs' nannte der Bischof
die von dem Laureat initiierte Einwerbung von Einzelspenden für die
Einrichtung eines barrierefreien Eingangs-Portals für die
Kathedrale, vor allem aber auch seinen Beitrag zur Erneuerung der
Außenbeleuchtung des Doms. „Ich danke ihnen für all das, was sie
getan haben und wie sie es getan haben“, so Bischof Dr. Wiesemann,
der dem auch noch „eine persönliche Dankbarkeit“ hinzufügen wollte
- „ Dankbarkeit für eine Begegnung, aus der auch ich als Bischof
noch habe lernen können“. Und der Bischof weiter: „Die hohe
moralische Integrität von Herrn Dr. Fuchs hat die Stiftung geprägt
und so einen bleibenden Stil geschaffen“.
Der Bischof würdigte Dr. Fuchs damit als eine
Persönlichkeit, welche die wirtschaftlichen Qualitäten eines
hervorragenden Unternehmers ebenso in sich trage, wie hohe
künstlerische Qualitäten: „Da kommen zwei Gehirnhälften zusammen,
was überaus selten ist“, so der Bischof. Daraus erkläre sich
womöglich auch die Faszination, mit der der Speyerer Dom mit seinen
unterschiedlichen Dimensionen – kunsthistorische, historische
ebenso wie politische – Dr. Fuchs erfasst habe und die ihn bis
heute antreibe, mit außergewöhnlichem persönlichen Engagement als
Vorstandsvorsitzender für die Sache des Domes einzutreten. Als
Beispiel für die soziale Gesinnung Dr. Fuchs' nannte der Bischof
die von dem Laureat initiierte Einwerbung von Einzelspenden für die
Einrichtung eines barrierefreien Eingangs-Portals für die
Kathedrale, vor allem aber auch seinen Beitrag zur Erneuerung der
Außenbeleuchtung des Doms. „Ich danke ihnen für all das, was sie
getan haben und wie sie es getan haben“, so Bischof Dr. Wiesemann,
der dem auch noch „eine persönliche Dankbarkeit“ hinzufügen wollte
- „ Dankbarkeit für eine Begegnung, aus der auch ich als Bischof
noch habe lernen können“. Und der Bischof weiter: „Die hohe
moralische Integrität von Herrn Dr. Fuchs hat die Stiftung geprägt
und so einen bleibenden Stil geschaffen“. Der so Geehrte dankte seinerseits dem Bischof für „seine
berührenden Worte“. „Wir haben mit unserem Dom einen Schatz, dem zu
dienen Spaß macht“, - Dieses Zitat des Bischofs habe er sich zu
Eigen gemacht, so Dr. Fuchs, der versprach, der Kathedrale auch
weiterhin verbunden zu bleiben. Neben dem Bischof bedankte sich der
scheidende Vorstandsvorsitzende, der bei dieser Gelegenheit auch
seines verstorbenen Vorgängers Dr. Theo Spettmann gedachte, auch
bei den „Hausherren des Doms“, Weihbischof und Dompropst Otto
Georgens und Domkustos Peter Schappert für die reibungslose
Zusammenarbeit und fügte, als kleine Episode, die bleibende
Erinnerung an einen Rundgang an, den er unter der Führung von
Domkustos Peter Schappert über die Zwerggalerie gemacht habe.
Der so Geehrte dankte seinerseits dem Bischof für „seine
berührenden Worte“. „Wir haben mit unserem Dom einen Schatz, dem zu
dienen Spaß macht“, - Dieses Zitat des Bischofs habe er sich zu
Eigen gemacht, so Dr. Fuchs, der versprach, der Kathedrale auch
weiterhin verbunden zu bleiben. Neben dem Bischof bedankte sich der
scheidende Vorstandsvorsitzende, der bei dieser Gelegenheit auch
seines verstorbenen Vorgängers Dr. Theo Spettmann gedachte, auch
bei den „Hausherren des Doms“, Weihbischof und Dompropst Otto
Georgens und Domkustos Peter Schappert für die reibungslose
Zusammenarbeit und fügte, als kleine Episode, die bleibende
Erinnerung an einen Rundgang an, den er unter der Führung von
Domkustos Peter Schappert über die Zwerggalerie gemacht habe. Einen besonderen Dank entbot Dr. Fuchs schließlich auch
dem anwesenden Kuratoriumsmitglied, Chefredakteur Michael
Garthe. Mit den Aktionen seiner Zeitung, z.B. der zurzeit
laufenden Aktion „Die Pfalz liest für den Dom“, habe er
Bemerkenswertes für den Dom geleistet. Zuletzt richtete Dr. Fuchs
seinen Dank an seine Kollegen des Vorstandes der Stiftung und an
das Team des Stifterbüros, von denen er zum Abschied eine
Lithographie des Doms aus dem Jahr 1829 entgegennehmen durfte.
Einen besonderen Dank entbot Dr. Fuchs schließlich auch
dem anwesenden Kuratoriumsmitglied, Chefredakteur Michael
Garthe. Mit den Aktionen seiner Zeitung, z.B. der zurzeit
laufenden Aktion „Die Pfalz liest für den Dom“, habe er
Bemerkenswertes für den Dom geleistet. Zuletzt richtete Dr. Fuchs
seinen Dank an seine Kollegen des Vorstandes der Stiftung und an
das Team des Stifterbüros, von denen er zum Abschied eine
Lithographie des Doms aus dem Jahr 1829 entgegennehmen durfte.




















 "Das war ein rundum
gelungener Abend", fasst Katja Stunz, die Theaterleiterin der
Frankenthaler Lux Kinos, nach der Diskussion ihren Eindruck
zusammen. Spontan wurde der Film auch noch in einem zweiten
Kinosaal gezeigt, nachdem der erste Saal ausverkauft war. "Das
Publikum war zufrieden, gerührt und bewegt, gerade auch von dem
anschließenden Gespräch." Beeindruckt hat die Kinofrau, wie
gemischt das Publikum war: "Alt und Jung, Frauen und Männer,
darunter auch viele, die sicher nicht oft ins Kino gehen." Zum
Kinopublikum zählten neben dem Frankenthaler OB Theo Wieder auch
mehrere Seelsorger sowie Firm- und Jugendgruppen.
"Das war ein rundum
gelungener Abend", fasst Katja Stunz, die Theaterleiterin der
Frankenthaler Lux Kinos, nach der Diskussion ihren Eindruck
zusammen. Spontan wurde der Film auch noch in einem zweiten
Kinosaal gezeigt, nachdem der erste Saal ausverkauft war. "Das
Publikum war zufrieden, gerührt und bewegt, gerade auch von dem
anschließenden Gespräch." Beeindruckt hat die Kinofrau, wie
gemischt das Publikum war: "Alt und Jung, Frauen und Männer,
darunter auch viele, die sicher nicht oft ins Kino gehen." Zum
Kinopublikum zählten neben dem Frankenthaler OB Theo Wieder auch
mehrere Seelsorger sowie Firm- und Jugendgruppen. Speyer- Ich freue mich, dass die ersten Gewinner
dieser Wahl die Wähler selbst sind. Die deutliche Erhöhung der
Wahlbeteiligung zeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger durch den
politischen Wettbewerb in der Sache und im fairen Wettstreit der
Kandidatinnen und Kandidaten motivieren lassen, zur Wahl zu
gehen.
Speyer- Ich freue mich, dass die ersten Gewinner
dieser Wahl die Wähler selbst sind. Die deutliche Erhöhung der
Wahlbeteiligung zeigt, dass sich Bürgerinnen und Bürger durch den
politischen Wettbewerb in der Sache und im fairen Wettstreit der
Kandidatinnen und Kandidaten motivieren lassen, zur Wahl zu
gehen.


 27 Lehrer
zum Fach „Evangelische Religion“ bevollmächtigt
27 Lehrer
zum Fach „Evangelische Religion“ bevollmächtigt Die
Politikerin im Interview mit 100 Tage, 100 Menschen
Die
Politikerin im Interview mit 100 Tage, 100 Menschen Speyer- Die Kirche St. Ludwig in Speyer wurde Anfang
Februar profaniert. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat in einem
Profanierungsdekret festgelegt, dass die Kirche ihre Weihe verliert
und auf Dauer einem profanen Gebrauch zugeführt wird. Anfang des
Jahres hatte sich das Bistum Speyer entschieden, das Bistumshaus
und die Kirche St. Ludwig in der Speyerer Innenstadt an das
Mannheimer Unternehmen „Diringer & Scheidel Wohn- und
Gewerbebau GmbH“ zu verkaufen.
Speyer- Die Kirche St. Ludwig in Speyer wurde Anfang
Februar profaniert. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann hat in einem
Profanierungsdekret festgelegt, dass die Kirche ihre Weihe verliert
und auf Dauer einem profanen Gebrauch zugeführt wird. Anfang des
Jahres hatte sich das Bistum Speyer entschieden, das Bistumshaus
und die Kirche St. Ludwig in der Speyerer Innenstadt an das
Mannheimer Unternehmen „Diringer & Scheidel Wohn- und
Gewerbebau GmbH“ zu verkaufen.


 Kirchliche Gerichte befassen sich mit theologischen und
rechtlichen Aspekten
Kirchliche Gerichte befassen sich mit theologischen und
rechtlichen Aspekten Für Kirchenpräsident Christian Schad muss sich in den
Kirchen und Religionsgemeinschaften die Verwurzelung im eigenen
Glauben und die Befähigung zur Toleranz, die den Anderen als
Anderen respektiert, zugleich vollziehen. „Die für das Miteinander
der Religionen notwendige, überzeugte Toleranz entsteht nicht durch
Relativierung oder Zurücknahme der jeweiligen religiösen Identität,
sondern durch Vergewisserung im Eigenen“, sagte Schad. Kirchliche
Kindergärten und der Religionsunterricht gewönnen daher als Orte
der Identitätsbildung und der Begegnung von Menschen
unterschiedlicher religiöser Überzeugungen immer mehr an
Bedeutung.
Für Kirchenpräsident Christian Schad muss sich in den
Kirchen und Religionsgemeinschaften die Verwurzelung im eigenen
Glauben und die Befähigung zur Toleranz, die den Anderen als
Anderen respektiert, zugleich vollziehen. „Die für das Miteinander
der Religionen notwendige, überzeugte Toleranz entsteht nicht durch
Relativierung oder Zurücknahme der jeweiligen religiösen Identität,
sondern durch Vergewisserung im Eigenen“, sagte Schad. Kirchliche
Kindergärten und der Religionsunterricht gewönnen daher als Orte
der Identitätsbildung und der Begegnung von Menschen
unterschiedlicher religiöser Überzeugungen immer mehr an
Bedeutung. Pontifikalamt
mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am Aschermittwoch im Dom zu
Speyer
Pontifikalamt
mit Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann am Aschermittwoch im Dom zu
Speyer Wiesemann stellte heraus, dass die Bußzeit ihre Wurzeln
in der Vorbereitung auf die Taufe hat. Das sei nicht nur für die
Taufbewerber wichtig, sondern für jeden: „Christ-Sein bedeutet auch
immer wieder Christ-Werden“, sich immer wieder neu mit Gott und der
Kirche zu verbinden. In diesen 40 Tagen vor Ostern erneuere sich
die Kirche stets aufs Neue.
Wiesemann stellte heraus, dass die Bußzeit ihre Wurzeln
in der Vorbereitung auf die Taufe hat. Das sei nicht nur für die
Taufbewerber wichtig, sondern für jeden: „Christ-Sein bedeutet auch
immer wieder Christ-Werden“, sich immer wieder neu mit Gott und der
Kirche zu verbinden. In diesen 40 Tagen vor Ostern erneuere sich
die Kirche stets aufs Neue.
 Gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Kreis- und
Stadtverwaltungen
Gute Zusammenarbeit mit den zuständigen Kreis- und
Stadtverwaltungen „Wir haben eine humanitäre Verantwortung für Menschen in
Not. Der Bedarf ist da und deshalb müssen wir tätig werden“, betont
Dr. Klaus Peter-Wresch, Ärztlicher Direktor im Speyerer Sankt
Vincentius Krankenhaus. Im vergangenen Jahr wurden hier 107
Flüchtlinge ambulant und 68 stationär versorgt. Seit der Eröffnung
der Speyerer Erstaufnahmeeinrichtung im Oktober seien die Zahlen
stark angestiegen. Oft handele es sich um Menschen, die hier das
erste Mal überhaupt versorgt werden, schildert der Chefarzt der
Anästhesie. Das Engagement der Einrichtung geht aber weit darüber
hinaus. Noch 2015 haben Mediziner, Pflegende und
Verwaltungsmitarbeiter des Speyerer Krankenhauses eine regelmäßige
medizinische Betreuung der Menschen in der neuen
Erstaufnahmeeinrichtung durch eine mehrmals in der Woche
stattfindende Sprechstunde aufgebaut – ehrenamtlich. Eine richtige
Praxis haben sie organisiert. Inzwischen wurde diese an die
niedergelassenen Mediziner übergeben. Doch das ist noch nicht
alles: Immer wenn neue Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung
ankommen, macht sich ein Team aus dem Vincentius Krankenhaus auf
den Weg. Sie nehmen die Flüchtlinge in Empfang und leisten eine
erste medizinische Untersuchung, sie erfassen akute Erkrankungen,
beraten bei chronischen Krankheiten und überprüfen die Hygiene.
Auch dies geschieht ehrenamtlich und wird durch die Kollegen, die
dann die Dienste übernehmen, und den Träger der Klinik
ermöglicht.
„Wir haben eine humanitäre Verantwortung für Menschen in
Not. Der Bedarf ist da und deshalb müssen wir tätig werden“, betont
Dr. Klaus Peter-Wresch, Ärztlicher Direktor im Speyerer Sankt
Vincentius Krankenhaus. Im vergangenen Jahr wurden hier 107
Flüchtlinge ambulant und 68 stationär versorgt. Seit der Eröffnung
der Speyerer Erstaufnahmeeinrichtung im Oktober seien die Zahlen
stark angestiegen. Oft handele es sich um Menschen, die hier das
erste Mal überhaupt versorgt werden, schildert der Chefarzt der
Anästhesie. Das Engagement der Einrichtung geht aber weit darüber
hinaus. Noch 2015 haben Mediziner, Pflegende und
Verwaltungsmitarbeiter des Speyerer Krankenhauses eine regelmäßige
medizinische Betreuung der Menschen in der neuen
Erstaufnahmeeinrichtung durch eine mehrmals in der Woche
stattfindende Sprechstunde aufgebaut – ehrenamtlich. Eine richtige
Praxis haben sie organisiert. Inzwischen wurde diese an die
niedergelassenen Mediziner übergeben. Doch das ist noch nicht
alles: Immer wenn neue Flüchtlinge in der Erstaufnahmeeinrichtung
ankommen, macht sich ein Team aus dem Vincentius Krankenhaus auf
den Weg. Sie nehmen die Flüchtlinge in Empfang und leisten eine
erste medizinische Untersuchung, sie erfassen akute Erkrankungen,
beraten bei chronischen Krankheiten und überprüfen die Hygiene.
Auch dies geschieht ehrenamtlich und wird durch die Kollegen, die
dann die Dienste übernehmen, und den Träger der Klinik
ermöglicht. Auch die Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie
Dr. med. Cornelia Leszinski ist mit aktiv. „Es
geht darum, dass aus Einzelerkrankungen keine Epidemie wird“,
berichtet sie. Durch engstes Zusammenleben auf der Flucht leiden
viele an Krätze, Läusen oder Durchfallerkrankungen. Aktuell gebe es
sehr viele fieberhafte und schwer Erkrankte. Die Medizinerin ist
aber auch an den Feiertagen vor Ort, wenn die eigentliche
Sprechstunde pausiert. „Die Pause ist sonst einfach zu lang“,
begründet sie den ehrenamtlichen Dienst an Weihnachten und Neujahr.
Die oft rein weiblichen Teams im Einsatz haben noch keine negativen
Erfahrungen gemacht, ist ihr wichtig. Im Gegenteil: „Wir erfahren
sehr sehr viel Dankbarkeit.“
Auch die Chefärztin der Allgemein- und Viszeralchirurgie
Dr. med. Cornelia Leszinski ist mit aktiv. „Es
geht darum, dass aus Einzelerkrankungen keine Epidemie wird“,
berichtet sie. Durch engstes Zusammenleben auf der Flucht leiden
viele an Krätze, Läusen oder Durchfallerkrankungen. Aktuell gebe es
sehr viele fieberhafte und schwer Erkrankte. Die Medizinerin ist
aber auch an den Feiertagen vor Ort, wenn die eigentliche
Sprechstunde pausiert. „Die Pause ist sonst einfach zu lang“,
begründet sie den ehrenamtlichen Dienst an Weihnachten und Neujahr.
Die oft rein weiblichen Teams im Einsatz haben noch keine negativen
Erfahrungen gemacht, ist ihr wichtig. Im Gegenteil: „Wir erfahren
sehr sehr viel Dankbarkeit.“ An den beiden Standorten des Nardini Klinikums St.
Elisabeth in Zweibrücken und St. Johannis in Landstuhl wurden 2015
rund 100 Flüchtlinge stationär und eine Vielzahl in den
Notfallambulanzen behandelt, erklärt Pflegedirektor Thomas Frank,
viele von ihnen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in Kusel und
Zweibrücken. Versorgt wurden Infektionen der Lunge und des
Magen-Darm-Traktes, schlecht heilende und chronische Wunden und
gynäkologische Erkrankungen. Hinzu kam die Versorgung von
Schwangeren, auch drei Kinder wurden geboren. „Die Behandlung von
Flüchtlingen stellte für uns eine große Herausforderung dar. Um uns
möglichst gut vorzubereiten, haben wir im Vorfeld Kontakt zu
Krankenhäusern aufgenommen, die bereits Erfahrungen mit dieser
Versorgungssituation hatten. Auf Grundlage dieser Gespräche haben
wir eine Organisationsrichtlinie mit medizinischen, pflegerischen,
hygienischen und administrativen Aspekten erstellt und diese in
kurzfristig organisierten Schulungen mit unseren Mitarbeitern
besprochen“, so Frank. Wegen der Sprachschwierigkeiten werden unter
anderem durch die Gesellschaft für Armut und Gesundheit in 14
Sprachen entwickelte Anamnesebögen verwendet, mit denen die
Mitarbeiter einen besseren Zugang zu den Menschen finden können.
Auch ein Zeigewörterbuch mache die Verständigung einfacher. Zudem
habe die interne Dolmetscherliste von Mitarbeitern mit besonderen
Sprachkenntnissen sehr geholfen. Vor allem mit den
Hilfsorganisationen, die vor Ort in Zweibrücken und Kusel die
Aufnahmeeinrichtungen koordinieren, und den niedergelassenen Ärzten
gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit, lobt der Pflegedirektor.
An den beiden Standorten des Nardini Klinikums St.
Elisabeth in Zweibrücken und St. Johannis in Landstuhl wurden 2015
rund 100 Flüchtlinge stationär und eine Vielzahl in den
Notfallambulanzen behandelt, erklärt Pflegedirektor Thomas Frank,
viele von ihnen aus den Erstaufnahmeeinrichtungen in Kusel und
Zweibrücken. Versorgt wurden Infektionen der Lunge und des
Magen-Darm-Traktes, schlecht heilende und chronische Wunden und
gynäkologische Erkrankungen. Hinzu kam die Versorgung von
Schwangeren, auch drei Kinder wurden geboren. „Die Behandlung von
Flüchtlingen stellte für uns eine große Herausforderung dar. Um uns
möglichst gut vorzubereiten, haben wir im Vorfeld Kontakt zu
Krankenhäusern aufgenommen, die bereits Erfahrungen mit dieser
Versorgungssituation hatten. Auf Grundlage dieser Gespräche haben
wir eine Organisationsrichtlinie mit medizinischen, pflegerischen,
hygienischen und administrativen Aspekten erstellt und diese in
kurzfristig organisierten Schulungen mit unseren Mitarbeitern
besprochen“, so Frank. Wegen der Sprachschwierigkeiten werden unter
anderem durch die Gesellschaft für Armut und Gesundheit in 14
Sprachen entwickelte Anamnesebögen verwendet, mit denen die
Mitarbeiter einen besseren Zugang zu den Menschen finden können.
Auch ein Zeigewörterbuch mache die Verständigung einfacher. Zudem
habe die interne Dolmetscherliste von Mitarbeitern mit besonderen
Sprachkenntnissen sehr geholfen. Vor allem mit den
Hilfsorganisationen, die vor Ort in Zweibrücken und Kusel die
Aufnahmeeinrichtungen koordinieren, und den niedergelassenen Ärzten
gebe es eine sehr gute Zusammenarbeit, lobt der Pflegedirektor. Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann gratuliert Norbert Thines
zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Kaiserslautern –
Bereits im Dezember Auszeichnung mit Ehrenkreuz der Caritas
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann gratuliert Norbert Thines
zur Verleihung der Ehrenbürgerwürde der Stadt Kaiserslautern –
Bereits im Dezember Auszeichnung mit Ehrenkreuz der Caritas Bistum Speyer überlässt ehemaliges kirchliches Altenheim
kostenfrei für zehn Jahre (plus...) der Stadt Speyer
Bistum Speyer überlässt ehemaliges kirchliches Altenheim
kostenfrei für zehn Jahre (plus...) der Stadt Speyer Bei einem Pressegespräch im „Blauen Salon“ der
Bischöflichen Finanzkammer, an dem neben dem Speyerer
Stadtoberhaupt und Generalvikar Dr. Franz Jung,
dem Leiter der Bistumsverwaltung und „alter Ego“ des Speyerer
Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann auch die verantwortlichen
Domkapitulare Peter Schappert - in der
Bistumsverwaltung zuständig für Finanzen und Immobilien – und
Karl-Ludwig Hundemer, Leiter des
Diözesan-Caritasverbandes, mit ihren Mitarbeitern teilnahmen,
erläuterten die Gesprächspartner das Konzept dieser Maßnahme, mit
der bis zur zweiten Jahreshälfte 2016 mit einem Aufwand von ca. 1,2
Mio. Euro Wohnraum für weitere rund 150 AsylbewerberInnen in Speyer
geschaffen werden solle. Über eine Subventionierung dieser Maßnahme
durch übergeordnete Institutionen auf Bundes- und Landesebene seien
erste Verhandlungen bereits aufgenommen worden.
Bei einem Pressegespräch im „Blauen Salon“ der
Bischöflichen Finanzkammer, an dem neben dem Speyerer
Stadtoberhaupt und Generalvikar Dr. Franz Jung,
dem Leiter der Bistumsverwaltung und „alter Ego“ des Speyerer
Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann auch die verantwortlichen
Domkapitulare Peter Schappert - in der
Bistumsverwaltung zuständig für Finanzen und Immobilien – und
Karl-Ludwig Hundemer, Leiter des
Diözesan-Caritasverbandes, mit ihren Mitarbeitern teilnahmen,
erläuterten die Gesprächspartner das Konzept dieser Maßnahme, mit
der bis zur zweiten Jahreshälfte 2016 mit einem Aufwand von ca. 1,2
Mio. Euro Wohnraum für weitere rund 150 AsylbewerberInnen in Speyer
geschaffen werden solle. Über eine Subventionierung dieser Maßnahme
durch übergeordnete Institutionen auf Bundes- und Landesebene seien
erste Verhandlungen bereits aufgenommen worden. Schließlich solle mit einem Kostenaufwand von rund 125.000
Euro durch die Niederlegung der in den 1960er Jahren errichteten
Kapelle – zuletzt nur noch für Kindergottesdienste und Meßfeiern
der kroatischen Gemeinde der Vorderpfalz genutzt – sowie durch die
Beseitigung einer bestehenden Doppelgarage die Zufahrt für
Rettungsfahrzeuge erleichtert und die Verkehrssicherheit in der von
Kindern und Schülern stark genutzten Engelsgasse erhöht und
zugleich eine völlig neue Eingangssituation für die
Flüchtlingsunterkunft geschaffen werden. Außerdem solle durch den
Einbau einer zweiten Fluchttreppe der Gewährleistung der wachsenden
Bedeutung des Brandschutzes Rechnung getragen werden.
Schließlich solle mit einem Kostenaufwand von rund 125.000
Euro durch die Niederlegung der in den 1960er Jahren errichteten
Kapelle – zuletzt nur noch für Kindergottesdienste und Meßfeiern
der kroatischen Gemeinde der Vorderpfalz genutzt – sowie durch die
Beseitigung einer bestehenden Doppelgarage die Zufahrt für
Rettungsfahrzeuge erleichtert und die Verkehrssicherheit in der von
Kindern und Schülern stark genutzten Engelsgasse erhöht und
zugleich eine völlig neue Eingangssituation für die
Flüchtlingsunterkunft geschaffen werden. Außerdem solle durch den
Einbau einer zweiten Fluchttreppe der Gewährleistung der wachsenden
Bedeutung des Brandschutzes Rechnung getragen werden. Dieser Grundsatz gelte aber fast noch mehr für ein
zweites, derzeit in der Entstehung befindliches Objekt am
Königsplatz, das die Stadt Speyer zur Unterbringung von rund 50
„unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen“ nutzen wolle und das
sie jetzt durch einen langfristigen Mietvertrag habe „sichern“
können. „Denn gerade solche Einrichtungen benötigen eine möglichst
dichte sozialpädagogische Begleitung“, erklärte der Domkapitular
dazu.
Dieser Grundsatz gelte aber fast noch mehr für ein
zweites, derzeit in der Entstehung befindliches Objekt am
Königsplatz, das die Stadt Speyer zur Unterbringung von rund 50
„unbegleiteten minderjährigen Jugendlichen“ nutzen wolle und das
sie jetzt durch einen langfristigen Mietvertrag habe „sichern“
können. „Denn gerade solche Einrichtungen benötigen eine möglichst
dichte sozialpädagogische Begleitung“, erklärte der Domkapitular
dazu. Den Vertretern der Diözese Speyer dankte der
Oberbürgermeister schließlich für ihre „vom ersten Augenblick an
uneingeschränkte Bereitschaft, uns bei dieser gewaltigen
Herausforderung nachhaltig zu unterstützen“. Auch wenn die
Verhandlungen darüber - von außen betrachtet - mitunter durchaus
lang zu sein schienen, so müsse doch bedacht werden, dass viele
Probleme zu lösen gewesen seien, „die keiner von uns noch wenige
Monaten zuvor so auf seinem „Bildschirm“ gehabt hätte“.
Den Vertretern der Diözese Speyer dankte der
Oberbürgermeister schließlich für ihre „vom ersten Augenblick an
uneingeschränkte Bereitschaft, uns bei dieser gewaltigen
Herausforderung nachhaltig zu unterstützen“. Auch wenn die
Verhandlungen darüber - von außen betrachtet - mitunter durchaus
lang zu sein schienen, so müsse doch bedacht werden, dass viele
Probleme zu lösen gewesen seien, „die keiner von uns noch wenige
Monaten zuvor so auf seinem „Bildschirm“ gehabt hätte“.
 Neue Pfarreienstruktur, Flüchtlingshilfe, Finanzstruktur
und „Heiliges Jahr der Barmherzigkeit“- „2016: Jahr vieler
Entscheidungen“
Neue Pfarreienstruktur, Flüchtlingshilfe, Finanzstruktur
und „Heiliges Jahr der Barmherzigkeit“- „2016: Jahr vieler
Entscheidungen“ Die weltweite Zunahme der kriegerischen
Auseinandersetzungen und der politischen Konflikte sowie das immer
weitere Umsichgreifen terroristischer Anschläge mache deutlich,
dass die Welt von einem Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit
sowie von einem verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung
derzeit so weit entfernt sei, wie lange nicht mehr, hob der
Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in
seinem Eingangsstatement hervor. In der Flüchtlingspolitik
polarisiere sich die Gesellschaft derzeit immer stärker. „Damit
aber geht in Teilen unserer Gesellschaft eine Verrohung in der
Kommunikation einher, die erschreckend ist“, so der Speyerer
Oberhirte. Immer öfter schlage dann die verbale in tatsächliche
Gewalt um, etwa wenn Flüchtlingsunterkünfte in Flammen aufgehen
oder, wie in der Silvesternacht in Köln, feierfreudige Passantinnen
zu Opfern sexueller Übergriffe werden. Für den Bischof stellen
diese Entwicklungen die nur Oberfläche einer tiefgreifenden
Verunsicherung und zunehmender Verlustängste in weiten Teilen der
Gesellschaft dar. In dieser Situation gelte es, das
Friedenspotential im Christentum, aber auch in anderen Religionen
neu zu entdecken. „Das Evangelium kann uns lehren, die Scheuklappen
des Egoismus und der Angst abzulegen und in allen Menschen gleich
welcher Nationalität und Herkunft unsere Brüder und Schwester zu
sehen und uns gemeinsam mit ihnen als Kinder des einen Gottes zu
begreifen, so Bischof Dr. Wiesemann.
Die weltweite Zunahme der kriegerischen
Auseinandersetzungen und der politischen Konflikte sowie das immer
weitere Umsichgreifen terroristischer Anschläge mache deutlich,
dass die Welt von einem Zusammenleben in Frieden und Gerechtigkeit
sowie von einem verantwortungsvollen Umgang mit der Schöpfung
derzeit so weit entfernt sei, wie lange nicht mehr, hob der
Speyerer Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann in
seinem Eingangsstatement hervor. In der Flüchtlingspolitik
polarisiere sich die Gesellschaft derzeit immer stärker. „Damit
aber geht in Teilen unserer Gesellschaft eine Verrohung in der
Kommunikation einher, die erschreckend ist“, so der Speyerer
Oberhirte. Immer öfter schlage dann die verbale in tatsächliche
Gewalt um, etwa wenn Flüchtlingsunterkünfte in Flammen aufgehen
oder, wie in der Silvesternacht in Köln, feierfreudige Passantinnen
zu Opfern sexueller Übergriffe werden. Für den Bischof stellen
diese Entwicklungen die nur Oberfläche einer tiefgreifenden
Verunsicherung und zunehmender Verlustängste in weiten Teilen der
Gesellschaft dar. In dieser Situation gelte es, das
Friedenspotential im Christentum, aber auch in anderen Religionen
neu zu entdecken. „Das Evangelium kann uns lehren, die Scheuklappen
des Egoismus und der Angst abzulegen und in allen Menschen gleich
welcher Nationalität und Herkunft unsere Brüder und Schwester zu
sehen und uns gemeinsam mit ihnen als Kinder des einen Gottes zu
begreifen, so Bischof Dr. Wiesemann. Die inhaltlichen Schwerpunkte in der Arbeit des Bistums im
Jahr 2016 erläuterte sodann Generalvikar Dr. Franz
Jung. „Nach den Vorbereitungen der vergangenen sechs Jahre
und dem Abschluss des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“ im
vergangenen Jahr geht es jetzt um die Umsetzung des neuen
Seelsorgekonzeptes“, zeigte er als Linie auf. Die Pfarreien stünden
jetzt vor der Aufgabe, in den neu gewählten Pfarrgremien die
inhaltliche Arbeit aufzunehmen und ein pastorales Konzept für ihre
jeweilige Pfarrei zu entwickeln.
Die inhaltlichen Schwerpunkte in der Arbeit des Bistums im
Jahr 2016 erläuterte sodann Generalvikar Dr. Franz
Jung. „Nach den Vorbereitungen der vergangenen sechs Jahre
und dem Abschluss des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“ im
vergangenen Jahr geht es jetzt um die Umsetzung des neuen
Seelsorgekonzeptes“, zeigte er als Linie auf. Die Pfarreien stünden
jetzt vor der Aufgabe, in den neu gewählten Pfarrgremien die
inhaltliche Arbeit aufzunehmen und ein pastorales Konzept für ihre
jeweilige Pfarrei zu entwickeln. Über den aktuellen Stand der diözesanen Hilfsaktion
„Teile und helfe“ für die Flüchtlinge informierte sodann, der
Vorsitzende des Caritasverbandes für die Diözese Speyer.
Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer. Dabei konnte er
mitteilen, dass der Flüchtlingshilfefonds der Diözese Speyer, der
vom Bistum ursprünglich mit rund 1,5 Millionen Euro ausgestattet
worden war, durch Spenden und Kollekten mittlerweile um weitere
rund 300.000 Euro angewachsen sei. Der Caritasverband richte dazu
derzeit 20 zusätzliche Vollzeitstellen für die Flüchtlingshilfe
ein, unter anderen für die Sozialberatung in den
Landesaufnahmestellen sowie für die Migrationsberatung und die
Ehrenamtskoordination in den acht Caritas-Zentren. „Unsere Kurse
zur Qualifizierung Ehrenamtlicher sind stets stark nachgefragt
immer voll ausgebucht“, berichtete Domkapitular Hundemer.
Über den aktuellen Stand der diözesanen Hilfsaktion
„Teile und helfe“ für die Flüchtlinge informierte sodann, der
Vorsitzende des Caritasverbandes für die Diözese Speyer.
Domkapitular Karl-Ludwig Hundemer. Dabei konnte er
mitteilen, dass der Flüchtlingshilfefonds der Diözese Speyer, der
vom Bistum ursprünglich mit rund 1,5 Millionen Euro ausgestattet
worden war, durch Spenden und Kollekten mittlerweile um weitere
rund 300.000 Euro angewachsen sei. Der Caritasverband richte dazu
derzeit 20 zusätzliche Vollzeitstellen für die Flüchtlingshilfe
ein, unter anderen für die Sozialberatung in den
Landesaufnahmestellen sowie für die Migrationsberatung und die
Ehrenamtskoordination in den acht Caritas-Zentren. „Unsere Kurse
zur Qualifizierung Ehrenamtlicher sind stets stark nachgefragt
immer voll ausgebucht“, berichtete Domkapitular Hundemer. Auf die Angebote des Bistums zum „Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit“ ging schließlich der Leiter der Hauptabteilung
Seelsorge des Bischöflichen, Domkapitular Franz
Vogelgesang, ein. Mit der Aktion „Mission Misericordia“
setze das Bistum Speyer einen Impuls, Türen im privaten,
öffentlichen oder kirchlichen Raum mit einem eigens für die Aktion
entwickelten Aufkleber zu bekleben und damit deutlich zu machen:
„Tritt ein, ich bin da für Dich!“. Im Speyerer Dom lade zudem ein
„Weg der Barmherzigkeit“ die Besucherinnen und Besucher dazu ein,
sich eingehender mit der Barmherzigkeit Gottes zu befassen. Deshalb
werde auch das Domweihefest 2016 am 2. Oktober seine besondere
Prägung durch das Heilige Jahr erfahren.
Auf die Angebote des Bistums zum „Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit“ ging schließlich der Leiter der Hauptabteilung
Seelsorge des Bischöflichen, Domkapitular Franz
Vogelgesang, ein. Mit der Aktion „Mission Misericordia“
setze das Bistum Speyer einen Impuls, Türen im privaten,
öffentlichen oder kirchlichen Raum mit einem eigens für die Aktion
entwickelten Aufkleber zu bekleben und damit deutlich zu machen:
„Tritt ein, ich bin da für Dich!“. Im Speyerer Dom lade zudem ein
„Weg der Barmherzigkeit“ die Besucherinnen und Besucher dazu ein,
sich eingehender mit der Barmherzigkeit Gottes zu befassen. Deshalb
werde auch das Domweihefest 2016 am 2. Oktober seine besondere
Prägung durch das Heilige Jahr erfahren. „Das Bistum Speyer befindet sich weiterhin auf
Konsolidierungskurs. Die gute konjunkturelle Entwicklung in
Deutschland hilft uns dabei, so dass wir für das Jahr 2016 ein
leicht positives Ergebnis erwarten“. So fasste der Leiter der
Hauptabteilung Finanzen und Immobilien des Bischöflichen
Ordinariats, Domkapitular Peter Schappert, die
aktuelle wirtschaftliche Lage des Bistums zusammen. Das Bistum
plane deshalb für das Jahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von rund 150
Millionen Euro, wobei sich die erwartete Kirchensteuer auf rund 128
Millionen Euro belaufe. Hauptursache für diese positive
Entwicklung, so Domkapitular Schappert, sei das sogenannte
Clearing-Verfahren, durch das dem Haushalt der Diözese mit
zeitlichem Verzug Erstattungen von bereits abgeführten
Kirchensteuereinnahmen zufließen, die sich im laufenden
Haushaltsjahr auf 13,6 Mio. Euro belaufen, während die
tatsächlichen Kirchensteuermehreinnahmen nur um 2,18 Prozent
ansteigen würden.
„Das Bistum Speyer befindet sich weiterhin auf
Konsolidierungskurs. Die gute konjunkturelle Entwicklung in
Deutschland hilft uns dabei, so dass wir für das Jahr 2016 ein
leicht positives Ergebnis erwarten“. So fasste der Leiter der
Hauptabteilung Finanzen und Immobilien des Bischöflichen
Ordinariats, Domkapitular Peter Schappert, die
aktuelle wirtschaftliche Lage des Bistums zusammen. Das Bistum
plane deshalb für das Jahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von rund 150
Millionen Euro, wobei sich die erwartete Kirchensteuer auf rund 128
Millionen Euro belaufe. Hauptursache für diese positive
Entwicklung, so Domkapitular Schappert, sei das sogenannte
Clearing-Verfahren, durch das dem Haushalt der Diözese mit
zeitlichem Verzug Erstattungen von bereits abgeführten
Kirchensteuereinnahmen zufließen, die sich im laufenden
Haushaltsjahr auf 13,6 Mio. Euro belaufen, während die
tatsächlichen Kirchensteuermehreinnahmen nur um 2,18 Prozent
ansteigen würden. Beim Haushalt für den Bischöflichen Stuhl erwartet
Finanzdirektorin Tatjana
Mast aufgrund der derzeit extrem niedrigen Zinssätze
einen Rückgang der Erträge.
Beim Haushalt für den Bischöflichen Stuhl erwartet
Finanzdirektorin Tatjana
Mast aufgrund der derzeit extrem niedrigen Zinssätze
einen Rückgang der Erträge. Fast schon nach Abschluß des eigentlichen Pressegesprächs
ergriff dann Bischof Sr. Wiesemann noch einmal das Wort, um seinem
„Finanzchef“, Domkapitular Peter Schappert und seinen
MitarbeiterInnen seinen ausdrücklichen Dank und sein
uneingeschränktes Vertrauen auszusprechen. Als er vor acht Jahren,
von außen nach Speyer kommend, hier das Amt des Bischofs übernommen
habe, sei er auf eine finanzielle „prekäre Situation“ gestoßen, die
durch die öffentliche Diskussion über die Finanzen anderer großer
Einrichtungen wie die im Bistum Limburg noch zusätzlich verschärft
worden sei.
Fast schon nach Abschluß des eigentlichen Pressegesprächs
ergriff dann Bischof Sr. Wiesemann noch einmal das Wort, um seinem
„Finanzchef“, Domkapitular Peter Schappert und seinen
MitarbeiterInnen seinen ausdrücklichen Dank und sein
uneingeschränktes Vertrauen auszusprechen. Als er vor acht Jahren,
von außen nach Speyer kommend, hier das Amt des Bischofs übernommen
habe, sei er auf eine finanzielle „prekäre Situation“ gestoßen, die
durch die öffentliche Diskussion über die Finanzen anderer großer
Einrichtungen wie die im Bistum Limburg noch zusätzlich verschärft
worden sei. Nordwestturm der
Kathedrale wird saniert
Nordwestturm der
Kathedrale wird saniert Zu den
substanzerhaltenden Maßnahmen gehören weiter: eine Kontrolle des
Turmhelms und eine Erneuerung des Taubenschutzes. Im Turminnern
wird die Elektrik erneuert. Die Holztreppe wird überprüft und
soweit überarbeitet, dass sie den aktuellen Sicherheitsbestimmungen
genügt. Diese dient allerdings ausschließlich Revisionszwecken,
betont Dombaumeister Colletto. Die Treppe im gegenüberliegenden
Südwestturm, die für den Besucherbetrieb eingerichtet wurde, musste
weitaus höheren Sicherheitsanforderungen genügen.
Zu den
substanzerhaltenden Maßnahmen gehören weiter: eine Kontrolle des
Turmhelms und eine Erneuerung des Taubenschutzes. Im Turminnern
wird die Elektrik erneuert. Die Holztreppe wird überprüft und
soweit überarbeitet, dass sie den aktuellen Sicherheitsbestimmungen
genügt. Diese dient allerdings ausschließlich Revisionszwecken,
betont Dombaumeister Colletto. Die Treppe im gegenüberliegenden
Südwestturm, die für den Besucherbetrieb eingerichtet wurde, musste
weitaus höheren Sicherheitsanforderungen genügen.
 Amtseinführung von Pfarrerin Anne Henning und
Gemeindereferent Patrick Stöbener
Amtseinführung von Pfarrerin Anne Henning und
Gemeindereferent Patrick Stöbener Bistum
entscheidet sich für „Diringer & Scheidel“ als Investor
Bistum
entscheidet sich für „Diringer & Scheidel“ als Investor Aus Sicht des Bistums
Speyer überzeugte an dem Konzept von „Diringer & Scheidel“ vor
allem, dass ältere Menschen die Möglichkeit erhalten, weiterhin im
Zentrum der Stadt Speyer zu wohnen und damit kurze Wege zu
Geschäften und Veranstaltungen haben. Die Teilhabe älterer Menschen
am Leben in der Stadt wird dadurch deutlich verbessert. Der Bedarf
an barrierefreien und altersgerechten Wohnungen in der Speyerer
Innenstadt war mehrfach festgestellt worden. Positiv wurde die
gelungene Einbindung des ehemaligen Kreuzgangs im Innenhof als
architektonischer Hinweis auf die kirchliche Tradition des Ortes
bewertet. Der Erhalt der Optik der Außenfassaden und die
durchgängig dreigeschossige Bauweise sorgen aus Sicht des Bistums
für ein stimmiges Gesamtbild und fügen das Gebäude harmonisch in
das bauliche Umfeld ein. Weitere Pluspunkte wurden in der
Wiederherstellung des früheren Haupteingangs zur Großen
Greifengasse sowie in der Schaffung eines Durchgangs für Fußgänger
von der Korngasse über das Wormser Gässchen hin zur Johannesstraße
und zur Großen Greifengasse gesehen. Geplant ist, dass der Investor
das Projekt demnächst im Bauausschuss und im Stadtrat vorstellen
wird. Text und Foto: is
Aus Sicht des Bistums
Speyer überzeugte an dem Konzept von „Diringer & Scheidel“ vor
allem, dass ältere Menschen die Möglichkeit erhalten, weiterhin im
Zentrum der Stadt Speyer zu wohnen und damit kurze Wege zu
Geschäften und Veranstaltungen haben. Die Teilhabe älterer Menschen
am Leben in der Stadt wird dadurch deutlich verbessert. Der Bedarf
an barrierefreien und altersgerechten Wohnungen in der Speyerer
Innenstadt war mehrfach festgestellt worden. Positiv wurde die
gelungene Einbindung des ehemaligen Kreuzgangs im Innenhof als
architektonischer Hinweis auf die kirchliche Tradition des Ortes
bewertet. Der Erhalt der Optik der Außenfassaden und die
durchgängig dreigeschossige Bauweise sorgen aus Sicht des Bistums
für ein stimmiges Gesamtbild und fügen das Gebäude harmonisch in
das bauliche Umfeld ein. Weitere Pluspunkte wurden in der
Wiederherstellung des früheren Haupteingangs zur Großen
Greifengasse sowie in der Schaffung eines Durchgangs für Fußgänger
von der Korngasse über das Wormser Gässchen hin zur Johannesstraße
und zur Großen Greifengasse gesehen. Geplant ist, dass der Investor
das Projekt demnächst im Bauausschuss und im Stadtrat vorstellen
wird. Text und Foto: is Eine Woche lang informieren sich über 400 Schülerinnen und
Schüler aus 14 Schulen über „ihre Diözese“
Eine Woche lang informieren sich über 400 Schülerinnen und
Schüler aus 14 Schulen über „ihre Diözese“ Auf großes Interesse stieß der zum ersten Mal angebotene
Workshop zur Frage „Wie ist ein gutes Leben für alle Menschen auf
der Welt möglich?“ unter der Leitung von Christoph Fuhrbach,
Referent für Weltkirche. Neben einer kurzen Darstellung von
Informationen und Fakten zum Verbrauch von Ressourcen auf der Erde,
ging es dabei vor allem um Ideen, was jeder einzelne tun kann, um
seinen Lebensstil nachhaltig zu verändern und den ökologischen und
sozialen Fußabdruck zu verringern. Konzentriert und engagiert
trugen die Schülerinnen und Schüler Vorschläge zusammen – von der
verstärkten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, der
Müllvermeidung, dem Energie sparen oder dem Kauf regionaler und
fairer Produkte bis zum Konsumverzicht. „Es war sehr interessant
die Fakten zu hören und der Workshop hat das Bewusstsein dafür
gestärkt, dass jeder etwas zur Veränderung beitragen kann“,
bewertete die 17-jährige Jennifer, Schülerin des Edith-Stein
Gymnasiums, das Angebot und auch ihre 18-jährigen Mitschülerin
Karla fand die vielen Ideen „was man konkret machen kann“ gut. Dem
stimmte auch Till, 17 Jahre und Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums
zu: „Der Workshop hat gezeigt, dass man ein paar Dinge umsetzen
kann und dass wir nicht einfach so weiterleben können wie bisher.“
Auf großes Interesse stieß der zum ersten Mal angebotene
Workshop zur Frage „Wie ist ein gutes Leben für alle Menschen auf
der Welt möglich?“ unter der Leitung von Christoph Fuhrbach,
Referent für Weltkirche. Neben einer kurzen Darstellung von
Informationen und Fakten zum Verbrauch von Ressourcen auf der Erde,
ging es dabei vor allem um Ideen, was jeder einzelne tun kann, um
seinen Lebensstil nachhaltig zu verändern und den ökologischen und
sozialen Fußabdruck zu verringern. Konzentriert und engagiert
trugen die Schülerinnen und Schüler Vorschläge zusammen – von der
verstärkten Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs, der
Müllvermeidung, dem Energie sparen oder dem Kauf regionaler und
fairer Produkte bis zum Konsumverzicht. „Es war sehr interessant
die Fakten zu hören und der Workshop hat das Bewusstsein dafür
gestärkt, dass jeder etwas zur Veränderung beitragen kann“,
bewertete die 17-jährige Jennifer, Schülerin des Edith-Stein
Gymnasiums, das Angebot und auch ihre 18-jährigen Mitschülerin
Karla fand die vielen Ideen „was man konkret machen kann“ gut. Dem
stimmte auch Till, 17 Jahre und Schüler des Carl-Bosch-Gymnasiums
zu: „Der Workshop hat gezeigt, dass man ein paar Dinge umsetzen
kann und dass wir nicht einfach so weiterleben können wie bisher.“
 Zum Abschluss des Tages stellte sich Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der Jugendlichen und stand ihnen
auch zu kontroversen Themen wie die Haltung der Kirche zur
Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder zum
Thema Scheidung und Priesteramt für Frauen in der katholischen
Kirche Rede und Antwort. „Es gibt keinen anderen Weg, als wieder
mehr über unseren Glauben zu reden“, ermunterte der Bischof die
Schülerinnen und Schüler bei der Frage, wie man der Entwicklung
gegensteuern könne, dass immer mehr Menschen die Kirche verlassen.
„Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir zeigen, dass der Glaube für
das Leben eine positive Qualität hat.“ Und zur Frage, wie man
Menschen begegnen kann, die eine schwere Schuld auf sich geladen
haben, gab Bischof Wiesemann am Ende des Gesprächs den Jugendlichen
mit auf den Weg: „Barmherzigkeit bedeutet die grundlegende
Bereitschaft, dem Menschen eine zweite Chance zu geben.“
Zum Abschluss des Tages stellte sich Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der Jugendlichen und stand ihnen
auch zu kontroversen Themen wie die Haltung der Kirche zur
Homosexualität und gleichgeschlechtlichen Partnerschaften oder zum
Thema Scheidung und Priesteramt für Frauen in der katholischen
Kirche Rede und Antwort. „Es gibt keinen anderen Weg, als wieder
mehr über unseren Glauben zu reden“, ermunterte der Bischof die
Schülerinnen und Schüler bei der Frage, wie man der Entwicklung
gegensteuern könne, dass immer mehr Menschen die Kirche verlassen.
„Unsere Aufgabe besteht darin, dass wir zeigen, dass der Glaube für
das Leben eine positive Qualität hat.“ Und zur Frage, wie man
Menschen begegnen kann, die eine schwere Schuld auf sich geladen
haben, gab Bischof Wiesemann am Ende des Gesprächs den Jugendlichen
mit auf den Weg: „Barmherzigkeit bedeutet die grundlegende
Bereitschaft, dem Menschen eine zweite Chance zu geben.“ Gründung der neuen Dompfarrei „Pax Christi“ will „Orte der
Ruhe“ schaffen
Gründung der neuen Dompfarrei „Pax Christi“ will „Orte der
Ruhe“ schaffen  Grund genug, dass der zukünftige Leiter der neuen
Großpfarrei, Dompfarrer und Domkapitular Matthias
Bender neben den in großer Zahl aus allen bisherigen
Speyerer Kirchengemeinden zusammengekommenen Pfarrkindern auch
zahlreiche Ehrengäste in der doppeltürmigen Kirche in der
Gilgenstraße begrüßen konnte, an ihrer Spitze
Oberbürgermeister Hansjörg Eger,
Bürgermeisterin Monika Kabs sowie als Vertreter
der Evangelischen Christen in der Stadt, Dekan Markus
Jäckle. Im Verlaufe des Gottesdienstes ließ es sich dann
auch der emeritierte Speyerer Bischof Dr. Anton
Schlembach nicht nehmen, aus seinem Altersruhesitz im
benachbarten St. Marthaheim in die „St. Josephs-Kirche“
herüberzukommen.
Grund genug, dass der zukünftige Leiter der neuen
Großpfarrei, Dompfarrer und Domkapitular Matthias
Bender neben den in großer Zahl aus allen bisherigen
Speyerer Kirchengemeinden zusammengekommenen Pfarrkindern auch
zahlreiche Ehrengäste in der doppeltürmigen Kirche in der
Gilgenstraße begrüßen konnte, an ihrer Spitze
Oberbürgermeister Hansjörg Eger,
Bürgermeisterin Monika Kabs sowie als Vertreter
der Evangelischen Christen in der Stadt, Dekan Markus
Jäckle. Im Verlaufe des Gottesdienstes ließ es sich dann
auch der emeritierte Speyerer Bischof Dr. Anton
Schlembach nicht nehmen, aus seinem Altersruhesitz im
benachbarten St. Marthaheim in die „St. Josephs-Kirche“
herüberzukommen.  Denn Jesus selbst stelle sich an diesem Tag in die Mitte
der Gläubigen und zugleich in die Reihe all jener, die wüssten,
dass sich auch in unserem Leben etwas ändern müsse. „Denn wir
Christen können nicht allein gut zueinander sein und Gutes
füreinander tun, sondern wir können ebenso auch furchtbare Kriege
gegeneinander führen und Menschen in die Flucht treiben - ganz so,
wie wir es gerade in diesen Wochen in vielen Regionen der Welt
erleben müssen“, so der Geistliche.
Denn Jesus selbst stelle sich an diesem Tag in die Mitte
der Gläubigen und zugleich in die Reihe all jener, die wüssten,
dass sich auch in unserem Leben etwas ändern müsse. „Denn wir
Christen können nicht allein gut zueinander sein und Gutes
füreinander tun, sondern wir können ebenso auch furchtbare Kriege
gegeneinander führen und Menschen in die Flucht treiben - ganz so,
wie wir es gerade in diesen Wochen in vielen Regionen der Welt
erleben müssen“, so der Geistliche.  Nein, das Geheimnis von Kirche sei auch heute Jesus
selbst, unterstrich der Dompfarrer, der daran erinnerte, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg in der neu errichteten Friedenskirche St.
Bernhard als erstes eine „Pax-Christi-Kapelle“ errichtet worden
sei, die der Förderung der Freundschaft und des Friedens zwischen
Deutschen und Franzosen, danach auch dem Frieden mit Polen und
inzwischen durch das „Interreligiöse Forum“ der Überwindung aller
religiösen und ethnischen Grenzen dienen solle. Dazu aber sei es
nicht nur notwendig, um Frieden in der Welt bemüht zu sein – zuvor
müsse „Friede in unsere Herzen herrschen“, so Pfarrer
Bender.
Nein, das Geheimnis von Kirche sei auch heute Jesus
selbst, unterstrich der Dompfarrer, der daran erinnerte, dass nach
dem Zweiten Weltkrieg in der neu errichteten Friedenskirche St.
Bernhard als erstes eine „Pax-Christi-Kapelle“ errichtet worden
sei, die der Förderung der Freundschaft und des Friedens zwischen
Deutschen und Franzosen, danach auch dem Frieden mit Polen und
inzwischen durch das „Interreligiöse Forum“ der Überwindung aller
religiösen und ethnischen Grenzen dienen solle. Dazu aber sei es
nicht nur notwendig, um Frieden in der Welt bemüht zu sein – zuvor
müsse „Friede in unsere Herzen herrschen“, so Pfarrer
Bender.  kommen und „Frieden in ihrem Herzen“ finden könnten. „Pax
Christi“ meine deshalb auch „Friede mit Gott“, so der Dompfarrer.
Diesen Frieden aber könnten sich die Menschen nur gegenseitig
schenken, so wie einst die Engel bei der Geburt Christi den Frieden
verkündeten. „Machen wir uns also mutig an diese Aufgabe“, rief der
Pfarrer der neuen Gemeinde „Pax Christi“ seinen Gemeindemitgliedern
zu - „der Himmel ist weit geöffnet – der Friede mit Gott ist da! -
Möge dieser Friede Christi der ganzen Stadt Speyer und der Welt
auch weiterhin zum Heil gedeihen!“.
kommen und „Frieden in ihrem Herzen“ finden könnten. „Pax
Christi“ meine deshalb auch „Friede mit Gott“, so der Dompfarrer.
Diesen Frieden aber könnten sich die Menschen nur gegenseitig
schenken, so wie einst die Engel bei der Geburt Christi den Frieden
verkündeten. „Machen wir uns also mutig an diese Aufgabe“, rief der
Pfarrer der neuen Gemeinde „Pax Christi“ seinen Gemeindemitgliedern
zu - „der Himmel ist weit geöffnet – der Friede mit Gott ist da! -
Möge dieser Friede Christi der ganzen Stadt Speyer und der Welt
auch weiterhin zum Heil gedeihen!“.  Speyerer Katholiken starten als Stadtpfarrei „Pax Christi“
neuen gemeinsamen Glaubensweg
Speyerer Katholiken starten als Stadtpfarrei „Pax Christi“
neuen gemeinsamen Glaubensweg Bei einem Pressegespräch im Gemeindezentrum „Ägidienhaus“
im Schatten der Kirche St. Joseph erläuterte jetzt der Leiter der
neu gegründeten Pfarrei „Pax Christi“ zu Speyer, Dompfarrer
und Domkapitular Matthias Bender, gemeinsam mit seinem
Stellvertreter in der Leitung der neuen Pfarrei und Trägervertreter
der katholischen Kindertageseinrichtungen, Diakon Paul
Nowicki, sowie zusammen mit dem Vorsitzenden
des gerade erst neu gewählten Pfarreirates,
Bernhard Kaas, und dem stellvertretenden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Hubert Kapp, die sich
aus dieser Umstrukturierung ergebenden Neuerungen: Dazu nannte er
vor allem das neu gegründete Pastoralteam aus sieben hauptamtlichen
theologischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - zunächst noch
unterstützt durch die emeritierten Priester Pfarrer Bernhard
Linvers, Pfarrer Wetzel und Pfarrer Sonntag, denen künftig ein in
den bisherigen Räumen des Dompfarramtes am Edith-Stein-Platz 6
untergebrachtes zentrales Pfarrbüro unterstützend zur Seite stehen
wird. Doch auch an den Standorten der bisherigen fünf
Pfarrgemeinden werden auch zukünftig zeitweise geöffnete Pfarrbüros
bestehen bleiben, um so zumindest ansatzweise die bisherigen
Verwaltungs- und Betreuungsstrukturen aufrecht zu
erhalten.
Bei einem Pressegespräch im Gemeindezentrum „Ägidienhaus“
im Schatten der Kirche St. Joseph erläuterte jetzt der Leiter der
neu gegründeten Pfarrei „Pax Christi“ zu Speyer, Dompfarrer
und Domkapitular Matthias Bender, gemeinsam mit seinem
Stellvertreter in der Leitung der neuen Pfarrei und Trägervertreter
der katholischen Kindertageseinrichtungen, Diakon Paul
Nowicki, sowie zusammen mit dem Vorsitzenden
des gerade erst neu gewählten Pfarreirates,
Bernhard Kaas, und dem stellvertretenden
Vorsitzenden des Verwaltungsrates, Hubert Kapp, die sich
aus dieser Umstrukturierung ergebenden Neuerungen: Dazu nannte er
vor allem das neu gegründete Pastoralteam aus sieben hauptamtlichen
theologischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern - zunächst noch
unterstützt durch die emeritierten Priester Pfarrer Bernhard
Linvers, Pfarrer Wetzel und Pfarrer Sonntag, denen künftig ein in
den bisherigen Räumen des Dompfarramtes am Edith-Stein-Platz 6
untergebrachtes zentrales Pfarrbüro unterstützend zur Seite stehen
wird. Doch auch an den Standorten der bisherigen fünf
Pfarrgemeinden werden auch zukünftig zeitweise geöffnete Pfarrbüros
bestehen bleiben, um so zumindest ansatzweise die bisherigen
Verwaltungs- und Betreuungsstrukturen aufrecht zu
erhalten.  Für die Gemeindemitglieder auch künftig besonders wichtig:
Die Gottesdienstordnung der neuen Pfarrei „Pax Christi“ mit ihren
regelmäßig zu versorgenden fünf Kirchen. Neben den regelmäßigen
Gottesdiensten im Speyerer Dom wird es deshalb auch in St. Joseph
an den Wochenenden „verlässliche Gottesdienste“ geben, so
Dompfarrer Bender. Daneben werden aber auch in den Kirchen St.
Konrad und St. Hedwig nach einem Terminplan, der sich von den
Beginnzeiten her in den kommenden zwei Jahren anhand der
Bedürfnisse und Wünsche der Gläubigen noch klarer strukturieren
muss, Sonntagsgottesdienste abgehalten. Lediglich bei St. Otto
steht schon heute fest: Hier sollen die bewährten und beliebten
Vorabend-Gottesdienste auch weiterhin fester Bestandteil der
allwöchentlichen Agenda sein. Eine ganz besondere Funktion
schließlich soll künftig der Kirche St. Hedwig zukommen: Hier
sollen nämlich neue Gottesdienstformen erprobt und auf ihre
Umsetzbarkeit im Alltag hin „getestet“ werden.
Für die Gemeindemitglieder auch künftig besonders wichtig:
Die Gottesdienstordnung der neuen Pfarrei „Pax Christi“ mit ihren
regelmäßig zu versorgenden fünf Kirchen. Neben den regelmäßigen
Gottesdiensten im Speyerer Dom wird es deshalb auch in St. Joseph
an den Wochenenden „verlässliche Gottesdienste“ geben, so
Dompfarrer Bender. Daneben werden aber auch in den Kirchen St.
Konrad und St. Hedwig nach einem Terminplan, der sich von den
Beginnzeiten her in den kommenden zwei Jahren anhand der
Bedürfnisse und Wünsche der Gläubigen noch klarer strukturieren
muss, Sonntagsgottesdienste abgehalten. Lediglich bei St. Otto
steht schon heute fest: Hier sollen die bewährten und beliebten
Vorabend-Gottesdienste auch weiterhin fester Bestandteil der
allwöchentlichen Agenda sein. Eine ganz besondere Funktion
schließlich soll künftig der Kirche St. Hedwig zukommen: Hier
sollen nämlich neue Gottesdienstformen erprobt und auf ihre
Umsetzbarkeit im Alltag hin „getestet“ werden.  Um hier möglichst rasch mehr Klarheit zu erlangen, wollen
sich am letzten Wochenende im Januar die neu gewählten Pfarreiräte
zu einer Klausur-Tagung in „Maria Rosenberg“ treffen, um diese und
andere noch offene Fragen zu besprechen.
Um hier möglichst rasch mehr Klarheit zu erlangen, wollen
sich am letzten Wochenende im Januar die neu gewählten Pfarreiräte
zu einer Klausur-Tagung in „Maria Rosenberg“ treffen, um diese und
andere noch offene Fragen zu besprechen.
 Die Fürbitten galten der Diözese, der Kirche und der
Welt. Die Gebete bezogen sich sowohl auf die, die neu in die
katholische Gemeinschaft aufgenommen wurden, als auch jene, die die
Verbindung zur Kirche gelöst haben. Sie richteten sich auf den
Glauben, die Hoffnung und Liebe, galten einsamen, verbitterten und
vereinsamten, versehrten Menschen, Verstorbenen sowie Politikern,
verbunden mit der Hoffnung, dass die Verantwortlichen Einsicht und
Tatkraft erlangen, damit alle in Frieden und Freiheit leben können.
Sie richteten sich an Gott mit der Bitte um Schutz, Einsicht und
den Mut zur Veränderung.
Die Fürbitten galten der Diözese, der Kirche und der
Welt. Die Gebete bezogen sich sowohl auf die, die neu in die
katholische Gemeinschaft aufgenommen wurden, als auch jene, die die
Verbindung zur Kirche gelöst haben. Sie richteten sich auf den
Glauben, die Hoffnung und Liebe, galten einsamen, verbitterten und
vereinsamten, versehrten Menschen, Verstorbenen sowie Politikern,
verbunden mit der Hoffnung, dass die Verantwortlichen Einsicht und
Tatkraft erlangen, damit alle in Frieden und Freiheit leben können.
Sie richteten sich an Gott mit der Bitte um Schutz, Einsicht und
den Mut zur Veränderung. Ort der Ruhe
und Stille in der Innenstadt
Ort der Ruhe
und Stille in der Innenstadt Diesem Investor möchte die aus vielen Katholiken und auch
einigen Protestanten bestehenden St.Ludwig-Initiativgruppe
ihr Konzept unterbreiten. „Das kennt er wahrscheinlich gar
nicht“, meint Pfarrer Linvers und weist darauf hin, dass sehr
viele Speyerer den geplanten Verkauf nicht verstehen und ihr
Veto auch mit über 1600 Unterschriften bekundet hatten.
Linvers und die anderen Mitglieder der Führungsgruppe werden
nichts unversucht lassen, um die weitere Nutzung der
Innenstadt-Kirche für Trauungen, Taufen und Bestattungen zu
ermöglichen. Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident
Christian Schad könnten den von ihnen erarbeiteten
„Ökumenischen Leitfaden“ auf diese Weise gemeinsam
wirkungsvoll mit Taten füllen und dieser Kasualien-Kirche ihren
Segen geben.
Diesem Investor möchte die aus vielen Katholiken und auch
einigen Protestanten bestehenden St.Ludwig-Initiativgruppe
ihr Konzept unterbreiten. „Das kennt er wahrscheinlich gar
nicht“, meint Pfarrer Linvers und weist darauf hin, dass sehr
viele Speyerer den geplanten Verkauf nicht verstehen und ihr
Veto auch mit über 1600 Unterschriften bekundet hatten.
Linvers und die anderen Mitglieder der Führungsgruppe werden
nichts unversucht lassen, um die weitere Nutzung der
Innenstadt-Kirche für Trauungen, Taufen und Bestattungen zu
ermöglichen. Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Kirchenpräsident
Christian Schad könnten den von ihnen erarbeiteten
„Ökumenischen Leitfaden“ auf diese Weise gemeinsam
wirkungsvoll mit Taten füllen und dieser Kasualien-Kirche ihren
Segen geben.  Bischof Wiesemann nimmt in seiner Weihnachtspredigt
Bezug auf die Terroranschläge in Paris und die weltweit 60
Millionen Flüchtlinge
Bischof Wiesemann nimmt in seiner Weihnachtspredigt
Bezug auf die Terroranschläge in Paris und die weltweit 60
Millionen Flüchtlinge cr. Speyer. Fast an jedem Tag, so auch heute
wieder, gehen Nachrichten durch die Agenturen, dass deutsche
Soldaten im Rahmen der Operation „Sophia“ Flüchtlinge vor dem
qualvollen Ertrinken im Mittelmeer bewahren. Der Speyerer
Militärpfarrer Ulrich Kronenberg, zu dessen
Verantwortungsbereich neben den „Resten“ des
„Spezialpionierbataillons 464“ in der Speyerer Kurpfalzkaserne auch
die Garnisonen in Germersheim und Bruchsal gehören und der in der
Vergangenheit auch selbst wiederholt in Auslandseinsätzen unterwegs
war, wollte jetzt die Weihnachtszeit nutzen, um die humanitären
Leistungen seiner Kameradinnen und Kameraden vor Ort in der
Öffentlichkeit zu würdigen.
cr. Speyer. Fast an jedem Tag, so auch heute
wieder, gehen Nachrichten durch die Agenturen, dass deutsche
Soldaten im Rahmen der Operation „Sophia“ Flüchtlinge vor dem
qualvollen Ertrinken im Mittelmeer bewahren. Der Speyerer
Militärpfarrer Ulrich Kronenberg, zu dessen
Verantwortungsbereich neben den „Resten“ des
„Spezialpionierbataillons 464“ in der Speyerer Kurpfalzkaserne auch
die Garnisonen in Germersheim und Bruchsal gehören und der in der
Vergangenheit auch selbst wiederholt in Auslandseinsätzen unterwegs
war, wollte jetzt die Weihnachtszeit nutzen, um die humanitären
Leistungen seiner Kameradinnen und Kameraden vor Ort in der
Öffentlichkeit zu würdigen. Ökumenische
Telefonseelsorge: Einsamkeit ist nicht nur an Weihnachten ein
Thema
Ökumenische
Telefonseelsorge: Einsamkeit ist nicht nur an Weihnachten ein
Thema Kirchenpräsident Christian Schad ruft dazu auf, Fremde und
Schwache nicht auszugrenzen
Kirchenpräsident Christian Schad ruft dazu auf, Fremde und
Schwache nicht auszugrenzen Erster Ausflug nach Klinikaufenthalt – Begleitung durch
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Bischof em. Dr. Anton
Schlembach
Erster Ausflug nach Klinikaufenthalt – Begleitung durch
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Bischof em. Dr. Anton
Schlembach Vor dem Marienbildnis zündeten die Bischöfe gemeinsam mit
dem Ehepaar Kohl eine Kerze an und beteten gemeinsam das „Vater
unser“ und das „Gegrüßet seist Du Maria“. Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann brachte seine Freude über den Besuch des Ehepaars Kohl
zum Ausdruck und übergab dem Bundeskanzler, der bis heute dem
Kuratorium der „Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“
vorsteht, das jüngst erschienene Buch „Himmlische Klänge –
Grandioses Raumerlebnis“ über die Orgeln im Dom zu Speyer. Er
verband damit seinen Dank für das große Engagement Helmut Kohls für
die romanische Kathedrale, die seit 1981 zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählt. „Sie haben sich in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt des
Doms verdient gemacht und entscheidend dazu beigetragen, Menschen
für dieses eindrucksvolle Sinnbild der christlichen Wurzeln eines
geeinten Europas zu begeistern“, dankte er Helmut Kohl, der von dem
Besuch tief berührt war. Der Besuch der Speyerer Kathedrale, der er
seit seiner Kindheit eng verbunden ist, bedeutete für ihn eine
große Freude. Bereits Ende September war er vom Speyer Domkapitel
für seine Verdienste für den Speyer Dom öffentlich geehrt worden.
Die Begegnung klang aus mit adventlichen und weihnachtlichen
Werken, dargeboten an der großen Domorgel von Domorganist Markus
Eichenlaub. Text: is; Fotos: Klaus Landry
Vor dem Marienbildnis zündeten die Bischöfe gemeinsam mit
dem Ehepaar Kohl eine Kerze an und beteten gemeinsam das „Vater
unser“ und das „Gegrüßet seist Du Maria“. Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann brachte seine Freude über den Besuch des Ehepaars Kohl
zum Ausdruck und übergab dem Bundeskanzler, der bis heute dem
Kuratorium der „Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer“
vorsteht, das jüngst erschienene Buch „Himmlische Klänge –
Grandioses Raumerlebnis“ über die Orgeln im Dom zu Speyer. Er
verband damit seinen Dank für das große Engagement Helmut Kohls für
die romanische Kathedrale, die seit 1981 zum UNESCO-Weltkulturerbe
zählt. „Sie haben sich in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt des
Doms verdient gemacht und entscheidend dazu beigetragen, Menschen
für dieses eindrucksvolle Sinnbild der christlichen Wurzeln eines
geeinten Europas zu begeistern“, dankte er Helmut Kohl, der von dem
Besuch tief berührt war. Der Besuch der Speyerer Kathedrale, der er
seit seiner Kindheit eng verbunden ist, bedeutete für ihn eine
große Freude. Bereits Ende September war er vom Speyer Domkapitel
für seine Verdienste für den Speyer Dom öffentlich geehrt worden.
Die Begegnung klang aus mit adventlichen und weihnachtlichen
Werken, dargeboten an der großen Domorgel von Domorganist Markus
Eichenlaub. Text: is; Fotos: Klaus Landry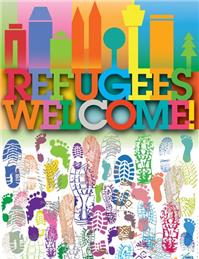 Bistum
Speyer hat Anregungen für Feiern mit Menschen unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen zusammengestellt
Bistum
Speyer hat Anregungen für Feiern mit Menschen unterschiedlicher
Sprachen und Kulturen zusammengestellt Chefredakteur Norbert Rönn sagt weitere Unterstützung
durch Aktion Silbermöwe zu
Chefredakteur Norbert Rönn sagt weitere Unterstützung
durch Aktion Silbermöwe zu Angebot soll spirituelle Bedeutung der Kathedrale ebenso
vermitteln wie kunstgeschichtliche Besonderheiten der
Weltkulturerbestätte
Angebot soll spirituelle Bedeutung der Kathedrale ebenso
vermitteln wie kunstgeschichtliche Besonderheiten der
Weltkulturerbestätte Kathedrale und Baudezernent des Bistums Speyer,
Domkapitular Peter Schappert, gemeinsam mit
Friederike Walter, der Verantwortlichen für das
„Dom-Kulturmanagement“ und Bastian Hoffmann vom
„Dom-Besuchermanagment“, im Rahmen eines Pressegespräches im
„Blauen Salon“ der Bischöflichen Finanzkammer mit. Damit sind jetzt
auch frühere Pläne vom Tisch, die vorsahen, das Besucherzentrum in
den 'Vikarienhöfen' direkt am Domplatz gegenüber der Kathedrale
einzurichten.
Kathedrale und Baudezernent des Bistums Speyer,
Domkapitular Peter Schappert, gemeinsam mit
Friederike Walter, der Verantwortlichen für das
„Dom-Kulturmanagement“ und Bastian Hoffmann vom
„Dom-Besuchermanagment“, im Rahmen eines Pressegespräches im
„Blauen Salon“ der Bischöflichen Finanzkammer mit. Damit sind jetzt
auch frühere Pläne vom Tisch, die vorsahen, das Besucherzentrum in
den 'Vikarienhöfen' direkt am Domplatz gegenüber der Kathedrale
einzurichten. Entsprechende Pläne, so erklärte Schappert dazu, hätten
sich angesichts der vorhandenen Bausubstanz als zu aufwändig und
damit als zu teuer erwiesen. So hätte allein die Schaffung eines
für Rollstuhlfahrer geeigneten, barrierefreien Zugangs zum
Hochparterre des denkmalgeschützten Gebäudes einen nur schwer zu
vertretenden Eingriff dargestellt, ohne dass aus einem solchen
Eingriff die gewünschten Vorteile in seiner funktionellen Nutzung
hätten erreicht werden können.
Entsprechende Pläne, so erklärte Schappert dazu, hätten
sich angesichts der vorhandenen Bausubstanz als zu aufwändig und
damit als zu teuer erwiesen. So hätte allein die Schaffung eines
für Rollstuhlfahrer geeigneten, barrierefreien Zugangs zum
Hochparterre des denkmalgeschützten Gebäudes einen nur schwer zu
vertretenden Eingriff dargestellt, ohne dass aus einem solchen
Eingriff die gewünschten Vorteile in seiner funktionellen Nutzung
hätten erreicht werden können.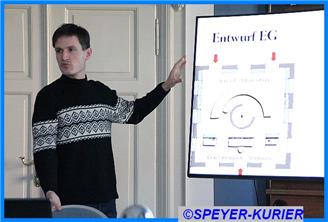
 Um dem internationalen Rang des Domes gerecht zu werden,
soll das im Dom-Besucherzentrum eingesetzte Personal mehrsprachig
Auskunft geben können. Die kulturhistorische Bedeutung des Domes
solle darüber hinaus in dem Produktangebot, insbesondere in Form
von entsprechender Literatur ihren Platz finden. Für Touristen wird
es zudem eine kleine Auswahl an Souvenirs und Postkarten geben. Ob
im Außenbereich auch noch ein gastronomisches Minimalangebot
realisiert werden könne, werde derzeit noch geprüft.
Um dem internationalen Rang des Domes gerecht zu werden,
soll das im Dom-Besucherzentrum eingesetzte Personal mehrsprachig
Auskunft geben können. Die kulturhistorische Bedeutung des Domes
solle darüber hinaus in dem Produktangebot, insbesondere in Form
von entsprechender Literatur ihren Platz finden. Für Touristen wird
es zudem eine kleine Auswahl an Souvenirs und Postkarten geben. Ob
im Außenbereich auch noch ein gastronomisches Minimalangebot
realisiert werden könne, werde derzeit noch geprüft. Nach der Übergabe des Gebäudes durch die Pächterin Ende
November 2015 sei inzwischen mit dem Rückbau des bisherigen
Innenausbaus begonnen worden. Aktuell würden Elektroarbeiten
durchgeführt, im Neuen Jahr gehe es dann mit Trockenbau, Boden und
Malerarbeiten weiter, ehe zuletzt die neue Möblierung aus Pfälzer
Eichenholz und einem Verbundwerkstoff eingebaut wird. Die Eröffnung
des neuen Besucherzentrums soll Mitte des Jahres 2016 erfolgen.
Nach der Übergabe des Gebäudes durch die Pächterin Ende
November 2015 sei inzwischen mit dem Rückbau des bisherigen
Innenausbaus begonnen worden. Aktuell würden Elektroarbeiten
durchgeführt, im Neuen Jahr gehe es dann mit Trockenbau, Boden und
Malerarbeiten weiter, ehe zuletzt die neue Möblierung aus Pfälzer
Eichenholz und einem Verbundwerkstoff eingebaut wird. Die Eröffnung
des neuen Besucherzentrums soll Mitte des Jahres 2016 erfolgen.-01.jpg) Friedenslichtaktion der Pfadfinder
Friedenslichtaktion der Pfadfinder-01.jpg) Der ökumenische Gottesdienst stand so auch ganz im
Zeichen des Hoffnungslichtes, das die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus Bethlehem nach Wien und von dort aus in viele
europäische Länder gebracht hatten. Im Rahmen des Gottesdienstes
kam Maria Lajin zu Wort, eine junge Christin, die mit ihren Eltern
und Geschwistern im Kleinkindalter aus dem Irak nach Deutschland
geflohen war. Die 18-jährige Ludwigshafenerin berichtete von der
Angst der Christen in ihrer alten Heimat, von der Flucht der Eltern
nach Deutschland und vom Heimisch-werden in einer neuen Umgebung.
Maria erzählte von ihrer Taufpatin, einer Frau, die der Familie
damals das Ankommen erleichterte. Marias Mutter hilft heute
ihrerseits Menschen, die auf ihrer Flucht in Deutschland gestrandet
sind und unterstützt sie bei Behördengängen.
Der ökumenische Gottesdienst stand so auch ganz im
Zeichen des Hoffnungslichtes, das die Pfadfinderinnen und
Pfadfinder aus Bethlehem nach Wien und von dort aus in viele
europäische Länder gebracht hatten. Im Rahmen des Gottesdienstes
kam Maria Lajin zu Wort, eine junge Christin, die mit ihren Eltern
und Geschwistern im Kleinkindalter aus dem Irak nach Deutschland
geflohen war. Die 18-jährige Ludwigshafenerin berichtete von der
Angst der Christen in ihrer alten Heimat, von der Flucht der Eltern
nach Deutschland und vom Heimisch-werden in einer neuen Umgebung.
Maria erzählte von ihrer Taufpatin, einer Frau, die der Familie
damals das Ankommen erleichterte. Marias Mutter hilft heute
ihrerseits Menschen, die auf ihrer Flucht in Deutschland gestrandet
sind und unterstützt sie bei Behördengängen.-01.jpg) Für die Hoffnung auf eine dauerhaft friedliches
Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen und
Religionen steht das Friedenslicht in diesem Jahr. Von Speyer aus
wird es nun in die Gemeinden des Bistums weitergegeben. Die
Kollekte des Gottesdienstes erbrachte ein Spendensumme von rund
1.000 Euro. Der Betrag wird der Flüchtlingshilfe zur Verfügung
gestellt.
Für die Hoffnung auf eine dauerhaft friedliches
Zusammenleben von Menschen aus verschiedenen Kulturen und
Religionen steht das Friedenslicht in diesem Jahr. Von Speyer aus
wird es nun in die Gemeinden des Bistums weitergegeben. Die
Kollekte des Gottesdienstes erbrachte ein Spendensumme von rund
1.000 Euro. Der Betrag wird der Flüchtlingshilfe zur Verfügung
gestellt.  Bischof Wiesemann durchschreitet „Heilige Pforte“ am Dom
zu Speyer– Domweihfest im Oktober geht eine „Nacht der
Barmherzigkeit“ mit Brüdern aus Taizé voraus
Bischof Wiesemann durchschreitet „Heilige Pforte“ am Dom
zu Speyer– Domweihfest im Oktober geht eine „Nacht der
Barmherzigkeit“ mit Brüdern aus Taizé voraus Auch in den Wallfahrtsorten Maria Rosenberg, Blieskastel
und Oggersheim werden am vierten Adventssonntag „Heilige Pforten“
eröffnet. Darüber setzt das Bistum Speyer mit der Aktion „Mission
Misericordia“ einen Impuls, Türen im privaten, öffentlichen oder
kirchlichen Raum mit einem eigens für die Aktion entwickelten
Aufkleber zu bekleben und damit deutlich zu machen: Tritt ein, ich
bin da für Dich.
Auch in den Wallfahrtsorten Maria Rosenberg, Blieskastel
und Oggersheim werden am vierten Adventssonntag „Heilige Pforten“
eröffnet. Darüber setzt das Bistum Speyer mit der Aktion „Mission
Misericordia“ einen Impuls, Türen im privaten, öffentlichen oder
kirchlichen Raum mit einem eigens für die Aktion entwickelten
Aufkleber zu bekleben und damit deutlich zu machen: Tritt ein, ich
bin da für Dich.-01.jpg) Das außerordentliche Heilige Jahr der Barmherzigkeit ist
von Papst Franziskus am 8. Dezember eröffnet worden, genau 50 Jahre
nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965).
Es soll dazu beitragen, „das Zeugnis der Gläubigen stärker und
wirkungsvoller zu machen", heißt es in der Verkündigungsbulle mit
dem Titel „Antlitz der Barmherzigkeit“. Der Papst fordert die
Kirche darin auf, verstärkt auf das Wesentliche zu schauen und
„Zeichen und Werkzeug von Gottes Barmherzigkeit“ zu sein. Die
Barmherzigkeit sei der letzte und endgültige Akt, mit dem Gott den
Menschen entgegentritt, und zugleich „das grundlegende Gesetz, das
im Herzen eines jeden Menschen ruht und den Blick bestimmt, wenn er
aufrichtig auf den Bruder und die Schwester schaut, die ihm auf dem
Weg des Lebens begegnen.“ Barmherzigkeit öffne das Herz für die
Hoffnung, dass „wir trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer
Schuld für immer geliebt sind“, so Papst Franziskus. Traditionell
werden zu Beginn eines Heiligen Jahres die Heiligen Pforten des
Petersdoms und der drei weiteren päpstlichen Basiliken in Rom
geöffnet.
Das außerordentliche Heilige Jahr der Barmherzigkeit ist
von Papst Franziskus am 8. Dezember eröffnet worden, genau 50 Jahre
nach Abschluss des Zweiten Vatikanischen Konzils (1962 bis 1965).
Es soll dazu beitragen, „das Zeugnis der Gläubigen stärker und
wirkungsvoller zu machen", heißt es in der Verkündigungsbulle mit
dem Titel „Antlitz der Barmherzigkeit“. Der Papst fordert die
Kirche darin auf, verstärkt auf das Wesentliche zu schauen und
„Zeichen und Werkzeug von Gottes Barmherzigkeit“ zu sein. Die
Barmherzigkeit sei der letzte und endgültige Akt, mit dem Gott den
Menschen entgegentritt, und zugleich „das grundlegende Gesetz, das
im Herzen eines jeden Menschen ruht und den Blick bestimmt, wenn er
aufrichtig auf den Bruder und die Schwester schaut, die ihm auf dem
Weg des Lebens begegnen.“ Barmherzigkeit öffne das Herz für die
Hoffnung, dass „wir trotz unserer Begrenztheit aufgrund unserer
Schuld für immer geliebt sind“, so Papst Franziskus. Traditionell
werden zu Beginn eines Heiligen Jahres die Heiligen Pforten des
Petersdoms und der drei weiteren päpstlichen Basiliken in Rom
geöffnet. Öffnungszeiten des „Wegs der Barmherzigkeit“ im Dom zu
Speyer:
Öffnungszeiten des „Wegs der Barmherzigkeit“ im Dom zu
Speyer: Pastor Danial betreut aus Ägypten, Syrien und dem Irak
stammende Christen in Ludwigshafen
Pastor Danial betreut aus Ägypten, Syrien und dem Irak
stammende Christen in Ludwigshafen Herxheim/Speyer- Kirchenpräsident Christian Schad
zum mutmaßlichen Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in
Herxheim und die im selben Gebäude verortete Kleiderkammer für
Asylbewerber
Herxheim/Speyer- Kirchenpräsident Christian Schad
zum mutmaßlichen Brandanschlag auf die Flüchtlingsunterkunft in
Herxheim und die im selben Gebäude verortete Kleiderkammer für
Asylbewerber Zweites
Feuer innerhalb weniger Tage – Justiz ermittelt wegen versuchten
Mordes und schwerer Brandstiftung – BDKJ und Jugendkirche LUMEN
laden zu Friedengebet ein
Zweites
Feuer innerhalb weniger Tage – Justiz ermittelt wegen versuchten
Mordes und schwerer Brandstiftung – BDKJ und Jugendkirche LUMEN
laden zu Friedengebet ein Bonifatiuswerk beschließt Fördermittel für 2016
Bonifatiuswerk beschließt Fördermittel für 2016 Das
Bonifatiuswerk unterstützt Katholiken überall dort, wo sie als
Minderheit ihren Glauben leben und fördert Projekte in Deutschland,
Nordeuropa und dem Baltikum. Von der Deutschen Bischofskonferenz
mit der Förderung der Diaspora-Seelsorge beauftragt, sammelt das
Werk Spenden und stellt diese u.a. für den Bau von Kirchen und
Gemeindezentren, für die Kinder- und Jugendseelsorge und für
sozialkaritative Projekte als Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung.
Gefördert werden so die Weitergabe des Glaubens, Orte der Begegnung
und der Gemeinschaft sowie die pastorale Begleitung.
Das
Bonifatiuswerk unterstützt Katholiken überall dort, wo sie als
Minderheit ihren Glauben leben und fördert Projekte in Deutschland,
Nordeuropa und dem Baltikum. Von der Deutschen Bischofskonferenz
mit der Förderung der Diaspora-Seelsorge beauftragt, sammelt das
Werk Spenden und stellt diese u.a. für den Bau von Kirchen und
Gemeindezentren, für die Kinder- und Jugendseelsorge und für
sozialkaritative Projekte als Hilfe zur Selbsthilfe zur Verfügung.
Gefördert werden so die Weitergabe des Glaubens, Orte der Begegnung
und der Gemeinschaft sowie die pastorale Begleitung. Eintreten wo Hilfe gebraucht wird
Eintreten wo Hilfe gebraucht wird
 Bei der abschließenden Andacht an der St. Nikolauskapelle
in der Rheinuferstraße sagte der Weihbischof von Speyer, Otto
Georgens, vor einer großen Anzahl von Prozessionsteilnehmern, dass
der heilige Nikolaus gerade in unserer heutigen Zeit fälschlich als
Weihnachtsmann dargestellt werden. „Kein Weihnachtsmann taugt zum
Schutzpatron der Binnenschiffer“, so der Weihbischof, der auch
darüber sprach, dass der Bischof von Myra meist unerkannt große
Hilfe gegenüber den Armen geleistet habe. Und er zeige sich auch
noch heute als ein großer Helfer in der Not. Armut habe viele
Gesichter, auch in unserer Zeit. Für die Christen sei es daher
gerade in der Advents- und Weihnachtszeit angesagt, dort
einzutreten, wo Hilfe gebraucht wird.
Bei der abschließenden Andacht an der St. Nikolauskapelle
in der Rheinuferstraße sagte der Weihbischof von Speyer, Otto
Georgens, vor einer großen Anzahl von Prozessionsteilnehmern, dass
der heilige Nikolaus gerade in unserer heutigen Zeit fälschlich als
Weihnachtsmann dargestellt werden. „Kein Weihnachtsmann taugt zum
Schutzpatron der Binnenschiffer“, so der Weihbischof, der auch
darüber sprach, dass der Bischof von Myra meist unerkannt große
Hilfe gegenüber den Armen geleistet habe. Und er zeige sich auch
noch heute als ein großer Helfer in der Not. Armut habe viele
Gesichter, auch in unserer Zeit. Für die Christen sei es daher
gerade in der Advents- und Weihnachtszeit angesagt, dort
einzutreten, wo Hilfe gebraucht wird. Erhebung
zur Ministranten-Arbeit in der Diözese Speyer
Erhebung
zur Ministranten-Arbeit in der Diözese Speyer Umzug in die Nikolaus-von-Weis-Straße für Anfang
2017 geplant
Umzug in die Nikolaus-von-Weis-Straße für Anfang
2017 geplant Bischof Wiesemann dankt allen Teilnehmern der Gebetskette,
die den Prozess „Gemeindepastoral 2015“ mit ihrem Gebet begleitet
haben – Fortsetzung der Gebetskette im Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit
Bischof Wiesemann dankt allen Teilnehmern der Gebetskette,
die den Prozess „Gemeindepastoral 2015“ mit ihrem Gebet begleitet
haben – Fortsetzung der Gebetskette im Heiligen Jahr der
Barmherzigkeit-01.jpg) Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Einsatz für Gemeinwohl
ist gelebte Solidarität
Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Einsatz für Gemeinwohl
ist gelebte Solidarität-01.jpg)
-01.jpg) Von 1974 bis 1977 hatte Cherdron dann die Pfarrstelle in
Neuhofen/Pfalz inne, ehe er zum Landesjugendpfarrer der Pfälzischen
Landeskirche nach Kaiserslautern berufen wurde.
Von 1974 bis 1977 hatte Cherdron dann die Pfarrstelle in
Neuhofen/Pfalz inne, ehe er zum Landesjugendpfarrer der Pfälzischen
Landeskirche nach Kaiserslautern berufen wurde.-01.jpg) Gemeinsam mit Eberhard Cherdron zeichnete die
Ministerpräsidentin übrigens an diesem Tag noch elf weitere
verdiente Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens mit dem Verdienstorden des Landes
Rheinland-Pfalz aus, die sich durch ganz unterschiedliche
Engagements verdient gemacht hätten - von der Förderung kultureller
und geschichtlicher Projekte über die Forschungsförderung und
soziale Hilfsprojekte bis hin zum Natur- und Umweltschutz. „All
dies spiegelt die Pluralität und den Reichtum des kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens wider, für die Rheinland-Pfalz steht.
Ihre Leistungen sind deshalb eine große Bereicherung für unser
Zusammenleben“, so die Ministerpräsidentin abschließend.
Gemeinsam mit Eberhard Cherdron zeichnete die
Ministerpräsidentin übrigens an diesem Tag noch elf weitere
verdiente Frauen und Männer aus den unterschiedlichsten Bereichen
des gesellschaftlichen Lebens mit dem Verdienstorden des Landes
Rheinland-Pfalz aus, die sich durch ganz unterschiedliche
Engagements verdient gemacht hätten - von der Förderung kultureller
und geschichtlicher Projekte über die Forschungsförderung und
soziale Hilfsprojekte bis hin zum Natur- und Umweltschutz. „All
dies spiegelt die Pluralität und den Reichtum des kulturellen und
gesellschaftlichen Lebens wider, für die Rheinland-Pfalz steht.
Ihre Leistungen sind deshalb eine große Bereicherung für unser
Zusammenleben“, so die Ministerpräsidentin abschließend.-01.jpg) Was ehrenamtliches Engagement zu erreichen vermöge, habe
sich gerade erst wieder in diesem Jahr gezeigt, in dem das Land den
größten Zuzug von Flüchtlingen seit dem Zweiten Weltkrieg erlebe.
„Hier leisten die zum großen Teil ehrenamtlich tätigen Helfer und
Helferinnen Herausragendes für unsere Gesellschaft und für
diejenigen Menschen, die aus Not zu uns geflüchtet sind“, betonte
die Ministerpräsidentin anerkennend.
Was ehrenamtliches Engagement zu erreichen vermöge, habe
sich gerade erst wieder in diesem Jahr gezeigt, in dem das Land den
größten Zuzug von Flüchtlingen seit dem Zweiten Weltkrieg erlebe.
„Hier leisten die zum großen Teil ehrenamtlich tätigen Helfer und
Helferinnen Herausragendes für unsere Gesellschaft und für
diejenigen Menschen, die aus Not zu uns geflüchtet sind“, betonte
die Ministerpräsidentin anerkennend. Speyer-
Der bundesweite Vorlesetag am 20. November war für die Prot. Kita
Arche Noah in Speyer Anlass, in der Kita-eigenen Bücherei drei Tage
lang fast rund um die Uhr vorzulesen.
Speyer-
Der bundesweite Vorlesetag am 20. November war für die Prot. Kita
Arche Noah in Speyer Anlass, in der Kita-eigenen Bücherei drei Tage
lang fast rund um die Uhr vorzulesen. Gemeinsames Eintreten der Weltreligionen entfacht Dynamik
im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Paris –
Weltkirchen-Referent Christoph Fuhrbach bei
Abschlussveranstaltungen der verschiedenen internationalen
Klima-Pilgerwege in Paris
Gemeinsames Eintreten der Weltreligionen entfacht Dynamik
im Vorfeld der Weltklimakonferenz in Paris –
Weltkirchen-Referent Christoph Fuhrbach bei
Abschlussveranstaltungen der verschiedenen internationalen
Klima-Pilgerwege in Paris Die Attentate in Paris vor zwei Wochen hatten
Auswirkungen auf den Abschluss der internationalen Klima-Pilgerwege
vor dem Start der COP 21 in Paris: Einige Veranstaltungen wie eine
große Demonstration für ein verbindliches Klimaschutzabkommen
wurden aufgrund der angespannten Sicherheitslage in Paris abgesagt.
Viele weitere Events mussten verlegt oder verkürzt und einige
Sicherheitskontrollen eingehalten werden. Banner und Fahnen durften
aufgrund des Demonstrationsverbots nicht ausgerollt werden, Gesang
war nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Zudem hatten sich etliche
Pilgernde in den vergangenen zwei Wochen für das Finale in Paris
abgemeldet. Gleichzeitig freuten sich die Menschen in Paris, dass
dennoch so viele Klima-Pilgernde in ihre Stadt kamen, was sie auch
als Solidaritätsbekundung in ihrer aktuell nicht einfachen
Situation deuteten.
Die Attentate in Paris vor zwei Wochen hatten
Auswirkungen auf den Abschluss der internationalen Klima-Pilgerwege
vor dem Start der COP 21 in Paris: Einige Veranstaltungen wie eine
große Demonstration für ein verbindliches Klimaschutzabkommen
wurden aufgrund der angespannten Sicherheitslage in Paris abgesagt.
Viele weitere Events mussten verlegt oder verkürzt und einige
Sicherheitskontrollen eingehalten werden. Banner und Fahnen durften
aufgrund des Demonstrationsverbots nicht ausgerollt werden, Gesang
war nur in geschlossenen Räumen erlaubt. Zudem hatten sich etliche
Pilgernde in den vergangenen zwei Wochen für das Finale in Paris
abgemeldet. Gleichzeitig freuten sich die Menschen in Paris, dass
dennoch so viele Klima-Pilgernde in ihre Stadt kamen, was sie auch
als Solidaritätsbekundung in ihrer aktuell nicht einfachen
Situation deuteten. Aus dem Veranstaltungsreigen ragte ein interreligiöses
Gebet in der Kathedrale von St. Denis mit muslimischen, jüdischen,
buddhistischen und christlichen Gläubigen heraus. Direkt im
Anschluss gab es ein Treffen von Vertreter/innen aller
Klimapilgerwege und der Weltreligionen mit bei der COP 21
zentralen Persönlichkeiten: Pilger/innen berichteten mit Hilfe von
mitgebrachten Symbolen über ihre im Laufe der Pilgerwege gemachten
Erfahrungen und Einsichten. Religiöse Würdenträger/innen stellten
klare Forderungen an die bei der Weltklimakonferenz politisch
Handelnden. Dabei wurde klar, dass es hier keine religiösen Grenzen
gibt, sondern dass – zum ersten Mal - alle großen Weltreligionen
sich einig sind, dass der Klimawandel und ein an Klimagerechtigkeit
ausgerichtetes Handeln eine der wesentlichen Herausforderungen der
gesamten Menschheit im 21. Jahrhundert sein wird. Erzbischof Thabo
Makgoba rief daher alle Gläubigen und alle politisch Handelnden
auf: „Wir können, wir müssen, wir werden handeln“, um den
Klimawandel zu begrenzen und Klimagerechtigkeit zu schaffen.
Aus dem Veranstaltungsreigen ragte ein interreligiöses
Gebet in der Kathedrale von St. Denis mit muslimischen, jüdischen,
buddhistischen und christlichen Gläubigen heraus. Direkt im
Anschluss gab es ein Treffen von Vertreter/innen aller
Klimapilgerwege und der Weltreligionen mit bei der COP 21
zentralen Persönlichkeiten: Pilger/innen berichteten mit Hilfe von
mitgebrachten Symbolen über ihre im Laufe der Pilgerwege gemachten
Erfahrungen und Einsichten. Religiöse Würdenträger/innen stellten
klare Forderungen an die bei der Weltklimakonferenz politisch
Handelnden. Dabei wurde klar, dass es hier keine religiösen Grenzen
gibt, sondern dass – zum ersten Mal - alle großen Weltreligionen
sich einig sind, dass der Klimawandel und ein an Klimagerechtigkeit
ausgerichtetes Handeln eine der wesentlichen Herausforderungen der
gesamten Menschheit im 21. Jahrhundert sein wird. Erzbischof Thabo
Makgoba rief daher alle Gläubigen und alle politisch Handelnden
auf: „Wir können, wir müssen, wir werden handeln“, um den
Klimawandel zu begrenzen und Klimagerechtigkeit zu schaffen. Delegationen aus den Pfarreien bekamen beim Pontifikalamt
im Speyerer Dom am 28. November die Errichtungsurkunden der neuen
Pfarreien und das künftige Pfarrsiegel überreicht
Delegationen aus den Pfarreien bekamen beim Pontifikalamt
im Speyerer Dom am 28. November die Errichtungsurkunden der neuen
Pfarreien und das künftige Pfarrsiegel überreicht In seiner Predigt wandte sich der Bischof dem Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ unter dem Leitwort „Der Geist ist es, der
lebendig macht“ zu. „Es geht dabei nicht zuerst um eine Veränderung
der Strukturen, sondern um eine geistliche Erneuerung, mit der wir
auf die Herausforderungen der Zeit Antwort geben“, so der Bischof.
Das Leitwort sei ein Appell, „nicht das Tote zu hüten, sondern das
Lebendige zu fördern“. Im Blick auf die Bedrohung durch den Terror
rief er die Gläubigen dazu auf, mit Mut für die christlichen Werte
und die Würde des Menschen einzutreten. Zugleich warb er für eine
offene und solidarische Haltung gegenüber den Menschen, die auf der
Flucht vor Krieg und Terror in Europa Schutz suchen. „Es ist das
Kennzeichen, gleichsam die Signatur des Christlichen, dass wir uns
dem Notleidenden öffnen und ihm Anteil an unserem Leben geben, als
wäre es Christus selbst.“
In seiner Predigt wandte sich der Bischof dem Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ unter dem Leitwort „Der Geist ist es, der
lebendig macht“ zu. „Es geht dabei nicht zuerst um eine Veränderung
der Strukturen, sondern um eine geistliche Erneuerung, mit der wir
auf die Herausforderungen der Zeit Antwort geben“, so der Bischof.
Das Leitwort sei ein Appell, „nicht das Tote zu hüten, sondern das
Lebendige zu fördern“. Im Blick auf die Bedrohung durch den Terror
rief er die Gläubigen dazu auf, mit Mut für die christlichen Werte
und die Würde des Menschen einzutreten. Zugleich warb er für eine
offene und solidarische Haltung gegenüber den Menschen, die auf der
Flucht vor Krieg und Terror in Europa Schutz suchen. „Es ist das
Kennzeichen, gleichsam die Signatur des Christlichen, dass wir uns
dem Notleidenden öffnen und ihm Anteil an unserem Leben geben, als
wäre es Christus selbst.“ Die leitenden Pfarrer, die gemeinsam mit dem Bischof, den
Mitgliedern des Domkapitels und den Dekanen um den Hochaltar
versammelt waren, sprachen das Glaubensbekenntnis und legten ihren
Amtseid als Pfarrer der neuen Pfarreien ab. Darin versprachen sie
unter anderem, die Gemeinschaft mit der Kirche zu bewahren und den
Bischöfen in Treue zur Seite zu stehen. Nach dem Schlussgebet
wurden die Delegationen aus den Pfarreien von Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann, Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar
Dr. Franz Jung für ihren Dienst in den neuen Pfarreien gesegnet und
ausgesandt. Den Delegationen aus den Pfarreien gehörten die
hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger und die Vertreter der
neu gewählten Pfarrgremien an. Sie erhielten zugleich die
Errichtungsurkunde der neuen Pfarrei und das neue Pfarrsiegel.
Die leitenden Pfarrer, die gemeinsam mit dem Bischof, den
Mitgliedern des Domkapitels und den Dekanen um den Hochaltar
versammelt waren, sprachen das Glaubensbekenntnis und legten ihren
Amtseid als Pfarrer der neuen Pfarreien ab. Darin versprachen sie
unter anderem, die Gemeinschaft mit der Kirche zu bewahren und den
Bischöfen in Treue zur Seite zu stehen. Nach dem Schlussgebet
wurden die Delegationen aus den Pfarreien von Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann, Weihbischof Otto Georgens und Generalvikar
Dr. Franz Jung für ihren Dienst in den neuen Pfarreien gesegnet und
ausgesandt. Den Delegationen aus den Pfarreien gehörten die
hauptamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger und die Vertreter der
neu gewählten Pfarrgremien an. Sie erhielten zugleich die
Errichtungsurkunde der neuen Pfarrei und das neue Pfarrsiegel. Gedanken von Gerhard Cantzler
Gedanken von Gerhard Cantzler Einer, der damals durch sein Wort und sein Gebet
maßgeblich dazu beigetragen hat, dass schon wenige Monate nach
diesem Besuch in der Pfalz die Mauer in Berlin fallen, die Grenzen
zwischen Ost und West ihren Wert verlieren und die Menschen auf
beiden Seiten des so überflüssig gewordenen „Eisernen Vorhangs“
glückselig ihre Wiedervereinigung feiern konnten, war er: Papst
Johannes Paul II., der unter anderem mit seiner Unterstützung der
christlich geprägten Gewerkschaft „Solidarnosc“ in seiner
polnischen Heimat den ersten Stein aus der bis dahin
undurchdringlichen Mauer zwischen Ost und West brach und mit seinem
Ruf „Habt keine Angst!“ alle Menschen guten Willens in der Welt
dazu ermutigen wollte, diesen Weg in eine bessere Zukunft mit ihm
gemeinsam zu gehen.
Einer, der damals durch sein Wort und sein Gebet
maßgeblich dazu beigetragen hat, dass schon wenige Monate nach
diesem Besuch in der Pfalz die Mauer in Berlin fallen, die Grenzen
zwischen Ost und West ihren Wert verlieren und die Menschen auf
beiden Seiten des so überflüssig gewordenen „Eisernen Vorhangs“
glückselig ihre Wiedervereinigung feiern konnten, war er: Papst
Johannes Paul II., der unter anderem mit seiner Unterstützung der
christlich geprägten Gewerkschaft „Solidarnosc“ in seiner
polnischen Heimat den ersten Stein aus der bis dahin
undurchdringlichen Mauer zwischen Ost und West brach und mit seinem
Ruf „Habt keine Angst!“ alle Menschen guten Willens in der Welt
dazu ermutigen wollte, diesen Weg in eine bessere Zukunft mit ihm
gemeinsam zu gehen. Als Johannes Paul II. 1987 in Deutschlandund in Speyer
weilte, da galt sein Besuch in erster Linie der von ihm so
hochverehrten, zwischenzeitlich gleichfalls heilig gesprochenen
jüdisch-deutschen Wissenschaftlerin und Karmelitin Edith Stein, die
im Bistum Speyer vom Judentum zum Katholizismus konvertiert war und
deren Seligsprechung Papst Johannes Paul II. 1987 bei seinem
Aufenthalt in Köln vornahm.
Als Johannes Paul II. 1987 in Deutschlandund in Speyer
weilte, da galt sein Besuch in erster Linie der von ihm so
hochverehrten, zwischenzeitlich gleichfalls heilig gesprochenen
jüdisch-deutschen Wissenschaftlerin und Karmelitin Edith Stein, die
im Bistum Speyer vom Judentum zum Katholizismus konvertiert war und
deren Seligsprechung Papst Johannes Paul II. 1987 bei seinem
Aufenthalt in Köln vornahm. Sie beide hatten Kontakte zu Speyer – die eine über
mehrere Jahre hinweg als Lehrerin im Kloster St. Magdalena, der
andere nur wenige Stunden. „Können wir es überhaupt zureichend
einschätzen, gemeinsam mit einem Heiligen am Altar gestanden zu
haben – ihm die Hand gereicht zu haben?“, fragte jetzt Bischof Dr.
Anton Schlembach nachdenklich und voller Ehrerbietung seine
bewegten Zuhörer im dicht besetzten Speyerer Ratssaal.
Sie beide hatten Kontakte zu Speyer – die eine über
mehrere Jahre hinweg als Lehrerin im Kloster St. Magdalena, der
andere nur wenige Stunden. „Können wir es überhaupt zureichend
einschätzen, gemeinsam mit einem Heiligen am Altar gestanden zu
haben – ihm die Hand gereicht zu haben?“, fragte jetzt Bischof Dr.
Anton Schlembach nachdenklich und voller Ehrerbietung seine
bewegten Zuhörer im dicht besetzten Speyerer Ratssaal.
 Pontifikalamt im Speyerer Dom am dritten
Adventssonntag
Pontifikalamt im Speyerer Dom am dritten
Adventssonntag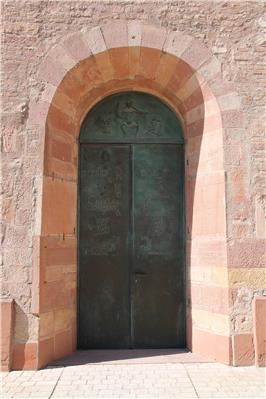 Zum ersten
Mal in einem Heiligen Jahr gibt es in jeder Bischofskirche eine
„Heilige Pforte“. Einen Höhepunkt des Gottesdienstes im Speyerer
Dom am dritten Adventssonntag stellt die Öffnung des Otto-Portals
im Südosten des Domes als „Heilige Pforte“ dar. Es ist dem heiligen
Bischof Otto von Bamberg gewidmet, der beim Dombau mitgewirkt
hat.
Zum ersten
Mal in einem Heiligen Jahr gibt es in jeder Bischofskirche eine
„Heilige Pforte“. Einen Höhepunkt des Gottesdienstes im Speyerer
Dom am dritten Adventssonntag stellt die Öffnung des Otto-Portals
im Südosten des Domes als „Heilige Pforte“ dar. Es ist dem heiligen
Bischof Otto von Bamberg gewidmet, der beim Dombau mitgewirkt
hat. Stadt und Domkapitel
unterzeichnen Vertrag zur Erneuerung der Außenbeleuchtung des
Doms
Stadt und Domkapitel
unterzeichnen Vertrag zur Erneuerung der Außenbeleuchtung des
Doms.jpg)
 Erste Entscheidung für weitere bauliche Entwicklung auf
echtem „Filet-Stück“ der Speyerer Innenstadt
Erste Entscheidung für weitere bauliche Entwicklung auf
echtem „Filet-Stück“ der Speyerer Innenstadt-01.jpg) Der Jury selbst hätten sieben Preisrichter und sechs
Stellvertreter angehört, die von zehn ausgewiesenen Fachleuten aus
unterschiedlichen Fachdisziplinen - von der Architektur über die
Denkmalpflege bis zur Stadtentwicklung - beraten wurden. Auch
Vertreter der vier „großen“ Fraktionen im Speyerer Stadtrat – von
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SWG - seien mit jeweils einem
Vertreter in der Jury vertreten gewesen.
Der Jury selbst hätten sieben Preisrichter und sechs
Stellvertreter angehört, die von zehn ausgewiesenen Fachleuten aus
unterschiedlichen Fachdisziplinen - von der Architektur über die
Denkmalpflege bis zur Stadtentwicklung - beraten wurden. Auch
Vertreter der vier „großen“ Fraktionen im Speyerer Stadtrat – von
CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen und SWG - seien mit jeweils einem
Vertreter in der Jury vertreten gewesen. Hinter diesem Planungsentwurf steht als Investor die
„Diringer und Scheidel Wohn-Gebewerbebau GmbH“ aus Mannheim, die
als international agierender Familienkonzern weltweit unterwegs
ist..
Hinter diesem Planungsentwurf steht als Investor die
„Diringer und Scheidel Wohn-Gebewerbebau GmbH“ aus Mannheim, die
als international agierender Familienkonzern weltweit unterwegs
ist.. Den dritten Platz, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe
von 4.000 Euro, konnte der Entwurf der „Arbeitsgemeinschaft
Bistumshaus“ aus den Saarbrücker Architekten Oliver Brünjes und der
„Khp Ingenieure GmbH“ aus Steinfeld gewinnen. Ihr Entwurf sieht
ebenfalls Wohnungen vor, ebenso kombiniert mit einem Hotel.
Den dritten Platz, verbunden mit einem Preisgeld in Höhe
von 4.000 Euro, konnte der Entwurf der „Arbeitsgemeinschaft
Bistumshaus“ aus den Saarbrücker Architekten Oliver Brünjes und der
„Khp Ingenieure GmbH“ aus Steinfeld gewinnen. Ihr Entwurf sieht
ebenfalls Wohnungen vor, ebenso kombiniert mit einem Hotel.-01.jpg) Nachdem die Entwürfe auf den Plätzen eins und zwei nach
Meinung der Jury sehr dicht beieinander lägen, seien sie von der
Jury intensiv weiterdiskutiert und dabei auch Ideen und
Ansatzpunkte für mögliche Verbesserungen aufgezeigt worden. Das
berichtete der Leiter der Hauptabteilung Finanzen und Immobilien
des Bistums Speyer, Domkapitular Peter Schappert. Das Domkapitel
wolle deshalb jetzt mit den beiden favorisierten Planverfassern in
weitergehende Gespräche zur Feinabstimmung ihrer Entwürfe
eintreten. „Danach treffen wir dann unsere endgültige Entscheidung
und der ausgewählte Investor kann dann seinen Bauantrag an die
Stadtverwaltung stellen“, erläuterte Schappert die nächsten
Verfahrensschritte.
Nachdem die Entwürfe auf den Plätzen eins und zwei nach
Meinung der Jury sehr dicht beieinander lägen, seien sie von der
Jury intensiv weiterdiskutiert und dabei auch Ideen und
Ansatzpunkte für mögliche Verbesserungen aufgezeigt worden. Das
berichtete der Leiter der Hauptabteilung Finanzen und Immobilien
des Bistums Speyer, Domkapitular Peter Schappert. Das Domkapitel
wolle deshalb jetzt mit den beiden favorisierten Planverfassern in
weitergehende Gespräche zur Feinabstimmung ihrer Entwürfe
eintreten. „Danach treffen wir dann unsere endgültige Entscheidung
und der ausgewählte Investor kann dann seinen Bauantrag an die
Stadtverwaltung stellen“, erläuterte Schappert die nächsten
Verfahrensschritte. Caritas-Kinderschutzdienst feiert sein 25-jähriges
gemeinsam mit Kindern der Kindertagesstätte St. Elisabeth und dem
Haus für Kinder St. Hedwig mit einer Luftballon-Aktion
Caritas-Kinderschutzdienst feiert sein 25-jähriges
gemeinsam mit Kindern der Kindertagesstätte St. Elisabeth und dem
Haus für Kinder St. Hedwig mit einer Luftballon-Aktion Der Einsatz
von Handpuppen sei eine Möglichkeit, insbesondere die kleineren
Kinder für ihre eigenen Grenzen, aber auch für die anderer Kinder
und im Umgang mit Erwachsenen zu sensibilisieren, so Sabrina
Wöhlert, Leitern der Kita St. Elisabeth. Sie war Gastgeberin für
die Jubiläumsfeier der Kinderschutzdienste. „Für unsere Erzieher
sind die Kinderschutzdienste eine wertvolle Unterstützung, wenn wir
Auffälligkeiten im Verhalten unserer Kinder entdecken“, sagt
sie.
Der Einsatz
von Handpuppen sei eine Möglichkeit, insbesondere die kleineren
Kinder für ihre eigenen Grenzen, aber auch für die anderer Kinder
und im Umgang mit Erwachsenen zu sensibilisieren, so Sabrina
Wöhlert, Leitern der Kita St. Elisabeth. Sie war Gastgeberin für
die Jubiläumsfeier der Kinderschutzdienste. „Für unsere Erzieher
sind die Kinderschutzdienste eine wertvolle Unterstützung, wenn wir
Auffälligkeiten im Verhalten unserer Kinder entdecken“, sagt
sie. Speyer- „60 Millionen Menschen sind
gegenwärtig auf der Flucht. Not und Perspektivlosigkeit zwingen
sie, ihre Heimat zu verlassen. Sie suchen Schutz und Beistand auch
bei uns. Indem wir für sie beten, bitten wir Gott um Hilfe.
Gleichzeitig ist unser Gebet ein Protest gegen das Vergessen. Es
stellt uns auch die Fluchtursachen vor Augen.
Speyer- „60 Millionen Menschen sind
gegenwärtig auf der Flucht. Not und Perspektivlosigkeit zwingen
sie, ihre Heimat zu verlassen. Sie suchen Schutz und Beistand auch
bei uns. Indem wir für sie beten, bitten wir Gott um Hilfe.
Gleichzeitig ist unser Gebet ein Protest gegen das Vergessen. Es
stellt uns auch die Fluchtursachen vor Augen. Bischof Wiesemann bringt in einem Brief an Bischof Pansard
die Verbundenheit mit dem französischen Partnerbistum angesichts
der Terroranschläge von Paris zum Ausdruck
Bischof Wiesemann bringt in einem Brief an Bischof Pansard
die Verbundenheit mit dem französischen Partnerbistum angesichts
der Terroranschläge von Paris zum Ausdruck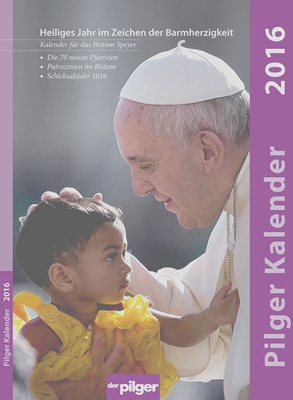 Bereits im 95.
Jahrgang: Pilger-Kalender 2016 liegt vor
Bereits im 95.
Jahrgang: Pilger-Kalender 2016 liegt vor Am 14.
November feiert Pfarrer Karl Gerhard Wien, langjähriger Leitender
Direktor der Diakonissen Speyer-Mannheim, seinen 80.
Geburtstag.
Am 14.
November feiert Pfarrer Karl Gerhard Wien, langjähriger Leitender
Direktor der Diakonissen Speyer-Mannheim, seinen 80.
Geburtstag.
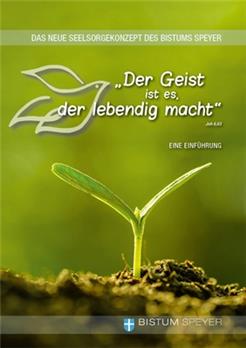 25-seitige
Publikation macht Grundlinien des neuen Seelsorgekonzepts deutlich
– Anregungen für die bisherigen Pfarrgemeinden zum Zusammenwachsen
in der neuen Pfarrei
25-seitige
Publikation macht Grundlinien des neuen Seelsorgekonzepts deutlich
– Anregungen für die bisherigen Pfarrgemeinden zum Zusammenwachsen
in der neuen Pfarrei
 Weihbischof
Otto Georgens und Oberkirchenrat Michael Gärtner, die die Predigt
in Dialogform hielten, spannten einen weiten Bogen von Jesus bis in
die Gegenwart. Sie erinnerten daran, dass Jesus selbst zum Handeln
aufrief. Seine Jünger folgten der Aufforderung und bewegten Großes:
Durch Worte und Taten schufen sie eine weltumspannende
Gemeinschaft. Der Missionsbefehl, das Evangelium allen Geschöpfen
zu verkünden, gilt nach wie vor, betonte Gärtner. Um das zu
verdeutlichen, beriefen sich der Oberkirchenrat und der Weihbischof
auf Franz von Assisi, der zu allen Geschöpfen – auch Blumen und
Tieren – gepredigt habe. Sie nannten ihn ein Vorbild. "Das
Evangelium verkünden – das geht nur ganzheitlich, mit Blick auf die
Einmaligkeit und Würde eines jeden Geschöpfes", brachte es Otto
Georgens auf den Punkt. "Gottes Heil betrifft nicht nur meine
Seele, sondern die ganze von Gott geschaffene Welt." Gärtner
knüpfte an: Franz von Assisi habe die Menschen nicht aufs Jenseits
vertröstet, sondern im Jetzt gehandelt, weil er an Gott glaubte.
Beide machten deutlich, dass das Klimapilgern als Antwort auf Jesu
Missionsbefehl zu sehen ist. Der Weg der Klimapilger "ist ein
echter Pilgerweg: religiös motiviert und missionarisch
ausgerichtet", betonte der Weihbischof. Gärtner fuhr fort: "Wer als
Klimapilger unterwegs ist, macht ernst mit dem Wort Jesu: 'Geht und
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.'"
Weihbischof
Otto Georgens und Oberkirchenrat Michael Gärtner, die die Predigt
in Dialogform hielten, spannten einen weiten Bogen von Jesus bis in
die Gegenwart. Sie erinnerten daran, dass Jesus selbst zum Handeln
aufrief. Seine Jünger folgten der Aufforderung und bewegten Großes:
Durch Worte und Taten schufen sie eine weltumspannende
Gemeinschaft. Der Missionsbefehl, das Evangelium allen Geschöpfen
zu verkünden, gilt nach wie vor, betonte Gärtner. Um das zu
verdeutlichen, beriefen sich der Oberkirchenrat und der Weihbischof
auf Franz von Assisi, der zu allen Geschöpfen – auch Blumen und
Tieren – gepredigt habe. Sie nannten ihn ein Vorbild. "Das
Evangelium verkünden – das geht nur ganzheitlich, mit Blick auf die
Einmaligkeit und Würde eines jeden Geschöpfes", brachte es Otto
Georgens auf den Punkt. "Gottes Heil betrifft nicht nur meine
Seele, sondern die ganze von Gott geschaffene Welt." Gärtner
knüpfte an: Franz von Assisi habe die Menschen nicht aufs Jenseits
vertröstet, sondern im Jetzt gehandelt, weil er an Gott glaubte.
Beide machten deutlich, dass das Klimapilgern als Antwort auf Jesu
Missionsbefehl zu sehen ist. Der Weg der Klimapilger "ist ein
echter Pilgerweg: religiös motiviert und missionarisch
ausgerichtet", betonte der Weihbischof. Gärtner fuhr fort: "Wer als
Klimapilger unterwegs ist, macht ernst mit dem Wort Jesu: 'Geht und
verkündet das Evangelium allen Geschöpfen.'" Georgens und
Gärtner wünschten sich zahlreiche Klimapilger. "Unsere geschundene
Schöpfung braucht Klimapilger", sagte der Weihbischof. Die Welt
brauche Menschen, die auf den Zusammenhang von gravierenden Umwelt-
und gesellschaftlichen Probleme aufmerksam machen und die die
Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zum
Umdenken aufrufen.
Georgens und
Gärtner wünschten sich zahlreiche Klimapilger. "Unsere geschundene
Schöpfung braucht Klimapilger", sagte der Weihbischof. Die Welt
brauche Menschen, die auf den Zusammenhang von gravierenden Umwelt-
und gesellschaftlichen Probleme aufmerksam machen und die die
Verantwortlichen in Politik, Gesellschaft und Wirtschaft zum
Umdenken aufrufen. Bremen/Speyer
(lk). Ich begrüße die Entscheidung des Bundestages, die
ein Verbot organisierter Hilfe bei der Selbsttötung ausspricht –
und so Sterbehilfevereinen die Grundlage ihres Handelns entzieht.
Damit wird der geschäftsmäßigen Werbung für den Suizid und den auf
Wiederholung angelegten Angeboten ein Riegel vorgeschoben. Niemand
darf Geschäfte mir der Not von Menschen machen.
Bremen/Speyer
(lk). Ich begrüße die Entscheidung des Bundestages, die
ein Verbot organisierter Hilfe bei der Selbsttötung ausspricht –
und so Sterbehilfevereinen die Grundlage ihres Handelns entzieht.
Damit wird der geschäftsmäßigen Werbung für den Suizid und den auf
Wiederholung angelegten Angeboten ein Riegel vorgeschoben. Niemand
darf Geschäfte mir der Not von Menschen machen. Sakristei-Außenwand
und Fenster des Mittelschiffs gereinigt und ausgebessert
Sakristei-Außenwand
und Fenster des Mittelschiffs gereinigt und ausgebessert So wie die Fenster
eines Wohnhauses dann und wann der Sanierung bedürfen, ist dies
auch bei einer Kathedrale notwendig. Die Obergadenfenster des
Speyerer Doms wurden zuletzt im 19. Jahrhundert komplett erneuert
und nun von Grund auf überarbeitet: gebrochene Glasscheiben wurden
erneuert, die Fenster gereinigt, lose Scheiben fixiert und die
Scheiben im Anschlussbereich der Gewände neu eingeputzt, wobei der
Farbton dem der umliegenden Mauersteine angepasst wurde. Bei den
Arbeiten an den Metallelementen wurden die nach 1960 ergänzten
unteren Bereiche der Fenster in Form und Verbleiung den oberen,
älteren Bereichen angeglichen um ein einheitliches Erscheinungsbild
zu erreichen. Im Rahmen der Restaurierung wurden auch alle Fenster
gereinigt, was bei Wintersonne besonders gut zur Geltung kommt.
So wie die Fenster
eines Wohnhauses dann und wann der Sanierung bedürfen, ist dies
auch bei einer Kathedrale notwendig. Die Obergadenfenster des
Speyerer Doms wurden zuletzt im 19. Jahrhundert komplett erneuert
und nun von Grund auf überarbeitet: gebrochene Glasscheiben wurden
erneuert, die Fenster gereinigt, lose Scheiben fixiert und die
Scheiben im Anschlussbereich der Gewände neu eingeputzt, wobei der
Farbton dem der umliegenden Mauersteine angepasst wurde. Bei den
Arbeiten an den Metallelementen wurden die nach 1960 ergänzten
unteren Bereiche der Fenster in Form und Verbleiung den oberen,
älteren Bereichen angeglichen um ein einheitliches Erscheinungsbild
zu erreichen. Im Rahmen der Restaurierung wurden auch alle Fenster
gereinigt, was bei Wintersonne besonders gut zur Geltung kommt. Beide Maßnahmen, die
an der Sakristei und an den Fenstern des Mittelschiffs, gehören zu
immer wiederkehrenden Bauaufgaben am Dom. „Turnusmäßig und ohne
große Überraschungen“ sind die Arbeiten, laut Dombaumeister Mario
Colletto, verlaufen. „Dabei weisen die neuesten Maßnahmen, nämlich
die der Restaurierungen der 1960er Jahre, heute die meisten Schäden
auf. Etwa der Zementputz des Sakristeiturms oder die Verfugungen
aus dieser Zeit“ berichtet der Dombaumeister.
Beide Maßnahmen, die
an der Sakristei und an den Fenstern des Mittelschiffs, gehören zu
immer wiederkehrenden Bauaufgaben am Dom. „Turnusmäßig und ohne
große Überraschungen“ sind die Arbeiten, laut Dombaumeister Mario
Colletto, verlaufen. „Dabei weisen die neuesten Maßnahmen, nämlich
die der Restaurierungen der 1960er Jahre, heute die meisten Schäden
auf. Etwa der Zementputz des Sakristeiturms oder die Verfugungen
aus dieser Zeit“ berichtet der Dombaumeister.

 Wenn wir in diesem Jahr der Deportation jüdischer
Mitmenschen nach Gurs vor 75 Jahren gedenken, dann tun wir dies
nicht nur, um die Erinnerung an diese schrecklichen Geschehnisse
wach zu halten, sondern auch um dafür zu sensibilisieren, dass
solche Gräueltaten nie wieder geschehen dürfen. Gerade auch die
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Blick in andere
Länder fordern uns heraus, uns zu Wort zu melden, wenn die Würde
des Menschen angetastet oder gar mit Füßen getreten wird.
Wenn wir in diesem Jahr der Deportation jüdischer
Mitmenschen nach Gurs vor 75 Jahren gedenken, dann tun wir dies
nicht nur, um die Erinnerung an diese schrecklichen Geschehnisse
wach zu halten, sondern auch um dafür zu sensibilisieren, dass
solche Gräueltaten nie wieder geschehen dürfen. Gerade auch die
aktuellen gesellschaftlichen Entwicklungen wie der Blick in andere
Länder fordern uns heraus, uns zu Wort zu melden, wenn die Würde
des Menschen angetastet oder gar mit Füßen getreten wird. Auf den
Nachfolger von Alexander Lauer warten vielfältige musikalische
Aufgaben
Auf den
Nachfolger von Alexander Lauer warten vielfältige musikalische
Aufgaben

 „Ermutigende und
wichtige Signale gesetzt“
„Ermutigende und
wichtige Signale gesetzt“ Statistische Angaben für das Jahr 2014 liegen vor
Statistische Angaben für das Jahr 2014 liegen vor Studenten vertreten Belange der Jugend
Studenten vertreten Belange der Jugend Landesebene aktiv. Als berufene Jugendvertreterin freue
sie sich darauf, die Interessen der Evangelischen Jugend in der
Landessynode vertreten zu können, so Holighaus.
Landesebene aktiv. Als berufene Jugendvertreterin freue
sie sich darauf, die Interessen der Evangelischen Jugend in der
Landessynode vertreten zu können, so Holighaus. Domkapitular
Franz Vogelgesang spricht Grußwort zur Landessynode der
Evangelischen Kirche der Pfalz / Bischof Wiesemann sendet
persönliche Glückwünsche an neu gewählten
Synodalpräsidenten
Domkapitular
Franz Vogelgesang spricht Grußwort zur Landessynode der
Evangelischen Kirche der Pfalz / Bischof Wiesemann sendet
persönliche Glückwünsche an neu gewählten
Synodalpräsidenten Jurist aus
Kaiserslautern tritt die Nachfolge von Henri Franck an – Präsidium
gewählt
Jurist aus
Kaiserslautern tritt die Nachfolge von Henri Franck an – Präsidium
gewählt
 Mehrsprachiges, umfassendes Online-Angebot mit vielen
aktuellen Informationen für Touristen und Domfreunde
freigeschaltet
Mehrsprachiges, umfassendes Online-Angebot mit vielen
aktuellen Informationen für Touristen und Domfreunde
freigeschaltet
 Weihbischof Otto Georgens, als Dompropst zugleich
Vorsitzender des Domkapitels, betonte, dass der Dom keine „stille
Gedenkstätte“ sei, sondern ein Ort, in dem sich „das ganze
Kirchenjahr über das Leben in seiner ganzen Fülle“ zeige. Dazu
zählten deshalb z.B. auch Berichte über den erst kürzlich wieder
überbrachten „Weinzehnt“ und die Freude der Menschen darüber. „Die
Dom-Homepage will den Dom in all seinen Facetten darstellen und
zeigen, dass dies ein wahrhaft lebendiger Ort ist“, so der
Weihbischof. „Dabei lässt sie erkennen, dass es das Anliegen des
Domkapitels und seiner Mitarbeiter ist, Menschen mit Augen, Ohren,
Herz und Verstand für den Dom zu begeistern.“
Weihbischof Otto Georgens, als Dompropst zugleich
Vorsitzender des Domkapitels, betonte, dass der Dom keine „stille
Gedenkstätte“ sei, sondern ein Ort, in dem sich „das ganze
Kirchenjahr über das Leben in seiner ganzen Fülle“ zeige. Dazu
zählten deshalb z.B. auch Berichte über den erst kürzlich wieder
überbrachten „Weinzehnt“ und die Freude der Menschen darüber. „Die
Dom-Homepage will den Dom in all seinen Facetten darstellen und
zeigen, dass dies ein wahrhaft lebendiger Ort ist“, so der
Weihbischof. „Dabei lässt sie erkennen, dass es das Anliegen des
Domkapitels und seiner Mitarbeiter ist, Menschen mit Augen, Ohren,
Herz und Verstand für den Dom zu begeistern.“ Domdekan Dr. Christoph Kohl erinnerte daran,
dass es in diesem Gotteshaus seit seiner Weihe Gottesdienste gebe
und dass seitdem auch festliche Kirchenmusik darin erklinge. „Wir
werden deshalb für das Internet sicher nichts „Neues“ erfinden,
sondern nur all das in neuer, übersichtlicherer Form präsentieren,
was auch heute schon - z.T. an ganz unterschiedlichen Stellen -
veröffentlicht wird und deshalb für so manchen Nutzer auch nur
schwer zu finden ist“. Informiert werden solle deshalb über alles,
was im Dom stattfindet. Dazu zählten vor allem Gottesdienste und
Wallfahrten, aber - aktuell – auch das Patroziniums Fest am 15.
August.
Domdekan Dr. Christoph Kohl erinnerte daran,
dass es in diesem Gotteshaus seit seiner Weihe Gottesdienste gebe
und dass seitdem auch festliche Kirchenmusik darin erklinge. „Wir
werden deshalb für das Internet sicher nichts „Neues“ erfinden,
sondern nur all das in neuer, übersichtlicherer Form präsentieren,
was auch heute schon - z.T. an ganz unterschiedlichen Stellen -
veröffentlicht wird und deshalb für so manchen Nutzer auch nur
schwer zu finden ist“. Informiert werden solle deshalb über alles,
was im Dom stattfindet. Dazu zählten vor allem Gottesdienste und
Wallfahrten, aber - aktuell – auch das Patroziniums Fest am 15.
August. Abschließend in dieser ersten Runde der Statements
erinnerte Domkustos Peter Schappert,
verantwortlich für die Erhaltung des UNESCO-Welterbes „Kaiserdom zu
Speyer“, daran, dass heute schon jährlich viele 100.000 Menschen
den Speyerer Dom besuchten. „Die Stadt Speyer geht davon aus, dass
jährlich über zwei Millionen Menschen in die Stadt kommen, von
denen wohl jeder zweite auch den Dom besucht“, machte er eine
Rechnung auf. Für diese Gäste sei es wichtig, vorab schon
Informationen über Gottesdienste, Öffnungszeiten und besondere
Angebote wie den Turmaufstieg zu erhalten, erläuterte der
Domkustos, der die konzeptionelle und redaktionelle Verantwortung
für den Internetauftritt trägt. Die Website biete einige
Basisinformationen zur Geschichte und zur baulichen Gestaltung des
Domes. Darüber hinaus würde sie den Besucher aber auch zum Gebet
einladen und dazu, den Dom in seiner geistlichen Bestimmung
wahrzunehmen.
Abschließend in dieser ersten Runde der Statements
erinnerte Domkustos Peter Schappert,
verantwortlich für die Erhaltung des UNESCO-Welterbes „Kaiserdom zu
Speyer“, daran, dass heute schon jährlich viele 100.000 Menschen
den Speyerer Dom besuchten. „Die Stadt Speyer geht davon aus, dass
jährlich über zwei Millionen Menschen in die Stadt kommen, von
denen wohl jeder zweite auch den Dom besucht“, machte er eine
Rechnung auf. Für diese Gäste sei es wichtig, vorab schon
Informationen über Gottesdienste, Öffnungszeiten und besondere
Angebote wie den Turmaufstieg zu erhalten, erläuterte der
Domkustos, der die konzeptionelle und redaktionelle Verantwortung
für den Internetauftritt trägt. Die Website biete einige
Basisinformationen zur Geschichte und zur baulichen Gestaltung des
Domes. Darüber hinaus würde sie den Besucher aber auch zum Gebet
einladen und dazu, den Dom in seiner geistlichen Bestimmung
wahrzunehmen. Übrigens: Ein „W-Lan-Hotspot“ befindet sich
derzeit schon in der Vorhalle des Domes – um weitere bemühe sich
das Domkapitel derzeit gemeinsam mit der Stadt Speyer.
Übrigens: Ein „W-Lan-Hotspot“ befindet sich
derzeit schon in der Vorhalle des Domes – um weitere bemühe sich
das Domkapitel derzeit gemeinsam mit der Stadt Speyer. In den nächsten Wochen und Monaten soll die Nutzung der
Seite intensiv begleitet, ausgewertet und weiter optimiert werden.
Federführend für die Umsetzung der Website ist die Speyerer
„Peregrinus GmbH“.
In den nächsten Wochen und Monaten soll die Nutzung der
Seite intensiv begleitet, ausgewertet und weiter optimiert werden.
Federführend für die Umsetzung der Website ist die Speyerer
„Peregrinus GmbH“. Die Konzeptentwicklung für die neue Dom-Webseite und die
Webseiten-Familie im Bistum Speyer hat die „Peregrinus GmbH“
geleistet, in deren Verlag auch die Bistumszeitung „der Pilger“ und
das neue „Pilger Magazin“ erscheinen. Als Dienstleister für Medien
und Kommunikation im Bistum Speyer kann „Peregrinus“ im Bereich
Internetkommunikation auf vielfältige Erfahrungen und
Referenzprojekte verweisen.
Die Konzeptentwicklung für die neue Dom-Webseite und die
Webseiten-Familie im Bistum Speyer hat die „Peregrinus GmbH“
geleistet, in deren Verlag auch die Bistumszeitung „der Pilger“ und
das neue „Pilger Magazin“ erscheinen. Als Dienstleister für Medien
und Kommunikation im Bistum Speyer kann „Peregrinus“ im Bereich
Internetkommunikation auf vielfältige Erfahrungen und
Referenzprojekte verweisen. Nur wenige Wochen nach ihrem 89. Geburtstag ist Oberin i.
R. Diakonisse Ilse Wendel am 7. Juli in Speyer
gestorben
Nur wenige Wochen nach ihrem 89. Geburtstag ist Oberin i.
R. Diakonisse Ilse Wendel am 7. Juli in Speyer
gestorben Die „gerüstfreie“
Zeit ist zu Ende – Arbeiten an der Außenwand der Sakristei und im
nördlichen Seitenschiff
Die „gerüstfreie“
Zeit ist zu Ende – Arbeiten an der Außenwand der Sakristei und im
nördlichen Seitenschiff Im nördlichen
Seitenschiff wird derzeit ein weiteres Gerüst aufgestellt.
Malerarbeiten, die vor etwa 10 Jahren unterbrochen wurden, sollen
nun abgeschlossen und Putzrisse beseitigt werden. „Geeignete Putze
sind unverzichtbar“, erklärt Dombaumeister Colletto, „sie sorgen
für eine Pufferung der Feuchte, insbesondere in den
Übergangszeiten, in denen die Luftfeuchte im Rauminneren ansteigen
kann, oft bis zu 90 Prozent. Dies ist eine wichtige Maßnahme zum
Bauerhalt.“
Im nördlichen
Seitenschiff wird derzeit ein weiteres Gerüst aufgestellt.
Malerarbeiten, die vor etwa 10 Jahren unterbrochen wurden, sollen
nun abgeschlossen und Putzrisse beseitigt werden. „Geeignete Putze
sind unverzichtbar“, erklärt Dombaumeister Colletto, „sie sorgen
für eine Pufferung der Feuchte, insbesondere in den
Übergangszeiten, in denen die Luftfeuchte im Rauminneren ansteigen
kann, oft bis zu 90 Prozent. Dies ist eine wichtige Maßnahme zum
Bauerhalt.“ Bischof
Wiesemann hat „Missio Canonica“ an 51 Religionslehrerinnen und
Religionslehrer verliehen
Bischof
Wiesemann hat „Missio Canonica“ an 51 Religionslehrerinnen und
Religionslehrer verliehen Der
Religionsunterricht beschert den Lehrern immer wieder
Überraschungen: Beim Thema Gottesbilder fragte eine Erstklässlerin
Isabelle Schreiner, ob Gott auch
ein Mädchen sein könnte. „Es ist toll, dass Schüler darüber
nachdenken“, freut sich die Lehrerin und ist immer wieder
beeindruckt, wie sehr die Kinder mitfühlen und mitdenken. „Manchmal
stellen sie tief greifende Fragen, die große theologische Themen
berühren“, hat sie erlebt. Ihre Grundschüler staunten zum Beispiel,
warum die Menschen traurig waren, als Jesus gestorben ist – obwohl
sie wussten, dass er weiterlebt. Schreiner ist begeistert: „Das
sind Momente, die nur der Religionsunterricht bietet.“ Religion ist
ihr Lieblingsfach. Sie wählte es im Studium als Schwerpunkt. In
ihrem Heimatort Edesheim ist die fröhliche junge Frau in der
Gemeinde fest verwurzelt und engagiert.
Der
Religionsunterricht beschert den Lehrern immer wieder
Überraschungen: Beim Thema Gottesbilder fragte eine Erstklässlerin
Isabelle Schreiner, ob Gott auch
ein Mädchen sein könnte. „Es ist toll, dass Schüler darüber
nachdenken“, freut sich die Lehrerin und ist immer wieder
beeindruckt, wie sehr die Kinder mitfühlen und mitdenken. „Manchmal
stellen sie tief greifende Fragen, die große theologische Themen
berühren“, hat sie erlebt. Ihre Grundschüler staunten zum Beispiel,
warum die Menschen traurig waren, als Jesus gestorben ist – obwohl
sie wussten, dass er weiterlebt. Schreiner ist begeistert: „Das
sind Momente, die nur der Religionsunterricht bietet.“ Religion ist
ihr Lieblingsfach. Sie wählte es im Studium als Schwerpunkt. In
ihrem Heimatort Edesheim ist die fröhliche junge Frau in der
Gemeinde fest verwurzelt und engagiert. Diakon Hartmut van Ehr als Beauftragten der
Polizeiseelsorge verabschiedet
Diakon Hartmut van Ehr als Beauftragten der
Polizeiseelsorge verabschiedet „Sie waren das Gesicht der Polizeiseelsorge im Bistum
Speyer. Sein Herz schlägt für die Polizei!“ In sehr persönlichen
Worten zeichnete Domkapitular Franz Vogelgesang den Weg von
Hartmut von Ehr nach, der seit 1979 in der Diözese Speyer in
mehrere Stationen im seelsorgerischen Bereich tätig war. Nach dem
Theologiestudium waren die erste Station in Harthausen. Danach
schnupperte er, als Pastoralreferent der deutschen Gemeinde in
Tokio, Auslandsluft. Nach der Rückkehr in die Heimat führte sein
Weg direkt in die Polizeiseelsorge, welche Domkapitular Vogelgesang
als eine Herzensangelegenheit von von Ehr bezeichnete. „Steht auch
seine Familie immer an 1. Stelle, so gibt es keinen großen
Zwischenraum zur Polizeiseelsorge“ betonte Vogelgesang. Als
Beispiel nannte der Domkapitular die Besuche, welche von Ehr
bei den verschiedensten Revieren gerade am Hl. Abend und
Weihnachten durchführte.
„Sie waren das Gesicht der Polizeiseelsorge im Bistum
Speyer. Sein Herz schlägt für die Polizei!“ In sehr persönlichen
Worten zeichnete Domkapitular Franz Vogelgesang den Weg von
Hartmut von Ehr nach, der seit 1979 in der Diözese Speyer in
mehrere Stationen im seelsorgerischen Bereich tätig war. Nach dem
Theologiestudium waren die erste Station in Harthausen. Danach
schnupperte er, als Pastoralreferent der deutschen Gemeinde in
Tokio, Auslandsluft. Nach der Rückkehr in die Heimat führte sein
Weg direkt in die Polizeiseelsorge, welche Domkapitular Vogelgesang
als eine Herzensangelegenheit von von Ehr bezeichnete. „Steht auch
seine Familie immer an 1. Stelle, so gibt es keinen großen
Zwischenraum zur Polizeiseelsorge“ betonte Vogelgesang. Als
Beispiel nannte der Domkapitular die Besuche, welche von Ehr
bei den verschiedensten Revieren gerade am Hl. Abend und
Weihnachten durchführte. Supervision – eine Hilfe für Beamtinnen und Beamte in
Krisensituationen – dies hat Diakon von Ehr noch als letztes
Projekt und Aufgabe auf den Weg gebracht und wird, nach den Worten
vieler im Polizeidienst Verantwortlicher, weiter intensiv
verfolgt werden. Nicht zu vergessen den Krankenbesuchsdienst, der
auf Anregung von Diakon von Ehr eingeführt wurde und der bei vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer offene Ohren und Herzen
gefunden hat. Ein Dienst, den die oder der sehr zu schätzen weis,
wenn er denn bei Krankheit freundschaftliche Unterstützung
erfährt.
Supervision – eine Hilfe für Beamtinnen und Beamte in
Krisensituationen – dies hat Diakon von Ehr noch als letztes
Projekt und Aufgabe auf den Weg gebracht und wird, nach den Worten
vieler im Polizeidienst Verantwortlicher, weiter intensiv
verfolgt werden. Nicht zu vergessen den Krankenbesuchsdienst, der
auf Anregung von Diakon von Ehr eingeführt wurde und der bei vielen
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer offene Ohren und Herzen
gefunden hat. Ein Dienst, den die oder der sehr zu schätzen weis,
wenn er denn bei Krankheit freundschaftliche Unterstützung
erfährt.
 Hartmut von Ehr dankte, in sehr persönlichen
Abschiedsworten, Allen, die ihn in den 25 Jahren bei der
Polizeiseelsorge begleitet und in vielfältigster Weise unterstützt
haben. Seinem Nachfolger, Patrick Stöbener, wünschte der scheidende
Seelsorger die Unterstützung welche er selbst erfahren hat, viel
Freude in diesem wichtigen Dienst und Gottes Segen.
Hartmut von Ehr dankte, in sehr persönlichen
Abschiedsworten, Allen, die ihn in den 25 Jahren bei der
Polizeiseelsorge begleitet und in vielfältigster Weise unterstützt
haben. Seinem Nachfolger, Patrick Stöbener, wünschte der scheidende
Seelsorger die Unterstützung welche er selbst erfahren hat, viel
Freude in diesem wichtigen Dienst und Gottes Segen.
 „Aufstehen zum Leben“: Frankenthalerinnen haben aus Schal
Umhängetasche gefertigt
„Aufstehen zum Leben“: Frankenthalerinnen haben aus Schal
Umhängetasche gefertigt „2014er Sausenheimer Riesling trocken“ aus dem Weingut
Gaul soll helfen, neue Beleuchtung in der Gedächtniskirche zu
finanzieren
„2014er Sausenheimer Riesling trocken“ aus dem Weingut
Gaul soll helfen, neue Beleuchtung in der Gedächtniskirche zu
finanzieren Als Dekan und Pfarrer der Gedächtniskirchengemeinde
obliege es ihm nicht allein, seine Nase ins Weinglas zu tauchen, um
im Interesse und zum Wohle seiner „Schäfchen“ den besten Wein für
sie auszuwählen, erklärte Dekan Jäckle in seiner Begrüßung – nein,
als gelernterTheologe habe er seine Nase natürlich auch in die
Bibel gesteckt und dort den Begriff „Wein“ - real und allegorisch -
an gleich 220 Stellen wiedergefunden. Vom „Wein, der des Menschen
Herz erfreut“ bis hin zu dem Gleichnis, in dem
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock – Ihr seid die
Reben“ - viele Zitate belegten, dass Jesus „kein Kostverächter“
gewesen sei und auch einen „guten Tropfen“ durchaus zu genießen
verstanden habe.
Als Dekan und Pfarrer der Gedächtniskirchengemeinde
obliege es ihm nicht allein, seine Nase ins Weinglas zu tauchen, um
im Interesse und zum Wohle seiner „Schäfchen“ den besten Wein für
sie auszuwählen, erklärte Dekan Jäckle in seiner Begrüßung – nein,
als gelernterTheologe habe er seine Nase natürlich auch in die
Bibel gesteckt und dort den Begriff „Wein“ - real und allegorisch -
an gleich 220 Stellen wiedergefunden. Vom „Wein, der des Menschen
Herz erfreut“ bis hin zu dem Gleichnis, in dem
Jesus sagt: „Ich bin der Weinstock – Ihr seid die
Reben“ - viele Zitate belegten, dass Jesus „kein Kostverächter“
gewesen sei und auch einen „guten Tropfen“ durchaus zu genießen
verstanden habe. Dies habe der Heiland mit dem großen Reformator
Martin Luther gemeinsam gehabt, von dem so deftige
Aussagen stammen sollen wie die:„Wer nicht liebt Wein, Weib und
Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang“. Und weil er gerade so
schön am 'Zitieren' war und es so gut in seinen Duktus passte,
schob Jäckle noch eine weitere Sentenz hinterher, die ihm
zugegebenermaßen noch kurzfrisrig eingefallen sei: „Wer Wein
trinkt, dem geht ein Licht auf – und so manchem sogar ein ganzer
Kronleuchter!“. Und damit war der Geistliche auch schon bei dem
nächsten größeren Projekt zugunsten der Gedächtniskirche angelangt,
für das in diesen Tagen die Planung abgeschlossen werden soll: Eine
komplett neue Beleuchtungsanlage für das Innere des Gotteshauses,
für die die bauausführende Firma schon mit dem Eingravieren der
Namen der „edlen Spender“ auf den Kronleuchtern begonnen habe. Bis
Weihnachten, so erhofft es sich Dekan Jäckle, könne die einem
komplexen Beleuchtungskonzept folgende Gesamtmaßnahme wohl
abgeschlossen sein und so die Kirche, rechtzeitig zur Feier der
Geburt Christi, in „neuem Licht“ erstrahlen.
Dies habe der Heiland mit dem großen Reformator
Martin Luther gemeinsam gehabt, von dem so deftige
Aussagen stammen sollen wie die:„Wer nicht liebt Wein, Weib und
Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang“. Und weil er gerade so
schön am 'Zitieren' war und es so gut in seinen Duktus passte,
schob Jäckle noch eine weitere Sentenz hinterher, die ihm
zugegebenermaßen noch kurzfrisrig eingefallen sei: „Wer Wein
trinkt, dem geht ein Licht auf – und so manchem sogar ein ganzer
Kronleuchter!“. Und damit war der Geistliche auch schon bei dem
nächsten größeren Projekt zugunsten der Gedächtniskirche angelangt,
für das in diesen Tagen die Planung abgeschlossen werden soll: Eine
komplett neue Beleuchtungsanlage für das Innere des Gotteshauses,
für die die bauausführende Firma schon mit dem Eingravieren der
Namen der „edlen Spender“ auf den Kronleuchtern begonnen habe. Bis
Weihnachten, so erhofft es sich Dekan Jäckle, könne die einem
komplexen Beleuchtungskonzept folgende Gesamtmaßnahme wohl
abgeschlossen sein und so die Kirche, rechtzeitig zur Feier der
Geburt Christi, in „neuem Licht“ erstrahlen. Je zwei Euro des 8,50 Euro pro Flasche kostenden
„Sausenheimer Rieslings“ werden in die neue Beleuchtung fließen, so
der Dekan – bei zunächst 1.000 abgefüllten Flachen also 2.000 Euro
– sicher nicht zuviel, damit „den Frommen das Licht aufgeht“, wie
es in Psalm 112 und bei Felix Mendelssohn-Bartholdy heißt.
Je zwei Euro des 8,50 Euro pro Flasche kostenden
„Sausenheimer Rieslings“ werden in die neue Beleuchtung fließen, so
der Dekan – bei zunächst 1.000 abgefüllten Flachen also 2.000 Euro
– sicher nicht zuviel, damit „den Frommen das Licht aufgeht“, wie
es in Psalm 112 und bei Felix Mendelssohn-Bartholdy heißt. Dorothee Gaul stellte sodann den ausgewählten
Riesling für den Bauverein der Speyerer Gedächtniskirche als eine
„trockene“ Kreszenz vor - „puristisch und selbstbewußt und mit
einem fein-edlen Apfelgeschmack“, in dem sich der „sehr kalkhaltige
Boden“, auf dem die Trauben zur Reife gelangen, auf das Feinste
wiederfindet.
Dorothee Gaul stellte sodann den ausgewählten
Riesling für den Bauverein der Speyerer Gedächtniskirche als eine
„trockene“ Kreszenz vor - „puristisch und selbstbewußt und mit
einem fein-edlen Apfelgeschmack“, in dem sich der „sehr kalkhaltige
Boden“, auf dem die Trauben zur Reife gelangen, auf das Feinste
wiederfindet. Im Speyerer
Dom herrschen im Hochsommer auch ohne Klimaanlage angenehme
Temperaturen
Im Speyerer
Dom herrschen im Hochsommer auch ohne Klimaanlage angenehme
Temperaturen Besucher
sind herzlich eingeladen, die Kühle des Ortes zu genießen und im
Dom zu verweilen.
Besucher
sind herzlich eingeladen, die Kühle des Ortes zu genießen und im
Dom zu verweilen.

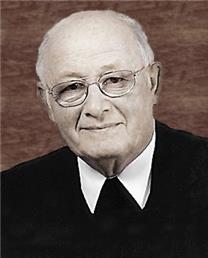 Fast 20 Jahre
Regens des Priesterseminars St. German in Speyer – Verantwortung
für verschiedene Aufgabenfelder in der Bistumsleitung
Fast 20 Jahre
Regens des Priesterseminars St. German in Speyer – Verantwortung
für verschiedene Aufgabenfelder in der Bistumsleitung
 Nachrichten aus allen katholischen Einrichtungen der
Pfarreiengemeinschaft werden vom Team in der Onlineredaktion
eingepflegt. Pfarrer Eric Klein und Pastoralreferent Steffen
Glombitza erhalten die Informationen, Textvorlagen und Termine
direkt von Ehrenamtlichen, die in der Gemeindearbeit und den
katholischen Einrichtungen vor Ort aktiv sind. Als wichtige
Informationsquelle für die Gemeindearbeit ist beispielsweise auch
der Pfarrbrief online abrufbar.
Nachrichten aus allen katholischen Einrichtungen der
Pfarreiengemeinschaft werden vom Team in der Onlineredaktion
eingepflegt. Pfarrer Eric Klein und Pastoralreferent Steffen
Glombitza erhalten die Informationen, Textvorlagen und Termine
direkt von Ehrenamtlichen, die in der Gemeindearbeit und den
katholischen Einrichtungen vor Ort aktiv sind. Als wichtige
Informationsquelle für die Gemeindearbeit ist beispielsweise auch
der Pfarrbrief online abrufbar. Speyer- Die Evangelische Kirche der Pfalz und die
Diakonie Pfalz unterstützen den Einsatz der Diakonie
Katastrophenhilfe für die Erdbebenopfer in Nepal mit 10.000 Euro
Soforthilfe. Gleichzeitig rufen sie zu Spenden auf.
Speyer- Die Evangelische Kirche der Pfalz und die
Diakonie Pfalz unterstützen den Einsatz der Diakonie
Katastrophenhilfe für die Erdbebenopfer in Nepal mit 10.000 Euro
Soforthilfe. Gleichzeitig rufen sie zu Spenden auf. Konzert zu Gunsten des Speyerer Dom
Konzert zu Gunsten des Speyerer Dom Ein gewaltiger, beeindruckender Anblick bot sich
den Gästen und den Ehrengästen unter ihnen der erem.
Bischof, Anton Schlembach und Weihbischof Otto
Georgens, die vom 1. Vorsitzenden des Dombauvereins, Dr.
Wolfgang Hissnauer, willkommen geheißen wurden.
Ein gewaltiger, beeindruckender Anblick bot sich
den Gästen und den Ehrengästen unter ihnen der erem.
Bischof, Anton Schlembach und Weihbischof Otto
Georgens, die vom 1. Vorsitzenden des Dombauvereins, Dr.
Wolfgang Hissnauer, willkommen geheißen wurden. Von moderneren Stücken wie „Mashiti aus Südafrika, oder
„My Lord what a morning, leiten die Männer gemeinsam mit den Frauen
zu konzertanteren Weisen über. „Sancta Maria“ von Johann Schweitzer
war genau so ein Hörgenuss wie “Ave Maria. Wenn ich ein Glöcklein
wär“ aus der Feder von J. Siegel. Franz Schubert zeichnet für
„Sanctus“ verantwortlich, Giuseppe Verdi für „La Vergine – die
Macht des Schicksals“.
Von moderneren Stücken wie „Mashiti aus Südafrika, oder
„My Lord what a morning, leiten die Männer gemeinsam mit den Frauen
zu konzertanteren Weisen über. „Sancta Maria“ von Johann Schweitzer
war genau so ein Hörgenuss wie “Ave Maria. Wenn ich ein Glöcklein
wär“ aus der Feder von J. Siegel. Franz Schubert zeichnet für
„Sanctus“ verantwortlich, Giuseppe Verdi für „La Vergine – die
Macht des Schicksals“.
_1.jpg)
_1.jpg) Der Leiter der Abteilung Pfarrverbände und
Kindertagesstätten im Bischöflichen Ordinariat, Joachim
Vatter, der auch den Festabend moderierte, dankte in
seiner Ansprache daher auch den pastoralen Begleitern für ihre
Unterstützung in der Umsetzung. In dem Qualitätsprozess habe man
großen Wert darauf gelegt, dass alle Akteure eng zusammenarbeiten
und sich miteinander vernetzen. Als „einmalig“ würdigte er die
Tatsache, dass sich einige pädagogische Berater und
Verwaltungskräfte im Rahmen des Prozesses zu Qualitätsberatern
hatten fortbilden lassen.
Der Leiter der Abteilung Pfarrverbände und
Kindertagesstätten im Bischöflichen Ordinariat, Joachim
Vatter, der auch den Festabend moderierte, dankte in
seiner Ansprache daher auch den pastoralen Begleitern für ihre
Unterstützung in der Umsetzung. In dem Qualitätsprozess habe man
großen Wert darauf gelegt, dass alle Akteure eng zusammenarbeiten
und sich miteinander vernetzen. Als „einmalig“ würdigte er die
Tatsache, dass sich einige pädagogische Berater und
Verwaltungskräfte im Rahmen des Prozesses zu Qualitätsberatern
hatten fortbilden lassen. Der
Leiter der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, Friedhelm Schneider,
geht in den Ruhestand
Der
Leiter der Arbeitsstelle Frieden und Umwelt, Friedhelm Schneider,
geht in den Ruhestand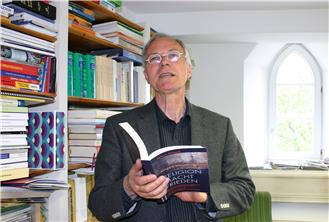 Bei dem
Versuch, Menschen für friedensethische Fragen zu sensibilisieren,
kann Schneider auf eine breite publizistische Tätigkeit
zurückblicken. Hunderte von Broschüren und Artikeln hat er im Laufe
der Jahre verfasst. 24 Jahre lang war er leitender Redakteur der
EKD-Zeitschrift „zivil“, die alle 50.000 evangelischen Zivis
erreichte. Über Jahrzehnte begleitete er Kriegsdienstverweigerer
beim Prozess der Gewissensentscheidung. Der von ihm aufgebaute
Auslandsdienst in Frankreich und Belgien half, Kriegsgegner aus
benachbarten Ländern miteinander ins Gespräch zu bringen,
Feindbilder abzubauen und europäische Perspektiven zu eröffnen.
Bei dem
Versuch, Menschen für friedensethische Fragen zu sensibilisieren,
kann Schneider auf eine breite publizistische Tätigkeit
zurückblicken. Hunderte von Broschüren und Artikeln hat er im Laufe
der Jahre verfasst. 24 Jahre lang war er leitender Redakteur der
EKD-Zeitschrift „zivil“, die alle 50.000 evangelischen Zivis
erreichte. Über Jahrzehnte begleitete er Kriegsdienstverweigerer
beim Prozess der Gewissensentscheidung. Der von ihm aufgebaute
Auslandsdienst in Frankreich und Belgien half, Kriegsgegner aus
benachbarten Ländern miteinander ins Gespräch zu bringen,
Feindbilder abzubauen und europäische Perspektiven zu eröffnen. Verbindungsmodell von Lutheranern und Unierten im
Mittelpunkt des Berichts vor der Vollkonferenz
Verbindungsmodell von Lutheranern und Unierten im
Mittelpunkt des Berichts vor der Vollkonferenz Bistum Speyer schreibt Planung- und
Investorenwettbewerb aus – Preisgericht beurteilt die Konzepte im
November
Bistum Speyer schreibt Planung- und
Investorenwettbewerb aus – Preisgericht beurteilt die Konzepte im
November
 Stadtjugendpfarrer von Kaiserslautern wechselt in
landeskirchliche Arbeitsstelle
Stadtjugendpfarrer von Kaiserslautern wechselt in
landeskirchliche Arbeitsstelle „Stipendienwerk Samenkorn“ will guatematekischen
Jugendlichen aus dem Volk der Maya Bildung und eine bessere Zukunft
ermöglichen
„Stipendienwerk Samenkorn“ will guatematekischen
Jugendlichen aus dem Volk der Maya Bildung und eine bessere Zukunft
ermöglichen Bildung sei in Guatemala noch immer ein Privileg für eine
reiche Ober- und allenfalls eine Mittelschicht, so Christian Stich.
Nur jeder fünfte Jugendliche schaffe deshalb einen Schulabschluss
der Sekundarstufe - nur einer von Fünfzig ein Examen an einer
Universität. Besonders für die bis heute diskriminierten
Jugendlichen aus dem indigenen Volk der Maya sei der Weg zu Bildung
noch immer weitestgehend verschlossen, gäbe es nicht Einrichtungen
wie das Stipendienwerk „Samenkorn“.
Bildung sei in Guatemala noch immer ein Privileg für eine
reiche Ober- und allenfalls eine Mittelschicht, so Christian Stich.
Nur jeder fünfte Jugendliche schaffe deshalb einen Schulabschluss
der Sekundarstufe - nur einer von Fünfzig ein Examen an einer
Universität. Besonders für die bis heute diskriminierten
Jugendlichen aus dem indigenen Volk der Maya sei der Weg zu Bildung
noch immer weitestgehend verschlossen, gäbe es nicht Einrichtungen
wie das Stipendienwerk „Samenkorn“. Das Stipendienwerk selbst sei bereits vor etwas mehr als
20 Jahren von der deutschen Journalistin und Politologin
Maria Christine Zauzich gegründet worden, die am 2. August
2009 leider bei einem Badeunfall an der guatemaltekischen
Pazifikküste ums Leben gekommen sei.
Das Stipendienwerk selbst sei bereits vor etwas mehr als
20 Jahren von der deutschen Journalistin und Politologin
Maria Christine Zauzich gegründet worden, die am 2. August
2009 leider bei einem Badeunfall an der guatemaltekischen
Pazifikküste ums Leben gekommen sei. Zu der finanziellen Unterstützung komme zudem ein
begleitendes Bildungsprogramm, in dem „Samenkorn“ zum Beispiel die
Sprachkenntnisse der Stipendiaten erweitere, die in ihrer Mehrzahl
nur eine der gut zwanzig traditionellen Maya-Sprachen sprächen und
bereits bei der Amtssprache Spanisch oft erhebliche Defizite
aufweisen würden.
Zu der finanziellen Unterstützung komme zudem ein
begleitendes Bildungsprogramm, in dem „Samenkorn“ zum Beispiel die
Sprachkenntnisse der Stipendiaten erweitere, die in ihrer Mehrzahl
nur eine der gut zwanzig traditionellen Maya-Sprachen sprächen und
bereits bei der Amtssprache Spanisch oft erhebliche Defizite
aufweisen würden. Das Jahresbudget von „Samenkorn“ liege derzeit übrigens
bei etwa 125.000 Euro im Jahr und werde zum größten Teil von dem
deutschen Unterstützerkreis „Samenkorn e.V“ aufgebracht. Gemeinsam
mit Christian Stich arbeiten derzeit vier Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für „Samenkorn“ - alle aus dem Volk der Maya - unter
ihnen auch eine Psychologin.
Das Jahresbudget von „Samenkorn“ liege derzeit übrigens
bei etwa 125.000 Euro im Jahr und werde zum größten Teil von dem
deutschen Unterstützerkreis „Samenkorn e.V“ aufgebracht. Gemeinsam
mit Christian Stich arbeiten derzeit vier Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für „Samenkorn“ - alle aus dem Volk der Maya - unter
ihnen auch eine Psychologin. Für die 24-jährige Jura-Studentin Maria-Jose
Xiloj sei die Begegnung mit „Samenkorn“ so etwas wie ein
„Weckruf“ gewesen.Sie habe dadurch viel Selbstbewusstsein dazu
gewonnen und glaube deshalb heute auch stärker als früher an sich
und ihre eigenen Fähigkeiten. Schon jetzt unterstütze sie die
Menschen in ihrem Dorf bei ihrer Korrespondenz mit Behörden und
anderen offiziellen Einrichtungen. Wichtig aber sei für sie vor
allem die Ermutigung, die sie durch „Samenkorn“ erfahren habe und
die sie nun an andere weitergeben könne. „Du kannst das auch
schaffen“ sei deshalb ein Satz, den die Menschen in ihrem Umfeld
häufig von ihr zu hören bekommen würden.
Für die 24-jährige Jura-Studentin Maria-Jose
Xiloj sei die Begegnung mit „Samenkorn“ so etwas wie ein
„Weckruf“ gewesen.Sie habe dadurch viel Selbstbewusstsein dazu
gewonnen und glaube deshalb heute auch stärker als früher an sich
und ihre eigenen Fähigkeiten. Schon jetzt unterstütze sie die
Menschen in ihrem Dorf bei ihrer Korrespondenz mit Behörden und
anderen offiziellen Einrichtungen. Wichtig aber sei für sie vor
allem die Ermutigung, die sie durch „Samenkorn“ erfahren habe und
die sie nun an andere weitergeben könne. „Du kannst das auch
schaffen“ sei deshalb ein Satz, den die Menschen in ihrem Umfeld
häufig von ihr zu hören bekommen würden. Ein Satz, den wohl auch die 21jährige Ana
Araceli oft gehört hat, die sich – eine Besonderheit im
Bildungswesen in Guatemala - derzeit auf ihren Beruf vorbereitet,
der sie gleichermaßen zur Arbeit als Grundschullehrerin wie zur
Erzieherin qualifizieren wird. Ana hat eine typische
guatemaltekische Karriere hinter sich: Schwester vieler Brüder und
Schwestern - Eltern, die Bildung für Mädchen für überflüssig halten
- da musste sie sich ihren Weg zu Ausbildung aus eigener Kraft
erkämpfen.
Ein Satz, den wohl auch die 21jährige Ana
Araceli oft gehört hat, die sich – eine Besonderheit im
Bildungswesen in Guatemala - derzeit auf ihren Beruf vorbereitet,
der sie gleichermaßen zur Arbeit als Grundschullehrerin wie zur
Erzieherin qualifizieren wird. Ana hat eine typische
guatemaltekische Karriere hinter sich: Schwester vieler Brüder und
Schwestern - Eltern, die Bildung für Mädchen für überflüssig halten
- da musste sie sich ihren Weg zu Ausbildung aus eigener Kraft
erkämpfen. Der 22jährige Annibal Garcia, der wie
die anderen Mitglieder der Besuchergruppe dank des regelmäßigen
Umgangs mit Christian Stich inzwischen durchaus brauchbar Deutsch
spricht, will nach dem Abitur Ökonomie studieren. Was ihn mit
seinen Kolleginnen und Kollegen eint, ist die feste Absicht, ihre
dank „Samenkorn“ gewonnenen Kenntnisse ganz in den Dienst ihres
Volkes, der Maya, zu stecken, das seit den Jahrhunderten der
Unterwerfung durch ihre spanischen Eroberer unendlich viel zu
leiden hatte.
Der 22jährige Annibal Garcia, der wie
die anderen Mitglieder der Besuchergruppe dank des regelmäßigen
Umgangs mit Christian Stich inzwischen durchaus brauchbar Deutsch
spricht, will nach dem Abitur Ökonomie studieren. Was ihn mit
seinen Kolleginnen und Kollegen eint, ist die feste Absicht, ihre
dank „Samenkorn“ gewonnenen Kenntnisse ganz in den Dienst ihres
Volkes, der Maya, zu stecken, das seit den Jahrhunderten der
Unterwerfung durch ihre spanischen Eroberer unendlich viel zu
leiden hatte. Weihbischof Otto Georgens, der mit einer
Delegation von „Adveniat“ das Land mit all seinen Problemen bereits
selbst kennenlernen konnte, zeigte sich tief beeindruckt von diesem
Projekt, das „in Menschen und ihre Bildung“ investiere. „Was als
Samenkorn vor mehr als zwanzig Jahren in den Boden gelegt wurde,
ist zu einem starken Baum emporgewachsen und trägt heute reiche
Frucht“, betonte Georgens. Der Weihbischof verband schließlich
seine Würdigung der Arbeit vor Ort in Guatemala mit der Hoffnung,
dass die Unterstützung für dieses Stipendienprojekt in Deutschland
nicht erlahmen möge.
Weihbischof Otto Georgens, der mit einer
Delegation von „Adveniat“ das Land mit all seinen Problemen bereits
selbst kennenlernen konnte, zeigte sich tief beeindruckt von diesem
Projekt, das „in Menschen und ihre Bildung“ investiere. „Was als
Samenkorn vor mehr als zwanzig Jahren in den Boden gelegt wurde,
ist zu einem starken Baum emporgewachsen und trägt heute reiche
Frucht“, betonte Georgens. Der Weihbischof verband schließlich
seine Würdigung der Arbeit vor Ort in Guatemala mit der Hoffnung,
dass die Unterstützung für dieses Stipendienprojekt in Deutschland
nicht erlahmen möge. Sanierung und Umbau des Speyerer Priesterseminars tritt in
ihre „heiße“ Phase ein
Sanierung und Umbau des Speyerer Priesterseminars tritt in
ihre „heiße“ Phase ein Wie Molitor ausführte, leiste das neue Blockheizkraftwerk
(BHKW), das neben dem Priesterseminar auch das benachbarte
Karmel-Kloster mit Strom und Wärme versorgen wird, gleichzeitig 50
Kwh elektrische sowie 81 kwh thermische Energie. Angetrieben wird
dieses BHKW durch einen stationären Gasmotor mit 145 KW Leistung.
Die aus dem Kühlwasser des Gasmotors gewonnene Abwärme wird dabei
ebenso in das Heizungssystem eingespeist wie die Wärme aus den vier
zusätzlich für Bedarfsspitzen an kalten Tagen vorgehaltenen
Brennwertkesseln, die sich je nach Bedarf kaskadenartig selbständig
zuschalten.
Wie Molitor ausführte, leiste das neue Blockheizkraftwerk
(BHKW), das neben dem Priesterseminar auch das benachbarte
Karmel-Kloster mit Strom und Wärme versorgen wird, gleichzeitig 50
Kwh elektrische sowie 81 kwh thermische Energie. Angetrieben wird
dieses BHKW durch einen stationären Gasmotor mit 145 KW Leistung.
Die aus dem Kühlwasser des Gasmotors gewonnene Abwärme wird dabei
ebenso in das Heizungssystem eingespeist wie die Wärme aus den vier
zusätzlich für Bedarfsspitzen an kalten Tagen vorgehaltenen
Brennwertkesseln, die sich je nach Bedarf kaskadenartig selbständig
zuschalten. Der
langjährige Bau- und Finanzdezernent der Landeskirche wurde 92
Jahre alt
Der
langjährige Bau- und Finanzdezernent der Landeskirche wurde 92
Jahre alt
 Neu im
Presbyterium: Dirk Pohlmann aus Römerberg – Interesse auch an
übergeordneten Gremien
Neu im
Presbyterium: Dirk Pohlmann aus Römerberg – Interesse auch an
übergeordneten Gremien Gläubige begehen mit feierlichen Ostergottesdiensten den
Höhepunkt des Kirchenjahres
Gläubige begehen mit feierlichen Ostergottesdiensten den
Höhepunkt des Kirchenjahres Der
Mädchenchor, die Domsingknaben, der Domchor und das Domorchester
führten im Rahmen des festlichen Gottesdienstes die „Missa in C“
(„Spaurmesse“, KV 258) von Wolfgang Amadeus Mozart und das
„Halleluja“ aus dem „Messiah“ von Georg Friedrich Händel auf.
Der
Mädchenchor, die Domsingknaben, der Domchor und das Domorchester
führten im Rahmen des festlichen Gottesdienstes die „Missa in C“
(„Spaurmesse“, KV 258) von Wolfgang Amadeus Mozart und das
„Halleluja“ aus dem „Messiah“ von Georg Friedrich Händel auf. Begonnen hatte der rund dreistündige Gottesdienst mit der
Weihe des Osterfeuers und der Osterkerze in der Domvorhalle.
Anschließend zogen die Gläubigen, darunter die Kommunionkinder der
Dompfarrei, mit ihren Kerzen in die völlig dunkle Kathedrale und
gaben das Licht, Symbol für den auferstandenen Christus, an alle
Mitfeiernden weiter.
Begonnen hatte der rund dreistündige Gottesdienst mit der
Weihe des Osterfeuers und der Osterkerze in der Domvorhalle.
Anschließend zogen die Gläubigen, darunter die Kommunionkinder der
Dompfarrei, mit ihren Kerzen in die völlig dunkle Kathedrale und
gaben das Licht, Symbol für den auferstandenen Christus, an alle
Mitfeiernden weiter..jpg) „Er
hat sich in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt des
Weltkulturdenkmals Speyerer Dom verdient gemacht“
„Er
hat sich in außergewöhnlicher Weise um den Erhalt des
Weltkulturdenkmals Speyerer Dom verdient gemacht“ Weihbischof Otto Georgens ruft bei Karfreitagsliturgie im
Dom dazu auf, nicht bei Enttäuschungen stehen zu bleiben
Weihbischof Otto Georgens ruft bei Karfreitagsliturgie im
Dom dazu auf, nicht bei Enttäuschungen stehen zu bleiben Mit „spirituellem Weg“ Christen auf „Ökumenischen
Kirchentag 2015“ in Speyer vorbereiten
Mit „spirituellem Weg“ Christen auf „Ökumenischen
Kirchentag 2015“ in Speyer vorbereiten An 35 Orten in dieser Region sollen sich dabei nach
Angaben der Vorbereitungsgruppe rund 700 bis 800 Teilnehmer in der
Zeit zwischen Ostern und Pfingsten an den ökumenischen „Exerzitien
im Alltag“ beteiligen. Die gemeinsame Erfahrung und das Gespräch in
den Gruppen könnten dabei helfen, das ökumenische Miteinander zu
vertiefen, zeigte sich dazu Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann überzeugt. Auferstehung sei nämlich nicht nur
als ein singuläres Ereignis zu verstehen, sondern als ein Weg, auf
dem man gemeinsame Erfahrungen sammeln und teilen könne.
Pastor Dr. Jochen Wagner hob die unterschiedlichen
Traditionen der Kirchen hervor, deren Vielfalt auch für das
geistliche Leben bereichernd sei. Kirchenpräsident
Christian Schad unterstrich, dass das spirituelle Angebot
Raum zur biblischen Meditation, zur Selbstreflexion, zur Hingabe an
Gott und zur Besinnung auf den Nächsten bieten solle. „Aufstehen
zum Leben“ bedeute deshalb darüber hinaus auch „sich einzusetzen
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung“.
An 35 Orten in dieser Region sollen sich dabei nach
Angaben der Vorbereitungsgruppe rund 700 bis 800 Teilnehmer in der
Zeit zwischen Ostern und Pfingsten an den ökumenischen „Exerzitien
im Alltag“ beteiligen. Die gemeinsame Erfahrung und das Gespräch in
den Gruppen könnten dabei helfen, das ökumenische Miteinander zu
vertiefen, zeigte sich dazu Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann überzeugt. Auferstehung sei nämlich nicht nur
als ein singuläres Ereignis zu verstehen, sondern als ein Weg, auf
dem man gemeinsame Erfahrungen sammeln und teilen könne.
Pastor Dr. Jochen Wagner hob die unterschiedlichen
Traditionen der Kirchen hervor, deren Vielfalt auch für das
geistliche Leben bereichernd sei. Kirchenpräsident
Christian Schad unterstrich, dass das spirituelle Angebot
Raum zur biblischen Meditation, zur Selbstreflexion, zur Hingabe an
Gott und zur Besinnung auf den Nächsten bieten solle. „Aufstehen
zum Leben“ bedeute deshalb darüber hinaus auch „sich einzusetzen
für Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung“. Mit täglichen geistlichen Übungen zu Hause, mit
Glaubensgesprächen an fünf Abenden in einer der 35 Gruppen und mit
der Möglichkeit zum Einzelgespräch mit einem Begleiter baue sich so
für jeden Teilnehmer sein „spiritueller Weg“ für die 50 Tage
zwischen Ostern und Pfingsten auf. Das erwarten sich
übereinstimmend die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe für diese
bundesweit wohl einzigartige Aktion, von denen bei dem
Pressegespräch neben dem Leiter der Abteilung „Spirituelle Bildung/
Exerzitienwerk“ beim Bischöflichen Ordinariat in Speyer,
Dr. Peter Hundertmark, und seinem
„Mitstreiter“ auf Protestantischer Seite, Oberkirchenrat
i.R. Dr. Klaus Bümlein auch der Pfarrer
der Protestantischen Kirchengemeinde Altrip, Bernhard
Pfeifer, zu Wort kam. Bei .Mit diesem gemeinsamen
Exerzitienangebot, so die Geistlichen, könnten sich die Teilnehmer
in die Grundthemen des Glaubens hineinfinden und „intensive
Erfahrungen mit unserem Gott machen, der sich gerne finden
lässt“.
Mit täglichen geistlichen Übungen zu Hause, mit
Glaubensgesprächen an fünf Abenden in einer der 35 Gruppen und mit
der Möglichkeit zum Einzelgespräch mit einem Begleiter baue sich so
für jeden Teilnehmer sein „spiritueller Weg“ für die 50 Tage
zwischen Ostern und Pfingsten auf. Das erwarten sich
übereinstimmend die Mitglieder der Vorbereitungsgruppe für diese
bundesweit wohl einzigartige Aktion, von denen bei dem
Pressegespräch neben dem Leiter der Abteilung „Spirituelle Bildung/
Exerzitienwerk“ beim Bischöflichen Ordinariat in Speyer,
Dr. Peter Hundertmark, und seinem
„Mitstreiter“ auf Protestantischer Seite, Oberkirchenrat
i.R. Dr. Klaus Bümlein auch der Pfarrer
der Protestantischen Kirchengemeinde Altrip, Bernhard
Pfeifer, zu Wort kam. Bei .Mit diesem gemeinsamen
Exerzitienangebot, so die Geistlichen, könnten sich die Teilnehmer
in die Grundthemen des Glaubens hineinfinden und „intensive
Erfahrungen mit unserem Gott machen, der sich gerne finden
lässt“.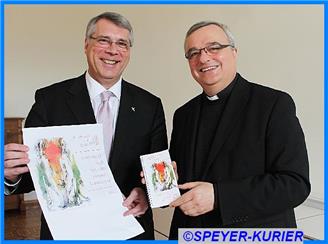 Während des „Ökumenischen Kirchentages“, über dessen
Ablauf zwischen Gedächtniskirche und Dom in Kürze noch gesondert
informiert werden soll, werde dieser „spirituelle Weg“ nicht
abgeschlossen sein, zeigten sich Bischof und Kirchenpräsident
überzeugt. Heute nur schon soviel: Während der beiden
Veranstaltungstage werde im „Friedrich-Spee-Haus“ am
Edith-Stein-Platz im Zusammenhang mit dem „Ökumenischen
Exerzitienangebot“ ein „Geistliches Zentrum“ eingerichtet, in dem
neben einer Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch ein „Raum der
Stille“ geöffnet sein wird, in dem durchgehend ein Mitglied des
Organisationsteams dieser so ganz besonderen Aktion des
Kirchentages als Gesprächspartner anwesend sein wird, mit dem man
an die Erfahrungen der Ökumenischen Kirchentage zur
Jahrtausendwende und zum 950. Weihejubiläum des Domes im Jahr 2012
anknüpfen wolle. Foto: gc
Während des „Ökumenischen Kirchentages“, über dessen
Ablauf zwischen Gedächtniskirche und Dom in Kürze noch gesondert
informiert werden soll, werde dieser „spirituelle Weg“ nicht
abgeschlossen sein, zeigten sich Bischof und Kirchenpräsident
überzeugt. Heute nur schon soviel: Während der beiden
Veranstaltungstage werde im „Friedrich-Spee-Haus“ am
Edith-Stein-Platz im Zusammenhang mit dem „Ökumenischen
Exerzitienangebot“ ein „Geistliches Zentrum“ eingerichtet, in dem
neben einer Vielzahl weiterer Veranstaltungen auch ein „Raum der
Stille“ geöffnet sein wird, in dem durchgehend ein Mitglied des
Organisationsteams dieser so ganz besonderen Aktion des
Kirchentages als Gesprächspartner anwesend sein wird, mit dem man
an die Erfahrungen der Ökumenischen Kirchentage zur
Jahrtausendwende und zum 950. Weihejubiläum des Domes im Jahr 2012
anknüpfen wolle. Foto: gc Dirmstein, Pfarrer Alfred Müller, T. 06238/989292
Dirmstein, Pfarrer Alfred Müller, T. 06238/989292 Mehr als 20 Jahre beim Bischöflichen Ordinariat tätig,
Baudirektor seit dem Jahr 2012
Mehr als 20 Jahre beim Bischöflichen Ordinariat tätig,
Baudirektor seit dem Jahr 2012 Kaisersaal und
Aussichtsplattform öffnen nach Winterpause wieder für
Besucher
Kaisersaal und
Aussichtsplattform öffnen nach Winterpause wieder für
Besucher Seit Oktober 2012
erwarten zwei neue Attraktionen am Speyerer Dom ihre Besucher. Die
Ausstellung der Schraudolph-Fresken im neu gestalteten Kaisersaal
und die Aussichtsplattform im Südwest-Turm bereichern die
UNESCO-Welterbestätte und zogen bereits mehr als 70.000 Gäste aus
nah und fern in ihren Bann.
Seit Oktober 2012
erwarten zwei neue Attraktionen am Speyerer Dom ihre Besucher. Die
Ausstellung der Schraudolph-Fresken im neu gestalteten Kaisersaal
und die Aussichtsplattform im Südwest-Turm bereichern die
UNESCO-Welterbestätte und zogen bereits mehr als 70.000 Gäste aus
nah und fern in ihren Bann.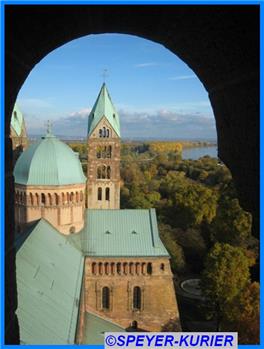 Insgesamt 304 Stufen
führen auf die Aussichtsplattform in rund 60 Metern Höhe. Dort
erwartet die Besucher ein einzigartiger Rundblick über die Stadt
Speyer, die Vorderpfalz und in die badische Nachbarschaft. An Tagen
mit guter Fernsicht überblickt man eine Entfernung von mehr als 50
Kilometern. Der Blick reicht vom Pfälzer Wald im Westen bis zu
Odenwald und Schwarzwald im Osten. Besonders reizvoll ist der Blick
auf die Maximiliansstraße, die Fußgängerzone im Herzen von Speyer,
die in einer leicht geschwungenen Linie den Dom und das
mittelalterliche Stadttor „Altpörtel“ miteinander verbindet
Insgesamt 304 Stufen
führen auf die Aussichtsplattform in rund 60 Metern Höhe. Dort
erwartet die Besucher ein einzigartiger Rundblick über die Stadt
Speyer, die Vorderpfalz und in die badische Nachbarschaft. An Tagen
mit guter Fernsicht überblickt man eine Entfernung von mehr als 50
Kilometern. Der Blick reicht vom Pfälzer Wald im Westen bis zu
Odenwald und Schwarzwald im Osten. Besonders reizvoll ist der Blick
auf die Maximiliansstraße, die Fußgängerzone im Herzen von Speyer,
die in einer leicht geschwungenen Linie den Dom und das
mittelalterliche Stadttor „Altpörtel“ miteinander verbindet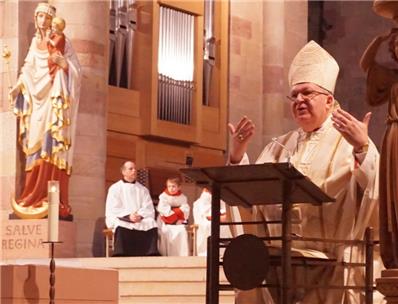 Weihbischof Otto Georgens blickt bei Pontifikalamt
im Speyerer Dom auf 20 Jahre im Amt des Weihbischofs zurück
Weihbischof Otto Georgens blickt bei Pontifikalamt
im Speyerer Dom auf 20 Jahre im Amt des Weihbischofs zurück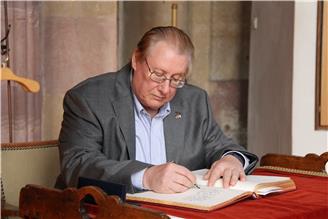


 Millionen Menschen in
Syrien und Irak auf der Flucht
Millionen Menschen in
Syrien und Irak auf der Flucht Mit dem „Brezelferdinand“ auf Entdeckungsreise durch den
Kaiser- und Mariendom
Mit dem „Brezelferdinand“ auf Entdeckungsreise durch den
Kaiser- und Mariendom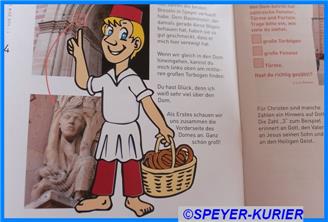 Dort stellte der Vorsitzende des Dombauvereins,
Dr. Wolfgang Hissnauer, gemeinsam mit seiner
Stellverterterin Gudrun Lanig und
Schriftführerin, Dr. Barbara Schmidt-Nechl, das
neue Büchlein vor, mit dem Kinder für den Dom begeistert werden und
eine dauerhafte Beziehung zu der „Mutterkirche des Bistums“
aufbauen sollen. Dass diese Veröffentlichung möglich geworden ist,
dafür dankte Dr. Hissnauer dem Geschäftsführer der „modus medien
und kommunikation“ im südpfälzischen Offenbach, Udo
Kuhn, den Sponsoren des Projektes, bei dieser Gelegenheit
vertreten durch Beate Klehr-Merkl vom
Erdöl-Explorations- und Förder-Konsortium „GDF SUEZ & Palatina
GeoCon“ und, last but not least, den engierten MitarbeiterInnen der
Schulabteilung und des Seelsorgeamtes des Bischöflichen
Ordinariats, die die Konzeption des neuen Domführers übernommen
hatten.
Dort stellte der Vorsitzende des Dombauvereins,
Dr. Wolfgang Hissnauer, gemeinsam mit seiner
Stellverterterin Gudrun Lanig und
Schriftführerin, Dr. Barbara Schmidt-Nechl, das
neue Büchlein vor, mit dem Kinder für den Dom begeistert werden und
eine dauerhafte Beziehung zu der „Mutterkirche des Bistums“
aufbauen sollen. Dass diese Veröffentlichung möglich geworden ist,
dafür dankte Dr. Hissnauer dem Geschäftsführer der „modus medien
und kommunikation“ im südpfälzischen Offenbach, Udo
Kuhn, den Sponsoren des Projektes, bei dieser Gelegenheit
vertreten durch Beate Klehr-Merkl vom
Erdöl-Explorations- und Förder-Konsortium „GDF SUEZ & Palatina
GeoCon“ und, last but not least, den engierten MitarbeiterInnen der
Schulabteilung und des Seelsorgeamtes des Bischöflichen
Ordinariats, die die Konzeption des neuen Domführers übernommen
hatten.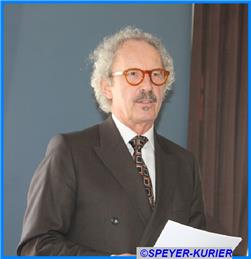 Der entscheidende Impuls für diese Veröffentlichung, so
Dr. Hissnauer, sei von einem der letzten „Familientage“ des
Dombauvereins ausgegangen, bei dem Kinder ihr großes Interesse an
der Kathedrale zum Ausdruck gebracht hätten. Mit dem jetzt
vorgelegten Domführer solle deshalb das Wissen der Kinder über den
Dom gefördert und die visuelle Beziehung zu der Kathedrale
aufgebaut und gestärkt werden.
Der entscheidende Impuls für diese Veröffentlichung, so
Dr. Hissnauer, sei von einem der letzten „Familientage“ des
Dombauvereins ausgegangen, bei dem Kinder ihr großes Interesse an
der Kathedrale zum Ausdruck gebracht hätten. Mit dem jetzt
vorgelegten Domführer solle deshalb das Wissen der Kinder über den
Dom gefördert und die visuelle Beziehung zu der Kathedrale
aufgebaut und gestärkt werden.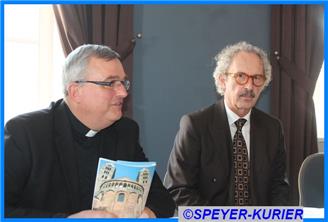 Auch Bischof Dr. Wiesemann lobte diesen
interaktiven Ansatz, der Kinder in ihrer Form der Wahrnehmung ernst
nehme, denn „Kinder sind oft weitaus bessere Beobachter als
Erwachsene“, so der „Jugendbischof“ der Deutschen
Bischofskonferenz, der es als eine der wichtigsten pädagogischen
Aufgaben überhaupt bezeichnete, „Kinder das Sehen zu lehren – das
Schauen und das Staunen“. Der Speyerer Kaiser- und Mariendom lade
geradezu ein „zum Staunen und zum Wahrnehmen des Großen und des
Kleinen“ - jener Mystheriologie, die diesem Bauwerk innewohne. Als
Beispiel verwies Bischof Dr. Wiesemann auf das runde
„Sonnenfenster“ in der Apsis des Domes, durch das an zwei Tagen im
Jahr die Sonne direkt auf das Kreuz im Vierungsgewölbe der
Kathedrale falle – nur eines von zahllosen Details in der
Kathedrale, von denen die Wichtigsten in dem neuen Domführer
zusammengefaßt seien. „Unsere Gesellschaft ist heute bestimmt von
einer
Auch Bischof Dr. Wiesemann lobte diesen
interaktiven Ansatz, der Kinder in ihrer Form der Wahrnehmung ernst
nehme, denn „Kinder sind oft weitaus bessere Beobachter als
Erwachsene“, so der „Jugendbischof“ der Deutschen
Bischofskonferenz, der es als eine der wichtigsten pädagogischen
Aufgaben überhaupt bezeichnete, „Kinder das Sehen zu lehren – das
Schauen und das Staunen“. Der Speyerer Kaiser- und Mariendom lade
geradezu ein „zum Staunen und zum Wahrnehmen des Großen und des
Kleinen“ - jener Mystheriologie, die diesem Bauwerk innewohne. Als
Beispiel verwies Bischof Dr. Wiesemann auf das runde
„Sonnenfenster“ in der Apsis des Domes, durch das an zwei Tagen im
Jahr die Sonne direkt auf das Kreuz im Vierungsgewölbe der
Kathedrale falle – nur eines von zahllosen Details in der
Kathedrale, von denen die Wichtigsten in dem neuen Domführer
zusammengefaßt seien. „Unsere Gesellschaft ist heute bestimmt von
einer  Überfülle von Eindrücken und Informationen“, stellte der
Bischof fest; „deshalb brauchen wir auch die Reduktion auf das
Wesentliche“. Dies gelte insbesondere auch für Kinder, die deshalb
schon früh an die große Kultur- und Geisteswelt des Abendlandes
herangeführt werden sollten.
Überfülle von Eindrücken und Informationen“, stellte der
Bischof fest; „deshalb brauchen wir auch die Reduktion auf das
Wesentliche“. Dies gelte insbesondere auch für Kinder, die deshalb
schon früh an die große Kultur- und Geisteswelt des Abendlandes
herangeführt werden sollten. Das handliche, 36 Seiten umfassende Büchlein ist wie eine
Führung durch den Speyerer Dom angelegt. Auf einer ausklappbaren
Übersicht sind die 13 darin erläuterten Stationen gekennzeichnet.
Start ist am Hauptportal, wo der „Brezelferdinand“ die Kinder
empfängt. Er ist die Leitfigur, die die Mädchen und Jungen
gewissermaßen an die Hand nimmt und durch die Kathedrale
begleitet.
Das handliche, 36 Seiten umfassende Büchlein ist wie eine
Führung durch den Speyerer Dom angelegt. Auf einer ausklappbaren
Übersicht sind die 13 darin erläuterten Stationen gekennzeichnet.
Start ist am Hauptportal, wo der „Brezelferdinand“ die Kinder
empfängt. Er ist die Leitfigur, die die Mädchen und Jungen
gewissermaßen an die Hand nimmt und durch die Kathedrale
begleitet. Begriffe erläutert. Außerdem verweisen QR-Codes auf
zusätzliche Informationen und verlinken zur Dom-App, zum virtuellen
Kaiserdom, zu den Internetauftritten des Dombauvereins, des
Bistums, der Dommusik und des Historischen Museums der Pfalz, in
dem auch der Domschatz ausgestellt ist.
Begriffe erläutert. Außerdem verweisen QR-Codes auf
zusätzliche Informationen und verlinken zur Dom-App, zum virtuellen
Kaiserdom, zu den Internetauftritten des Dombauvereins, des
Bistums, der Dommusik und des Historischen Museums der Pfalz, in
dem auch der Domschatz ausgestellt ist.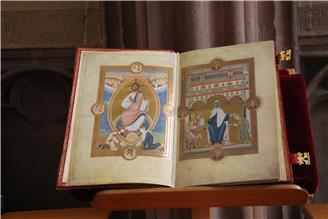 Vor 20 Jahren am 4.
März 1995 wurde dem Dom zu Speyer eine Faksimileausgabe des
Speyerer Evangeliars übergeben
Vor 20 Jahren am 4.
März 1995 wurde dem Dom zu Speyer eine Faksimileausgabe des
Speyerer Evangeliars übergeben Diplom-Ingenieur und Architekt hat zum 1. März die
Nachfolge von Gustav Appeltauer angetreten
Diplom-Ingenieur und Architekt hat zum 1. März die
Nachfolge von Gustav Appeltauer angetreten Metropole. Seine berufliche Laufbahn begann der
Diplom-Ingenieur und Architekt als Projektleiter bei einem
Karlsruher Architekturbüro. In den Jahren 2007 und 2008 nahm er
zudem einen Lehrauftrag am Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen
der Universität Karlsruhe wahr. Vor sieben Jahren wechselte Stephan
Tschepella zur Kreisverwaltung Südliche Weinstraße nach Landau, wo
er in der Abteilung Bauen und Umwelt einen Baubezirk leitete. Über
mehrere Jahre engagierte sich Stephan Tschepella in der
Architektenkammer und einem Karlsruher Bürgerverein.
Metropole. Seine berufliche Laufbahn begann der
Diplom-Ingenieur und Architekt als Projektleiter bei einem
Karlsruher Architekturbüro. In den Jahren 2007 und 2008 nahm er
zudem einen Lehrauftrag am Lehrstuhl für Städtebau und Entwerfen
der Universität Karlsruhe wahr. Vor sieben Jahren wechselte Stephan
Tschepella zur Kreisverwaltung Südliche Weinstraße nach Landau, wo
er in der Abteilung Bauen und Umwelt einen Baubezirk leitete. Über
mehrere Jahre engagierte sich Stephan Tschepella in der
Architektenkammer und einem Karlsruher Bürgerverein.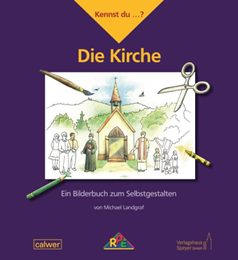 Von Michael Landgraf ist ein neues Kinderbuch zum
Selbstgestalten erschienen
Von Michael Landgraf ist ein neues Kinderbuch zum
Selbstgestalten erschienen

 Verlängertes Angebot am Mittwochabend – Montags
geschlossen
Verlängertes Angebot am Mittwochabend – Montags
geschlossen Weihbischof Georgens predigte am Aschermittwoch im
Speyerer Dom - Gläubige mit Aschenkreuz bezeichnet
Weihbischof Georgens predigte am Aschermittwoch im
Speyerer Dom - Gläubige mit Aschenkreuz bezeichnet
 Info: Die Kirche St.Ludwig stammt aus dem 13.
Jahrhundert und bildete bis zum 17. Jahrhundert das geistige
Zentrum eines Dominikanerklosters. Für den bisherigen Kirchenraum
wird ein neues Nutzungskonzept gesucht, das der religiösen,
kulturellen und stadtgeschichtlichen Bedeutung des Ortes Rechnung
trägt.
Info: Die Kirche St.Ludwig stammt aus dem 13.
Jahrhundert und bildete bis zum 17. Jahrhundert das geistige
Zentrum eines Dominikanerklosters. Für den bisherigen Kirchenraum
wird ein neues Nutzungskonzept gesucht, das der religiösen,
kulturellen und stadtgeschichtlichen Bedeutung des Ortes Rechnung
trägt.
 Bistum
Speyer plant flächendeckende Einführung eines Qualitätsmanagements
in den katholischen Kindertagesstätten / Bis zum Jahr 2018 sollen
alle Einrichtungen gestartet sein
Bistum
Speyer plant flächendeckende Einführung eines Qualitätsmanagements
in den katholischen Kindertagesstätten / Bis zum Jahr 2018 sollen
alle Einrichtungen gestartet sein Das Bistum Speyer hat sich für das Gütesiegel des
Bundesverbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)
als Grundlage seines Qualitätsmanagements entschieden. Das
KTK-Gütesiegel ist ein bundesweit anerkanntes
Qualitätsmanagementssystem, das Kindertagesstätten dabei
unterstützt, die Qualität ihrer Arbeit zu reflektieren,
weiterzuentwickeln und zu dokumentieren. Dazu werden neun
Qualitätsbereiche – von „Kinder“ und „Eltern“ über „Mittel“ und
„Personal“ bis hin zu „Kirchengemeinde“ und „Glaube“ – genau unter
die Lupe genommen.
Das Bistum Speyer hat sich für das Gütesiegel des
Bundesverbandes Katholischer Tageseinrichtungen für Kinder (KTK)
als Grundlage seines Qualitätsmanagements entschieden. Das
KTK-Gütesiegel ist ein bundesweit anerkanntes
Qualitätsmanagementssystem, das Kindertagesstätten dabei
unterstützt, die Qualität ihrer Arbeit zu reflektieren,
weiterzuentwickeln und zu dokumentieren. Dazu werden neun
Qualitätsbereiche – von „Kinder“ und „Eltern“ über „Mittel“ und
„Personal“ bis hin zu „Kirchengemeinde“ und „Glaube“ – genau unter
die Lupe genommen. Die
Erfahrungen der 19 Kindertagesstätten, die am Pilotprojekt zum
Qualitätsmanagement teilgenommen haben, wurden bei der
Veranstaltung in Kaiserslautern in einer Gesprächsrunde beleuchtet.
„Das Qualitätsmanagement zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch
unsere Arbeit. Es führt im Ergebnis dazu, dass das einzelne Kind
besser in den Blick kommt und die wesentlichen Fragen stärker in
den Vordergrund rücken“, zog Petra Ruffing, Leiterin der
katholischen Kindertagesstätte in Schönenberg-Kübelberg, eine erste
Bilanz. Heribert Brenk, Mitglied des Verwaltungsrats der Pfarrei
St. Maria Magdalena in Roxheim, schätzt vor allem den Zugewinn an
Klarheit: „Es ist jetzt für alle nachvollziehbar geregelt, wer
wofür verantwortlich ist. Außerdem können wir nach außen eindeutig
kommunizieren, wer wir sind, was wir wollen und nach welchen Regeln
in unserer Kindertagesstätte gearbeitet wird.“ Für Pfarrer Andreas
Rubel aus Roxheim hat sich durch die Einführung des
Qualitätsmanagements das Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit
von Kindertagesstätte und Pfarrgemeinde verbessert: „Wir haben
gespürt, dass die Kindertagesstätte wirklich zur Gemeinde gehört
und umgekehrt.“ Durch Patenschaften für das Essensgeld von Kindern
aus einkommensschwachen Familien und Deutschkurse für Mütter von
Kindern mit Migrationshintergrund wird ein starker caritativer
Akzent gesetzt. „Das Qualitätsmanagement erfüllt das Leitbild der
Einrichtung mit Leben“, so das Resümee von Pfarrer Rubel.
Die
Erfahrungen der 19 Kindertagesstätten, die am Pilotprojekt zum
Qualitätsmanagement teilgenommen haben, wurden bei der
Veranstaltung in Kaiserslautern in einer Gesprächsrunde beleuchtet.
„Das Qualitätsmanagement zieht sich jetzt wie ein roter Faden durch
unsere Arbeit. Es führt im Ergebnis dazu, dass das einzelne Kind
besser in den Blick kommt und die wesentlichen Fragen stärker in
den Vordergrund rücken“, zog Petra Ruffing, Leiterin der
katholischen Kindertagesstätte in Schönenberg-Kübelberg, eine erste
Bilanz. Heribert Brenk, Mitglied des Verwaltungsrats der Pfarrei
St. Maria Magdalena in Roxheim, schätzt vor allem den Zugewinn an
Klarheit: „Es ist jetzt für alle nachvollziehbar geregelt, wer
wofür verantwortlich ist. Außerdem können wir nach außen eindeutig
kommunizieren, wer wir sind, was wir wollen und nach welchen Regeln
in unserer Kindertagesstätte gearbeitet wird.“ Für Pfarrer Andreas
Rubel aus Roxheim hat sich durch die Einführung des
Qualitätsmanagements das Bewusstsein für die Zusammengehörigkeit
von Kindertagesstätte und Pfarrgemeinde verbessert: „Wir haben
gespürt, dass die Kindertagesstätte wirklich zur Gemeinde gehört
und umgekehrt.“ Durch Patenschaften für das Essensgeld von Kindern
aus einkommensschwachen Familien und Deutschkurse für Mütter von
Kindern mit Migrationshintergrund wird ein starker caritativer
Akzent gesetzt. „Das Qualitätsmanagement erfüllt das Leitbild der
Einrichtung mit Leben“, so das Resümee von Pfarrer Rubel.
 Gottesdienstzeiten, Termine für Veranstaltungen in den
Gemeinden auf einen Blick, Angebote von Kindertagesstätten oder die
Adresse des Pfarrbüros – dank der klar strukturierten
Informationsaufbereitung, die sich an das identitätsstiftende
Erscheinungsbild der neuen Webseiten-Familie anlehnt, kommen
Interessenten mit wenigen Klicks und intuitiv ans Ziel. Nachrichten
aus allen katholischen Einrichtungen werden von der Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Dekanats recherchiert und
eingepflegt. Dekan Alban Meißner erklärt: „Da auch in Ludwigshafen
die Räume für die Seelsorge größer werden, wollen wir mit dem
zeitgemäßen Onlineauftritt die Vielfalt und Breite unserer Angebote
und Leistungen bekannter machen, um – parallel zu besseren
Kommunikation – weitere Anlässe für reale Begegnungen mit Menschen
zu schaffen!“ Zur besseren Orientierung sind die neuen
Pfarreistrukturen des Dekanats, die aus dem Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ resultieren, bereits berücksichtigt. Was
die Orientierung vereinfacht: Besucher können über die sogenannte
Landkarten- und die zusätzliche Schlagwort-Navigation gezielt nach
Inhalten suchen. Passgenaue Informationen rund um Kirchenthemen,
wie zum Beispiel zu häufigen Suchschlagwörtern Hochzeit, Taufe oder
Erstkommunion sind damit schnell zur Hand. Text und Foto:
Dekanat Ludwigshafen
Gottesdienstzeiten, Termine für Veranstaltungen in den
Gemeinden auf einen Blick, Angebote von Kindertagesstätten oder die
Adresse des Pfarrbüros – dank der klar strukturierten
Informationsaufbereitung, die sich an das identitätsstiftende
Erscheinungsbild der neuen Webseiten-Familie anlehnt, kommen
Interessenten mit wenigen Klicks und intuitiv ans Ziel. Nachrichten
aus allen katholischen Einrichtungen werden von der Referentin für
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Dekanats recherchiert und
eingepflegt. Dekan Alban Meißner erklärt: „Da auch in Ludwigshafen
die Räume für die Seelsorge größer werden, wollen wir mit dem
zeitgemäßen Onlineauftritt die Vielfalt und Breite unserer Angebote
und Leistungen bekannter machen, um – parallel zu besseren
Kommunikation – weitere Anlässe für reale Begegnungen mit Menschen
zu schaffen!“ Zur besseren Orientierung sind die neuen
Pfarreistrukturen des Dekanats, die aus dem Prozess
„Gemeindepastoral 2015“ resultieren, bereits berücksichtigt. Was
die Orientierung vereinfacht: Besucher können über die sogenannte
Landkarten- und die zusätzliche Schlagwort-Navigation gezielt nach
Inhalten suchen. Passgenaue Informationen rund um Kirchenthemen,
wie zum Beispiel zu häufigen Suchschlagwörtern Hochzeit, Taufe oder
Erstkommunion sind damit schnell zur Hand. Text und Foto:
Dekanat Ludwigshafen In der neuen
Struktur umfasst die Webseiten-Familie den Internetauftritt des
Bistums Speyer, seiner zehn Dekanate und 70 Pfarreien. Um eine
optimale Breitenwirkung und möglichst schnelle Wiedererkennung zu
entfalten, richtet sich das freiwillige Angebot zur
Projektbeteiligung zunächst an alle Dekante und Pfarreien im
Bistum. Durch Verlinkungen und die gemeinsame Nutzung von
Nachrichten und Datenbankinformationen entsteht in Schritten eine
vernetzte „Plattform für Kommunikation“ mit immer größerer
Reichweite. Vergleichbar mit einem „Baukasten-System“ sind die
einzelnen Internetauftritte ähnlich strukturiert und als Teil der
Webseiten-Familie leicht zu erkennen. Dank des neuen Konzepts
werden die Orientierung und der Informationszugang vereinfacht und
gleichzeitig der Nachrichtenwert erhöht. Besonderes Augenmerk wird
darauf gelegt, dass jede Pfarrei ausreichend Gestaltungsspielraum
hat und die eigenen Seiten entsprechend regionalisieren und
personalisieren kann. Um dieses Ziel zu gewährleisten, lassen sich
alle Inhalte und Funktionalitäten sehr einfach mit einem
Content-Management-System auf Typo-3-Basis einpflegen und anpassen.
Das Bistum Speyer unterstützt die neue Onlinekommunikation. Die
Konzeptentwicklung zur Erstellung der Webseiten und der Schulungen
verantwortet die Peregrinus GmbH, der Verlag in dem die
Bistumszeitung „der pilger“ erscheint.
In der neuen
Struktur umfasst die Webseiten-Familie den Internetauftritt des
Bistums Speyer, seiner zehn Dekanate und 70 Pfarreien. Um eine
optimale Breitenwirkung und möglichst schnelle Wiedererkennung zu
entfalten, richtet sich das freiwillige Angebot zur
Projektbeteiligung zunächst an alle Dekante und Pfarreien im
Bistum. Durch Verlinkungen und die gemeinsame Nutzung von
Nachrichten und Datenbankinformationen entsteht in Schritten eine
vernetzte „Plattform für Kommunikation“ mit immer größerer
Reichweite. Vergleichbar mit einem „Baukasten-System“ sind die
einzelnen Internetauftritte ähnlich strukturiert und als Teil der
Webseiten-Familie leicht zu erkennen. Dank des neuen Konzepts
werden die Orientierung und der Informationszugang vereinfacht und
gleichzeitig der Nachrichtenwert erhöht. Besonderes Augenmerk wird
darauf gelegt, dass jede Pfarrei ausreichend Gestaltungsspielraum
hat und die eigenen Seiten entsprechend regionalisieren und
personalisieren kann. Um dieses Ziel zu gewährleisten, lassen sich
alle Inhalte und Funktionalitäten sehr einfach mit einem
Content-Management-System auf Typo-3-Basis einpflegen und anpassen.
Das Bistum Speyer unterstützt die neue Onlinekommunikation. Die
Konzeptentwicklung zur Erstellung der Webseiten und der Schulungen
verantwortet die Peregrinus GmbH, der Verlag in dem die
Bistumszeitung „der pilger“ erscheint. 
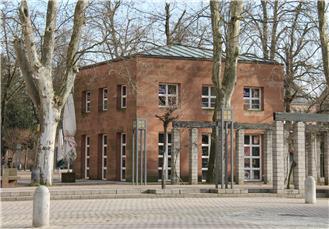 Domkapitel fasst
Dompavillion als neue Lösung ins Auge
Domkapitel fasst
Dompavillion als neue Lösung ins Auge 500
Schülerinnen und Schüler aus 15 Schulen nehmen bis Freitag daran
teil
500
Schülerinnen und Schüler aus 15 Schulen nehmen bis Freitag daran
teil Am Nachmittag hatte die Schülerinnen und Schüler
die Wahl zwischen fünf verschiedenen Workshop-Angeboten - von der
Recherche im Bistumsarchiv, einem Gespräch mit Gefängnisseelsorger
Johannes Finck zum Thema „Wie spreche ich mit einem Mörder?“,
Angeboten zum Thema „Berufung“ mit Ordensleuten und
Priesteramtskandidaten aus dem Bistum bis hin zu Informationen über
die Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes. Zum Abschluss des
Tages stellte sich Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der
Jugendlichen.
Am Nachmittag hatte die Schülerinnen und Schüler
die Wahl zwischen fünf verschiedenen Workshop-Angeboten - von der
Recherche im Bistumsarchiv, einem Gespräch mit Gefängnisseelsorger
Johannes Finck zum Thema „Wie spreche ich mit einem Mörder?“,
Angeboten zum Thema „Berufung“ mit Ordensleuten und
Priesteramtskandidaten aus dem Bistum bis hin zu Informationen über
die Möglichkeiten eines Freiwilligendienstes. Zum Abschluss des
Tages stellte sich Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann den Fragen der
Jugendlichen. Die
Schülertage werden in diesem Jahr zum dritten Mal angeboten. Bis
einschließlich Freitag nehmen rund 500 Schülerinnen und Schüler aus
insgesamt 15 Schulen - Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und
Berufsbildenden Schulen - daran teil. Mitarbeiter aus insgesamt
zwölf Bereichen des Bistums präsentieren ihre Arbeit. Fachleute des
Caritasverbandes stellen ihre Beratungs- und Hilfsangebote vor, die
Redakteure der Kirchenzeitung lassen sich bei der Produktion des
„Pilger“ über die Schulter schauen. Neben Bischof Wiesemann stellen
sich auch Generalvikar Dr. Franz Jung (am Mittwoch) und Domdekan
Dr. Christoph Kohl (am Donnerstag) den Fragen der Jugendlichen.
Die
Schülertage werden in diesem Jahr zum dritten Mal angeboten. Bis
einschließlich Freitag nehmen rund 500 Schülerinnen und Schüler aus
insgesamt 15 Schulen - Gymnasien, Integrierten Gesamtschulen und
Berufsbildenden Schulen - daran teil. Mitarbeiter aus insgesamt
zwölf Bereichen des Bistums präsentieren ihre Arbeit. Fachleute des
Caritasverbandes stellen ihre Beratungs- und Hilfsangebote vor, die
Redakteure der Kirchenzeitung lassen sich bei der Produktion des
„Pilger“ über die Schulter schauen. Neben Bischof Wiesemann stellen
sich auch Generalvikar Dr. Franz Jung (am Mittwoch) und Domdekan
Dr. Christoph Kohl (am Donnerstag) den Fragen der Jugendlichen. Pfarrer Annweiler
als Telefonseelsorger eingeführt – Vorgänger Seidlitz
verabschiedet
Pfarrer Annweiler
als Telefonseelsorger eingeführt – Vorgänger Seidlitz
verabschiedet

 Nachkommen des
Architekten Albert Boßlet informierten sich über Nachlass - Rund
100 Kirchen geschaffen
Nachkommen des
Architekten Albert Boßlet informierten sich über Nachlass - Rund
100 Kirchen geschaffen

 Dass Wasser ein wichtiges Symbol für einen lebendigen
Glauben und für die Verbundenheit aller Christen durch die Taufe
ist, wurde bei der Erneuerung des Taufgedächtnisses der Gläubigen
deutlich. Dazu waren alle Mitfeiernden eingeladen, sich einzeln von
den Liturgen mit Wasser bekreuzigen zu lassen.
Dass Wasser ein wichtiges Symbol für einen lebendigen
Glauben und für die Verbundenheit aller Christen durch die Taufe
ist, wurde bei der Erneuerung des Taufgedächtnisses der Gläubigen
deutlich. Dazu waren alle Mitfeiernden eingeladen, sich einzeln von
den Liturgen mit Wasser bekreuzigen zu lassen.
 Beim
Neujahrsempfang sprach der Kirchenpräsident auch denjenigen, die
sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Krisengebieten
engagieren, seinen Dank und seine Anerkennung aus. Stellvertretend
nannte Schad den Migrationsbeauftragten der Landeskirche, Reinhard
Schott, und für den „Treffpunkt Asyl“ in Speyer Pfarrer Uwe
Weinerth und Dekan Markus Jäckle. „Frauen, Männer und Kinder kommen
in diesen Tagen bei uns an, weil die Gewalt sich immer mehr
ausbreitet und sie an Leib und Seele bedroht. Ich bedanke mich
heute bei allen, die diejenigen, die es nach schlimmen Erfahrungen
zu Hause und auf der Flucht bis hierher geschafft haben, bei uns
herzlich empfangen und willkommen heißen“, sagte der
Kirchenpräsident.
Beim
Neujahrsempfang sprach der Kirchenpräsident auch denjenigen, die
sich für die Aufnahme von Flüchtlingen aus den Krisengebieten
engagieren, seinen Dank und seine Anerkennung aus. Stellvertretend
nannte Schad den Migrationsbeauftragten der Landeskirche, Reinhard
Schott, und für den „Treffpunkt Asyl“ in Speyer Pfarrer Uwe
Weinerth und Dekan Markus Jäckle. „Frauen, Männer und Kinder kommen
in diesen Tagen bei uns an, weil die Gewalt sich immer mehr
ausbreitet und sie an Leib und Seele bedroht. Ich bedanke mich
heute bei allen, die diejenigen, die es nach schlimmen Erfahrungen
zu Hause und auf der Flucht bis hierher geschafft haben, bei uns
herzlich empfangen und willkommen heißen“, sagte der
Kirchenpräsident. Stellungnahmen der französischen Kirchen bekräftigen
Solidarität mit Opfern und ihren Familien
Stellungnahmen der französischen Kirchen bekräftigen
Solidarität mit Opfern und ihren Familien Pfarrer Peter
Annweiler kehrt als Telefonseelsorger in die Pfalz
zurück
Pfarrer Peter
Annweiler kehrt als Telefonseelsorger in die Pfalz
zurück Pontifikalamt
zum Fest der Erscheinung des Herrn im Speyerer Dom / Empfang im
Friedrich-Spee-Haus für Mitarbeiter von Ordinariat und
Caritasverband
Pontifikalamt
zum Fest der Erscheinung des Herrn im Speyerer Dom / Empfang im
Friedrich-Spee-Haus für Mitarbeiter von Ordinariat und
Caritasverband Bischof Wiesemann zelebrierte den Gottesdienst am
Dreikönigstag gemeinsam mit Weihbischof Otto Georgens, Generalvikar
Dr. Franz Vogelgesang, Domkapitular Franz Vogelgesang und
Dompfarrer Matthias Bender. Sternsinger aus der Dompfarrei brachten
dem Dom ihren Segen. Die Dommusik gestaltete die Liturgie mit
Kantorengesängen, die Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub.
Bischof Wiesemann zelebrierte den Gottesdienst am
Dreikönigstag gemeinsam mit Weihbischof Otto Georgens, Generalvikar
Dr. Franz Vogelgesang, Domkapitular Franz Vogelgesang und
Dompfarrer Matthias Bender. Sternsinger aus der Dompfarrei brachten
dem Dom ihren Segen. Die Dommusik gestaltete die Liturgie mit
Kantorengesängen, die Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub. Beim anschließenden Empfang für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats und des Caritasverbandes
im Friedrich-Spee-Haus ging Generalvikar Dr. Franz Jung auf den
„Krippenstreit“ ein, der sich vor Weihnachten in Frankreich
abgespielt hatte. Die Vereinigung der Freidenker hatte unter
Hinweis auf den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat
erzwingen wollen, dass im öffentlichen Raum keine Weihnachtskrippen
mehr aufgestellt werden dürfen. Der Bürgermeister von Castres bei
Toulouse hatte den Freidenkern in einem öffentlichen Brief Paroli
geboten. „Die Krippe ist auch ein Zeichen der Hoffnung für alle,
die ohne Obdach sind.“ Sie stehe zugleich für einen arabischen,
einen afrikanischen und einen asiatischen König, die sich bei einem
Juden einfinden. „Ein hoffnungsfrohes Zeichen des Friedens in
Zeiten, wo Zivilisationen aufeinander prallen und im Nahen Osten
ein furchtbarer Konflikt tobt“, zitierte der Generalvikar aus dem
öffentlichen Schreiben des Bürgermeisters.
Beim anschließenden Empfang für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Bischöflichen Ordinariats und des Caritasverbandes
im Friedrich-Spee-Haus ging Generalvikar Dr. Franz Jung auf den
„Krippenstreit“ ein, der sich vor Weihnachten in Frankreich
abgespielt hatte. Die Vereinigung der Freidenker hatte unter
Hinweis auf den Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat
erzwingen wollen, dass im öffentlichen Raum keine Weihnachtskrippen
mehr aufgestellt werden dürfen. Der Bürgermeister von Castres bei
Toulouse hatte den Freidenkern in einem öffentlichen Brief Paroli
geboten. „Die Krippe ist auch ein Zeichen der Hoffnung für alle,
die ohne Obdach sind.“ Sie stehe zugleich für einen arabischen,
einen afrikanischen und einen asiatischen König, die sich bei einem
Juden einfinden. „Ein hoffnungsfrohes Zeichen des Friedens in
Zeiten, wo Zivilisationen aufeinander prallen und im Nahen Osten
ein furchtbarer Konflikt tobt“, zitierte der Generalvikar aus dem
öffentlichen Schreiben des Bürgermeisters.-01.jpg) Jugendministerin Irene Alt und Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann unterstützen Forderungen der
Sternsinger
Jugendministerin Irene Alt und Bischof Dr. Karl-Heinz
Wiesemann unterstützen Forderungen der
Sternsinger -01.jpg) Der Protestmarsch der kleinen und großen Könige wurde
prominent unterstützt von Kinder- und Jugendministerin Irene Alt.
Er endete mit einer Kundgebung am Altpörtel. Auf der Bühne machte
Sternsingerkönig Jonas aus Erfweiler-Ehlingen
deutlich, was sich hinter der Forderung nach besserer
Ernährung für Kinder weltweit konkret verbirgt. Der Elfjährige ist
überzeugt: "Wenn man immer Hunger haben muss, kann man nicht groß
werden". Im Gespräch mit Christoph Fuhrbach (Referent für
weltkirchliche Aufgaben) und Felix Goldinger (Diözesanvorstand des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Speyer)
unterstützte auch die zwöfjährige Kim aus
Schifferstadt die Forderungen der Sternsinger: "Ohne Bildung
gibt es kein Geld, keine Arbeit und keine Chancen auf eine gute
Zukunft". Ministerin Alt freute sich über den Einsatz der Kinder
und Jugendlichen. In ihren Grußwort betonte sie: "Gesunde Ernährung
ist leider nach wie vor nicht selbstverständlich. In aller Welt –
auch bei uns in Deutschland – gibt es Kinder, die nicht einmal
jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Ich freue mich, dass die
Sternsinger-Aktion auf das Kinderrecht hinweisen, das besagt, dass
Kinder das Recht auf Gesundheit haben – hierzu gehört auch eine
gesunde Ernährung."
Der Protestmarsch der kleinen und großen Könige wurde
prominent unterstützt von Kinder- und Jugendministerin Irene Alt.
Er endete mit einer Kundgebung am Altpörtel. Auf der Bühne machte
Sternsingerkönig Jonas aus Erfweiler-Ehlingen
deutlich, was sich hinter der Forderung nach besserer
Ernährung für Kinder weltweit konkret verbirgt. Der Elfjährige ist
überzeugt: "Wenn man immer Hunger haben muss, kann man nicht groß
werden". Im Gespräch mit Christoph Fuhrbach (Referent für
weltkirchliche Aufgaben) und Felix Goldinger (Diözesanvorstand des
Bundes der Deutschen Katholischen Jugend im Bistum Speyer)
unterstützte auch die zwöfjährige Kim aus
Schifferstadt die Forderungen der Sternsinger: "Ohne Bildung
gibt es kein Geld, keine Arbeit und keine Chancen auf eine gute
Zukunft". Ministerin Alt freute sich über den Einsatz der Kinder
und Jugendlichen. In ihren Grußwort betonte sie: "Gesunde Ernährung
ist leider nach wie vor nicht selbstverständlich. In aller Welt –
auch bei uns in Deutschland – gibt es Kinder, die nicht einmal
jeden Tag eine warme Mahlzeit bekommen. Ich freue mich, dass die
Sternsinger-Aktion auf das Kinderrecht hinweisen, das besagt, dass
Kinder das Recht auf Gesundheit haben – hierzu gehört auch eine
gesunde Ernährung."-01.jpg) Bischof Wiesemann eröffnete noch am Altpörtel den
Gottesdienst, der mit einem Schweigemarsch zurück in den Dom
begann. Hier segnete der Bischof die Sternsinger und ihr Tun
und gab damit offiziell den Startschuss für die Sternsingeraktion
2015. Die Könige nahmen neben dem bischöflichen Segen auch dessen
Dank entgegen. In seiner Predigt sagte Wiesemann: "Ihr habt
gesehen, dass es Kinder gibt, die jemanden brauchen, der für sie
die Stimme erhebt. Das habt ihr getan. Ich finde es toll, dass ihr
euch für die Rechte von Kindern einsetzt! Dafür möchte ich
euch Danke sagen."
Bischof Wiesemann eröffnete noch am Altpörtel den
Gottesdienst, der mit einem Schweigemarsch zurück in den Dom
begann. Hier segnete der Bischof die Sternsinger und ihr Tun
und gab damit offiziell den Startschuss für die Sternsingeraktion
2015. Die Könige nahmen neben dem bischöflichen Segen auch dessen
Dank entgegen. In seiner Predigt sagte Wiesemann: "Ihr habt
gesehen, dass es Kinder gibt, die jemanden brauchen, der für sie
die Stimme erhebt. Das habt ihr getan. Ich finde es toll, dass ihr
euch für die Rechte von Kindern einsetzt! Dafür möchte ich
euch Danke sagen." Arbeitskreis Kirche und Judentum im Gespräch mit der
jüdischen Kultusgemeinde
Arbeitskreis Kirche und Judentum im Gespräch mit der
jüdischen Kultusgemeinde
 Bischof Wiesemann hält Pontifikalamt zum
Jahresabschluss
Bischof Wiesemann hält Pontifikalamt zum
Jahresabschluss „Wir haben tiefste Hochachtung vor allen Menschen,
gleichwelcher Religion und Abstammung, die sich nicht brechen
lassen durch Gewalt und Hass. Dass das überhaupt möglich ist, das
ist für mich das Wunder des Glaubens. Hier zeigt sich, dem
einzelnen bewusst oder nicht, das Wirken des Geistes Gottes in
unserer Welt“, erklärte Wiesemann.
„Wir haben tiefste Hochachtung vor allen Menschen,
gleichwelcher Religion und Abstammung, die sich nicht brechen
lassen durch Gewalt und Hass. Dass das überhaupt möglich ist, das
ist für mich das Wunder des Glaubens. Hier zeigt sich, dem
einzelnen bewusst oder nicht, das Wirken des Geistes Gottes in
unserer Welt“, erklärte Wiesemann.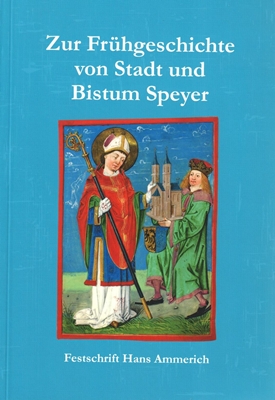 Festschrift zu Ehren Professor Hans Ammerichs erschienen –
35 Jahre Leiter des Bistumsarchivs
Festschrift zu Ehren Professor Hans Ammerichs erschienen –
35 Jahre Leiter des Bistumsarchivs Speyer- Die Aussendungsfeier des
Friedenslichts lockte am 11. Dezember mehr als 1.000 Pfadfinder und
Besucher in den Speyerer Dom. Die Flamme, die in der Geburtsgrotte
Jesu in Bethlehem entzündet worden war, wurde von einer
fünfköpfigen Delegation aus Wien in die Pfalz geholt. Die
Delegierten vertraten die Pfadfinderverbände Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG) und Verband christlicher Pfadfinderinnen und
Pfadfinder (VCP). Seit vielen Jahren findet die Aussendung des
Friedenslichts in einem ökumenischen Gottesdienst in Speyer
statt.
Speyer- Die Aussendungsfeier des
Friedenslichts lockte am 11. Dezember mehr als 1.000 Pfadfinder und
Besucher in den Speyerer Dom. Die Flamme, die in der Geburtsgrotte
Jesu in Bethlehem entzündet worden war, wurde von einer
fünfköpfigen Delegation aus Wien in die Pfalz geholt. Die
Delegierten vertraten die Pfadfinderverbände Bund der
Pfadfinderinnen und Pfadfinder (BdP), Deutsche Pfadfinderschaft
Sankt Georg (DPSG) und Verband christlicher Pfadfinderinnen und
Pfadfinder (VCP). Seit vielen Jahren findet die Aussendung des
Friedenslichts in einem ökumenischen Gottesdienst in Speyer
statt. Um Verbundenheit, die Frieden ermöglicht, ging es auch im
Gottesdienst. Alle Teilnehmer verbanden sich mit den Händen zu
einem großen Netz, das den Dom ausfüllte.
Um Verbundenheit, die Frieden ermöglicht, ging es auch im
Gottesdienst. Alle Teilnehmer verbanden sich mit den Händen zu
einem großen Netz, das den Dom ausfüllte. 
 Der neue Domsekt ist ab sofort in der Geschäftsstelle des
Dombauvereins (Edith-Stein-Platz 8) sowie im Dom-Besucherzentrum
(Domplatz) erhältlich. Zudem kann er direkt über die
Winzergenossenschaft Weinbiet bezogen werden. Diverse Einzelhändler
sowie Supermärkte der Region haben den Domsekt ebenfalls in ihrem
Programm.
Der neue Domsekt ist ab sofort in der Geschäftsstelle des
Dombauvereins (Edith-Stein-Platz 8) sowie im Dom-Besucherzentrum
(Domplatz) erhältlich. Zudem kann er direkt über die
Winzergenossenschaft Weinbiet bezogen werden. Diverse Einzelhändler
sowie Supermärkte der Region haben den Domsekt ebenfalls in ihrem
Programm. Kirchenpräsident Schad
mahnt beim Pressetee Werte der „freien, streitbaren Demokratie“
an
Kirchenpräsident Schad
mahnt beim Pressetee Werte der „freien, streitbaren Demokratie“
an
 Bischof
Wiesemann bestätigt Wahl der Dekanatsversammlung
Bischof
Wiesemann bestätigt Wahl der Dekanatsversammlung

 Ziel der neuen Außenbeleuchtung ist vor allem die
Erneuerung der in die Jahre gekommen Technik. Die neuen
LED-Lichtquellen bringen zum einen eine sehr viel höhere
Energieeffizienz mit sich und ermöglichen gleichzeitig eine
dynamische Lichtsteuerung, die den Tages- und Nachtzeiten angepasst
ist. Zum anderen betont die neue Beleuchtung die Plastizität der
einzelnen Bauteile, die für die romanische Kathedrale so
charakteristisch ist.
Ziel der neuen Außenbeleuchtung ist vor allem die
Erneuerung der in die Jahre gekommen Technik. Die neuen
LED-Lichtquellen bringen zum einen eine sehr viel höhere
Energieeffizienz mit sich und ermöglichen gleichzeitig eine
dynamische Lichtsteuerung, die den Tages- und Nachtzeiten angepasst
ist. Zum anderen betont die neue Beleuchtung die Plastizität der
einzelnen Bauteile, die für die romanische Kathedrale so
charakteristisch ist. Der Teilnahme an
der Jahrestagung der Stiftungsgremien gingen eine Begrüßung durch
den Bischof und ein Besuch des Doms voraus
Der Teilnahme an
der Jahrestagung der Stiftungsgremien gingen eine Begrüßung durch
den Bischof und ein Besuch des Doms voraus Der
Teilnahme an der Jahrestagung der Stiftungsgremien gingen eine
Begrüßung durch Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und ein Rundgang
durch den Dom voraus. Anschließend nahm der Erbgroßherzog an der
Europa-Rede des ehemaligen BASF-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.
Jürgen Strube im Dom teil.
Der
Teilnahme an der Jahrestagung der Stiftungsgremien gingen eine
Begrüßung durch Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und ein Rundgang
durch den Dom voraus. Anschließend nahm der Erbgroßherzog an der
Europa-Rede des ehemaligen BASF-Vorstandsvorsitzenden Prof. Dr.
Jürgen Strube im Dom teil. Rede von
Professor Jürgen Strube im Dom zu Speyer
Rede von
Professor Jürgen Strube im Dom zu Speyer

 In Dom und Bistum
gab es zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit eine Reihe besonderer
Angebote für Pilger und Besucher
In Dom und Bistum
gab es zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit eine Reihe besonderer
Angebote für Pilger und Besucher Manfred Gräf ist
der neue Vorsitzende - Hede Strubel-Metz im Amt bestätigt
Manfred Gräf ist
der neue Vorsitzende - Hede Strubel-Metz im Amt bestätigt Mitarbeiterjubiläum der Diakonissen
Speyer-Mannheim
Mitarbeiterjubiläum der Diakonissen
Speyer-Mannheim.jpg)
.jpg)
.jpg) Die
neuen Medien und die Entwicklungen in der Computerwelt bringen
viele neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich,
stellten die drei Partner mit Blick auf ihre gemeinsame
Computerschule in Ghana fest. Hier müssten neue Ausbildungsgänge
entwickelt und damit die Zukunft des Projekts gesichert werden,
sind sich Pfarrer In Myung-Jin aus Korea und sein ghanaischer
Kollege, Pfarrer Samuel Ayete-Nyampong, einig. „Unser Bemühen, die
Welt ein Stück besser und dadurch Gottes Liebe spürbar zu machen,
vereint uns in unserer ökumenischen Partnerschaft“, so Pfarrer
Samuel Ayete-Nyampong aus Ghana.
Die
neuen Medien und die Entwicklungen in der Computerwelt bringen
viele neue Möglichkeiten, aber auch Herausforderungen mit sich,
stellten die drei Partner mit Blick auf ihre gemeinsame
Computerschule in Ghana fest. Hier müssten neue Ausbildungsgänge
entwickelt und damit die Zukunft des Projekts gesichert werden,
sind sich Pfarrer In Myung-Jin aus Korea und sein ghanaischer
Kollege, Pfarrer Samuel Ayete-Nyampong, einig. „Unser Bemühen, die
Welt ein Stück besser und dadurch Gottes Liebe spürbar zu machen,
vereint uns in unserer ökumenischen Partnerschaft“, so Pfarrer
Samuel Ayete-Nyampong aus Ghana..jpg)
 Weihbischof Otto Georgens feierte Gottesdienst zu
Allerheiligen im Speyerer Dom
Weihbischof Otto Georgens feierte Gottesdienst zu
Allerheiligen im Speyerer Dom.jpg)
.jpg) Wiesemann
betonte, die Kirche müsse sich den Zukunftsaufgaben stellen, sich
nicht um sich selbst kümmern, sondern auf die Menschen zugehen und
solidarisch handeln. Der diakonische Dienst sei verknüpft mit
diesem Hinausgehen, sei gleichzeitig ein missionarischer Dienst.
Diakone setzten sich konkret für Menschen vor Ort ein und den
karitativen Auftrag um. Der Bischof stellte gleichzeitig den
grundlegenden Kern von Kirche dar. "Kirche kann nur aus dem Dienen
her verstanden werden", sagte er und rief ins Gedächtnis, welche
Bedeutung die Stola um den Hals von Diakonen, Priestern und
Bischöfen besitzt: "Diese Stola erinnert uns an das Joch, mit dem
wir den Karren Jesu Christi ziehen."
Wiesemann
betonte, die Kirche müsse sich den Zukunftsaufgaben stellen, sich
nicht um sich selbst kümmern, sondern auf die Menschen zugehen und
solidarisch handeln. Der diakonische Dienst sei verknüpft mit
diesem Hinausgehen, sei gleichzeitig ein missionarischer Dienst.
Diakone setzten sich konkret für Menschen vor Ort ein und den
karitativen Auftrag um. Der Bischof stellte gleichzeitig den
grundlegenden Kern von Kirche dar. "Kirche kann nur aus dem Dienen
her verstanden werden", sagte er und rief ins Gedächtnis, welche
Bedeutung die Stola um den Hals von Diakonen, Priestern und
Bischöfen besitzt: "Diese Stola erinnert uns an das Joch, mit dem
wir den Karren Jesu Christi ziehen.".jpg) spendete
Bischof Wiesemann durch Handauflegen und Gebet. Das Weiheritual
endete mit dem Überreichen des Evangelienbuchs und dem Umarmen der
neugeweihten Diakone durch Bischof, Konzelebranten und Diakone.
Damit nahmen sie Wolfgang Rhein und Rudolf Schwarz in ihre
Gemeinschaft auf. Anschließend bereiteten die Neugeweihten
gemeinsam mit Wiesemann die Gaben.
spendete
Bischof Wiesemann durch Handauflegen und Gebet. Das Weiheritual
endete mit dem Überreichen des Evangelienbuchs und dem Umarmen der
neugeweihten Diakone durch Bischof, Konzelebranten und Diakone.
Damit nahmen sie Wolfgang Rhein und Rudolf Schwarz in ihre
Gemeinschaft auf. Anschließend bereiteten die Neugeweihten
gemeinsam mit Wiesemann die Gaben.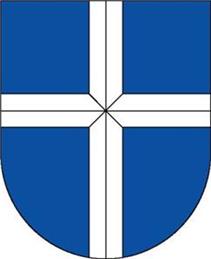 Gute
wirtschaftliche Lage in Deutschland hat positiven Effekt auf die
Kirchensteuer – Auch den Pfarreien und dem Caritasverband stehen
damit mehr Mittel für ihre Arbeit zur Verfügung
Gute
wirtschaftliche Lage in Deutschland hat positiven Effekt auf die
Kirchensteuer – Auch den Pfarreien und dem Caritasverband stehen
damit mehr Mittel für ihre Arbeit zur Verfügung Wöchentliche
Bilder, Bücher, Medientipps rund um Martin Luther
Wöchentliche
Bilder, Bücher, Medientipps rund um Martin Luther
 Die
Bibel auf neue Weise zur Sprache bringen
Die
Bibel auf neue Weise zur Sprache bringen Link zu
den Bibel-Erzählungen:
Link zu
den Bibel-Erzählungen:
 Bundesweiter Abschluss der missio-Kampagne am Sonntag der
Weltmission – Pontifikalamt im Dom zu Speyer
Bundesweiter Abschluss der missio-Kampagne am Sonntag der
Weltmission – Pontifikalamt im Dom zu Speyer Bischof Wiesemann zeigte sich beeindruckt von dem
Engagement der Gäste aus den Philippinen, die sich aus ihrem tiefen
Glauben heraus für die Verwirklichung ihrer Vision zur Verbesserung
der Lebenssituation der Menschen in ihrer Heimat einsetzen. „Die
Kirche auf den Philippinen steht für die Option für die Armen, für
Friedensarbeit und interreligiösen Dialog, für die bleibende
Verwurzelung und die Rechte der indigenen Bevölkerung, für die
Bewahrung der Schöpfung und den Kampf gegen den Klimawandel, für
die Förderung der Familien und gegen die Ausbeutung von Frauen und
Kindern“, so der Bischof. Die auf den Philippinen gewonnenen
Erfahrungen mit kleinen christlichen Gemeinschaften könnten auch im
Bistum Speyer hilfreich sein.
Bischof Wiesemann zeigte sich beeindruckt von dem
Engagement der Gäste aus den Philippinen, die sich aus ihrem tiefen
Glauben heraus für die Verwirklichung ihrer Vision zur Verbesserung
der Lebenssituation der Menschen in ihrer Heimat einsetzen. „Die
Kirche auf den Philippinen steht für die Option für die Armen, für
Friedensarbeit und interreligiösen Dialog, für die bleibende
Verwurzelung und die Rechte der indigenen Bevölkerung, für die
Bewahrung der Schöpfung und den Kampf gegen den Klimawandel, für
die Förderung der Familien und gegen die Ausbeutung von Frauen und
Kindern“, so der Bischof. Die auf den Philippinen gewonnenen
Erfahrungen mit kleinen christlichen Gemeinschaften könnten auch im
Bistum Speyer hilfreich sein.

 „ Month of service „
Einsatz von SAP-Mitarbeitern in der Prot. Kita Villa Kunterbunt
Speyer
„ Month of service „
Einsatz von SAP-Mitarbeitern in der Prot. Kita Villa Kunterbunt
Speyer Am 10.
Oktober 1956 in Rom zum Priester geweiht – „Deus salus – Gott ist
das Heil“ lautet sein bischöflicher Wahlspruch
Am 10.
Oktober 1956 in Rom zum Priester geweiht – „Deus salus – Gott ist
das Heil“ lautet sein bischöflicher Wahlspruch Jugendnacht spiegelte Vielfalt kirchlicher Gebetspraxis-
Brüder aus Taizé zu Gast im Dom
Jugendnacht spiegelte Vielfalt kirchlicher Gebetspraxis-
Brüder aus Taizé zu Gast im Dom Bischof Wiesemann hatte zuvor gemeinsam mit Pfarrer
Carsten Leinhäuser die Nacht der Barmherzigkeit eröffnet. Der
Speyerer Bischof machte deutlich, dass der barmherzige Blick auf
die Mitmenschen dem Ausschluss Einzelner entgegenwirke. Er zitierte
aus der berühmten Rede von Martin Luther King "I have a dream- Ich
habe einen Traum" und betete für den Zusammenhalt der Menschen,
unabhängig von Rasse, Nation oder Weltanschauung.
Bischof Wiesemann hatte zuvor gemeinsam mit Pfarrer
Carsten Leinhäuser die Nacht der Barmherzigkeit eröffnet. Der
Speyerer Bischof machte deutlich, dass der barmherzige Blick auf
die Mitmenschen dem Ausschluss Einzelner entgegenwirke. Er zitierte
aus der berühmten Rede von Martin Luther King "I have a dream- Ich
habe einen Traum" und betete für den Zusammenhalt der Menschen,
unabhängig von Rasse, Nation oder Weltanschauung.  bereits während der „Nacht der Barmherzigkeit“ ein Zeichen
setzen und die Fotobox nutzen, um sich mit ihrem Gesicht und
Statement stark zu machen für ein buntes Land: „Wir finden:
Zukunftszeit ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit“, erklärte Lena
Schmidt. „Wir wollen nicht, dass Menschen benachteiligt sind oder
ausgeschlossen werden. Wir wollen das nicht, weil Gott so nicht ist
und er uns einen klaren Auftrag gegeben hat, zu helfen, wo Hilfe
gebraucht wird. Das ist ganz unabhängig von Hautfarbe, Herkunft
oder sonstigen Merkmalen.“
bereits während der „Nacht der Barmherzigkeit“ ein Zeichen
setzen und die Fotobox nutzen, um sich mit ihrem Gesicht und
Statement stark zu machen für ein buntes Land: „Wir finden:
Zukunftszeit ist ein Ausdruck von Barmherzigkeit“, erklärte Lena
Schmidt. „Wir wollen nicht, dass Menschen benachteiligt sind oder
ausgeschlossen werden. Wir wollen das nicht, weil Gott so nicht ist
und er uns einen klaren Auftrag gegeben hat, zu helfen, wo Hilfe
gebraucht wird. Das ist ganz unabhängig von Hautfarbe, Herkunft
oder sonstigen Merkmalen.“ Gast und brachte mit der Tanzgruppe der Philippinischen
Kulturgemeinschaft im Saarland das Land näher, das im Zentrum der
diesjährigen Missio-Kampagne steht. Pater Kenneth Centeno,
Vinzentiner von den Philippinen, lebt derzeit in München. In seinem
Impulstext sagte er: „Die Barmherzigkeit Gottes ist eine Einladung
zum neuen Leben, das eine neue Hoffnung schafft“. Diese bezog er
ganz konkret auf die Lebensituation der Menschen hier und auf den
Philippinen und spannte einen weiten gesellschaftlich- politischen
Bogen von den Ängsten der Menschen in Deutschland bis hin zu den
Folgen des Klimawandels.
Gast und brachte mit der Tanzgruppe der Philippinischen
Kulturgemeinschaft im Saarland das Land näher, das im Zentrum der
diesjährigen Missio-Kampagne steht. Pater Kenneth Centeno,
Vinzentiner von den Philippinen, lebt derzeit in München. In seinem
Impulstext sagte er: „Die Barmherzigkeit Gottes ist eine Einladung
zum neuen Leben, das eine neue Hoffnung schafft“. Diese bezog er
ganz konkret auf die Lebensituation der Menschen hier und auf den
Philippinen und spannte einen weiten gesellschaftlich- politischen
Bogen von den Ängsten der Menschen in Deutschland bis hin zu den
Folgen des Klimawandels..jpg) Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann verleiht Pirminius-Plakette an besonders
engagierte Kirchenmitglieder aus der Diözese Speyer
Bischof Dr.
Karl-Heinz Wiesemann verleiht Pirminius-Plakette an besonders
engagierte Kirchenmitglieder aus der Diözese Speyer.jpg) unterstützt
seit fast 60 Jahren das Bonifatiuswerk. Seit 1962 kümmert sich der
heute 74-Jährige um Busse des Hilfswerks, wartet und pflegt sie.
Seit vielen Jahrzehnten übernimmt Brunck Sonntag für Sonntag
Fahrdienste und ermöglicht so, dass Gläubige aus den umliegenden
Dörfern den Gottesdienst besuchen können. Daneben war Theodor
Brunck über Jahrzehnte Mitglied und Vorsitzender im
Pfarrgemeinderat, Mitglied im Verwaltungsrat und Lektor. Seit 40
Jahren übernimmt er den Sakristandienst in St. Josef Bayerfeld,
führte ihn trotz schwerer gesundheitlicher Probleme weiter. Ebenso
lange begleitet er die Aktion Dreikönigssingen.
unterstützt
seit fast 60 Jahren das Bonifatiuswerk. Seit 1962 kümmert sich der
heute 74-Jährige um Busse des Hilfswerks, wartet und pflegt sie.
Seit vielen Jahrzehnten übernimmt Brunck Sonntag für Sonntag
Fahrdienste und ermöglicht so, dass Gläubige aus den umliegenden
Dörfern den Gottesdienst besuchen können. Daneben war Theodor
Brunck über Jahrzehnte Mitglied und Vorsitzender im
Pfarrgemeinderat, Mitglied im Verwaltungsrat und Lektor. Seit 40
Jahren übernimmt er den Sakristandienst in St. Josef Bayerfeld,
führte ihn trotz schwerer gesundheitlicher Probleme weiter. Ebenso
lange begleitet er die Aktion Dreikönigssingen..jpg) Alban
Gutting aus Lingenfeld (Pfarrei Seliger Paul Josef
Nardini, Germersheim) ist seit seiner Kindheit eng mit der
Kirchengemeinde verbunden. „So fällt es schwer, all Ihre Ehrenämter
zu benennen“, bekannte der Bischof. In den 1970er Jahren übernahm
Gutting die Geschäftsführung des Elisabethenvereins, gliederte die
pfarrliche Krankenpflege in die neue Ökumenische Sozialstation
Germersheim-Lingenfeld ein. Bis heute ist er als
Verwaltungsratsmitglied der Sozialstation tätig. Mit großem
Engagement und Verantwortungsbewusstsein kümmerte sich Gutting um
den Neubau eines Schwesternhauses der Niederbronner Schwestern,
einer Kindertagesstätte und war viele Jahre Ansprechpartner für die
Belange des Personals und der Gebäude. Als Lingenfelder
Ortsbürgermeister – das Amt bekleidete er fast zwei Jahrzehnte –
lag sein Augenmerk auf der guten Zusammenarbeit zwischen Orts- und
Kirchengemeinde. Daneben ist der 78-Jährige Mitglied im
Verwaltungsrat sowie seit 50 Jahren Sänger im Lingenfelder
Kirchenchor.
Alban
Gutting aus Lingenfeld (Pfarrei Seliger Paul Josef
Nardini, Germersheim) ist seit seiner Kindheit eng mit der
Kirchengemeinde verbunden. „So fällt es schwer, all Ihre Ehrenämter
zu benennen“, bekannte der Bischof. In den 1970er Jahren übernahm
Gutting die Geschäftsführung des Elisabethenvereins, gliederte die
pfarrliche Krankenpflege in die neue Ökumenische Sozialstation
Germersheim-Lingenfeld ein. Bis heute ist er als
Verwaltungsratsmitglied der Sozialstation tätig. Mit großem
Engagement und Verantwortungsbewusstsein kümmerte sich Gutting um
den Neubau eines Schwesternhauses der Niederbronner Schwestern,
einer Kindertagesstätte und war viele Jahre Ansprechpartner für die
Belange des Personals und der Gebäude. Als Lingenfelder
Ortsbürgermeister – das Amt bekleidete er fast zwei Jahrzehnte –
lag sein Augenmerk auf der guten Zusammenarbeit zwischen Orts- und
Kirchengemeinde. Daneben ist der 78-Jährige Mitglied im
Verwaltungsrat sowie seit 50 Jahren Sänger im Lingenfelder
Kirchenchor..jpg) Brigitte
Dauer aus Eußerthal (Pfarrei Hl. Elisabeth, Annweiler)
prägte über 30 Jahre lang die Kirchenmusiktage. In der Pfarrei
unterstützte die heute 80-Jährige eine Zeitlang Pfarrer Rinnert
fürsorglich im Haushalt, übernahm das Schmücken der Kirche und war
unter anderem bei Hochzeiten und Kommunionfeiern mit ihren
Blumenschmuckideen gefragt. Lange Zeit war Brigitte Dauer Mitglied
im Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat und pflegte die Gewänder der
Messdiener. Brigitte Dauer hatte eine Überraschung für den Bischof
mitgebracht: Sie überreichte ihm ein Foto, das ihn beim Fest zum
750. Jubiläum von Eußerthal zeigt.
Brigitte
Dauer aus Eußerthal (Pfarrei Hl. Elisabeth, Annweiler)
prägte über 30 Jahre lang die Kirchenmusiktage. In der Pfarrei
unterstützte die heute 80-Jährige eine Zeitlang Pfarrer Rinnert
fürsorglich im Haushalt, übernahm das Schmücken der Kirche und war
unter anderem bei Hochzeiten und Kommunionfeiern mit ihren
Blumenschmuckideen gefragt. Lange Zeit war Brigitte Dauer Mitglied
im Pfarrgemeinderat und Verwaltungsrat und pflegte die Gewänder der
Messdiener. Brigitte Dauer hatte eine Überraschung für den Bischof
mitgebracht: Sie überreichte ihm ein Foto, das ihn beim Fest zum
750. Jubiläum von Eußerthal zeigt..jpg) Auf
Vorschlag des Bischofs wurde Franz Leidecker
aus Kaiserslautern mit der Pirminius-Plakette
geehrt für „ein Engagement in einem besonders wichtigen, aber auch
schmerzlichen Bereich des kirchlichen Lebens“, wie Wiesemann
erklärte. Bis Ende September hatte Leidecker das Amt des
Missbrauchsbeauftragten des Bistums Speyer ausgeübt. Am 1. Oktober
hat Ansgar Schreiner, Direktor des Amtsgerichts Ludwigshafen, diese
Aufgabe übernommen. Franz Leidecker war bis 2011 als leitender
Kriminaldirektor und stellvertretender Polizeipräsident des
Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen tätig. Vor sechs
Jahren hatte er der Diözese seinen Dienst angeboten und sich
bereiterklärt, als Ansprechpartner bei Fällen von sexuellem
Missbrauch zur Verfügung zu stehen – zu jener Zeit, als die
kirchlichen Missbrauchsfälle fast täglich in den Medien
thematisiert wurden. Tag und Nacht sei Leidecker telefonisch
erreichbar gewesen. Der Bischof bescheinigte Leidecker
Verantwortungsbewusstsein und Diskretion, großen juristischen
Sachverstand und ein starkes Maß an Einfühlungsvermögen. „Ihre
unabhängige Stellung, aber auch Ihre souveräne Art haben Sie für
alle Seiten zu einem vertrauenswürdigen Ansprechpartner gemacht.
Wir schulden Ihnen Dank.“, würdigte Bischof Wiesemann die
Verdienste Leideckers.“Ihrer Einschätzung der Situation und Ihren
Vorschlägen zur finanziellen Anerkennung des Leids, die Sie auf
Grund der genauen Kenntnis der Situation abgegeben haben, konnten
wir als Diözese ohne Einschränkung folgen.“
Auf
Vorschlag des Bischofs wurde Franz Leidecker
aus Kaiserslautern mit der Pirminius-Plakette
geehrt für „ein Engagement in einem besonders wichtigen, aber auch
schmerzlichen Bereich des kirchlichen Lebens“, wie Wiesemann
erklärte. Bis Ende September hatte Leidecker das Amt des
Missbrauchsbeauftragten des Bistums Speyer ausgeübt. Am 1. Oktober
hat Ansgar Schreiner, Direktor des Amtsgerichts Ludwigshafen, diese
Aufgabe übernommen. Franz Leidecker war bis 2011 als leitender
Kriminaldirektor und stellvertretender Polizeipräsident des
Polizeipräsidiums Rheinpfalz in Ludwigshafen tätig. Vor sechs
Jahren hatte er der Diözese seinen Dienst angeboten und sich
bereiterklärt, als Ansprechpartner bei Fällen von sexuellem
Missbrauch zur Verfügung zu stehen – zu jener Zeit, als die
kirchlichen Missbrauchsfälle fast täglich in den Medien
thematisiert wurden. Tag und Nacht sei Leidecker telefonisch
erreichbar gewesen. Der Bischof bescheinigte Leidecker
Verantwortungsbewusstsein und Diskretion, großen juristischen
Sachverstand und ein starkes Maß an Einfühlungsvermögen. „Ihre
unabhängige Stellung, aber auch Ihre souveräne Art haben Sie für
alle Seiten zu einem vertrauenswürdigen Ansprechpartner gemacht.
Wir schulden Ihnen Dank.“, würdigte Bischof Wiesemann die
Verdienste Leideckers.“Ihrer Einschätzung der Situation und Ihren
Vorschlägen zur finanziellen Anerkennung des Leids, die Sie auf
Grund der genauen Kenntnis der Situation abgegeben haben, konnten
wir als Diözese ohne Einschränkung folgen.“
 Sybille
Jatzko, Psychotherapeutin aus Krickenbach bei Kaiserslautern mit
langjährigen Erfahrungen in der Begleitung traumatisierter
Betroffener, hatte die Aufgabe als zweite Ansprechpartnerin für
Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger im Bistum
Speyer im Oktober 2013 übernommen. „Sybille Jatzko hat sich mit
viel Erfahrung und Herzblut eingebracht“, dankte Generalvikar Jung
auch ihr. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte in der
überarbeiteten Fassung der Leitlinien zum Umgang mit sexuellem
Missbrauch 2013 festgelegt, dass in einer Diözese mindestens zwei
Ansprechpartner für Missbrauchsopfer und wenn möglich eine Frau und
ein Mann benannt werden sollen. Sie stehen Hilfesuchenden in allen
Fällen sexuellen Missbrauchs zur Verfügung.
Sybille
Jatzko, Psychotherapeutin aus Krickenbach bei Kaiserslautern mit
langjährigen Erfahrungen in der Begleitung traumatisierter
Betroffener, hatte die Aufgabe als zweite Ansprechpartnerin für
Verdachtsfälle auf sexuellen Missbrauch Minderjähriger im Bistum
Speyer im Oktober 2013 übernommen. „Sybille Jatzko hat sich mit
viel Erfahrung und Herzblut eingebracht“, dankte Generalvikar Jung
auch ihr. Die Deutsche Bischofskonferenz hatte in der
überarbeiteten Fassung der Leitlinien zum Umgang mit sexuellem
Missbrauch 2013 festgelegt, dass in einer Diözese mindestens zwei
Ansprechpartner für Missbrauchsopfer und wenn möglich eine Frau und
ein Mann benannt werden sollen. Sie stehen Hilfesuchenden in allen
Fällen sexuellen Missbrauchs zur Verfügung.
 christlicher Seite schlossen sich ein Friedensgebet, ein
Lobpreis und ein Bittgebet an. Vertreter der eritreisch-orthodoxen
sowie der griechisch-orthodoxen Gemeinde sprachen ihre Gebete auch
in ihrer Heimatsprache. Desgleichen bestand der
sunnitisch-muslimische Beitrag aus einer Koranrezitation, die auf
deutsch und arabisch vorgetragen wurde, ebenso wie der
buddhistische Beitrag in deutsch und sanskrit gehalten wurde. Auch
die alevitische Gemeinde war mit einem Gebet vertreten.
christlicher Seite schlossen sich ein Friedensgebet, ein
Lobpreis und ein Bittgebet an. Vertreter der eritreisch-orthodoxen
sowie der griechisch-orthodoxen Gemeinde sprachen ihre Gebete auch
in ihrer Heimatsprache. Desgleichen bestand der
sunnitisch-muslimische Beitrag aus einer Koranrezitation, die auf
deutsch und arabisch vorgetragen wurde, ebenso wie der
buddhistische Beitrag in deutsch und sanskrit gehalten wurde. Auch
die alevitische Gemeinde war mit einem Gebet vertreten. Führungswechsel bei der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen des Bistums Speyer
Führungswechsel bei der Diözesanen Arbeitsgemeinschaft der
Mitarbeitervertretungen des Bistums Speyer
 Neue Adventsaktion
für Kindertagesstätten, Pfarreien und Familien im Bistum
Speyer
Neue Adventsaktion
für Kindertagesstätten, Pfarreien und Familien im Bistum
Speyer Speyer- Der Medienverleih des Bistums Speyer wurde in
den vergangenen Monaten neu organisiert, um Synergien mit den
Angeboten von AVMZ und medien.rlp im gemeinsamen Medienverleih
Mainz optimal zu nutzen. Ab sofort steht das umfangreiche
Serviceangebot der Medienzentrale Speyer (MZSP) unter
Speyer- Der Medienverleih des Bistums Speyer wurde in
den vergangenen Monaten neu organisiert, um Synergien mit den
Angeboten von AVMZ und medien.rlp im gemeinsamen Medienverleih
Mainz optimal zu nutzen. Ab sofort steht das umfangreiche
Serviceangebot der Medienzentrale Speyer (MZSP) unter  Partnerschaftsarbeit und interkulturelle Vernetzung im
Blick – Nachfolger von Marianne Wagner
Partnerschaftsarbeit und interkulturelle Vernetzung im
Blick – Nachfolger von Marianne Wagner Gärtner
wird Nachfolger von Marianne Wagner, die seit 1. September als
Oberkirchenrätin in Speyer tätig ist. Der in Grünstadt geborene
Gärtner hat in Heidelberg, Tübingen und Port Elisabeth (Südafrika)
Theologie studiert und ein Masterstudium „Management von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen“ absolviert. Er ist
verheiratet und hat drei Kinder.
Gärtner
wird Nachfolger von Marianne Wagner, die seit 1. September als
Oberkirchenrätin in Speyer tätig ist. Der in Grünstadt geborene
Gärtner hat in Heidelberg, Tübingen und Port Elisabeth (Südafrika)
Theologie studiert und ein Masterstudium „Management von
Gesundheits- und Sozialeinrichtungen“ absolviert. Er ist
verheiratet und hat drei Kinder.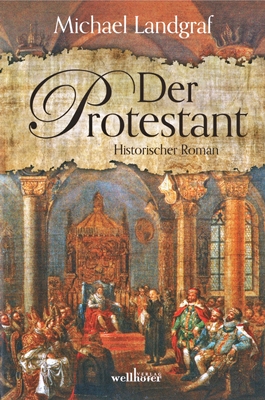 Historischer Roman von Michael Landgraf spielt vor allem
in der Pfalz
Historischer Roman von Michael Landgraf spielt vor allem
in der Pfalz


 Mehr als die
Hälfte der Jubelpaare ist 50 Jahre und länger verheiratet. 269
Paare feiern in diesem Jahr ihre Goldene Hochzeit. 71 Eheleute
blicken auf einen gemeinsamen Lebensweg von 60 oder mehr Jahren
zurück. Die Paare kamen aus der gesamten Diözese. Manche nahmen
eine weite Anreise in Kauf, kamen gar aus dem saarländischen
Mandelbachtal an den Rhein.
Mehr als die
Hälfte der Jubelpaare ist 50 Jahre und länger verheiratet. 269
Paare feiern in diesem Jahr ihre Goldene Hochzeit. 71 Eheleute
blicken auf einen gemeinsamen Lebensweg von 60 oder mehr Jahren
zurück. Die Paare kamen aus der gesamten Diözese. Manche nahmen
eine weite Anreise in Kauf, kamen gar aus dem saarländischen
Mandelbachtal an den Rhein.  In einer seiner
bewegenden Predigt verglich Weihbischof Otto Georgens die Liebe mit
einem Abenteuer – einem Abenteuer fürs Leben, bei dem Gott mit im
Spiel ist. Er erinnerte daran, dass bei Herausforderungen,
Belastungsproben und Krisen die vor ihm sitzenden Eheleute in Treue
zueinandergestanden haben. "Sie haben auf Gott vertraut, auf den
Dritten im Bund Ihrer Ehe, und das Abenteuer Ihres Lebens nicht nur
erlebt, sondern bestanden." Der Weihbischof versicherte: "Gott ist
treu. Auf die Zusage, dass Gott auch in Zukunft zu Ihnen steht,
dürfen Sie vertrauen." Er sprach die Sehnsucht aller Menschen nach
Liebe und Treue an – einer tief verwurzelten Sehnsucht. Wer Liebe
gefunden hat, muss daran arbeiten. "Das Schließen einer Ehe darf
nicht das Abschließen einer Ehegeschichte sein, die Ehe ist als
Gestaltungsaufgabe zu sehen." Liebe ist laut Georgens Ziel und Weg
zugleich, "weil Gott die Liebe ist und weil die Liebe aus Gott
ist". Sie ist ein Kompass, anspruchsvoll, braucht Mut zur
Veränderung, Sensibilität füreinander und ist nicht billig zu
haben.
In einer seiner
bewegenden Predigt verglich Weihbischof Otto Georgens die Liebe mit
einem Abenteuer – einem Abenteuer fürs Leben, bei dem Gott mit im
Spiel ist. Er erinnerte daran, dass bei Herausforderungen,
Belastungsproben und Krisen die vor ihm sitzenden Eheleute in Treue
zueinandergestanden haben. "Sie haben auf Gott vertraut, auf den
Dritten im Bund Ihrer Ehe, und das Abenteuer Ihres Lebens nicht nur
erlebt, sondern bestanden." Der Weihbischof versicherte: "Gott ist
treu. Auf die Zusage, dass Gott auch in Zukunft zu Ihnen steht,
dürfen Sie vertrauen." Er sprach die Sehnsucht aller Menschen nach
Liebe und Treue an – einer tief verwurzelten Sehnsucht. Wer Liebe
gefunden hat, muss daran arbeiten. "Das Schließen einer Ehe darf
nicht das Abschließen einer Ehegeschichte sein, die Ehe ist als
Gestaltungsaufgabe zu sehen." Liebe ist laut Georgens Ziel und Weg
zugleich, "weil Gott die Liebe ist und weil die Liebe aus Gott
ist". Sie ist ein Kompass, anspruchsvoll, braucht Mut zur
Veränderung, Sensibilität füreinander und ist nicht billig zu
haben.





 Bistum Speyer
stellt Kalender für neues Schuljahr vor.
Bistum Speyer
stellt Kalender für neues Schuljahr vor.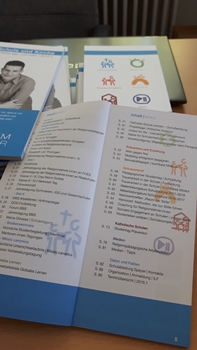 Die rund 50
unterschiedlichen Angebote im Kalender „Schule und Kirche“ umfassen
die Bereiche Religionspädagogik, Globales Lernen, Erziehung und
Prävention sowie Schulpastoral und Medien. Die Veranstaltungen
finden regional im Bistum statt, von St. Ingbert, Pirmasens, Landau
und Speyer, ebenso in Kaiserslautern und Ludwigshafen.
Die rund 50
unterschiedlichen Angebote im Kalender „Schule und Kirche“ umfassen
die Bereiche Religionspädagogik, Globales Lernen, Erziehung und
Prävention sowie Schulpastoral und Medien. Die Veranstaltungen
finden regional im Bistum statt, von St. Ingbert, Pirmasens, Landau
und Speyer, ebenso in Kaiserslautern und Ludwigshafen. Gestaltungskonzept von Bernhard Mathäss überzeugt Jury,
Verwaltungsrat, Kunstbeirat und Bischof – Innenrenovierung der
Seminarkirche beginnt voraussichtlich im Oktober
Gestaltungskonzept von Bernhard Mathäss überzeugt Jury,
Verwaltungsrat, Kunstbeirat und Bischof – Innenrenovierung der
Seminarkirche beginnt voraussichtlich im Oktober Pontifikalamt zu
Mariä Himmelfahrt im Speyerer Dom mit Bischof Dr. Wiesemann
Pontifikalamt zu
Mariä Himmelfahrt im Speyerer Dom mit Bischof Dr. Wiesemann
 Bei der
Marienfeier am Abend predigte Privatdozent Dr. Joachim Reger, der
Maria als „Mutter der Barmherzigkeit“ in den Mittelpunkt seiner
Betrachtung stellte. Barmherzig sein werde nicht selten mit
Nachgiebigkeit, Inkonsequenz und Schwäche gleichgesetzt. Der
Einwand verdeutliche, dass Barmherzigkeit auch gefährlich sein
kann, „wenn sie aus Schwäche geschieht.“ Bloße Gerechtigkeit führe
zu einer Gesellschaft der Kälte, die den Brüchen eines jeden Lebens
nicht gerecht wird. Eine menschenwürdige Gesellschaft aber lasse
sich mit dieser Haltung nicht aufbauen. „Wahre Barmherzigkeit ist
daher keine Haltung der Schwäche, sondern der Stärke. Sie erwächst
aus einer Liebe, die so stark ist, dass sie sich wirklich auf den
Nächsten einlassen kann“, betonte Reger. Barmherzigkeit fordere die
Stärke, über sich selbst hinauszuwachsen und frei zu werden für
andere Menschen. Anschließend zogen die Gläubigen in einer
stimmungsvollen Lichterprozession durch den Domgarten. Die
musikalische Gestaltung der abendlichen Liturgie lag in den Händen
des Chors der Dompfarrei und der Dombläser. Text: Friederike
Walter, Fotos: Klaus Landry
Bei der
Marienfeier am Abend predigte Privatdozent Dr. Joachim Reger, der
Maria als „Mutter der Barmherzigkeit“ in den Mittelpunkt seiner
Betrachtung stellte. Barmherzig sein werde nicht selten mit
Nachgiebigkeit, Inkonsequenz und Schwäche gleichgesetzt. Der
Einwand verdeutliche, dass Barmherzigkeit auch gefährlich sein
kann, „wenn sie aus Schwäche geschieht.“ Bloße Gerechtigkeit führe
zu einer Gesellschaft der Kälte, die den Brüchen eines jeden Lebens
nicht gerecht wird. Eine menschenwürdige Gesellschaft aber lasse
sich mit dieser Haltung nicht aufbauen. „Wahre Barmherzigkeit ist
daher keine Haltung der Schwäche, sondern der Stärke. Sie erwächst
aus einer Liebe, die so stark ist, dass sie sich wirklich auf den
Nächsten einlassen kann“, betonte Reger. Barmherzigkeit fordere die
Stärke, über sich selbst hinauszuwachsen und frei zu werden für
andere Menschen. Anschließend zogen die Gläubigen in einer
stimmungsvollen Lichterprozession durch den Domgarten. Die
musikalische Gestaltung der abendlichen Liturgie lag in den Händen
des Chors der Dompfarrei und der Dombläser. Text: Friederike
Walter, Fotos: Klaus Landry 75. Jahrestag
des Stalin-Erlasses zur Deportation der Wolgadeutschen
75. Jahrestag
des Stalin-Erlasses zur Deportation der Wolgadeutschen

 "Meet the world" (Triff die Welt) war der Titel, unter den
die Abteilung Jugendseelsorge im Bistum Speyer ihre Fahrt mit 41
Jugendlichen gestellt hatte. Schon bei der Ankunft am 20. Juli
wurden die Speyerer Pilgerinnen und Pilger von der weltweiten
Dimension dieser Reise beeindruckt. Die erste von zwei Wochen
verbrachten sie in der Gemeinde Ledziny. Mehrere Tausend junge
Menschen aus Deutschland, Bosnien, Polen und Tschechien füllten die
ländliche Region in der Nähe von Kattowitz mit Leben. Untergebracht
waren sie in kleinen Gruppen bei Gastfamilien. "In einem fremden
Land von fremden Menschen so herzlich aufgenommen zu werden, war
eine wunderbare Erfahrung" erinnert sich Anna Berenz (Frankenthal).
Höhepunkte der Woche waren ein Treffen mit Jugendbischof Wiesemann
und ein Festival mit etwa 12000 Jugendlichen aus aller Welt auf
einem Flugplatz in Kattowitz.
"Meet the world" (Triff die Welt) war der Titel, unter den
die Abteilung Jugendseelsorge im Bistum Speyer ihre Fahrt mit 41
Jugendlichen gestellt hatte. Schon bei der Ankunft am 20. Juli
wurden die Speyerer Pilgerinnen und Pilger von der weltweiten
Dimension dieser Reise beeindruckt. Die erste von zwei Wochen
verbrachten sie in der Gemeinde Ledziny. Mehrere Tausend junge
Menschen aus Deutschland, Bosnien, Polen und Tschechien füllten die
ländliche Region in der Nähe von Kattowitz mit Leben. Untergebracht
waren sie in kleinen Gruppen bei Gastfamilien. "In einem fremden
Land von fremden Menschen so herzlich aufgenommen zu werden, war
eine wunderbare Erfahrung" erinnert sich Anna Berenz (Frankenthal).
Höhepunkte der Woche waren ein Treffen mit Jugendbischof Wiesemann
und ein Festival mit etwa 12000 Jugendlichen aus aller Welt auf
einem Flugplatz in Kattowitz. Zur Abschlussveranstaltung am 30. und 31. August
pilgerten die Speyerer Jugendlichen zu Fuß zum "Campus
Misericordiae", einem Feld in den Sumpfgebieten im Osten Krakaus.
Bei strahlendem Sonnenschein warteten sie gemeinsam mit etwa 1,5
Millionen Jugendlichen auf Papst Franziskus, mit dem sie eine Vigil
(Nachtgebet) feierten. Einfachste Umstände und extreme Hitze
brachten die jungen Menschen nicht davon ab, bis spät in die Nacht
zu feiern und zu beten. Nach einer Übernachtung unter freiem Himmel
endete der Weltjugendtag mit einem großen Abschlussgottesdienst -
und einem 8 Kilometer langen Fußmarsch durch Gewitterregen.
Zur Abschlussveranstaltung am 30. und 31. August
pilgerten die Speyerer Jugendlichen zu Fuß zum "Campus
Misericordiae", einem Feld in den Sumpfgebieten im Osten Krakaus.
Bei strahlendem Sonnenschein warteten sie gemeinsam mit etwa 1,5
Millionen Jugendlichen auf Papst Franziskus, mit dem sie eine Vigil
(Nachtgebet) feierten. Einfachste Umstände und extreme Hitze
brachten die jungen Menschen nicht davon ab, bis spät in die Nacht
zu feiern und zu beten. Nach einer Übernachtung unter freiem Himmel
endete der Weltjugendtag mit einem großen Abschlussgottesdienst -
und einem 8 Kilometer langen Fußmarsch durch Gewitterregen.





 Der
„Grüne Gockel“ hilft kirchlichen Einrichtungen,
Energieeinsparpotenziale zu erkennen, sich energiesparend zu
verhalten und sinnvolle Investitionen zu planen. Erfahrungen von
zertifizierten Kirchengemeinden hätten gezeigt, dass der
Ressourcenverbrauch allein durch Veränderung des Nutzerverhaltens
dauerhaft um zehn bis 20 Prozent gesenkt werden könne, sagt die
Umweltbeauftragte der Landeskirche, Bärbel Schäfer. Die
Umweltauswirkungen in den Bereichen Energieverbrauch, Mobilität,
Beschaffung und Abfall systematisch zu erfassen und Möglichkeiten
des Einsparens zu erkennen und zu bewerten seien u.a. wichtige
Bausteine des Umweltmanagements.
Der
„Grüne Gockel“ hilft kirchlichen Einrichtungen,
Energieeinsparpotenziale zu erkennen, sich energiesparend zu
verhalten und sinnvolle Investitionen zu planen. Erfahrungen von
zertifizierten Kirchengemeinden hätten gezeigt, dass der
Ressourcenverbrauch allein durch Veränderung des Nutzerverhaltens
dauerhaft um zehn bis 20 Prozent gesenkt werden könne, sagt die
Umweltbeauftragte der Landeskirche, Bärbel Schäfer. Die
Umweltauswirkungen in den Bereichen Energieverbrauch, Mobilität,
Beschaffung und Abfall systematisch zu erfassen und Möglichkeiten
des Einsparens zu erkennen und zu bewerten seien u.a. wichtige
Bausteine des Umweltmanagements.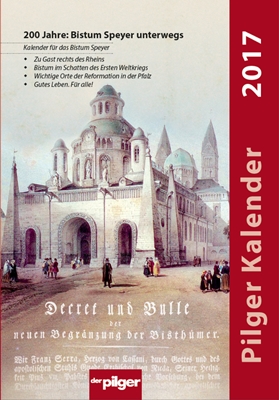 „Pilger-Kalender“ spannt weiten Themenbogen –
Bistumsneugründung vor 200 Jahren ein Schwerpunkt
„Pilger-Kalender“ spannt weiten Themenbogen –
Bistumsneugründung vor 200 Jahren ein Schwerpunkt
 Solidarität gilt den Angehörigen – Tränen sind die äußeren
Zeichen unseres Mitgefühls
Solidarität gilt den Angehörigen – Tränen sind die äußeren
Zeichen unseres Mitgefühls

 Der
Schulleiter bedankte sich bei den Diakonissen Speyer-Mannheim als
Träger der Fachschule: „Damit eine gute Ausbildung gelingen kann,
ist es wichtig, im Hintergrund einen Träger zu wissen, der die
Bedeutung von Ausbildung und Schule kennt und seine Schule fördert
und unterstützt.“ Im Namen des Trägers gratulierte Vorsteher
Pfarrer Dr. Günter Geisthardt den Absolventinnen und Absolventen.
Sie könnten als Erzieherinnen und Sozialassistenten „dazu
beitragen, dass Leben gelingt: Ihr eigenes und das anderer“,
betonte Geisthardt. Im Rahmen der Veranstaltung dankte er gemeinsam
mit Kollegen und Schülern dem Leiter des Ausbildungszentrums
Michael Wendelken für sein jahrelanges Engagement für die Schulen
der Diakonissen Speyer-Mannheim: Er wird künftig für die
Personalentwicklung Gesundheit und Soziales im Unternehmen
verantwortlich sein.
Der
Schulleiter bedankte sich bei den Diakonissen Speyer-Mannheim als
Träger der Fachschule: „Damit eine gute Ausbildung gelingen kann,
ist es wichtig, im Hintergrund einen Träger zu wissen, der die
Bedeutung von Ausbildung und Schule kennt und seine Schule fördert
und unterstützt.“ Im Namen des Trägers gratulierte Vorsteher
Pfarrer Dr. Günter Geisthardt den Absolventinnen und Absolventen.
Sie könnten als Erzieherinnen und Sozialassistenten „dazu
beitragen, dass Leben gelingt: Ihr eigenes und das anderer“,
betonte Geisthardt. Im Rahmen der Veranstaltung dankte er gemeinsam
mit Kollegen und Schülern dem Leiter des Ausbildungszentrums
Michael Wendelken für sein jahrelanges Engagement für die Schulen
der Diakonissen Speyer-Mannheim: Er wird künftig für die
Personalentwicklung Gesundheit und Soziales im Unternehmen
verantwortlich sein.
 Auf der Suche nach neuen pastoralen Impulsen
weltweit
Auf der Suche nach neuen pastoralen Impulsen
weltweit
 In
seiner Predigt erinnerte Georgens daran, dass in allen großen
Religionen Gott nicht am Menschen vorbei handele, sondern
„Mitliebende“ brauche und Menschen „für sich in Dienst“ nehme. Der
Weihbischof verwies auf das Evangelium vom barmherzigen Samariter.
Die Frage eines Schriftgelehrten nach dem richtigen Weg zum ewigen
Leben beantworte Jesus mit dieser Geschichte über ein Beispiel
tatkräftiger Nächstenliebe. Er mache damit deutlich, dass es in
jeder Situation darum gehe, barmherzig zu handeln. „Das heißt, es
kommt entscheidend auf dich selbst an. Du musst die Augen
aufmachen, dann wirst du lauter Menschen entdecken, die deine Hilfe
brauchen", so der Weihbischof. Und es stecke auch „eine gehörige
Portion Kirchenkritik“ in dem Gleichnis, wenn beschrieben werde,
dass gerade Priester und Levit keine Hilfe leisteten. Georgens
warnte deshalb davor „den kirchlichen Betrieb und seine
reibungslose Abwicklung für das Wichtigste zu halten“ und deswegen
den Kern der Botschaft Jesu zu vergessen: „Die erbarmende Liebe,
das Mitleiden mit allen Gequälten, die spontane Bereitschaft zur
Hilfe“. Ob ein Christ fromm sei oder nicht entscheide sich in
seinem Umgang mit demjenigen, dem er begegne und der ihn
brauche.
In
seiner Predigt erinnerte Georgens daran, dass in allen großen
Religionen Gott nicht am Menschen vorbei handele, sondern
„Mitliebende“ brauche und Menschen „für sich in Dienst“ nehme. Der
Weihbischof verwies auf das Evangelium vom barmherzigen Samariter.
Die Frage eines Schriftgelehrten nach dem richtigen Weg zum ewigen
Leben beantworte Jesus mit dieser Geschichte über ein Beispiel
tatkräftiger Nächstenliebe. Er mache damit deutlich, dass es in
jeder Situation darum gehe, barmherzig zu handeln. „Das heißt, es
kommt entscheidend auf dich selbst an. Du musst die Augen
aufmachen, dann wirst du lauter Menschen entdecken, die deine Hilfe
brauchen", so der Weihbischof. Und es stecke auch „eine gehörige
Portion Kirchenkritik“ in dem Gleichnis, wenn beschrieben werde,
dass gerade Priester und Levit keine Hilfe leisteten. Georgens
warnte deshalb davor „den kirchlichen Betrieb und seine
reibungslose Abwicklung für das Wichtigste zu halten“ und deswegen
den Kern der Botschaft Jesu zu vergessen: „Die erbarmende Liebe,
das Mitleiden mit allen Gequälten, die spontane Bereitschaft zur
Hilfe“. Ob ein Christ fromm sei oder nicht entscheide sich in
seinem Umgang mit demjenigen, dem er begegne und der ihn
brauche. Mit einem
Handschlag und der Überreichung der Heiligen Schrift sandte
Weihbischof Georgens die vier Beauftragten an ihre erste Stelle
aus, die sie zum 1. August antreten. Katja Kirsch (28), die ihre
Praktikumszeit während des zweijährigen Pastoralkurses in der
Pfarrei Heiliger Bruder Konrad in Martinshöhe absolvierte, wird als
Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Remigius in Kusel tätig
sein. Melanie Müller (30) wird in der Pfarrei Heilige Katharina von
Alexandria in Hauenstein arbeiten. Sie war während der
pastoralpraktischen Ausbildung in der Gemeinde Kaiserslautern St.
Maria und – unterbrochen durch ein Jahr Elternzeit – in Neustadt
St. Marien tätig. Für Katrin Ziebarth (38) beginnt der Einsatz im
pastoralen Dienst nach ihrer Praktikumszeit, die sie in der Pfarrei
Heilig Kreuz in Gersheim absolvierte, jetzt in der ehemaligen
Projektpfarrei Franz von Assisi in Queidersbach. Die Wirkungsstätte
von Christoph Raupach (52), der während seines Praktikums in der
Pfarrei Heiliger Christophorus in Wörth arbeitete, wird die Pfarrei
Seliger Paul Josef Nardini in Pirmasens sein.
Mit einem
Handschlag und der Überreichung der Heiligen Schrift sandte
Weihbischof Georgens die vier Beauftragten an ihre erste Stelle
aus, die sie zum 1. August antreten. Katja Kirsch (28), die ihre
Praktikumszeit während des zweijährigen Pastoralkurses in der
Pfarrei Heiliger Bruder Konrad in Martinshöhe absolvierte, wird als
Pastoralassistentin in der Pfarrei Heiliger Remigius in Kusel tätig
sein. Melanie Müller (30) wird in der Pfarrei Heilige Katharina von
Alexandria in Hauenstein arbeiten. Sie war während der
pastoralpraktischen Ausbildung in der Gemeinde Kaiserslautern St.
Maria und – unterbrochen durch ein Jahr Elternzeit – in Neustadt
St. Marien tätig. Für Katrin Ziebarth (38) beginnt der Einsatz im
pastoralen Dienst nach ihrer Praktikumszeit, die sie in der Pfarrei
Heilig Kreuz in Gersheim absolvierte, jetzt in der ehemaligen
Projektpfarrei Franz von Assisi in Queidersbach. Die Wirkungsstätte
von Christoph Raupach (52), der während seines Praktikums in der
Pfarrei Heiliger Christophorus in Wörth arbeitete, wird die Pfarrei
Seliger Paul Josef Nardini in Pirmasens sein. Musikalisch gestaltet
wurde der Gottesdienst vom Mädchenchor, den Domsingknaben und dem
Domchor unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller. An der Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub.
Musikalisch gestaltet
wurde der Gottesdienst vom Mädchenchor, den Domsingknaben und dem
Domchor unter der Leitung von Domkapellmeister Markus Melchiori und
Domkantor Joachim Weller. An der Orgel spielte Domorganist Markus
Eichenlaub.
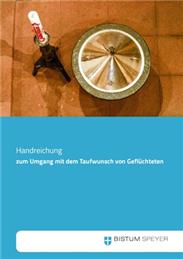 Bischöfliches Ordinariat gibt Handreichung zum
Umgang mit dem Taufwunsch von Geflüchteten heraus
Bischöfliches Ordinariat gibt Handreichung zum
Umgang mit dem Taufwunsch von Geflüchteten heraus.jpg) Gab es in den
vergangenen Jahren nur vereinzelt muslimische Taufbewerber, so ist
ihre Zahl inzwischen angestiegen. „Viele Flüchtlinge sind auf der
Suche nach einer neuen Heimat – auch im Glauben“, erklärt
Vogelgesang. Für manche von ihnen gehörte der im Herkunftsland
nicht realisierbare Wunsch, sich taufen zu lassen und erkennbar als
Christ zu leben, zu den Gründen, die Heimat zu verlassen. In den
Pfarreien sorge das Interesse am christlichen Glauben einerseits
für Freude. Andererseits bestehe die Angst, „etwas falsch zu machen
oder in den Verdacht zu geraten, die Situation der Flüchtlinge mit
meist muslimischem Hintergrund ausnutzen oder sie gar bekehren zu
wollen.“ Neben den sprachlichen und kulturellen Hürden gebe es auch
rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Taufe, die nicht
leicht zu beantworten seien.
Gab es in den
vergangenen Jahren nur vereinzelt muslimische Taufbewerber, so ist
ihre Zahl inzwischen angestiegen. „Viele Flüchtlinge sind auf der
Suche nach einer neuen Heimat – auch im Glauben“, erklärt
Vogelgesang. Für manche von ihnen gehörte der im Herkunftsland
nicht realisierbare Wunsch, sich taufen zu lassen und erkennbar als
Christ zu leben, zu den Gründen, die Heimat zu verlassen. In den
Pfarreien sorge das Interesse am christlichen Glauben einerseits
für Freude. Andererseits bestehe die Angst, „etwas falsch zu machen
oder in den Verdacht zu geraten, die Situation der Flüchtlinge mit
meist muslimischem Hintergrund ausnutzen oder sie gar bekehren zu
wollen.“ Neben den sprachlichen und kulturellen Hürden gebe es auch
rechtliche Fragestellungen im Zusammenhang mit der Taufe, die nicht
leicht zu beantworten seien..jpg) Das Bistum
Speyer und seine Pfarreien bewerteten den Taufwunsch von
Flüchtlingen grundsätzlich nicht anders als den Taufwunsch jedes
anderen Erwachsenen, macht Vogelgesang deutlich. „Wer im
Erwachsenenalter Christ werden möchte, hat in einer
Vorbereitungszeit von etwa einem Jahr die Möglichkeit, schrittweise
in den christlichen Glauben hineinzuwachsen.“ Dabei werden auch die
Beweggründe für den Übertritt und die Konsequenzen dieser
Entscheidung reflektiert. Die Vorbereitung findet in einer
Katechumenatsgruppe oder in Einzelgesprächen mit einem Seelsorger
statt. Den Höhepunkt bildet die Tauffeier, häufig in der
Osternacht, in der der Taufbewerber durch die Spendung der
Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie in die volle
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wird.
Das Bistum
Speyer und seine Pfarreien bewerteten den Taufwunsch von
Flüchtlingen grundsätzlich nicht anders als den Taufwunsch jedes
anderen Erwachsenen, macht Vogelgesang deutlich. „Wer im
Erwachsenenalter Christ werden möchte, hat in einer
Vorbereitungszeit von etwa einem Jahr die Möglichkeit, schrittweise
in den christlichen Glauben hineinzuwachsen.“ Dabei werden auch die
Beweggründe für den Übertritt und die Konsequenzen dieser
Entscheidung reflektiert. Die Vorbereitung findet in einer
Katechumenatsgruppe oder in Einzelgesprächen mit einem Seelsorger
statt. Den Höhepunkt bildet die Tauffeier, häufig in der
Osternacht, in der der Taufbewerber durch die Spendung der
Sakramente der Taufe, der Firmung und der Eucharistie in die volle
Gemeinschaft der Kirche aufgenommen wird. Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer schneidet bei Erhebung
sehr gut ab
Bund der
Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) Speyer schneidet bei Erhebung
sehr gut ab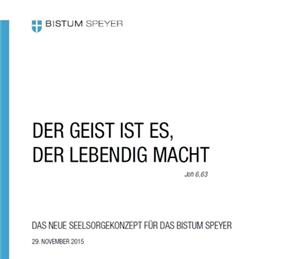 Konzept ist
Ergebnis des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“, der im Jahr 2009
begonnen wurde und zum Jahresende 2015 seinen Abschluss gefunden
hat
Konzept ist
Ergebnis des Prozesses „Gemeindepastoral 2015“, der im Jahr 2009
begonnen wurde und zum Jahresende 2015 seinen Abschluss gefunden
hat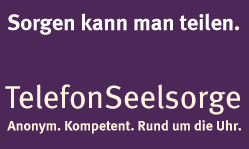 Pfälzische
Einrichtung nimmt an bundesweitem Jubiläum und Weltkongress
teil
Pfälzische
Einrichtung nimmt an bundesweitem Jubiläum und Weltkongress
teil

 Speyer- Unter diesem Motto hat letztes Wochenende
die katholische Gemeinde St. Konrad in Speyer Nord zum
traditionellen Gemeindefest eingeladen.
Speyer- Unter diesem Motto hat letztes Wochenende
die katholische Gemeinde St. Konrad in Speyer Nord zum
traditionellen Gemeindefest eingeladen. Nach dem
Gottesdienst erfreuten sich alle Gäste an dem reichhaltigen
Angebot. Bei Bratwurst, Spießbraten, Pommes Frites und weiteren
Pfälzer Spezialitäten wurde Geselligkeit gelebt. Auf Empfehlung der
Bierprofis Speyer, zum ersten Mal eine große Auswahl an
verschiedenen Biersorten angeboten. Die Bierprofis sind aus einer
Gruppenstunde der Pfarrei St. Konrad entstanden und testen seit
1989 weltweit Biere. Aktuell bereits über 7950 Stück. Ihre
Empfehlungen, alles Biere mit Bestnoten, kamen bei den Besuchern
sehr gut an. Der Cocktailstand erfreute sich großer Beliebtheit.
Der italienische Rotwein, der vom Freundeskreis Ravenna angeboten
wurde, war nicht nur bei den Italienischen Gästen aus Pomposa auf
den Tischen zu finden.
Nach dem
Gottesdienst erfreuten sich alle Gäste an dem reichhaltigen
Angebot. Bei Bratwurst, Spießbraten, Pommes Frites und weiteren
Pfälzer Spezialitäten wurde Geselligkeit gelebt. Auf Empfehlung der
Bierprofis Speyer, zum ersten Mal eine große Auswahl an
verschiedenen Biersorten angeboten. Die Bierprofis sind aus einer
Gruppenstunde der Pfarrei St. Konrad entstanden und testen seit
1989 weltweit Biere. Aktuell bereits über 7950 Stück. Ihre
Empfehlungen, alles Biere mit Bestnoten, kamen bei den Besuchern
sehr gut an. Der Cocktailstand erfreute sich großer Beliebtheit.
Der italienische Rotwein, der vom Freundeskreis Ravenna angeboten
wurde, war nicht nur bei den Italienischen Gästen aus Pomposa auf
den Tischen zu finden. Im Anschluss an
den Gottesdienst feierten die Besucher bei sonnigem Wetter im
Pfarrhof weiter. Jung und Alt informierte sich im Garten des
Pfarrhauses über die Geschichte, Arbeit und Angebote der
Pfadfinder. Für Kinder boten diese ein interessantes Stationsspiel,
welches viel Anklang fand. Am Nachmittag sang sich Rainbow, ein
Chor der Chorgemeinschaft Speyer, in die Herzen der Besucher. Bei
Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Gartenbroten und weiteren
Leckereien von der Frauengemeinschaft, Spießbraten, gebackenem
Schafskäse und weiteren Spezialitäten verlebten die Gäste einen
sonnigen und unterhaltsamen Nachmittag.
Im Anschluss an
den Gottesdienst feierten die Besucher bei sonnigem Wetter im
Pfarrhof weiter. Jung und Alt informierte sich im Garten des
Pfarrhauses über die Geschichte, Arbeit und Angebote der
Pfadfinder. Für Kinder boten diese ein interessantes Stationsspiel,
welches viel Anklang fand. Am Nachmittag sang sich Rainbow, ein
Chor der Chorgemeinschaft Speyer, in die Herzen der Besucher. Bei
Kaffee und selbst gebackenen Kuchen, Gartenbroten und weiteren
Leckereien von der Frauengemeinschaft, Spießbraten, gebackenem
Schafskäse und weiteren Spezialitäten verlebten die Gäste einen
sonnigen und unterhaltsamen Nachmittag.

.jpg)
.jpg) Walter
Höcky kam auf Umwegen zum Priesteramt. Wiesemann erinnerte in
seiner Predigt daran, dass der Weihekandidat bereits als Messdiener
Gottes Kraft und Liebe gespürt habe. Der Weg hin zum Priesteramt
verlief aber nicht geradlinig. Höcky engagierte sich stark in
seiner Heimatgemeinde in Edesheim. Nach Abitur und Wehrdienst
studierte er aber zunächst Politikwissenschaft, Soziologie und
Psychologie. Gleichzeitig besuchte Höcky damals schon
Theologievorlesungen. Erst im reiferen Alter, blickte Wiesemann
zurück, nahm der Weihekandidat tatsächlich ein Theologiestudium
auf. In seiner pastoralpraktischen Ausbildung war Walter Höcky in
der Pfarrei Heiliger Petrus in Bobenheim-Roxheim tätig. Wiesemann
dankte Höckys Wegbegleitern, seinen Freunden und Verwandten,
Mitgliedern von Höckys Heimatgemeinde und seiner Diakonatspfarrei.
Sie hatten den 45-Jährigen zu seiner Weihe in den Dom begleitet.
Ebenso erinnerte der Bischof an Höckys verstorbene Eltern.
Walter
Höcky kam auf Umwegen zum Priesteramt. Wiesemann erinnerte in
seiner Predigt daran, dass der Weihekandidat bereits als Messdiener
Gottes Kraft und Liebe gespürt habe. Der Weg hin zum Priesteramt
verlief aber nicht geradlinig. Höcky engagierte sich stark in
seiner Heimatgemeinde in Edesheim. Nach Abitur und Wehrdienst
studierte er aber zunächst Politikwissenschaft, Soziologie und
Psychologie. Gleichzeitig besuchte Höcky damals schon
Theologievorlesungen. Erst im reiferen Alter, blickte Wiesemann
zurück, nahm der Weihekandidat tatsächlich ein Theologiestudium
auf. In seiner pastoralpraktischen Ausbildung war Walter Höcky in
der Pfarrei Heiliger Petrus in Bobenheim-Roxheim tätig. Wiesemann
dankte Höckys Wegbegleitern, seinen Freunden und Verwandten,
Mitgliedern von Höckys Heimatgemeinde und seiner Diakonatspfarrei.
Sie hatten den 45-Jährigen zu seiner Weihe in den Dom begleitet.
Ebenso erinnerte der Bischof an Höckys verstorbene Eltern..jpg) Nach
der Predigt nahm Bischof Wiesemann dem Edesheimer das
Weiheversprechen ab. Während der Litanei lag der Weihekandidat zum
Zeichen seiner Hingabe ausgestreckt auf dem Boden. Anschließend
legte der Bischof – so wie es schon die Apostel taten – schweigend
dem Weihekandidaten die Hände auf sowie anschließend alle
anwesenden Priester.
Nach
der Predigt nahm Bischof Wiesemann dem Edesheimer das
Weiheversprechen ab. Während der Litanei lag der Weihekandidat zum
Zeichen seiner Hingabe ausgestreckt auf dem Boden. Anschließend
legte der Bischof – so wie es schon die Apostel taten – schweigend
dem Weihekandidaten die Hände auf sowie anschließend alle
anwesenden Priester. -01.jpg) Delegation aus dem Weinort übergibt „Weinzehnt“ vor dem
Dom – Bischof Wiesemann verweist auf Erlebnistag Deutsche
Weinstraße unter dem Motto „Himmlische Pfalz“
Delegation aus dem Weinort übergibt „Weinzehnt“ vor dem
Dom – Bischof Wiesemann verweist auf Erlebnistag Deutsche
Weinstraße unter dem Motto „Himmlische Pfalz“-01.jpg) Wein
von einer Abordnung der Ortsgemeinde mit dem Kirrweiler
Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Janine I. und den beiden
Pfarrern Marco Richtscheid und Dr. Gerd Babelotzky sowie dem
Venninger „Essigmacher“ Georg Wiedemann.
Wein
von einer Abordnung der Ortsgemeinde mit dem Kirrweiler
Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Janine I. und den beiden
Pfarrern Marco Richtscheid und Dr. Gerd Babelotzky sowie dem
Venninger „Essigmacher“ Georg Wiedemann.-01.jpg) In
seiner kurzen Ansprache erinnerte Bürgermeister Metzger an die
jahrhundertelangen Verbindungen zwischen seiner Gemeinde und den
Speyerer Bischöfen. Zu Feudalzeiten war Kirrweiler Oberamt und
Sommerresidenz der Fürstbischöfe des Bistums Speyer, denen die
Winzer ihren „Weinzehnten“ ablieferten. Auch heute noch gehört
innerhalb der Gemarkung Kirrweiler ein Weinberg dem bischöflichen
Stuhl.
In
seiner kurzen Ansprache erinnerte Bürgermeister Metzger an die
jahrhundertelangen Verbindungen zwischen seiner Gemeinde und den
Speyerer Bischöfen. Zu Feudalzeiten war Kirrweiler Oberamt und
Sommerresidenz der Fürstbischöfe des Bistums Speyer, denen die
Winzer ihren „Weinzehnten“ ablieferten. Auch heute noch gehört
innerhalb der Gemarkung Kirrweiler ein Weinberg dem bischöflichen
Stuhl.-01.jpg) Weihbischof Georgens, zünftig gekleidet mit Winzerkittel,
zitierte mit Augenzwinkern eine Predigt des Mainzer Weihbischofs
Valentin Heimes (1741-1806). Unter dem Motto „Der Missbrauch aber
schließt den Gebrauch nicht aus“ hatte der für einen maßvollen
Genuss des Weins geworben: „denn der Wein erfreut des Menschen
Herz!“.
Weihbischof Georgens, zünftig gekleidet mit Winzerkittel,
zitierte mit Augenzwinkern eine Predigt des Mainzer Weihbischofs
Valentin Heimes (1741-1806). Unter dem Motto „Der Missbrauch aber
schließt den Gebrauch nicht aus“ hatte der für einen maßvollen
Genuss des Weins geworben: „denn der Wein erfreut des Menschen
Herz!“.-01.jpg) Bischof
Wiesemann zeigte sich beeindruckt davon, wie intensiv sich die
Kirrweiler mit ihrer Geschichte beschäftigten. Er verweis darauf,
dass in diesem Jahr der Erlebnistag Deutsche Weinstraße unter dem
Motto „Himmlische Pfalz“ steht und gemeinsam mit den Kirchen
veranstaltet wird und überreichte dem Kirrweiler Bürgermeister das
gelbe Plakat, mit dem für den Erlebnistag geworben wird.
Bischof
Wiesemann zeigte sich beeindruckt davon, wie intensiv sich die
Kirrweiler mit ihrer Geschichte beschäftigten. Er verweis darauf,
dass in diesem Jahr der Erlebnistag Deutsche Weinstraße unter dem
Motto „Himmlische Pfalz“ steht und gemeinsam mit den Kirchen
veranstaltet wird und überreichte dem Kirrweiler Bürgermeister das
gelbe Plakat, mit dem für den Erlebnistag geworben wird. Kombiangebote für Dom und Domschatz im Historischen Museum
der Pfalz
Kombiangebote für Dom und Domschatz im Historischen Museum
der Pfalz „Ich freue mich,
dass wir nach der kombinierten Dom-Stadtführung nun auch ein
Kombiprodukt zusammen mit dem Historischen Museum der Pfalz
anbieten, zumal das Museum und der Dom sich in direkter
Nachbarschaft befinden,“ erklärte Domkustos Peter Schappert.
Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert ergänzte:
„Ich freue mich,
dass wir nach der kombinierten Dom-Stadtführung nun auch ein
Kombiprodukt zusammen mit dem Historischen Museum der Pfalz
anbieten, zumal das Museum und der Dom sich in direkter
Nachbarschaft befinden,“ erklärte Domkustos Peter Schappert.
Museumsdirektor Dr. Alexander Schubert ergänzte: Das Kombiticket und die Kombiführung sind ausschließlich
im Dom-Besucherzentrum am Domplatz erhältlich. Die Führung dauert
etwa eindreiviertel Stunden und kann dienstags bis samstags
zwischen 9 und 16 Uhr sowie sonntags zwischen 12 und 16
gebucht werden (Führungsbeginn).
Das Kombiticket und die Kombiführung sind ausschließlich
im Dom-Besucherzentrum am Domplatz erhältlich. Die Führung dauert
etwa eindreiviertel Stunden und kann dienstags bis samstags
zwischen 9 und 16 Uhr sowie sonntags zwischen 12 und 16
gebucht werden (Führungsbeginn). Speyer- Gleich dreifachen Grund zum Feiern hat
die Pfarrgemeinde St. Joseph am Samstag, 2.Juli:
Speyer- Gleich dreifachen Grund zum Feiern hat
die Pfarrgemeinde St. Joseph am Samstag, 2.Juli:.jpg)
.jpg) Mit einem
kleinen Sektempfang begrüßte Felix Goldinger die Teilnehmer. Der
Referent für Missionarische Pastoral im Bistum hatte den Anstoß zum
Instawalk gegeben. Kirche trifft Netz-Community: Das passt für
Goldinger gut zur neuen Netzgemeinde DA_ZWISCHEN, die vor drei
Monaten gegründet wurde. Sie ist ein spirituelles Angebot der
Diözese Speyer in den sozialen Netzwerken und bei WhatsApp. Unter
dem Titel #instakirche öffnen bundesweit Kirchen ihre Türen für
Instagram-Fotografen. Nach Instawalks durch den Osnabrücker Dom,
das Bonner Münster, den Essener Dom und die Probsteikirche Leipzig
war der Speyerer Dom die fünfte Station.
Mit einem
kleinen Sektempfang begrüßte Felix Goldinger die Teilnehmer. Der
Referent für Missionarische Pastoral im Bistum hatte den Anstoß zum
Instawalk gegeben. Kirche trifft Netz-Community: Das passt für
Goldinger gut zur neuen Netzgemeinde DA_ZWISCHEN, die vor drei
Monaten gegründet wurde. Sie ist ein spirituelles Angebot der
Diözese Speyer in den sozialen Netzwerken und bei WhatsApp. Unter
dem Titel #instakirche öffnen bundesweit Kirchen ihre Türen für
Instagram-Fotografen. Nach Instawalks durch den Osnabrücker Dom,
das Bonner Münster, den Essener Dom und die Probsteikirche Leipzig
war der Speyerer Dom die fünfte Station..jpg) Für
Kristijan Nujic aus Ludwigshafen ist der Instawalk ein Erlebnis:
"Ich war schon oft ihm Dom, aber nie mit dem Handy und nie so
allein." Die Instawalker hatten die Kathedrale ganz für sich
allein. Die Führung fand außerhalb der Öffnungszeiten statt.
Deshalb konnte Peter Schappert die Gruppe auch in den Altarraum und
die Apsis führen und eröffnete damit neue Ein- und Ausblicke. Die
Teilnehmer spürten, wie der Bischof auf die Gemeinde blickt, wenn
er vor dem Hochaltar predigt. Sie streiften durch Katharinen- und
Taufkapelle, immer auf der Suche nach einem guten Motiv. Sie
mussten nicht lange suchen, fingen prächtige Reliquiare und
Säulenkapitelle ein. Sie erlebten die Krypta und die Grablege der
Kaiser und Könige. Zum Schluss ging's zum Endspurt die Treppen
hinauf in den Kaisersaal und auf die Chorempore. Hier eröffnet sich
ein einmaliger Blick auf die Fresken, die das Hauptschiff schmücken
und in den Dom. Diese Gelegenheit ließen sich die Instawalker
natürlich nicht entgehen, machen an dieser Stelle sogar
Panoramaaufnahmen und Selfies.
Für
Kristijan Nujic aus Ludwigshafen ist der Instawalk ein Erlebnis:
"Ich war schon oft ihm Dom, aber nie mit dem Handy und nie so
allein." Die Instawalker hatten die Kathedrale ganz für sich
allein. Die Führung fand außerhalb der Öffnungszeiten statt.
Deshalb konnte Peter Schappert die Gruppe auch in den Altarraum und
die Apsis führen und eröffnete damit neue Ein- und Ausblicke. Die
Teilnehmer spürten, wie der Bischof auf die Gemeinde blickt, wenn
er vor dem Hochaltar predigt. Sie streiften durch Katharinen- und
Taufkapelle, immer auf der Suche nach einem guten Motiv. Sie
mussten nicht lange suchen, fingen prächtige Reliquiare und
Säulenkapitelle ein. Sie erlebten die Krypta und die Grablege der
Kaiser und Könige. Zum Schluss ging's zum Endspurt die Treppen
hinauf in den Kaisersaal und auf die Chorempore. Hier eröffnet sich
ein einmaliger Blick auf die Fresken, die das Hauptschiff schmücken
und in den Dom. Diese Gelegenheit ließen sich die Instawalker
natürlich nicht entgehen, machen an dieser Stelle sogar
Panoramaaufnahmen und Selfies.
 Lieferung aus Kirrweiler kommt am 24. Juni nach Speyer –
Zug mit der Pferdekutsche von der Stadthalle zum Dom
Lieferung aus Kirrweiler kommt am 24. Juni nach Speyer –
Zug mit der Pferdekutsche von der Stadthalle zum Dom-01-01.jpg) Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto
Georgens werden die Weinfuhre am Freitag, 24. Juni, gegen 15 Uhr
vor dem Speyerer Dom in Empfang nehmen. Begleitet wird die Kutsche
mit dem Wein von einer Delegation der Ortsgemeinde mit dem
Kirrweiler Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Janine I. und
den beiden Pfarrern Marco Richtscheid und Dr. Gerd Babelotzky. Der
Zug mit der Pferdekutsche wird von der Stadthalle über die
Bahnhofstraße zum Altpörtel und dann über die Maximilianstraße
zum Dom führen.
Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto
Georgens werden die Weinfuhre am Freitag, 24. Juni, gegen 15 Uhr
vor dem Speyerer Dom in Empfang nehmen. Begleitet wird die Kutsche
mit dem Wein von einer Delegation der Ortsgemeinde mit dem
Kirrweiler Bürgermeister Rolf Metzger, Weinprinzessin Janine I. und
den beiden Pfarrern Marco Richtscheid und Dr. Gerd Babelotzky. Der
Zug mit der Pferdekutsche wird von der Stadthalle über die
Bahnhofstraße zum Altpörtel und dann über die Maximilianstraße
zum Dom führen.
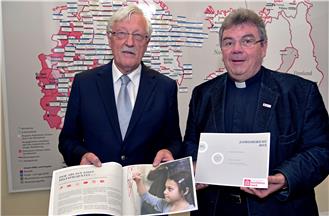
 Das
Bonifatiuswerk förderte Projekte im Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz mit 6,1 Millionen Euro, in Norwegen, Schweden,
Dänemark Finnland und Island mit 1,4 Millionen Euro und in Estland
und Lettland mit 860.000 Euro. In dieser Förderung enthalten sind
77 Bauprojekte mit 3,35 Millionen Euro, 728 Projekte der Kinder-
und Jugendhilfe mit 2,1 Millionen Euro und 39 Projekte der
Glaubenshilfe mit 612.000 Euro. Durch die Verkehrshilfe konnte die
Anschaffung von 47 BONI-Bussen und Gemeindefahrzeugen für mehr als
880.000 Euro unterstützt werden. In missionarische Projekte und
Initiativen zur Neuevangelisierung sowie in die religiöse
Bildungsarbeit flossen 2,3 Millionen Euro, in die Projektbetreuung
und- begleitung rund 396.000 Euro. Aus den Mitteln des
Diaspora-Kommissariats wurden 4,6 Millionen Euro an Projekte in
Nordeuropa weitergeleitet.
Das
Bonifatiuswerk förderte Projekte im Bereich der Deutschen
Bischofskonferenz mit 6,1 Millionen Euro, in Norwegen, Schweden,
Dänemark Finnland und Island mit 1,4 Millionen Euro und in Estland
und Lettland mit 860.000 Euro. In dieser Förderung enthalten sind
77 Bauprojekte mit 3,35 Millionen Euro, 728 Projekte der Kinder-
und Jugendhilfe mit 2,1 Millionen Euro und 39 Projekte der
Glaubenshilfe mit 612.000 Euro. Durch die Verkehrshilfe konnte die
Anschaffung von 47 BONI-Bussen und Gemeindefahrzeugen für mehr als
880.000 Euro unterstützt werden. In missionarische Projekte und
Initiativen zur Neuevangelisierung sowie in die religiöse
Bildungsarbeit flossen 2,3 Millionen Euro, in die Projektbetreuung
und- begleitung rund 396.000 Euro. Aus den Mitteln des
Diaspora-Kommissariats wurden 4,6 Millionen Euro an Projekte in
Nordeuropa weitergeleitet.-01.jpg) Pontifikalamt zum Jubiläum mit Weihbischof Otto Georgens
am 19. Juni
Pontifikalamt zum Jubiläum mit Weihbischof Otto Georgens
am 19. Juni Klimaschutzinitiative: Zehn „Vorbildgemeinden 2016“
ausgezeichnet
Klimaschutzinitiative: Zehn „Vorbildgemeinden 2016“
ausgezeichnet „Vorbildgemeinden 2016“ sind Altenglan,
Bruchhof-Sanddorf, Dierbach, Essingen-Dammheim-Bornheim, die
Gedächtniskirchengemeinde in Speyer, Gries, Haßloch, die
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Hochspeyer, die Lutherkirchengemeinde
in Frankenthal und die Johannes-Kirchengemeinde Mußbach. Diese
Kirchengemeinden hätten u.a. dazu beigetragen, dass die pfälzische
Landeskirche bis zum Jahr 2015 das Ziel erreicht habe, im
Gebäudebereich 25 Prozent des klimaschädlichen Gases
Kohlenstoffdioxid (CO₂) einzusparen, erklärt Kirchenpräsident
Christian Schad in seinem Vorwort zu der Broschüre. Jeder Schritt
bringe die Weltgemeinschaft dem Ziel näher, die Erderwärmung zu
begrenzen. Entsprechend einem Beschluss der Frühjahrssynode
unterstützt die Landeskirche auch das auf Ebene der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) vereinbarte Ziel, den CO₂-Ausstoß bis
2020 um 40 Prozent (gemessen am Basisjahr 2005) zu reduzieren.
„Vorbildgemeinden 2016“ sind Altenglan,
Bruchhof-Sanddorf, Dierbach, Essingen-Dammheim-Bornheim, die
Gedächtniskirchengemeinde in Speyer, Gries, Haßloch, die
Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Hochspeyer, die Lutherkirchengemeinde
in Frankenthal und die Johannes-Kirchengemeinde Mußbach. Diese
Kirchengemeinden hätten u.a. dazu beigetragen, dass die pfälzische
Landeskirche bis zum Jahr 2015 das Ziel erreicht habe, im
Gebäudebereich 25 Prozent des klimaschädlichen Gases
Kohlenstoffdioxid (CO₂) einzusparen, erklärt Kirchenpräsident
Christian Schad in seinem Vorwort zu der Broschüre. Jeder Schritt
bringe die Weltgemeinschaft dem Ziel näher, die Erderwärmung zu
begrenzen. Entsprechend einem Beschluss der Frühjahrssynode
unterstützt die Landeskirche auch das auf Ebene der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) vereinbarte Ziel, den CO₂-Ausstoß bis
2020 um 40 Prozent (gemessen am Basisjahr 2005) zu reduzieren.
 Elli Zimpelmann aus
Limburgerhof freute sich über Blumen und einen Katalog aus der Hand
des Domkustos Peter Schappert
Elli Zimpelmann aus
Limburgerhof freute sich über Blumen und einen Katalog aus der Hand
des Domkustos Peter Schappert „Von Beginn an ist
die Öffnung von Kaisersaal und Aussichtsplattform eine
Erfolgsgeschichte.“, freute sich Domkapitular Peter Schappert. „Im
direkten Kontakt mit den Besuchern und über unsere
Besucherbefragung bekommen wir sehr viel positiven Zuspruch. Gelobt
werden hier vor allem die Freundlichkeit unserer Besucherbegleiter
und die eindrucksvolle Gestaltung des Raums“.
„Von Beginn an ist
die Öffnung von Kaisersaal und Aussichtsplattform eine
Erfolgsgeschichte.“, freute sich Domkapitular Peter Schappert. „Im
direkten Kontakt mit den Besuchern und über unsere
Besucherbefragung bekommen wir sehr viel positiven Zuspruch. Gelobt
werden hier vor allem die Freundlichkeit unserer Besucherbegleiter
und die eindrucksvolle Gestaltung des Raums“. Speyer- (is). Seinen 50. Geburtstag
feiert heute, am Samstag, den 4. Juni, der Speyerer Generalvikar
Dr. Franz Jung. Der aus Ludwigshafen stammende Geistliche hat in
Rom und München studiert und wurde 1992 in Rom zum Priester
geweiht. Seit dem Jahr 2009 leitet er als Generalvikar das
Bischöfliche Ordinariat des Bistums Speyer und ist damit der engste
Mitarbeiter des Speyerer Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann.
Speyer- (is). Seinen 50. Geburtstag
feiert heute, am Samstag, den 4. Juni, der Speyerer Generalvikar
Dr. Franz Jung. Der aus Ludwigshafen stammende Geistliche hat in
Rom und München studiert und wurde 1992 in Rom zum Priester
geweiht. Seit dem Jahr 2009 leitet er als Generalvikar das
Bischöfliche Ordinariat des Bistums Speyer und ist damit der engste
Mitarbeiter des Speyerer Bischofs Dr. Karl-Heinz Wiesemann. DGB und Kirchen in
Rheinland-Pfalz setzen sich für den Sonntagsschutz ein
DGB und Kirchen in
Rheinland-Pfalz setzen sich für den Sonntagsschutz ein Fronleichnamsprozession: Bischof Wiesemann ruft zu
Solidarität auf / Rund 1000 Gläubige begleiten den Weg
Fronleichnamsprozession: Bischof Wiesemann ruft zu
Solidarität auf / Rund 1000 Gläubige begleiten den Weg "Dieser Weg dazwischen ist der anspruchsvollere,
schwierigere, es ist der Weg der Seelsorge", sagte Wiesemann und
wies auf die Liebe Gottes hin, die sich aber selbst für das Leiden
nicht zu schade ist. "Das Mitgehen mit dem Schicksal der einzelnen,
die Solidarität des Mitleidens bei einer Schuld - das ist die
mütterliche Kirche", betonte der Bischof mit Verweis auf die
Gottesmutter und das schützende Dach des Speyerer Mariendomes.
"Dieser Weg dazwischen ist der anspruchsvollere,
schwierigere, es ist der Weg der Seelsorge", sagte Wiesemann und
wies auf die Liebe Gottes hin, die sich aber selbst für das Leiden
nicht zu schade ist. "Das Mitgehen mit dem Schicksal der einzelnen,
die Solidarität des Mitleidens bei einer Schuld - das ist die
mütterliche Kirche", betonte der Bischof mit Verweis auf die
Gottesmutter und das schützende Dach des Speyerer Mariendomes. Schon die
Prozession, die in vier Abschnitte - zuhören, hinsehen, hingehen
und handeln - unterteilt war, wurde getragen vom Anstoß der
Christen, es dem Herrn gleich zu tun und für die Menschen in der
konkreten Situation der Zeit da zu sein. Prozession als Gegenwart,
Bewegung und Ausrichtung auf ein Ziel wurde den Menschen ins
Bewusstsein gerufen. Die Texte, Gebete, Bibelverse und Lieder waren
vom Liturgieausschuss der Pfarrei Pax Christi entsprechend des
Leitwortes zusammengestellt worden. Sichtbares Zeichen des Glaubens
war die Monstranz mit der Hostie, die unter dem Himmel durch die
Straßen und von Wiesemann schließlich in den Dom getragen
wurde.
Schon die
Prozession, die in vier Abschnitte - zuhören, hinsehen, hingehen
und handeln - unterteilt war, wurde getragen vom Anstoß der
Christen, es dem Herrn gleich zu tun und für die Menschen in der
konkreten Situation der Zeit da zu sein. Prozession als Gegenwart,
Bewegung und Ausrichtung auf ein Ziel wurde den Menschen ins
Bewusstsein gerufen. Die Texte, Gebete, Bibelverse und Lieder waren
vom Liturgieausschuss der Pfarrei Pax Christi entsprechend des
Leitwortes zusammengestellt worden. Sichtbares Zeichen des Glaubens
war die Monstranz mit der Hostie, die unter dem Himmel durch die
Straßen und von Wiesemann schließlich in den Dom getragen
wurde.-01.jpg) Dom-Besucherzentrum in Speyer feierlich eingeweiht –
hunderte Menschen besuchten bei Sonnenschein den Festakt und nutzen
die verschiedenen Angebote rund um den Dom
Dom-Besucherzentrum in Speyer feierlich eingeweiht –
hunderte Menschen besuchten bei Sonnenschein den Festakt und nutzen
die verschiedenen Angebote rund um den Dom-01.jpg) Weihbischof Georgens erläuterte zu Beginn kurz die
Entstehungsgeschichte des Dom-Besucherzentrums. Die Idee dazu habe
es bereits vor zwanzig Jahren gegeben, so Georgens. Verschiedene
Pläne wurden gemacht und wieder verworfen. Umso glücklicher sei er,
dass mit der Eröffnung des Dom-Besucherzentrums nun eine echte
Lücke geschlossen werde: „Ich bin froh, dass es nun eine ständige
personelle Präsenz am Dom gibt. Ein Ort der persönlichen Begegnung,
wo alle, die etwas über den Dom wissen wollen, einen
Anknüpfungspunkt finden", freute sich der Speyerer Weihbischof.
Weihbischof Georgens erläuterte zu Beginn kurz die
Entstehungsgeschichte des Dom-Besucherzentrums. Die Idee dazu habe
es bereits vor zwanzig Jahren gegeben, so Georgens. Verschiedene
Pläne wurden gemacht und wieder verworfen. Umso glücklicher sei er,
dass mit der Eröffnung des Dom-Besucherzentrums nun eine echte
Lücke geschlossen werde: „Ich bin froh, dass es nun eine ständige
personelle Präsenz am Dom gibt. Ein Ort der persönlichen Begegnung,
wo alle, die etwas über den Dom wissen wollen, einen
Anknüpfungspunkt finden", freute sich der Speyerer Weihbischof.-01.jpg) Unterstützern des Vorhabens, ein Dom-Besucherzentrum
einzurichten. Hier hob er insbesondere die finanzielle
Unterstützung durch die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer
hervor, die das Projekt mit 140.000 Euro unterstützt hatte.
Domkapitular Schappert würdigte aber auch die gute Zusammenarbeit
mit der Stadt und Nachbarinstitutionen, wie dem Historischen Museum
der Pfalz, dem Technikmuseum und dem Sea Life.
Unterstützern des Vorhabens, ein Dom-Besucherzentrum
einzurichten. Hier hob er insbesondere die finanzielle
Unterstützung durch die Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer
hervor, die das Projekt mit 140.000 Euro unterstützt hatte.
Domkapitular Schappert würdigte aber auch die gute Zusammenarbeit
mit der Stadt und Nachbarinstitutionen, wie dem Historischen Museum
der Pfalz, dem Technikmuseum und dem Sea Life.-01.jpg) Manfred Fuchs, Vorstandsvorsitzender der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer, zeigte sich in seinem Grußwort
erfreut von der Art und Weise, wie das Projekt Dom-Besucherzentrum
umgesetzt worden sei und lobte dessen Gestaltung.
Manfred Fuchs, Vorstandsvorsitzender der Europäischen
Stiftung Kaiserdom zu Speyer, zeigte sich in seinem Grußwort
erfreut von der Art und Weise, wie das Projekt Dom-Besucherzentrum
umgesetzt worden sei und lobte dessen Gestaltung..jpg) Zahlreiche Gläubige bei Wallfahrt der muttersprachlichen
Gemeinden im Dom
Zahlreiche Gläubige bei Wallfahrt der muttersprachlichen
Gemeinden im Dom.jpg) In
seiner Predigt stellte der Weibischof die Gottlosigkeit im Leben
der Menschen in den Mittelpunkt. Gott tauche im Alltag nicht mehr
auf, beklagte Georgens. Er habe sich in den Raum der religiösen
Sprache, in den Kirchenraum zurückgezogen, komme in
Sonntagspredigten und in der Bistumszeitung vor. Die Aufgabe der
Christen bestehe darin, Gott in unserer Welt einen Platz zu
sichern. Wenn der christliche Glaube von Gott spreche, dann sei
Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeint, betonte Georgens und nahm
damit Bezug auf den Dreifaltigkeitssonntag, der alljährlich am
Sonntag nach Pfingsten gefeiert wird. „Die Wallfahrt der
muttersprachlichen Gemeinden zum Dom sei ein eindrucksvolles
Bekenntnis zum dreifaltigen Gott. Menschen unterschiedlicher
Sprache und Herkunft – in einem Geist vereint – beten und singen
miteinander und geben so Zeugnis von ihrem gemeinsamen Glauben.“ So
zeige sich Kirche im Bild des dreieinigen Gottes: Sie bewahre das
Wertvolle der einzelnen Völker und stifte zugleich eine neue große
Einheit.
In
seiner Predigt stellte der Weibischof die Gottlosigkeit im Leben
der Menschen in den Mittelpunkt. Gott tauche im Alltag nicht mehr
auf, beklagte Georgens. Er habe sich in den Raum der religiösen
Sprache, in den Kirchenraum zurückgezogen, komme in
Sonntagspredigten und in der Bistumszeitung vor. Die Aufgabe der
Christen bestehe darin, Gott in unserer Welt einen Platz zu
sichern. Wenn der christliche Glaube von Gott spreche, dann sei
Vater, Sohn und Heiliger Geist gemeint, betonte Georgens und nahm
damit Bezug auf den Dreifaltigkeitssonntag, der alljährlich am
Sonntag nach Pfingsten gefeiert wird. „Die Wallfahrt der
muttersprachlichen Gemeinden zum Dom sei ein eindrucksvolles
Bekenntnis zum dreifaltigen Gott. Menschen unterschiedlicher
Sprache und Herkunft – in einem Geist vereint – beten und singen
miteinander und geben so Zeugnis von ihrem gemeinsamen Glauben.“ So
zeige sich Kirche im Bild des dreieinigen Gottes: Sie bewahre das
Wertvolle der einzelnen Völker und stifte zugleich eine neue große
Einheit.
 Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Brückenbauer, Vorbild und
Quelle der Inspiration
Ministerpräsidentin Malu Dreyer: Brückenbauer, Vorbild und
Quelle der Inspiration Pontifikalamt zum Pfingstsonntag mit Bischof Wiesemann im
Dom zu Speyer
Pontifikalamt zum Pfingstsonntag mit Bischof Wiesemann im
Dom zu Speyer Er beendete seine Predigt mit Lob und Dank an
Domkapellmeister Markus Melchiori, das Domorchester, den Domchor
und Domorganisten Markus Eichenlaub. Sie führten unter anderem
Franz Schuberts Messe in Es-Dur auf, die einen Großteil des
Gottesdienstes einnahm. Würde die Kirche schwarz-weiß denken, so
Wiesemann, dürfte dieses Werk hier nicht erklingen. Denn Schubert
habe mit Gott gehadert, im Credo das Bekenntnis zum allmächtigen
Vater ausgelassen. Die Messe in Es-Dur spiegle die Zerrissenheit
und Suche des Komponisten wider und wirke nicht zuletzt deshalb
lebendig.
Er beendete seine Predigt mit Lob und Dank an
Domkapellmeister Markus Melchiori, das Domorchester, den Domchor
und Domorganisten Markus Eichenlaub. Sie führten unter anderem
Franz Schuberts Messe in Es-Dur auf, die einen Großteil des
Gottesdienstes einnahm. Würde die Kirche schwarz-weiß denken, so
Wiesemann, dürfte dieses Werk hier nicht erklingen. Denn Schubert
habe mit Gott gehadert, im Credo das Bekenntnis zum allmächtigen
Vater ausgelassen. Die Messe in Es-Dur spiegle die Zerrissenheit
und Suche des Komponisten wider und wirke nicht zuletzt deshalb
lebendig.
 Künftig
steht eine junge Frau aus dem Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) an der Spitze des höchsten Laiengremiums im Bistum
Speyer
Künftig
steht eine junge Frau aus dem Bund der Deutschen Katholischen
Jugend (BDKJ) an der Spitze des höchsten Laiengremiums im Bistum
Speyer .jpg) Leipzig- Anlässlich des 100. Deutschen
Katholikentags hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) ein
Sonderpostwertzeichen herausgegeben.
Leipzig- Anlässlich des 100. Deutschen
Katholikentags hat das Bundesministerium für Finanzen (BMF) ein
Sonderpostwertzeichen herausgegeben.
 Neben Informationen des Arbeitskreises Asyl Speyer und
der Diakonissen Hebammenschule, die seit einigen Monaten in der
Elternschule eine Sprechstunde für schwangere Flüchtlingsfrauen
anbietet, erfreuten sich die Spiele, die unter anderem die
Diakonissen Fachschule für Sozialwesen und die Diakonissen Kitas
vorbereitet hatten, vor allem bei den vielen kleinen Besuchern
großer Beliebtheit.
Neben Informationen des Arbeitskreises Asyl Speyer und
der Diakonissen Hebammenschule, die seit einigen Monaten in der
Elternschule eine Sprechstunde für schwangere Flüchtlingsfrauen
anbietet, erfreuten sich die Spiele, die unter anderem die
Diakonissen Fachschule für Sozialwesen und die Diakonissen Kitas
vorbereitet hatten, vor allem bei den vielen kleinen Besuchern
großer Beliebtheit.
 Leipzig- Die Sorge ums Gemeinwohl gehört für
Harald Langenfeld zum "genetischen Code" einer Sparkasse. "Seit 190
Jahren ist die Sparkasse hier zu Hause und genauso lange setzen wir
uns schon für die positive Entwicklung unserer Region ein", sagt
der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Leipzig im Gespräch mit
Leipzig- Die Sorge ums Gemeinwohl gehört für
Harald Langenfeld zum "genetischen Code" einer Sparkasse. "Seit 190
Jahren ist die Sparkasse hier zu Hause und genauso lange setzen wir
uns schon für die positive Entwicklung unserer Region ein", sagt
der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Leipzig im Gespräch mit

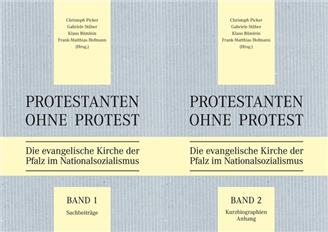 Landeskirche und Evangelische Akademie stellen
Handbuch „Protestanten ohne Protest“ vor
Landeskirche und Evangelische Akademie stellen
Handbuch „Protestanten ohne Protest“ vor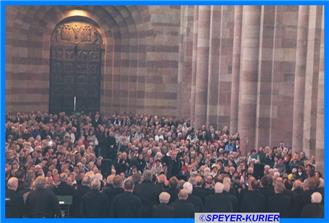 7.700 Euro bei „Baden schaut über den Rhein“
ersungen
7.700 Euro bei „Baden schaut über den Rhein“
ersungen Zu Beginn erklang ein Instrumentalstück. Das Prelude aus
dem „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, bekannt als Fanfare bei
Fernseh-Übertragungen im Rahmen der Eurovision, spielten
Holger Becker an der Chororgel und Frédéric Messner an der
Trompete. Zunächst nach Männer- und Frauenstimmen getrennt kamen
danach die unterschiedlichsten Werke zu Gehör. Unter der Leitung
von Wolfgang Tropf erklangen, neben dem „Vater unser“ und „Dona
Maria“, auch Titel wie „Über 7 Brücken“ oder „Conquest of Paradise,
welches alle Chöre gemeinsam sangen.
Zu Beginn erklang ein Instrumentalstück. Das Prelude aus
dem „Te Deum“ von Marc-Antoine Charpentier, bekannt als Fanfare bei
Fernseh-Übertragungen im Rahmen der Eurovision, spielten
Holger Becker an der Chororgel und Frédéric Messner an der
Trompete. Zunächst nach Männer- und Frauenstimmen getrennt kamen
danach die unterschiedlichsten Werke zu Gehör. Unter der Leitung
von Wolfgang Tropf erklangen, neben dem „Vater unser“ und „Dona
Maria“, auch Titel wie „Über 7 Brücken“ oder „Conquest of Paradise,
welches alle Chöre gemeinsam sangen. Den traditionellen Schluss- und Höhepunkt bildete das
gemeinsame Singen des Chorals „Großer Gott wir loben dich“, bei dem
2.000 Stimmen zu hören gewesen sein dürften. Unter den Sängern
waren auch der Bischof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann sowie
der emeritierte Bischof Dr. Anton Schlembach.
Den traditionellen Schluss- und Höhepunkt bildete das
gemeinsame Singen des Chorals „Großer Gott wir loben dich“, bei dem
2.000 Stimmen zu hören gewesen sein dürften. Unter den Sängern
waren auch der Bischof von Speyer, Dr. Karl-Heinz Wiesemann sowie
der emeritierte Bischof Dr. Anton Schlembach. Perspektiven für Jugendliche in Osteuropa notwendig -
Justizminister Robbers dankt für breit gefächertes Engagement der
katholischen Kirche
Perspektiven für Jugendliche in Osteuropa notwendig -
Justizminister Robbers dankt für breit gefächertes Engagement der
katholischen Kirche Bischof Wiesemann zelebrierte den Gottesdienst gemeinsam
mit Erzbischof Duro Hranić (Dakovo), Weihbischof Pero Sudar
(Sarajevo) und Weihbischof Otto Georgens, der für die Kontakte des
Bistums Speyer in die Weltkirche hinein verantwortlich ist. Das
Thema Osteuropa wurde im Gottesdienst auf verschiedene Weise
aufgegriffen. Zum Beispiel wurde die zweite Lesung in litauischer
Sprache vorgetragen. Die Kollekte war für das Projekt „Ältere
Schwester – älterer Bruder“ des Vereins „Narko Ne“ (Nein zu Drogen)
aus Bosnien und Herzegowina bestimmt. Eine Band mit
Roma-Jugendlichen aus Ardud in Rumänien knüpfte eine musikalische
Verbindung und ergänzte die Dommusik, die zusammen mit dem
Orchester der städtischen Musikschule eine Messe von Leo Delibes
aufführte. Beim anschließenden Empfang im Haus Trinitatis
erläuterten die Renovabis-Gäste in kurzen Interviews ihre Arbeit.
Der rheinland-pfälzische Justizminister Gerhard Robbers dankte der
katholischen Kirche und ihrem Hilfswerk Renovabis für ihr breit
gefächertes Engagement in den Ländern Mittel- und Osteuropas.
Bischof Wiesemann zelebrierte den Gottesdienst gemeinsam
mit Erzbischof Duro Hranić (Dakovo), Weihbischof Pero Sudar
(Sarajevo) und Weihbischof Otto Georgens, der für die Kontakte des
Bistums Speyer in die Weltkirche hinein verantwortlich ist. Das
Thema Osteuropa wurde im Gottesdienst auf verschiedene Weise
aufgegriffen. Zum Beispiel wurde die zweite Lesung in litauischer
Sprache vorgetragen. Die Kollekte war für das Projekt „Ältere
Schwester – älterer Bruder“ des Vereins „Narko Ne“ (Nein zu Drogen)
aus Bosnien und Herzegowina bestimmt. Eine Band mit
Roma-Jugendlichen aus Ardud in Rumänien knüpfte eine musikalische
Verbindung und ergänzte die Dommusik, die zusammen mit dem
Orchester der städtischen Musikschule eine Messe von Leo Delibes
aufführte. Beim anschließenden Empfang im Haus Trinitatis
erläuterten die Renovabis-Gäste in kurzen Interviews ihre Arbeit.
Der rheinland-pfälzische Justizminister Gerhard Robbers dankte der
katholischen Kirche und ihrem Hilfswerk Renovabis für ihr breit
gefächertes Engagement in den Ländern Mittel- und Osteuropas. „Jung, dynamisch, chancenlos?“
„Jung, dynamisch, chancenlos?“
 Angesichts aktueller Zahlen, z. B. aus Litauen oder
Bosnien und Herzegowina scheinen solche Veränderungen auch dringend
nötig zu sein. Die litauische Sozialarbeiterin Roberta
Daubaraitė-Randė berichtete aus ihrer Heimat, dass rund 60 Prozent
der Jugendlichen vom Auswandern träumten. In Bosnien seien es sogar
70 Prozent, sagte Weihbischof Pero Sudar, der in Bosnien die
multi-ethnischen Europa-Schulen initiiert hat. Beide sind im Rahmen
der Renovabis-Pfingstaktion in Speyer zu Gast und berichten bei
zahlreichen Veranstaltungen über die Situation in ihren
Heimatländern.
Angesichts aktueller Zahlen, z. B. aus Litauen oder
Bosnien und Herzegowina scheinen solche Veränderungen auch dringend
nötig zu sein. Die litauische Sozialarbeiterin Roberta
Daubaraitė-Randė berichtete aus ihrer Heimat, dass rund 60 Prozent
der Jugendlichen vom Auswandern träumten. In Bosnien seien es sogar
70 Prozent, sagte Weihbischof Pero Sudar, der in Bosnien die
multi-ethnischen Europa-Schulen initiiert hat. Beide sind im Rahmen
der Renovabis-Pfingstaktion in Speyer zu Gast und berichten bei
zahlreichen Veranstaltungen über die Situation in ihren
Heimatländern. „Die aktuelle Entwicklung ist eine große
Herausforderung“, betont auch der Geschäftsführer von Renovabis,
Dr. Gerhard Albert. Es sei wichtig, die zuständigen Regierungen und
Politiker nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Nicht nur für
die Jugendlichen sei die Situation oft dramatisch, so Albert, „denn
die anhaltende Abwanderung junger Leute stellt auch für die
Entwicklung der osteuropäischen Staaten eine echte Bedrohung dar“.
Für Renovabis gehe es im Rahmen der diesjährigen Pfingstaktion
darum, auf diese Situation aufmerksam zu machen und um Solidarität
mit jungen Menschen im Osten Europas zu werben.
„Die aktuelle Entwicklung ist eine große
Herausforderung“, betont auch der Geschäftsführer von Renovabis,
Dr. Gerhard Albert. Es sei wichtig, die zuständigen Regierungen und
Politiker nicht aus ihrer Verantwortung zu entlassen. Nicht nur für
die Jugendlichen sei die Situation oft dramatisch, so Albert, „denn
die anhaltende Abwanderung junger Leute stellt auch für die
Entwicklung der osteuropäischen Staaten eine echte Bedrohung dar“.
Für Renovabis gehe es im Rahmen der diesjährigen Pfingstaktion
darum, auf diese Situation aufmerksam zu machen und um Solidarität
mit jungen Menschen im Osten Europas zu werben.
 Spende des „Clubs Deutscher Drehorgelfreunde e.V.“ und des
„Pfälzer Drehorgelstammtisches“
Spende des „Clubs Deutscher Drehorgelfreunde e.V.“ und des
„Pfälzer Drehorgelstammtisches“ Festgottesdienst mit Schülerinnen, Lehren und Gästen –
Martin Schöneich gestaltete neuen Altar, Ambo und
Tabernakel
Festgottesdienst mit Schülerinnen, Lehren und Gästen –
Martin Schöneich gestaltete neuen Altar, Ambo und
Tabernakel Schon
zu Urzeiten hätten die Menschen Opfer dargebracht, um Schuld zu
tilgen und Gott gnädig zu stimmen. Dann aber opferte Gott seinen
eigenen Sohn, um seine grenzenlose Liebe zu den Menschen zu zeigen.
Fortan, so Wiesemann, sollen Christen immer daran erinnert werden,
„dass die Liebe das Wichtigste ist und das Einzige, das Zukunft
bringt“. Durch die Auferstehung habe Christus nicht nur den eigenen
Tod überwunden, sondern - leiblich wie geistig – auch Grenzen
überwunden. So, wie sich der Auferstandene durch verschlossene
Türen und verängstigte Herzen den Weg zu den Emmaus-Jüngern bahnte,
so, wie er mit ihnen das Brot brach, „so entsteht Kirche – so
entsteht Gemeinde – so kommt Jesus in die Mitte“.
Schon
zu Urzeiten hätten die Menschen Opfer dargebracht, um Schuld zu
tilgen und Gott gnädig zu stimmen. Dann aber opferte Gott seinen
eigenen Sohn, um seine grenzenlose Liebe zu den Menschen zu zeigen.
Fortan, so Wiesemann, sollen Christen immer daran erinnert werden,
„dass die Liebe das Wichtigste ist und das Einzige, das Zukunft
bringt“. Durch die Auferstehung habe Christus nicht nur den eigenen
Tod überwunden, sondern - leiblich wie geistig – auch Grenzen
überwunden. So, wie sich der Auferstandene durch verschlossene
Türen und verängstigte Herzen den Weg zu den Emmaus-Jüngern bahnte,
so, wie er mit ihnen das Brot brach, „so entsteht Kirche – so
entsteht Gemeinde – so kommt Jesus in die Mitte“. schließlich gereinigt, eingedeckt und beweihräuchert wurde
und die Messfeier mit besonders feierlicher Musik fortgesetzt
wurde. Orgel (Manuel Cordel) und Trompete (Michael Hammer),
Klavier (Ulrike Sauerhöfer) und ein Streichquartett (Leitung: Agnes
Hoffmann) sowie der Kammerchor der Maria Ward Schule, verstärkt
durch den Lehrerchor, intonierten ein vielseitiges geistliches
Repertoire und boten einen breiten Klangteppich für die
singfreudige Gemeinde.
schließlich gereinigt, eingedeckt und beweihräuchert wurde
und die Messfeier mit besonders feierlicher Musik fortgesetzt
wurde. Orgel (Manuel Cordel) und Trompete (Michael Hammer),
Klavier (Ulrike Sauerhöfer) und ein Streichquartett (Leitung: Agnes
Hoffmann) sowie der Kammerchor der Maria Ward Schule, verstärkt
durch den Lehrerchor, intonierten ein vielseitiges geistliches
Repertoire und boten einen breiten Klangteppich für die
singfreudige Gemeinde.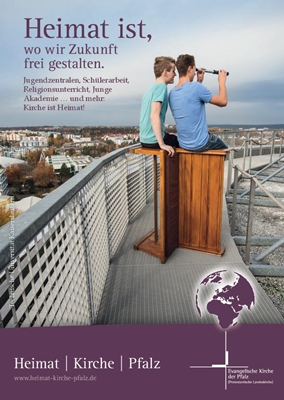 Schüler des
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums Neustadt gestalten Plakatmotiv der
Öffentlichkeitsarbeit
Schüler des
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasiums Neustadt gestalten Plakatmotiv der
Öffentlichkeitsarbeit.jpg)
.jpg) In
persönlichen Begegnungen wurde schnell deutlich: gleich, welchen
Schulabschluss sie auch mitbringen, jeder von ihnen will die Chance
nutzen, beruflich einen erfolgreichen Weg zu gehen. Und trotz
weltweiter Krisen der Zukunft optimistisch entgegensehen. „Man muss
an einem Strang ziehen, dann kriegt man auch große Probleme in den
Griff“, brachte es ein Azubi auf den Punkt und lobte das
Zusammengehörigkeitsgefühl im Betrieb. Und welche Wünsche haben sie
an die Kirche, wollten die Speyerer Gäste wissen. „Sie soll
moderner werden“, waren sich Befragten einig, und der Bischof
versprach, die Anregungen zu beherzigen.
In
persönlichen Begegnungen wurde schnell deutlich: gleich, welchen
Schulabschluss sie auch mitbringen, jeder von ihnen will die Chance
nutzen, beruflich einen erfolgreichen Weg zu gehen. Und trotz
weltweiter Krisen der Zukunft optimistisch entgegensehen. „Man muss
an einem Strang ziehen, dann kriegt man auch große Probleme in den
Griff“, brachte es ein Azubi auf den Punkt und lobte das
Zusammengehörigkeitsgefühl im Betrieb. Und welche Wünsche haben sie
an die Kirche, wollten die Speyerer Gäste wissen. „Sie soll
moderner werden“, waren sich Befragten einig, und der Bischof
versprach, die Anregungen zu beherzigen. Pastoralreferentin Gabriele Bamberger ist
Internetseelsorge-Beauftragte im Bistum Speyer
Pastoralreferentin Gabriele Bamberger ist
Internetseelsorge-Beauftragte im Bistum Speyer Paul Neumann aus
Römerberg steht mit den Menschen in Polen, Weißrussland und
Russland in engem Kontakt – Kinder aus Tschernobyl kommen jedes
Jahr zur Erholung in die Pfalz
Paul Neumann aus
Römerberg steht mit den Menschen in Polen, Weißrussland und
Russland in engem Kontakt – Kinder aus Tschernobyl kommen jedes
Jahr zur Erholung in die Pfalz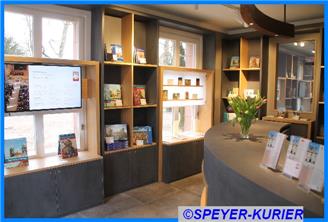
 Ab dem 1. April
öffnen Kaisersaal und Turm wieder für Besucher. Während der kalten
Jahreszeit bleiben die beiden Bereiche geschlossen. Der über der
Vorhalle des Doms gelegene Kaisersaal beherbergt eine
Dauerausstellung mit neun monumentalen Fresken des Malers Johann
Baptist Schraudolph. Sie zeigen Szenen von Heiligen, die für den
Dom eine besondere Bedeutung haben. Ursprünglich waren die Fresken
an den Wänden der Seitenschiffe des Domes angebracht. Von dort
wurden sie im Zuge der großen Domrestaurierung der 1950er-Jahre
entfernt. Seit 2012 sind sie im Kaisersaal zu bestaunen.
Ab dem 1. April
öffnen Kaisersaal und Turm wieder für Besucher. Während der kalten
Jahreszeit bleiben die beiden Bereiche geschlossen. Der über der
Vorhalle des Doms gelegene Kaisersaal beherbergt eine
Dauerausstellung mit neun monumentalen Fresken des Malers Johann
Baptist Schraudolph. Sie zeigen Szenen von Heiligen, die für den
Dom eine besondere Bedeutung haben. Ursprünglich waren die Fresken
an den Wänden der Seitenschiffe des Domes angebracht. Von dort
wurden sie im Zuge der großen Domrestaurierung der 1950er-Jahre
entfernt. Seit 2012 sind sie im Kaisersaal zu bestaunen. Mehrere tausend Gläubige besuchen an den Osterfeiertagen
festlich gestaltete Gottesdienste
Mehrere tausend Gläubige besuchen an den Osterfeiertagen
festlich gestaltete Gottesdienste Viele
Menschen lebten aus dieser Kraft des Auferstandenen. Beispiel dafür
seien die Ärzte ohne Grenzen und die humanitären Helfer, die sich
um der Menschen willen in die Todeszonen dieser Welt wagten, die
sich nicht einschüchtern ließen, „sondern auch den Abgründen dieser
Welt ein menschliches Angesicht geben“ oder Journalisten, die um
der Wahrheit willen ihr Leben wagten, Polizisten und
Sicherheitskräfte, „die unsere Freiheit schützen sowie die
Soldaten, die nicht Krieg schüren, sondern mit ihrem Lebenseinsatz
die Spielräume des Dialoges, der Möglichkeit für Versöhnung und
Frieden sichern helfen und seien sie noch so klein“, erläuterte
Bischof Wiesemann.
Viele
Menschen lebten aus dieser Kraft des Auferstandenen. Beispiel dafür
seien die Ärzte ohne Grenzen und die humanitären Helfer, die sich
um der Menschen willen in die Todeszonen dieser Welt wagten, die
sich nicht einschüchtern ließen, „sondern auch den Abgründen dieser
Welt ein menschliches Angesicht geben“ oder Journalisten, die um
der Wahrheit willen ihr Leben wagten, Polizisten und
Sicherheitskräfte, „die unsere Freiheit schützen sowie die
Soldaten, die nicht Krieg schüren, sondern mit ihrem Lebenseinsatz
die Spielräume des Dialoges, der Möglichkeit für Versöhnung und
Frieden sichern helfen und seien sie noch so klein“, erläuterte
Bischof Wiesemann. Neue Anlaufstelle für Dombesucher direkt neben der
Kathedrale
Neue Anlaufstelle für Dombesucher direkt neben der
Kathedrale Eingerichtet wurde das Dom-Besucherzentrum in einem
kleinen, kubusartigen Sandsteingebäude auf der Südseite des Doms.
Beim Betreten fällt der Blick zunächst auf eine große, runde
Empfangstheke. Hier werden die Besucher willkommen geheißen und
erhalten Auskunft über Zeiten, Wege und Veranstaltungen. Noch sind
die Regale nicht fertig eingeräumt und es riecht nach Farbe. „Seit
Montag haben wir geöffnet“, so der Leiter des Besuchermanagements,
Bastian Hoffmann. „Wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken um
das Konzept gemacht und sind gespannt, ob alles so wirkt und
funktioniert, wie wir es uns wünschen. Die ersten Reaktionen sind
durchweg begeistert.“
Eingerichtet wurde das Dom-Besucherzentrum in einem
kleinen, kubusartigen Sandsteingebäude auf der Südseite des Doms.
Beim Betreten fällt der Blick zunächst auf eine große, runde
Empfangstheke. Hier werden die Besucher willkommen geheißen und
erhalten Auskunft über Zeiten, Wege und Veranstaltungen. Noch sind
die Regale nicht fertig eingeräumt und es riecht nach Farbe. „Seit
Montag haben wir geöffnet“, so der Leiter des Besuchermanagements,
Bastian Hoffmann. „Wir haben uns im Vorfeld sehr viele Gedanken um
das Konzept gemacht und sind gespannt, ob alles so wirkt und
funktioniert, wie wir es uns wünschen. Die ersten Reaktionen sind
durchweg begeistert.“ Einrichtung und der Farbgebung wurde eine moderne
Architektur geschaffen. Außerdem finden sich im Dom-Besucherzentrum
auch Materialien wieder, die auch bei der Möblierung des Doms
Verwendung fanden, wie Eiche oder rostiger Stahl, der im Dom bei
den Windfängen, beim Besucherzentrum bei der Beleuchtung verwendet
wurde.“
Einrichtung und der Farbgebung wurde eine moderne
Architektur geschaffen. Außerdem finden sich im Dom-Besucherzentrum
auch Materialien wieder, die auch bei der Möblierung des Doms
Verwendung fanden, wie Eiche oder rostiger Stahl, der im Dom bei
den Windfängen, beim Besucherzentrum bei der Beleuchtung verwendet
wurde.“ Das Dom-Besucherzentrum ist barrierefrei zugänglich. Auch
die Empfangstheke verfügt über einen Abschnitt, der auch mit dem
Rollstuhl gut anzusteuern ist. Geöffnet ist die Anlaufstelle für
Dombesucher ganzjährig während der regulären Domöffnungszeiten. Das
bedeutet, dass es den Besuchern auch dann offen steht, wenn der Dom
wegen eines besonderen Gottesdienstes oder einer Veranstaltung
nicht besichtig werden kann.
Das Dom-Besucherzentrum ist barrierefrei zugänglich. Auch
die Empfangstheke verfügt über einen Abschnitt, der auch mit dem
Rollstuhl gut anzusteuern ist. Geöffnet ist die Anlaufstelle für
Dombesucher ganzjährig während der regulären Domöffnungszeiten. Das
bedeutet, dass es den Besuchern auch dann offen steht, wenn der Dom
wegen eines besonderen Gottesdienstes oder einer Veranstaltung
nicht besichtig werden kann. Im Obergeschoss wurden in einem Großraumbüro vier
Arbeitsplätze und ein Bereich für Besprechungen eingerichtet. Das
Büro für Domführungen, Besucher- und Kulturmanagement werden
künftig von hier aus arbeiten.
Im Obergeschoss wurden in einem Großraumbüro vier
Arbeitsplätze und ein Bereich für Besprechungen eingerichtet. Das
Büro für Domführungen, Besucher- und Kulturmanagement werden
künftig von hier aus arbeiten.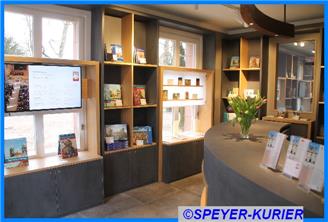 Nach Übergabe des Gebäudes im November 2015 wurde
zunächst mit dem Rückbau des bisherigen Innenausbaus begonnen und
alle Einbauten und Zwischenwände entfernt. In den folgenden
dreieinhalb Monaten wirkten ein Sanitärbetrieb, Elektriker, Boden-
und Fliesenleger, Maler und Schreiner in dem kleinen Gebäude. Dabei
wurde der Bauzeitenplan komplett eingehalten, so dass nach dieser
denkbar kurzen Umbauzeit das Dom-Besucherzentrum noch vor Ostern
2016 in Betrieb genommen werden konnte. „Mit dem Verlauf und dem
Ergebnis der Baumaßnahme bin ich sehr zufrieden“, so Dombaumeister
Colletto.
Nach Übergabe des Gebäudes im November 2015 wurde
zunächst mit dem Rückbau des bisherigen Innenausbaus begonnen und
alle Einbauten und Zwischenwände entfernt. In den folgenden
dreieinhalb Monaten wirkten ein Sanitärbetrieb, Elektriker, Boden-
und Fliesenleger, Maler und Schreiner in dem kleinen Gebäude. Dabei
wurde der Bauzeitenplan komplett eingehalten, so dass nach dieser
denkbar kurzen Umbauzeit das Dom-Besucherzentrum noch vor Ostern
2016 in Betrieb genommen werden konnte. „Mit dem Verlauf und dem
Ergebnis der Baumaßnahme bin ich sehr zufrieden“, so Dombaumeister
Colletto.