Interview der Woche:
 Heute mit dem
Speyerer Prof. Dr. rer. pol., Dr.-Ing.
h.c. Jochem Heizmann
Heute mit dem
Speyerer Prof. Dr. rer. pol., Dr.-Ing.
h.c. Jochem Heizmann
Mitglied des Vorstands der Volkswagen AG
Präsident und CEO der „Volkswagen Group China“
geb. am 31. Januar 1952 in Speyer
Abitur am Hans-Purrmann-Gymnasium Speyer
Studium der Wirtschaftsingenieurwissenschaften an der Technischen Universität Karlsruhe (TU)
dort 1980 Promotion zum Dr. rer.pol.
Bis 1982 Wissenschaftlicher Mitarbeiter und Oberingenieur an der TU.
1982 Eintritt bei der NSU AUDI Autounion AG Ingolstadt
Beschäftigung in vielfältigen Funktionen
2012 Ernennung zum Mitglied des Vorstandes der Volkswagen AG und Leiter des Chinageschäftes.
Prof. Dr. Heizmann ist verheiratet und hat zwei 2 Kinder
17.04.2015
SPEYER-JURIER: Lieber Herr Prof. Heizmann, seit September 2012 sind Sie als Präsident und CEO der „Volkswagen Group China“ mit Sitz in Peking verantwortlich für den auch für die Volkswagen-Gruppe sicher bedeutendsten Automobilmarkt der Welt. Deshalb zunächst eine ganz persönliche Frage: Wie fühlt sich der „Speyerer Bub“ in der Mega-City Peking und finden Sie überhaupt Zeit, die Vorzüge und Nachteile einer solch riesigen Metropole auf sich einwirken zu lassen?
 Prof. Dr.
Heizmann: Peking ist so unvorstellbar groß, dass es mir
auch nach zwei Jahren ob der Vielfältigkeit immer wieder die
Sprache verschlägt. Wenn man sich dort auskennt, findet man auch
Orte, die eine gewisse Ruhe mit sich bringen und an denen mitten in
der Stadt auch Stille herrschen kann. Oder aber ich schlendere mit
meiner Frau am Wochenende durch den ‚Art District 798‘. Dieses
spannende, impulsive Viertel mit seinen Galerien und Ausstellungen
und den kleinen Gässchen hat es mir sehr angetan. Besonders schön
finde ich die Mischung verschiedener Kunstformen aus aller
Welt.
Prof. Dr.
Heizmann: Peking ist so unvorstellbar groß, dass es mir
auch nach zwei Jahren ob der Vielfältigkeit immer wieder die
Sprache verschlägt. Wenn man sich dort auskennt, findet man auch
Orte, die eine gewisse Ruhe mit sich bringen und an denen mitten in
der Stadt auch Stille herrschen kann. Oder aber ich schlendere mit
meiner Frau am Wochenende durch den ‚Art District 798‘. Dieses
spannende, impulsive Viertel mit seinen Galerien und Ausstellungen
und den kleinen Gässchen hat es mir sehr angetan. Besonders schön
finde ich die Mischung verschiedener Kunstformen aus aller
Welt.
SPEYER-KURIER: China hat ja gerade im Bereich der Automobilindustrie in den zurückliegenden zwei Jahrzehnten eine geradezu explosionsartige Expansion hinter sich gebracht. Längst werden Produktionszahlen nicht mehr von staatlichen Planungsbehörden bestimmt, sondern von dem sich aus der Verbindung von Binnennachfrage und dem Export ergebenden Bedarf. Wodurch unterscheidet sich der chinesische Automobilmarkt heute von dem in anderen großen Wirtschaftsregionen in der Welt?
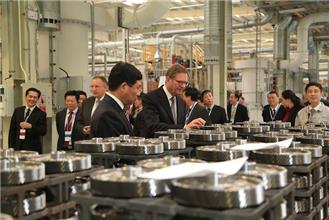 Prof. Dr.
Heizmann: China ist und bleibt das Zugpferd des globalen
Wachstums. Das Besondere am chinesischen Markt ist nicht seine
Stärke allein, sondern vielmehr die dazugehörige Dynamik. Der
hiesige Markt ist sehr schnelllebig, sodass die chinesischen Kunden
deutlich wechselfreudiger sind, wenn es beispielsweise um
Markenloyalität geht. Nirgendwo gibt es solch ein Wachstum, so
viele unterschiedliche Marken und Modelle und diese
Auswahlmöglichkeit ist unseren chinesischen Kunden sehr wichtig.
Der durchschnittliche Kunde in China ist Mitte 30, männlich und
verheiratet. In Europa liegt der Altersdurchschnitt der Konsumenten
bei um die 50. Der Markt ist deutlich älter, kein Wunder also, dass
sich die Ansprüche der verschiedenen Kulturen und Generationen
unterscheiden: Die Europäer ersetzen beispielsweise meist ein
Vorgängerfahrzeug durch ein neues Auto, die Chinesen wiederum sind
meist Erstkäufer. Deshalb schneiden wir unsere Handelsbetriebe umso
mehr auf den chinesischen Markt zu und geben alles, um das vom
(Neu-)Kunden gewünschte Einkaufs- und Beratungserlebnis unserer
Marken zu bieten. Mit allem, das dazugehört: Information, Beratung,
Probefahrt. Wenn ich einige Dekaden zurückblicke, muss ich sagen,
es ist beeindruckend in welcher enormen Geschwindigkeit sich hier
alles verändert hat. Ein weiterer Unterschied im Vergleich zu
anderen Märkten ist, dass der Wandel immer weiter fortschreitet und
noch lange nicht am Ende angekommen ist. Vergleicht man die ersten
drei Quartale von 2014 mit dem Jahr 2013, hat der chinesische
Automarkt um 12,7% zugelegt! Bis Ende September wurden im
Gesamtmarkt China bereits 12,7 Millionen Autos ausgeliefert. 2,7
Millionen davon haben unsere Kunden gekauft.
Prof. Dr.
Heizmann: China ist und bleibt das Zugpferd des globalen
Wachstums. Das Besondere am chinesischen Markt ist nicht seine
Stärke allein, sondern vielmehr die dazugehörige Dynamik. Der
hiesige Markt ist sehr schnelllebig, sodass die chinesischen Kunden
deutlich wechselfreudiger sind, wenn es beispielsweise um
Markenloyalität geht. Nirgendwo gibt es solch ein Wachstum, so
viele unterschiedliche Marken und Modelle und diese
Auswahlmöglichkeit ist unseren chinesischen Kunden sehr wichtig.
Der durchschnittliche Kunde in China ist Mitte 30, männlich und
verheiratet. In Europa liegt der Altersdurchschnitt der Konsumenten
bei um die 50. Der Markt ist deutlich älter, kein Wunder also, dass
sich die Ansprüche der verschiedenen Kulturen und Generationen
unterscheiden: Die Europäer ersetzen beispielsweise meist ein
Vorgängerfahrzeug durch ein neues Auto, die Chinesen wiederum sind
meist Erstkäufer. Deshalb schneiden wir unsere Handelsbetriebe umso
mehr auf den chinesischen Markt zu und geben alles, um das vom
(Neu-)Kunden gewünschte Einkaufs- und Beratungserlebnis unserer
Marken zu bieten. Mit allem, das dazugehört: Information, Beratung,
Probefahrt. Wenn ich einige Dekaden zurückblicke, muss ich sagen,
es ist beeindruckend in welcher enormen Geschwindigkeit sich hier
alles verändert hat. Ein weiterer Unterschied im Vergleich zu
anderen Märkten ist, dass der Wandel immer weiter fortschreitet und
noch lange nicht am Ende angekommen ist. Vergleicht man die ersten
drei Quartale von 2014 mit dem Jahr 2013, hat der chinesische
Automarkt um 12,7% zugelegt! Bis Ende September wurden im
Gesamtmarkt China bereits 12,7 Millionen Autos ausgeliefert. 2,7
Millionen davon haben unsere Kunden gekauft.
SPEYER-KURIER: China ist heute als Absatzmarkt wie als Produktionsstätte von Automobilen wie kaum eine andere Wirtschaftsregion auch entscheidend verantwortlich für das „Wohl und Wehe“ der großen Automobilhersteller der Welt, zu denen auch die Volkswagen-Gruppe an vorderster Stelle zählt. Welchen Einfluss hat diese Vormachtstellung der Chinesen heute auf Design und technische Ausstattung zukünftiger VW-Konzern-Modelle?
 Prof. Dr.
Heizmann: Wir hören sehr genau auf die Bedürfnisse unserer
chinesischen Kunden und liefern ihnen Produkte, die diesen Wünschen
entsprechen. Wir bieten eine breite Produktvielfalt,
chinaspezifische Farben und verlängerte Radabstände für mehr
Komfort. Kundenzufriedenheit hat bei uns oberste Priorität. Zudem
bauen wir weiter unsere lokalen Produktionskapazitäten und R&D
Kompetenzen aus. Gerade lokale Entwicklungskompetenz ermöglicht
uns, die Bedürfnisse unserer Kunden hier im Markt genau zu erkennen
und maßgeschneiderte Produkte herzustellen. Seit unserer Ankunft in
China vor rund dreißig Jahren haben wir immer wieder viel Wert
darauf gelegt, unser Know-how an unsere chinesischen Kollegen
weiterzugeben und sie kontinuierlich zu qualifizieren. In unseren
Forschungszentren arbeiten ungefähr 90% Einheimische, die durchaus
Einfluss auf die Entwicklung unserer Fahrzeuge nehmen. So haben wir
neue Produkte entwickelt, wie z.B. das jüngste Mitglied in unserer
Volkswagen Familie, den Lamando, ein Sportcoupé, das es so nur in
China gibt.
Prof. Dr.
Heizmann: Wir hören sehr genau auf die Bedürfnisse unserer
chinesischen Kunden und liefern ihnen Produkte, die diesen Wünschen
entsprechen. Wir bieten eine breite Produktvielfalt,
chinaspezifische Farben und verlängerte Radabstände für mehr
Komfort. Kundenzufriedenheit hat bei uns oberste Priorität. Zudem
bauen wir weiter unsere lokalen Produktionskapazitäten und R&D
Kompetenzen aus. Gerade lokale Entwicklungskompetenz ermöglicht
uns, die Bedürfnisse unserer Kunden hier im Markt genau zu erkennen
und maßgeschneiderte Produkte herzustellen. Seit unserer Ankunft in
China vor rund dreißig Jahren haben wir immer wieder viel Wert
darauf gelegt, unser Know-how an unsere chinesischen Kollegen
weiterzugeben und sie kontinuierlich zu qualifizieren. In unseren
Forschungszentren arbeiten ungefähr 90% Einheimische, die durchaus
Einfluss auf die Entwicklung unserer Fahrzeuge nehmen. So haben wir
neue Produkte entwickelt, wie z.B. das jüngste Mitglied in unserer
Volkswagen Familie, den Lamando, ein Sportcoupé, das es so nur in
China gibt.
SPEYER-KURIER: Wird der „chinesische Geschmack“, der sich ja - ausweislich der Designsprache chinesischer „Heimatmarken“ - immer noch sehr deutlich von dem in Europa oder Nordamerika unterscheidet, hier langfristig die Oberhand gewinnen oder müssen statt dessen Kraftfahrzeuge zukünftig nicht immer stärker entsprechend den regionalen Marktbedürfnissen entwickelt werden?
 Prof. Dr.
Heizmann: Der Lamando ist hierfür ein sehr gutes Beispiel.
Dieses Modell wurde allein für den chinesischen Markt entwickelt
und wird auch nur hier verkauft werden.
Prof. Dr.
Heizmann: Der Lamando ist hierfür ein sehr gutes Beispiel.
Dieses Modell wurde allein für den chinesischen Markt entwickelt
und wird auch nur hier verkauft werden.
Der Erfolg unserer Modelle basiert auf einer Kombination aus gutem Preis/Leistungsverhältnis, höchster Qualität und gutem Raumangebot, das speziell auf die Wünsche chinesischer Käufer zugeschnitten ist. Vor allem gelungenes Fahrzeug-Design, technische Innovation (wie TSI Motoren und DSG Getriebe) sowie verschiedene Sicherheitsfeatures sind für chinesische Käufer die Hauptgründe, sich für ein Modell aus dem Volkswagen Konzern zu entscheiden.
Bei den lokal produzierten Fahrzeugen der Marke Volkswagen erfreuen sich vor allem die Modelle Santana, Jetta, Lavida und Sagitar großer Beliebtheit. Von Skoda kam der Octavia mit bis jetzt circa 88,800 Auslieferungen in 2014 gut bei unseren chinesischen Kunden an. Bei Audi sind die Limousinen Audi A4 und A6 sowie die SUVs Audi Q3, Q5 und der importierte Q7 unsere Bestseller.
SPEYER-KURIER: Über viele Jahre hinweg haben sich chinesische Inlandsprodukte ja vielfach eher dadurch „ausgezeichnet“, dass sie sich in der detailgetreuen Kopie europäischer Erfolgsprodukte versuchten. Das galt für das Design ebenso wie für technische Systemlösungen und führte noch vor wenigen Jahren dazu, dass europäische Zollbeamte reihenweise chinesische Fahrzeuge als Plagiate von den Messeständen ihrer chinesischen Hersteller entfernten. Hat sich da inzwischen eine Änderung im Verhalten vollzogen und inwieweit trifft es zu, dass Chinesen hier einfach ein anderes Verständnis von Patent- und Gebrauchsmusterschutz haben als Europäer?
 Prof. Dr. Heizmann: Beim Thema Plagiat sprechen
wir hier über Einzelfälle, das ist nicht die Regel. Klar ist, dass
wir immer einen Schritt voraus sein müssen. Und zwar sowohl, wenn
es um die Konkurrenz aus Übersee, als auch die unserer chinesischen
Konkurrenten geht. Wir können nicht verhindern, dass unsere
Innovationen Andere inspirieren. Stattdessen sind wir stolz auf
unsere Vorreiterrolle und erfinden uns und unsere Produkte immer
wieder neu. Wir haben das Ziel, immer wieder erneut für eine
Überraschung gut zu sein, damit unsere chinesischen Kunden mit uns
und unseren Produkten mehr als nur zufrieden sind. Wir wollen sie
begeistern! Und die Verkaufszahlen belegen das: Bis Ende September
2014 hat die Volkswagen Group China mehr als 2,7 Millionen
Fahrzeuge auf die chinesischen Straßen gebracht, davon über zwei
Millionen Autos der Marke Volkswagen. Im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum entsprechen diese Zahlen einem Wachstum von 15,2%
für die Gruppe und von 15,3% für die Marke Volkswagen. Audi hat im
gleichen Zeitraum 415,700 Fahrzeuge ausgeliefert. Das entspricht
sogar einer Steigerung von 16%!
Prof. Dr. Heizmann: Beim Thema Plagiat sprechen
wir hier über Einzelfälle, das ist nicht die Regel. Klar ist, dass
wir immer einen Schritt voraus sein müssen. Und zwar sowohl, wenn
es um die Konkurrenz aus Übersee, als auch die unserer chinesischen
Konkurrenten geht. Wir können nicht verhindern, dass unsere
Innovationen Andere inspirieren. Stattdessen sind wir stolz auf
unsere Vorreiterrolle und erfinden uns und unsere Produkte immer
wieder neu. Wir haben das Ziel, immer wieder erneut für eine
Überraschung gut zu sein, damit unsere chinesischen Kunden mit uns
und unseren Produkten mehr als nur zufrieden sind. Wir wollen sie
begeistern! Und die Verkaufszahlen belegen das: Bis Ende September
2014 hat die Volkswagen Group China mehr als 2,7 Millionen
Fahrzeuge auf die chinesischen Straßen gebracht, davon über zwei
Millionen Autos der Marke Volkswagen. Im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum entsprechen diese Zahlen einem Wachstum von 15,2%
für die Gruppe und von 15,3% für die Marke Volkswagen. Audi hat im
gleichen Zeitraum 415,700 Fahrzeuge ausgeliefert. Das entspricht
sogar einer Steigerung von 16%!
SPEYER-KURIER: Die Volkswagen-Gruppe hat einst als einer der ersten Hersteller mit dem AUDI-A6 auf der verlängerten Plattform den Zeitgeist der chinesischen Kunden getroffen: Als andere europäische – auch deutsche - Hersteller noch grundsätzliche Zweifel am wirtschaftlichen Potential und den Entwicklungsmöglichkeiten der Chinesen äußerten (Zitat eines hochrangigen deutschen Automobil-Managers noch aus dem Jahr 2007: „In China können sich ja ohnedies nur Funktionäre ein Auto leisten....“), hatte AUDI offensichtlich bereits das richtige Auto für diesen Markt gehabt. Dennoch: Auch in China eignen sich ein A 6 oder ein Skoda Superb wohl kaum zur Massenmotorisierung der Bevölkerung. Wie werden denn für diesen Markt die Automobile der Zukunft aussehen? Wie werden sich die Produktwünsche der Chinesen nach Ihrer Meinung in der Zukunft entwickeln und umsetzen lassen?
 Prof. Dr.
Heizmann: Wir strecken unsere Fühler in viele verschiedene
Richtungen aus, immer mit dem Ziel vor Augen, unseren Kunden das
beste und emotionalste Produkt zu bieten. Unser breites
Produktportfolio sorgt für große Auswahlmöglichkeiten in jeder
Preiskategorie und dank der großen Stückzahlen können wir die hohe
Nachfrage nach individueller Mobilität besser befriedigen. Mit
zukünftig mehr und mehr wachsender Digitalisierung ist unseren
Kunden vor allem das Thema Vernetzung sehr wichtig. Dafür haben wir
die richtigen Lösungen: Unser VW ‚Car-Net‘ ermöglicht unseren
Kunden auch im Fahrzeug ‚always on‘ zu sein. Unsere
‚Car-Net‘-Nutzer können rund um die Uhr durch unseren Service
telefonischen Support in Anspruch nehmen. Außerdem entwickelt
Volkswagen neue Antriebsformen, um den CO-2-Ausstoss weiter zu
verringern, ohne dabei das Fahrvergnügen zu vermindern. Wir werden
das Angebot an hochwertigen Produkten über unsere gesamte
Konzernmodellpallette erhöhen, unsere Kunden begeistern und den
Ausdruck persönlichen Geschmacks ermöglichen.
Prof. Dr.
Heizmann: Wir strecken unsere Fühler in viele verschiedene
Richtungen aus, immer mit dem Ziel vor Augen, unseren Kunden das
beste und emotionalste Produkt zu bieten. Unser breites
Produktportfolio sorgt für große Auswahlmöglichkeiten in jeder
Preiskategorie und dank der großen Stückzahlen können wir die hohe
Nachfrage nach individueller Mobilität besser befriedigen. Mit
zukünftig mehr und mehr wachsender Digitalisierung ist unseren
Kunden vor allem das Thema Vernetzung sehr wichtig. Dafür haben wir
die richtigen Lösungen: Unser VW ‚Car-Net‘ ermöglicht unseren
Kunden auch im Fahrzeug ‚always on‘ zu sein. Unsere
‚Car-Net‘-Nutzer können rund um die Uhr durch unseren Service
telefonischen Support in Anspruch nehmen. Außerdem entwickelt
Volkswagen neue Antriebsformen, um den CO-2-Ausstoss weiter zu
verringern, ohne dabei das Fahrvergnügen zu vermindern. Wir werden
das Angebot an hochwertigen Produkten über unsere gesamte
Konzernmodellpallette erhöhen, unsere Kunden begeistern und den
Ausdruck persönlichen Geschmacks ermöglichen.
SPEYER-KURIER: Wenn Sie aus Ihrem Bürofenster in Peking blicken, dann werden Sie die meiste Zeit des Jahres vermutlich nichts oder nur sehr wenig sehen: Der Smog aus Heizungsanlagen, Industrieschloten, aber auch aus den Auspuffanlagen der Automobile in diesem Land sorgt dafür, dass die Menschen kaum noch atmen können. Wenn dazu nun auch noch die Massenmotorisierung kommt, dann wird die Lage wohl gänzlich unerträglich. Was kann Ihre Branche auf diesem weiter schnell wachsenden Markt tun, um den massenhaften Wunsch der Chinesen nach bezahlbarer Mobilität mit der Notwendigkeit zur Reduzierung der Luftverschmutzung oder zumindest einer Abflachung der Zuwachskurve in Einklang zu bringen?
 Prof. Dr.
Heizmann: Selbstverständlich genießen wir auch regelmäßig
schöne Tage in Peking. Damit wir das noch öfter können und die Luft
wieder dauerhaft besser wird, leisten wir unseren Beitrag dazu und
haben dafür kürzlich unsere neue Produktoffensive angekündigt: Wir
bringen noch dieses Jahr den electric up! auf die chinesischen
Straßen gefolgt in 2015 vom Audi A3 e-tron, dem Golf GTE und dem
e-Golf, zwei innovativen Plug-in-Hybridfahrzeugen und einem
weiteren rein elektrischen Auto. Mittlerweile erfüllen bereits rund
17 Konzernmodelle die chinesischen gesetzlichen Anforderungen für
„Besonders Energie sparende Fahrzeuge“.
Prof. Dr.
Heizmann: Selbstverständlich genießen wir auch regelmäßig
schöne Tage in Peking. Damit wir das noch öfter können und die Luft
wieder dauerhaft besser wird, leisten wir unseren Beitrag dazu und
haben dafür kürzlich unsere neue Produktoffensive angekündigt: Wir
bringen noch dieses Jahr den electric up! auf die chinesischen
Straßen gefolgt in 2015 vom Audi A3 e-tron, dem Golf GTE und dem
e-Golf, zwei innovativen Plug-in-Hybridfahrzeugen und einem
weiteren rein elektrischen Auto. Mittlerweile erfüllen bereits rund
17 Konzernmodelle die chinesischen gesetzlichen Anforderungen für
„Besonders Energie sparende Fahrzeuge“.
Wir machen aber beim Produkt alleine nicht Halt. Mit verschiedenen privaten Lade-Konzepten wie etwa einer Wallbox oder aber auch mit Ladestationen in der Öffentlichkeit werden wir unseren Kunden den Umstieg auf unsere Plug-In-Hybride sehr angenehm gestalten. In 2016 startet die lokale Produktion von weiteren Plug-In-Hybriden, wie dem Audi A6 e-tron. Und das ist noch nicht alles! Wir bekennen uns zu unserer ökologischen Verantwortung. Unsere Fabriken folgen der Think.Blue.Factory-Strategie. Es geht darum, auch bei der Produktion Energie zu sparen und Emissionen zu vermeiden. Und auch unsere konventionellen Fahrzeuge verbessern wir kontinuierlich. Wir arbeiten konstant an Gewichtsreduktion und technischen Verbesserungen, wie unseren neuen High-Tech-Getrieben aus dem Werk in Tianjin, um die anvisierten durchschnittlichen 5 Liter pro 100 Kilometer zu erreichen.
SPEYER-KURIER: In unserer Reihe „Interview der Woche“ versuchen wir auch immer, unsere Gesprächspartner den Leserinnen und Lesern des SPEYER-KURIER auch als Menschen näher zu bringen, was sich angesichts Ihrer Herkunft aus Speyer und unseren gemeinsamen schulischen Berührungspunkte anbietet. Deshalb zum Schluss noch einige persönliche Fragen:
Soweit Ihnen Ihre vielfältigen Verantwortlichkeiten die Zeit dazu lassen: Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit? Welchen Hobbies „frönt“ der Automobilmanager Jochem Heizmann?
 Prof. Dr.
Heizmann: Ich liebe klassische Musik und bin ein großer
Kunst-Enthusiast. Wenn ich es einrichten kann, besuche ich sehr
gern Konzerte. Sehr gut gefällt mir die Musik des chinesischen
Pianisten Lang Lang, der mit seiner beeindruckenden Energie bei
seinen Auftritten die Massen begeistert. Toll finde ich, dass er
nicht nur ein virtuoser Musiker, sondern auch ein Vorbild ist, wenn
es um die Förderung der Jugend geht. Als Marken-Botschafter
arbeitet Lang Lang mit uns schon seit mehreren Jahre zusammen. Wenn
ich an das Werkskonzert in Wolfsburg zurückdenke, bekomme ich heute
noch Gänsehaut. Klassische Musik in so einem interessanten,
technischen Umfeld zu erleben ist wirklich ein unvergessliches
Erlebnis.
Prof. Dr.
Heizmann: Ich liebe klassische Musik und bin ein großer
Kunst-Enthusiast. Wenn ich es einrichten kann, besuche ich sehr
gern Konzerte. Sehr gut gefällt mir die Musik des chinesischen
Pianisten Lang Lang, der mit seiner beeindruckenden Energie bei
seinen Auftritten die Massen begeistert. Toll finde ich, dass er
nicht nur ein virtuoser Musiker, sondern auch ein Vorbild ist, wenn
es um die Förderung der Jugend geht. Als Marken-Botschafter
arbeitet Lang Lang mit uns schon seit mehreren Jahre zusammen. Wenn
ich an das Werkskonzert in Wolfsburg zurückdenke, bekomme ich heute
noch Gänsehaut. Klassische Musik in so einem interessanten,
technischen Umfeld zu erleben ist wirklich ein unvergessliches
Erlebnis.
Was die Kunst anbelangt, entdecke ich gern neue Werke chinesischer Künstler, entweder im ‚Art District‘ oder einer der Künstlerkolonien am Rande Pekings. Es gefällt mir sehr, wie Kunstwerke bei jedem Menschen andere Eindrücke hinterlassen und wie ich immer wieder neue Aspekte entdecken kann, sei es bei mir bekannten oder mir unbekannten Werken.
Außerdem halte ich mich mit Sport wie Joggen oder Schwimmen fit. Mein persönliches Highlight ist es schließlich, wenn ich Zeit mit meiner Enkelin verbringen kann.
SPEYER-KURIER: Auch wenn Sie bereits beruflich sicher sehr viel unterwegs sind: Gibt es ein präferiertes Urlaubsland für Sie?
 Prof. Dr.
Heizmann: Wenn ich Urlaub habe, zieht es mich weg von der
Großstadt in ruhigere Sphären, um ein wenig zu entspannen. Deshalb
fahre ich mit meiner Frau sehr gern in die Berge. Dort kann ich die
gute Luft und Aussichten genießen, fernab vom städtischen Trubel.
Momentan versuche ich ebenfalls die Gelegenheit zu nutzen, um China
und die Nachbarländer besser kennenzulernen.
Prof. Dr.
Heizmann: Wenn ich Urlaub habe, zieht es mich weg von der
Großstadt in ruhigere Sphären, um ein wenig zu entspannen. Deshalb
fahre ich mit meiner Frau sehr gern in die Berge. Dort kann ich die
gute Luft und Aussichten genießen, fernab vom städtischen Trubel.
Momentan versuche ich ebenfalls die Gelegenheit zu nutzen, um China
und die Nachbarländer besser kennenzulernen.
SPEYER-KURIER: Welches Buch, welche Zeitschrift liegt derzeit neben Ihrem Bett?
Prof. Dr. Heizmann: Im Bett lese ich nicht (lacht). Ich habe etliche Tageszeitungen und einige Wochenzeitschriften wie Wirtschaftswoche, Stern, Capital und Spiegel abonniert. Ich fände es schon gut, wenn ich die Zeit hätte, erst einmal all diese gründlich durchzulesen.
SPEYER-KURIER: Und abschließend noch einige Fragen an den „alten“ Speyerer: Haben Sie noch Kontakte in Ihre Geburtsstadt – zu alten Freunden oder Klassenkameraden?
Prof. Dr. Heizmann: Leider habe ich kaum noch Kontakte nach Speyer, weil ich keine Familie mehr dort habe. Wenn ich mal in der Region bin, besuche ich immer das Grab meiner Eltern. Das ist mir sehr wichtig.
SPEYER-KURIER: Was sind Ihre Lieblingsorte, wenn Sie an Speyer denken?
Prof. Dr. Heizmann: Da muss ich nicht lange nachdenken. Meine Top 3 sind die Hauptstraße, der Dom und das Brezelfest!
SPEYER-KURIER: Wenn Sie von Ihrer Schulzeit in Speyer träumen oder sich daran zurückerinnern, was oder wer kommt Ihnen da in den Sinn?
 Prof. Dr. Heizmann: Wenn ich an meine
Gymnasialzeit am Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer zurückdenke,
erinnere ich mich insbesondere an unsere Abiturfeier und an unsere
Abiturzeitung, die ich noch in Ehren aufbewahre. Ich war damals
Klassensprecher und habe dementsprechend viel Herzblut
hineingesteckt.
Prof. Dr. Heizmann: Wenn ich an meine
Gymnasialzeit am Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer zurückdenke,
erinnere ich mich insbesondere an unsere Abiturfeier und an unsere
Abiturzeitung, die ich noch in Ehren aufbewahre. Ich war damals
Klassensprecher und habe dementsprechend viel Herzblut
hineingesteckt.
SPEYER-KURIER: Verspüren Sie „draußen in der großen, weiten Welt“ auch schon einmal so etwas wie Heimweh nach Ihrer Geburtsstadt und könnten Sie sich vorstellen, nach dem Ende Ihrer beruflichen Tätigkeit wieder hierher zurückzukehren?
Prof. Dr. Heizmann: Speyer ist eine wirklich liebenswerte Stadt und ich habe dort sehr gerne gelebt. Zurzeit sind China und Wolfsburg meine Lebensmittelpunkte und in Deutschland zieht es mich vor allem nach Süddeutschland, weil wir dort viele Jahre gewohnt haben und auch unsere Kinder und Enkel mittlerweile dort zu hause sind. Deshalb kann ich mir kaum vorstellen, wieder dauerhaft nach Speyer zurückzukehren.
SPEYER-KURIER: Dann aber doch vielleicht einmal auf eine Tasse Kaffee in der alten Heimatstadt....
Herr Prof. Dr. Heizmann, wir dürfen uns ganz herzlich dafür bedanken, dass Sie sich soviel Zeit für dieses ausführliche Gespräch genommen haben, mit dem Sie den Leserinnen und Lesern des SPEYER-KURIER zugleich Einblick in die Entwicklung eines der wichtigsten deutschen Industriezweige und ihrem derzeit bedeutsamsten Markt gewährt haben.
Wir wünschen Ihnen für Ihre verantwortlungsvolle Aufgabe auch weiterhin viel Erfolg und alles Gute.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler
17.04.2015
„Interview der Woche“
 Heute
mit:
Heute
mit:
Dr. Alexander Schubert
Direktor des „Historischen Museums der Pfalz“ in Speyer
verheiratet
geb. 1969 in Bayreuth
1992 - 2002 Studium der Geschichte, Germanistik, Politikwissenschaften und Erziehungswissenschaften in Bayreuth und Bamberg
2002 Promotion über den „Ersten süddeutschen Städtekrieg“ bei Prof. Dr. Bernd Schneidmüller
2002 – 2004 Museen der Stadt Bamberg
2004 Kulturhistorisches Museum Magdeburg
2007 Reiss-Engelhorn-Museen Mannheim
Persönlicher Referent des Generaldirektors
2011 Wissenschaftlicher Direktor für die Bereiche Wissenschaftliche Großprojekte, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Museumspädagogik
Juli 2014 Berufung zum Direktor des „Historischen Museums der Pfalz“ in Speyer
19.12.2014
Das Museum den Menschen als „Lern- und Wohlfühlort“ nahebringen
SPEYER-KURIER: Herr Dr. Schubert, an diesem Wochenende, am 20. Dezember, öffnet in Ihrem Haus die höchst spektakuläre „Titanic-Ausstellung“ ihre Pforten. Doch viele Menschen fragen sich heute: Was hat der Untergang dieses Luxuskreuzfahrtschiffes im Jahr 1912 mit Speyer und der Pfalz zu tun?
 Dr.
Alexander Schubert: In der Tat verbindet man auf den
ersten Blick die Pfalz und Speyer eher mit der Rheinschifffahrt als
mit diesem berühmten Passagierschiff, das seine Prominenz vor allem
dadurch erlangte, dass es kurz nach seinem Stapellauf bei einer
Atlantik-Überquerung verunglückt und gesunken ist. Wenn man aber
genauer hinsieht, dann finden sich durchaus Bezugspunkte zwischen
der „Titanic“ und der Pfalz. Denn unter den Passagieren befanden
sich auch Pfälzer: Eine höchst illustre Figur dabei war Isidor
Straus, der 1845 in Otterberg in der Pfalz geboren wurde, als
junger Mensch mit seinem Vater in die Vereingten Staaten
ausgewandert war und dort eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat.
Er avancierte zum Multimillionär, indem er mit großem Erfolg die
Kaushauskette R.H. Macy führte, die wohl jeder Amerikaner und die
meisten Amerika-Touristen kennen und die bis heute besteht. Dieser
Isidor Straus war gemeinsam mit seiner Ehefrau Ida Straus, die
interesanterweise aus Worms stammte, auf diesem Schiff. Diese
Besonderheit des Themas wollen wir unter anderem in der Ausstellung
herausarbeiten und daran exemplarisch einiges aus der
Auswandergeschichte der Pfälzer aufzeigen. Und da sind wir dann
auch schon mitten drin in der Pfalz. Ein Beispiel also, wie man
große weltgeschichtliche Themen anhand eines Ankerpunktes in der
Pfalz darstellen kann.
Dr.
Alexander Schubert: In der Tat verbindet man auf den
ersten Blick die Pfalz und Speyer eher mit der Rheinschifffahrt als
mit diesem berühmten Passagierschiff, das seine Prominenz vor allem
dadurch erlangte, dass es kurz nach seinem Stapellauf bei einer
Atlantik-Überquerung verunglückt und gesunken ist. Wenn man aber
genauer hinsieht, dann finden sich durchaus Bezugspunkte zwischen
der „Titanic“ und der Pfalz. Denn unter den Passagieren befanden
sich auch Pfälzer: Eine höchst illustre Figur dabei war Isidor
Straus, der 1845 in Otterberg in der Pfalz geboren wurde, als
junger Mensch mit seinem Vater in die Vereingten Staaten
ausgewandert war und dort eine Erfolgsgeschichte geschrieben hat.
Er avancierte zum Multimillionär, indem er mit großem Erfolg die
Kaushauskette R.H. Macy führte, die wohl jeder Amerikaner und die
meisten Amerika-Touristen kennen und die bis heute besteht. Dieser
Isidor Straus war gemeinsam mit seiner Ehefrau Ida Straus, die
interesanterweise aus Worms stammte, auf diesem Schiff. Diese
Besonderheit des Themas wollen wir unter anderem in der Ausstellung
herausarbeiten und daran exemplarisch einiges aus der
Auswandergeschichte der Pfälzer aufzeigen. Und da sind wir dann
auch schon mitten drin in der Pfalz. Ein Beispiel also, wie man
große weltgeschichtliche Themen anhand eines Ankerpunktes in der
Pfalz darstellen kann.
SPEYER.KURIER: Zuletzt, noch unter Ihrem Vorgänger Dr. Eckart Köhne, wurde mit der „playmobil-Ausstellung“ gleichfalls eine Schau gezeigt, die auf den ersten Blick ebenfalls nur wenig mit der Pfalz zu tun hatte und die deshalb auch auf vereinzelte Kritik stieß. Andererseits aber wurde sie dann doch zu einem schier unglaublichen Publikumserfolg. Werden solche Schauen, die ja durchaus eine kulturhistorische Bedeutung für sich reklamieren können, die aber sicher auch ein Stück weit auf die Sensationslust ihrer Besucher zielen, auch unter Ihrer Leitung weiterhin ihren Platz behalten?
 Dr.
Alexander Schubert: Natürlich hat auch „playmobil“ auf den
ersten Blick nichts mit der Pfalz zu tun. Die Firma Brandstätter
ist ja bekanntlich im fränkischen Zirndorf beheimatet, aber das
Speyerer Museum hat ja schon eine gewisse Traditionsbildung
vollzogen, weil hier vor zehn Jahren bereits die erste
Jubiläumsausstellung „30 Jahre playmobil“ initiiert worden war. Und
deshalb war es nur konsequent, zehn Jahre später die Ausstellung
zum vierzigjährigen zu zeigen - und wir haben auch vor, in zehn
Jahren gemeinsam mit „playmobil“ das nächste runde Jubiläum, den
50. Geburtstag der Marke zu feiern.
Dr.
Alexander Schubert: Natürlich hat auch „playmobil“ auf den
ersten Blick nichts mit der Pfalz zu tun. Die Firma Brandstätter
ist ja bekanntlich im fränkischen Zirndorf beheimatet, aber das
Speyerer Museum hat ja schon eine gewisse Traditionsbildung
vollzogen, weil hier vor zehn Jahren bereits die erste
Jubiläumsausstellung „30 Jahre playmobil“ initiiert worden war. Und
deshalb war es nur konsequent, zehn Jahre später die Ausstellung
zum vierzigjährigen zu zeigen - und wir haben auch vor, in zehn
Jahren gemeinsam mit „playmobil“ das nächste runde Jubiläum, den
50. Geburtstag der Marke zu feiern.
Das spannende an diesem Konzept war, dass es hier gelungen ist, Museumsbesucher unterschiedlicher Altersgruppen ganz unbefangen durch die Tore eines solchen Hauses zu bekommen: Die Kinder, die sofort „losgeschossen“ sind auf die Spieletische, aber auch die Erwachsenen, die etwas aus ihrer eigenen Kindheit oder – soweit es sich um die Großeltern handelte – aus der Kindheit ihrer eigenen Kinder wiederentdeckt haben.
Es war also schon sehr spannend, wie es auf diesem Wege gelungen ist, gewisse Schwellenängste abzubauen. Denn wenn jemand als Erwachsener, vor der Entscheidung steht, ein Museum zu besuchen, dann stellt er sich vielleicht die Frage: „Was muss ich da an Vorwissen mitbringen?“- „Weiß ich zum Thema der Schau überhaupt genug?“ Wer aber als Kind spielerisch damit konfrontiert wird, der wird sich da durchaus leichter tun und deshalb ist es uns sehr, sehr wichtig, um auch künftige Generationen für das Museum zu gewinnen – das Museum als 'Lernort', aber auch als 'Wohlfühlort' kennenzulernen.
SPEYER-KURIER: Herr Dr. Schubert, Sie haben bereits von dem großen Erfolg der „playmobil-Ausstellung“ gesprochen. Wie hat sich der denn im einzelnen, insbesondere im Bezug auf die Besucherzahlen, dargestellt?
 Dr.
Alexander Schubert: Diese Ausstellung hat über 211.000
Besucher angezogen und zählte damit in diesem Jahr definitiv zu den
erfolreichsten bundesweit. Das zeigt, dass das Konzept der Kollegen
aus unserem Haus aufgegangen ist, weil es keine Produktschau war,
sondern im wesentlichen die Zeitgeschichte der vergangenen vierzig
Jahre spiegelte. So konnte man z.B. gut nachvollziehen, wie sich
die Rolle der Frau in diesen Jahrzehnten in der Bundesrepubik
verändert hat. Wenn man die ersten Figuren von playmobil ansieht,
so gibt es dort nur männliche Figuren. Dann aber kommen klassische
Frauenberufe dazu und heute gibt es die Pilotin, die Managerin und
viele weitere. Das Ganze war also auch ein Schaufenster für die
gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten vierzig Jahren,
ganz abgesehen davon, dass es sich dabei ja auch um ein Spielzeug
mit einem ausgesprochen guten Ruf und einer Prise Humor handelt,
das auch von daher sehr gut in das „Historische Museum der Pfalz“
passt, einem Haus, das sich zudem auch durch sein „Junges Museum
JuMus“ als Alleinstellungsmerkmal auszeichnet.
Dr.
Alexander Schubert: Diese Ausstellung hat über 211.000
Besucher angezogen und zählte damit in diesem Jahr definitiv zu den
erfolreichsten bundesweit. Das zeigt, dass das Konzept der Kollegen
aus unserem Haus aufgegangen ist, weil es keine Produktschau war,
sondern im wesentlichen die Zeitgeschichte der vergangenen vierzig
Jahre spiegelte. So konnte man z.B. gut nachvollziehen, wie sich
die Rolle der Frau in diesen Jahrzehnten in der Bundesrepubik
verändert hat. Wenn man die ersten Figuren von playmobil ansieht,
so gibt es dort nur männliche Figuren. Dann aber kommen klassische
Frauenberufe dazu und heute gibt es die Pilotin, die Managerin und
viele weitere. Das Ganze war also auch ein Schaufenster für die
gesellschaftlichen Veränderungen in den letzten vierzig Jahren,
ganz abgesehen davon, dass es sich dabei ja auch um ein Spielzeug
mit einem ausgesprochen guten Ruf und einer Prise Humor handelt,
das auch von daher sehr gut in das „Historische Museum der Pfalz“
passt, einem Haus, das sich zudem auch durch sein „Junges Museum
JuMus“ als Alleinstellungsmerkmal auszeichnet.
SPEYER-KURIER: Zurück aus der erfolgreichen Vergangenheit in die Gegenwart: „Große Ereignisse werfen ihre Container voraus“, möchte man in Abwandlung eines geflügelten Wortes sagen. Denn wie auch der SPEYER-KURIER berichtete, sind vor Ihrem Haus in den letzten Wochen zahlreiche riesige LKW vorgefahren und aus ihnen zum Teil wohl auch große Exponate in die Ausstellungsräume geschafft worden. Was erwartet denn die Besucher an besonders Spektakulärem in dieser nächsten, großen Schau?
 Dr.
Alexander Schubert: Ich habe mich in der
letzten Zeit immer wieder drüben im Museum umgesehen, weil sich
dort jeden Tag etwas verändert hat. Und man kann heute sicher mit
Fug und Recht sagen, dass Sie das Museum so, wie Sie es bisher
erlebt haben, wohl nicht wiedererkennen werden. Denn es wird mit
großen Inszenierungen und Einbauten gearbeitet – sie werden so
quasi das Schiff betreten und durch den Gang der Ersten Klasse zu
den verschiedenen Kabinen gehen können – Sie werden ein Verandacafé
sehen, Schleußen, die vermeintlich zur Sicherheit an Bord dienen
sollten und dergleichen mehr - also allein schon vom Raumeindruck
her wird es wirklich spektakulär werden. Was hinzukommt, sind über
250 originale Exponate, die bei Bergungsexpeditionen aufgefunden
wurden und die wir hier zeigen können.
Dr.
Alexander Schubert: Ich habe mich in der
letzten Zeit immer wieder drüben im Museum umgesehen, weil sich
dort jeden Tag etwas verändert hat. Und man kann heute sicher mit
Fug und Recht sagen, dass Sie das Museum so, wie Sie es bisher
erlebt haben, wohl nicht wiedererkennen werden. Denn es wird mit
großen Inszenierungen und Einbauten gearbeitet – sie werden so
quasi das Schiff betreten und durch den Gang der Ersten Klasse zu
den verschiedenen Kabinen gehen können – Sie werden ein Verandacafé
sehen, Schleußen, die vermeintlich zur Sicherheit an Bord dienen
sollten und dergleichen mehr - also allein schon vom Raumeindruck
her wird es wirklich spektakulär werden. Was hinzukommt, sind über
250 originale Exponate, die bei Bergungsexpeditionen aufgefunden
wurden und die wir hier zeigen können.
Und noch ein weiteres: Speyer wird in Deutschland die erste Station für diese völlig neu konzipierte Schau sein, die zuvor nur in Amsterdam und in Brüssel gezeigt wurde. Damit werden wir nach meiner Überzeugung ein rundes Bild bieten können dazu, wie man sich auf diesem Schiff bewegt hat, wie die Atmosphäre war, aber auch, wie es zu dem tragischen Unglück kommen konnte. Und schließlich wird auch das spannende Thema abgehandelt, wie die Bergung der Überreste möglich wurde. Das war ja damals schon beeindruckend, als im Jahr 1985 eine Forschungsexpedition in fast vier Kilometern Meerestiefe – allein diese Zahl ist atemberaubend – dieses Schiff mit seinen sehr gut erhaltenen Artefakten plötzlich aufgefunden hat.
SPEYER-KURIER: Auch ein Museumsmann hat ja in jeder Ausstellung unter den Exponaten vielleicht auch so seine „Favoriten“. Gibt es denn auch in dieser Schau bereits ein „Lieblingsstück“ von Alexander Schubert?
 Dr.
Alexander Schubert: Es ist tatsächlich so, dass diese
Exponate einem sehr, sehr nahe heranbringen an die Schicksale der
einzelnen Menschen. Es ist deshalb wichtig, dass man nicht so sehr
das Sensationelle dieses Unglücks in den Vordergrund stellt,
sondern die Biographien der Menschen. Und da ist es so, dass man
sehr nah an einen Menschen herankommt, wenn man z.B. eine Geldbörse
mit einem noch erhaltenen Dollar-Schein aus der Zeit sieht. Da
bekommt man schon eine Gänsehaut, weil man damit ganz, ganz nah an
den Menschen dran ist, die voller Euphorie mit großen Hoffnungen
und Erwartungen dieses Schiff betreten haben.
Dr.
Alexander Schubert: Es ist tatsächlich so, dass diese
Exponate einem sehr, sehr nahe heranbringen an die Schicksale der
einzelnen Menschen. Es ist deshalb wichtig, dass man nicht so sehr
das Sensationelle dieses Unglücks in den Vordergrund stellt,
sondern die Biographien der Menschen. Und da ist es so, dass man
sehr nah an einen Menschen herankommt, wenn man z.B. eine Geldbörse
mit einem noch erhaltenen Dollar-Schein aus der Zeit sieht. Da
bekommt man schon eine Gänsehaut, weil man damit ganz, ganz nah an
den Menschen dran ist, die voller Euphorie mit großen Hoffnungen
und Erwartungen dieses Schiff betreten haben.
Man hatte dieses Schiff ja schon vor seinem Stapellauf als ein „Wunderwerk der Technik“ gefeiert, als unsinkbar. Und wenn man sich dann in diese Umstände und in diese Euphorie hineinversetzt – und das machen die zu sehenden Artefakte möglich – dann gewinnt man ein sehr konkretes Bild von den Umständen der Zeit und von den Gemütslagen seiner Passagiere.
SPEYER-KURIER: Das „Historische Museum der Pfalz“ hat sich ja in den vergangenen Jahren auch durch seine sehr interessanten Begleitprogramme zu den Ausstellungen einen Namen gemacht. Was wird denn in dieser Hinsicht in Sachen „Titanic“ zu erwarten sein?
 Dr.
Alexander Schubert: Uns war wichtig, das Rahmenprogramm
ebenfalls unterhaltend zu gestalten und nicht zu sehr nur das
Unglück in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch zu zeigen, wie
sich das Leben auf dem Schiff in der Zeit vor seinem Untergang
abgespielt hat. So wird es bei uns z.B. an drei Abenden ein
„Titanic-Dinner“ geben, bei denen Gerichte der uns überlieferte
Speisekarte originalgetreu nachgekocht werden. Außerdem werden wir
versuchen, den Besuchern in szenischen Inszenierungen das Leben auf
dem Schiff zu vermitteln. Es wird also ganz spannend werden, an
drei Abenden eine Mischung von „Histotainment“ und kulinarischem
Erleben zu genießen. Das ist übrigens etwas, was ich sehr empfehlen
kann - es wird aber auch Vortragsreihen und Führungen gemeinsam mit
der „Theaterwerkstatt Heidelberg“ geben, in denen Schauspieler in
historischer Gewandung das Thema lebensnah vermitteln.
Dr.
Alexander Schubert: Uns war wichtig, das Rahmenprogramm
ebenfalls unterhaltend zu gestalten und nicht zu sehr nur das
Unglück in den Mittelpunkt zu stellen, sondern auch zu zeigen, wie
sich das Leben auf dem Schiff in der Zeit vor seinem Untergang
abgespielt hat. So wird es bei uns z.B. an drei Abenden ein
„Titanic-Dinner“ geben, bei denen Gerichte der uns überlieferte
Speisekarte originalgetreu nachgekocht werden. Außerdem werden wir
versuchen, den Besuchern in szenischen Inszenierungen das Leben auf
dem Schiff zu vermitteln. Es wird also ganz spannend werden, an
drei Abenden eine Mischung von „Histotainment“ und kulinarischem
Erleben zu genießen. Das ist übrigens etwas, was ich sehr empfehlen
kann - es wird aber auch Vortragsreihen und Führungen gemeinsam mit
der „Theaterwerkstatt Heidelberg“ geben, in denen Schauspieler in
historischer Gewandung das Thema lebensnah vermitteln.
SPEYER-KURIER: Ein großes und breit angelegtes Programm also, mit dem Sie jetzt bereits auf das erste halbe Jahr Ihres Wirkens an neuer Stätte in Speyer zurückblicken können. Im Verlauf Ihres beruflichen Werdegangs haben Sie ja schon eine ganze Reihe prominenter Museen von innen kennengelernt und dort gearbeitet. Dennoch aber war wohl jede dieser Aufgaben anders - die Arbeit an jedem Haus sicher ganz speziell. Herr Dr. Schubert, was also ist in Speyer anders als in Bamberg. Madeburg oder zuletzt bei den „Reiss-Enegrlhorn-Museen“ in Mannheim?
 Dr.
Alexander Schubert: (zögert) ….das ist eine ganz
schwierige Frage. Insgesamt ist es aber sicher so, dass jeder
Arbeitsplatz eine eigene Herausforderung ist. Ich befinde mich
jetzt ja auch in einer anderen Rolle: In Mannheim war ich einer der
Direktoren, aber der Generaldirektor hatte die Gesamtverantwortung.
Hier in Speyer stehe ich jetzt selbst in der vordersten Front, was
die Verantwortlichkeit betrifft. Ich sehe es deshalb eher so, dass
ich an jeder meiner bisherigen beruflichen Stationen lernen und
Erfahrungen sammeln konnte, die mir jetzt hier in Speyer zugute
kommen.
Dr.
Alexander Schubert: (zögert) ….das ist eine ganz
schwierige Frage. Insgesamt ist es aber sicher so, dass jeder
Arbeitsplatz eine eigene Herausforderung ist. Ich befinde mich
jetzt ja auch in einer anderen Rolle: In Mannheim war ich einer der
Direktoren, aber der Generaldirektor hatte die Gesamtverantwortung.
Hier in Speyer stehe ich jetzt selbst in der vordersten Front, was
die Verantwortlichkeit betrifft. Ich sehe es deshalb eher so, dass
ich an jeder meiner bisherigen beruflichen Stationen lernen und
Erfahrungen sammeln konnte, die mir jetzt hier in Speyer zugute
kommen.
Bamberg und Speyer lassen sich sicher von der Örtlichkeit her vergleichen – Städte mit einer großen Historie, mit einem Dom und einer großen Geschichte, die man aus unterschiedlichen Blickwinkeln immer wieder im Museum zeigen kann. In Bamberg waren dies allerdings meine Anfangsjahre als Volontär, in denen ich mich sehr stark in einer Phase des Lernens befand. Zuletzt in Mannheim war ich acht Jahre, in denen ich gleichfalls viele Erfahrungen sammeln konnte, die mich dann letztlich auf meine Führungsrolle in Speyer vorbereitet haben.
Was ich in Speyer als anders bezeichnen würde, ist die Nähe und sind die schnellen Entscheidungswege, z.B. wenn es darum geht, rasch einen Termin beim Oberbürgermeister zu bekommen, wo wir uns dann auf einer sehr vertrauensvollen Ebene beraten können, oder auch mit dem Vorsitzenden des „Historischen Vereins der Pfalz“, Herrn Schineller zu sprechen. Und das gilt in gleicher Weise auch für den Bezirkstagsvorsitzenden Theo Wieder und die anderen Träger unseres Hauses.
Was ich an Speyer darüber hinaus sehr schätze, ist die Tatsache, dass hier die Stadtgesellschaft offensichtlich sehr lebendig ist. Das ist zuletzt auch bei dem Workshop deutlich geworden, den der Oberbürgermeister veranstaltet hat. Was ich gleichfalls sehr schätze, ist die starke touristische Qualität, die Speyer hat - allein schon durch den Dom als „UNESCO-Weltkulturerbe“, aber auch insgesamt durch die hohe Attraktivität der Lage unseres Museums zwischen Dom, Technik-Museum und dazwischen diesem wunderbaren Parkplatz auf dem Festplatz.
Ich genieße es deshalb schon sehr, dass man sich hier in einem Umfeld mit vielen Partnern befindet, die alle das gleiche Ziel verfolgen, nämlich dass die Menschen, die hierher kommen, etwas mitnehmen - dass sie gut unterhalten werden und dass sie hier ein attraktives Angebot vorfinden. Das ist sicher auch eine Aufgabe des Museums, aber wir sind hier nicht allein, sind keine Einzelkämpfer, sondern befinden uns in einer beachtlichen Riege und das macht unsere Aufgabe hier so überaus attraktiv.
SPEYER-KURIER: Gab es da aber auch etwas, von dem Sie heute im Nachhinein sagen würden: Das hat mich überrascht?
 Dr.
Alexander Schubert: (denkt lange nach)...Was hat mich
überrascht? Mir kam natürlich zugute, dass ich das Haus schon eine
Weile kannte und dass ich mir im Zuge von Kooperationen mit
Kolleginnen und Kollegen die Ausstellungen der letzten Jahre
angesehen hatte und mit ihnen zusammenarbeiten konnte. Insofern
hatte ich durchaus einen Startvorteil, sodass eigentlich bisher
alles frei von Überraschungen ablief.
Dr.
Alexander Schubert: (denkt lange nach)...Was hat mich
überrascht? Mir kam natürlich zugute, dass ich das Haus schon eine
Weile kannte und dass ich mir im Zuge von Kooperationen mit
Kolleginnen und Kollegen die Ausstellungen der letzten Jahre
angesehen hatte und mit ihnen zusammenarbeiten konnte. Insofern
hatte ich durchaus einen Startvorteil, sodass eigentlich bisher
alles frei von Überraschungen ablief.
SPEYER-KURIER: Als Historiker mit einem deutlichen Akzent auf Pädagogik und den Medienwissenschaften wollen Sie Ihrem Publikum mit den von Ihnen verantworteten Ausstellungen ja wohl auch immer einen „belehrenden, einen aufklärenden Impetus“ mitgeben? Können wir deshalb ein Museum im Kant'schen Sinne auch als eine „moralische Anstalt“ verstehen, die seinen Besuchern nicht nur „Unterhaltung auf hohem Niveau“, sondern auch Lebenshilfe und Orientierung geben will?
Dr. Alexander Schubert: Lassen Sie es mich einmal so sagen: Die Unterhaltung ist für uns – ähnlich wie in den Schulen und in anderen Bildungseinrichtungen, wo sich das ja auch verändert hat – ein wichtiges Mittel, um Lerninhalte an die Menschen zu bringen. Heute wissen wir ja, dass die Menschen am leichtesten lernen, wenn sie sich wohl fühlen und wenn sie garnicht merken, dass sie lernen, aber trotzdem mit einem Erkenntnisgewinn herausgehen. Es ist deshalb ganz klar: Wir sind kein „Entertainmentbetrieb“, sondern wir wollen kulturhistorische Inhalte den Menschen nahebringen, aber auf eine angenehme Weise – nicht mit dem erhobenen Zeigefinger oder mit Druck, sondern so, dass sie sich gut unterhalten fühlen.
Und eines ist auch ganz klar: Dieses Museum hat sein Profil als „Historisches Museum der Pfalz“. Es steht nicht irgendwo und deshalb ist es die Königsdisziplin, wenn es uns gelingt, Themen auch mit der Region in Verbindung zu bringen. Als Beispiel sei nur noch einmal Isidor Straus aus Otterberg genannt.
Unser Ziel ist es, einerseits ein Stück weit zur Identitätsstärkung der Menschen in der Region beizutragen und andererseits den Menschen, die von außerhalb hierher kommen, die Pfalz und Speyer als interessanten, kulturhistorischen Ort in Erinnerung zu rufen, den sie immer wieder einmal ansteuern. Eine doppelte Herausforderung also: Wirkung nach innen, was die Identitätsstärkung angeht und Ausstrahlung nach außen, was das Image und die Wahrnehmung betrifft.
SPEYER-KURIER: Um diesen doppelten Anspruch erfolgreich umsetzen zu können, braucht es ja wohl auch immer wieder so etwas wie eine entsprechende Dramaturgie und „Inszenierung“. Als jemand, der in der Richard-Wagner-Stadt Bayreuth geboren und aufgewachsen ist und so schon früh mit dem Geist und der künstlerischen Ausstrahlung des großen Komponisten und mit den mannigfachen dramatischen Umsetzungen seines Werks auf dem „Grünen Hügel“ in Kontakt gekommen ist, haben sie sicher schon früh den Wert von Inszenierungen kennengelernt. Auch eine Ausstellung, gleich welcher Art, braucht für ihr Gelingen ein gekonntes dramaturgisches Konzept. Haben Sie davon, wie bei den Wagner-Festspielen Stoffe dramatisiert und inszeniert werden, auch Inspirationen für Ihre jetzige Aufgabe empfangen können?
 Dr.
Alexander Schubert: Tätsichlich bin ich durchaus etwas
geprägt durch diese Festspiele. Ich hatte als Kind zwischen dem
zehnten und fünfzehnten Lebensjahr Gelegenheit, dort als Statist
mitzuwirken und fand damals schon die Bühnenbilder und die
Ausstattungen tief beeindruckend. Ob sich daraus allerdings
spezielle Fertigkeiten für meine heutige Tätigkeit entwickelt
haben, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Zumindest aber habe ich
dort gelernt, dass die Atmosphäre immer ganz wichtig ist. Ich kann
in einer Ausstellung – sehr pursitisch – allein die Exponate
zeigen, kann aber auch - und das hat sich hier in Speyer ja schon
seit langem als eigenständige „Handschrift“ herausgebildet –
richtige 'Erfahrungsräume' schaffen, in denen man die Exponate in
einem gewissen Kontext präsentiert, indem man sie nicht nur ins
rechte Licht rückt, sondern um sie herum eine eigene Atmoshäre
schafft. Das, so glaube ich, ist sehr wichtig, denn die Menschen
bereiten sich ja logischerweise nicht intensiv auf den Museumsgang
vor, sondern waren zuvor schon Einkaufen oder hatten noch ein
anstrengendes Telefonat. Die muss man dann erst einmal zu dem Thema
hinführen und ihnen hier eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Und das
ist bei den Wagner-Festspielen sicher ähnlich. Doch ob es deshalb
in mir eine direkte Beziehung gibt, das vermag ich so absolut nicht
zu sagen.
Dr.
Alexander Schubert: Tätsichlich bin ich durchaus etwas
geprägt durch diese Festspiele. Ich hatte als Kind zwischen dem
zehnten und fünfzehnten Lebensjahr Gelegenheit, dort als Statist
mitzuwirken und fand damals schon die Bühnenbilder und die
Ausstattungen tief beeindruckend. Ob sich daraus allerdings
spezielle Fertigkeiten für meine heutige Tätigkeit entwickelt
haben, das vermag ich jetzt nicht zu sagen. Zumindest aber habe ich
dort gelernt, dass die Atmosphäre immer ganz wichtig ist. Ich kann
in einer Ausstellung – sehr pursitisch – allein die Exponate
zeigen, kann aber auch - und das hat sich hier in Speyer ja schon
seit langem als eigenständige „Handschrift“ herausgebildet –
richtige 'Erfahrungsräume' schaffen, in denen man die Exponate in
einem gewissen Kontext präsentiert, indem man sie nicht nur ins
rechte Licht rückt, sondern um sie herum eine eigene Atmoshäre
schafft. Das, so glaube ich, ist sehr wichtig, denn die Menschen
bereiten sich ja logischerweise nicht intensiv auf den Museumsgang
vor, sondern waren zuvor schon Einkaufen oder hatten noch ein
anstrengendes Telefonat. Die muss man dann erst einmal zu dem Thema
hinführen und ihnen hier eine Wohlfühlatmosphäre schaffen. Und das
ist bei den Wagner-Festspielen sicher ähnlich. Doch ob es deshalb
in mir eine direkte Beziehung gibt, das vermag ich so absolut nicht
zu sagen.
SPEYER-KURIER: Viele Museen leiden ja heute unter einer latenten finanziellen Auszehrung und an einem spürbaren Besucherschwund, insbesondere was die jüngere und jüngste Generation angeht. Zumindest was die Besucherzahlen angeht, befindet sich Speyer hier ja in einer durchaus komfortablen Situation, denn mit dem „JuMus“, dem „Jungen Museum,“ unternimmt Ihr Haus ja schon seit einigen Jahren erfolgreich den Versuch, mit speziellen Programmen die Besucher von morgen an sich zu binden. Inwieweit halten Sie diese Versuche für gelungen und wo könnte Ihres Erachtens dieses „junge Profil“ des „Historischen Museums der Pfalz“ noch weiter geschärft werden?
 Dr.
Alexander Schubert: Also, es ist sicher unbestreitbar,
dass unser „Junges Museum“ inzwischen bundesweit Vorbildcharakter
hat. Nach und nach erhalten wir Informationen von anderen Häusern,
die beginnen, sich in diesem Bereich zu profilieren. Das
„Historische Museum“ in Speyer ist da im letzten Jahrzehnt in der
Bundesrepublik sicher an die Spitze gerückt und hat hier die
Vorreiterrolle übernommen. Da wäre es vermessen, wenn der „neue
Mann an der Spitze“ eine Veränderung vornehmen wollte. Wir werden
deshalb alles daran setzen, diese Erfolgsgeschichte „JuMus“
weiterzuschreiben, was mir auch ganz persönlich sehr, sehr wichtig
ist.
Dr.
Alexander Schubert: Also, es ist sicher unbestreitbar,
dass unser „Junges Museum“ inzwischen bundesweit Vorbildcharakter
hat. Nach und nach erhalten wir Informationen von anderen Häusern,
die beginnen, sich in diesem Bereich zu profilieren. Das
„Historische Museum“ in Speyer ist da im letzten Jahrzehnt in der
Bundesrepublik sicher an die Spitze gerückt und hat hier die
Vorreiterrolle übernommen. Da wäre es vermessen, wenn der „neue
Mann an der Spitze“ eine Veränderung vornehmen wollte. Wir werden
deshalb alles daran setzen, diese Erfolgsgeschichte „JuMus“
weiterzuschreiben, was mir auch ganz persönlich sehr, sehr wichtig
ist.
Neben der Säule der kulturgeschichtlichen Ausstellungen werden in unserem Haus die Ausstellungen für Familien und junge Museumsgänger auch weiterhin eine ganz zentrale Rolle spielen. So planen wir beispielsweise für den Herbst 2015 eine Ausstellung zu „Detektiven, Agenten und Spionen“, ein Thema, das über die Generationen hinweg Kinder und Jugendliche begeistert. Dort wollen wir einerseits die berühmten Fernsehdetektive und Agenten vorstellen, aber auch solche Themen wie den „Umgang mit den eigenen Daten im Internet“ beleuchten. Auch damit wollen wir auf eine unterhaltsame Weise zur Bildung beitragen...
SPEYER-KURIER: ...und sich zugleich in eine allgemeine gesellschaftpolitische Diskussion einschalten.
Dr. Alexander Schubert: Genau, Natürlich wird bei uns auch Eduard Snowdon eine Rolle spielen, aber insgesamt doch mit dem Charakter einer unterhaltenden Ausstellung.
SPEYER-KURIER: Ein Musuem soll und will ja auch immer ein Ort für andere Künste sein – außerhalb von Archäologie, Kultur- und Kunstgeschichte. Gibt es auch hier bei Ihnen neben der einen oder anderen Musikveranstaltung der unterschiedlichen Genres von Klassik bis Pop noch weitergehende Ideen zur Nutzung Ihrer Räumlichkeiten?
Dr. Alexander Schubert: Unser Kerngeschäft sind natürlich zuallererst einmal unsere Ausstellungen. Dazu zählen neben den Sonderausstellungen auch die Ertüchtigung und die Modernisierung unserer Dauerausstellungen. Das wird eine wichtige Aufgabe für die nächsten Jahre sein. Dort allerdings, wo es sich mit unseren Kernthemen vereinbaren läßt, wollen wir auch ergänzende Angebote machen. So planen wir perspektivisch eine Schau zu „den Helden der Kinderbücher“ und da das Thema „Lesen“ auch sonst eine große Rolle spielt, wollen wir dort auch noch witere Cross-over-Projekte angehen, Das alles muss aber stets ausgehen von unserem Kerngeschäft.
SPEYER-KURIER; Sie haben es ja zum Teil schon anklingen lassen; dennoch unsere Frage: Auf was dürfen sich die Freunde des Speyerer „Historischen Museums der Pfalz“ in den nächsten Jahren thematisch außerdem freuen?
 Dr.
Alexander Schubert: Die größeren Ausstellungen habe ich ja
schon genannt: Nach der „Titanic“ werden „Detektive, Agenten und
Spione“ in das Museum einziehen, ehe im Jahr darauf die noch von
Herrn Dr. Köhne geplante Ausstellung über die „Maya-Kultur“ gezeigt
wird - gleichfalls ein faszinierendes Thema über eine Hochkultur,
die aufblühte, um dann plötzlich wieder unterzugehen. Dort werden
dann u.a. Exponate aus Mexiko und Guatemala gezeigt, die zuvor noch
nie in Deutschland zu sehen waren.
Dr.
Alexander Schubert: Die größeren Ausstellungen habe ich ja
schon genannt: Nach der „Titanic“ werden „Detektive, Agenten und
Spione“ in das Museum einziehen, ehe im Jahr darauf die noch von
Herrn Dr. Köhne geplante Ausstellung über die „Maya-Kultur“ gezeigt
wird - gleichfalls ein faszinierendes Thema über eine Hochkultur,
die aufblühte, um dann plötzlich wieder unterzugehen. Dort werden
dann u.a. Exponate aus Mexiko und Guatemala gezeigt, die zuvor noch
nie in Deutschland zu sehen waren.
Ja, und eine weiteres Thema, das mir auch ganz persönlich sehr am Herzen liegt, wird im Jahr 2017 die Ausstellung über „Richard Löwenherz“ sein. Das wird wieder eine Ausstellung über eine große europäische Persönlichkeit sein, die wohl jeder schon einmal kennengelernt hat und die zugleich auch Landes-, Regional- und Stadtgeschichte geschrieben hat. Wie Sie wissen, stand Richard Löwenherz nur wenige Meter von hier im Dom vor Gericht und wurde auf dem Trifels gefangen gesetzt. Dieses historische Thema bildet zugleich die Machtverhältnisse zwischen England, Frankreich und dem Heiligen Römischen Reich ab und hat auch Bezüge zur Pfalz. Also ein weiteres Beispiel für große Themen mit einem Bezug zur Pfalz.
SPEYER-KURIER: Lieber Herr Dr. Schubert, bei so vielen konkreten Plänen, gibt es da noch so etwas wie die „geheimen Wünsche“ des neuen Direktors? Ich denke da vielleicht gerade auch an die Finanzausstattung Ihres Hauses.
 Dr. Alexander Schubert: (lacht)...also wenn ich
Ihnen das sagen würde, wären es ja keine Geheimnisse mehr.
Natürlich stehen auch wir hier unter einem gewissen finanziellen
Druck, das ist hier so wie an anderen Häusern auch. Natürlich
wünschen wir uns Planungssicherheit, um das Museum in der
Erfolgsspur zu halten. Immerhin werden Sie in Deutschland keine
Stadt in vergleichbarer Grösse wie Speyer finden, die über ein
solches Museum verfügt, ein Museum, das mit 200.000 bis 300.000
Besuchern in der „ersten Liga“ der deutschen Museen spielt. Und das
zu erreichen und zu erhalten ist alles andere als ein Selbstläufer,
das ist harte Arbeit und auch Geschick aller meiner Vorgänger, die
entsprechende Themen gesetzt und diese tolle Belegschaft hier im
Haus zusammengestellt haben – und nicht zuletzt steht und fällt so
etwas auch mit den finanziellen Möglichkeiten eines Hauses.
Dr. Alexander Schubert: (lacht)...also wenn ich
Ihnen das sagen würde, wären es ja keine Geheimnisse mehr.
Natürlich stehen auch wir hier unter einem gewissen finanziellen
Druck, das ist hier so wie an anderen Häusern auch. Natürlich
wünschen wir uns Planungssicherheit, um das Museum in der
Erfolgsspur zu halten. Immerhin werden Sie in Deutschland keine
Stadt in vergleichbarer Grösse wie Speyer finden, die über ein
solches Museum verfügt, ein Museum, das mit 200.000 bis 300.000
Besuchern in der „ersten Liga“ der deutschen Museen spielt. Und das
zu erreichen und zu erhalten ist alles andere als ein Selbstläufer,
das ist harte Arbeit und auch Geschick aller meiner Vorgänger, die
entsprechende Themen gesetzt und diese tolle Belegschaft hier im
Haus zusammengestellt haben – und nicht zuletzt steht und fällt so
etwas auch mit den finanziellen Möglichkeiten eines Hauses.
SPEYER-KURIER: Abschließend, wie bei diesem Format üblich, jetzt noch einige persönliche Fragen: Was macht Alexander Schubert, wenn er nicht hier im Haus über seine Arbeit brütet? Kurz: Womit verbringen Sie Ihre Freizeit?
Dr. Alexander Schubert: Da schau ich mit großer Begeisterung, aktuell zwar mit Wehmut, die Zweitligaspiele des „TSV 1860 München“ an, auch wenn ich den Verein zur Zeit auf einem Abstiegsplatz sehen muss...
SPEYER-KURIER: Nach unten gibt es ja durchaus noch genug Raum zur „Entfaltung“...
Dr. Alexander Schubert: ...oh ja, aber das sollte man nicht herbeireden. Dann höre ich sehr gerne Rockmusik, wenn's die Zeit erlaubt – das sind so zwei meiner Schwerpunkte. Ich spiele aber auch gerne Squash und interessiere micht aktiv und passiv für vielfältige Sportarten.
SPEYER-KURIER: Gibt es derzeit ein aktuelles Buch, das Sie, außerhalb Ihrer beruflichen Verpflichtungen, gerade lesen?
Dr. Alexander Schubert: Vor kurzem war ich als Zuschauer Gast in Frank Elstners Sendung „Menschen der Woche“, wo auch der Autor Frank Schätzing sein neues Buch „breaking news“ vorstellte. Das steht jetzt weit oben auf meiner Weihnachtswunschliste und vielleicht habe ich Glück und bekomme es geschenkt.
SPEYER-KURIER: Und als drittes: Gibt es für Sie und Ihre Frau besonders beliebte oder bevorzugte Urlaubsreiseziele?
Dr. Alexander Schubert: Ganz klar sind das zwei Ziele: Die Vereinigten Staaten - Karlifornien ganz konkret - wenn sich die zeitliche Möglichkeit dazu bietet, denn nach Kalifornien reist man ja nicht nur wegen drei, vier Tagen – ansonsten Kurzurlaube in der Region, wo wir unter Einbeziehung des Elsass auch gerne ein paar Tage Urlaub in einer Stadt machen.
SPEYER-KURIER: Und nun zuguterletzt: Gibt es in den Sammlungen „Ihres“ neuen Museums schon so etwas wie ein „Lieblingsexponat“, zu dem es Sie immer wieder hinzieht?
 Dr.
Alexander Schubert: Also, es ist tatsächlich sehr
schwerig, hier etwas herauszugreifen, denn – und das ist ja eines
der großen Gütesiegel des Speyerer Museums – dieses Haus ist
angefüllt mit Spitzenexponaten, angefangen vom „Goldenen Hut von
Schifferstadt“ über den „Domschatz“ bis hin zur Darstellung des
Festzuges aufs Hambacher Schloß. Ich bin ja selbst
Mittelalter-Historiker, darum faszinieren mich schon aus der Zeit,
bevor ich hierher kam, speziell der Domschatz, die Kaiserkrone und
der Mantel Philipps von Schwaben. Ich würde jetzt einmal diesen
Mantel herausgreifen, weil mir die Könige und Kaiser schon von
meiner Ausbildung her sehr nahe stehen und ich es immer toll fand,
dass man hier ein Königsgewand in seinen Beständen hat.
Dr.
Alexander Schubert: Also, es ist tatsächlich sehr
schwerig, hier etwas herauszugreifen, denn – und das ist ja eines
der großen Gütesiegel des Speyerer Museums – dieses Haus ist
angefüllt mit Spitzenexponaten, angefangen vom „Goldenen Hut von
Schifferstadt“ über den „Domschatz“ bis hin zur Darstellung des
Festzuges aufs Hambacher Schloß. Ich bin ja selbst
Mittelalter-Historiker, darum faszinieren mich schon aus der Zeit,
bevor ich hierher kam, speziell der Domschatz, die Kaiserkrone und
der Mantel Philipps von Schwaben. Ich würde jetzt einmal diesen
Mantel herausgreifen, weil mir die Könige und Kaiser schon von
meiner Ausbildung her sehr nahe stehen und ich es immer toll fand,
dass man hier ein Königsgewand in seinen Beständen hat.
SPEYER-KURIER: Lieber Herr Dr. Schubert, dann dürfen wir uns sehr herzlich für dieses ausführliche Gespräch bedanken und Ihnen für Ihre erste große, selbstverantwortete Ausstellung viel Erfolg und ein „überragendes Publikumsinteresse“ wünschen.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler / Foto: gc
19.12.2014
Interview der Woche
 heute mit
Norbert Schindler MdB
heute mit
Norbert Schindler MdB
Für ein faireres Bild vom Bauern und der Landwirtschaft in der Öffentlichkeit – DBV-Vizepräsident Schindler kündigt Rückzug aus der ersten Reihe der bäuerlichen Standespolitik an.
Für den bekennenden Pfälzer und gelernten Landwirtschaftsmeister Norbert Schindler (64), seit 1994 direkt gewählter Abgeodneter zum Deutschen Bundestag im Wahlkreis Neustadt – Speyer, war der „Deutsche Bauerntag 2014“ in seiner Heimat, in seinem Bad Dürkheim, wohl der Höhepunkt eines langen und vielfältigen standespolitischen Engagements für die Sache der Bauern- und Winzerschaft in Rheinland-Pfalz und in Deutschland. Vizepräsident des „Deutschen Bauernverbandes“, Präsident der „Bauern- und Winzerschaft Rheinland-Pfalz-Süd“ - kaum eine Spitzenposition, die der beliebte Politiker und Standesvertreter nicht erreicht hätte. Am Rande des „Deutschen Bauerntages 2014“ hatte der SPEYER-KURIER trotz aller Hektik dieser Tage Gelegenheit, mit Schindler über seine Gefühle und Erwartungen an diesen „Bauerntag 2014“ zu sprechen.
SPEYER-KURIER: „Deutscher Bauerntag“ und „Landjugendtag 2014“ hier in Bad Dürkheim. Was bedeutet das für Sie als einflussreichen Politiker in der Region und engagierten Verfechter der Interessen der Bauern- und Winzerschaft weit über Ihre nähere Heimat hinaus?
 Norbert
Schindler: Der Abgeordnete Norbert Schindler hat ja
angekündigt, dass er ab Herbst diesen Jahres und bis zum Ablauf
seiner Amtszeit als Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes im
nächsten Jahr vieles von seiner Verantwortung als Agrarier abgeben
wird. Und deshalb wollte ich noch einmal alle meine Freunde aus der
gesamten Bundesrepublik zum letzten Bauerntag einladen, bei dem ich
mit am Präsidiumstisch sitze. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich
als Vizepräsident ausscheiden und es ist ja auch bekannt, dass ich
im September auch als Präsident des Bauern- und Winzerverbandes
Rheinland-Pfalz-Süd aufhören werde.
Norbert
Schindler: Der Abgeordnete Norbert Schindler hat ja
angekündigt, dass er ab Herbst diesen Jahres und bis zum Ablauf
seiner Amtszeit als Vizepräsident des Deutschen Bauernverbandes im
nächsten Jahr vieles von seiner Verantwortung als Agrarier abgeben
wird. Und deshalb wollte ich noch einmal alle meine Freunde aus der
gesamten Bundesrepublik zum letzten Bauerntag einladen, bei dem ich
mit am Präsidiumstisch sitze. Nächstes Jahr um diese Zeit werde ich
als Vizepräsident ausscheiden und es ist ja auch bekannt, dass ich
im September auch als Präsident des Bauern- und Winzerverbandes
Rheinland-Pfalz-Süd aufhören werde.
Dass wir aber in Sachfragen immer wieder neue und aktuelle Themen haben – vom Mindestlohn im Gemüsebau bis zur Reglementierung des Grünlandumbruchs oder zur Düngemittelverordnung – das ist das tägliche Allerlei für uns alle.
Aber auch die Debatte darüber, wie es in Europa künftig weitergehen soll oder die Frage nach der Zukunft des EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz), das sind alles Fragen, in die wir Bauern unmittelbar eingebunden sind. Wir als Bauern sind absolut überzeugte Europäer. Das ist für mich eine der Kernbotschaften, die auch von diesem „Bauerntag“ ausgehen wird – trotz all des Ärgers, den wir im Detail immer wieder mit 'Europa' haben.
Natürlich aber wollen wir auch von hier aus werben für die Nachhaltigkeit unserer Produkte: Wir können heute hier den besten Wein der vergangenen 2000 Jahren anbieten; die „alten“ Römer würden sich ja „totsaufen“, könnten sie diese Genüsse von heute erleben. Und das gilt für so vieles andere auch. Wie hochwertig heute unsere Lebensmittel sind, ist zwar weithin bekannt. Dennoch werden wir von der Gesellschaft kritisch begleitet: „Was tut Ihr denn eigentlich dafür?“, werden wir oft gefragt, weil das Wissen über Erzeugung qualitätvollerLebensmittel heute in den Schulen nicht mehr so kompetent an die Kinder gebracht wird wie vielleicht noch vor fünfzig Jahren. Ich mache mir deshalb schon echt Gedanken darüber, wie wir das ändern können und wie hierzu vielleicht auch die Öffentlichkeitsarbeit unserer Verbände einen wirkungsvolleren Beitrag leisten kann und wie eine neutrale Berichterstattung auch wieder in die Schulen und in große Teile unserer Medien gelangen könnte. Das ist für ich die Sorge der Zukunft.
SPEYER-KURIER: Eines der beherrschenden Themen dieser Tage von Bad Dürkheim: Der Gesetzliche Mindestlohn. Das ist ja gerade bei uns in der Pfalz mit ihrem großen Anteil an Sonderkulturanbau ein wichtiges Thema. Wie ist da Ihre Meinung dazu?
 Norbert
Schindler: Hierzu gibt es ja eine klare Position
unsererseits: Wer Mindestlohn jetzt ohne Brücken und
Sonderregelungen einführt, wie es ja auch Frau Dreyer heute hier in
Bad Dürkheim noch einmal wiederholt hat, der nimmt in Kauf, dass
bestimmte Produkte in der Pfalz und in Deutschland insgesamt nicht
mehr angebaut werden können. Dann wird auch einiges passieren – von
der Kirsche angefangen bis zu anderen Obstbaumarten. Und wenn dann
unsere Nachbarländer dann andere Mindestlohngrenzen haben, dann
wird künftig nur noch verglichen: Hoher Mindestlohn für die
saisonalen Arbeitskräfte hier, niedrigere Löhne dort – wenn dann
die Transportkosten stimmen, dann können wir unsere Obstbäume
abhacken.
Norbert
Schindler: Hierzu gibt es ja eine klare Position
unsererseits: Wer Mindestlohn jetzt ohne Brücken und
Sonderregelungen einführt, wie es ja auch Frau Dreyer heute hier in
Bad Dürkheim noch einmal wiederholt hat, der nimmt in Kauf, dass
bestimmte Produkte in der Pfalz und in Deutschland insgesamt nicht
mehr angebaut werden können. Dann wird auch einiges passieren – von
der Kirsche angefangen bis zu anderen Obstbaumarten. Und wenn dann
unsere Nachbarländer dann andere Mindestlohngrenzen haben, dann
wird künftig nur noch verglichen: Hoher Mindestlohn für die
saisonalen Arbeitskräfte hier, niedrigere Löhne dort – wenn dann
die Transportkosten stimmen, dann können wir unsere Obstbäume
abhacken.
Ich persönlich bin für einen Mindestlohn. Aber es muss gerade in den Bereichen, in denen wir mit diesen Arbeitskräften den sozialen Bereich der Bundesrepublik Deutschland nicht berühren – also Tätigkeiten bis zu acht Wochen, dann geht man wieder nach Hause – Sonderregelungen geben. Dass wir hier eine Sonderregelung bekommen, die den Arbeitskräften, die zum Teil über mehr als 800 Kilometer zu uns anreisen, einen Anreiz gibt, das ist richtig. Man muss aber andererseits auch unseren Bauern eine Möglichkeit geben, für eine Übergangszeit von fünf, sechs Jahren eine Sonderregelung in Anspruch zu nehmen, weil die betreffenden Arbeitskräfte nicht dauerhaft in unser soziales System eintreten.
Auch für den Normalbeschäftigten in der Landwirtschaft – und dazu stehe ich ausdrücklich – muss der Mindestlohn gelten. Dazu haben wir vor einem Jahr einen Tarifvertrag geschlossen und daran haben sich die Bauern inzwischen auch gewöhnt. Dennoch wird es dazu auch in den nächsten zwei, drei Jahren noch Debatten geben. Ich weiß das, weil ich auch schon selbst wiederholt angegriffen worden bin, wenn ich meine Grundhaltung pro Mindestlohn dazu erklärt habe. Aber in diesem saisonalen Bereich – das war schon im Kaiserreich so – muss es eine Sonderregelung geben. Und dazu brauchen wir einen Übergang.
SPEYER-KURIER: Ein Thema, das in diesen Tagen hier gleichfalls zur Sprache kommt, dreht sich um den Einsatz von Düngemitteln, Insektiziden und Pestiziden. Im Verlauf dieser Veranstaltung sind Sie ja auch in der Forschungseinrichtung für solche Mittel bei der BASF in Limburgerhof zu Gast...
 Norbert
Schindler: ...und dazu stehe ich auch ausdrücklich und
lobe es. Natürlich höre ich da gleich wieder: „Landwirtschaft und
Industrie, das ist doch 'eine Bagage'“ Für mich ist das schlicht
eine Unverschämtheit. Keiner von diesen Wohlstandsbürgern und
Gutmenschen weiß oder will es zumindest nicht zur Kenntnis nehmen,
dass mit Hilfe der Forschung gerade in der Medizin und in der
Chemie der Mensch inzwischen im Durchschnitt zwischen 80 und 85
Jahren alt wird.
Norbert
Schindler: ...und dazu stehe ich auch ausdrücklich und
lobe es. Natürlich höre ich da gleich wieder: „Landwirtschaft und
Industrie, das ist doch 'eine Bagage'“ Für mich ist das schlicht
eine Unverschämtheit. Keiner von diesen Wohlstandsbürgern und
Gutmenschen weiß oder will es zumindest nicht zur Kenntnis nehmen,
dass mit Hilfe der Forschung gerade in der Medizin und in der
Chemie der Mensch inzwischen im Durchschnitt zwischen 80 und 85
Jahren alt wird.
Nein - wir erzeugen in Deutschland die besten und nachgewiesenermaßen die gesündesten Lebensmittel. Wir haben einen kaum noch zu steigernden, hohen technischen Standard beim Einbringen von Dünger, quasi dem 'Futter' für die Pflanzen. Und wie sensibel wir vorgehen beim Ausbringen von Dünger, Pestziden und Insektiziden – das sind ja ihrerseits ganz schlimme Begriffe für 'Otto Normalverbraucher' – wie gezielt und damit trinkwasserschonend wir dabei vorgehen – das gab es – ich nenne nur das Beispiel Nitrate - vor vierzig, fünfzig Jahren so noch nicht. Es ist deshalb die Debatte von heute, in der uns die Sünden der Vergangenheit einholen. Doch das ist m.E. gegenüber den Akteuren von heute ungerecht und gerade deshalb müssen wir uns fragen, ob wir uns so unfifferenzierte Vorwürfe, die im Ergebnis auch ins Eigentum eingreifen können, gefallen lassen wollen.
SPEYER-KURIER: Herr Schindler, welche Botschaft soll denn vom „Bauerntag 2014“ in Bad Dürkheim ausgehen?
 Norbert
Schindler: Also, wir sollten fairer miteinander umgehen.
Das Bild des Bauern – und das sage ich jetzt als Vertreter des
Bauernverbandes – ist anders als das, das man so oft in der
veröffentlichten Meinung vorfindet, wo man 'Ackerbau und Viehzucht'
so gerne mit einer „heilen Welt“ verbindet - mit der lila Kuh auf
der Schokoladenpackung - wo man es am liebsten hätte, wenn die
Bauern noch mit Sense und Sichel zu Werke gingen, während man
selbst für seine eigene Arbeit zum Laptop greift und mit 'Navi' im
klimatisierten Automobil fährt.
Norbert
Schindler: Also, wir sollten fairer miteinander umgehen.
Das Bild des Bauern – und das sage ich jetzt als Vertreter des
Bauernverbandes – ist anders als das, das man so oft in der
veröffentlichten Meinung vorfindet, wo man 'Ackerbau und Viehzucht'
so gerne mit einer „heilen Welt“ verbindet - mit der lila Kuh auf
der Schokoladenpackung - wo man es am liebsten hätte, wenn die
Bauern noch mit Sense und Sichel zu Werke gingen, während man
selbst für seine eigene Arbeit zum Laptop greift und mit 'Navi' im
klimatisierten Automobil fährt.
Dass man da wieder ein Stück weit zueinander findet und dass auch große, marktbeherrschende Zeitungen auch in Rheinland-Pfalz begreifen, wie bei uns die Landwirtschaft hohe Produktivität und günstige Preise der Lebensmittel zum Vorteil der Verbraucher miteinander vereinen und über diesen Zusammenhang objektiv berichten – wenn das gelingen würde, dann wäre unsere, dann wäre meine Botschaft angekommen.
SPEYER-KURIER: Dann bleibt uns nur, Ihnen und Ihren Berufskollegen zu wünschen, dass sie mit dieser Botschaft erfolgreich sind.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler/ Fotos: tw.
29.06.2014
Pfarrer Grimm aus Hüfingen zum Fronleichnamfest
 „Wünsche
mir, dass offener auf Jugendliche zugegangen wird“
„Wünsche
mir, dass offener auf Jugendliche zugegangen wird“
Seit 2008 ist der katholische Pfarrer Manuel Grimm in der St. Verena und Gallus Gemeinde in Hüfingen im Schwarzwald-Baar Kreis tätig. Bereits während seiner Zeit als Vikar in Karlsruhe und Rheinfelden lag ihm das Thema Jugendarbeit besonders am Herzen. Darin sieht er eine große Chance, die Jugendlichen wieder für die Kirche zu begeistern.
SPEYER-KURIER Mitarbeiterin Jana Volk hat sich mit ihm im Interview über junge Menschen, Christ sein und Glauben in einem modernen Alltag unterhalten.
Speyer-Kurier: Herr Pfarrer Grimm, junge Menschen möchten sich vor allem frei und ohne Zwänge entfalten, trotzdem sind sie auf der Suche nach Spiritualität.
Steht die traditionelle Kirche mit ihren vielen Vorschriften diesem Wunsch nicht entgegen?
Pfarrer Manuel Grimm: Zunächst einmal muss man die entsprechenden Vorschriften genau beleuchten und die verschiedenen Ebenen hinterfragen. Wenn ich einmal ein Beispiel geben darf: Im Straßenverkehr hat das Stoppschild eine andere Qualität als ein Vorfahrtzeichen. Und wer ist nicht schon einmal über eine Kreuzung gefahren ohne vorher anzuhalten?
Vielleicht muss man aber bei manchen Ge- und Verboten den tieferen Sinn hinterfragen. Im Nachhinein stellt man oft fest, dass diese durchaus ihre Berechtigung haben.
Ich habe aber den Eindruck, dass Vorschriften manchmal weniger eine Rolle spielen, als vielmehr die Frage, wie man Kirche vor Ort vermittelt bekommt.
Speyer-Kurier: Der Sohn oder die Tochter möchte auf einmal nicht mehr mit zum Gottesdienst kommen. Wie reagiert man als Eltern am besten darauf?
Pfarrer Manuel Grimm: Am besten ganz gelassen bleiben und keinesfalls Druck ausüben. Wenn Eltern einen religiösen Bezug haben, überträgt sich das meistens auch auf die Kinder. Und dadurch, dass die Eltern den Gottesdienst besuchen, machen sie durch ihre Vorbildfunktion deutlich, dass dieser bei ihnen einen hohen Stellenwert einnimmt. Oft kommen die Jugendlichen nach einer gewissen Zeit dann auch von selbst wieder darauf zurück. Ganz hilfreich ist es, miteinander im Gespräch zu bleiben.
Speyer-Kurier: An den großen Feiertagen wie Weihnachten und Ostern sind die Kirchen dann aber meistens bis auf den letzten Platz besetzt.
Sehen Sie die sogenannten „Feiertags-Christen“ eher kritisch?
 Pfarrer Manuel
Grimm: Die Gottesdienstbesucher, die jeden Sonntag zur Messe
kommen, gibt es, bedingt durch die Zusammenlegung von Gemeinden,
fast nicht mehr. Ich freue mich über jeden, der in die Kirche kommt
– selbst wenn das vielleicht nur einmal im Jahr an Weihnachten
ist.
Pfarrer Manuel
Grimm: Die Gottesdienstbesucher, die jeden Sonntag zur Messe
kommen, gibt es, bedingt durch die Zusammenlegung von Gemeinden,
fast nicht mehr. Ich freue mich über jeden, der in die Kirche kommt
– selbst wenn das vielleicht nur einmal im Jahr an Weihnachten
ist.
Schöne Erfahrungen konnte ich auch mit denjenigen machen, die schon länger nicht mehr in der Kirche waren und dann aus einem bestimmten Anlass, beispielsweise einer Beerdigung, wieder kamen. Bei mir sind alle Menschen willkommen.
Jugendlichen dagegen fällt es oft schwer, alleine einen Gottesdienst zu besuchen. Der Kindergottesdienst ist für diese Altersgruppe nicht mehr geeignet und in der regulären Sonntagsmesse für Erwachsene fühlen sie sich fehl am Platz; es fehlt ihnen oft an dem Gefühl dort willkommen zu sein. Manchen ist vielleicht auch ein Kirchenbesuch vor den Altersgenossen etwas peinlich.
Speyer-Kurier: Viele können mit dem ständig gleichbleibenden Ritus einer Sonntagsmesse und der Predigt wenig anfangen.
Welche Vorteile bietet denn ein festgelegter Ritus?
Pfarrer Manuel Grimm: Rituale sind förderlich. In der Familie geben Rituale wie das Vorlesen von Gute-Nacht Geschichten Sicherheit und Geborgenheit. Menschen, die Yoga oder Meditation machen, kennen ebenfalls bestimmte Rituale.
Dasselbe geschieht im Gottesdienst. Würde jede Sonntagsmesse anders gestaltet werden, gäbe das ziemlich viel Unruhe und würde mich ebenfalls unter Druck setzen. Rituale stützen die Spiritualität. Auch kann man überall auf der Welt einen Gottesdienst besuchen – selbst wenn man die Landessprache nicht versteht, der Ablauf ist derselbe.
Speyer-Kurier: Unter welchen Aspekten bereiten Sie ihre Predigten vor?
Pfarrer Manuel Grimm: Mir sind die Bibelstellen wichtig. Die Einleitung zur Predigt kann auch aus meiner Lebenserfahrung kommen.
Speyer-Kurier: Wäre eine Neuinterpretation der Bibel auf unsere Lebenswirklichkeit eine wünschenswerte Möglichkeit?
Pfarrer Manuel Grimm: Die Bibel wird ohnehin immer mal wieder neu übersetzt. Man darf dabei nicht vergessen, dass die Bibel ja auch eine Dokumentation der damaligen Zeit ist, deshalb muss der ursprüngliche Text als solcher unbedingt erhalten bleiben. Sie zu interpretieren ist Aufgabe der Pfarrer.
Speyer-Kurier: Kann man einer modernen Gesellschaft überhaupt noch den Sinn von Glauben vermitteln?
 Pfarrer Manuel
Grimm: Auf jeden Fall. Dazu gehört auch, andere Meinungen
anzuerkennen, beispielsweise die der Naturwissenschaften, die
ergänzend zu unserer christlichen Wahrnehmung stehen. Gott und
Urknall müssen kein unvereinbarer Widerspruch sein, da sich die
These des Urknalls mit Glaubensinhalten beleuchten lässt. Das
Kernprodukt dabei - und das ist das Wesentliche - ist Gott.
Pfarrer Manuel
Grimm: Auf jeden Fall. Dazu gehört auch, andere Meinungen
anzuerkennen, beispielsweise die der Naturwissenschaften, die
ergänzend zu unserer christlichen Wahrnehmung stehen. Gott und
Urknall müssen kein unvereinbarer Widerspruch sein, da sich die
These des Urknalls mit Glaubensinhalten beleuchten lässt. Das
Kernprodukt dabei - und das ist das Wesentliche - ist Gott.
Speyer-Kurier: Sprechen wir über das Thema Erstkommunion. Einige Eltern sehen es kritisch, dass der Weiße Sonntag bereits im Alter von 10 Jahren gefeiert wird. Können Kinder in diesem Alter den tieferen Sinn dieses großen Festes tatsächlich in vollem Umfang begreifen?
Pfarrer Manuel Grimm: Gegenfrage: Begreifen es denn die Eltern immer? Gerade in einem Alter ab der zweiten Klasse sind die Kinder offen und wissbegierig für alles Neue. Das können neue Sprachen, andere Länder, neue Freunde, neue Lerninhalte sein und natürlich die Fragen nach Religion und Gott.
Speyer-Kurier: Zahlreiche Schulen bieten alternativ das Fach Ethik an.
Wo liegen die konkreten Unterschiede zwischen Ethik und Religion?
Pfarrer Manuel Grimm: Die Grundbasis der Wertevermittlung ist dieselbe. Im Fach Religion kommt jedoch die zusätzliche Komponente des Lehrers hinzu, der den eigenen Standpunkt sowie Traditionen und Erfahrungen vermittelt.
Speyer-Kurier: Spätestens nach der Firmung, wenn die Jugendlichen 14 Jahre alt sind, ist oft Schluss mit den regelmäßigen Besuchen der Gottesdienste.
Welche Möglichkeiten gibt es, um junge Menschen weiterhin für das Thema Kirche zu begeistern?
Pfarrer Manuel Grimm: Hier in Hüfingen haben wir die Katholische Junge Gemeinde und die Ministranten. Gerade die Kinder und Jugendlichen, die dort mit dabei sind, bleiben meist auch später der Kirche verbunden.
Speyer-Kurier: Durch diese Aktivitäten werden unter anderem die Entstehung sozialer Kompetenzen gefördert – wie macht sich das im Alltag bemerkbar?
Pfarrer Manuel Grimm: Wir sprechen hier von zwei verschiedenen Ebenen. Die eine Ebene, in der die Kinder Mitglied in einer dieser Gruppen sind, spricht die Sozialkompetenz an. Das Kind fügt sich in eine Gruppe ein, lernt selbstständiger zu werden, sich zu orientieren, Kontakte zu knüpfen.
Die andere Ebene ist die der Gruppenleiter, die mit ihrem Handeln soziale Verantwortung für andere übernehmen,
Speyer-Kurier: Christ sein und sich für etwas einzusetzen also eine moderne und richtig „coole“ Angelegenheit und zu dem eine Investition in die Zukunft?
Pfarrer Manuel Grimm: Auf jeden Fall, da Eigenschaften wie Empathie, Teamgeist und Selbstständigkeit gefördert werden, die wir im täglichen Miteinander und im Berufsleben brauchen. Immer mehr Firmen legen überdies Wert auf Auszubildende, die bereits schon in ihrer Freizeit gelernt haben, Verantwortung zu übernehmen.
Speyer-Kurier: Die modernen Medien haben unterdessen auf nahezu allen Ebenen Einzug gehalten.
Wie sehen Sie die neuen Medien bzw. die sozialen Netzwerke? Könnte die Kirche in diesen Netzwerken ebenfalls aktiv werden und auf diesem Weg versuchen, mehr junge Leute für das Thema Kirche zu gewinnen?
 Pfarrer Manuel
Grimm: Das Interesse an der Vernetzung bedeutet ja im Grunde
genommen nichts anderes als die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Doch
die digitale Kommunikation hat den Nachteil, dass man seinen
Gegenüber nicht sehen kann. Nicht immer werden SMS und E-mails
richtig interpretiert.
Pfarrer Manuel
Grimm: Das Interesse an der Vernetzung bedeutet ja im Grunde
genommen nichts anderes als die Sehnsucht nach Gemeinschaft. Doch
die digitale Kommunikation hat den Nachteil, dass man seinen
Gegenüber nicht sehen kann. Nicht immer werden SMS und E-mails
richtig interpretiert.
Und ja, wir könnten als Kirche im Netz aktiv sein, jedoch immer mit dem Ziel der Hinführung, der Begegnung mit der echten Gemeinschaft. Die Begegnung mit dem realen Menschen muss deshalb stets im Vordergrund stehen.
Speyer-Kurier: Durch diese neuen Medien sind wir auch mitteilungsfreudiger geworden. Sehr freizügig werden dort private Dinge in aller Öffentlichkeit ausgeplaudert. Bei religiösen Themen herrscht aber eher„Funkstille“.
Woran liegt das?
Pfarrer Manuel Grimm: Die Kommunikation im Internet spiegelt ja immer eine gewisse Aktualität wieder. Um jedoch über Glaubensdinge zu reden, braucht es einen gewissen Rahmen, einen sicheren Rückzugsort. Sie sind tief im Inneren eines jeden verankert und unterscheiden sich doch stark von den alltäglichen Unterhaltungen. Aber auf Jugendfreizeiten, wenn alle bei einem abendlichen Lagerfeuer zusammensitzen, werden diese Themen durchaus angesprochen.
Speyer-Kurier: Feiern, Party machen und auch ab und zu etwas über die Stränge schlagen. Ist so etwas überhaupt mit dem „Christ sein“ vereinbar?
Pfarrer Manuel Grimm: (lacht) Für die Jugendlichen ist das durchaus vereinbar.
Speyer-Kurier: Wünschen Sie sich mehr Engagement der Jugend in der Gemeinde.
Pfarrer Manuel Grimm: Das Wort Engagement gefällt mir in diesem Zusammenhang nicht, hört es sich doch zu sehr nach Leistungsdenken an. Schön ist es, wenn die Jugendlichen ihre eigene Persönlichkeit einbringen. Unsere KJG hat in diesem Jahr in Eigenregie ein Projekt zur Teilnahme des Blumenlegens für den Fronleichnamsteppich initiiert. Darüber freue ich mich sehr.
Speyer-Kurier: Christ sein im Alltag. Können Sie das an einem konkreten Beispiel erklären?
Pfarrer Manuel Grimm: Da sind zum einen familiäre Werte – seine Kinder taufen lassen, Kindererziehung, Familie, Geborgenheit. Einfach das füreinander da sein. Zum anderen sind es oftmals ganz bestimmte Talente, die zum Wohle der Allgemeinheit eingesetzt werden. Das kann auch die Kandidatur für den Gemeinderat sein, um sich für mehr Gerechtigkeit und für ein besseres Miteinander einzusetzen.
Speyer-Kurier: Nicht nur junge Menschen beklagen vor allem die mangelnde Toleranz der Kirche gegenüber homosexuellen Paaren, Paare die vor der Hochzeit schon zusammen leben sowie den wiederverheirateten Geschiedenen.
Der Wunsch nach mehr Aktualität der Kirche – ist er berechtigt oder sind wir auf dem besten Weg zu einem „weichgespülten Glauben“, in dem die Bibel je nach Wunsch der Gläubigen ausgelegt wird?
 Pfarrer Manuel
Grimm: Eine Aussage dazu, was richtig oder falsch ist, ist
schwierig, weil ich jetzt urteilen müsste und das möchte ich nicht.
Schön wäre es, wenn das Schema des Schwarz-Weiß Denkens beendet
würde. Unsere Alltagssituation hat sich geändert. Lebensplanungen
und Ehen zerbrechen. Umso wichtiger ist es, dass man den Gläubigen
als Menschen begegnet.
Pfarrer Manuel
Grimm: Eine Aussage dazu, was richtig oder falsch ist, ist
schwierig, weil ich jetzt urteilen müsste und das möchte ich nicht.
Schön wäre es, wenn das Schema des Schwarz-Weiß Denkens beendet
würde. Unsere Alltagssituation hat sich geändert. Lebensplanungen
und Ehen zerbrechen. Umso wichtiger ist es, dass man den Gläubigen
als Menschen begegnet.
Beim Thema um die wiederverheirateten Geschiedenen wird leider viel zu sehr das Bild vermittelt, dass bei ihnen nur die Erlaubnis zur Teilnahme an der Kommunion im Vordergrund steht. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass sie zunächst jemanden brauchen, der ihnen zuhört, ihre Geschichte hören will. Wobei sicherlich das Urteil, nicht an der Kommunion teilnehmen zu dürfen, etwas ist, das sehr schmerzt.
Speyer-Kurier: Ist der Glaube ein Geschenk oder etwas, das jeden Tag neu erarbeitet werden muss – am Ende vielleicht sogar eine Last?
Pfarrer Manuel Grimm: Der Glaube gehört zum einzelnen Menschen, also ist er ein Geschenk. Wenn man ihn als Last empfindet, scheint etwas negativ besetzt zu sein.
Speyer-Kurier: Der Glaube sucht den Intellekt. Da dürfen dann auch Zweifel, Nachfragen und Nachdenken nicht fehlen, gerade wenn es um Leid, Elend und Gewalt geht.
Pfarrer Manuel Grimm: Es gibt Momente im Leben, bei denen der Glaube sozusagen auf den Prüfstand gestellt wird. Das ist mit Sicherheit nicht leicht auszuhalten. Und doch haben mir Menschen von Ausnahmesituationen erzählt, in denen sie trotz ihrer großen Verzweiflung eine große Kraft in sich gespürt haben.
Speyer-Kurier: Sowohl die katholische wie auch die evangelische Kirche verzeichnen momentan eine große Anzahl an Kirchenaustritten, die mit Frust und Resignation begründet werden.
Was sagen Sie diesen Menschen?
Pfarrer Manuel Grimm: Der Kirchenaustritt ist sicher keine gute Lösung. Besser ist es, miteinander ins Gespräch zu kommen und eine konstruktive Kritik einzubringen. Dieser Dialog würde allen gut tun.
Speyer-Kurier: Die Abschaffung des Zölibats, Frauen im Priesteramt – sind solche „Modernisierungen“ wirklich geeignet, um dem Priestermangel entgegenzuwirken?
Pfarrer Manuel Grimm: Nein, nicht wirklich. Die Abschaffung des Zölibats würde aus meiner Sicht nur kurzfristig mehr Bewerber für das Priesteramt ansprechen.
Speyer-Kurier: Papst Franziskus gilt als Hoffnungsträger für eine weltoffene und moderne Kirche. In welchen Bereichen dürfen wir auf grundlegende Reformen hoffen, wo gibt es Grenzen?
 Pfarrer Manuel
Grimm: Papst Franziskus geht die Probleme der Kirche aus
einem etwas anderen Blickwinkel an. Er urteilt nicht, er wertet
nicht, sondern er hört zu. Sein Ziel ist eine hörende Kirche, eine
Kirche der Barmherzigkeit und der Mitmenschlichkeit. Dazu gehört
das Zugehen auf Menschen mit all ihrer Unterschiedlichkeit, der
Blick nach außen und vor allem ein achtsamer Umgang im
Miteinander
Pfarrer Manuel
Grimm: Papst Franziskus geht die Probleme der Kirche aus
einem etwas anderen Blickwinkel an. Er urteilt nicht, er wertet
nicht, sondern er hört zu. Sein Ziel ist eine hörende Kirche, eine
Kirche der Barmherzigkeit und der Mitmenschlichkeit. Dazu gehört
das Zugehen auf Menschen mit all ihrer Unterschiedlichkeit, der
Blick nach außen und vor allem ein achtsamer Umgang im
Miteinander
Mit radikalen Reformen wäre er gezwungen zu urteilen, zu werten. Genau das macht er nicht. Für Kritiker ist dies leider oft genug ein Anlass ihm vorzuwerfen, Problemen aus dem Weg zu gehen. Das Priesteramt für Frauen bleibt vermutlich tabu.
Speyer-Kurier: Zum Abschluss unseres Interviews noch eine Frage: Was wünschen Sie sich für die Zukunft Ihrer Kirche?
Manuel Grimm: Ich wünsche mir, dass viel mehr offener auf Jugendliche zugegangen wird, als das bisher der Fall ist und dass ihnen mit Wertschätzung und Anerkennung begegnet wird.
Speyer-Kurier: Herr Pfarrer Grimm, hiermit bedanken wir uns auch im Namen unserer Leser für dieses spannende und informative Interview und wünschen Ihnen für die Zukunft alles Gute!
Die Fragen stellte Jana Volk
Fotos: J. Volk
Zur Person
Manuel Grimm wurde 1973 in Pforzheim geboren. Nach dem Abitur entschied er sich für das Priesterseminar und das Theologiestudium in Freiburg.
2003 erfolgte die Priesterweihe. Als Vikar lag sein Wirkungskreis drei Jahre lang in Karlsruhe und zwei Jahre in Rheinfelden. Seit 2008 ist er Pfarrer der St. Verena und Gallus Gemeinde in Hüfingen.
Ein Jahr seines Studiums hat Manuel Grimm in Irland verbracht und ist ein begeisterter Fan von Land und Leuten.
Trotz seiner knapp bemessenen Freizeit ist er Mitglied einer Irish-Folk-Rock Band, die den Namen Last Order trägt und zwei Mal im Jahr in Weil am Rhein auftritt. Dort spielt er am liebsten auf seinem Lieblingsinstrument, der Bodhran.
 Der Blumenteppich
in Hüfingen
Der Blumenteppich
in Hüfingen
Gelebte christliche Tradition
Seit 1842 wird in Hüfingen anlässlich des Fronleichnamsfestes einer der wohl aufwändigsten Blumenteppiche der gesamten Region gelegt. Der Bildhauer Franz Xaver Reich brachte die Idee von einer Studienreise nach Italien zurück.
Unzählige Blüten, die erst ca. drei Tage vor dem sogenannten Herrgottstag in freier Natur gesammelt werden, werden bei Tagesanbruch von der großen Anzahl an Helfern zu prächtigen Motiven gelegt. Wenn die Vegetation es zulässt, kann der Blumenteppich eine Länge von 450 m erreichen.
In diesem Jahr machte jedoch die zu warme Witterung und das späte Pfingstfest einen dicken Strich durch die Rechnung. Zu wenig Material für den großen Teppich lautete das ernüchterte Fazit.
Trotzdem haben die Hüfinger das Beste daraus gemacht. Entlang der Prozessionsstrecke sind an den vier Altären wunderschöne Motive entstanden.
20.06.2014
Zur Kommunalwahl am Sonntag
 Auf einen Kaffee
mit Rechtsanwalt Dennis Peterhans, Spitzenkandidat der FDP in
Speyer
Auf einen Kaffee
mit Rechtsanwalt Dennis Peterhans, Spitzenkandidat der FDP in
Speyer
Auch für die kleineren Parteien in Speyer geht der Wahlkampf so langsam seinem Ende entgegen – noch einmal „eine Runde Prospekte“ in die Briefkästen der Bürgerinnen und Bürger verteilen, dann am Samstag ein letztes mal offensiv Straßenwahlkampf auf dem Wochenmarkt oder am Altpörtel machen – dann sind die Wähler am Zuge. Für den Speyerer Rechtsanwalt und Spitzenkandidat der Speyerer FDP, Dennis Peterhans (36) Gelegenheit, durchzuatmen und sich fit zu machen für die Endrunde des Wahlkampfes und die Erwartungen auf den kommenden Sonntag einzurichten.
Der SPEYER-KURIER traf Dennis Peterhans an einem seiner Lieblingsorte seiner Vaterstadt, im Domgarten.
SPEYER-KURIER: Herr Peterhans, der Wahlkampf neigt sich seinem Ende zu. Was sind denn Ihre Erfahrungen? Welches waren die wichtigsten Themen, über die Sie, gestützt auf das Wahlprogramm der Speyerer FDP, mit den Menschen in der Stadt vorrangig ins Gespräch kommen konnten? Welche Themen haben die Speyerer am meisten interessiert?
Dennis Peterhans: Das wichtigste Thema war eindeutig die Haushaltspolitik und dass sich die Stadt nicht „totsparen“ darf. Natürlich ist Sparen ein ganz wichtiger Aspekt – wir waren uns aber mit den Bürgerinnen und Bürgern einig, dass man verstärkt auch auf die Einnahmenseite blicken sollte. So sollte zukünftig wieder verstärkt der alte Grundsatz gelten: „Wer bestellt, bezahlt“ – sprich: wenn Bund oder Land Aufgaben auf die Kommunen überwälzen und dafür Gelder bereitstellen, dann müssen diese Gelder auch dort ankommen, wo sie hingehören.
SPEYER-KURIER: ...also all das, was man mit dem Stichwort „Konnexitäts-Prinzip“ verbindet. Können Sie dazu konkrete Beispiele nennen?
 Dennis
Peterhans: Ich denke da vor allem an die Bereitstellung
von kostenfreien KiTa-Plätzen, was zur Aufgabe der Kommunen gemacht
wurde. Das mag vom Ansatz her eine schöne Sache sein; aber hierfür
werden auch in erheblichem Umfang Gelder gebraucht, die zwar vom
Bund bereitsgestellt werden, die aber regelmäßig im Landessäckel
verschwinden. Bekanntlich überlegt ja deshalb Neustadt derzeit,
Klage gegen dieses Verhalten des Landes einzureichen, und wir, die
Speyerer FDP, denken, dass dies auch ein Weg für Speyer sein
sollte.
Dennis
Peterhans: Ich denke da vor allem an die Bereitstellung
von kostenfreien KiTa-Plätzen, was zur Aufgabe der Kommunen gemacht
wurde. Das mag vom Ansatz her eine schöne Sache sein; aber hierfür
werden auch in erheblichem Umfang Gelder gebraucht, die zwar vom
Bund bereitsgestellt werden, die aber regelmäßig im Landessäckel
verschwinden. Bekanntlich überlegt ja deshalb Neustadt derzeit,
Klage gegen dieses Verhalten des Landes einzureichen, und wir, die
Speyerer FDP, denken, dass dies auch ein Weg für Speyer sein
sollte.
SPEYER-KURIER: In diesem Zusammenhang ist es ja durchaus bemerkenswert, dass sich auch die profilierte SPD-Landrätin Theresia Riedmeier von der „Südlichen Weinstraße“ in die Phalanx der Kläger eingereiht hat. Was ist das denn aus Ihrer Sicht für ein Signal?
Dennis Peterhans: Das ist für uns ein eindeutiges Signal dafür, dass die SPD auf Landesebene Beschlüsse fasst, an die sich dann selbst ihre eigenen Genossen an der kommunalen Basis nicht mehr gebunden fühlen. Vielleicht so etwas wie „Schaufensterpolitik“.
SPEYER-KURIER: Zurück zum „Sparen vor Ort“ - wo sehen Sie denn in der Stadt selbst Möglichkeiten zum Sparen?
Dennis Peterhans: Das beginnt eigentlich schon bei der Vermeidung unnötiger Ausgaben mit so überflüssigen Projekten wie z.B. dem zuletzt erwogenen Bau aufwändiger Parkhäuser für Fahrräder. Da sollte die Stadt ja wiederum „nur“ einen Eigenanteil von 60.000 Euro dazu zahlen. Da denke ich aber, dass so etwas bei einem privaten Investor besser aufgehoben wäre. Denn wenn sich so etwas wirklich rentieren sollte, dann würde das sicher auch ein privater Investor machen. Für eine Stadt ist so etwas aber sicher keine vorrangige Aufgabe.
SPEYER-KURIER: Die FDP in der Stadt war in der Vergangenheit immer eine Partei, die stets ganz besonders penibel „auf das Geld der Stadt“ geschaut hat. Der Stadtrat hat ja zuletzt, auch mit den Stimmen der FDP-Ratsmitglieder, für den Beitritt zum Kommunalen Entschuldungsfonds gestimmt. Sind Sie denn davon überzeugt, dass das Land angesichts einer höchst angespannten eigenen Finanzlage und dem Inkrafttreten der Schuldenbremse am Ende überhaupt noch dazu im Stande sein wird, seinen Anteil an der Entschuldung der Kommunen zu leisten?
 Dennis
Peterhans: Also, ich gehe davon aus, dass das Land das
halten wird, was es dazu versprochen hat; Hier ist es aber auch an
uns, die in diesem Zusammenhang eingegangenen Verpflichtungen zu
erfüllen.
Dennis
Peterhans: Also, ich gehe davon aus, dass das Land das
halten wird, was es dazu versprochen hat; Hier ist es aber auch an
uns, die in diesem Zusammenhang eingegangenen Verpflichtungen zu
erfüllen.
SPEYER-KURIER: In diesem Zusammenhang hat die FDP ja auch Kritik an der Bewirtschaftung frei werdender Personalstellen bei der Stadtverwaltung kritisiert. Um was geht es Ihnen dabei?
Dennis Peterhans: Ja, ich denke da an den Stellenabbau und die zeitweise Sperre für freiwerdende Stellen, wie das auch in Speyer praktiziert wird. Eine „Stellenbremse“ in Analogie zur „Schuldenbremse“ ist ja schön und gut – die Erfahrungen zeigen aber, dass die Mitarbeiter der Stadt bereits jetzt schon an ihrem Limit arbeiten und deshalb ganz erheblich unter Stellenstreichungen und der sechsmonatigen Sperrfrist vor Wiederbesetzungen leiden. Daran leidet dann nämlich die gesamte Qualität der Arbeit.
So ist die Stadt z.B. nicht mehr in der Lage, ihre eigenen Baustellen, die geplant und in der Durchführung begriffen sind, zu überwachen, weil einfach das Personal fehlt. Im Bereich der KiTas werden die ErzieherInnen immer mehr mit Verwaltungsaufgaben belastet, so dass ihnen für ihre eigentliche Aufgabe, Kinder zu erziehen, immer weniger Zeit bleibt. Ich denke, da muss ein Umdenken stattfinden.
SPEYER-KURIER: Bleiben wir noch kurz bei der Bildung: Eine der Kernforderungen Ihrer Partei ist ja die Einführung eines Ganztags-Gymnasiums.
Dennis Peterhans: Ja, zumindest erhoffen wir uns eine Schule mit einer Ganztagsklasse, bzw. einem anderen Ganztagsangebot. Das ist gerade im Zusammenhang mit dem Ruf nach besserer Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein ganz wichtiger Punkt. Ich denke deshalb, wenn hier alle – Lehrer, Eltern und die Politik - an einem Strang ziehen, und das sollte es eine gute Chance geben, das in den nächsten Jahren stemmen zu können.
SPEYER-KURIER: Eines der Anliegen der FDP ist ja traditionell auch die Wirtschaftsförderung:
 Dennis
Peterhans: Ich denke, dass die Wirtschaftsförderung durch
die Stadt zuletzt doch sehr stiefmütterlich behandelt worden ist.
Hier bietet sich dem neuen Wirtschaftsförderer der Stadt deshalb
sicher ein reiches Betätigungsfeld. Wir plädieren jedoch dafür,
u.a. auch durch entsprechende Anreize, den Fokus dieser Bemühungen
vor allem auf die Ansiedlung kleinerer Unternehmen zu richten, die
flächenmäßig keine so großen Ansprüche haben, die aber zusätzliche
Innovationen und Know-How in die Stadt bringen könnten und dann
hier auch ihre Gewerbesteuern zahlen.
Dennis
Peterhans: Ich denke, dass die Wirtschaftsförderung durch
die Stadt zuletzt doch sehr stiefmütterlich behandelt worden ist.
Hier bietet sich dem neuen Wirtschaftsförderer der Stadt deshalb
sicher ein reiches Betätigungsfeld. Wir plädieren jedoch dafür,
u.a. auch durch entsprechende Anreize, den Fokus dieser Bemühungen
vor allem auf die Ansiedlung kleinerer Unternehmen zu richten, die
flächenmäßig keine so großen Ansprüche haben, die aber zusätzliche
Innovationen und Know-How in die Stadt bringen könnten und dann
hier auch ihre Gewerbesteuern zahlen.
Darüber hinaus müsste auch der Versuch unternommen werden, zu mehr Kooperationen mit den Umlandgemeinden zu kommen. Wenn ich an Römerberg oder Dudenhofen denke, dann sehe ich dort vielfältige Möglichkeiten, die über das hinausgehen könnten, dass Speyerer dort wohnen und ihre Kinder in die von Speyer finanzierten Schulen schicken. So etwas könnte für alle Beteiligten ein gutes 'joint-venture' sein.
SPEYER-KURIER: In diesem Wahlkampf hat ja auch das Thema „kostengünstiges Wohnen“ eine erhebliche Rolle gespielt. Wie ist dazu die Einstellung der FDP?
Dennis Peterhans: Da muss man als erstes darauf aufmerksam machen, dass dies primär nicht die Kommunen in der Hand haben. Es is ja keinesfalls so, dass wir da morgen einfach nur einen Ratsbeschluss fassen müssten und dann sind die Mietpreise nur noch halb so hoch. Natürlich hat auch die Stadt bedingt Einfluß, indem man zukünftig z.B. auch einmal versucht, Mischgebiete in Form einer Mischbebauung zu überplanen und so zu einer ausgewogenen Mischung zwischen Ein-, Mehrfamilienhäusern und Geschossbauweise zu kommen. Hier wird man auch nicht umhinkommen, Einrichtungen wie die GEWO mehr in der Verantwortung dabei zu nehmen, den sozialen Wohnungsbau stärker voranzubringen....
SPEYER-KURIER:...die GEWO, die dann darauf verweist, dass es dazu als erstes entsprechender Programme von Bund und Land bedarf und die im übrigen vor allem darauf verweist, dass 'billig bauen' heute sowieso kaum noch geht...
Dennis Peterhans: Das ist absolut richtig. Bauen geht heute nicht mehr billig, weil inzwischen die Standards, gerade was die Energieeffizienz angeht, so hoch gelegt worden sind. Das ist deshalb kein leichtes Unterfangen mehr. Aber ich denke, dass die Stadt auch bei der Vergabe von Grundstücken verstärkt auf die GEWO zugehen kann.
SPEYER-KURIER: Die FDP hat ja in der letzten Ratsperiode in einer Koalition mit CDU und Speyerer Wählergruppe im Rathaus eine Mehrheit gebildet. Wie sehen Sie denn die Rolle Ihrer Partei nach der Wahl am kommenden Sonntag in der nächsten Periode?
 Dennis
Peterhans: Ich sehe die Rolle der FDP als das, was sie
eigentlich schon immer war: Als wichtiges Korrektiv für die großen
Parteien nämlich. Und das ist unabhängig davon zu sehen, ob man die
Mitwirkung in einer Koalition anstrebt, wo man natürlich mehr
Einfluss ausüben kann, oder ob man in der Opposition sitzt. Dieses
Korrektiv wird immer und immer mehr gebraucht werden, und da sehen
wir auch in der Zukunft unsere Verantwortung – gerade wenn es um
die Finanzen, ums Sparen oder ums Geld ausgeben geht.
Dennis
Peterhans: Ich sehe die Rolle der FDP als das, was sie
eigentlich schon immer war: Als wichtiges Korrektiv für die großen
Parteien nämlich. Und das ist unabhängig davon zu sehen, ob man die
Mitwirkung in einer Koalition anstrebt, wo man natürlich mehr
Einfluss ausüben kann, oder ob man in der Opposition sitzt. Dieses
Korrektiv wird immer und immer mehr gebraucht werden, und da sehen
wir auch in der Zukunft unsere Verantwortung – gerade wenn es um
die Finanzen, ums Sparen oder ums Geld ausgeben geht.
SPEYER-KURIER: Ein anderes Thema, das im Wahlkampf zeitweise alle anderen zu überlagern schien, heißt „fahrradfreundliche Stadt“, heißt „Fahrrad-Stadt Speyer“. Wie ist da die Position der Speyerer FDP und halten Sie es denn für möglich, die Stadt in eine „Fahrrad-Stadt“ umzubauen?
Dennis Peterhans: Da bin auch ich der Meinung, dass sichere und gut ausgebaute Fahrradwege ein sehr wichtiger Punkt sind. Ich bin auch selbst sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs und da ist es manchmal schon sehr erschreckend, wenn man über Radwege fährt, von denen man denkt, dass man sie eigentlich nicht einmal zu Fuss benutzen sollte. Es muss hier deshalb der Fokus darauf gerichtet werden, die Sicherheit zu schaffen, die zum Radfahren notwendig ist.
Wir halten als FDP im übrigen auch nichts davon, den kompletten Innenstadtbereich in eine einzige Fahrradzone umzuwidmen und dafür den Automobilverkehr ganz oder zumindest weitgehend aus der Innenstadt zu verbannen.Gott sei Dank verfügen wir ja gerade rund um die Maximilianstraße über einen florierenden Einzelhandel. Das ist ein wichtiges Gut, das wir uns so auch erhalten sollten. Deshalb würde sich Speyer sicher keinen Gefallen tun, wenn es die ganze Innenstadt so umgestalten würde, dass z.B. ältere Menschen, die nicht mehr mit dem Rad unterwegs sein wollen, ihre Einkäufe nicht mehr von einem Parkplatz in der Nähe der Hauptstraße aus mit dem Auto nach Hause transportieren könnten.
Zur „Fahrradstadt Speyer“: Da fällt mir, wie so vielen anderen auch, die gerne so apostrophierte „Fahrradstadt Münster“ ein mit ihren unheimlich vielen Studenten, die hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich denke, das ist zwar eine schöne Idee - das werden wir aber so in Speyer nie hinbekommen, um so mehr als Münster über ein völlig anderes Straßennetz und eine andere Topografie verfügt. Im übrigen ist auch das sicher keine Sache, die man einfach so politisch dekretieren kann - „von morgen an sind wir eine Fahrradstadt“ - sondern ich denke, dass auch das eine über Jahrzehnte gewachsene Sache sein muss.
SPEYER-KURIER: Im Zusammenhang mit der Aufstellung der Kandidatenliste hat die Speyerer FDP ja einen Initiativantrag beschlossen, wonach die Stadt künftig in der Frage „Erhalt von Bäumen“ anders vorgehen soll. Was war der Hintergrund dieses Antrags und wohin zielt die Partei damit?
 Dennis
Peterhans: Dieser Beschluss kam direkt aus der Mitte der
Partei zustande und man merkte, dass es da bei unseren Mitgliedern
ein überaus wichtiges Anliegen war, dass bei der Frage, ob ein Baum
gefällt werden darf, mehr Bürgerbeteiligung gefragt sein sollte.
Offensichtlich haben viele Bürger den Eindruck, dass in Speyer
viele Bäume unnötigerweise gefällt werden und die Aufholzung nicht
in dem Maße stattfindet, wie man uns immer wieder glauben zu machen
versucht. Von daher stellen wir die Forderung, dass zukünftig vor
Baumfällarbeiten noch ein eigenes Kontrollgremium solche Maßnahmen
überprüfen sollte. Das könnte z.B. auch ein Unterausschuss des
Umweltausschusses sein. Natürlich bedeutet das nicht, dass „bei
Gefahr im Verzug“ nicht auch sofort gehandelt werden darf. Aber
auch da müsste hinterher Rechenschaft abgelegt und eine
Wiederaufforstung konsequenter betrieben werden. Und noch eines:
Ein absolutes „No-Go“ für uns ist die Forderung, den Auwald noch
weitergehend wirtschaftlich zu nutzen. Das ist eine der wenigen
Oasen, die wir in Speyer und der Umgebung noch haben und die
sollten wir uns unter allen Umständen erhalten.
Dennis
Peterhans: Dieser Beschluss kam direkt aus der Mitte der
Partei zustande und man merkte, dass es da bei unseren Mitgliedern
ein überaus wichtiges Anliegen war, dass bei der Frage, ob ein Baum
gefällt werden darf, mehr Bürgerbeteiligung gefragt sein sollte.
Offensichtlich haben viele Bürger den Eindruck, dass in Speyer
viele Bäume unnötigerweise gefällt werden und die Aufholzung nicht
in dem Maße stattfindet, wie man uns immer wieder glauben zu machen
versucht. Von daher stellen wir die Forderung, dass zukünftig vor
Baumfällarbeiten noch ein eigenes Kontrollgremium solche Maßnahmen
überprüfen sollte. Das könnte z.B. auch ein Unterausschuss des
Umweltausschusses sein. Natürlich bedeutet das nicht, dass „bei
Gefahr im Verzug“ nicht auch sofort gehandelt werden darf. Aber
auch da müsste hinterher Rechenschaft abgelegt und eine
Wiederaufforstung konsequenter betrieben werden. Und noch eines:
Ein absolutes „No-Go“ für uns ist die Forderung, den Auwald noch
weitergehend wirtschaftlich zu nutzen. Das ist eine der wenigen
Oasen, die wir in Speyer und der Umgebung noch haben und die
sollten wir uns unter allen Umständen erhalten.
SPEYER-KURIER: Herr Peterhans, das Ehrenamt hat in den Äußerungen der Liberalen in der Vergangenheit immer eine große Rolle gespielt. Wie ist da heute die Haltung des Spitzenkandidaten zu dieser Frage?
Dennis Peterhans: Ich bin mir mit allen Bürgerinnen und Bürger einig, die davon überzeugt sind, dass unser Gemeinwesen ohne Menschen, die sich im Ehrenamt engagieren, nicht lebensfähig wäre. Das bedeutet aber auch, dass man das Ehrenamt auch selbst leben muss; ich weiß aus eigener Erfahrung: Es macht Spaß und es lohnt sich auch, sich im Ehrenamt zu engagieren. Wie Sie wissen, bin ich schon seit längerem im Verkehrsverein Speyer aktiv und organisiere und leite gemeinsam mit meinem Freund Mike Oehlmann den Großen Brezelfestumzug, was in jedem Jahr eine echte Herausforderung darstellt. Daneben bewirte ich im Wechsel mit Freunden eine Pfälzerwald-Hütte, weil sonst auch der Hüttenbetrieb aussterben würde. Und schließlich bin ich seit einiger Zeit im „Reitclub Speyer“ engagiert und stehe da gerne mit Rat und Tat zur Verfügung.
SPEYER-KURIER: Mit dieser Stadtratswahl vollzieht sich bei der Speyerer FDP ja so etwas wie ein Generationswechsel. Die bisherigen Ratsmitglieder ziehen sich zurück und machen Platz für junge aus Ihrer Generation.
Dennis Peterhans: Also die Leute, die hinter mir auf der Liste stehen, sind eigentlich so ganz neu nicht. Die sind durchweg schon viele Jahre bei der FDP dabei und aktiv und sind mit den Problemen in der Stadt durchaus vertraut. Ich bin froh und dankbar darüber, dass insgesamt ein Umdenken stattgefunden hat, sodass jetzt im vorderen Bereich ein junges Team steht, von dem ich denke, dass wir bei der Wahl eine gute Chance haben und in den nächsten Jahren eine gute Arbeit leisten können, wobei wir auch gerne immer wieder auf die Erfahrungen unserer „alten Hasen“ zurückgreifen, die uns mit ihrem Sachverstand auch künftig eine wertvolle Stütze sein werden.
SPEYER-KURIER: Wie sind Ihre konkreten Erwartungen an den Ausgang der Wahlen am kommenden Sonntag?
 Dennis
Peterhans: Unsere Erwartungen - oder besser gesagt: unsere
Hoffnungen - sind, dass wir wieder mit zwei Mandaten in den
Speyerer Stadtrat zurückkehren werden. Alles, was darüber
hinausgeht, wäre für uns eine Riesenfreude....
Dennis
Peterhans: Unsere Erwartungen - oder besser gesagt: unsere
Hoffnungen - sind, dass wir wieder mit zwei Mandaten in den
Speyerer Stadtrat zurückkehren werden. Alles, was darüber
hinausgeht, wäre für uns eine Riesenfreude....
SPEYER-KURIER: ..und für die Europawahlen?
Dennis Peterhans: Für die Europawahlen bin ich zuversichtlich, dass die FDP mit einem respektablen Ergebnis – vielleicht etwas unter dem der letzten Wahl – in das Parlament einziehen wird.
SPEYER-KURIER: Dann wünschen wir Ihnen wie allen Bewerbern um ein Mandat, dass sie am Sonntag abend (oder wann immer das Wahlergebnis vorliegt) Grund zur Freude haben. Herr Peterhans, vielen Dank für dieses Gespräch.
Das Interview führte Gerhard Cantzler/ Fotos: gc
23.05.2014
SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi im Gespräch
 Europawahlen, Ukrainekrise und die Arbeitssicherheit in
der Türkei
Europawahlen, Ukrainekrise und die Arbeitssicherheit in
der Türkei
SPEYER-KURIER: Frau Fahimi, was spricht denn eigentlich dafür, am 25. Mai zur Europawahl zu gehen?
Yasmin Fahimi: Wir können diesesmal mit der Wahl des Spitzenkandidaten erstmals mitentscheiden, welchen Impuls für die Zukunft wir setzen wollen. Martin Schulz, der Spitzenkandidat der SPD für Wahl zum EU-Kommissions-Vorsitzenden, steht dafür, dass die Banken an die Leine genommen und die Steueroasen ausgetrocknet werden und dass wir die Jugendarbeitslosigkeit in Europa ernsthaft bekämpfen. Dazu, so finde ich, hat er ein paar tolle Ideen vorgelegt. Vor allem aber ist Martin Schulz ein überzeugender Wahlkämpfer, der in seinem Dorf bei Aachen sehr bodenständig geblieben ist, aber auf der anderen Seite ein großartiger Europäer ist, der sich im Brüsseler „Geschäft“ bestens auskennt – einen besseren Kandidaten kann man deshalb nicht haben.
SPEYER-KURIER: Glauben Sie denn, dass die europäische Bankenkrise, die man so gerne in eine europäische Schuldenkrise umgemünzt hätte, inzwischen geregelt ist?
Yasmin Fahimi: Nein, das ist alles andere als geregelt – da ist noch viel zu tun. Wir müssen einerseits Sicherheiten schaffen, damit die Steuerzahler – also wir alle – nicht wieder dafür aufkommen müssen, was die Banken an Spekulationsgeschäften betreiben und sich damit selber in den Ruin treiben – d.h., es wird auf europäischer Ebene einen Fonds geben müssen, mit dem die Banken sich gegenseitig absichern gegen die Pleiten und nicht wieder der Steuerzahler dafür bezahlen muss.
Zum anderen müssen wir in den Krisenländern eine Haushaltspolitik voranbringen, die eine echte, realistische Entschuldung möglich macht. Dabei müssen wir darauf achten, dass dort natürlich auch Einsparprogramme umgesetzt werden und dass Korruption bekämpft wird. Dazu gehört aber auch, dass diese Länder Luft bekommen müssen für Investitionen in die Zukunft – in die Bildungssysteme, in Arbeitsplätze, in den Aufbau von Branchen und Industrien. Im Moment können sie das nicht, weil sie abgewürgt und immer weiter abgewertet werden durch Rating-Agenturen in den USA – da müssen wir zu einem deutlich anderen Krisenmanagement kommen.
SPEYER-KURIER: Nun überlagert ja derzeit ein aktuelles Problem alle anderen europäischen Krisenszenarien – ich meine die Ukraine-Krise. Was erwarten Sie, wie wird sich das weiterentwickeln?
Yasmin Fahimi: Na ja, wir setzen darauf, dass es Frank-Walter Steinmeier gelingen wird, einen 'runden Tisch' zu initiieren, an den er alle Parteien dieser Krise zusammenbringt. In einer derart spannungsgeladenen Situation wie im Moment kann es nicht darum gehen, zu entscheiden, wer nun 'gut' oder wer 'böse' ist. Jetzt muss es vielmehr darum gehen, alle Parteien, die jetzt den Anspruch erheben, zumindest für Teile des Landes zu sprechen, auch an einen Tisch zu bringen. Wir müssen damit verhindern, dass es zu einem Bürgerkrieg in der Ukraine kommt und deshalb setze ich viel Hoffnung darauf, dass uns die sogenannte „Genf-II-Konferenz“ gelingt, bei der auch Rußland mit an den Tisch und seinen Einfluss geltend machen muss. Darauf setzen wir, und ich denke, dass das im Augenblick auf einem guten Weg ist. Es ist aber dennoch eine hoch-brandgefährliche Situation.
SPEYER-KURIER: Frau Fahimi, eine letzte Frage: Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie zur Zeit die schrecklichen Bilder von der Bergwerkskatastrophe in der Türkei sehen?
Yasmin Fahimi: Das ist ein ganz furchtbares Drama und ich kann den Angehörigen der Toten, die während ihrer harten Arbeit ihr Leben verloren haben, nur mein tiefstes Beileid aussprechen.
Das Schreckliche an diesem Ereignis aber ist, dass sich ja jetzt herausstellt, dass dort tatsächlich nicht dafür gesorgt worden ist, dass es entsprechende Arbeitssicherheit gibt. Wir kennen solche Zustände aus dem Deutschland der 1950er und 60er Jahre und ich weiß, wie sehr Gewerkschaften dafür gekämpft haben, dass Arbeitssicherheit gerade im Bergbau mit oberster Priorität behandelt wird. Das ist in der Türkei leider so noch nicht der Fall und ich kann deshalb gut verstehen, dass die Menschen jetzt dagegen protestieren und aufbegehren, weil es nicht sein darf, dass Arbeit Menschenleben zerstört.
SPEYER-KURIER: Der türkische Ministerpräsident Erdogan wird ja noch vor der Europawahl, am 24. Mai, bei einer großen Wahlkundgebung vor seinen Landsleuten in Deutschland auftreten und dort eine große Rede halten. Wenn Sie Gelegenheit hätten, ihm in diesem Zusammenhang zu begegnen – was würden Sie ihm da sagen?
Yasmin Fahimi: Dann würde ich ihm genau das gleiche sagen: Arbeit darf nicht Menschenleben kosten - und es ist auch Aufgabe des Staates, dafür zu sorgen, dass die Unternehmen und Betriebe dazu verpflichtet werden, auf die Arbeitssicherheit zu achten.
Und ich würde ihm außerdem noch sagen, dass ich mir wünschen würde, dass die Türkei ein Land wird, in dem Pressefreiheit und Meinungsfreiheit mehr geschätzt werden und dass der Ministerpräsident gut beraten wäre, die Proteste gegen ihn nicht als einen persönlichen Angriff gegen ihn zu werten, sondern als den Wunsch nach mehr Freiheit in seinem Land.
SPEYER-KURIER: Frau Fahimi, haben Sie herzlichen Dank für dieses Gespräch.
17.05.2014
Interview der Woche
 heute mit Rebecca Harms, Vorsitzende der „Grünen/
EFA“-Fraktion im Europäischen Parlament.
heute mit Rebecca Harms, Vorsitzende der „Grünen/
EFA“-Fraktion im Europäischen Parlament.
SPEYER-KURIER: Frau Harms, die Ukraine bereitet ja derzeit der Europäischen Union und Ihnen als erklärter einer Freundin dieses Landes und seiner Menschen viel Kopfzerbrechen und schlaflose Nächte. Wie sind aktuell Ihre Prognosen bezüglich der Zukunft dieses Landes?
Rebecca Harms: Da ich mich sehr viel mit der Demokratiebewegung in der Ukraine beschäftigt habe, die eine wirklich starke Bürgerbewegung für Rechtsstaatlichkeit darstellt und ein demokratisches System, das dem Oligarchen-System, das sich dort etabliert hatte, ein Ende machen möchte, glaube ich – selbst wenn es jetzt gerade ganz, ganz schwierig ist – dass man diese Entwicklung nicht mehr aufhalten kann. Es ist deshalb nicht mehr eine Frage des 'Ob', sondern nur noch des 'wann' – wann gibt es diesen Neuaufbruch in der Ukraine. Die Europäische Union hat die Ukraine niemals zu einer Entscheidung gezwungen, welchen Weg sie gehen will. Aber wenn die Menschen dort gefragt werden, wohin sie sich orientieren wollen, nach Paris, Berlin, Warschau oder nach Moskau, dann ist die Antwort völlig klar: Sie möchten zum Westen – die Europäische Union ist für sie attraktiv - gesellschaftlich, politisch, aber auch wirtschaftlich. Und diese Entwicklung ist eingemündet in dieses Assoziierungsabkommen mit der EU.
Und deshalb sind die Europäer jetzt auch richtig aufgestellt, wenn sie sagen: wir wollen den Ukrainern das Selbstbestimmungsrecht auf dem Territorium ihres Landes garantieren.
Ich bin seit heute morgen wieder ein wenig optimistischer, weil ich höre, dass kurzfristig ein 'runder Tisch' geschaffen werden soll. Da versprechen auch die OSZE-Bemühungen um die Ukraine einen neuen politischen Anlauf und durchbrechen hoffentlich die Eskalation mit Waffen.
Wichtig ist, dass Rußland in diesen diplomatischen Bemühungen weiter dazu gedrängt wird, seinerseits die russische Armee von der Grenze anzuziehen und den Separatisten eindeutig klarzumachen, dass es keine Intentionen gibt, dass man im Osten der Ukraine so vorgeht wie auf der Krim.
SPEYER-KURIER: Ist es aber nicht auch ein Stück Selbstbestimmung, wenn Russen aufgrund ihrer Herkunft erklären, sie möchten lieber zu Rußland gehören?
Rebecca Harms: Ich glaube, dass da etwas entschieden werden muss: Bisher habe ich bei keinem meiner Besuche im Osten der Ukraine feststellen können, dass es einen Wunsch gab, nach Moskau zurückzukehren. Es gab zwar auch eine Distanziertheit gegenüber Kiew, aber es gab nie den Wunsch, „wir wollen nach Moskau“. Was dieser runde Tisch deshalb jetzt gewährleisten muss, ist, dass nicht nur die Präsidentschaftswahlen durchgeführt werden, sondern dass auch die Frage, wie dieser Staat aufgebaut sein soll – soll es mehr Macht in den Regionen geben, gibt es eine Föderation – all das muss jetzt geklärt werden.
Die ukrainische Politik leidet - so lange ich es verfolge und ich kenne dieses Land schon seit über 25 Jahren - darunter, dass sich die Machtblöcke stets gegenseitig bekämpfen, allein um der Macht willen und dass nie Politik gemacht worden ist für die Entwicklung des Landes und für die Bürgerinnen und Bürger. Und das jetzt wieder wettzumachen - das ist die eigentliche Herausforderung.
SPEYER-KURIER: Wir möchten die derzeitige Problematik noch einmal auf zwei Punkte zuspitzen – zum einen den Vorwurf, dass im Parlament und in der Übegangsregierung in Kiew durchaus auch faschistisch gesinnte Strömungen vorhanden sind. Und das zweite, dass es – wie zuvor schon erwähnt – auch das Recht russisch-stämmiger Menschen in der Ukraine geben muss, sich zu ihrer „angestammten russischen Heimat“ zu bekennen..
Rebecca Harms: Aktuell sind Vertreter der Partei 'Svoboda' in der Kiewer Regierung vertreten. Das hat sich so aus dem Wunsch der EU ergeben, nachdem das Parlament mit den Abgeordneten der Fraktion von Viktor Janukowitsch den Präsidenten abgesetzt hatte und dieser „getürmt“ war. So wurde ein Neuanfang einer Regierung auf Zeit ermöglicht, von der die EU gefordert hatte, dass Herr Jazeniuk eine All-Fraktionen-Regierung bilden sollte, um das das ganze Land zusammen zuhalten. Da haben sich bis auf „Svoboda' und die jungen, demokratisch gesinnten Leute aus der „Euro-Maijdan-Bewegung“ alle anderen Fraktionen aus, finde ich, rein opportunistischen Gründen geweigert, sich an einer solchen Regierung zu beteiligten, weil sie damit ihre Chancen bei der Präsidentschaftswahl nicht gefährden wollten.So ist es dazu gekommen, dass „Svoboda“ mit drei Ministern in dieser Regierung vertreten ist. Gott sei Dank aber geht die Zustimmung für „Svoboda“ inzwischen spürbar zurück; heute stehen sie nicht mehr, wie bei der letzten Parlamentswahl noch bei zehn, sondern nur noch bei fünf Prozent.
Ich denke, dass deshalb jetzt die Rolle der Nationalisten bei den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen geklärt werden muss. Die Rolle dieser Rechtsnationalisten wird m.E. hier bei uns völlig falsch diskutiert, weil man inzwischen schon die ganze Übergangsregierung unter rechtsradikalen Faschismusverdacht stellt. Das ist aber wirklich nicht zutreffend, zumal dabei auch übersehen wird, dass die Aufladung zwischen russischsprachigen und ukrainischsprachigen Menschen erst zum Problem wurde, seitdem die Krim von den Russen besetzt wurde. Dieses Problem hat es so in der Ukraine zuvor noch nie gegeben, weil immer Russisch gesprochen wurde. So wird in Kiew – ich kann das bezeugen, weil ich sehr oft dort war - mehrheitlich Russisch gesprochen.
SPEYER-KURIER: Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass in der früheren Sowjetunion Ukrainisch als eigene Sprache verboten war.
Rebecca Harms:.Ja, genau so, wie alle Nationalsprachen in der früheren Sowjetunion verboten waren und es auch heute in Rußland noch keine Minderheitenrechte gibt. Denn auch das ist Teil der Putin-Strategie.
SPEYER-KURIER: Wir haben selbst auch Kontakte, z.B. in eine Stadt im Südosten der Ukraine. Und da hören wir, dass die Menschen schlicht nur noch Angst haben. Da gibt es beispielsweise kein Geld mehr in den Geldautomaten – deshalb können die Menschen keine Lebensmittel mehr kaufen, obwohl diese in den Geschäften reichlich vorhanden sind - und sie haben Angst, dass die beschossen werden, wenn sie sich auf die Straße trauen. Was kann man da aktiv tun?
Rebecca Harms: Die Waffen müssen weg – die allererste Forderung lautet: Die Waffen müssen weg. Die ukrainische Armee kann dies auch nicht mit ihren Terror- oder Antiterror-Einsätzen lösen; die sollten nur ganz defensive Einsätze machen und sich darauf konzentrieren, die öffentliche Sicherheit für Menschen zu gewährleisten, so wie auch Sie sie gerade erwähnt haben. Sie können aber auch nicht gegen die Separatisten kämpfen, denn das schürt nur noch mehr diesen russischen Nationalismus. Ich fordere deshalb, dass sich Rußland viel eindeutiger gegenüber diesen Separatisten positionieren muss. Rußland muss ihnen zeigen, dass es den Weg des Separatismus nicht mehr geben darf und dass der neue Zuschnitt des Staates Ukraine von den Ukrainern unter Moderation der OSZE erarbeitet werden muss.
SPEYER-KURIER: Frau Harms, haben Sie die Hoffnung, dass man Wladimir Putin davon überzeugen kann, dass das, was Sie glauben, der richtige Weg ist?
Rebecca Harms: Wladimir Putin ist ja von dem anderen Weg überzeugt gewesen – die Besetzung der Krim war ja kein Zufall. Er hat sich entschieden, mit einer ethnischen Begründung die Friedensordnung in Europa aufzukündigen und mit dieser Begründung Grenzen zu verschieben. Wenn man mit Putin jetzt verhandelt, dann muss man erst einmal davon ausgehen. Die Idee, dass Putin gedemütigt worden sei, weil sich die Ukrainer unter unterschiedlichen Regierungen mehrheitlich für die EU entschieden haben, halte ich nicht für tragfähig. Für mich geht es deshalb vielmehr darum, was für eine Realität muss ich heute beurteilen? Die Europäer haben entschieden: Dieser Konflikt ist nicht mit Waffen zu lösen, darum wollen wir allein eine Lösung über die Diplomatie. Damit aber unsere Diplomatie erfolgreich sein kann, ist wichtig, dass Merkel und die anderen Staats- und Regierungschefs, die sich auf einen Katalog von Sanktionen geeinigt haben, diese Sanktionen beibehalten, so lange der Verdacht besteht, dass Rußland nicht de eskaliert, sondern selbst zur Eskalation beiträgt.
SPEYER-KURIER: Bleibt uns allen wohl nur die Hoffnung, dass doch noch alles gut ausgeht. Frau Harms, wie danken Ihnen für dieses Gespräch.
15.05.2014
Interview der Woche
 Heute mit
Heute mit
Oberstleutnant Stefan Jeck (40),
Dipl.-BauIng (univ.)
Kommandeur des Spezialpionierbataillons (SpezPiBal) 464
und voraussichtlich letzter Standortältester am Bundeswehr-Standort Speyer.
Verheiratet, 2 Kinder
Militärischer Werdegang:
01.07.1993: Eintritt in die Bundeswehr - 3./ PiBtl 6, Plön
bis Sept.1996 Ausbildung zum Truppen-Offizier der Pioniertruppe bei
PiS/FSH/BauT in München und beim PiBtl 320 in Lahnstein
Okt.1996 bis Febr. 2000 Studium BauIngWesen an der Uni der
Bundeswehr in München
März 2000 bis März 2002 Zugführer,TiefbauOffz beim PiBtl 320 in
Lahnstein
Apr. 2002 bis Juni 2003 Komp.Chef 2.PiBtl 320 in Lahnstein
Juli 2003 bis Oktober 2004 KpChef 5./SpezPiBtl 464 in
Speyer.
Nov. 2004 bis März 2006 PersonalOffz beim Personalamt der
Bundeswehr in Köln
Apr. 2006 bis Sept. 2008 3. SKgem LGAN, Führungsakademie der
Bundeswehr in Hamburg
Okt. 2008 bis Juni 2010 G3, SKA VII 2 (1) in Bonn
Juli 2010 bis Mai 2012 Grundsatzreferent beim Org/ Stat, BMVg Fü H
I 4, in Bonn
Juni 2012 bis Dez. 2012 M.A. to ISAF Spokesperson
HQ ISAF ,Kabul, Afghanistan
Jan. 2013 bis Sept. 2013 Grundsatzreferent beim Org, Kommando Heer
III 2 (1) Bonn
Seit Okt. 2013 Kommandeur SpezPiBtl 464 in
Speyer.
Auslandseinsätze: ISAF - Afghanistan
Ehrenzeichen: Ehrenkreuz der Bundeswehr in Silber (2010)
Orden: Einsatzmedaille ISAF
19.12.2013
 SPEYER-KURIER: Herr Oberstleutnant Jeck, für Sie
als Kommandeur des „Spezialpionierbataillons 464“ und
Standortältesten der Speyerer Bundeswehr-Garnison war die Domstadt
bei der Übernahme dieses Kommandos nicht die erste Begegnung mit
der Domstadt.
SPEYER-KURIER: Herr Oberstleutnant Jeck, für Sie
als Kommandeur des „Spezialpionierbataillons 464“ und
Standortältesten der Speyerer Bundeswehr-Garnison war die Domstadt
bei der Übernahme dieses Kommandos nicht die erste Begegnung mit
der Domstadt.
Sie haben ja bereits bei einer früheren Verwendung als Kompaniechef in den Jahren 2003/2004 die Garnison Speyer und die Stadt kennengelernt. Welche Gedanken, welche Gefühle überkamen Sie, als Sie von dieser Verwendung erfuhren?
Oberstlt. Jeck: Ich habe mich sehr darüber gefreut – nicht nur, dass ich Kommandeur werden durfte, das ist nämlich heute eine ganz besondere Auszeichnung – sondern vor allem auch darüber, dass diese Verwendung beim SpezPiBtl 464 hier in Speyer sein sollte. Ich habe seinerzeit als Kompaniechef hier im Bataillon sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl mit den Kameraden, aber insbesondere auch mit der Speyerer Bevölkerung und mit der Patengemeinde unserer Kompanie, mit Lingenfeld, so dass ich letztlich zu dem Ergebnis komme: Ja, ich habe mich sehr gefreut und muss nach meinen ersten sechs Wochen als Kommandeur sagen: Ja, es bestätigt sich wieder – ich bin gerne wieder hier.
SPEYER-KURIER: Nun steht ja – leider, wie viele Menschen in der Region sagen – am Ende Ihres Kommandos in Speyer die Auflösung des Spez.Pi.Bat. 464 und die dauerhafte Schließung des Pionierstandortes Speyer. Macht sich denn bei Ihren Soldaten schon so etwas wie „Abschiedsstimmung“ breit – haben Sie schon auf „Schließungs-Modus“ umgeschaltet?
Oberstlt. Jeck: Wir haben sowohl in 2013 und werden auch in 2014 volle Auftragsbücher haben. Die Auftragserfüllung und insbesondere hier die Auslandseinsätze stehen dabei weiterhin im Vordergrund. Wir werden auch in 2014 wieder über das gesamte Jahr hinweg Einsatzkontingente auf die verschiedenen Kontinente in der Welt entsenden; wir werden auch 2014 weiterhin ausbilden, sodass ich sagen kann: Nein, wir sind nicht im „Schließungsmodus“, sondern auch weiterhin absolut im „Auftragserfüllungsmodus“. Meine Soldaten haben Freude an ihrem Dienst, sie kommen gerne nach Speyer und nach meiner persönlichen Bewertung wird die Masse erst in 2015 dazu kommen, sich mit der Auflösung auseinaderzusetzen.
SPEYER-KURIER: Auch wenn bei den Offiziers-Kadern in den letzten Jahren der „Drei-Jahres-Turnus“ gegriffen hat, so gilt doch speziell für viele Unterführer, dass sie längst dauerhaft Wurzeln in Speyer und in der Region geschlagen haben. Manche haben hier ein Haus gebaut, haben sich darauf eingesetllt, bis zum Ende ihrer Dienstzeit in Speyer eine Verwendung zu finden. Was wird mit der Auflösung mit denen passieren?
 Oberstlt. Jeck: Das ist jetzt noch schwer
abzusehen. Man muss dort in verschiedenene Fallgruppen – so möchte
ich es einmal nennen – unterscheiden: Wir haben eine Gruppe, die
bis zur Auflösung oder spätestens ein Jahr nach der Auflösung des
Bataillons ihr Dienstzeitende erreichen werden. Für die brauchen
wir uns um keine Folgeverwendung mehr bemühen – die laufen in
dieser Verwendung quasi aus und das ist schon eine große
Gruppe.
Oberstlt. Jeck: Das ist jetzt noch schwer
abzusehen. Man muss dort in verschiedenene Fallgruppen – so möchte
ich es einmal nennen – unterscheiden: Wir haben eine Gruppe, die
bis zur Auflösung oder spätestens ein Jahr nach der Auflösung des
Bataillons ihr Dienstzeitende erreichen werden. Für die brauchen
wir uns um keine Folgeverwendung mehr bemühen – die laufen in
dieser Verwendung quasi aus und das ist schon eine große
Gruppe.
Von den Berufssoldaten und den Soldaten auf Zeit, die noch mehrere Dienstjahre vor sich haben, werden natürlich alle noch einmal in eine Folgeverwendung gehen müssen, die zum einen hier in der Region sein könnte – Beispiel ist hier meine 8. Kompanie, die zum 31. März 2014, also schon vorzeitig, aufgelöst wird – davon werden viele als Brandschutz-Soldaten zum ABC-Abwehrbataillon nach Bruchsal wechseln. Es wird aber auch Fälle geben, wo Kameraden nach Nord- oder Süddeutschland, nach Osten oder ganz in den Westen versetzt werden. Das System ist so angelegt, dass man versucht, das dienstliche Interesse mit dem persönlichen der Soldaten zu verbinden. Das wäre dann sicher die Ideallösung. Das wird aber sicher nicht in allen Fällen greifen. Bei dem einen oder anderen wird vielleicht auch das dienstliche Interesse nicht mit dem persönlichen Interesse zusammenfallen und dann wird am Ende wohl das dienstliche Interesse im Vordergrund stehen.
SPEYER-KURIER: Ihre Einheit hat in der Zeiti ihres Bestehens in zahlreichen Einsätzen immer wieder Ihre besoindere Kompetenz unter Beweis stellen können. An vielen Menschen – gerade auch in Speyer – ist allerdings dennoch vorbeigegangen, was die besonderen Fähigkeiten dieser Einheit waren und noch immer sind. Vielleicht können Sie unseren Leserinnen und Lesern diese besonderen Kompetenzen noch einmal beschreiben.
 Oberstlt. Jeck: In unserem Bataillon sind
vielfältige Fähigkeitn vereint: Die wesentlichen – und dafür sind
auch die meisten meiner Soldaten ausgebildet – sind der
Feldlagerbau und der Feldlagerbetrieb, also das Sicherstellen der
Unterbringung der Soldaten in den Einsatzgebieten. Eine weitere
Fähigkeit ist in meiner 7. Kompanie verankert, das sind meine
Pipeline-Pioniere, die sich schwerpunktmäßig mit dem Bauen und dem
Betreiben eines Feldtanklagers beschäftigen. Da geht es also im
Kern darum, grosse Mengen Kraftstoff zwischenzulagern und dann bei
entsprechendem Bedarf an Luftfahrzeuge oder an bodengebundene
Fahrzeuge abzugeben. Des weiteren habe ich in der 8. Kompanie – ich
sprach es bereits an - noch bis zum 31.03.2014 Brandschutzkräfte,
also eine militärische Feuerwehr. Außerdem habe ich dort auch einen
großen Anteil an Pioniermaschinen, wie wir sie beispielsweise auch
aus dem Baugewerbe kennen, um eben, wie die Feldlagerbetriebskräfte
oder die Pipielinepioniere auch, entsprechende
Vorbereitungsmassnahmen – z.B. Erdbewegungsarbeiten durchzuführen.
Last but not least habe ich in der 1. Kompanie noch eine sehr
spezielle Fähigkeit und das ist die Wasseraufbereitung – also aus
nicht trinkfähigem Wasser Trinkwasser aufzubereiten.
Oberstlt. Jeck: In unserem Bataillon sind
vielfältige Fähigkeitn vereint: Die wesentlichen – und dafür sind
auch die meisten meiner Soldaten ausgebildet – sind der
Feldlagerbau und der Feldlagerbetrieb, also das Sicherstellen der
Unterbringung der Soldaten in den Einsatzgebieten. Eine weitere
Fähigkeit ist in meiner 7. Kompanie verankert, das sind meine
Pipeline-Pioniere, die sich schwerpunktmäßig mit dem Bauen und dem
Betreiben eines Feldtanklagers beschäftigen. Da geht es also im
Kern darum, grosse Mengen Kraftstoff zwischenzulagern und dann bei
entsprechendem Bedarf an Luftfahrzeuge oder an bodengebundene
Fahrzeuge abzugeben. Des weiteren habe ich in der 8. Kompanie – ich
sprach es bereits an - noch bis zum 31.03.2014 Brandschutzkräfte,
also eine militärische Feuerwehr. Außerdem habe ich dort auch einen
großen Anteil an Pioniermaschinen, wie wir sie beispielsweise auch
aus dem Baugewerbe kennen, um eben, wie die Feldlagerbetriebskräfte
oder die Pipielinepioniere auch, entsprechende
Vorbereitungsmassnahmen – z.B. Erdbewegungsarbeiten durchzuführen.
Last but not least habe ich in der 1. Kompanie noch eine sehr
spezielle Fähigkeit und das ist die Wasseraufbereitung – also aus
nicht trinkfähigem Wasser Trinkwasser aufzubereiten.
SPEYER-KURIER: Zu den Verwendungen der 464er gehörten ja immer wieder auch „Out-of-area“-Einsätze – u.a. bis heute in Afghanistan. Wo überall waren denn die Soldaten Ihrer Einheit in den vergangene Jahren schon unterwegs?
Oberstlt. Jeck: Wir sind – und das ist auch dort, wo wir schwerpunktmäßig eingesetzt werden – in Afghanistan, dort im Norden des Landes im deutschen santwortungsbereich. Daneben habe ich aber auch weiterhin Kräfte im Kosovo, in Mali sowie in der Türkei. Das sind die Einsätze, die wir von hier aus mit eigenem Personal und mit eigenem Material bestücken müssen. Und das sind – wenn ich zurückblicke – auch die Einsatzorte, wo wir auch in den vergangenen Jahren gebraucht wurden.
SPEYER-KURIER: Bleibt Ihnen denn da überhaupt noch Zeit, um auch die in Deutschland stationierten militärischen Strukturen pioniermäßig zu unterstützen?
Oberstlt. Jeck: Ja, das schaffen wir. Wie Sie sicherlich wissen, haben meine Soldaten ca. 1 Jahr Pause zwischen zwei Einsätzen, und da schaffen wir es, an nationalen und auch internationalen Übungen teilzunehmen und dort unsere Fähigkeiten beizusteuern. Letztendlich dient das ja auch der In-Übung-Haltung zwischen den Einsätzen. Deshalb: Ja, wir schaffen das.
SPEYER-KURIER; Herr Oberstleutnant, für Ihre Einheit sowie für das Schwesterbataillon in Husum wurde ja auch immer wieder mit, durch und für sie Spezialgerät entwickelt, das man so auf dem freien Markt nicht kaufen kann. Was wird denn nach der Auflösung mit diesem Gerät passieren und vor allem – hat den die Kompetenz Ihrer Soldatinnen und Soldaten eine Chance, in anderen Einheiten erhalten zu bleiben?
 Oberstlt. Jeck: Bei dem Material handelt es sich
in großen Teilen um solches, das wir bereits im Einsatz haben;
davon habe ich hier aber nur sehr wenig am Standort. Wenn meine
Soldaten Feldlagerbau und -betrieb üben, dann tun sie das in der
Regel auf dem Truppenünungsplatz in Putlos (in Schleswig-Holstein
d. Red.).. Da gibt es ein spezielles
Spezialpionierausbildungs- und Übungszentrum, wo wir üben können.
Zum anderen machen wir das auch an der
Bauinstandsetzungseinrichtung in Münchsmünster (bei
Ingolstadt (d.Red.), so dass ich hier spezifisches
Großgerät nur in geringem Umfang im Bestand habe. Fahrzeuge,
spezielle Pioniermaschinen, wie ich sie eben schon ansprach, werden
auch in den Heerespionierbataillonen gebraucht, d.h., da ist davon
auszugehen, dass viele dieser Maschinen an diese Einheiten
abgegeben werden, um dort weiter verwendet zu werden.
Oberstlt. Jeck: Bei dem Material handelt es sich
in großen Teilen um solches, das wir bereits im Einsatz haben;
davon habe ich hier aber nur sehr wenig am Standort. Wenn meine
Soldaten Feldlagerbau und -betrieb üben, dann tun sie das in der
Regel auf dem Truppenünungsplatz in Putlos (in Schleswig-Holstein
d. Red.).. Da gibt es ein spezielles
Spezialpionierausbildungs- und Übungszentrum, wo wir üben können.
Zum anderen machen wir das auch an der
Bauinstandsetzungseinrichtung in Münchsmünster (bei
Ingolstadt (d.Red.), so dass ich hier spezifisches
Großgerät nur in geringem Umfang im Bestand habe. Fahrzeuge,
spezielle Pioniermaschinen, wie ich sie eben schon ansprach, werden
auch in den Heerespionierbataillonen gebraucht, d.h., da ist davon
auszugehen, dass viele dieser Maschinen an diese Einheiten
abgegeben werden, um dort weiter verwendet zu werden.
Der zweite Teilaspekt Ihrer Frage war der nach der Personalqualifizierung meiner Solfaten. Natürlich, es gibt noch unser Schwesterbataillon, das Husum 164 – da gibt es tatsächlich 1 : 1 die gleichen Verwendungen und die gleiche Ausrüstung; es wird auch in jedem Logistikbataillon der Streitkräftebasis einige Dienstposten für Spezialpioniere geben, die ihren Schwerpunkt im Feldlagerbau haben und über entsprechende Einsatzerfahrung verfügen, um im Planungsprozess und im Einsatzführungsprozess eines Logsitikbataillons unterstützend beraten zu können.
SPEYER-KURIER: Iherr Oberstleutnant, Sie haben vorhin schon angesprochen, dass zum 31.03.2014 die 8. Kompanie ihres Bataillons aufgelöst wird, Wie genau sind denn die Schritte für diese Auflösung, bis Sie dann Ende 2015 die militärischen Einrichtungen in Speyer „besenrein“, wie es so schön heißt, an die BaFin übergeben können?
 Oberstlt. Jeck: In der Tat wird die 8. Kompanie,
in der ich im Schwerpunkt Brandschutzfähigkeiten und
Pioniermaschinenbediener habe, zum 31. März 2014 aufgelöst werden.
Aber, wie schon angedeutete, wird die Fähigkeit „Militärischer
Brandschutz“ von den beiden ABC-Abwehr-Bataillonen wahrgenommen.
Und dem entsprechend ist es nur konsequent, dass man unsere 8.
Kompanie schon vorher auflöst, damit ihre Fähigkeit in diesen
beiden Bataillonen aufgeht.
Oberstlt. Jeck: In der Tat wird die 8. Kompanie,
in der ich im Schwerpunkt Brandschutzfähigkeiten und
Pioniermaschinenbediener habe, zum 31. März 2014 aufgelöst werden.
Aber, wie schon angedeutete, wird die Fähigkeit „Militärischer
Brandschutz“ von den beiden ABC-Abwehr-Bataillonen wahrgenommen.
Und dem entsprechend ist es nur konsequent, dass man unsere 8.
Kompanie schon vorher auflöst, damit ihre Fähigkeit in diesen
beiden Bataillonen aufgeht.
Wenn man aber nach vorne blickt und schaut, wie sich das dann auf der Zeitachse bis 2015 darstellt: Dann werden wir als unseren Schwerpunkt auch in 2014 weiterhin unseren Hauptauftrag, die Sicherstellung der Einsatzkräfte für den Feldlagerbau und -betrieb fortsetzen. Dazu werden wir unsere fachlichen Fähigkeiten durch entsprechende Übungen auch weiter aufrecht erhalten. Von daher denkt 2014 niemand von uns an Auflösung. Das wird wirklich erst in 2015 der Fall sein, wenn wir dann ab dem Frühjahr spüren werden, dass das Personal langsam weniger wird und dass die Kameraden so langsam in ihre neuen Verwendungen gehen.
SPEYER-KURIER: Kann einen da nicht angesichts der Komplexität eines solchen Prozesses die Sorge überkommen, am Ende doch noch den einen oder anderen Punkt zu übersehen?
Oberstlt. Jeck: Diese Sorge habe ich in keinster Weise. Das liegt vor allem daran, dass ich tiefstes Vertrauen in meine Mitarbeiter habe, in meinen Stab und in meine Kompanien. Ich glaube nicht, dass uns da etwas durchgeht. Wir werden alles beachten und uns insbesondere um das Personal kümmern. Die Soldaten und ihre Familien - das muss in einer Phase der Auflösung oberste Priorität haben.
.SPEYER-KURIER: Herr Oberstelutant, gibt es denn – aus heutiger Sicht und nach Ihrer Einschätzung - überhaupt noch eine Chance, dass die Entscheidung des Deutschen Bundestages, den Speyerer Standort aufzulösen, am Ende doch noch revidiert werden könnte?
Oberstlt. Jeck: Die Entscheidungslage ist uns allen bekannt – die Entscheidungslage des Bundesministers der Verteidigung – jetzt Bundesministerin – sieht vor, dass der Standort Speyer und damit auch unser Bataillon 464 am 31. 12. 2015 aufgelöst wird. Diese Entscheidung zweifelt hier keiner an und wir werden diese Entscheidung hier auch ganz loyal umsetzen.
SPEYER-KURIER: Wie beurteilen Sie denn die neue „Gefechtslage“ mit einer Ministerin an der Spitze des Bundesverteidigungsministeriums?
Oberstlt. Jeck: Das war natürlich auch für uns alle eine Überraschung. Ich traue aber Frau von der Leyen durchaus zu, dass sie diese Aufgabe meistern wird. Die angelaufene Bundeswehrreform muss weitergebracht und der Rückzug aus Afghanistan bewältigt werden.
SPEYER-KURIER: Was viele Speyerer, die sich mit „Ihren“ Pionieren verbunden fühlen, immer wieder umtreibt, ist die Frage: Was wird aus dem Traditionsraum hier in der Kurpfalz-Kaserne, in dem sich die Geschichte der verschiedenen hier stationierten Einheiten widerspiegelt. Gibt es hierfür schon eine absehbare neue Unterkunft?
 Oberstlt. Jeck: Dazu gibt es erste Gedanken, die
im Moment aber noch im kleinsten Kreise kursieren. Natürlich ist
auch das Thema „Traditionspflege“ bei uns auf der Agenda.
Allerdings liegen dazu dezeit noch keine veröffentlichungsfähigen
Ergebnisse vor. Da bitte ich Sie um Verständnis – da werden die
Entscheidungsprozesse noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.
Oberstlt. Jeck: Dazu gibt es erste Gedanken, die
im Moment aber noch im kleinsten Kreise kursieren. Natürlich ist
auch das Thema „Traditionspflege“ bei uns auf der Agenda.
Allerdings liegen dazu dezeit noch keine veröffentlichungsfähigen
Ergebnisse vor. Da bitte ich Sie um Verständnis – da werden die
Entscheidungsprozesse noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.
SPEYER-KURIER: Bevor es dann wirklich Ernst wird mit dem Abzug – womit können die Speyerer zum Abschied noch rechnen? Wird eine große Truppenparade über die Hauptstraße ziehen wie einst beim Einzug – vielleicht auch noch ein letzter Brückenschlag mit den legendären Amphibilen über den offenen Rhein oder spricht mehr dafür, dass sich dieser Abzug sang- und klanglos vollziehen wird?
Oberstlt. Jeck: Auch da kann ich noch nichts Genaueres sagen. Derzeit gibt es noch keinen Zeitpunkt, wann wir dies machen und noch keinen konkreten Plan über das Wie. Da habe ich zwar erste Gedanken, aber auch die sind noch nicht spruchreif. Was aber sicher ist: Es wird kein sang- und klangloser Abschied sein – das wäre nicht mein Wunsch.
SPEYER-KURIER: Lassen Sie uns schließlich auch noch auf die militärischen Liegenschaften in und um Speyer zu sprechen kommen. Wie sind da Ihre Prognosen: Wird die Stadt Speyer schon vor dem Abzug der letzten Soldaten bereits Teile der frei werdenden Liegenschaften in ihre Obhut übernehmen können? Gibt es da schon eine konkrete Reihenfolge?
Oberstlt. Jeck: Eine konkrete Reihenfolge gibt es so sicher noch nicht. Aber Sie wissen, dass das Polygon-Gelände, wo wir unsere Kraftfahraus- und weiterbildung gemacht haben, bereits abgegeben ist. Damit haben wir noch den Landübungsplatz, den Wasserübungsplatz und als größte Immobilie die Kurpfalz-Kaserne. Die Kurpfalz-Kaserne werden wir sicher bis zum Ende behalten müssen. Ob wir den Landübungsplatz bis zum Ende behalten, vermag ich heute noch nicht zu beurteilen. Gleiches gilt auch für den Wasserübungsplatz. Das müssen wir hier stabsintern prüfen und letztlich auch entscheiden,ob wir alles in einem Gesamtpaket zum gleichen Zeitpunkt abgeben oder ob wir gegebenenfalls einzelne Flächen schon vorher abgeben können und ob dafür ein Bedarf und auch ein Interesse da ist.
Vom Verfahren her ist es so – und das Ihnen ja sicher auch geläufig – dass wir Flächen und Einrichtungen, die dem Bund gehören, an die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) übergeben, die dann mit den entsprechenden Städten und Gemeinden über eine entsprechende Nachnutzung verhandelt. Deshalb kann ich natürlich auch zu einer weiteren Nachnutzung der vier Areales noch nichts sagen – das entzieht sich im übrigen auch meiner Zuständigkeit.
SPEYER-KURIER: Dann möchte ich Ihnen, weil das bei uns so Tradition ist, zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen stellen: Womit beschäftigt sich Stefan Jeck, wenn er Freizeit hat – welches sind Ihre Hobbies?
Oberstlt. Jeck: Wenn ich Freizeit habe, was ja durchaus vorkommt- das muss ich ehrlich sagen – dann verbringe ich diese Freizeit sehr gerne mit meiner Familie, mit meiner Frau und meinen Kindern. Das tue ich vorwiegend im Westerwald, wo ich in der Nähe von Montabaur auch privat wohne - – dann lese ich auch sehr gerne und gehe gerne mit meiner Frau zum Tanzen – das machen wir seit zwei, drei Jahren regelmässig am Wochenende bei mir zuhause in einer Tanzschule.
SPEYER-KURIER: Herr Jeck, Sie sagten, Sie lesen gerne – welches Buch liegt denn zur Zeit auf Ihrem Nachttisch?
 Oberstlt. Jeck: Das ist sehr unterschiedlich. Ich
lese sowohl militärische Literatur – z.B. wo es um
Aufstandbekämpfung geht, mit den Szenarien, auf die wir heute
treffen. Ich lese aber auch sehr gerne Bücher über das Land
Afghanistan, wenn es um die Tradition und um die Gesellschaft dort
geht und um die Kultur. Im Moment lese ich außerdem ein Buch mit
dem Titel „Blackout“, in dem es um Stromausfälle in Europa und in
den USA geht . Das sind so Bücher, die ich gerne lese.
Oberstlt. Jeck: Das ist sehr unterschiedlich. Ich
lese sowohl militärische Literatur – z.B. wo es um
Aufstandbekämpfung geht, mit den Szenarien, auf die wir heute
treffen. Ich lese aber auch sehr gerne Bücher über das Land
Afghanistan, wenn es um die Tradition und um die Gesellschaft dort
geht und um die Kultur. Im Moment lese ich außerdem ein Buch mit
dem Titel „Blackout“, in dem es um Stromausfälle in Europa und in
den USA geht . Das sind so Bücher, die ich gerne lese.
SPEYER-KURIER: ...und wenn Sie dann einmal in Urlaub gehen – gibt es da präferierte Reiseziele?
Oberstlt. Jeck: Da gibt es keine bevorzugten Ziele. Ob Inland oder Ausland – wir machen beides gerne. Wir haben auch nicht das Lebensziel, dass wir an jedem Fleck der Erde gewesen sein müssten. So manche Flecken, z.B. die Mecklenburgische Seenplatte, dahin kehren wir gerne häufiger zurück – wir fahren aber auch nach Frankreich oder Spanien – also da gibt es wirklich keine absolut bevorzugten Ziele.
SPEYER-KURIER: Dann dürfen wir Ihnen und Ihrem Bataillon ein Frohes Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr wünschen und Ihnen noch ein paar erfolgreiche Monate in Speyer. Vor allem hoffen wir, dass alle Kameraden unverseht von den Einsätzen in Afghanistan, Mali und der Türkei zurückkehren mögen und Ihnen persönlich diese Abwicklungs-Aufgabe gelingen möge, die wohl alles andere ist als das, was sich ein Soldat so wünscht.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler/
Foto: Bundeswehr; gc
19.12.2013
Interview der Woche
 Heute mit Stefan
Fuchs
Heute mit Stefan
Fuchs
Er gehört zu den „Perlen“ der deutschen Wirtschaft – der weltweit operierende, börsennotierte Mannheimer Schmierstoff-Spezialist „Fuchs Petrolub SE“. Das bedeutende Familienunternehmen, das inzwischen weltweit mit mehr als 10.000 unterschiedlichen Produkten auf allen Märkten vertreten ist, wird seit fast zehn Jahren von Stefan Fuchs, dem Enkel des Firmengründers Rudolf Fuchs geführt, der in den 1930er Jahren die von ihm vertriebenen Öle und Fette noch persönlich mit dem Fahrrad in Mannheim verteilt hat.
Heute steht die hochinnovative „Fuchs Petrolub SE“ vor dem Sprung über die Zwei-Milliarden-Euro-Umsatz-Grenze und beschäftigt weltweit fast 4.000 Menschen.
Lesen Sie im Folgenden im SPEYER-KURIER unser Interview der Woche
Heute mit Dipl. Kaufmann Stefan Fuchs (45),
Vorstandsvorsitzender der „Fuchs Petrolub SE“ Mannheim.
Verheiratet, 2 Kinder
Abitur in Mannheim
Studium der Betriebswirtschaft an der Universität Mannheim.
29.07.2013
SPEYER-KURIER: Herr Fuchs, der von Ihnen als Vorstandsvorsitzender geführte Schmierstoffkonzern zählt heute mit einem Umsatz von gut 1,8 Milliarden Euro zu den wohl erfolgreichsten Familienunternehmen in der Bundesrepublik Deutschland und ist mit über 10.000 unterschiedlichen Produkten sicher auch eines der innovativsten Spezialunternehmen seiner Art in der Welt.
Zur Jahreswende 2013/14 werden Sie jetzt die Leitung von „Fuchs“ zehn Jahre innehaben. In welchem Alter wurde Ihnen denn klar, dass - in der Nachfolge Ihres Vaters, Dr. Manfred Fuchs - die Verantwortung für die Firma irgendwann auf Sie zukommen würde?
 Stefan
Fuchs: Eigentlich wurde mir erst nach meinem Studium und
nach meinem Examen - ich habe an der Universität Mannheim
Betriebswirtschaft studiert – durch ein Praktikum bei „Fuchs“ so
richtig klar, dass ich einmal in die Firma eintreten wollte. Ich
habe dann zunächst noch bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gearbeitet und bin danach für „Fuchs“ drei Jahre in die USA
gegangen. Was mich an diesem Unternehmen faszinierte, war vor allem
die Tatsache, dass „Fuchs“ mit seinen vielen Produkten so
außerordentlich breit aufgestellt ist und dass das Thema
Schmierstoffe eine sehr spannende Sache ist. Von daher ist diese
Entscheidung also erst in den Jahren 1994/95 so richtig gereift.
Nach meinem Eintritt in die Firma im Jahr 1996 bin ich dann, wie
gesagt, für drei Jahre in die USA gegangen und kam 1999 nach
Mannheim zurück und wurde in den Vorstand des Unternehmens
berufen.
Stefan
Fuchs: Eigentlich wurde mir erst nach meinem Studium und
nach meinem Examen - ich habe an der Universität Mannheim
Betriebswirtschaft studiert – durch ein Praktikum bei „Fuchs“ so
richtig klar, dass ich einmal in die Firma eintreten wollte. Ich
habe dann zunächst noch bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
gearbeitet und bin danach für „Fuchs“ drei Jahre in die USA
gegangen. Was mich an diesem Unternehmen faszinierte, war vor allem
die Tatsache, dass „Fuchs“ mit seinen vielen Produkten so
außerordentlich breit aufgestellt ist und dass das Thema
Schmierstoffe eine sehr spannende Sache ist. Von daher ist diese
Entscheidung also erst in den Jahren 1994/95 so richtig gereift.
Nach meinem Eintritt in die Firma im Jahr 1996 bin ich dann, wie
gesagt, für drei Jahre in die USA gegangen und kam 1999 nach
Mannheim zurück und wurde in den Vorstand des Unternehmens
berufen.
SPEYER-KURIER: Ihr Vater Dr. Manfred Fuchs wurde ja durch den frühen Tod Ihres Großvaters Rudolf Fuchs - er gründete das Unternehmen im Jahr 1931, verstarb aber bereits im Jahr 1959 im Alter von nur 49 Jahren - schon sehr früh und vermutlich auch ziemlich unvorbereitet in die Leitung der Firma quasi „hineinkatapultiert“. Wie haben Ihre Eltern denn Sie auf diese höchst anspruchsvolle Leitungsfunktion vorbereitet?
Stefan Fuchs: Für meinen Vater war es in der Tat ein sehr schwieriger Start, denn er war erst zwanzig Jahre alt, als sein Vater verstarb. Und da ist es schon höchst bemerkenswert, wie er damals mit Unterstützung seiner beiden Schwestern und seiner Mutter das Unternehmen weiter aufgebaut und schließlich auch an die Börse gebracht hat. In all den Jahren war der Zusammenhalt innerhalb der Familie sicher eine wesentliche Voraussetzung für den Erfolg des Unternehmens.
Aber zurück zu Ihrer Frage: Meine Eltern haben nie Druck auf mich ausgeübt, in die Firma einzutreten. Dazu ist es wichtig, zu beachten, dass wir ein familiengeprägtes börsennotiertes Unternehmen sind. Dabei hält zwar die Familie die Mehrheit der Stammaktien, aber durch die zwei verschiedenen Aktiengattungen „nur“ 26 Prozent am Gesamtkapital, während 74 Prozent im Besitz von fremden Dritten sind. Und dementsprechend führen wir die Firma auch: Dass bei dieser Kapitalbeteiligung ein Vertreter der Familie Fuchs im Aufsichtsrat sitzt, halte ich für durchaus angemessen - dass aber auch ein Fuchs im Vorstand sitzt oder gar den Vorstandsvorsitz inne hat, mag eine schöne Fügung sein - darauf besteht aber für die Familie Fuchs kein automatischer Anspruch.
Unsere Eltern haben in meinem Fall das Interesse an dem Unternehmen durch ein Praktikum und vor allem durch den dreijährigen Aufenthalt in den USA geweckt. Dabei war es wichtig, sich innerhalb des großen Netzwerkes eines solchen Unternehmens erst einmal seine Sporen im Ausland zu verdienen, denn in Amerika wird man nicht unbedingt so behandelt wie in Deutschland, wenn man Fuchs heißt und in der gleichnamigen Firma arbeitet. Ich hatte damals in den USA einen Mentor, einen späteren Vorstandskollegen, bei dem ich viel über unser Geschäft gelernt habe.
SPEYER-KURIER: Wie präsent war denn im Alltag Ihrer eigenen Kinder- und Jugendzeit die Lebensleistung Ihres Großvaters Rudolf Fuchs?
Stefan Fuchs: Ich bin ja erst 1968 geboren und habe deshalb meinen 1959 verstorbenen Großvater leider nicht mehr persönlich kennengelernt. Aber er war auch bei mir durchaus präsent. Er hat die Firma von null an gegründet und das findet meinen allerhöchsten Respekt. Er hat in den ersten Jahren das Öl noch mit dem Fahrrad in Mannheim ausgefahren und die Grundlagen für das Unternehmen gelegt.
Mein Vater hat dann mit seinem damaligen Team die Firma über vierzig Jahre hinweg hervorragend auf- und ausgebaut, so dass ich selbst auf einem sehr hohen Niveau weitermachen konnte. Auch ich konnte auf ein gutes Team aufbauen, weshalb ich immer darauf bedacht bin, die Aufmerksamkeit für den Erfolg von „Fuchs“ von Einzelpersönlichkeiten weg auf die Mannschaft zu lenken.
SPEYER-KURIER: Es gibt ja in der
Wirtsc haftsgeschichte und in der
Literatur genug Beispiele von Familienunternehmen, die gerade in
der dritten Generation aus der „Erfolgsspur“ geraten sind. Das
scheint aber bei Ihrer Familie – bei Ihrem Unternehmen - kaum
vorstellbar. „Fuchs“ hat sich seit seiner Gründung stets
kontinuierlich, aber behutsam aufwärts entwickelt. Aus Anlass des
75. Geburtstags des Unternehmens im Jahr 2006 bekannten Sie sich in
einem Interview zu den Grundprinzipien der Unternehmensführung, so
wie sie von Ihrem Vater aufgestellt worden waren. Heute – fast acht
Jahre weiter – hat sich an dieser Einstellung etwas geändert?
haftsgeschichte und in der
Literatur genug Beispiele von Familienunternehmen, die gerade in
der dritten Generation aus der „Erfolgsspur“ geraten sind. Das
scheint aber bei Ihrer Familie – bei Ihrem Unternehmen - kaum
vorstellbar. „Fuchs“ hat sich seit seiner Gründung stets
kontinuierlich, aber behutsam aufwärts entwickelt. Aus Anlass des
75. Geburtstags des Unternehmens im Jahr 2006 bekannten Sie sich in
einem Interview zu den Grundprinzipien der Unternehmensführung, so
wie sie von Ihrem Vater aufgestellt worden waren. Heute – fast acht
Jahre weiter – hat sich an dieser Einstellung etwas geändert?
Stefan Fuchs: Nein – natürlich muss sich ein Unternehmen immer wieder neu an den zeitgemäßen Gegebenheiten orientieren und dabei klar nach vorne schauen. Aber unser Grundprinzip „Fortschritt gepaart mit Tradition“, hat bei uns einen unverändert hohen Stellenwert. Daran haben wir auch unser Firmenleitbild festgemacht, das wir vor einem Jahr zusammen mit den fünf zentralen Werten definiert haben. Das haben wir allen 3.826 Mitarbeitern weltweit persönlich vorgestellt - übersetzt in über 25 Sprachen und auch ausführlich erklärt. Es ist leicht, z.B. von Respekt oder von Verlässlichkeit zu sprechen - wir aber denken, dass man dazu auch erklären muss, was man darunter versteht. Und dazu gehört auf allen Ebenen die Vorbildfunktion – und so führen wir unseren Konzern auch. Dafür brauchen wir ein solches verbindliches Wertegerüst, das z.B. auch ein Argentinier, ein Mexikaner, ein Thai, ein Chinese oder ein Russe versteht und in dem er sich auch selbst wiederfindet.
SPEYER-KURIER: Das Familienstatut Ihrer Familien ist ja darauf angelegt, den Status von „Fuchs“ als Familienunternehmen auch in die Zukunft weiterzutragen. Gibt es denn heute schon eine vierte Generation im Hause Fuchs, die diese „Fackel der Verantwortung“ weitertragen könnte?
Stefan Fuchs: Die dritte Generation ist heute Mitte vierzig/ Anfang fünfzig und die vierte Generation wird an das Unternehmen über Familientage, Präsentationen und Rundgänge herangeführt; da muss man abwarten, was sich mit der Zeit entwickelt. Aber die Bindung der Familie an das Unternehmen ist extrem stark – die Aktien sind alle in der Familiengesellschaft gebündelt und von daher glaube ich, dass auch nach wie vor die Familie als Ankeraktionär die Unabhängigkeit von „Fuchs“ dauerhaft sicherstellt. Entscheidend ist, dass „Fuchs“ mit der Familie den Ankeraktionär hat, der die Unabhängigkeit als integralen Bestandteil unseres Geschäftsmodells sicherstellt.
SPEYER-KURIER: Nach der Vorstellung der jüngsten Halbjahreszahlen Ihres Unternehmens vor wenigen Wochen hat der SPEYER-KURIER „Solidität, Kontinuität“ und das in Ihren eigenen Veröffentlichungen immer wieder gerne apostrophierte „organische Wachstum“ als die Grundlagen Ihres Geschäftserfolgs bezeichnet, der dazu führte, dass „Fuchs“ in seiner inzwischen schon 82jährigen Unternehmensgeschichte noch nie „rote Zahlen“ geschrieben, noch in keinem Jahr nicht zumindest ein moderates Wachstum vermelden und seit dem Börsengang vor rund 30 Jahren stets ansehnliche Dividenden ausschütten konnte. Glauben Sie denn, dass Sie diese beeindruckende Erfolgsgeschichte auch unter den sich immer rascher verändernden Gegebenheiten eines globalisierten Wirtschaftssystems werden fortschreiben können?
 Stefan
Fuchs: Wir arbeiten fest daran. Für uns gilt es immer
wieder, auf die veränderten Marktbedingungen zu reagieren, denn
grundsätzlich verändern können wir diese Bedingungen ja nicht. Wir
haben Anwendungen, die über die Jahre wegfallen können und haben
Länder, die einmal besser laufen und andere, die dafür schlechter
laufen. Unterm Strich ist wichtig, dass man immer „so viele Eisen
im Feuer hat“, dass das Geschäft kontinuierlich wächst. Ich bin
sicher, dass wir mit unserem gegenwärtigen Wachstumsplan alles
dafür tun, dass wir auch in der Zukunft weiter wachsen. Es gibt
immer wieder neue Herausforderungen, doch was man in keinem Fall
tun darf, ist, sich zufrieden zurückzulehnen; das wäre der Anfang
vom Ende. Und deshalb muss man darauf achten, den Motor der
Entwicklung weiter am Laufen zu halten und sich immer wieder neue
Ziele zu stecken.
Stefan
Fuchs: Wir arbeiten fest daran. Für uns gilt es immer
wieder, auf die veränderten Marktbedingungen zu reagieren, denn
grundsätzlich verändern können wir diese Bedingungen ja nicht. Wir
haben Anwendungen, die über die Jahre wegfallen können und haben
Länder, die einmal besser laufen und andere, die dafür schlechter
laufen. Unterm Strich ist wichtig, dass man immer „so viele Eisen
im Feuer hat“, dass das Geschäft kontinuierlich wächst. Ich bin
sicher, dass wir mit unserem gegenwärtigen Wachstumsplan alles
dafür tun, dass wir auch in der Zukunft weiter wachsen. Es gibt
immer wieder neue Herausforderungen, doch was man in keinem Fall
tun darf, ist, sich zufrieden zurückzulehnen; das wäre der Anfang
vom Ende. Und deshalb muss man darauf achten, den Motor der
Entwicklung weiter am Laufen zu halten und sich immer wieder neue
Ziele zu stecken.
SPEYER-KURIER: Das „Geheimnis“ des Erfolgs von „Fuchs“ dürfte in seiner überaus beeindruckenden Innovationskraft zu finden sein. Nicht umsonst investiert Ihr Haus Jahr für Jahr ganz erhebliche Summen in die Entwicklung neuer Produkte. Vielleicht können Sie unseren Leserinnen und Lesern einmal kurz skizzieren, was – neben den zahllosen Schmierstoffen, die in der Produktion und im Betrieb z.B. von Automobilen eingesetzt werden - besonders herausragende, vielleicht auch „exotisch“ scheinende Anwendungen sind, die in Ihrem Haus „erfunden“ wurden und hier auch produziert werden?
Stefan Fuchs: Die gesamte Innovation unseres Hauses findet zum einen Teil in unseren Labors statt, zum anderen Teil bei unseren Kunden. Die Kunden geben uns in weiten Bereichen unseren Weg vor – mit ihnen lernen wir, wie sich unsere Produkte auf ihre Prozesse auswirken. Deshalb will der Kunde bei uns nicht z.B. x Liter eines Schmierstoffs kaufen, sondern er will einfach wissen: „Wie könnt Ihr - „Fuchs“- meine Prozesskosten verbessern und effizienter gestalten?“
Die Produkte, die wir herstellen, sind zum einen für Automobile im Einsatz – dazu zählen wir z.B. auch schon Straßenbaumaschinen, landwirtschaftliche Maschinen, LKW und PKW …
SPEYER-KURIER: ….also praktisch alles, was sich bewegt...
Stefan Fuchs:.. genau -dann aber auch lebensmittelgerechte Schmierstoffe, d.h. keine Maschinenschmierung im klassischen Sinne. Nehmen wir z.B. einmal moderne Abfüllanlagen: Da werden in der Stunde 60.000 Flaschen in einer Anlage abgefüllt und da ist es wichtig, dass das Produkt stets auch toxikologisch einwandfrei ist. Wenn einmal ein Tropfen des Schmiermittels ins Bier oder ins Mineralwasser kommt, dann muss das lebensmitteltechnisch unbedenklich sein. Das gilt auch für Produkte für Großbäckereien, für Großschlächtereien und von vielem anderen mehr.
Wir haben auch Produkte, die „halal“ und „koscher“ sein müssen – d.h. sie müssen den rituellen Ernährungsvorschriften von Muslimen oder Juden entsprechen, denen wir im Food-Bereich heute besondere Aufmerksamkeit schenken.
Wir haben z.B. auch Produkte für die Zementherstellung, die weltweit in den Zementwerken zum Einsatz kommen - wir haben Produkte, die bei der Erzeugung von Windenergie benutzt werden, wo wir die Getriebe der großen Windkraftanlagen schmieren – wir bearbeiten Themen wie „Umformschmierstoffe“ - d.h. Ihr Edelstahlbecken, das im Zuge der Herstellung umgeformt werden muss, wird mit einem Schmierstoff von uns bearbeitet - wir erzeugen schwer entflammbare Hydraulikflüssigkeiten für den Untertage-Bergbau – ich könnte Ihnen stundenlang immer weitere Anwendungen aufzählen – Sie haben ja selbst richtig gesagt – derzeit sind es 10.000 verschiedene Produkte.
Oder: Sie haben heute in Ihrem Auto schon mindestens drei verschiedene Öle und dreißig verschiedene Schmierfette...
SPEYER-KURIER: ...und im Vorfeld, in der Automobil-Produktion ist es vermutlich noch einmal ein Vielfaches davon...
 Stefan
Fuchs: ...ganz richtig, denn wir haben eine Vielzahl von
Produkten für die Metallbearbeitung. Das ganze Programm haben wir
dann noch in verschiedenen Verpackungsgrößen. Das heißt bei uns ist
'Komplexität' ein großes Thema.
Stefan
Fuchs: ...ganz richtig, denn wir haben eine Vielzahl von
Produkten für die Metallbearbeitung. Das ganze Programm haben wir
dann noch in verschiedenen Verpackungsgrößen. Das heißt bei uns ist
'Komplexität' ein großes Thema.
SPEYER-KURIER: Wir würden gerne noch auf ein Produkt Ihres Hauses zu sprechen kommen, das auf den ersten Blick so gar nichts mit einem Schmierstoff zu tun hat. Ich meine die Mittel, die dafür sorgen, dass meine Bank- oder Kreditkarte in den Bankomaten eingezogen und vor allem danach auch wieder unbeschadet und ohne Kratzer zurückgegeben wird. Das ist ja auch etwas, was in Ihrem Haus entwickelt wurde und mit dem Sie bis heute höchst erfolgreich am Markt sind?
Stefan Fuchs: Ja, das sind die sogenannten Trockenfilme. Die kommen z. B. auch beim Schließen der Sitzgurte im Auto und bei vielen anderen Anwendungen zum Einsatz, wo es darum geht, dass der Schmierstoff bei seinen Benutzern durch die Berührung keine lästigen Spuren hinterlässt. Auch hier gilt, dass unsere Produkte häufig „die stillen Helfer im Verborgenen“ sind. Dafür sind gerade diese Trockenfilme gute Beispiele: z.B. Schrauben, die mit einem solchen Trockenfilm beschichtet werden und damit quasi „vorgeschmiert“ sind oder ölfreie Kompressoren, bei denen solche Filme als Trockenschmierung zum Einsatz kommen.
SPEYER-KURIER: Herr Fuchs, wie kann man sich in einer sich so schnell entwickelnden Industrie über 80 Jahre – und das ist ja eine durchaus lange Zeit – diese enorme Innovationskraft erhalten?
Stefan Fuchs: Indem man sich immer wieder an den Kundenbedürfnissen orientiert und indem man ständig an und mit neuen Materialien forscht. Wir haben keine Raffinerie im klassischen Sinne und müssen deshalb keine vorgegebenen Grundöle benutzen, sondern sind auch in diesem Bereich sehr flexibel und breit aufgestellt und kommen Schritt für Schritt voran. Wir haben nie den bahnbrechenden 'blockbuster,' sondern unsere Entwicklung vollzieht sich in einem stetigen, kontinuierlichen Prozess. Dazu sind neben der Innovation auch die Produktqualität und die Partnerschaft mit unseren Kunden von größter Bedeutung, die – Gott sei Dank - auch heute, im Zeitalter des Internets, unverändert die Grundlagen einer vertrauensvollen Zusammenarbeit darstellen. Und das kann man nicht von heute auf morgen aufbauen, sondern das muss über Jahre und Jahrzehnte hinweg wachsen.
SPEYER-KURIER: Hinter jeder Innovation steckt ja zunächst eigentlich immer der Mensch – wo finden Sie die Menschen, die diese Innovationen entwickeln und weitertragen?
 Stefan
Fuchs: Wir haben ein tolles Team und sehr loyale
Mitarbeiter. „Fuchs“ ist über verschiedene Phasen hinweg gewachsen.
Wir hatten eine Phase mit vielen Akquisitionen, d.h. wir haben auch
eigene Firmenkulturen „eingekauft“, die wir erst auf Fuchs
„umpolen“ mussten. Wir sind dann aber auch wieder organisch
gewachsen in Ländern wie Russland oder China, in denen wir viele
neue Leute eingestellt haben, die wir auch an die 'Fuchs-Kultur'
heranführen mussten. In der Regel versuchen wir, vor allem junge
Leute in der Firma voranzubringen und anstehende
Nachfolgeregelungen aus den eigenen Reihen zu lösen. Das gelingt
zwar nicht immer, aber zumindest zu 90 Prozent hat sich jeder, der
bei uns im Hause Karriere gemacht hat, auch hier seine Sporen
verdient.
Stefan
Fuchs: Wir haben ein tolles Team und sehr loyale
Mitarbeiter. „Fuchs“ ist über verschiedene Phasen hinweg gewachsen.
Wir hatten eine Phase mit vielen Akquisitionen, d.h. wir haben auch
eigene Firmenkulturen „eingekauft“, die wir erst auf Fuchs
„umpolen“ mussten. Wir sind dann aber auch wieder organisch
gewachsen in Ländern wie Russland oder China, in denen wir viele
neue Leute eingestellt haben, die wir auch an die 'Fuchs-Kultur'
heranführen mussten. In der Regel versuchen wir, vor allem junge
Leute in der Firma voranzubringen und anstehende
Nachfolgeregelungen aus den eigenen Reihen zu lösen. Das gelingt
zwar nicht immer, aber zumindest zu 90 Prozent hat sich jeder, der
bei uns im Hause Karriere gemacht hat, auch hier seine Sporen
verdient.
SPEYER-KURIER: Bei der bereits angesprochenen Halbjahres-Pressekonferenz haben Sie von aktuellen Erweiterungs- und Neubauten in den USA, in China, Russland und in Brasilien berichten können. An wie vielen Standorten in der Welt ist der Schmiermittel-Spezialist „Fuchs“ heute eigentlich insgesamt vertreten?
Stefan Fuchs: Wir haben heute 33 Produktionsstandorte weltweit - dazu aber noch eine Vielzahl von Lagern und Büros, mit denen wir immer sehr nah an unseren Kunden sind. Unsere großen Produktionsstandorte sind vor allem in Mannheim und Kaiserslautern, aber auch in Chicago und zwei weitere in den USA. Darüber hinaus haben wir zwei Fabriken in England und in China, zwei in Australien, eine in Frankreich und noch einige mehr. Beispielsweise zwei in Südamerika, eine in Südafrika, um nur einige zu nennen.

SPEYER-KURIER: Inwieweit ist diese vielfältige Präsenz in den ganz unterschiedlichen Wirtschaftsräumen der Welt auch ein Garant für Ihren Geschäftserfolg?
Stefan Fuchs: Wir sind zum einen sehr breit aufgestellt, was unsere Produktpalette angeht – wir machen nur etwa ein Fünftel unseres Umsatzes mit der Automobilindustrie (PKW, LKW, Land- und Baumaschinen).
Wir sind aber auch regional sehr breit aufgestellt, machen etwas mehr als die Hälfte unseres Umsatzes in Europa inklusive Osteuropa – wir machen knapp 30 Prozent unseres Umsatzes in Asien, von dem wiederum allein ein Drittel aus China kommt - dazu um die 17 Prozent in Nord- und Südamerika. Es läuft nie alles gleich gut, es läuft aber auch nie alles gleichzeitig in eine Rezession hinein. Insoweit gleicht immer eine Region in der Welt bzw. eine Anwendung eine andere Region oder Anwendung aus. Und so können wir unser Wachstum auch in der Zukunft fortsetzen.
SPEYER-KURIER: Wie wirkt sich das auf den Börsenkurs der „Fuchs“-Aktie aus?
Stefan Fuchs: Ich bin davon überzeugt, dass der Aktienkurs eines Unternehmens langfristig – über viele Jahre hinweg - seinen Fundamentaldaten folgt. Und wenn Sie „Fuchs“ anschauen, dann ist unser Umsatz im Vergleich zu vor zehn Jahren doppelt so hoch wie damals. Und da wir in dieser Zeit auch viel an unserer Rendite gearbeitet haben, ist unser Ergebnis nach Steuern heute sechs Mal so hoch wie vor zehn Jahren. Wir haben unsere Bilanz entschuldet; durch die vielen Akquisitionen hatten wir eine relativ hohe Verschuldung. Diese wurde inzwischen komplett zurückgefahren – und das, obwohl wir in jedem Jahr Dividenden gezahlt, weiterhin Akquisitionen getätigt und investiert haben. Wir haben heute eine Gesellschaft mit einer guten Größenordnung und einer guten Ertragskraft sowie einer soliden Bilanz. Das hat dazu geführt, dass sich unser Aktienkurs in den letzten zehn Jahren verzwanzigfacht hat.
SPEYER-KURIER: Herr Fuchs, wie sieht denn der typische „Fuchs-Aktionär“ in dem Spannungsfeld zwischen Risiko und Sicherheit seiner Anlage aus?
Stefan Fuchs: Das ist schwierig zu sagen, weil wir alle in der Regel immer auf die Vergangenheit blicken. Wer seine Aktie schon lange hält, der hat natürlich bis heute gut daran verdient. Wer die Aktie auf dem jetzigen Niveau kauft, der gibt nicht zu erkennen, an welchem Ende der Skala zwischen Risiko und Sicherheit er sich selbst sieht. Was man aber allein schon aus den Zahlen der letzten Jahrzehnte ablesen kann: Die „Fuchs“-Aktie ist ein Papier, das über die Jahre hinweg, so denke ich, zu guten Erträgen geführt hat - sowohl aufgrund der Kurssteigerung wie auch aufgrund der Dividenden, die wir über die Jahre hinweg stets steigerten. Diese progressive Dividendenpolitik ist unser Ziel auch für die kommenden Jahre. Von daher denke ich, dass die Anleger auch weiterhin zufrieden mit ihrem „Fuchs“-Investment sein werden.
SPEYER-KURIER Welche Rolle spielen in diesem internationalen Netzwerk von Forschungs-, Entwicklungs- und Herstellungsstandorten die deutschen Niederlassungen Ihres Unternehmens? An Ihren zahlreichen Standorten in der ganzen Welt beschäftigt Ihr Haus ja derzeit 3.826 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Für diese schuf bereits Ihr Großvater im Jahr 1954 als eines der ersten Unternehmen dieser Größenordnung eine betriebliche Altersversorgung. Wie hat sich dieses soziale Engagement seitdem weiter entwickelt?
Stefan Fuchs: Wir haben eine sehr loyale Mannschaft, die zum Teil schon in der zweiten oder dritten Generation bei uns beschäftigt ist. Wir bezahlen unsere Mitarbeiter leistungsgerecht und haben eine geringe Fluktuation in der Mitarbeiterschaft. Dazu kommt, dass unser Unternehmen schuldenfrei ist und die Unabhängigkeit durch die Familie Fuchs sichergestellt ist – das sind für die Mitarbeiter hohe Werte. Außerdem werden wir auch weiterhin unseren Mittelpunkt hier in Mannheim haben, was wir ja auch durch die baulichen Investitionen in unsere Firmenzentrale hier auf der Friesenheimer Insel zum Ausdruck gebracht haben.
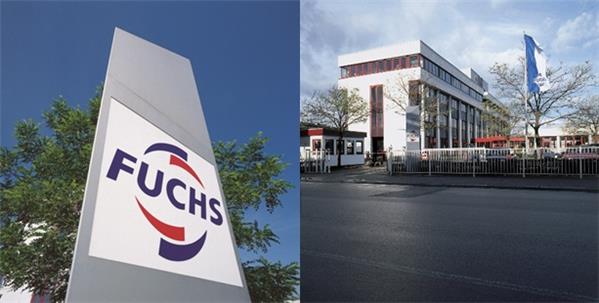
SPEYER-KURIER: In der bereits erwähnten Firmenchronik zum 75. Jubiläum Ihres Hauses „Fuchs 1931 – 2006 – 75 Jahre Kompetenz in Schmierstoffen“ haben Sie u.a. auch das gesellschaftliche Engagement Ihres Unternehmens vorgestellt.
Lesen Sie, liebe Leserinnen und Leser, dazu den entsprechenden
Beitrag in der Firmenchronik im Wortlaut im SPEYER-KURIER.

Was hat sich denn seit diesem Firmenjubiläum an diesem Engagement geändert – was ist gegebenenfalls noch zusätzlich dazugekommen?
 Stefan
Fuchs: Wir haben die Linie, die wir seit vielen
Jahrzehnten verfolgen, so fortgesetzt, wie sie in dem o.g. Beitrag
dargestellt ist. Wir haben Schwerpunkte im Sozialbereich – hier ist
unser Flaggschiff der „Fuchs-Förderpreis“, den wir in diesem Jahr
von 30.000 auf 50.000 Euro deutlich aufstocken und mit dem wir
viele ehrenamtliche Gruppen finanziell, aber durch öffentliche
Anerkennung fördern. Dafür können sich entsprechende Mannheimer
Institutionen bewerben – wir erhalten in der Regel rund 30
Bewerbungen für diesen Preis – die dann im Zusammenwirken mit dem
Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt Mannheim in einem fairen
Prozess ausgewählt werden. Bei der Verleihung der Preise stellen
die Verantwortlichen ihre Projekte vor und für uns ist es dann
stets die schönste Sache, zu erleben, wie viele Menschen freiwillig
und ehrenamtlich viele Stunden im Dienste der Allgemeinheit opfern.
Dass darunter oft auch Gruppen sind, die eher am Rande der
Gesellschaft stehen, freut uns deshalb ganz besonders, weil es
diese in Deutschland oft besonders schwer haben. Von daher ist der
Förderpreis auch das Flaggschiff unserer sozialen Aktivitäten.
Stefan
Fuchs: Wir haben die Linie, die wir seit vielen
Jahrzehnten verfolgen, so fortgesetzt, wie sie in dem o.g. Beitrag
dargestellt ist. Wir haben Schwerpunkte im Sozialbereich – hier ist
unser Flaggschiff der „Fuchs-Förderpreis“, den wir in diesem Jahr
von 30.000 auf 50.000 Euro deutlich aufstocken und mit dem wir
viele ehrenamtliche Gruppen finanziell, aber durch öffentliche
Anerkennung fördern. Dafür können sich entsprechende Mannheimer
Institutionen bewerben – wir erhalten in der Regel rund 30
Bewerbungen für diesen Preis – die dann im Zusammenwirken mit dem
Fachbereich Arbeit und Soziales der Stadt Mannheim in einem fairen
Prozess ausgewählt werden. Bei der Verleihung der Preise stellen
die Verantwortlichen ihre Projekte vor und für uns ist es dann
stets die schönste Sache, zu erleben, wie viele Menschen freiwillig
und ehrenamtlich viele Stunden im Dienste der Allgemeinheit opfern.
Dass darunter oft auch Gruppen sind, die eher am Rande der
Gesellschaft stehen, freut uns deshalb ganz besonders, weil es
diese in Deutschland oft besonders schwer haben. Von daher ist der
Förderpreis auch das Flaggschiff unserer sozialen Aktivitäten.
Daneben fördern wir die Universität Mannheim – davon haben wir durch die vielen Abgänger auch einen unmittelbaren Nutzen – wir arbeiten eng mit der RWTH in Aachen, der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule, zusammen und fördern die Hochschule Mannheim, die übrigens einen eigenen Lehrstuhl für Tribologie – die Lehre der Reibung – unterhält.
Im kulturellen Bereich arbeiten wir seit Jahren schon u.a. mit dem Nationaltheater Mannheim zusammen, unterstützen das Kurpfälzische Kammerorchester, die Schwetzinger Festspiele, die Kunsthalle Mannheim, die „Europäische Stiftung Kaiserdom zu Speyer“ und anderes mehr - also von daher gibt es viel Engagement in den drei Themenbereichen Kultur, Soziales und Wissenschaft, die wir auch weiter gerne fördern werden.
SPEYER-KURIER: Lassen Sie uns abschließend eine Prognose wagen: Wo sehen Sie Ihr Unternehmen, den „Fuchs Konzern“, in zwanzig Jahren?

Stefan Fuchs: Das ist immer eine gute Frage. Natürlich wollen wir weiter wachsen, wobei sich die regionalen Zusammensetzungen in der Welt verschieben. Ich denke, dass der Anteil von Asien an unserem Geschäft weiter wachsen wird, aber auch in Nord- und Südamerika erwarten wir weiteres Wachstum. Mittelfristig, so glaube ich, wird es so sein: 20 Prozent in Amerika – Nord- und Südamerika, 35 Prozent in Asien und 45 Prozent in Europa. Das heißt aber nicht, dass ein Bereich bzw. eine Region schrumpft, sondern, dass wir in einem anderen Bereich bzw. anderen Region schneller wachsen.
Und deshalb muss kein Mitarbeiter in Europa um seinen Job fürchten, da unser Engagement in China und Russland unser weltweites Geschäft mit Schlüsselkunden festigt. Für diese sind wir ein verlässlicher Partner; es gibt keine Firma, die wie wir mit dem kompletten Sortiment an Schmierstoffen – für alle Anwendungen - weltweit präsent ist.
Die Grundlage unseres künftigen Erfolgs wird sein, genug Nachwuchs im Unternehmen aufzubauen, damit wir die notwendigen Ressourcen bereitstellen können. Wir müssen auch weiter daran arbeiten, schneller und besser zu kommunizieren.
SPEYER-KURIER: ..aber auch weiterhin ohne sprunghaftes Wachstum, sondern mit einer eher behutsamem Entwicklung – auch was die Personalausstattung angeht?
Stefan Fuchs: Wir haben in den letzten Jahren unser Personal mit dem Schwerpunkt Forschung und Vertrieb deutlich aufgestockt – allein in den letzten drei Jahren um zehn Prozent. So wollen wir es auch weiterhin halten, dass entsprechend unserem Geschäft auch unsere Mannschaft weiterwachsen wird.
SPEYER-KURIER: Herr Fuchs, dann wünschen wir Ihnen auf diesem Weg viel Erfolg und bedanken uns namens der Leserinnen und Leser des SPEYER-KURIER für dieses höchst informative Gespräch.
Das Interview führte Gerhard Cantzler Fotos: gec/ Fuchs-Werksfotos
29.08.2013
Unternehmenskultur
 Verantwortung für die
Gesellschaft
Verantwortung für die
Gesellschaft
Mehr als 4.000 Menschen in 45 Ländern arbeiten heute für FUCHS PETROLUB.
Was sie verbindet, ist ihre Bereitschaft zum Einsatz für eine Firma, die vor 75 Jahren in Mannheim gegründet wurde und heute in aller Welt tätig ist. Mehr als 4.000 Menschen vieler Nationen und vieler Rassen bekennen sich damit zu einem Unternehmen, das offen ist für die Welt und gleichermaßen einsteht für seinen deutschen Standort, sie bekennen sich zu seiner Identität und Kultur.
Diese Werte formten sich im Lauf der Jahre und sind niedergelegt im Verhaltenskodex des FUCHS PETROLUB Konzerns wie auch im Familien-Statut der FUCHS-Familiengesellschaft, der Hauptaktionärin des Unternehmens.
In diesen Dokumenten sagt FUCHS, dass sich das Unternehmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung bewusst ist und alle seine geschäftlichen Aktivitäten an diesem Grundsatz ausrichtet. FUCHS respektiert demzufolge die Kulturen der Länder, in denen das Unternehmen tätig ist, und ihre geltenden Gesetze. FUCHS berücksichtigt die Rechte der Arbeit – wie beispielsweise die Vereinigungsfreiheit oder das Diskriminierungsverbot – die in den Kernarbeitsnormen der International Labour Organization formuliert sind.
Wer die Technologie- und Innovationsführerschaft in seinem
Arbeitsgebiet der Schmierstoffspezialitäten inne hat und behaupten
will, der pflegt seine Mitarbeiter. Diese Mitarbeiter sind stolz
darauf, für einen Weltmarktführer zu arbeiten. Sie haben Anteil
daran, dass im Airbus 380 ein Kühlschmierstoff von FUCHS
Bestandteil der Bauteilzulassung ist. Sie haben daran
mitgearbeitet, dass jeder zweite Pkw auf deutschen Autobahnen mit
einem FUCHS-Motorenöl fährt. Sie wissen, warum der Autositz im
Kraftfahrzeug bei minus 40 Grad Celsius in Finnland ebenso gut
funktioniert wie bei plus 50 Grad in Saudi Arabien – die
FUCHS-Forschung hat einige Jahre daran gearbeitet, bis das dort
eingesetzte Schmierfett Serienreife erlangt hat. Im eigenen Haus
achtet der Konzern darauf, dass Offenheit und Vertrauen herrschen
und dass die Motivation einer geeinten Mannschaft zum Tragen kommt.
Ressorts oder Gesellschaften kämpfen nicht gegeneinander,
Tochtergesellschaften nicht gegen die Konzernmutter, Intrigen
werden nicht geduldet. Die Führungskräfte wissen, dass sie
Vorbildfunktion haben und daran gemessen werden.
FUCHS will Kunden, Kapitalgebern, Mitarbeitern, und Standortnachbarn ein guter Partner sein. Das Unternehmen, das 10.000 Produkte für mehr als 100.000 Kunden in aller Welt fertigt, fühlt sich der Gesellschaft in vielfacher Hinsicht verpflichtet. Unternehmen sind nicht nur in Märkte eingebettet, sondern zugleich in ein gesellschaftliches Umfeld. Ihr Ansehen, ihre Attraktivität, ihre Wertschätzung hängt auch davon ab, wie sie sich in dieser Sphäre bewähren. FUCHS engagiert sich daher weltweit für zahlreiche gemeinnützige soziale und kulturelle Aufgaben. Einige Beispiele: In Südafrika ist das Unternehmen eingebunden in die Aids-Prävention; dieses bitterernste Problem des Landes betrifft dort auch die eigene Belegschaft. Englischkurse für die meist farbigen Mitarbeiter, Hilfe für finanzschwache Familien stehen in Südafrika ebenfalls auf der Agenda. In Saudi-Arabien initiiert und finanziert die ALHAMRANI-FUCHS Jugendprogramme, um das soziale Verhalten, die Verkehrssicherheit und das Umweltbewusstsein der Jugendlichen zu schulen. Kultur- und Musikförderung ist Bestandteil des Konzern-Engagements in Indien, Schüleraufklärung über das Great Barrier Reef und seine Umweltprobleme unterstützt FUCHS in Australien – die Bandbreite des sozialen Engagements ist groß.
Der Einsatz von FUCHS PETROLUB wird besonders spürbar im unmittelbaren Einzugsbereich des Unternehmens an seinem Sitz in Mannheim in der Europäischen Metropolregion Rhein-Neckar. FUCHS fördert seit Jahren vorbildliche Initiativen und Projekte in sozialen Einrichtungen der Stadt Mannheim. Dieses Engagement zeigt sich durch die Vergabe einen Förderpreises in Höhe von 20.000 Euro, der gemeinsam mit der Stadt Mannheim ausgeschrieben und jährlich vergeben wird. Dabei hilft FUCHS herausragenden Selbsthilfe-Initiativen und entsprechenden Projekten kleinerer Träger sozialer Einrichtungen. In den letzten Jahren wurde beispielsweise eine Anlaufstelle für Familien mit entwicklungsauffälligen Kindern im Vorschulalter unterstützt oder eine Mädchengruppe in einem sozialen Brennpunkt Mannheims, die ein online-Magazin herausgibt.
FUCHS ist überzeugt, dass Kunst und Kultur für die Gesellschaft unverzichtbar sind. Vor allem in Zeiten der leeren öffentlichen Kassen sind Kunst und Kultur auf die Partnerschaft der Wirtschaft angewiesen, auch wenn deren Hilfe nur ergänzenden Charakter haben kann. Die Grundversorgung im kulturellen Leben – so denkt man bei FUCHS – muss weiterhin von der öffentlichen Hand geleistet werden. Doch die Wirtschaft kann im Rahmen ihrer gesellschafts- und steuerrechtlichen Bestimmungen und ihrer Satzungen zusätzliche Impulse geben. Denn auch sie braucht die Kultur. Gute kulturelle Einrichtungen sind wichtiger Bestandteil der „weichen Standortfaktoren“, von denen die Lebensqualität einer Region zum guten Teil geprägt wird. Wenn die Wirtschaft diese pflegt, sorgt sie zugleich vor für das Wohlergehen ihrer Mitarbeiter und für die Gewinnung von Nachwuchs- und Führungskräften.
So engagiert sich FUCHS neben seinen weltweiten Anstrengungen am Unternehmenssitz vor allem für:
- Universität Mannheim
- Fachhochschule für Technik und Gestaltung
- Landesmuseum für Technik und Arbeit
- Nationaltheater Mannheim
- Kurpfälzisches Kammerorchester
- Staatliche Pop-Akademie Mannheim
- Kinderakademie Mannheim
- Kunsthalle Mannheim
29.08.2013
Interview der Woche
 Auf einen Tag
in Speyer: Der Wiener Zeichner, Graphiker und Radierer Prof. Herwig
Zens im Gespräch - Ausstellung
„Feuerbach-Paraphrasen“ im Speyerer Stadtarchiv
verlängert
Auf einen Tag
in Speyer: Der Wiener Zeichner, Graphiker und Radierer Prof. Herwig
Zens im Gespräch - Ausstellung
„Feuerbach-Paraphrasen“ im Speyerer Stadtarchiv
verlängert
Eigentlich sollte in dieser Woche, am 31. Juli 2013, Schluss sein mit der höchst sehenswerten Ausstellung der „Feuerbach-Paraphrasen“ des Wiener Zeichners, Graphikers und Radierers Prof. Herwig Zens. Aufgrund des ungebrochenen Publikums-Interesses haben die Verantwortlichen im Speyerer Stadtarchiv sich nun entschlossen, die Ausstellung bis mindestens Ende August zu verlängern.
Nachdem Prof. Zens bei der Eröffnung der Ausstellung am 03. April 2013 aufgrund einer akuten Erkrankung nicht dabei sein konnte, war der langjährige Professor an der Wiener Akademie für Bildende Kunst nun doch noch zu einem überraschende Besuch in die Domstadt gekommen, um die Ausstellung seiner Arbeiten im Speyerer Stadtarchiv kritisch zu begutachten. Bei dieser Gelegenheit traf der SPEYER-KURIER den bedeutenden Künstler, der sich dankenswerter Weise die Zeit nahm für ein ausführliches, mit viel „Wiener Charme und Schmäh“ gewürztes Gespräch.
Lesen Sie jetzt im SPEYER-KURIER unser Interview der Woche
heute mit Prof. Herwig Zens, Maler, Grahiker und Zeichner
Professor an der Akademie der bildenden Künste in Wien.
Geboren 1943 in Himberg bei Wien
Studium an der Akademie der bildenden Künste in Wien
1962 Besuch der „Schule des Sehens“ bei Oskar Kokoschka in Salzburg.
29.08.2013
SPEYER-KURIER: Herr Prof. Zens, herzlich willkommen in der Geburtsstadt des Malers Anselm Feuerbach, mit dem sie ja eine schon lange währende enge Verbindung haben. Wie kam es denn dazu?
 Prof. Herwig
Zens: Diese Verbindung stammt daher, dass es in der Wiener
Akademie der bildenden Künste, wo ich zwanzig Jahre lang als Lehrer
tätig sein durfte, eine riesige Aula im historistischen Sinne gibt.
Und diese Aula besitzt eine gigantische Decke, die von Feuerbach
mit einem Deckengemälde ausgemalt wurde. Sein Titel - typisch für
unser Haus - „Sturz der Titanen“. Dieses Bild ist auch von der
Technik her sehr interessant: Alle Leute glauben, dass es ein
Fresko wäre – das ist es aber nicht, sondern es sind vielmehr
riesige Leinwände, die zusammengenäht wurden. Und wenn man das
nicht genau weiß, dann erkennt man das von unten auch nicht. Und
dieses Deckenbild hängt faktisch bildverkehrt über der gesamten
Decke.
Prof. Herwig
Zens: Diese Verbindung stammt daher, dass es in der Wiener
Akademie der bildenden Künste, wo ich zwanzig Jahre lang als Lehrer
tätig sein durfte, eine riesige Aula im historistischen Sinne gibt.
Und diese Aula besitzt eine gigantische Decke, die von Feuerbach
mit einem Deckengemälde ausgemalt wurde. Sein Titel - typisch für
unser Haus - „Sturz der Titanen“. Dieses Bild ist auch von der
Technik her sehr interessant: Alle Leute glauben, dass es ein
Fresko wäre – das ist es aber nicht, sondern es sind vielmehr
riesige Leinwände, die zusammengenäht wurden. Und wenn man das
nicht genau weiß, dann erkennt man das von unten auch nicht. Und
dieses Deckenbild hängt faktisch bildverkehrt über der gesamten
Decke.
Das Verhältnis Feuerbachs zu unserem Haus war Zeit seines Hierseins ein sehr gespaltenes. Das beginnt schon damit, dass er gegen den Willen der Professoren vom Kaiser persönlich berufen wurde. Das haben die Kollegen natürlich als Affront empfunden und haben ihn das auch „anständig“ merken lassen. Und das endete dann auch so, dass er sich zurückgezogen hat in sein über alles geliebtes Venedig. Eigentlich wollte er ja ganz offiziell kündigen, was allerdings nicht so einfach möglich war. Und so wurde – und das ist für mich technisch heute noch ungeheuer imponierend – dieser ganze „Sturz der Titanen“ von Feuerbach in Venedig gemalt, danach zerlegt und das ganze Bild – es ist immerhin mindestens fünfzig Meter lang und 15 Meter breit – dann in Wien montiert. Es gab dann allerdings neue Schwierigkeiten mit dem sehr selbstbewussten Architkten des Akademie-Gebäudes, Theophil Hansen - so etwas wie ein „Superstar“ seiner Zunft in der damaligen Zeit - als der gespürt hat, dass dieses Riesengemälde faktisch den ganzen Raum schluckt.
Übrigens habe ich im Zusammenhang damit auf meiner Reise hierher durch Zufall in Freiburg im Breisgau etwas sehr Interessantes entdeckt: Dort hängt nämlich der erste Entwurf für dieses Deckengemälde und da reicht das an vier vier Seiten ganz bis zum Rand. Theophil Hansen hat dann allerdings durchgesetzt, dass das Bild auf ein Oval reduziert und rundherum vier Rosetten angeordnet wurden. Das gab dann natürlich auch wieder neue Schwierigkeiten mit Feuerbach – und am Ende gab's natürlich auch noch Ärger mit dem Bezahlen – halt alles so, wie das so üblich ist im Umgang mit der Wiener Akademie.
SPEYER-KURIER: In Speyer gibt es ja das Feuerbachhaus, in dem man Feuerbach weniger als den Maler als vielmehr als den frühen Zeichner erleben kann. Diese Leidenschaft für das Zeichnen ist ja auch etwas, was Sie mit Feuerbach verbindet?
 Prof. Herwig
Zens: Das Feurbachhaus in Speyer kenne ich sehr genau und
wenn Sie auf den Zeichner Feurbach anspielen: Die Akademie besitzt
stapelweise Entwurfszeichnungen Feuerbachs für das Deckengemälde,
und jetzt formuliere ich bewußt provokant oder auch dumm – so
langweilig seine Malerei ist, und so fremd uns diese Malerei heute
ist, so spannend und aufregend sind seine Skizzen. Da sind Dinge
dabei, die würde man nie für einen Feuerbach halten – einfach so
hingeschleudert. Der Feuerbach war ein absolut sicherer Zeichner
und diese Zeichnungen haben wir alle in Wien. Und da ich mich auch
sehr für Kunstgeschichte interessiere, war ich immer wieder mit
meinen Studenten oben im Kupferstichkabinett und haben uns das dort
angesehen. Und das war dann eigentlich auch der Ansatzpunkt, dass
der Herr Bentz (Dr. Oliver Bentz vom Stadtarchiv Speyer d.
Red.) sagte, „Lass uns ein paar von den alten Feuerbachskizzen
nehmen und Du machst dann ein Paraphrasen darüber. Wir haben eh'
keine Bilder in unserem Lesesaal hängen, deshalb mach sie bitte so
und so groß und dann passen sie genau dorthin“. Der Oliver Bentz
war also so etwas wie der Theophil Hansen in der ganzen
Geschichte.
Prof. Herwig
Zens: Das Feurbachhaus in Speyer kenne ich sehr genau und
wenn Sie auf den Zeichner Feurbach anspielen: Die Akademie besitzt
stapelweise Entwurfszeichnungen Feuerbachs für das Deckengemälde,
und jetzt formuliere ich bewußt provokant oder auch dumm – so
langweilig seine Malerei ist, und so fremd uns diese Malerei heute
ist, so spannend und aufregend sind seine Skizzen. Da sind Dinge
dabei, die würde man nie für einen Feuerbach halten – einfach so
hingeschleudert. Der Feuerbach war ein absolut sicherer Zeichner
und diese Zeichnungen haben wir alle in Wien. Und da ich mich auch
sehr für Kunstgeschichte interessiere, war ich immer wieder mit
meinen Studenten oben im Kupferstichkabinett und haben uns das dort
angesehen. Und das war dann eigentlich auch der Ansatzpunkt, dass
der Herr Bentz (Dr. Oliver Bentz vom Stadtarchiv Speyer d.
Red.) sagte, „Lass uns ein paar von den alten Feuerbachskizzen
nehmen und Du machst dann ein Paraphrasen darüber. Wir haben eh'
keine Bilder in unserem Lesesaal hängen, deshalb mach sie bitte so
und so groß und dann passen sie genau dorthin“. Der Oliver Bentz
war also so etwas wie der Theophil Hansen in der ganzen
Geschichte.
SPEYER-KURIER: Wir sehen ja heute auch sehr viele, zumeist jüngere Studenten, die das Zeichnen in seiner absoluten Exaktheit kaum noch kennengelernt haben und die statt dessen gleich „in die große Fläche“, in die Farbe gehen und darüber ganz vergessen, dass 'Malen' ja eigentlich ganz anders anfängt?
 Prof. Herwig
Zens: Na ja, das ist schon richtig, was Sie da sagen. Aber
wenn man's historisch betrachtet, dann war's eigentlich immer so,
dass die Älteren darüber 'gejeiert' (gejammert) haben, dass die
Jungen nichts mehr können. Und die Jungen haben gesagt: „Wer
braucht denn diesen 'Schmarren' schon“. Mir persönlich tut das
leid. Wenn ich mir die Studienpläne an den Akademien anschaue – bei
uns in Wien, aber auch hier sind sie sicher auch nicht anders –
dann gilt: Früher – und damit meine ich jetzt nicht „die guten
alten Zeiten“ - früher mussten z.B. die Architekten, abgesehen von
der Perspekive, auch täglich zwei Stunden 'Nachzeichnen' gehen. So
wie überhaupt jeder Student an der Akademie bis heute täglich von
fünf bis sieben Uhr Aktzeichnen gehen sollte – auch die
Restauratoren – einfach alle. Bei dieser Gelegenheit hat man dann
auch die Leute von den anderen Fakultäten kennengelernt und hat
dabei alles von der Pike auf gelernt. Und wenn man dadurch gelernt
hat, dass z.B. der Herr Boeckl gesagt hat – und ich sage das jetzt
nur so dahin – du musst die Köpfe viereckig zeichnen, dann hat man
sie halt absichtlich rund gemacht, weil man wusste ja schon immer
alles besser. Aber dieses Provozieren, diese Herausforderung war ja
auch der Sinn der Sache – dass einer da war, der einem sagte, so
geht’s und das musst Du erst einmal beherrschen. Und dann kam man
zu der eigenen Erkenntnis: Das ist eigentlich 'Blödsinn' – und das
braucht man nicht wirklich.
Prof. Herwig
Zens: Na ja, das ist schon richtig, was Sie da sagen. Aber
wenn man's historisch betrachtet, dann war's eigentlich immer so,
dass die Älteren darüber 'gejeiert' (gejammert) haben, dass die
Jungen nichts mehr können. Und die Jungen haben gesagt: „Wer
braucht denn diesen 'Schmarren' schon“. Mir persönlich tut das
leid. Wenn ich mir die Studienpläne an den Akademien anschaue – bei
uns in Wien, aber auch hier sind sie sicher auch nicht anders –
dann gilt: Früher – und damit meine ich jetzt nicht „die guten
alten Zeiten“ - früher mussten z.B. die Architekten, abgesehen von
der Perspekive, auch täglich zwei Stunden 'Nachzeichnen' gehen. So
wie überhaupt jeder Student an der Akademie bis heute täglich von
fünf bis sieben Uhr Aktzeichnen gehen sollte – auch die
Restauratoren – einfach alle. Bei dieser Gelegenheit hat man dann
auch die Leute von den anderen Fakultäten kennengelernt und hat
dabei alles von der Pike auf gelernt. Und wenn man dadurch gelernt
hat, dass z.B. der Herr Boeckl gesagt hat – und ich sage das jetzt
nur so dahin – du musst die Köpfe viereckig zeichnen, dann hat man
sie halt absichtlich rund gemacht, weil man wusste ja schon immer
alles besser. Aber dieses Provozieren, diese Herausforderung war ja
auch der Sinn der Sache – dass einer da war, der einem sagte, so
geht’s und das musst Du erst einmal beherrschen. Und dann kam man
zu der eigenen Erkenntnis: Das ist eigentlich 'Blödsinn' – und das
braucht man nicht wirklich.
Ich habe erst kürzlich mit dem Prof. Peichl gesprochen (der Architekt Prof. Gustav Peichl, d. Red.), der bis heute ein exzellenter Zeichner ist. Der hat wirklich nur darüber gejammert, dass die Studenten keine Persepektive mehr darstellen können, weil das Zeichnen nicht mehr händisch geübt wird, sondern weil nur noch am Computer gezeichnet wird. Ich weisss schon, dass das in der Bautechnik heute so üblich ist, aber deshalb ist ein Großteil der Studierenden heute auch nicht mehr in der Lage, einfach etwas kurz zu skizzieren.
Ich war selbst drei Jahre lang an der Erstellung der neuen Studienpläne an der Wiener Kunstakademie beteiligt. Dort wurden die verschiedenen Wünsche aus den Fächern an das Haus herangetragen und – ich werde das nie vergessen – da saß die ganze Zeit ein Mann still in einer Ecke des großen Vorlesungssaales und als dann schließliuch die Frage kam, ob noch jemand aus dem Bereich der verschiedenen Gewerke irgend welche Wünsche habe, dann ist der in seiner Ecke aufgestanden, hat sich als Polizeihauptmann „Sowieso“ vorgestellt und gesagt: „Meine Herren“ - wir waren damals überhaupt nur Herren im Lehrkörper der Akademie - „ich hab mir das jetzt alles angehört – ich hab es sowieso nicht verstanden, aber das macht ja nichts – aber ich sage Ihnen eines: Die Leute sind heute nicht einmal mehr im Stande, die einfachste Unfallskizze zu zeichnen, so dass man danach handeln kann. Wenn sie nicht ihren Fotoapparat bei sich haben, dann sind die Studenten nicht einmal mehr im Stande, die Situation, so wie sie war, festzuhalten. Auf der Grundlage eines Fotos aber können wir einen Unfallhergang nicht rekonstruieren - wie lang war der Bremsweg....“. Sie sehen also, unsere Fragesrtellung zielt noch in ganz, ganz andere - in ganz praktische Bereiche.
SPEYER-KURIER: Müsste man da aber nicht vielleicht schon viel früher ansetzen und den Kindern in der Schule „das Sehen beibringen“?
Prof. Herwig Zens: Na ja, bevor ich an die Akademie berufen wurde, war ich ja 23 Jahre selbst Lehrer. Es wird ja schon immer – und jetzt mit den Schulreformen noch viel mehr – das Fördern und das Zulassen der freien Gestaltung ganz obenan gesetzt. Das ist wunderbar und sicher auch alles richtig. Aber das entbindet dieses Fach 'Bildnerische Erziehung', wie man es bei uns in Österreich nennt, nicht davon, dass es dort auch 'erlernbare Inhalte' geben muss – also ein bisserl Kunstgeschichte hat noch nie jemand geschadet. Und wenn ich zum Beispiel lerne, wie man einen Würfel einigermaßen korrekt zeichnet, dann schadet das auch nicht. Dass das vielleicht einen Sechsjährigen nicht interessiert, das wissen wir. Aber spätestens in der Pubertät gehen die Kinder dann ab von dem 'freien Dahinzeichnen' und über zum 'Schön zeichnen'. Wir kennen ja alle diese Altersphasen, wo die Kinder dann dasitzen mit Fotos irgendwelcher Stars und versuchen, diese so ggenau wie irgend möglich nachzuzeichnnen. Und dabei kann man ihnen dann gewisse Tricks vermitteln, z.B. wie man eine gebogene Ebene oder einen Schattenwurf darstellt. Aber da sind wir schon wieder bei dem Jammern der Älteren über die Jungen – denn das alles geht dann leider oft unter in diesem 'Kreativitäts-Wahnsinn', der ja im Prinzip so garnichts bringt.
SPEYER-KURIER: Das heißt, Sie denken schon, dass man auch bei Kindern Kreativität stärker lenken muss?
Prof. Herwig Zens: Schauen Sie, ich kann ein irrsinniges Gebäude konstruieren, wie wir es z.B. bei einem Frank Gehry sehen können. Aber ich muss dennoch wissen, dass dazu erst einmal eine Basis gehört, auf der dieses Gebäude steht - und es hat noch nie jemand geschadet, wenn man ein paar Grundgesetze der Statik beherrscht. Und Statik gibt es im übertragenen Sinne auch bei der Malerei, der Graphik und so fort.
SPEYER-KURIER: Herr Prof. Zens, wie würden Sie denn generell die Zeichnung und das Zeichnen in dem Gesamtgefüge der Malerei definieren?
 Prof. Herwig
Zens: Na ja, da sprechen Sie das Urproblem an. Die einen
sagen, das Zeichnen ist eigentlich – wenn Sie es mit einem
Liebesakt vergleichen – das 'Vorspiel' der ganzen Geschichte, das
dann in der Malerei vollendet wird. An dieser Stelle ist aber
gerade auch Feuerbach sehr interessant, weil man gerade in der Zeit
des Historismus und des Klassizismus damit begonnen hat, der Linie
wieder sehr, sehr viel Gewicht zu geben. Da war ein Bild zunächst
einmal eine gezeichnete Angelegenheit, die mit Farbe angelegt
wurde. Das war eine Zeitentwicklung, die dann überrollt wurde – im
Impressionismus waren dann überhaupt keine Linien mehr da – in der
Abstrakten aber kommt sie dann interessanterweise wieder zurück –
denken Sie nur einmal an Kandinsky – das ist eine Sache der Zeit,
wem man mehr Gewicht gibt. Mir selbst wirft man vor, dass ich mit
der Farbe zeichne, drum werde ich auch immer als Graphiker
eingestuft, also etwa nach dem Motto: „Zeichnen kannst Du
vielleicht, aber Malen net...“. Was man hier in den
Feuerbach-Paraphrasen sieht, ist die Problematik 'Zeichnen –
Farbe'. So wie es hier in der Ausstellung hängt, ist das deshalb
nicht nur einen „Dahinschlamperei“, sondern mehr: Ich habe mich
ziemlich intensiv mit Feuerbach auseinandergesetzt und war deshalb
auch mehrfach hier im Speyerer Feuerbachhaus – auch seine
Biographie hat mich sehr interessiert und ich habe versucht, dieses
Spannungsverhältnis zwischen Linie und Farbe heute aufzulösen. Ob
mir das gelungen ist – ich weiss es nicht, das müssen andere
beurteilen.
Prof. Herwig
Zens: Na ja, da sprechen Sie das Urproblem an. Die einen
sagen, das Zeichnen ist eigentlich – wenn Sie es mit einem
Liebesakt vergleichen – das 'Vorspiel' der ganzen Geschichte, das
dann in der Malerei vollendet wird. An dieser Stelle ist aber
gerade auch Feuerbach sehr interessant, weil man gerade in der Zeit
des Historismus und des Klassizismus damit begonnen hat, der Linie
wieder sehr, sehr viel Gewicht zu geben. Da war ein Bild zunächst
einmal eine gezeichnete Angelegenheit, die mit Farbe angelegt
wurde. Das war eine Zeitentwicklung, die dann überrollt wurde – im
Impressionismus waren dann überhaupt keine Linien mehr da – in der
Abstrakten aber kommt sie dann interessanterweise wieder zurück –
denken Sie nur einmal an Kandinsky – das ist eine Sache der Zeit,
wem man mehr Gewicht gibt. Mir selbst wirft man vor, dass ich mit
der Farbe zeichne, drum werde ich auch immer als Graphiker
eingestuft, also etwa nach dem Motto: „Zeichnen kannst Du
vielleicht, aber Malen net...“. Was man hier in den
Feuerbach-Paraphrasen sieht, ist die Problematik 'Zeichnen –
Farbe'. So wie es hier in der Ausstellung hängt, ist das deshalb
nicht nur einen „Dahinschlamperei“, sondern mehr: Ich habe mich
ziemlich intensiv mit Feuerbach auseinandergesetzt und war deshalb
auch mehrfach hier im Speyerer Feuerbachhaus – auch seine
Biographie hat mich sehr interessiert und ich habe versucht, dieses
Spannungsverhältnis zwischen Linie und Farbe heute aufzulösen. Ob
mir das gelungen ist – ich weiss es nicht, das müssen andere
beurteilen.
SPEYER-KURIER: Herr Prof. Zens, Sie sind ja besonders bekannt geworden durch Ihr höchst umfangreiches druckgraphisches Werk. Wo sehen Sie denn in diesem Bereich heute noch eine Entwicklung? Es wird ja heute wahnsinnig viel gezeigt, ob man nur an die „Art Cologne“ denkt oder an die einschlägigen Messen in Mainz oder Basel?
 Prof. Herwig
Zens: Das kommt darauf an, was man unter Druckgraphik
versteht. Wenn ich darunter die Massenauflagen verstehe, die man
heute mit Hilfe der Digitalfotografie „herunterschustern“ kann,
dass es nur so „scheppert“ - oder wenn ich zu der klassischen
Druckgrafik zurückgehe – also Radierung, Lithographie oder den
Siebdruck – dann sind das ganz verschiedene Paar Schuhe. Lassen Sie
mich mal eine Anmerkung zu der klassischen Druckgrafik machen und
Ihnen ein Beispiel erzählen, das ich vor etwa drei Wochen erlebt
habe: Da treffe ich den Herrn Prof Damisch (Gunter Damisch, Prof.
für Graphik an der Wiener Akademie, d. Red.), der gerade
eine Ausstellung in der Albertina hat. Wir plaudern halt so über
seine Ausstellung und im Rahmen dieses Gesprächs frage ich ihn:
„Sag amal, Gunther, kann ma eigentlich Eure große Druckmaschine“ -
wir haben eine riesengroße Druckmaschine in der Akademie - „für
einen Tag zum Drucken mieten?“ Die war nämlich früher immer
besetzt. Da hat mich Damisch lächelnd angeblickt und gesagt: „Da
kannst a ganze Woch'n drucke auf dem Ding – es druckt heut' eh
niemand mehr“. Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Böses – dies
aber ganz bewußt: Der Anteil der weiblichen Studenten an der
Akademie ist extrem angewachsen. Als ich studierte, da war das
Verhältnis etwa achtzig zu zwanzig Pozent männlich – weiblich,
wobei die weiblichen Studenten meistens in den Bereichen
Restaurierung und Textiles Gestalten zu finden waren – heute aber
können Sie das ruhig schon umdrehen. In der Graphik haben wir zur
Zeit 65 Studenten, davon sind üer 40 Damen. Und jetzt sage ich
absichtlich etwas Böses: Die Damen machen sich nicht gerne die
Finger dreckig und das Drehen von dem „Radel“ über den
Kupferplatten ist extrem anstrengend. Und außerdem sind die
Studenten heute – und das ist jetzt überhaupt keine Wertung - ganz
schön clever – egal, ob männlich oder weiblich. Ich habe meine
Studenten einmal gefragt, warum sie sich immer weniger für
Radierungen interessieren. Und da haben die mich milde lächelnd
angeschaut wie den „depperten Alten“ und gesagt: „Schaun's, Herr
Professor, bevor ich eine Radierung mach, habe ich schon drei
Aquarelle gemalt.. - Und für die ganze Auflage einer Radierung, die
ich sowieso nie komplett verkaufe, bekomme ich vielleicht, wenn's
gut geht, nach Abzug der Galerieprovision maximal 2.000 Euro – für
drei Aquarelle krieg' ich 6.000 Euro. Warum soll ich mir dann das
mit den Radierungen antun?“ Das ist also eine absolut logische
Angelegenheit.
Prof. Herwig
Zens: Das kommt darauf an, was man unter Druckgraphik
versteht. Wenn ich darunter die Massenauflagen verstehe, die man
heute mit Hilfe der Digitalfotografie „herunterschustern“ kann,
dass es nur so „scheppert“ - oder wenn ich zu der klassischen
Druckgrafik zurückgehe – also Radierung, Lithographie oder den
Siebdruck – dann sind das ganz verschiedene Paar Schuhe. Lassen Sie
mich mal eine Anmerkung zu der klassischen Druckgrafik machen und
Ihnen ein Beispiel erzählen, das ich vor etwa drei Wochen erlebt
habe: Da treffe ich den Herrn Prof Damisch (Gunter Damisch, Prof.
für Graphik an der Wiener Akademie, d. Red.), der gerade
eine Ausstellung in der Albertina hat. Wir plaudern halt so über
seine Ausstellung und im Rahmen dieses Gesprächs frage ich ihn:
„Sag amal, Gunther, kann ma eigentlich Eure große Druckmaschine“ -
wir haben eine riesengroße Druckmaschine in der Akademie - „für
einen Tag zum Drucken mieten?“ Die war nämlich früher immer
besetzt. Da hat mich Damisch lächelnd angeblickt und gesagt: „Da
kannst a ganze Woch'n drucke auf dem Ding – es druckt heut' eh
niemand mehr“. Und jetzt sage ich Ihnen etwas ganz Böses – dies
aber ganz bewußt: Der Anteil der weiblichen Studenten an der
Akademie ist extrem angewachsen. Als ich studierte, da war das
Verhältnis etwa achtzig zu zwanzig Pozent männlich – weiblich,
wobei die weiblichen Studenten meistens in den Bereichen
Restaurierung und Textiles Gestalten zu finden waren – heute aber
können Sie das ruhig schon umdrehen. In der Graphik haben wir zur
Zeit 65 Studenten, davon sind üer 40 Damen. Und jetzt sage ich
absichtlich etwas Böses: Die Damen machen sich nicht gerne die
Finger dreckig und das Drehen von dem „Radel“ über den
Kupferplatten ist extrem anstrengend. Und außerdem sind die
Studenten heute – und das ist jetzt überhaupt keine Wertung - ganz
schön clever – egal, ob männlich oder weiblich. Ich habe meine
Studenten einmal gefragt, warum sie sich immer weniger für
Radierungen interessieren. Und da haben die mich milde lächelnd
angeschaut wie den „depperten Alten“ und gesagt: „Schaun's, Herr
Professor, bevor ich eine Radierung mach, habe ich schon drei
Aquarelle gemalt.. - Und für die ganze Auflage einer Radierung, die
ich sowieso nie komplett verkaufe, bekomme ich vielleicht, wenn's
gut geht, nach Abzug der Galerieprovision maximal 2.000 Euro – für
drei Aquarelle krieg' ich 6.000 Euro. Warum soll ich mir dann das
mit den Radierungen antun?“ Das ist also eine absolut logische
Angelegenheit.
SPEYER-KURIER: Dennoch sollen ja gerade Ausstellungen wie die Mainzer „Minipessen-Messe“ so erfolgreich sein wie nie?
Prof. Herwig Zens: Na ja, das ist so ein „Justament-Standpunkt“, wie wir das in Wien so nennen. Ich arbeite seit Jahren mit einem Vertreter dieses Genres zusammen: Der macht Bücher mit rein bibliophilem Charakter und hat dafür in seinem Keller eine kleine Offset-Lithomaschine aufgestellt. Wir haben jetzt schon ein paar Bücher miteiander gemacht und wenn ich wirklich gut drauf bin, dann fahre ich am Mittag zu ihm hinauf – der lebt etwas nördlich von Wien – der gibt mir dann das Manuskript für das Buch, das ich zuvor überhaupt noch nicht gesehen hab – dann geh'n wir essen, weil seine Frau sehr gut kocht - dann schaun wir, dass wir nicht verdurst und dann geh' ich mit ihm in den Keller hinunter und wenn ich gut drauf bin, dann ist das Buch bis am Abend fertig. Da ist sicher auch schon viel daneben gegangen, das geb' ich zu, aber einige der Bücher können sich durchaus sehen lassen. Und der Mann lebt mit seinen Büchern und der hat mir auch berichtet: In Mainz, das läuft wie „geschmiert“ - aber nur in diesen Kleinstauflagen - das sind diese „Narren“, die sagen: Jetzt mach ich's justament so...“
SPEYER-KURIER: Es gibt also einen kleinen Kreis von Liebhabern, die sich ganz intensiv mit diesem Genre beschäftigen, das aber weitgehend an der Gesamtgesellschaft vorbeigeht....
 Prof. Herwig
Zens: Das ist richtig und ich möchte das einmal mit einem
Erlebnis vergleichen, das ich gestern hatte, als ich mit meiner
Frau über die Speyerer Hauptstraße gegangen bin: Also jeder zweite
'Depp' – ich auch – hat ja heute eine Digitalkamera oder er hat
sein i-Pad dabei, wenn er auf den Dom zugeht. Dann hört man nur
noch die Kameraverschlüsse klicken. Dadurch wird man heute
'zugeschüttet' mit Bildern bis zum Geht-nicht-mehr. Dann aber sah
ich dort einen stehen mit einer Leica – allein beim Anblick hat
mich der Neid g'fressen – und der hat da herumgetan und Objektive
gewechselt. Und da kam ich nicht umhin, ihn anzusprechen und zu
fragen: „Ist das Modell sowieso aus dem Jahr 1948?“ - Und dann sagt
der: „Ja, genau das ist es...“ - Darauf ich: „Ich hoffe, Sie
fotographieren nur schwarz-weiss?“ Da schaute der mich an, als
wollte er sagen: „Glaub'n Sie, ich wär ein Depp und fotographier'
mit einer Leica farbig?“
Prof. Herwig
Zens: Das ist richtig und ich möchte das einmal mit einem
Erlebnis vergleichen, das ich gestern hatte, als ich mit meiner
Frau über die Speyerer Hauptstraße gegangen bin: Also jeder zweite
'Depp' – ich auch – hat ja heute eine Digitalkamera oder er hat
sein i-Pad dabei, wenn er auf den Dom zugeht. Dann hört man nur
noch die Kameraverschlüsse klicken. Dadurch wird man heute
'zugeschüttet' mit Bildern bis zum Geht-nicht-mehr. Dann aber sah
ich dort einen stehen mit einer Leica – allein beim Anblick hat
mich der Neid g'fressen – und der hat da herumgetan und Objektive
gewechselt. Und da kam ich nicht umhin, ihn anzusprechen und zu
fragen: „Ist das Modell sowieso aus dem Jahr 1948?“ - Und dann sagt
der: „Ja, genau das ist es...“ - Darauf ich: „Ich hoffe, Sie
fotographieren nur schwarz-weiss?“ Da schaute der mich an, als
wollte er sagen: „Glaub'n Sie, ich wär ein Depp und fotographier'
mit einer Leica farbig?“
Also, nur zum Vergleich: Da sind die Horden die auf den Dom zutrampeln, um der Tante Amalie in Worms zu zeigen, wie der Dom in Speyer aussieht und der probiert da mit seiner Kamera herum...“. Oder bleiben wir hier im Stadtarchiv: Der Dr. Bentz hat uns gestern durch die Räume geführt und da lag irgendwo ein Lederkästchen herum. Und da sag' ich zu meiner Frau: „Das ist eine alte Agfa-Box“. Und meine Frau hat dann auch so Glitzeraugen bekommen, denn des war nämlich unser erster Fotoapparat. Und da war es üblich – weil Geld hatten wir keines – einen Film pro Urlaub zu verknipsen - also zwölf Aufnahmen. Und da hat man sich genau überlegt, was man fotografiert – einmal Du auf dem Baumstamm sitzend, einmal ich auf dem Baumstamm sitzend – und um die Romantik auf die Spitze zu treiben, wurde der Film am Ende des Urlaubs zum Fotographen gebracht oder man hat ihn selbst entwickelt, und wenn man dann heimgekommen ist mit den zwölf Fotos , von denen sowieso sieben verwackelt waren, dann war das eine großartige Angelegenheit. Und das ist halt heute alles weg.
SPEYER-KURIER: Das ist ja beim Film ähnlich. In der Zeit, als man noch mit 16mm-Film gearbeitet hat, da musste man sich vorher genau überlegen, wie der Schnitt, wie die Sequenz am Ende aussehen soll. Denn wenn das Material gedreht war, dann war alles vorbei. Heute kann man sagen: Das löschen wir einfach und machen es noch ein, zwei, dreimal neu. Das ist sicher einerseits ein Vorteil, aber andererseits auch ein Nachteil, weil eigentlich plötzlich jeder glaubte, 'Film' machen zu können.
Herr Prof. Zenz, Sie sind ja derzeit in vielen Projekten untewegs und haben heute hier in Speyer nur zwischen zwei anderen Stationen mit Ihrer Gattin kurz einen Stopp eingelegt. Was ist es denn, was Sie derzeit und in der näheren Zukunft beschäftigt?
 Prof. Herwig
Zens: Ich habe in Wien im Herbst in der „Kleinen Galerie“
eine größere Ausstellung mit etwa hundert Arbeiten – dann eine sehr
schöne Ausstellung im Paris – bis heute dem 'Mekka' der Kunst - und
dann, was mich auch sehr gefreut hat, dass die Kupferstichsammlung
der Österreichischen Nationalbiliothek sechs Arbeiten von mir
angekauft hat. Dabei ist es mir weniger um die fünf-, sechshundert
Euro gegangen, sondern allein um die Tatsache, in dieser Sammlung
vertreten sein zu dürfen. Das ist der eine Sinn des Ausstellens,
dann aber auch – wenn Sie Druckgraphik machen – die Möglichkeit,
aufgrund der Auflagen an mehreren Orten gleichzeitig Ihre Arbeiten
zu zeigen.
Prof. Herwig
Zens: Ich habe in Wien im Herbst in der „Kleinen Galerie“
eine größere Ausstellung mit etwa hundert Arbeiten – dann eine sehr
schöne Ausstellung im Paris – bis heute dem 'Mekka' der Kunst - und
dann, was mich auch sehr gefreut hat, dass die Kupferstichsammlung
der Österreichischen Nationalbiliothek sechs Arbeiten von mir
angekauft hat. Dabei ist es mir weniger um die fünf-, sechshundert
Euro gegangen, sondern allein um die Tatsache, in dieser Sammlung
vertreten sein zu dürfen. Das ist der eine Sinn des Ausstellens,
dann aber auch – wenn Sie Druckgraphik machen – die Möglichkeit,
aufgrund der Auflagen an mehreren Orten gleichzeitig Ihre Arbeiten
zu zeigen.
Und schließlich geben Sie einem Galeristen hundert Blätter, von denen er von vorne herein einige verschwinden lässt – das sind ja eh'alles Betrüger -und dann kommen Sie nach zwei, drei Jahren wieder vorbei und bekommen von ihm vielleicht 280 Euro und können damit essen gehen. Aber das ist ja auch ganz schön....
Also kurz: Ich stelle sehr gerne aus – nicht zuletzt, weil ich inzwischen fast schon in den Blättern in meinem Atelier ersticke. Bedingt ist das dadurch, dass ich sehr geschwind arbeite, halt sehr schnell. Dann entstehen zwischendurch aber auch immer wieder so Lücken, da geht garnichts und da macht man halt den ganzen administrativen 'Schmarren' Deshalb liebe ich es auch so, durch einen Termin gezwungen zu werden, eine Arbeit zu Ende zu bringen. Meine Ftrau bringt das immer wieder zur Raserei - „in einer Woche ist schon die Eröffnung der Ausstellung und Du hast noch nicht einmal angefangen“ usw. Und je kürzer es wird mit der Zeit und je unmöglicher, eigentlich noch fertig zu werden, desto lieber hab ich das.
SPEYER-KURIER: Das merkt man dann ja auch an der Dynamik, die aus Ihren Arbeiten spricht....
Prof. Herwig Zens: Ja genau, obwohl es ja nichts besagt, wenn man mit einer Arbeit schon in einer dreiviertel Stunde fertig ist. Ich habe mich, wie schon gesagt, zum Beispiel wochenlang mit dem Feuerbach auseinandergesetzt – da gibt es ganze Stapel mit Zeichnungen und Entwürfen und dann macht man am Ende die Endfassungen. Ob da alles wirklich gelungen ist, das ist ja dann eine ganz andere Frage und eigentlich am Ende auch völlig wurscht.
SPEYER-KURIER: Welche Themen wollen Sie sich denn in der nächsten Zeit so vornehmen?
 Prof. Herwig
Zens: Ich willl also in jedem Fall an dem Thema der
Mythologie weiterarbeiten. Das ist eine Bereich, der interessiert
mich ungeheuer, besonders die Figuren, die nicht so bekannt sind
wie zum Beispiel die Europa. Ich lese da sehr gerne darüber und
kenne auch eine ganze Menge Altphilologen sehr gut – das
interessiert mich und deshalb geistere ich auch immer wieder in der
Türkei und in Griechenland herum, um dort die Schauplätze zu
besuchen. Dann ist es aber auch die reine Landschaft; das hat sich
zunehmend auf die Städtelandschaft konzentriert – also auf die
klassische, „alte“ Verdute - das ist immer noch mein „Spielzeug“.
Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich jetzt zwei Tage
in Straßbourg war und dort herumgerannt bin. Nicht, dass ich es so
gut gekonnt hätte wie der Caspar David Friedrich - die Stadt von
hinten und von vorne zu zeichnen – ich sage noch einmal: Auch ich
habe eine Digital-Kamera und hätte das alles auch fotografieren
können – aber nehmen Sie nur einmal diesen Engelspfeiler, den ich
natürlich vorher schon gekannt habe – wenn Sie den einmal zeichnen,
wie der Bogen von dem Flügel ausgeht, dann ist das schon etwas
anderes als eine Fotografie. ...Wie heißt es so richtig? Man sieht
nur, was man zeichnet..... Ich denke, das ist ein gutes Wort.
Prof. Herwig
Zens: Ich willl also in jedem Fall an dem Thema der
Mythologie weiterarbeiten. Das ist eine Bereich, der interessiert
mich ungeheuer, besonders die Figuren, die nicht so bekannt sind
wie zum Beispiel die Europa. Ich lese da sehr gerne darüber und
kenne auch eine ganze Menge Altphilologen sehr gut – das
interessiert mich und deshalb geistere ich auch immer wieder in der
Türkei und in Griechenland herum, um dort die Schauplätze zu
besuchen. Dann ist es aber auch die reine Landschaft; das hat sich
zunehmend auf die Städtelandschaft konzentriert – also auf die
klassische, „alte“ Verdute - das ist immer noch mein „Spielzeug“.
Das war übrigens auch einer der Gründe, warum ich jetzt zwei Tage
in Straßbourg war und dort herumgerannt bin. Nicht, dass ich es so
gut gekonnt hätte wie der Caspar David Friedrich - die Stadt von
hinten und von vorne zu zeichnen – ich sage noch einmal: Auch ich
habe eine Digital-Kamera und hätte das alles auch fotografieren
können – aber nehmen Sie nur einmal diesen Engelspfeiler, den ich
natürlich vorher schon gekannt habe – wenn Sie den einmal zeichnen,
wie der Bogen von dem Flügel ausgeht, dann ist das schon etwas
anderes als eine Fotografie. ...Wie heißt es so richtig? Man sieht
nur, was man zeichnet..... Ich denke, das ist ein gutes Wort.
SPEYER-KURIER: ...und könnte fast schon so etwas wie ein Schlusswort sein. Ich möchte aber zuvor doch noch kurz auf ein anderes Thema kommen: Es gibt für Sie ja zu Speyer noch eine andere Verbindung – die nämlich zu unserem gemeinsamen Freund Thomas Duttenhoefer. Von ihm haben wir ja im SPEYER-KURIER im Rahmen der Berichterstattung über die Eröffnung Ihrer Ausselluung der „Feuerbach-Paraphrasen“ den Film über die Entstehung einer Plastik gezeigt, eines Kopfes, für den Sie selbst ihm Modell gesessen haben.
 Prof. Herwig
Zens: Ja, der Duttenhoeffer - der ist auch noch so ein
klassisches Schlachtross nach altem Massstab. Und Sie haben ja
erwähnt, wie er diesen Kopf von mir geschaffen hat. Das war auch
für mich faszinierend, wie er in knapp zehn Minuten diesen
„Plotzer“ hingebracht hat. Diese Zehn-Minuten-Fertigkeit ist
natürlich durch ein mehr als zehnjähriges Lernen geprägt. Wir haben
uns manchesmal gegenseitig an die Brust geworfen und gejammert:
„Die heutige Jugend lernt überhaupt nichts mehr“ - Thomas und ich
haben aber unser ganzes Leben lang auch versucht, den Studenten
irgendwelche erlernbaren Gundlagen zu vermitteln.
Prof. Herwig
Zens: Ja, der Duttenhoeffer - der ist auch noch so ein
klassisches Schlachtross nach altem Massstab. Und Sie haben ja
erwähnt, wie er diesen Kopf von mir geschaffen hat. Das war auch
für mich faszinierend, wie er in knapp zehn Minuten diesen
„Plotzer“ hingebracht hat. Diese Zehn-Minuten-Fertigkeit ist
natürlich durch ein mehr als zehnjähriges Lernen geprägt. Wir haben
uns manchesmal gegenseitig an die Brust geworfen und gejammert:
„Die heutige Jugend lernt überhaupt nichts mehr“ - Thomas und ich
haben aber unser ganzes Leben lang auch versucht, den Studenten
irgendwelche erlernbaren Gundlagen zu vermitteln.
Was aber erschreckend ist bei den Jungen – und arüber hat sich schon Sokrates beschwert – ist, dass da oft die einfachsten Grundlagen fehlen. Der Duttenhoefer hat mir jetzt erzählt, dass in einem Referat, das er gehalten hat, der Name 'Büchner' fiel – und keiner der 18 Studenten, die da saßen – 19-, 20jährige -, hatte je zuvor den Namen 'Georg Büchner' gehört.
Anderes Beispiel: Ich habe jetzt über vier Jahre hindurch einen großen Kunstgeschichts-Zyklus gelesen und – vielleicht ist es mein Fehler, dass ich diesen Mythologie-Tick habe – die Daten des Herkules, die hat kein Mensch gekannt und keiner hat eine Ahnung gehabt, was der gemacht hat - geschweige denn warum. Und da wird’s dann schon schwer, Zusammenhänge zu erklären, denn wenn ich mir z.B. einen Baselitz anschaue oder einen Lüpertz, dann kann ich das nicht verstehen, wenn ich die Vorgeschichte nicht kenne.
SPEYER-KURIER: Lieber Herr Prof Zenz, dann dürfen wir uns sehr herzlich für dieses charmante, aber auch offene Gespräch bedanken und gemeinsam mit Ihnen hoffen, dass auch zukünftig talentierte, junge Zeichner und Maler nachwachsenb, die sich an dem orientieren, was Generationen vor ihnen geschaffen haben – vielleicht auch der eine oder andere an Ihrem Werk, lieber Herr Prof. Zens.
Das Gespräch mit Prof. Zens führte Gerhard Cantzler / Foto: gc
29.08.2013
Interview der Woche
 Heute mit Dr. med. Cornelia Leszinski
Heute mit Dr. med. Cornelia Leszinski
Chefärztin der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer
Geb. 1964 in Speyer
1970 - 1974 Roßmarkt-Grundschule in Speyer
1974 - 1982 Gymnasium am Kaiserdom in Speyer
1982 - 1988 Studium der Humanmedizin an der Johannes-Gutenberg-Universität Mainz 1989 Promotion
1988 - 1989 St. Marienkrankenhaus Ludwigshafen
 1989 - 2000
Chirurgische Kliniken des Klinikums Worms
1989 - 2000
Chirurgische Kliniken des Klinikums Worms
1995 Facharztanerkennung als Chirurgin
1997 Facharztanerkennung als Unfallchirurgin
2001 – 2013 Oberärztin in der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie im
Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer
2008 Facharztanerkennung als Viszeralchirurgin
01.04.2013 Berufung zur Chefärztin für Allgemein- und Viszeralchirurgie im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer
18.07.2013
SPEYER-KURIER: Frau Dr. Leszinski, Ihr Berufsstand – die Chirurgen – steht derzeit heftig in der öffentlichen Kritik. Zu oft werde in Deutschland das Skalpell angesetzt – Operationen, die man ja durchaus als die 'radikalste' Form einer medizinischen Behandlung bezeichnen kann, würden vorschnell durchgeführt. Auch wenn man sich immer vor pauschalen Angriffen und vorschnellen Urteilen hüten sollte – wie sieht es in deutschen Operationssälen wirklich aus? Wird heute wirklich zu schnell operiert?
 Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist eine Frage, die man aus meiner
Sicht gar nicht so einfach beantworten kann. Die Vorhaltungen, die
gemacht werden, sind sicher fundiert. Sie basieren auf Statistiken
- insbesondere auf europäischen Vergleichstatistiken. Und dabei
läuft es insbesondere immer wieder auf drei Operationstypen hinaus:
Das sind die Endoprothesen – also der operative Gelenkersatz bei
Arthrose – das sind zum zweiten die Herzkatheter-Untersuchungen und
schließlich die Bandscheiben-Operationen. Da fällt Deutschland aus
dem europäischen Vergleichsrahmen heraus. Das ist ein Faktum und
das muss man zunächst einmal so akzeptieren. Ob man daraus
allerdings zu Recht die Folgerung ziehen darf, es werde vorschnell
und – im Sinne einer Wertung – zu viel operiert, das ist eine ganz
andere Frage. Sicher wird heute mehr operiert als früher.....
Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist eine Frage, die man aus meiner
Sicht gar nicht so einfach beantworten kann. Die Vorhaltungen, die
gemacht werden, sind sicher fundiert. Sie basieren auf Statistiken
- insbesondere auf europäischen Vergleichstatistiken. Und dabei
läuft es insbesondere immer wieder auf drei Operationstypen hinaus:
Das sind die Endoprothesen – also der operative Gelenkersatz bei
Arthrose – das sind zum zweiten die Herzkatheter-Untersuchungen und
schließlich die Bandscheiben-Operationen. Da fällt Deutschland aus
dem europäischen Vergleichsrahmen heraus. Das ist ein Faktum und
das muss man zunächst einmal so akzeptieren. Ob man daraus
allerdings zu Recht die Folgerung ziehen darf, es werde vorschnell
und – im Sinne einer Wertung – zu viel operiert, das ist eine ganz
andere Frage. Sicher wird heute mehr operiert als früher.....
Es gehört aber zu jeder Operation auch die Frage, ob sie sinnvoll ist - welchen Nutzen sie dem Patienten bringt und welches Risiko dem gegenüber steht. Und in unserem Gesundheitssystem kommt dazu auch noch die Frage: Werden die Kosten übernommen?
Was die Nutzen-Seite betrifft, so kann ich zu Herzkatheter-Untersuchungen nichts sagen - das ist ein Thema, von dem ich selbst zu wenig verstehe. Bei den Arthrose-Eingriffen – also bei Bandscheiben-OPs und Endoprothesen-Implantation ist der Nutzen ein subjektiver. Die körperliche Belastbarkeit von Menschen wird erhöht, indem durch natürlichen Verschleiß hervorgerufene Beschwerden wieder aufgehoben werden. Diese Möglichkeit gibt es schon länger. Wie hoch dieser Nutzen aber bewertet wird, hängt von dem einzelnen Patienten und von seinen individuellen Ansprüchen ab. Und diese haben sich im Laufe der Jahre deutlich gewandelt: Ein 70jähriger ist heute nicht mehr damit zufrieden, dass er schmerzfrei in seinem Lehnstuhl sitzen kann, sondern er möchte auch noch Fahrrad fahren oder vielleicht noch wandern oder tanzen gehen – und das auch noch mit achtzig.
Schmerzfrei im Stuhl sitzen geht auch mit Arthrose und Schmerzmitteln – will jemand noch Fahrrad fahren, dann reicht das allerdings nicht mehr aus. Das heißt, der Patientenwunsch nach einer wirklich vollständigen Beschwerdefreiheit – also einer viel weiter gehenden Wiederherstellung der Gesundheit – ist heute sicher viel ausgeprägter als noch vor zehn oder zwanzig Jahren. Die Menschen bleiben länger jung und aktiv. - Das ist erst einmal die Patientenseite.
Auf der anderen Seite ist das Risiko solcher Eingriffe in den letzten dreißig, vierzig Jahren kontinuierlich zurückgegangen: Der Blutverlust ist gesunken, die Narkosen sind immer sicherer geworden und auch die Prothesen selbst haben längere Standzeiten – d.h. man kann mit einer Prothese inzwischen zwanzig Jahre leben, ohne dass sie gewechselt werden muss. Damit ist das Risiko einer solchen Operation deutlich gesunken. Aus diesem Grund ist es aus meiner Sicht auch nicht verwunderlich, dass sich immer mehr Patienten - auch immer ältere Patienten - für eine solche Operation entscheiden.
SPEYER-KURIER: Wie groß ist denn aus Ihrer Erfahrung der Anteil eines psychologisch bedingten Heilungseffektes – also, man hat jetzt diesen oder jenen Eingriff bei mir vorgenommen und deshalb geht es mir hinterher auch besser?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Das ist sicherlich von dem jeweiligen Operationstyp abhängig - es spielt sicher insbesondere bei den Bandscheibenoperationen eine größere Rolle. Hier wird ja nur korrigierend in das natürliche System eingegriffen. Der Gelenkersatz ist da insofern etwas anders zu betrachten, als in der Tat etwas Neues eingebaut wird – ein neues Gelenk eben. Beim Gelenkersatz wird daher alles, was zuvor Schmerzen bereitet hat, mit einem Schlag beseitigt.
Aber wenn man chronische Schmerzen an der Bandscheibe verspürt – ich weiss, wovon ich rede - ich bin selbst mehrfach an der Bandscheibe operiert worden – also wenn man lange diesen Schmerz verspürt hat und dann aus der Narkose erwacht und denkt: „Wo ist denn jetzt dieser Schmerz? – Der Schmerz ist ja weg!“ - Das hat dann sicher auch nicht mehr allein etwas mit psychologischen Effekten zu tun.
Aber lassen Sie mich noch einmal auf die Situation in anderen europäischen Ländern zurückkommen. Und da sind wir dann auch schon beim dritten Punkt, nämlich bei der Frage: Haben wir für solche Operationen auch genügend Geld im Gesundheitssystem? Für uns Deutsche ist es in jedem Alter eine Selbstverständlichkeit, anzunehmen, dass, wenn wir eine Endoprothese brauchen, auch Geld dafür da ist und dies auch bezahlt wird. Ein Engländer jenseits der Achtzig würde sich gar keine Gedanken darum machen, weil er weiß, dass er es sowieso nicht bezahlt bekommt.
Insofern glaube ich, dass natürlich auch das Angebot des Systems eine Art Anspruchshaltung erzeugt, der wir oft gar nicht gerecht werden können. Die Krankenkassen legen ja großen Wert darauf, ihren Mitgliedern gegenüber den Eindruck zu erwecken: Es wird ja ohnedies immer alles bezahlt – Oft können wir gar nicht alles „reparieren“, von dem unsere Patienten erwarten, dass wir es tun. Und deshalb denke ich schon, dass auch diese durch die Werbung der Kostenträger hervorgerufene Anspruchshaltung der Patienten an das Gesundheitswesen mit dafür verantwortlich ist, dass in Deutschland häufiger operiert wird.
SPEYER-KURIER: Ein anderer Vorwurf, der immer öfter zu hören ist, lautet: Nicht mehr der Arzt bestimmt die Behandlungsmethoden – die Therapie, sondern der Verwaltungsdirektor der Klinik, der damit die Auslastung und Refinanzierung teurer Geräte sicherstellen will. Inwieweit trifft dieser Vorhalt zu?
 Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist ganz schwierig, hierzu eine
allgemein gültige Antwort zu geben. Die Krankenhäuser unterliegen
ja ganz unterschiedlichen Organisationsformen, haben
unterschiedliche Träger und verfolgen deshalb auch ganz
unterschiedliche Ziele. Ohne dass ich das jetzt aus eigener
Erfahrung belegen könnte, ist es sicher ein Unterschied, ob der
Träger eines Krankenhauses oder einer Krankenhausgemeinschaft ein
kommerzielles Unternehmen ist oder, wie in unserem Fall, die
Stiftung eines katholischen Ordens. Das muss von Natur aus
unterschiedliche Zielsetzungen bedeuten. Ich kann für unser
Krankenhaus sagen: Wir sind glücklicherweise nicht in der
Situation, dass wir gezwungen sind, teure Geräte abzuschreiben. Wir
haben sicher ein sehr breites Spektrum medizinischen Leistungen und
bieten das auch auf dem jeweils aktuellen technischen Niveau an.
Wir führen aber auf der anderen Seite auch nur die Untersuchungen
und Operationen durch, die in einer Stadt in der Größe von Speyer
in einer Häufigkeit anfallen, dass sie vernünftigerweise von uns
angeboten werden sollten.
Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist ganz schwierig, hierzu eine
allgemein gültige Antwort zu geben. Die Krankenhäuser unterliegen
ja ganz unterschiedlichen Organisationsformen, haben
unterschiedliche Träger und verfolgen deshalb auch ganz
unterschiedliche Ziele. Ohne dass ich das jetzt aus eigener
Erfahrung belegen könnte, ist es sicher ein Unterschied, ob der
Träger eines Krankenhauses oder einer Krankenhausgemeinschaft ein
kommerzielles Unternehmen ist oder, wie in unserem Fall, die
Stiftung eines katholischen Ordens. Das muss von Natur aus
unterschiedliche Zielsetzungen bedeuten. Ich kann für unser
Krankenhaus sagen: Wir sind glücklicherweise nicht in der
Situation, dass wir gezwungen sind, teure Geräte abzuschreiben. Wir
haben sicher ein sehr breites Spektrum medizinischen Leistungen und
bieten das auch auf dem jeweils aktuellen technischen Niveau an.
Wir führen aber auf der anderen Seite auch nur die Untersuchungen
und Operationen durch, die in einer Stadt in der Größe von Speyer
in einer Häufigkeit anfallen, dass sie vernünftigerweise von uns
angeboten werden sollten.
Es gibt Spezialuntersuchungen wie das PET-CT, die extrem teuer sind und die darum auch immer wieder in die Diskussion geraten – da sind wir der Meinung, dass sich das für eine Stadt wie Speyer nicht lohnt, weil diese Untersuchung nicht oft genug indiziert (geboten d. Red.) ist und deshalb wird so etwas bei uns auch nicht angeschafft.
Man kann ja auch bei der Frage, wie man sein Spektrum ausrichtet, auf solche Aspekte bereits Rücksicht nehmen, sodass man wirtschaftlich arbeiten kann, ohne zu eigentlich unzulässigen Mitteln zu greifen. Dass es die grundsätzlich gibt, entspricht vermutlich der Wahrheit – das kann ich nicht anders vermuten nach all dem, was man in der Öffentlichkeit hört. Um an dem Beispiel der Endoprothetik zu bleiben, um die es ja in ganz besonderem Maße geht: Statt die Operationszahlen zu maximieren, kann man auch versuchen, sein Spektrum auf alle Therapiemöglichkeiten auszudehnen. Wir haben hier als relativ kleines Krankenhaus eine Abteilung für Konservative Orthopädie und eine Abteilung für operative Orthopädie und Unfallchirurgie. Das heißt: Für uns ist jeder Patient, der mit Gelenkschmerzen zu uns kommt, ein Patient, dem wir helfen können. Und wenn man es wirtschaftlich sieht, ist es für uns egal, ob wir unser Geld mit dem Patienten verdienen, der in der Konservativen Orthopädie von einem ganzen Team aus Physiotherapeuten, Orthopäden und Psychologen systematisch behandelt wird – auch das wird ja von den Krankenkassen bezahlt – oder ob er, weil all diese Maßnahmen keinen Nutzen gebracht haben - er also „austherapiert“ ist – ein künstliches Hüftgelenk bekommt.
SPEYER-KURIER: Gleichwohl, Frau Dr. Leszinski, es ist ja ein immer wieder zu beobachtendes Phänomen, dass derartige Kritikpunkte - quasi wellenartig - über unsere Gesellschaft hinwegrollen. Derzeit ist es das Thema der vermeintlich 'überflüssigen Operationen' – noch vor zwei, drei Jahren war es die angeblich mangelnde Hygiene in den deutschen Kliniken. Sie selbst sind ja schon seit einigen Jahren auch die „Hygienebeauftragte“ in Ihrem Haus und haben in dieser Funktion ja offensichtlich wirklich beeindruckende Erfolge erzielt. Was ist da passiert?
 Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist eine nach meiner Überzeugung
erfreuliche Begleiterscheinung der Welle an Interesse, die sich auf
dieses Gebiet gerichtet hatte. In diesem Fall hat - wie dies
vermutlich auch bei der Frage der OP-Indikationen sein wird - da
hat also dieses öffentliche Interesse Gedanken auf den Weg gebracht
und letztlich auch Mittel, auch personelle Mittel freigesetzt, um
nach der Veränderung der gesetzlichen Grundlagen – vor allem des
Infektionsschutzgesetzes – die Strukturen zu schaffen, um Hygiene
in einem Krankenhaus aus ihrem 'Schattendasein' - aus der
'Schmuddelecke' herauszuholen. Das ist sicher ein ganz wichtiger
Schritt gewesen. Hinzu kommt – und das ist der Teil, den wir hier
im „Vincenz“ für ganz besonders wichtig halten – dass uns wir
bemühen, Hygiene heute einen anderen Stellenwert zu verschaffen.
Hygiene war früher etwas, was man halt lästigerweise machen musste
wie den TÜV-Besuch beim Auto und nichts, in das man irgendwelche
Energien hineinsteckte. Wir haben uns hier in unserem Team intensiv
mit Hygiene befasst und festgestellt, dass das etwas
außerordentlich Spannendes ist – dass man Dinge bewegen und
verändern und durch oft ganz einfache Maßnahmen Schaden vom
Patienten abwenden kann.
Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist eine nach meiner Überzeugung
erfreuliche Begleiterscheinung der Welle an Interesse, die sich auf
dieses Gebiet gerichtet hatte. In diesem Fall hat - wie dies
vermutlich auch bei der Frage der OP-Indikationen sein wird - da
hat also dieses öffentliche Interesse Gedanken auf den Weg gebracht
und letztlich auch Mittel, auch personelle Mittel freigesetzt, um
nach der Veränderung der gesetzlichen Grundlagen – vor allem des
Infektionsschutzgesetzes – die Strukturen zu schaffen, um Hygiene
in einem Krankenhaus aus ihrem 'Schattendasein' - aus der
'Schmuddelecke' herauszuholen. Das ist sicher ein ganz wichtiger
Schritt gewesen. Hinzu kommt – und das ist der Teil, den wir hier
im „Vincenz“ für ganz besonders wichtig halten – dass uns wir
bemühen, Hygiene heute einen anderen Stellenwert zu verschaffen.
Hygiene war früher etwas, was man halt lästigerweise machen musste
wie den TÜV-Besuch beim Auto und nichts, in das man irgendwelche
Energien hineinsteckte. Wir haben uns hier in unserem Team intensiv
mit Hygiene befasst und festgestellt, dass das etwas
außerordentlich Spannendes ist – dass man Dinge bewegen und
verändern und durch oft ganz einfache Maßnahmen Schaden vom
Patienten abwenden kann.
SPEYER-KURIER: Wie stellt sich das konkret im Krankenhaus-Alltag dar?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Das stellt sich zum einen in fest gefügten formalen Strukturen dar, wie einer Hygienekommission, die sich zweimal pro Jahr trifft, formale Beschlüsse fasst und dann ein halbes Jahr später wieder zusammenkommt. Das kommt allerdings nicht wirklich im Alltag an. Dadurch weiß die Schwester auf Station oder der Arzt in der Ambulanz noch überhaupt nicht, wie er sich hygienesicher gegenüber seinem Patienten verhalten muss...
SPEYER-KURIER: ...aber es bewirkt vermutlich einen Bewußtseinswandel...
Dr. med. Cornelia Leszinski: So ist es – und dazu haben wir hier im Haus einen „Arbeitskreis Hygiene“ gegründet, in dem aus jedem ärztlichen Bereich ein Oberarzt oder ein Chefarzt – also jemand, der in der Klinik auch wirklich etwas bewegen kann – und von jeder Station die Stationsleitung oder ihre Stellvertretung in dem Team dazu gehören. In diesen Arbeitskreis werden die Maßnahmen, die in der Hygienekommission beschlossen oder mit externen Hygienefachärzten besprochen werden, dann wirksam in den Alltag umgesetzt.
SPEYER-KURIER: Nun sprechen wir hier ja nicht allein über Patienten Ihres Hauses, die diesbezüglich offensichtlich sehr gut betreut werden. Woran kann denn ein Patient, der in eine Klinik kommt, ganz generell erkennen, dass die von Ihnen genannten Regeln eingehalten und umgesetzt werden?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Der Patient erkennt das in jedem Augenblick seines Aufenthalts in einer Klinik schon daran, wie man mit ihm umgeht. Die Patienten achten heute darauf – und das ist gut so – ob sich Schwestern und Ärzte die Hände desinfizieren, bevor sie mit ihnen körperlichen Kontakt aufnehmen. Das muss noch nicht beim Händeschütteln sein, aber bevor eine Untersuchung oder eine Blutentnahme stattfindet, sollten sich Arzt und Schwester die Hände desinfizieren. Das ist eine zentrale Maßnahme, an der man erkennen kann, ob Hygiene in einem Krankenhaus eine wichtige Rolle spielt. Dass sie im Einzelfall im Trubel auch einmal vergessen werden kann, ist möglich. Aber wird die Händedesinfektion immer vergessen oder wird sie eigentlich immer durchgeführt? Gibt es überhaupt Spender für Desinfektionsmittel? Kann man diese leicht, ja überhaupt erreichen? Das sind Dinge, die die Patienten ständig beobachten können und auf die sie heute berechtigterweise auch achten.
SPEYER-KURIER: Sie gehen hier aber grundsätzlich von dem informierten Patienten aus, der auf solche Details achtet? Wie groß ist denn aber der Anteil der Patienten, die bei ihrer Einlieferung in eine Klinik zum ersten Mal aktiv mit einem Krankenhaus in Berührung kommen und deshalb auch auf solche Fragen nicht vorbereitet sind?
 Dr. med.
Cornelia Leszinski: Also in unserem Krankenhaus sind das,
einmal frei geschätzt, vielleicht zehn bis zwanzig Prozent. Aber
auch die haben vorher Zeitung gelesen, im Internet recherchiert
oder ferngesehen. Nein, diese Problematik ist den Patienten
heutzutage aus meiner Sicht eher zu präsent – die haben nämlich
Angst, wenn sie in das Krankenhaus kommen. Das ist bedauerlich und
es ist deshalb wichtig, dass man darüber redet - und das ist dann
leider die andere Seite dieses gesteigerten öffentlichen
Interesses. Wenn die Patienten in die Sprechstunde kommen, haben
sie oft mehr Angst davor, sich eines von diesen 'Killerkeimen' im
Krankenhaus zu holen, als vor der eigentlichen Operation. Das ist
dann eine völlige Verkehrung der tatsächlichen Umstände. Es
bedeutet, dass bei einem Patienten, der z. B. am Blinddarm operiert
werden muss, zu den damit verbundenen Ängsten – das ist alles neu
für ihn und macht ihm deshalb verständlicherweise Angst – auch noch
die Angst vor der Infektion kommt. Und deshalb geht diese
Informiertheit – das ist mein Eindruck – manchmal fast schon zu
weit, zumal sie auch nicht immer sachlich fundiert und berechtigt
ist.
Dr. med.
Cornelia Leszinski: Also in unserem Krankenhaus sind das,
einmal frei geschätzt, vielleicht zehn bis zwanzig Prozent. Aber
auch die haben vorher Zeitung gelesen, im Internet recherchiert
oder ferngesehen. Nein, diese Problematik ist den Patienten
heutzutage aus meiner Sicht eher zu präsent – die haben nämlich
Angst, wenn sie in das Krankenhaus kommen. Das ist bedauerlich und
es ist deshalb wichtig, dass man darüber redet - und das ist dann
leider die andere Seite dieses gesteigerten öffentlichen
Interesses. Wenn die Patienten in die Sprechstunde kommen, haben
sie oft mehr Angst davor, sich eines von diesen 'Killerkeimen' im
Krankenhaus zu holen, als vor der eigentlichen Operation. Das ist
dann eine völlige Verkehrung der tatsächlichen Umstände. Es
bedeutet, dass bei einem Patienten, der z. B. am Blinddarm operiert
werden muss, zu den damit verbundenen Ängsten – das ist alles neu
für ihn und macht ihm deshalb verständlicherweise Angst – auch noch
die Angst vor der Infektion kommt. Und deshalb geht diese
Informiertheit – das ist mein Eindruck – manchmal fast schon zu
weit, zumal sie auch nicht immer sachlich fundiert und berechtigt
ist.
SPEYER-KURIER: Bei allen Themen, über die wir heute hier sprechen, schwingt ja im Hintergrund immer das Problem des demographischen Wandels mit. Die Menschen werden immer älter, die Zahl der über 100jährigen nimmt rasch zu – die Menschen erkranken heute an Krankheiten, die sie früher aus Altersgründen nie oder zumindest viel seltener erreicht hätten. Wie muss nach Ihrer Meinung die Medizin mit dieser Veränderung umgehen?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Wir haben, gerade auch in der Chirurgie, in den letzten Jahrzehnten gelernt, dass allein das biologische Alter unserer Patienten für die Therapie-Entscheidung ausschlaggebend sein muss und das Datum, das in der Geburtsurkunde steht, nahezu keine Rolle mehr spielt. Das heißt, die Frage, wieviel Therapie kann ich einem Menschen zumuten, so dass das für ihn noch sinnvoll ist, ist etwas, was mehr denn je wirklich nur ganz individuell und von dem einzelnen Menschen und seinem Kontext und seinem Umfeld abhängig entschieden werden muss. Das ist, so glaube ich, die wichtigste Veränderung.
Wir machen heute Tumoroperationen bei Patienten, in deren Alter noch vor 25 Jahren, als ich als Chirurgin anfing, kein Mensch daran gedacht hätte, z. B. eine Darmresektion (Darmentfernung die. Red.) vorzunehmen. Wir machen das heute, weil wir wissen, dass auch die meisten älteren Patienten eine solche ausgedehnte Operation heute verkraften. Wir haben aber auch in der gesamten perioperativen Medizin (Zeitraum rund um die Operation die Red.) gelernt, uns darauf einzustellen, was erstaunlicherweise bedeutet, dass wir viel weniger als früher künstlich in den Organismus eingreifen und versuchen, unsere Störungen so gering wie möglich zu halten. Dadurch machen wir die Erfahrung, dass auch sehr alte Menschen oft mit diesem reduzierten Trauma sehr gut umgehen können.
SPEYER-KURIER: Wenn wir hier jetzt so etwas wie ein Zwischenfazit ziehen wollten – welche Rolle spielt bei all den genannten medizinischen Maßnahmen die Erhaltung der Lebensqualität?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Das ist natürlich immer unser oberstes Ziel.
SPEYER-KURIER: …doch war das immer so?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Was meine persönliche Erfahrung angeht, war das eigentlich immer so. Ich bin schon in eine Zeit der Medizin hineingeboren, die über den schlimmsten Machbarkeitswahn hinweg war. Ich habe diese Diskussion als junge Ärztin noch erlebt – z. B. als die ersten wirksamen Chemotherapien aufkamen, die Frage, wieviel kann man und wieviel sollte man tun. Ich habe da alle Varianten kennengelernt vom absoluten Therapie-Nihilismus - „das bringt ja sowieso nichts mehr“ – bis hin zum akademischen maximalen Ausreizen aller Möglichkeiten, habe aber, weil ich von Anfang an in meiner Ausbildung erfreulicherweise auch menschlich kompetente Vorbilder hatte, ein Verständnis dafür entwickelt, dass auch 'Lebensqualität' individuell zu beurteilen ist. Was ist dem einzelnen Menschen wichtig? Manchem ist wichtig, möglichst lange zu leben - anderen ist wichtig, bestimmte Dinge auf keinen Fall zu erleben und wieder andere möchten vielleicht noch ein bestimmtes Ereignis im Leben ihrer Enkel miterleben. Das sind also ganz individuelle Ansätze und unsere Behandlung muss sich immer daran ausrichten. Das ist aber etwas, was mich schon durch mein ganzes Berufsleben begleitet.
SPEYER-KURIER: Das heißt also, ein 'gnädiger Tod' kann auch ein Stück Lebensqualität darstellen?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Selbstverständlich. Der Tod ist auch für uns Ärzte und gerade auch in unserem katholischen Krankenhaus ein ganz selbstverständlicher Teil unseres Alltags. Ohne dass wir dazu jetzt formalistische Strukturen wie Pallitivstationen einrichten, wissen unsere Tumorpatienten, bei denen das ja am ehesten absehbar ist, dass sie zu jeder Zeit und in jedem Stadium zu uns kommen dürfen. Und die Patienten, die wir operiert haben und die uns kennen, kommen zu uns und dürfen hier bei uns in Friede und Würde und schmerzfrei sterben. Das ist für uns ein selbstverständlicher Teil unserer Behandlung, so dass wir es auch nicht für notwendig halten, das aus dem normalen Stationsalltag auszugliedern.
Operiert und gesund werden gehört zum Leben und in ein Krankenhaus – und das Ende des Lebens gehört genauso dazu.
SPEYER-KURIER: Ein anderes Problem, das sicher gleichfalls etwas mit dem veränderten Alterungs-Verhalten unserer Gesellschaft zu tun hat, betrifft die sich immer mehr ausbreitenden Dekubitus-Erkrankungen. Was können Patienten, was müssen pflegende Angehörige und professionelle Pflegekräfte beachten, um das Entstehen dieser schmerzhaften Druckgeschwüre zu vermeiden?
 Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist ein pflegerisch sehr
anspruchsvoller Bereich, denn er ist außerordentlich zeitintensiv.
Es gibt technische Unterstützung wie bestimmte
Anti-Dekubitus-Matratzen, die eine besondere Weichlagerung
ermöglichen. Da aber Druckgeschwüre letztlich immer dann entstehen,
wenn die Gewichtskraft des eigenen Körpers zu lange auf einen zu
kleinen Bereich einwirkt, sodass das Gewebe nicht mehr gut
durchblutet wird, ist das wichtigste die Änderung der
Krafteinwirkung. Das ist das, was wir alle im Schlaf ganz
automatisch machen: auf den Schmerz, der entsteht, wenn wir zu
lange z. B. auf dem Beckenknochen liegen, dadurch zu reagieren,
dass wir uns im Schlaf umdrehen und eine andere Stelle belasten.
Bei Patienten, die dazu selbst nicht mehr in der Lage sind, ist das
eine Aufgabe, die dann die Pflegekräfte, die Angehörigen übernehmen
müssen. Leider sind die Zeitfenster, in denen ein Mensch eine
Lagerung auf einer Stelle toleriert, sehr klein- erfahrungsgemäß
nur so um die zwei Stunden – so dass die einzige Möglichkeit, einen
Dekubitus zu vermeiden, die konsequente Umlagerung alle zwei
Stunden ist, sofern er selbst nicht mehr dazu in der Lage ist.
Jeder Mensch, der das noch einigermaßen selbst kann, sollte
regelmäßig dazu angehalten werden, aktiv seine Lage zu wechseln,
zumal gerade bei alten Menschen auch das Schmerzempfinden
herabgesetzt ist.
Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist ein pflegerisch sehr
anspruchsvoller Bereich, denn er ist außerordentlich zeitintensiv.
Es gibt technische Unterstützung wie bestimmte
Anti-Dekubitus-Matratzen, die eine besondere Weichlagerung
ermöglichen. Da aber Druckgeschwüre letztlich immer dann entstehen,
wenn die Gewichtskraft des eigenen Körpers zu lange auf einen zu
kleinen Bereich einwirkt, sodass das Gewebe nicht mehr gut
durchblutet wird, ist das wichtigste die Änderung der
Krafteinwirkung. Das ist das, was wir alle im Schlaf ganz
automatisch machen: auf den Schmerz, der entsteht, wenn wir zu
lange z. B. auf dem Beckenknochen liegen, dadurch zu reagieren,
dass wir uns im Schlaf umdrehen und eine andere Stelle belasten.
Bei Patienten, die dazu selbst nicht mehr in der Lage sind, ist das
eine Aufgabe, die dann die Pflegekräfte, die Angehörigen übernehmen
müssen. Leider sind die Zeitfenster, in denen ein Mensch eine
Lagerung auf einer Stelle toleriert, sehr klein- erfahrungsgemäß
nur so um die zwei Stunden – so dass die einzige Möglichkeit, einen
Dekubitus zu vermeiden, die konsequente Umlagerung alle zwei
Stunden ist, sofern er selbst nicht mehr dazu in der Lage ist.
Jeder Mensch, der das noch einigermaßen selbst kann, sollte
regelmäßig dazu angehalten werden, aktiv seine Lage zu wechseln,
zumal gerade bei alten Menschen auch das Schmerzempfinden
herabgesetzt ist.
SPEYER-KURIER: Nun sehen Sie die betroffenen Patienten ja meist erst, wenn die entsprechenden Gewebeveränderungen bereits eingetreten sind. Was kann die Klinik, was kann vielleicht auch die häusliche Pflege tun, um diese Symptomatik wieder zu beheben?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Es gibt die Möglichkeit, die Wunde lokal zu behandeln, was heute in sehr professioneller Weise auch ambulant durchgeführt wird. Wenn allerdings der Dekubitus eine bestimmte Größe überschreitet, wird eine vollständige Ausheilung auf diesem Wege kaum noch zu erzielen sein. Dann gibt es aber immer noch die Möglichkeit, nach entsprechender Vorbereitung der Wunde operativ gesundes Gewebe - nicht nur Haut-, sondern auch Fettgewebe, die Muskelhüllschicht oder Teile der Muskulatur selbst – aus dem umliegenden Gewebe in den betroffenen Bereich zu verschieben und so die druckgeschädigten Stellen mit eigenem, gesundem Gewebe auszufüllen. Der typische Bereich, der hierzu in Frage kommt, ist der Bereich des Kreuzbeins, also neben dem Gesäß. Da kann man dann aus dem Gesäßbereich gesundes Gewebe in diesen Defekt einbringen, das dann dort einwächst und ermöglicht, dass das Gewebe bei entsprechender Lagerung genauso dauerhaft belastbar ist wie es vor dem Auftreten des Dekubitus war.
SPEYER-KURIER: Frau Dr. Leszinski, Ihr eigentliches Fachgebiet ist ja die Viszeralchirurgie. Was kann der medizinische Laie darunter verstehen?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Die Viszeralchirurgie – vom lateinischen 'viscera', zu Deutsch 'die Eingeweide betreffend', was allerdings nur eingeschränkt den Kern trifft – beschäftigt sich mit den Organen des Bauchraumes wie Magen, Dünn- und Dickdarm, Gallenblase, Bauchspeicheldrüse. Zur Viszeralchirurgie gehört aber auch die Chirurgie der Hormon bildenden Drüsen, speziell der Schilddrüse und der Nebenschilddrüse, dazu alle Erkrankungen der Bauchwand - das sind überwiegend Brucherkrankungen. Die häufigsten Operationen in der Allgemeinchirurgie sind ja immer noch die Leistenbruchoperationen.
SPEYER-KURIER: Die jetzt von Ihnen aufgeführten Eingriffe sind für Sie – wenn Sie den saloppen Ausdruck erlauben – ja so etwas wie „Alltagsgeschäft“. Eine Kritik, die in der jüngsten Zeit aber gerade auch an der Chirurgie erhoben worden ist, bezieht sich auf die Fallzahlen bestimmter Operationen in den Kliniken. „Übung macht den Meister“ sagt das Sprichwort und meint - auf die Medizin bezogen – dass ein Eingriff für den Patienten um so riskanter ist, je seltener er in einer Klinik vorgenommen wird. Gibt es hier eigentlich definierte „Untergrenzen“ und hat das Sankt Vincentius Krankenhaus in Speyer z.B. „ausreichend“ viele Bauchraum-Operationen auf seinem Operationsplan?
 Dr. med.
Cornelia Leszinski: Ja, da haben sie völlig recht. Das ist
für mich als eine jetzt Mitverantwortliche genauso, wie es die
ganze Zeit schon für Herrn Dr. Winter war, ein wichtiges
Qualitätskriterium. Und darum haben wir klare Grenzen gesetzt: Wir
sind Viszeralchirurgen , aber wir führen nicht alle Operationen der
Viszeralchirurgie durch. Die wichtigste Ausnahme – und da treffen
Sie ganz genau den Punkt – sind Tumor-Operationen an der
Bauspeicheldrüse. Diese Erkrankung ist relativ selten und der
Anteil der Patienten, die kurativ - das heißt unter
Heilungsabsichten – operiert werden, ist leider sehr gering. Das
sind Operationen, die in einer Stadt wie Speyer nur sehr selten
vorkommen –sicher nicht mehr als zehn bis zwanzig Patienten pro
Jahr. Und das ist zu wenig, um diese Operation einschließlich der
Logistik darum herum erfolgreich durchführen zu können. Das ist der
Grund, weshalb wir diese Operationen bei uns nicht durchführen.
Dr. med.
Cornelia Leszinski: Ja, da haben sie völlig recht. Das ist
für mich als eine jetzt Mitverantwortliche genauso, wie es die
ganze Zeit schon für Herrn Dr. Winter war, ein wichtiges
Qualitätskriterium. Und darum haben wir klare Grenzen gesetzt: Wir
sind Viszeralchirurgen , aber wir führen nicht alle Operationen der
Viszeralchirurgie durch. Die wichtigste Ausnahme – und da treffen
Sie ganz genau den Punkt – sind Tumor-Operationen an der
Bauspeicheldrüse. Diese Erkrankung ist relativ selten und der
Anteil der Patienten, die kurativ - das heißt unter
Heilungsabsichten – operiert werden, ist leider sehr gering. Das
sind Operationen, die in einer Stadt wie Speyer nur sehr selten
vorkommen –sicher nicht mehr als zehn bis zwanzig Patienten pro
Jahr. Und das ist zu wenig, um diese Operation einschließlich der
Logistik darum herum erfolgreich durchführen zu können. Das ist der
Grund, weshalb wir diese Operationen bei uns nicht durchführen.
Natürlich behandeln wir auch in diesem Bereich alle Notfälle – Bauchspeicheldrüsen-Entzündungen sind recht häufig. Dabei führen wir, wenn es notwendig ist, auch schon einmal die Entfernung einer kompletten Bauchspeicheldrüse durch - das ist keine Frage. Aber diese spezielle Tumor-Chirurgie gibt es bei uns nicht und deswegen überweisen wir diese Patienten in entsprechende Zentren. Von daher haben Sie also völlig recht.
Wir sind jedoch in der glücklichen Lage, dass wir die anderen Operationen aus dem Bereich der Viszeralchirurgie in sehr großer Anzahl durchführen– Speyer hat ja ein Einzugsgebiet, das über die Stadt hinausreicht bis weit auch in den badischen Raum hinein. Wir arbeiten da mit vielen Kollegen zusammen, so dass wir z. B. mindestens 150 Darmoperationen im Jahr machen, bei Gallenoperationen 150 – 200 pro Jahr, Leistenbruchoperationen etwa in gleicher Zahl. Und wenn man berücksichtigt, dass wir ja - anders als in Universitätskliniken, wo auf einen Chefarzt zwanzig Oberärzte und fünfzig Assistenten kommen - dass wir hier im Haus im wesentlichen drei Operateure sind, dann sehen Sie, dass die Anzahl der von jedem von uns vorgenommenen Operationen von kaum einem Universitäts-Chirurgen durchgeführt wird. Von daher führen wir unsere Operationen weitaus häufiger durch als das die Kollegen an jeder großen Klinik tun.
SPEYER-KURIER: Der Beruf des Chirurgen gilt ja seit den „heroischen Zeiten“ eines Prof. Ferdinand Sauerbruch als ein „ganz besonderer“ Beruf. Zweifellos besonders verantwortungsvoll, vielfach auch körperlich besonders fordernd, wenn ich an viele Stunden dauernde Eingriffe denke. Ist das der Grund, dass heute immer noch die Frauen am Operationstisch eine so verschwindende Minderheit darstellen, während sie im Medizinstudium doch schon längst in der Mehrzahl sind? Wenn Sie selbst eine Tochter hätten, würden sie der guten Gewissens empfehlen können, den beschwerlichen und langen Weg einer Karriere in der Chirurgie auf sich zu nehmen?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Ja, in jedem Fall. Ich glaube, die einzige Voraussetzung für eine Frau gerade heute ist, dass sie an diesem Beruf, an dieser Art von Arbeit Freude hat. Der Beruf des Chirurgen ist eine besondere Tätigkeit, die alle operativen Fächer gemeinsam haben: Sie erfordern die Bereitschaft und die Fähigkeit, auch nach längeren Routinephasen in besonderen Situationen auch unter Druck schnell und korrekt zu handeln – und dann auch mit dieser Entscheidung leben zu können. Es gibt Menschen, die das gerne machen, denen das nichts ausmacht und die in einer solchen Situation 'gut' sind. Es gibt aber auch Menschen, die in einer solchen Situation einen 'black out' bekommen und die sich unter Druck immer schwerer tun. Die werden in der Chirurgie niemals glücklich werden. Es ist eher selten die manuelle Geschicklichkeit, die die Eignung für den Beruf des Chirurgen ausmacht, sondern viel mehr die Fähigkeit, auch unter Druck konsequent zu denken und zu entscheiden. Das Wichtigste ist aber, dass man sagen kann: Ja, das macht mir Freude. Das möchte ich machen. Dann würde ich jedem jungen Menschen ohne Bedenken zuraten. Und deswegen sage ich auch immer wieder' Ja' zu diesem Beruf.
SPEYER-KURIER: Ist diese Erwartung - ja ich würde fast sagen - ist diese fast autosuggestive Überzeugung, frei nach dem Motto „Ich schaff' das schon“, ausreichend, um sich dieser von Ihnen beschriebenen Herausforderung zu stellen - und in diesen Beruf hineinzugehen?
 Dr. med. Cornelia
Leszinski: Ich denke, heute sind die jungen Kollegen hier
in einer sehr günstigen Situation. Als ich anfing, gab es eine
Ärzteschwemme und keine Stellen. Das heißt, es war damals so gut
wie unmöglich, wenn man zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn 'aufs
falsche Pferd' gesetzt hatte – wenn man den falschen Fachbereich
ausgewählt hatte - dann noch einmal in einen anderen Bereich zu
wechseln. Das hat sich heute grundlegend geändert: Heute gibt es
einen Ärztemangel - es gibt sehr viele Stellen und die jungen
Kollegen können sich aussuchen, wo sie arbeiten möchten und in
welchem Bereich – und vor allem: heute hat jeder die Möglichkeit,
wenn er merkt, dass er sich zunächst für den falschen Bereich
entschieden hat, auch noch einmal zu wechseln.
Dr. med. Cornelia
Leszinski: Ich denke, heute sind die jungen Kollegen hier
in einer sehr günstigen Situation. Als ich anfing, gab es eine
Ärzteschwemme und keine Stellen. Das heißt, es war damals so gut
wie unmöglich, wenn man zu Beginn seiner beruflichen Laufbahn 'aufs
falsche Pferd' gesetzt hatte – wenn man den falschen Fachbereich
ausgewählt hatte - dann noch einmal in einen anderen Bereich zu
wechseln. Das hat sich heute grundlegend geändert: Heute gibt es
einen Ärztemangel - es gibt sehr viele Stellen und die jungen
Kollegen können sich aussuchen, wo sie arbeiten möchten und in
welchem Bereich – und vor allem: heute hat jeder die Möglichkeit,
wenn er merkt, dass er sich zunächst für den falschen Bereich
entschieden hat, auch noch einmal zu wechseln.
Wir bilden hier im Haus ja auch Nachwuchs-Mediziner aus. Gerade in der Chirurgie ist es ja ohnedies so, dass man vor der Spezialisierung eine zweijährige Basisausbildung – den sogenannten 'common trunk' durchläuft -, in dem die Kollegen im gesamten Bereich der Chirurgie ausgebildet werden. Da gehört Unfallchirurgie dazu, Allgemeinchirurgie, Viszeralchirurgie – auch die Gefäßchirurgie und nicht zuletzt auch die Intensivmedizin. Diese Bereiche der Ausbildung bieten wir hier an und haben deshalb auch immer junge Kollegen im Haus, die auch eine gewisse Rotation durch die verschiedenen Abteilungen durchmachen. Und dabei ist es auch meine Aufgabe als Ausbilderin, in regelmäßigen halbjährlichen Gesprächen den jungen Kollegen rückzumelden: „Das ist gut“ – „da sehe ich noch ein Problem“ oder im Einzelfall auch einmal: „Überlegen Sie sich, ob Sie sich mit diesem Berufsweg wirklich einen Gefallen tun“. Und gegebenenfalls suchen wir dann auch gemeinsam nach einer beruflichen Alternative. Das ist eine Aufgabe, der wir uns als Ausbilder ganz intensiv widmen.
SPEYER-KURIER: Wir wissen ja, dass die Zahl der Ärzte allein schon aus Gründen der Demografie zukünftig immer geringer werden wird – und deshalb auch die der Berufseinsteiger. Bedeutet das, dass Sie und Ihre Chefarztkollegen auch in die Schulen gehen müssen, um Oberstufenschüler über diesen Beruf zu informieren und vielleicht auch aktiv dafür zu werben?
Es ist ja seit langem schon so, dass der Zugang zum Medizinstudium ein Einser-Abitur zur Voraussetzung hat, was ja eigentlich ganz im Gegensatz zu dem steht, was Sie zuvor selbst über diesen Beruf gesagt haben.
Müssen dann – gerade auch mit Blick auf die Entwicklung in der Landarztversorgung – nicht doch vielleicht heute schon die Zugangsvoraussetzungen für dieses Studium geändert werden?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Das ist sicherlich ein Problem. Wir hatten ja bislang immer genügend Studenten. Im Gegenteil, wir haben - wie Sie richtig sagen - immer noch einen strengen Numerus clausus, der aber dadurch aufgeweicht wird, dass immer mehr Studienplätze im direkten Gespräch und über zusätzliche Tests von den Universitäten vergeben werden, so dass durchaus auch Nicht-Einser-Abiturienten die Chance haben, hier zum Zuge zu kommen. Das Problem ist aber heute – und die Antwort auf die Frage 'Warum ist das so' ist noch immer unbeantwortet – dass diese vielen Studenten, die in Deutschland ausgebildet werden, dann zu einem großen Teil gar nicht mehr in der Praxis ankommen. Das ist ein Phänomen und ich denke – egal, wie lange man darum herumredet - hier widerspricht der Beruf des Arztes dem heutigen Zeitgeist.
Arzt zu sein ist halt kein 'Job'. Man kann Arbeitszeiten regeln, und das sollte man auch tun - man kann Belastungen auf ein menschenwürdiges Maß zurückführen, aber der Arztberuf kann niemals nur ein 'Job' sein.
Ich hoffe, dass es gelingen wird, – und da bin ich eigentlich aus meiner Erfahrung mit jungen Menschen sehr zuversichtlich - junge Menschen wieder zu motivieren, dass auf diesen überschießenden Wunsch nach Freizeit und der Sinnfindung in der Freizeitgestaltung auch wieder eine Welle folgen wird, die einen vernünftigen Ausgleich zwischen Beruf und Freizeit sucht. Und da wird sich dann auch der moderne Beruf des Arztes finden, so wie er sich heute darstellt – ein Beruf, der durchaus auch vereinbar ist mit Familie, mit Freizeit – der aber nie nur 'Job' sein darf.
 SPEYER-KURIER: Liebe
Frau Dr. Leszinski, damit haben Sie selbst schon das Stichwort
gegebenen für einige persönliche, private Fragen: Was tut Dr.
Cornelia Leszinski, um nach einem anstrengenden Tag am OP-Tisch
wieder „herunter“ zu kommen - kurz: Bleibt der neuen Chefärztin des
Sankt Vincentius Krankenhauses neben ihrem aufreibenden Beruf Zeit
für Hobbies?
SPEYER-KURIER: Liebe
Frau Dr. Leszinski, damit haben Sie selbst schon das Stichwort
gegebenen für einige persönliche, private Fragen: Was tut Dr.
Cornelia Leszinski, um nach einem anstrengenden Tag am OP-Tisch
wieder „herunter“ zu kommen - kurz: Bleibt der neuen Chefärztin des
Sankt Vincentius Krankenhauses neben ihrem aufreibenden Beruf Zeit
für Hobbies?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Leider nur in reduzierter Form. Ein Hobby, das ich früher mit Liebe ausgeübt habe, war das Reiten – ich hatte sogar ein eigenes Pferd. Dazu fehlt mir aber heute leider die Zeit und ich musste dieses Hobby aufgeben. Aber natürlich ist ein Ausgleich wichtig und deshalb habe ich in den letzten Jahren damit begonnen zu laufen. Das ist etwas, was man relativ zeitunabhängig machen kann. Für mich ist das immer wieder ein Augenblick, wo ich aus dieser Klinik herauskommen und im Freien sein kann. Dazu kommt noch: Ich habe einen ganz kleinen Garten, den ich mit viel Liebe selbst angelegt habe und in dem ich mich am Abend, wenn ich nach Hause komme, immer wieder gerne hinsetze.
Das sind Möglichkeiten, die einen zur Ruhe kommen lassen und die man im Alltag auch braucht.
SPEYER-KURIER: Welchen Stellenwert hat die Musik in Ihrem Leben?
Dr. med. Cornelia Leszinski: Die hat früher auch eine aktive Rolle gespielt. Ich habe sehr lange – auch noch während meiner Berufstätigkeit – Klavier gespielt, bin dann aber mit meinen eigenen Ansprüchen in Schwierigkeiten gekommen. Ich habe verletzungsbedingt lange nicht spielen können und jetzt nicht mehr die Zeit, wieder so „einsteigen“ zu können zu können, wie ich das dann auch für richtig halten würde. Aber ich höre sehr gern klassische und moderne Musik, vor allem auch Jazz – allerdings alles leider nur noch passiv.
SPEYER-KURIER: Eine Frage, die wir solchen Gesprächen immer wieder stellen: Welches Buch liegt derzeit auf Ihrem Nachttisch?
Dr. med. Cornelia Leszinski: (lacht).. das ist eine überraschende Frage, aber sicher sehr berechtigt …
SPEYER-KURIER: ...außer vielleicht dem „Ärzteblatt?...
Dr. med. Cornelia Leszinski: ...Nein, das lese ich abends sicher auf keinen Fall. Bei mir liegt da derzeit der „SPIEGEL“-Bestseller „Schulden“ von David Graeber, dem Begründer der „Occupy-Bewegung“ - das finde ich enorm spannend und hochinteressant.
SPEYER-KURIER: Und dann ganz zum Schluss noch eine sehr persönliche Frage. Aus Ihrer Vita wissen wir, dass Sie einen aus Afrika stammenden Pflegesohn adoptiert haben. Was hat Sie damals zu diesem Schritt bewogen?
 Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist ein Junge, der in meiner Zeit
am Krankenhaus in Worms zur Behandlung zu uns kam. Er hatte sich in
seiner Heimat an einem Strommast schwere Verbrennungen zugezogen
und kam zusammen mit einem weiteren Mädchen über eine ärztliche
Hilfsorganisation zu uns. Diese beiden Kinder, um die ich mich
damals gekümmert habe, waren über ein dreiviertel Jahr bei uns und
sind im Anschluss an ihre Behandlung wieder in ihre Heimat Angola
zurückgekehrt. Leider ist seine Familie im Bürgerkrieg in Angola
ums Leben gekommen. Ich habe ihn dann dort auch noch zweimal
besucht und als sein Leben im Bürgerkrieg bedroht war, habe ich ihn
im Alter von 15 Jahren nach Deutschland geholt. Als er dann
volljährig wurde, habe ich ihn adoptiert.
Dr. med.
Cornelia Leszinski: Das ist ein Junge, der in meiner Zeit
am Krankenhaus in Worms zur Behandlung zu uns kam. Er hatte sich in
seiner Heimat an einem Strommast schwere Verbrennungen zugezogen
und kam zusammen mit einem weiteren Mädchen über eine ärztliche
Hilfsorganisation zu uns. Diese beiden Kinder, um die ich mich
damals gekümmert habe, waren über ein dreiviertel Jahr bei uns und
sind im Anschluss an ihre Behandlung wieder in ihre Heimat Angola
zurückgekehrt. Leider ist seine Familie im Bürgerkrieg in Angola
ums Leben gekommen. Ich habe ihn dann dort auch noch zweimal
besucht und als sein Leben im Bürgerkrieg bedroht war, habe ich ihn
im Alter von 15 Jahren nach Deutschland geholt. Als er dann
volljährig wurde, habe ich ihn adoptiert.
Er ist jetzt 29 Jahre alt, hat hier in Speyer die Nikolaus-von-Weis-Schule besucht und eine Ausbildung in kaufmännischer Bürokommunikation absolviert. Heute ist er jetzt fest angestellt in der BG-Klinik in Ludwigshafen
SPEYER-KURIER: Also auch ein wunderbares Beispiel einer gelungenen Integration. Dann dürfen wir uns sehr herzlich für dieses so ausführliche und offene Gespräch bedanken, das unseren Leserinnen und Lesern eine verantwortliche Speyerer Chefärztin sicher von einer anderen, einer sehr persönlichen Seite nahegebracht hat und das vielleicht auch dazu beitragen kann, Ängste im Umgang mit Ärzten und Kliniken abzubauen.
Foto: gc; Sankt Vincentius Krankenhaus
18.07.2013
Interview der Woche

Speyer- Kurz vor ihrem Auftritt in der Speyerer Dreifaltigkeitskirche – siehe Rezension im SPEYER-KURIER vom 18.06.2013 - hatte unser Redakteur Gelegenheit zu einem Gespräch mit dem sympathischen, unprätentiösen Star-Gast dieses Abends:
ID Mariae Gloria Fürstin von Thurn und Taxis
19.06.2013
SPEYER-KURIER: Durchlaucht, was fasziniert heute - 915 Jahre nach ihrer Geburt - noch immer die Menschen an der Heiligen Hildegard von Bingen? Was lässt noch heute ihre Schriften Jahr für Jahr Rekordauflagen erzielen?
 Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Natürlich ist das sicher in
erster Linie die von ihr entdeckte ganzheitliche Medizin. Sie lehrt
die Menschen auch heute noch, dass es nicht immer die Pharmazie
sein muss, sondern dass man auch durch Kräuter und eine gesunde
Lebensweise Heilungserfolge erzielen kann. Die Einheit von Geist
und Körper, die sie schon vor fast 900 Jahren gepredigt hat – sie
überzeugt auch heute noch immer die Menschen.
Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Natürlich ist das sicher in
erster Linie die von ihr entdeckte ganzheitliche Medizin. Sie lehrt
die Menschen auch heute noch, dass es nicht immer die Pharmazie
sein muss, sondern dass man auch durch Kräuter und eine gesunde
Lebensweise Heilungserfolge erzielen kann. Die Einheit von Geist
und Körper, die sie schon vor fast 900 Jahren gepredigt hat – sie
überzeugt auch heute noch immer die Menschen.
SPEYER-KURIER: Etwa zur gleichen Zeit, als Hildegard von Bingen in die Geschichte eintrat, setzte sich im christianisierten Abendland mit dem Gregorianischen Choral auch die erste notierte Form liturgischer Musik durch – auch wenn ihre Wurzeln ja wohl schon bis ins Rom des 7. Jahrhunderts zurückreichen.
Heute nun stehen Gruppen wie die „Singenden Mönche des Benediktinerklosters Heiligenkreuz bei Wien“ ganz weit oben auf den internationalen Charts und die deutsche Gruppe „die Priester“ - sie besteht ja in der Tat aus drei ordinierten Priestern – hätte ja um ein Haar in diesem Jahr Deutschland beim „Eurovision Song Contest“ vertreten – ja und nicht zuletzt auch die Gruppe, mit der sie selbst derzeit durch Deutschland „touren“, macht in dieser Verbindung mehr und mehr von sich reden.
SPEYER-KURIER: Was steckt hinter diesem „Hype“, wie man das heute so nennen würde? Was fasziniert insbesondere auch junge Menschen an dieser Musik? I
 Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Diese Musik zeichnet sich ja
nicht nur durch sehr schöne Melodie-Führungen aus, sondern sie hat
vor allem etwas mystisches – etwas geheimnisvolles, was die
Menschen heute so in der Kirche leider kaum noch erleben können.
Deswegen müssen sie das auf anderem Wege für sich entdecken.
Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Diese Musik zeichnet sich ja
nicht nur durch sehr schöne Melodie-Führungen aus, sondern sie hat
vor allem etwas mystisches – etwas geheimnisvolles, was die
Menschen heute so in der Kirche leider kaum noch erleben können.
Deswegen müssen sie das auf anderem Wege für sich entdecken.
SPEYER-KURIER: Bedeutet das, dass wir heute wieder so etwas wie eine „Renaissance der Mystik“ erleben?
Gloria Fürstin von Thurn und Taxis: Ich würde sagen, dass wir heute in jedem Fall wieder verstärkt Suchende sind – Suchende, die mit ihren Fragen nach der Vergangenheit Antworten für die Gegenwart finden.
SPEYER-KURIER: Aber wie passt das alles mit unserer ach so 'moderne' Zeit zusammen? Was fasziniert gerade die junge Generation an dieser Musik – ist es mehr als nur ein besonders „cleveres Geschäftsmodell“, wenn man mit solchen „Events“ wie Sie heute abend in Speyer in der Öffentlichkeit auftritt?
 Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Ja, es sind in jedem Fall
eine oder anderthalb Stunden der Besinnung möglich an einem solchen
Abend. Wir werden da ja mit einer Frau konfrontiert, die vor 900
Jahre gelebt hat und wir hören auch Musik, die vor 900 Jahren
entstanden ist. Ich finde es deshalb enorm spannend, wenn man sagen
kann: wir tauchen komplett ein in die Vergangenheit. Auch der
Kirchenraum, der den äußeren Rahmen - das Gehäuse - für unseren
Auftritt abgibt, ist alt. Wir gehen also auf eine Zeitreise an
einem solchen Abend. Und das ist schon etwas anderes als das, was
uns das Fernsehen oder das Theater bieten können.
Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Ja, es sind in jedem Fall
eine oder anderthalb Stunden der Besinnung möglich an einem solchen
Abend. Wir werden da ja mit einer Frau konfrontiert, die vor 900
Jahre gelebt hat und wir hören auch Musik, die vor 900 Jahren
entstanden ist. Ich finde es deshalb enorm spannend, wenn man sagen
kann: wir tauchen komplett ein in die Vergangenheit. Auch der
Kirchenraum, der den äußeren Rahmen - das Gehäuse - für unseren
Auftritt abgibt, ist alt. Wir gehen also auf eine Zeitreise an
einem solchen Abend. Und das ist schon etwas anderes als das, was
uns das Fernsehen oder das Theater bieten können.
SPEYER-KURIER: Dennoch Durchlaucht, noch einmal meine Frage: Wie passt das in eine Zeit, in der die Kirchen immer mehr ihrer Mitglieder verlieren und wo man gleichzeitig z.B. in den Vereinigten Staaten ein starkes Aufleben sogenannter evangelikaler Sekten erlebt. Ist das also so etwas wie ein neue Form von Kirchlichkeit?
Gloria Fürstin von Thurn und Taxis: Also, zu dem Phänomen der evangelikalen Sekten kann ich nur wenig sagen – das ist für mich zu weit weg - da kenne ich mich nicht gut genug aus. Ich denke aber, dass die heutige Zeit davon geprägt ist, dass die Menschen keine langfristigen Bindungen mehr eingehen wollen – ganz egal, was das ist – ob das der Arbeitsplatz oder ob das eine Beziehung ist. Auch die Beziehung zum lieben Gott oder zur Kirche erfordert ja schon ein 'committment', wie es heute so schön auf Englisch heißt. Und das erscheint offensichtlich vielen Menschen zunehmend unattraktiv. Darin sehe ich auch eine Ursache, warum die Menschen heute nicht mehr in die Kirche gehen wollen – sie fürchten einfach dieses Committment – diese Verpflichtung. Man möchte sich heute nicht mehr binden und möchte auch nicht mehr bezahlen. Das ist häufig ein Grund, die Kirche zu verlassen. Aber so ist halt unsere Zeit....
SPEYER-KURIER: ...unsere Zeit, die geprägt ist Staatsschulden- und Eurokrise und bestimmt von Rettungsschirmen – geht das alles noch zusammen mit tiefem, ehrlichem Glauben?
 Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Natürlich haben wir die Krise
in Deutschland nicht so stark empfunden wie z.B. unsere
Nachbarländer, die es weit schwerer getroffen hat, wo hohe
Arbeitslosigkeit herrscht – denken Sie nur an Spanien oder auch an
Italien – da bewegen wir uns hier in Deutschland noch immer auf
einem sehr hohen Niveau – und (zögert) auch ich weiß nicht, wie
diese Krise am Ende ausgehen wird.
Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Natürlich haben wir die Krise
in Deutschland nicht so stark empfunden wie z.B. unsere
Nachbarländer, die es weit schwerer getroffen hat, wo hohe
Arbeitslosigkeit herrscht – denken Sie nur an Spanien oder auch an
Italien – da bewegen wir uns hier in Deutschland noch immer auf
einem sehr hohen Niveau – und (zögert) auch ich weiß nicht, wie
diese Krise am Ende ausgehen wird.
SPEYER-KURIER: Glauben Sie denn, dass die Menschen aus solchen 'Performances', wie wir sie auch heute abend hier in der Dreifaltigkeitskirche eleben werden, Kraft schöpfen können für einen immer schwieriger werdenden Alltag?
Gloria Fürstin von Thurn und Taxis: Es ist zumindest einmal ein besinnlicher Abend, der einem Informationen vermittelt über die Heilige und den Inhalt ihrer Schriften und Visionen - und es ist auch ein musikalisches Erlebnis.Und das in 90 Minuten – das ist doch schon einmal nicht schlecht.
SPEYER-KURIER: Durchlaucht, wir sitzen ja hier quasi im Schatten eines Mariendomes. Ich weiß, dass Sie auch selbst eine große Marienverehrerin sind. Was bedeuten Glaube und Anrufung der heiligen Jungfrau Maria für Sie in einer Zeit, die im Grunde eher von großer Nüchternheit und Sachlichkeit geprägt ist?
 Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Ich denke, wir haben Glück,
weil wir in Maria einen Menschen verehren dürfen, der Christus, der
unseren Erlöser zur Welt gebracht hat. Durch diese herausragende
Stellung hat die Kirche auch gezeigt, wie wichtig die Frau in der
Kirche ist.
Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Ich denke, wir haben Glück,
weil wir in Maria einen Menschen verehren dürfen, der Christus, der
unseren Erlöser zur Welt gebracht hat. Durch diese herausragende
Stellung hat die Kirche auch gezeigt, wie wichtig die Frau in der
Kirche ist.
Es wird ja immer behauptet, die katholische Kirche sei gegen Frauen eingestellt; das kann aber gar nicht sein, weil die wichtigste Person in unserer Kirche gleich nach dem Gottessohn die Mutter Gottes ist, denn ohne sie hätte Gott Christus, seinen Sohn, nicht in die Welt bringen können.
Die Mutter ist für einen jeden von uns wichtig und ich glaube, dass man sich in jeder Lebenssituation, bei jeglichem Anliegen leichter tut, wenn man den Weg über die Mutter wählt. Und deshalb ist die Marienverehrung auch ganz tief verwurzelt in der Volksfrömmigkeit, der auch ich selbst sehr anhänge, weil die Volksfrömmigkeit einfach eine sinnliche Frömmigkeit ist.
SPEYER-KURIER: Wenn man einschlägien Gazetten Glauben schenken darf, dann konnte man Sie in den späten 1970er und frühen 1980er Jahren ja eher in der „wilden Szene“ von Schwabing antreffen als in der beschaulichen, contemplativen Umgebung von Klöstern und Kirchen. Was hat Sie eigentlich selbst der Heiligen Hildegard von Bingen und der Gregorianik nahe gebracht?
 Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Die Heilige Hildegard von
Bingen ist ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit durch ihre Erhebung
zur Kirchenlehrerin gerückt. Vorher kannte ich von ihr nur das
allegemen Bekannte – über ihre Heilkunde – eben alles, was man über
sie nachlesen kann.
Gloria
Fürstin von Thurn und Taxis: Die Heilige Hildegard von
Bingen ist ins Zentrum meiner Aufmerksamkeit durch ihre Erhebung
zur Kirchenlehrerin gerückt. Vorher kannte ich von ihr nur das
allegemen Bekannte – über ihre Heilkunde – eben alles, was man über
sie nachlesen kann.
Den Gregorianischen Choral kenne und liebe ich schon so lange ich denken kann und er ist für mich etwas ganz besonderes. Diese besinnliche Musik ist mir einfach ganz besonders nahe.
SPEYER-KURIER: Durchlaucht, Sie sind derzeit viel unterwegs mit diesem Programm. Wie reagiert denn Ihr Publikum auf diese Mischung aus Rezitation und Choral?
Gloria Fürstin von Thurn und Taxis: Meine Erfahrung ist eine durchweg positive. Die Menschen hören das sehr still und andächtig an, obwohl das Programm ja doch durchaus recht anspruchsvoll ist und auch recht lange dauert. Ich denke, dass die Menschen am Ende zufrieden aus diesen Abenden gehen. Die Echos, die ich gehört habe, waren jedenfalls sehr gut und sehr positiv.
SPEYER-KURIER: Schloß Emmeran in Regensburg – der Stammsitz Ihrer Familie – ist ja auch selbst ein Ort ganz unterschiedlicher kultureller Aktivitäten. Auf was darf man sich da in der nächsten Zeit freuen?
Gloria Fürstin von Thurn und Taxis: Oh ja, bei uns ist immer viel los. Jetzt im Juli haben wir wieder die Schloßfestspiele – da haben wir große Künstler zu Gast – zum Beispiel Florian Voigt, den neuen Wagner-Star-Tenor, dann – ebenfalls ganz, ganz toll, den großen deutschen Geiger Michael Garrett oder den bedeutenden Entertainer Max Raabe mit seinem Palast-Orchester; und dann kommt auch der legendäre Udo Jürges und nicht zuletzt, gleichfalls ganz, ganz großartig: Der große Elton John.
SPEYER-KURIER: … und dann werden Sie ja auch selbst Ihren Auftritt haben?
 Gloria Fürstin von
Thurn und Taxis: (lacht) oh ja, dann habe auch ich meinen
Auftritt – das ist dann allerdings wieder einmal etwas mehr
„Klamauk“ – in der „Rocky Horror Picture Show“ werde ich im
entsprechenden Outfit den Hauptdarsteller mit der Harley Davidson
auf die Bühne bringen – aber die „Rocky Horror Picture Show“ ist ja
einfach Klamauk – insofern passt das dann ja auch perfekt
zusammen...
Gloria Fürstin von
Thurn und Taxis: (lacht) oh ja, dann habe auch ich meinen
Auftritt – das ist dann allerdings wieder einmal etwas mehr
„Klamauk“ – in der „Rocky Horror Picture Show“ werde ich im
entsprechenden Outfit den Hauptdarsteller mit der Harley Davidson
auf die Bühne bringen – aber die „Rocky Horror Picture Show“ ist ja
einfach Klamauk – insofern passt das dann ja auch perfekt
zusammen...
SPEYER-KURIER: Dann dürfen wir Ihnen für Ihre Rezitationsabende viel Erfolg wünschen – einen schönen, erlebnisreichen Kultursommer auf Schloss Emmeran – kein Hochwasser, wie es zuletzt ja auch Ihre bayerische Heimat betroffen hatte - und Ihnen, Durchlaucht, herzlichen Dank für dieses ausführliche und informative Gespräch.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler; Foto: pem
19.06.2013
Interview der Woche
 Als Solitär
von Speyer aus auf die Märkte der Welt
Als Solitär
von Speyer aus auf die Märkte der Welt
Spezialchemikalien-Hersteller Haltermann operiert, durch Zukauf gestärkt, wieder selbständig im Bereich der Kohlewasserstoff- Destillation
In diesem Jahr sind es 50 Jahre, dass auf dem Gelände hinter dem neuen Rheinhafen die Bauarbeiten für die ERS - die Erdölraffinerie Speyer - aufgenommen wurden, einem Gemeinschaftsunternehmen der deutschen VEBA-Gelsenberg und dem französischen Staatskonzern elf-Aquitaine. 1965 fertiggestellt wurde bereits 1972 beschlossen, die jährliche Durchsatzkapazität dieser Raffinerie auf sieben Millionen Tonnen zu verdreifachen – die damals größte Mineralöl-Raffinerie europaweit entstand auf dem Areal im Süden der Stadt.
Bereits im Jahr 1968 hatte sich „im Schatten“ dieser Raffinerie und der sie umgebenden riesigen Tanklager mit dem 1898 gegründeten, traditionsreichen Hamburger „Hersteller von Spezial-Treibstoffen, Spezialchemikalien und Lösemitteln auf Kohlenwasserstoffbasis“ Johann Haltermann GmbH ein Familienunternehmen in Speyer niedergelassen, das hier seine zweite Produktionsstätte errichtete. In den entsprechenden Märkten überaus erfolgreich, überstand die Haltermann GmbH dann auch die im Februar 1984 überraschend angekündigte Schließung der Speyerer Raffinerie unbeschadet und gelangte erst im Jahr 1998 im Zuge eines Generationswechsels innerhalb der Familie in den Besitz der englischen Firma Ascot und 2001 durch Verkauf von Ascot in den Besitz des US-amerikanischen Chemie-Riesen Dow Chemical.Company. Für diesen Multi-Konzern allerdings waren die Spezialisten aus Hamburg und Speyer auf die Dauer einfach „zu klein“, so dass sie das Unternehmen vor fast genau zwei Jahren an den europäischen Zweig der weltweit tätigen US-amerikanische Beteiligungsgesellschaft „H.I.G. Capital“ abgaben. Dort ist das Unternehmen jetzt unter dem neuen, programmatischen Namen „Haltermann – making solutions“ - dank der Aquisition seines englischen Wettbewerbers Petrochem Carless Anfang des Jahres 2013 mit einem Umsatz von 650 Mio. Euro – als unabhängiger und eigenständiger Anbieter seiner Spezialitäten ins Marktgeschehen als „HCS Group“ – Haltermann Carless Solutions -zurückgekehrt. Seinen Firmensitz hat „Haltermann“ jetzt in Speyer genommen – besser gesagt: mangels geeigneter Büroräume am Firmensitz in der Schifferstadter Rehbachstrasse 20 als Mieter im Gebäude der dortigen „Thüga AG“.
Geschäftsführer der neu formierten Haltermann Holding GmbH ist der Chemiker Dr. Uwe Nickel (54). Der gebürtige Frankfurter, der 1986 im Fach Organische Chemie an der Universität seiner Heimatstadt promovierte, hat heute mit Frau und den vier Kindern seinen Familienwohnsitz in der Nähe von Basel in der Schweiz, und war vor zu seinem Wechsel an die Spitze von Haltermann Mitglied im Vorstand des Spezialchemieherstellers „Clariant International“. Mit ihm traf sich jetzt der SPEYER-KURIER im Rahmen seiner Reihe „Interview der Woche“ zu einem ausführlichen Gespräch.
04.06.2013
SPEYER-KURIER: Herr Dr. Nickel, das Traditionsunternehmen Haltermann hat jetzt nach einigen Besitzerwechseln eine neue Heimat unter dem Dach einer großen internationalen Beteiligungsgesellschaft gefunden. Ist das so etwas, was man gemeinhin als eine „Heuschrecke“ bezeichnet?
 Dr.
Nickel: Das mit den „Heuschrecken“ ist ja dummerweise -
ähnlich wie die Aussage eines Vorstandsvorsitzenden der Deutschen
Bank, der fünfzig Millionen Mark als „peanuts“ bezeichnet hatte -
einfach nicht mehr aus den Köpfen der Menschen herauszubekommen.
Genauso ist das mit der Äußerung eines SPD-Vorsitzenden über
„Heuschrecken“ - auch sie ist wohl nicht mehr aus den Köpfen der
Menschen zu tilgen.
Dr.
Nickel: Das mit den „Heuschrecken“ ist ja dummerweise -
ähnlich wie die Aussage eines Vorstandsvorsitzenden der Deutschen
Bank, der fünfzig Millionen Mark als „peanuts“ bezeichnet hatte -
einfach nicht mehr aus den Köpfen der Menschen herauszubekommen.
Genauso ist das mit der Äußerung eines SPD-Vorsitzenden über
„Heuschrecken“ - auch sie ist wohl nicht mehr aus den Köpfen der
Menschen zu tilgen.
Nein: „private equity“ hat heute keine anderen Anforderungen an den Geschäftsführer eines Unternehmens wie ein Aufsichtsrat sie zum Beispiel an den Vorstand eines DAX-Konzerns stellt. Man muss es einmal ganz klar sagen: Die schönen alten Zeiten, wo es die schönen Produkte gab, die man einfach nur „verteilen“ musste, sind lange vorbei. Auch DAX-Konzerne haben heute klar definierte Finanzziele, die sie erreichen müssen und von daher sehe ich zwischen dem, was ich zuvor in einem börsennotierten Konzern gemacht habe und dem, was ich heute mache, überhaupt keinen Unterschied.
Der einzige Unterschied ist vielleicht, dass „private equity“ ganz klar sagt: Wir kaufen ein Unternehmen und verkaufen es wieder - und nicht: Wir kaufen dieses Unternehmen und halten es dann in alle Ewigkeit. Aber auch das ist nicht wirklich ein Unterschied, wenn man sich mal ansieht wieviel Besitzerwechsel es in der chemischen Industrie von börsennotierten Unternehmen seit 1995 gab.
SPEYER-KURIER: Das Unternehmen Haltermann hatte ja ursprünglich seinen Sitz in Hamburg. Heute ist der Firmensitz von „Haltermann neu“ in Speyer. Wie kam es dazu?
Dr. Nickel: Johann Haltermann, die das Unternehmen vor fast 115 Jahren gründete, war ein Hamburger Kaufmann und die Haltermanns, die zum Teil bis heute dort leben, waren eine Hamburger Familie. Sie hatten in der Hamburger Innenstadt ihre Zentrale und dazu die beiden Werke in Hamburg-Wilhelmsburg und in Speyer Jetzt ist der Firmensitz in Speyer und die Leitung des Unternehmens sitzt hier in Schifferstadt.
SPEYER-KURIER: Welches dieser beiden Werke ist denn das größere – und wie ist ihre Personalausstattung?
Dr. Nickel: Die ist ziemlich genau gleich. Wir haben rund siebzig Mitarbeiter in Hamburg und eine gleich große Zahl in Speyer.
SPEYER-KURIER: ...und wie verhält sich das bei den Produktionslinien? Gibt es da Unterschiede?
Dr. Nickel: Die Produktionslinien haben sich schon immer unterschieden. Das Werk Speyer erzeugt aus Rohstoffströmen des Raffinierungsprozesses bestimmte Wertstoffe heraus, die teilweise in Hamburg weiterverarbeitet werden. Dort gibt es keine Raffinerie. Das war aber schon lange Zeit in „Alt-Haltermann“-Zeiten also vor 1998 so, die ursprüngliche –kleine- Raffinerie dort wurde vor sehr langer Zeit geschlossen und abgerissen.
SPEYER-KURIER: Welche Produkte stellen Sie heute her?
 Dr.
Nickel: Was wir herstellen, sind im wesentlichen
Kohlenwasserstoffe für ganz unterschiedlichste Anwendungen: Da sind
zum einen Kohlenwasserstoffe für Test- und Referenzkraftstoffe –
die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Tank Ihres neuen Autos bei der
Übernahme zwanzig, dreißig Liter Kraftstoff von Haltermann
befinden, ist sehr groß. Dieser Kraftstoff ist nicht der, den Sie
an Ihrer Tankstelle kaufen können, sondern der ist anders. Warum?
Wenn Sie Ihr Auto bestellen, dann wird das z.B. in Stuttgart,
München, Wolfsburg u.s.w. gebaut und läuft dann dort vom Band auf
die Halde. Von dort fährt es dann z.B. auf ein Schiff, auf einen
Zug oder direkt per LKW zum Händler – dabei wird es vielleicht auch
einmal ein paar Meter gefahren und dann wieder abgestellt. Wenn Sie
dann einen ganz normalen Kraftstoff im Tank hätten, dann könnte es
Ihnen passieren, dass das Auto nicht anspringt. Und das will
natürlich niemand – am wenigsten Ihr Lieferant. Also liefern wir
einen speziellen Kraftstoff, der in jeder Situation zündet. Und
solche speziellen Kraftstoffe stellen wir her.
Dr.
Nickel: Was wir herstellen, sind im wesentlichen
Kohlenwasserstoffe für ganz unterschiedlichste Anwendungen: Da sind
zum einen Kohlenwasserstoffe für Test- und Referenzkraftstoffe –
die Wahrscheinlichkeit, dass sich im Tank Ihres neuen Autos bei der
Übernahme zwanzig, dreißig Liter Kraftstoff von Haltermann
befinden, ist sehr groß. Dieser Kraftstoff ist nicht der, den Sie
an Ihrer Tankstelle kaufen können, sondern der ist anders. Warum?
Wenn Sie Ihr Auto bestellen, dann wird das z.B. in Stuttgart,
München, Wolfsburg u.s.w. gebaut und läuft dann dort vom Band auf
die Halde. Von dort fährt es dann z.B. auf ein Schiff, auf einen
Zug oder direkt per LKW zum Händler – dabei wird es vielleicht auch
einmal ein paar Meter gefahren und dann wieder abgestellt. Wenn Sie
dann einen ganz normalen Kraftstoff im Tank hätten, dann könnte es
Ihnen passieren, dass das Auto nicht anspringt. Und das will
natürlich niemand – am wenigsten Ihr Lieferant. Also liefern wir
einen speziellen Kraftstoff, der in jeder Situation zündet. Und
solche speziellen Kraftstoffe stellen wir her.
Wir stellen aber auch Kraftstoffe für die Formel 1 her, die natürlich auch nichts mit dem zu tun haben, was Sie an ein er Tankstelle tanken können. Und der Kraftstoff, den Fernando Alonso in Barcelona fährt, hat nichts mit dem Kraftstoff zu tun, den derselbe Alonso zum Beispiel in Bahrain fährt, und der wiederum hat nichts mit dem Kraftstoff zu tun, den Vettel in Monte Carlo fährt. Formel 1 Kraftsstoffe sind somit massgeschneidert - das also ist die zweite Anwendung.
Die dritte Anwendung kommt beim Test von Motoren relevant, wo die Motorenhersteller sich wünschen, dass der verwendete Kraftstoff immer exakt gleich zusammengesetzt ist, damit sie zum Beispiel die Stärken und Schwächen von Schmierölen testen können. Dazu aber brauchen sie eben einen Kraftstoff, der immer absolut gleich ist. Nur so wissen sie, dass Veränderungen im Betriebsverhalten des Motors vom Öl kommen und nicht vom Kraftstoff. Das ist also der Bereich Test- und Referenzkraftstoffe.
Dann haben wir noch einen anderen Anwendungsbereich, wo wir Lösungsmittel herstellen, z.B. für LCD-Bildschirme oder die Mittel zum Reinigen von Arzneimittel-Wirkstoffen in der Pharma-Industrie und schließlich noch ein anderer Bereich, in dem wir Treibmittel herstellen – sogenannte „blowing agents“ - die für die riesigen Volumina in Polystyrol- oder Poly-Urethan-Schäumen verantwortlich sind.
Und schließlich die letzten Komponenten, die wir herstellen, sind Öle für die Farbenindustrie, die dafür sorgen, dass die Farbe auf dem Papier haften bleibt.
Mit dem Zukauf der englischen Firma haben wir unser Portfolio jetzt noch einmal deutlich vergrößert, denn was wir da gekauft haben, ist absolut komplementär zu dem, was Haltermann schon bisher gemacht hat. Damit liefern wir neben dem bereits beschriebenen Sortiment Lösungsmittel für die Agroindustrie und verkaufen Kondensate die bei der Gaserzeugung in der Nordsee anfallen
SPEYER-KURIER: All diese Produkte werden in Ihrem Haus ja nicht nur hergestellt, sondern auch entwickelt....
Dr. Nickel: Ja, und deshalb haben wir unsere Firma ja auch mit dem Motto „Haltermann – making solutions“ überschrieben. „Solutions“ findet sich auch im neuen Gruppennamen dem „S“ in HCS Group wieder. Wir liefern also nicht einfach nur ein Lösungsmittel, sondern auch die Lösung dazu. Also: ein Kunde, z.B. im Kraftstoffbereich, sagt uns, wir möchten die oder die Lösung erzielen – z.B. dass der Kraftstoff unter bestimmten extremen Witterungs- oder Klimabedingungen arbeitet oder dass er in bestimmten Motoren vorgegebene Eigenschaften entwickelt – dann zeigen wir ihm den Weg dahin auf und unterbreiten ihm einen entsprechenden Lösungsvorschlag. Deshalb ist das „Making solutions“ nicht einfach nur ein Werbeslogan, sondern umschreibt unsere Aufgaben - Entwicklung, Anwendungstechnischer Service und alle anderen Dienstleistungen darum herum. Das bedeutet auch, dass wir einem Kunden alles von einem bis 1.000 Liter liefern können
SPEYER-KURIER: Damit treffen Sie ja genau auf eine Entwicklung z.B. in der Automobil-Industrie, die schon längst von der Vorstellung abgerückt ist, an einem neuen Modell alles selbst, im eigenen Haus, entwickeln zu müssen. Statt desen holen sie sich Partner ins Boot, denen sie eine bestimmte Aufgabe stellen und bei denen sie sich dann die für sie beste Lösung aussuchen.
 Dr.
Nickel: Das ist richtig. Diese Veränderung gilt zwar noch
nicht in allen Bereichen, trifft aber gerade auf die
Automobil-Industrie zu, denn Automobil-Industrie war, ist und wird
wohl noch lange eine absolute Ingenieur-Domäne bleiben. Die
Automobil-Leute fokusieren sich auf Ihre Kernbereiche, zu denen die
Chemie seit jeher nicht zählt. Und deshalb – und das macht ja auch
viel Sinn - kaufen sie Chemie ein. Die Ingenieure fordern z.B. eine
weitere Optimierung der Dieselmotoren, was sie ja auch schon seit
Jahren sehr erfolgreich machen. Da wissen sie sehr genau, was sie
selbst dazu beitragen müssen – was aber die Chemie dazu betrifft –
das ist die Domäne von anderen.
Dr.
Nickel: Das ist richtig. Diese Veränderung gilt zwar noch
nicht in allen Bereichen, trifft aber gerade auf die
Automobil-Industrie zu, denn Automobil-Industrie war, ist und wird
wohl noch lange eine absolute Ingenieur-Domäne bleiben. Die
Automobil-Leute fokusieren sich auf Ihre Kernbereiche, zu denen die
Chemie seit jeher nicht zählt. Und deshalb – und das macht ja auch
viel Sinn - kaufen sie Chemie ein. Die Ingenieure fordern z.B. eine
weitere Optimierung der Dieselmotoren, was sie ja auch schon seit
Jahren sehr erfolgreich machen. Da wissen sie sehr genau, was sie
selbst dazu beitragen müssen – was aber die Chemie dazu betrifft –
das ist die Domäne von anderen.
Deshalb würden wir selbst uns auch nie ganz breit aufstellen. Wir wollen das machen, was auch wirklich gut können - und das machen wir nur in einem klar umrissenen Segment. Dadurch sind wir in manchen Bereichen auch so etwas wie ein Nischenanbieter. Und mit dem Zukauf der englischen Firma haben wir uns wieder einige neue Nischen eröffnet. Die neue Firma hat die gleiche Zielsetzung, aber andere Produkte.
SPEYER-KURIER: Wie groß ist diese neue Firma?
Dr. Nickel: Die macht einen Umsatz von 450 Millionen Euro und hat 180 Mitarbeiter. - also eine glatte Verdoppleung unserer bisherigen Größe auf 650 Miillionen Euro.
SPEYER-KURIER: Wie groß ist eigentlich der Wettbewerb, dem Sie sich stellen müssen?
Dr. Nickel: Das ist ganz schwer zu sagen, weil wir ja ganz unterschiedliche Märkte, ganz unterschiedliche Industrien bedienen Und auch da muss man ganz genau differenzieren: Da gibt es die ganz großen Wettbewerber wie Exxon Mobile, BP, Shell aber auch die OMV, die einfach groß sind - und dann kommt lang, lang nichts, aber dann kommen wir zusammen mit noch 1-2 Wettbewerbern, Und wir haben unsere Existenzberechtigung darin, dass wir Dinge machen, die die Großen nicht machen wollen oder auch nicht machen können. Und das aus ganz unterschiedlichen Gründen. Deshalb sind wir nicht die Massenanbieter, sondern die Hersteller von Spezialitäten, die in einem so riesigen Unternehmen untergehen würden.
Und diese Differenzierung ist auch der Vorteil des Mittelstandes, zu dem wir uns auch zählen.
SPEYER-KURIER: Inzwischen werden ja fast überall auf der Welt Automobile gefertigt, d.h. Ihre Produkte werden dort auch überall gebraucht. Gibt es dafür Wettbewerber für Sie in anderen Regionen der Welt?
Dr. Nickel: ...also in Europa gibt es nicht viele. Wir sind insbesondere durch den Kauf der „Petrochem Carless“ in Europa einer der Top 3 in allen Industriezweigen geworden, in denen wir aktiv sind.
SPEYER-KURIER: Wo sind Sie denn außerhalb Deutschlands aktiv?
Dr. Nickel: Wenn wir die Gruppe betrachten, so machen wir etwa die Hälfte unseres Umsatzes in Zentraleuropa. Etwa 20 bis 25 %gehen nach Osteuropa und in sonstige Regionen in Europa, die restlichen 25% gehen in den Rest der Welt. Das ist ein relativ großer Anteil ist, haben wir es doch mit Lösungsmitteln zu tun und Lösungsmittel „reisen“ nicht so gern, d.h. die Transportkosten sind bei der Preisgestaltung und Kaufentscheidung relevant.
SPEYER-KURIER: Gegenwärtig verlagert sich ja vieles in den Industrien, für die auch Sie tätig sind, von Westen nach Osten – nach China insbesondere. Ist es unter diesen Voraussetzungen auch für Haltermann eine Option, mit seinen Produkten oder gar mit neuen Produktionsstätten in diese Märkte zu gehen?
 Dr.
Nickel: Also, ich denke, da muss man schon ein wenig die
Kirche im Dorf lassen. China ist ein Thema z.B. für die
Grossunternehmen, aber für die ist das schon seit 25 Jahren ein
Thema. Und die grossen Chemieunternehmen haben in diesen 25 Jahren
auch viel gelernt und sich entsprechend entwickelt, wie man
beispielhaft am Chemiekomplex der BASF in Nanjing eindrucksvoll
sehen kann. Für uns ist das deshalb auch nicht die entscheidende
Frage. Für uns ist die Frage, ob wir die Resourcen dafür haben,
das, was wir in Europa erfolgreich machen, auch genauso erfolgreich
in Asien oder einer anderen Region zu tun. Diese Frage stellt sich
zu Asien – stellt sich aber genauso zu Amerika, zu Südamerika und
auch zu Russland. Der Hype um China ist meines Erachtens schon
wieder vorbei – im Moment ist dieser Hype eher in Amerika – und das
wird auch noch einige Zeit so bleiben - aber dann wird der Hype
halt wo anders hingehen. Von daher ist China für uns auch nicht das
Thema, dass mir Sorgen machen müssten, dass Hersteller aus China
uns gefährlich werden könnten oder dass wir unseren Platz auf den
Märkten verlieren würden, wenn wir nicht unsererseits auch nach
China gehen würden. Diese Frage stellt sich einem mittelständischen
Unternehmen nicht so stark, wenn überhaupt.
Dr.
Nickel: Also, ich denke, da muss man schon ein wenig die
Kirche im Dorf lassen. China ist ein Thema z.B. für die
Grossunternehmen, aber für die ist das schon seit 25 Jahren ein
Thema. Und die grossen Chemieunternehmen haben in diesen 25 Jahren
auch viel gelernt und sich entsprechend entwickelt, wie man
beispielhaft am Chemiekomplex der BASF in Nanjing eindrucksvoll
sehen kann. Für uns ist das deshalb auch nicht die entscheidende
Frage. Für uns ist die Frage, ob wir die Resourcen dafür haben,
das, was wir in Europa erfolgreich machen, auch genauso erfolgreich
in Asien oder einer anderen Region zu tun. Diese Frage stellt sich
zu Asien – stellt sich aber genauso zu Amerika, zu Südamerika und
auch zu Russland. Der Hype um China ist meines Erachtens schon
wieder vorbei – im Moment ist dieser Hype eher in Amerika – und das
wird auch noch einige Zeit so bleiben - aber dann wird der Hype
halt wo anders hingehen. Von daher ist China für uns auch nicht das
Thema, dass mir Sorgen machen müssten, dass Hersteller aus China
uns gefährlich werden könnten oder dass wir unseren Platz auf den
Märkten verlieren würden, wenn wir nicht unsererseits auch nach
China gehen würden. Diese Frage stellt sich einem mittelständischen
Unternehmen nicht so stark, wenn überhaupt.
SPEYER-KURIER: Lassen Sie mich es noch einmal anders versuchen: Gibt es nicht Produkte, wo Sie in der Welt eine solche Vorrangstellung einnehmen, dass Sie damit vielleicht auch in diese weit entfernten Länder gehen müssten.
Dr. Nickel: Das machen wir ja schon und das steckt in den vorhin aifgeführten letzten 25%.
SPEYER-KURIER: Aber dort auch produzieren?
Dr. Nickel:....das war für uns in den letzten zwei Jahren keine Option. Wir erzeugen solche Produkte hier und verkaufen sie dann von hier aus in alle Regionen der Welt.
Für uns war es zuerst einmal wichtig, Haltermann wieder auf eigene Füsse zu stellen - mit einer eigenständgen Finanzabteilung, einer eigenständigen IT-Abteilung und vor allem mit einer eigenständigen Entwicklung. Zum zweiten wollen wir weiter wachsen – organisch wachsen und gegebenenfalls auch durch Akquisition. Mit dem Zukauf der englischen Firma haben wir diese Absicht deutlich gemacht. Und drittens; Wir wollen entweder durch Akquisition oder aus eigenen Stärken heraus unseren Globalauftritt verstärken. Das kann man tun, indem man Produkte hier herstellt und nach irgendwohin verschifft – und so fängt man normalerweise auch an und so haben eigentlich alle einmal angefangen – dann kann man vielleicht auch eine neue Produktionsstätte finden, mit der man einen lokalen oder regionalen Markt bedienen kann. Und da kann ich nur sagen – ohne ins Detail gehen zu können – das verfolgen wir sehr aktiv.
Ziel der HCS Gruppe war und ist es, in diesem Sinne auch weiterhin zu wachsen. Dazu bedarf es natürlich auch gewiesser Rahmenbedingungen – so müssen Sie dazu auch entsprechend geeignete Mitarbeiter finden...
SPEYER-KURIER: ...was gerade in so spezialisierten Bereichen auch zunehmend schwieriger wird...
 Dr.
Nickel: Das ist zwar einerseits richtig, andererseits war
es aber schon immer schwierig, solche Spezialisten zu finden. Das
ist natürlich auch eine Herausforderung. Als wir vor zwei Jahren
angetreten sind, da kannte kaum noch jemand den Namen Haltermann.
Das war nicht immer so, wenn früher jemand ein Destillationsproblem
hatte, da wusste man in Fachkreisen, dass man zu Haltermann gehen
muss – die lösen dann das Problem. Doch diese Zeiten waren längst
vorbei. Die Fachleute kannten natürlich den Namen Haltermann, aber
allgemein war er etwas ins Abseits geraten und in der grossen Dow
auch etwas untergegangen. Als wir dann wieder angefangen haben und
Mitarbeiter suchten, da war das zunächst garnicht so einfach. Viele
haben gefragt: Haltermann, wer ist denn das?
Dr.
Nickel: Das ist zwar einerseits richtig, andererseits war
es aber schon immer schwierig, solche Spezialisten zu finden. Das
ist natürlich auch eine Herausforderung. Als wir vor zwei Jahren
angetreten sind, da kannte kaum noch jemand den Namen Haltermann.
Das war nicht immer so, wenn früher jemand ein Destillationsproblem
hatte, da wusste man in Fachkreisen, dass man zu Haltermann gehen
muss – die lösen dann das Problem. Doch diese Zeiten waren längst
vorbei. Die Fachleute kannten natürlich den Namen Haltermann, aber
allgemein war er etwas ins Abseits geraten und in der grossen Dow
auch etwas untergegangen. Als wir dann wieder angefangen haben und
Mitarbeiter suchten, da war das zunächst garnicht so einfach. Viele
haben gefragt: Haltermann, wer ist denn das?
Doch das hat sich inzwischen völlig gewandelt. Wenn wir heute wollten, könnten wir glatt doppelt so viele Leute einstellen, ohne lange suchen oder werben zu müssen. Natürlich haben wir dazu auch etwas gemacht: Wir haben Werbung gemacht, sind an die einschlägigen Universitäten gegangen – alles in kleinem, bescheidenem Masse. Das hat dazu geführt, dass wir inzwischen im Personalbereich kräftig nachgefragt werden. Und das macht uns schon ein wenig stolz.
SPEYER-KURIER: Wieviele Mitarbeiter haben Sie denn gegenwärtig in der Speyerer Produktion beschäftigt?
Dr. Nickel: Die vorhin schon erwähnten siebzig...
SPEYER-KURIER: .. und hier in der Verwaltung?
Dr. Nickel: Da sind es zur Zeit zwanzig.
SPEYER-KURIER: Herr Dr. Nickel, was waren denn die Gründe, dass Sie Ihre Verwaltung hier in Schifferstadt angesiedelt haben und nicht in Speyer, wo doch eigentlich Ihre Firmenzentrale und eine Ihrer Produktionsstätten sind?
 Dr.
Nickel: Bis zu seiner Neukonstituierung vor zwei Jahren
hatte Haltermann überhaupt keine eigene Verwaltung. Das wurde zuvor
von Dow erledigt. Als wir uns dann neu gegründet haben, beschlossen
wir, mit der Zentrale nach Speyer zu gehen. Auf dem Werksgelände
hatten wir jedoch kein ausreichend großes Verwaltungsgebäude, und
zwei Jahre warten, bis dort etwas entsprechendes hochgezogen worden
wäre - das konnten wir nicht – das hätte uns einfach zu lange
gedauert. Aber trotz monatelanger, intensiver Suche haben wir in
Speyer kein geeignetes Verwaltungsgebäude gefunden- Als jemand, der
den Speyerer Dom kennt, der diese schöne Stadt Speyer kennt und
liebt und der die Pfalz kennt, war ich überaus erstaunt, dass uns
niemand etwas geeignetes anbieten konnte. Wie gesagt: Wir haben
wirklich intensiv gesucht - aber es gab einfach nichts. Und so sind
wir am Ende hier in Schifferstadt gelandet.... Wenn wir in
Ludwigshafen etwas gefunden hätten, dann wären wir heute vielleicht
in Ludwigshafen.
Dr.
Nickel: Bis zu seiner Neukonstituierung vor zwei Jahren
hatte Haltermann überhaupt keine eigene Verwaltung. Das wurde zuvor
von Dow erledigt. Als wir uns dann neu gegründet haben, beschlossen
wir, mit der Zentrale nach Speyer zu gehen. Auf dem Werksgelände
hatten wir jedoch kein ausreichend großes Verwaltungsgebäude, und
zwei Jahre warten, bis dort etwas entsprechendes hochgezogen worden
wäre - das konnten wir nicht – das hätte uns einfach zu lange
gedauert. Aber trotz monatelanger, intensiver Suche haben wir in
Speyer kein geeignetes Verwaltungsgebäude gefunden- Als jemand, der
den Speyerer Dom kennt, der diese schöne Stadt Speyer kennt und
liebt und der die Pfalz kennt, war ich überaus erstaunt, dass uns
niemand etwas geeignetes anbieten konnte. Wie gesagt: Wir haben
wirklich intensiv gesucht - aber es gab einfach nichts. Und so sind
wir am Ende hier in Schifferstadt gelandet.... Wenn wir in
Ludwigshafen etwas gefunden hätten, dann wären wir heute vielleicht
in Ludwigshafen.
SPEYER-KURIER: Wenn ich Sie also recht verstehe, heißt das nicht, dass das mit Schifferstadt auf Dauer so bleiben muss...
Dr. Nickel: Nein, nein, das hier ist sicher nur eine Übergangslösung. Wir haben ja sehr viele Gespräche geführt und darin bekundet, dass wir ein entsprechend repräsentatives Verwaltungsgebäude in Speyer suchen, aber unsere Bemühungen waren bis zum heutigen Tage völlig erfolglos.
SPEYER-KURIER: Lieber Herr Dr. Nickel, dann dürfen wir uns ganz herzlich für das ausführliche und informative Gespräch bedanken und Ihnen und der Haltermann GmbH Speyer viel Erfolg bei Ihren weiteren Aktivitäten wünschen, aber auch eine glückliche Hand bei Ihrer Suche nach einer angemessenen „Bleibe“ in der Speyer.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler, Fotos: gc; Haltermann GmbH
04.06.2013
Interview der Woche
 heute mit
heute mit
Bernhard Slavetinsky,
Bankdirektor - Vorstandsvorsitzender der PSD Bank Karlsruhe-Neustadt eG
verheiratet. - 2 Kinder
geb.: 1959 in Mosbach/Baden
1980 - 1983 Studium an der FH Bund in Köln/Dieburg
1984 - 1989 Studium der Wirtschaftswissenschaften an der Fernuniversität Hagen
1987 - 1989 Studium der Bankbetriebswirtschaft an der Akademie der VR Banken in Montabaur
Seit 2003 Vorstandsvorsitzender der PSD Bank-Stiftung „Aufwind“
Seit 2003 Beiratsmitglied der DZ Bank Frankfurt/Main
28.05.2013
SPEYER-KURIER: Herr Slavetinsky, die PSD Bank vereinigt mehrere ganz unterschiedliche Werte in sich: Da ist zum einen die lange Tradition der vor über 140 Jahren gegründeten Post-, Spar- und Darlehensvereine, der die Modernität einer zeitgemäß operierenden Direktbank gegenübersteht. Zugleich aber ist die PSD Bank ja auch eine klassische Genossenschaftsbank. Wie geht das alles zusammen?
 B.
Slavetinsky: Das passt sehr gut zusammen. Wir sind 1872 von dem
damaligen Generalpostmeister Heinrich von Stephan als
Selbsthilfeeinrichtung für das Postpersonal gegründet worden.
Dieser hatte damals die bis heute moderne Idee, Mitarbeitern im
Falle einer finanziellen Notlage einen Ansprechpartner zu geben. So
entstanden im Deutschen Reich bei allen 21 Oberpostdirektionen PSD
Banken: Post-, Spar-, Darlehens- und Vorschusskassen. Diese haben
sich im Gewand der Deutschen Bundespost für deren Mitarbeiter bis
über die Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg
weiterentwickelt. Mitte des 20. Jahrhunderts waren es dann
allerdings nicht mehr allein die Postler, die bei der PSD Bank
Mitglied werden konnten, sondern auch Mitarbeiter der Telekom und
später auch der Postbank.
B.
Slavetinsky: Das passt sehr gut zusammen. Wir sind 1872 von dem
damaligen Generalpostmeister Heinrich von Stephan als
Selbsthilfeeinrichtung für das Postpersonal gegründet worden.
Dieser hatte damals die bis heute moderne Idee, Mitarbeitern im
Falle einer finanziellen Notlage einen Ansprechpartner zu geben. So
entstanden im Deutschen Reich bei allen 21 Oberpostdirektionen PSD
Banken: Post-, Spar-, Darlehens- und Vorschusskassen. Diese haben
sich im Gewand der Deutschen Bundespost für deren Mitarbeiter bis
über die Währungsreform nach dem Zweiten Weltkrieg
weiterentwickelt. Mitte des 20. Jahrhunderts waren es dann
allerdings nicht mehr allein die Postler, die bei der PSD Bank
Mitglied werden konnten, sondern auch Mitarbeiter der Telekom und
später auch der Postbank.
1993 schließlich wurde die Dreiteilung der Deutschen Bundespost vollzogen. Aus ihr gingen die Deutsche Post AG, die Telekom AG und die Postbank hervor. Auch was aus der PSD Bankengruppe werden sollte, stand im Raum. Wir haben uns damals entschieden, selbständig zu bleiben. Wir sind in der Folge 1998 in den Genossenschaftlichen Verbund eingetreten und haben uns für alle Verbraucher geöffnet.
Ich selbst bin 1993 in den Vorstand der PSD Bank berufen worden und hatte dadurch die Möglichkeit, die Bank, so wie sie sich heute darstellt, mitzugestalten.
SPEYER-KURIER: Wenn Sie von 'wir' sprechen, Herr Slavetinsky, dann ist das ja nicht allein die PSD Bank hier in Karlsruhe-Neustadt, sondern die gesamte PSD Gruppe?
 B.
Slavetinsky: Mit 'wir' meine ich die PSD Bank
Karlsruhe-Neustadt und diesen Vorstand.
B.
Slavetinsky: Mit 'wir' meine ich die PSD Bank
Karlsruhe-Neustadt und diesen Vorstand.
SPEYER-KURIER: Aber diese Genese haben doch die anderen PSD Banken in der gleichen Weise vollzogen...
B. Slavetinsky: ...in der gleichen Weise sicher. Der Unterschied liegt aber auch hier im Detail. Zwar tritt die PSD Bankengruppe nach außen sehr homogen auf, intern setzt sie aber in den regionalen PSD Banken ganz unterschiedliche Schwerpunkte in der Geschäftspolitik. Das liegt an der Regionalität und der jeweiligen Struktur des Platzes, aber auch an den Vertriebsgewohnheiten.
SPEYER-KURIER: Herr Slavetinsky, der Begriff 'Direktbank' beschreibt ja oft nicht nur die im wesentlichen auf „online-banking“ basierende besondere Nähe einer solchen Bank zu ihren Kunden, sondern auch, dass sie sich oft in dem, was sie tun, spezialisiert haben. Da gibt es Direktbanken, die sich auf die Finanzierung von Automobilen spezialisiert haben, andere, die sich auf die Finanzierung von Einrichtungen konzentrieren. Wo liegt die Spezialität der PSD Bank Karlsruhe-Neustadt?
B. Slavetinsky: Wir haben traditionell nicht viele Filialen, dafür aber ein umfangreiches Netz von Vertrauensleuten, die unsere Kunden betreuen. Spezialisiert haben wir uns auf das, was wir können: das Kreditgeschäft und dabei insbesondere die Baufinanzierung. Auch für Phasen, wo Geld übrig ist, haben wir entsprechende Angebote kreiert. Daneben bieten wir das gesamte Versicherungspaket an und bearbeiten das Thema Altersvorsorge, welches wir mit unseren Kooperationspartnern im genossenschaftlichen Verbund gut abdecken. Schließlich betreuen wir auch Standard-Tagesgeldkonten mit Giro-Funktion. In der Summe gibt es aber insgesamt nur sechs Produkte in unserem Portfolio. Wenn Sie zu einer Primärbank oder gar zu einer Großbank gehen, können Sie unter oft mehr als 200 Produkten auswählen. Das haben wir in dieser Breite nicht, glauben aber dennoch, damit richtig aufgestellt zu sein.
SPEYER-KURIER: Um eine Bank Ihres Ranges auch im Vergleich einordnen zu können, muss man die Frage nach Ihrer Bilanzsumme stellen.
 B.
Slavetinsky: Unsere Bilanzsumme geht in Richtung 1,6 Milliarden
Euro. Beim Geschäftsvolumen liegen wir bei 2,4 Milliarden Euro.
Dazu zählen Kundeneinlagen, Kredite, Guthaben, auch Guthaben bei
den Verbundpartnern in Versicherungen und Bausparverträgen sowie
Aktiendepots, die ebenfalls bei uns möglich sind.
B.
Slavetinsky: Unsere Bilanzsumme geht in Richtung 1,6 Milliarden
Euro. Beim Geschäftsvolumen liegen wir bei 2,4 Milliarden Euro.
Dazu zählen Kundeneinlagen, Kredite, Guthaben, auch Guthaben bei
den Verbundpartnern in Versicherungen und Bausparverträgen sowie
Aktiendepots, die ebenfalls bei uns möglich sind.
SPEYER-KURIER: Herr Slavetinsky, Direktbanken wird ja immer wieder vorgeworfen, dass es ihnen an einer zureichenden Verankerung in der Region fehlt. Wie ist das bei der PSD Bank?
B. Slavetinsky: Der Vergleich mit einer normalen Direktbank ist problematisch, weil diese meist deutschland- oder sogar europaweit tätig sind. Wie in unserer Satzung festgeschrieben ist, konzentrieren uns auf die Pfalz und Nordbaden und leisten hier auch unseren Sozialbeitrag. Das bedeutet: Wir verdienen hier unser Geld und geben es hier auch aus.
SPEYER-KURIER: Das heißt, Sie unterscheiden sich von herkömmlichen Direktbanken doch ganz fundamental.
B.Slavetinsky: Ja, das ist völlig richtig. Wenn man den direkten Vergleich mit einer üblichen Direktbank hernimmt, haben wir die lokale und regionale Nähe mit Speyer und Karlsruhe als Hauptanlaufstelle. Damit hat jeder Kunde maximal eine Anreise von 80 Kilometern. Diesen Weg muss er allerdings nur noch für wirklich wichtige Fragen, wie zum Beispiel eben der Baufinanzierung, auf sich nehmen, wobei unsere Berater auch zu unseren Kunden nach Hause kommen, wenn sie das wünschen.
SPEYER-KURIER: Ein anderer Vorhalt, der den Direktbanken oft gemacht wird, lautet, sie würden sich aus der Ausbildung von Nachwuchsmitarbeitern weitestgehend heraushalten und diese stattdessen lieber 'fertig' bei ihren Wettbewerbern abwerben. Gilt das auch für die PSD Bank?
 B.
Slavetinsky: Das ist bei uns völlig anders: Wenn man ein
Institut mit unserer Tradition hernimmt, dann haben sich Werte zu
einer echten Unternehmenskultur entwickelt. Und diese
Unternehmenskultur können Sie am besten mit Leuten, die Sie selbst
ausgebildet haben, fortführen. Immer dann, wenn Sie von Extern
einstellen, kaufen Sie auch ein Stück weit eine andere
Unternehmenskultur ein. Deshalb legen wir extrem großen Wert
darauf, unseren Nachwuchs selbst auszubilden.
B.
Slavetinsky: Das ist bei uns völlig anders: Wenn man ein
Institut mit unserer Tradition hernimmt, dann haben sich Werte zu
einer echten Unternehmenskultur entwickelt. Und diese
Unternehmenskultur können Sie am besten mit Leuten, die Sie selbst
ausgebildet haben, fortführen. Immer dann, wenn Sie von Extern
einstellen, kaufen Sie auch ein Stück weit eine andere
Unternehmenskultur ein. Deshalb legen wir extrem großen Wert
darauf, unseren Nachwuchs selbst auszubilden.
Bei der Ausbildung, aber auch bei Investitionsentscheidungen und der Produktauswahl legen wir drei zentrale Schwerpunkte zugrunde: die Kundenzufriedenheit als unser oberstes Ziel – alles, was wir machen, muss im Interesse unserer Kunden geschehen – eine betriebswirtschaftlich auskömmliche Größe und schließlich zufriedene Mitarbeiter. Denn diese sorgen für zufriedene Kunden und zufriedene Kunden wiederum unterstützen unsere Bilanz. Auf diese Weise versuchen wir, die Unternehmenskultur unseres fast 141 Jahre alten Instituts auch in die Zukunft weiterzutragen.
SPEYER-KURIER: Wie viele Mitarbeiter beschäftigt die PSD Bank Karlsruhe-Neustadt derzeit eigentlich?
 B.
Slavetinsky: Wir hatten per Ende 2012 insgesamt 145 Mitarbeiter
an den Standorten Karlsruhe und Speyer – 25 davon in
Speyer.
B.
Slavetinsky: Wir hatten per Ende 2012 insgesamt 145 Mitarbeiter
an den Standorten Karlsruhe und Speyer – 25 davon in
Speyer.
SPEYER-KURIER: Herr Slavetinsky, wir haben ja bereits über die Vorurteile gesprochen, denen sich Direktbanken vielfach ausgesetzt sehen. Dazu gehört ja auch, dass sie sich nicht an der Förderung gemeinnütziger Aufgaben beteiligen würden – dem Sponsoring von Sport, Kultur und sozialen Belangen? Nun wissen wir ja, dass das bei Ihnen anders ist - immerhin haben wir uns doch zuletzt bei der Überreichung einer Spende für einen sozialen Zweck in Speyer getroffen - wie verhält sich das bei der PSD Bank generell?
B. Slavetinsky: Entsprechend unserer Tradition haben wir schon immer nach unserer selbstgestellten Verpflichtung gehandelt, benachteiligte Gruppen oder Einzelpersonen zu unterstützen. Das beginnt bei der Gestaltung unserer Zinspolitik, die für alle unsere Kunden ein Vorteil ist, äußert sich aber auch in der direkten monetären Unterstützung bestimmter Gruppen. Dazu haben wir 2003 eine Stiftung gegründet, die sich speziell in Nordbaden und der Pfalz um Sozialprojekte kümmert, die wir für wichtig halten und wo der Staat nicht mehr über zureichende Fördermöglichkeiten verfügt. Eines davon – in Speyer – ist JUMA - „Junge Menschen im Aufwind“. Daneben haben wir noch Projekte in Heidelberg und Karlsruhe.
SPEYER-KURIER: Nun unterstützen Geldinstitute ja oft bevorzugt Gruppierungen, von denen sie sich erhoffen, ihnen später wieder als Kunden zu begegnen. Straffällig gewordene Jugendliche zählen hier ja aber eher weniger zu dieser Gruppe...
B. Slavetinsky: Wir bewegen uns mit unserem Sponsoring bei der PSD Bank auf zwei unterschiedlichen Ebenen: Das 'Social-Sponsoring' bedenken wir über die Stiftung. Es ist mit keinerlei wirtschaftlichen Interessen verbunden. Vielmehr liegt uns daran, soziale Verantwortung zu übernehmen. Der zweite Bereich ist das 'Professional Sponsoring'. Wir unterstützen zum Beispiel die Handballmannschaft der „Rhein-Neckar Löwen“, die Basketballgemeinschaft in Karlsruhe, die „BIS-Baskets“ sowie den Judo-Club in Speyer – und versprechen uns davon natürlich auch eine Steigerung unseres Bekanntheitsgrades.
SPEYER-KURIER: Sie haben über Sponsoring im Sozialbereich und im Sport berichtet – wie steht es um die Kultur?
 B.
Slavetinsky: Seit letztem Jahr finanzieren wir eine
Stiftungsprofessur an der Hochschule in Pforzheim – das verstehen
wir als ersten Einstieg in den Bereich des kulturellen
Sponsorings.
B.
Slavetinsky: Seit letztem Jahr finanzieren wir eine
Stiftungsprofessur an der Hochschule in Pforzheim – das verstehen
wir als ersten Einstieg in den Bereich des kulturellen
Sponsorings.
SPEYER-KURIER: Vielfältige Aufgaben, für die ein Vorstandsvorsitzender die Verantwortung trägt. Unabhängig von diesen Tagesthemen – was bewegt Sie derzeit in unserer Gesellschaft am meisten?
B. Slavetinsky: Was mich beschäftigt, ist zum einen die Spaltung unserer Gesellschaft in Arm und Reich. Ich beobachte seit Jahren mit wachsender Sorge, dass es immer mehr Menschen gibt, die immer weniger haben.
Zum anderen haben wir nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa einen ausgesprochenen Hang zu mehr Bürokratie. Ich kann verstehen, dass man gerade auch im Bankensektor viel regeln will. Aber die Art und Weise halte ich für kontraproduktiv. Die Probleme, die mit der Weltwirtschaftskrise entstanden, haben nur einige wenige verursacht – die Lasten müssen jedoch alle tragen. Das bedeutet, dass nun alle Banken Vorschriften umsetzen müssen, die sie eigentlich gar nicht betreffen – und dadurch einen unvergleichlich hohen bürokratischen Aufwand betreiben müssen. Das wiederum hat zur Folge, dass der Kostenanteil, den wir an den Kunden weitergeben müssen, so hoch wird, dass das Produkt selbst unverhältnismäßig teuer wird. Das ist längst zu einem perpetuum mobile geworden, dessen Ende noch nicht absehbar ist.
SPEYER-KURIER: Haben am Ende nicht Stimmen recht wie der Sozialethiker Prof. Friedhelm Hengsbach, die fordern, alle Banken außer den für die tägliche Geldversorgung notwendigen Genossenschaftsbanken und Sparkassen zu schließen?
B. Slavetinsky: Das lässt die Komplexität unserer Wirtschaft nicht zu. Eine Volksbank, eine Raiffeisenbank oder eine Sparkasse kann den internationalen Warenverkehr nicht finanzieren. Wenn z.B. ein Container von Shanghai nach Hamburg verschifft wird, kann eine PSD Bank in Karlsruhe damit nichts anfangen. Aber diese Geschäfte müssen auch finanziert werden. Ich kann allerdings Prof. Hengsbach verstehen und gebe ihm recht, wenn man den Fokus auf den ganz normalen Verbraucher lenkt. Und das ist ja auch die Basis unserer Geschäftsstrategie. Den normalen Bürger können wir im Primärbankenbereich völlig ausreichend bedienen. Für internationale Geschäfte im Zeichen der Globalisierung allerdings sind wir zu klein.
SPEYER-KURIER: Wir erleben ja gegenwärtig, aus ganz anderen Gründen, eine Aufteilung in „good banks“ und „bad banks“. Vielleicht wäre es sinnvoller, hier eine andere Aufteilung in Banken für die „Alltagsgeschäfte“ und Banken für die „internationalen, globalen Geschäfte“ vorzunehmen?
 B.
Slavetinsky: Ja, so etwas könnte man sicher organisieren. Ich
wage allerdings zu bezweifeln, ob das erfolgversprechend wäre, weil
die Wirtschaft anders funktioniert und in Gedanken meist der
Entwicklung schon vorausgeht.
B.
Slavetinsky: Ja, so etwas könnte man sicher organisieren. Ich
wage allerdings zu bezweifeln, ob das erfolgversprechend wäre, weil
die Wirtschaft anders funktioniert und in Gedanken meist der
Entwicklung schon vorausgeht.
SPEYER-KURIER: Herr Slavetinsky. Wir sprechen ja heute im Alltag ständig von Krisen – von der Haushaltskrise, der Finanzkrise und meinen damit ja eigentlich die Staatsschuldenkrise – wie ist denn Ihre Prognose, wie wird das weitergehen?
B. Slavetinsky: Zunächst habe ich in meinen 54 Jahren gelernt, dass es immer weiter geht. Im Kleinen können wir jeden Tag etwas verändern, aber nicht im Grundsätzlichen. Darum wird diese Krise auch uns weiterentwickeln. Meiner Meinung nach wird es zu einem neuen Gleichgewicht kommen, woraus sich eine neue Entwicklung ergibt. Ob das eine Entspannungs- oder eine Prosperitätsphase sein wird, weiß ich nicht. Vorausberechnen können wir das bei einem so komplexen Gesellschafts- und Finanzsystem nicht, auch wenn sich das wohl jeder von uns wünschen würde. Ich sage in diesem Zusammenhang immer gerne, dass es mir schon genügen würde, die Lottozahlen vom nächsten Samstag zu wissen …
Ich hoffe nur, dass sich unsere Zukunft in Frieden und Wohlstand weiter entwickeln kann.
SPEYER-KURIER: Lieber Herr Slavetinsky, nach sovielen informativen, aber auch durchaus nachdenklichen Antworten zum Schluss – wie üblich beim SPEYER-KURIER – ein paar schnelle persönliche Fragen: Welche Hobbys hat Bernhard Slavetinsky jenseits seiner Arbeit in der Bank?
B. Slavetinsky: ….zunächst kann ich mir eigentlich kaum vorstellen, dass ich, wann immer ich die Augen offen habe, nicht an die Bank denke, denn wenn Sie so einen Job machen, gibt es praktisch keine Freizeit. Aber wenn ich völlig privat bin, dann mache ich viel Sport – passiv und aktiv. Ich spiele gerne Golf und Tennis, gehe ins Fitnessstudio, auch wenn eigentlich immer ein Ball im Spiel sein sollte – und dann ist da auch noch die Leichtathletik.
SPEYER-KURIER: Welche Musikrichtung bevorzugen Sie?
B. Slavetinsky: Rock in allen Formen.
SPEYER-KURIER: Und zu guter Letzt: Welches Buch liegt zur Zeit auf Ihrem Nachttisch?
B. Slavetinsky: „FIFA-Mafia“ - ein spannender Einblick in die Machenschaften der internationalen „Fußball-Götter“. So richtig passend in unserer Zeit.
SPEYER-KURIER: Dann dürfen wir Ihnen sehr herzlich für das ausführliche Gespräch danken und wünschen Ihnen für Ihre verantwortungsvolle Aufgabe auch weiterhin viel Glück und Erfolg.
Das Gespräch führte SPEYER-KURIER-Redakteur Gerhard Cantzler; Foto: spk; PSD Bank
28.05.2013
Interview der Woche
Investition in die Zukunft – Europaabgeordneter Jürgen Creutzmann FDP spricht sich nachdrücklich für Zusammenschluss der drei vorderpfälzischen Sparkassen aus
Ein Thema beherrscht derzeit die Diskussion der Menschen in der Vorderpfalz wie kaum ein anderes - die geplante Fusion der drei gegenwärtig noch als Wettbewerber in der Region operierenden Sparkassen in Ludwigshafen, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis.
In den nächsten Tagen sollen nun die Entscheidungsgremien der vier betroffenen Gebietskörperschaften, die Stadträte von Ludwigshafen, Speyer und Schifferstadt sowie der Kreistag des Rhein-Pfalz-Kreises ihr Votum zu dieser einschneidenden Veränderung abgeben, an das dann die Mitglieder der Versammlungen der drei Sparkassen-Zweckverbände bei ihrer letztendlichen Entscheidung gebunden sind.
In seinem „Interview der Woche“ sprach jetzt der SPEYER-KURIER mit einem der profiliertesten Befürworter dieses Zusammenschlusses, dem Abgeordneten im Europäischen Parlament, Jürgen Creutzmann FDP, Dudenhofen, der zugleich Mitglied im Verwaltungsrat der Kreissparkasse Rhein-Pfalz ist.
 SPEYER-KURIER:
Herr Creutzmann, die drei Sparkassen in der Vorderpfalz stehen wohl
kurz vor ihrer Fusion zu einer gemeinsamen Sparkasse Vorderpfalz.
Sie selbst sind Mitglied im Verwaltungsrat der Kreisparkasse
Rhein-Pfalz, der Sparkasse also, die für den größeren Teil des
Rhein-Pfalz-Kreises zuständig ist und sprechen sich vehement für
diesen Zusammenschluss ein. Wo liegen denn nach Ihrer Meinung die
Vorteile einer solchen Fusion?
SPEYER-KURIER:
Herr Creutzmann, die drei Sparkassen in der Vorderpfalz stehen wohl
kurz vor ihrer Fusion zu einer gemeinsamen Sparkasse Vorderpfalz.
Sie selbst sind Mitglied im Verwaltungsrat der Kreisparkasse
Rhein-Pfalz, der Sparkasse also, die für den größeren Teil des
Rhein-Pfalz-Kreises zuständig ist und sprechen sich vehement für
diesen Zusammenschluss ein. Wo liegen denn nach Ihrer Meinung die
Vorteile einer solchen Fusion?
Jürgen Creutzmann: Man muss einen Zusammenschluss dieser Sparkassen vor allem vor dem Hintergrund einer veränderten Marktlandschaft betrachten. Immer mehr junge Menschen machen heute online-Banking und schauen dort darauf, wo sie die besten Konditionen vorfinden. Sie können heute ganz leicht ein Konto eröffnen, wo immer sie wollen - innerhalb Deutschlands, Europas, ja in der ganzen Welt. Dazu brauchen sie sich nur einmal zu legitimieren und schon können Sie Ihre gesamten Bankgeschäfte online erledigen.
Die Sparkassen – und übrigens auch die Genossenschaftsbanken – haben den Vorteil, dass sie bundesweit in der Fläch und vor Ort vertreten sind. Das ist ihr großes Prae, denn es gibt auch heute noch immer viele Menschen, die mit den modernen Techniken nicht umgehen wollen oder auch nicht umgehen können und die für ihre Entscheidung die persönliche Beratung in Anspruch nehmen möchten.
Die Sparkassen müssen deshalb mehr denn je Größenordnungen erreichen, die sie finanziell in die Lage versetzen, ihre Filialen auch in einer kleinen Gemeinde aufrecht zu erhalten. Auch in einer Gemeinde wie z.B. in Hanhofen oder in einem Ortsteil wie Heiligenstein sollte es auch in der Zukunft eine Niederlassung einer Sparkasse geben. Dies bedeutet, sie müssen sich „backstage“ - also im Verwaltungsbereich - so stark machen, dass sie sich dieses eng geflochtene Netz von Niederlassungen auf dem Lande leisten können. Wir brauchen auch deshalb eine gewisse Größenordnung, um eine höhere Effizienz darstellen zu können. Allerdings wird es dann sicher zehn bis fünfzehn Jahre dauern, bis diese höhere Effizienz spürbar wird.
SPEYER-KURIER: Was würde eine solche Fusion ganz konkret für die Mitarbeiter der drei Sparkassen-Institute bedeuten?
 Jürgen
Creutzmann: Es wird wegen dieses Zusammenschlusses sicher
kein einziger Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz verlieren – denn
gerade der Berater vor Ort wird immer gebraucht – im Gegenteil: Die
Sparkasse wird durch einen solchen Zusamenschluss sogar zu einem
viel attraktiveren Arbeitgeber, weil es innerhalb eines größeren
Hauses auch viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten gibt.
Jürgen
Creutzmann: Es wird wegen dieses Zusammenschlusses sicher
kein einziger Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz verlieren – denn
gerade der Berater vor Ort wird immer gebraucht – im Gegenteil: Die
Sparkasse wird durch einen solchen Zusamenschluss sogar zu einem
viel attraktiveren Arbeitgeber, weil es innerhalb eines größeren
Hauses auch viel mehr Aufstiegsmöglichkeiten gibt.
Die angestrebte Strukturveränderung wird sich also nur in den natürlichen Personalfluktuationen niederschlagen. Natürlich wird die Fusion Folgen für die Verwaltung der Sparkassen haben: So werden Sie z.B. zukünftig statt drei Leitern des Rechnungswesens nur noch einen brauchen – und anstatt sechs Vorständen vielleicht nur noch vier oder gar nur drei – und das wird für andere Stabsstellen in der Verwaltung auch gelten..
Das geht dann allerdings wiederum sehr gut mit der prognostizierten demographischen Entwicklung zusammen, die uns für die kommenden Jahre eine erhebliche Zunahme des Fachkräftemangel vorhersagt. Auch deshalb müssen wir uns schon heute für die Zukunft wirtschaftlicher aufstellen.
SPEYER-KURIER: Und gilt das auch für das bisherige, umfangreiche Filialnetz der Sparkassen?
Jürgen Creutzmann: Auch hier gilt: Es wird keine der Niederlassung, keine Zweigstelle geschlossen, denn diese Nähe zu den Kunden ist ihr wichtigstes Kapital. Allenfalls könnte dort, wo - wie in Oggersheim - dann zwei Filialen direkt nebeneinander bestehen würden, diese zu einer zusammengeschlossen werden. Aber das sind ganz wenige Ausnahmen.
Für mich ist die angestrebte Fusion deshalb eine echte Investition in die Zukunft und darum bin ich voll und ganz für diesen Zusammenschluss, weil er wirklich nur Vorteile bringt. Einer davon übrigens auch: Er wird die neue Sparkasse in die Lage versetzen, noch mehr junge Menschen als bisher auszubilden – und auch das ist wichtig.
SPEYER-KURIER: Wo würde denn die neue Sparkasse Vorderpfalz bei einem Zusammenschluss im Ranking der Sparkassen im Lande rangieren – und vor allem: Was würde denn mit der Kreis- und Stadtsparkasse Speyer passieren,, wenn die Fusion scheiterte?
 Jürgen
Creutzmann: Also bei einem Zusammenschluss – und ich hoffe
inständig, dass er zustande kommt – würde die größte Sparkasse in
Rheinland-Pfalz entstehen. Sollte das allerdings nicht gelingen,
dann würde das die Speyerer Bank in eine schwierige Situation
bringen. Sicher – es ist in der Vergangenheit schon viel spekuliert
worden: Zusammenschluss der Kreissparkasse Ludwigshafen mit der
Kreissparkasse Bad Dürkheim oder aber Speyer mit Germersheim, aber
das berücksichtigt nicht, dass zu der gegenwärtigen Sparkasse in
Speyer auch Teile des Rhein-Pfalz-Kreises - also die Gemeinden des
alten Landkreises Speyer - gehören. Und ohne deren Zustimmung wäre
eine andere Fusion wohl nicht möglich.
Jürgen
Creutzmann: Also bei einem Zusammenschluss – und ich hoffe
inständig, dass er zustande kommt – würde die größte Sparkasse in
Rheinland-Pfalz entstehen. Sollte das allerdings nicht gelingen,
dann würde das die Speyerer Bank in eine schwierige Situation
bringen. Sicher – es ist in der Vergangenheit schon viel spekuliert
worden: Zusammenschluss der Kreissparkasse Ludwigshafen mit der
Kreissparkasse Bad Dürkheim oder aber Speyer mit Germersheim, aber
das berücksichtigt nicht, dass zu der gegenwärtigen Sparkasse in
Speyer auch Teile des Rhein-Pfalz-Kreises - also die Gemeinden des
alten Landkreises Speyer - gehören. Und ohne deren Zustimmung wäre
eine andere Fusion wohl nicht möglich.
Nein, bei der jetzt angestrebten Lösung passt einfach alles optimal zusammen: Jede der drei Sparkassen hat ihre Stärken in Bereichen, wo die jeweils beiden anderen nicht so stark aufgestellt sind: Die Kreis- und Stadtsparkasse Speyer ist traditionell besonders stark im Wertpapiergeschäft - die Kreissparkasse des Rheinpfalz-Kreises dagegen hatte nie so viele Berater, weil sie sehr viele Ausleihungen an nicht so beratungsintensive Kunden vorgenommen hat und schließlich verfügt die gegenwärtige Sparkasse Vorderpfalz in Ludwigshafen über eine sehr stark ausgeprägte Kundenberatung.
Damit würde die Fusion also für alle drei Institute eine echte Win-win-Situation darstellen, in der drei unterschiedliche Strukturen passgenau zu einer einzigen verschmolzen werden könnten.
Und noch eine weitere, bedeutsame Konsequenz. Mit einer solchen Fusion könnte sich die neue, größere Sparkasse Vorderpfalz auch völlig neue Geschäftsfelder erschließen – z.B. die bessere Beratung vermögender Kunden oder die Möglichkeit, dem Mittelstand höhere Kredite gewähren zu können, weil sie diese dann durch ihr größeres Eigenkapital unterlegen könnte. Derzeit sind die Mittelständler hier ja noch auf die Landesbanken angewiesen, die bisher diese Geschäfte für die Sparkassen erledigt haben. Kurz: Die neue Sparkasse wäre dann so groß, dass sie noch erfolgreicher in der Region agieren kann - dass sie sich aber auch noch günstiger als bisher refinanzieren kann und nicht mehr auf die Landesbanken angewiesen wäre, die sich ohendies in der Auflösung befinden.
Es spricht also alles für die Fusion und ich kann nur hoffen, dass sie auch zustande kommt.
SPEYER-KURIER. Vermutlich würde es aber auch in dieser Dreier-Verbindung Grössere und Kleinere geben – Mächtigere und weniger Mächtige - und Speyer wäre sicher der kleinste Partner. Droht da nicht die Gefahr, dass Speyer von dem größeren Partner Ludwigshafen „an die Wand gedrückt“ werden könnte?
 Jürgen
Ceutzmann: Nein – und das ist ja auch der eigentliche
Charme der angestrebten Lösung. Ich darf Ihnen sagen, da hat man
wirklich überaus fair und für den kleineren Partner höchst
entgegenkommend verhandelt. Denn die Anteile der neuen Eigentümer
würden so aufgeteilt, dass keiner den anderen dominieren kann. Alle
Institute würden auch in dem neuen Vorstand mit ihren bisherigen
Vorständen vertreten sein und man würde auch in der Zukunft ein
absolut ausgewogenes Verhältnis zwischen der bisherigen Sparkassen
erhalten.
Jürgen
Ceutzmann: Nein – und das ist ja auch der eigentliche
Charme der angestrebten Lösung. Ich darf Ihnen sagen, da hat man
wirklich überaus fair und für den kleineren Partner höchst
entgegenkommend verhandelt. Denn die Anteile der neuen Eigentümer
würden so aufgeteilt, dass keiner den anderen dominieren kann. Alle
Institute würden auch in dem neuen Vorstand mit ihren bisherigen
Vorständen vertreten sein und man würde auch in der Zukunft ein
absolut ausgewogenes Verhältnis zwischen der bisherigen Sparkassen
erhalten.
Entsprechend des ermittelten gegenwärtigen von Unternehmenswertes von 53% für die Sparkasse Vorderpfalz „alt“ in Ludwigshafen, 21% für die Kreissparkasse Rhein-Pfalz und 26% für die Kreis- und Stadtsparkasse Speyer – wobei hier zu berücksichtigen ist, dass von dem Speyerer Anteil 8,7% auf den Kreis entfallen - wurde für die Trägerversammlung eine Mandatsverteilung von 47% für die Stadt Ludwigshafen, 29,8% für den Rhein-Pfalz-Kreis, 17.4% für die Stadt Speyer und 5,4% für die Stadt Schifferstadt empfohlen - ein überaus faires und ausgewogenes Verhältnis.
Dabei hat man übrigens auch darauf geachtet, dass diese Ausgewogeneheit auch in der Zukunft sichergestellt bleibt: So wird z.B. die „Sparkassen-Stiftung Speyer“ unverändert weiter bestehen und weiterhin bedient werden. Das heißt, man hat ein wirkliches „Fair-Play“ in den Verhandlungen gefunden und – der Speyerer Oberbürgermeister Eger hat hier wirklich sehr gut verhandelt – und deshalb wiederhole ich das ganz ausdrücklich - das ist der eigentliche Charme dieser Vereinbarung.
Ich hätte mir nie vorstellen können, dass es gelingt, auch die Interessen der Stadt Speyer in diesem großen Umfang zu gewährleisten – aber auch das ist, wie wir jetzt wissen, gelungen, und deshalb hoffe ich eindringlich, dass Speyer nicht im letzten Moment noch von dieser Vereinbarung „abspringt“.und dass der Stadtrat dieser im Vorfeld gefundenen Vereinbarung zustimmt.
SPEYER-KURIER: Herr Creutzmann, wie können denn bei einem solchen Zusammenschluss die Partikularinteressen der Umlandgemeinden innerhalb der bisherigen Kreis- und Stadtsparkasse „aussortiert“ werden, damit der Einfluss des Kreises auf die Interessen der Stadt nicht quasi „durch die Hintertür“ vergrößert wird?
 Jürgen
Creutzmann: Da kann ich Sie und natürlich auch die
Speyerer wirklich beruhigen: Der Rhein-Pfalz-Kreis war ja bislang
schon nur in der Versammlung des Zweckverbandes und im
Verwaltungsrat vertreten. Das operative Geschäft ist aber schon
immer allein in Speyer gemacht worden und das wird auch zukünftig
so bleiben.
Jürgen
Creutzmann: Da kann ich Sie und natürlich auch die
Speyerer wirklich beruhigen: Der Rhein-Pfalz-Kreis war ja bislang
schon nur in der Versammlung des Zweckverbandes und im
Verwaltungsrat vertreten. Das operative Geschäft ist aber schon
immer allein in Speyer gemacht worden und das wird auch zukünftig
so bleiben.
Ich möchte aber noch auf einen anderen Aspekt hinweisen: Die Kreis- und Stadtsparkasse Speyer steht ja vor Ort insbesondere im Wettbewerb mit der Volksbank, die durch Fusionen ihr Geschäftsgebiet längst deutlich ausgeweitet hat und dabei sogar über den Rhein gegangen ist. Mit dieser Volksbank also steht die Sparkasse in Konkurrenz, und wenn sie deren Konditionen nicht mitgehen kann, dann wird sie immer öfter den Kürzeren ziehen und im Zweifel sogar Kunden verlieren. Das heißt, die neue Sparkasse Vorderpfalz wird endlich ein wirklich wettberwerbsfähiges Sparkassen-Institut im Konzert der regionalen Banken sein – also eine richtig gute Situation, wie ich sie mir vor Jahren so noch nicht hätte vorstellen können.
Stellen Sie sich vor, man hätte die Kreis- und Stadtsparkasse Speyer mit der Kreissparkasse des Rhein-Pfalz-Kreises zusammengeschlossen, was ja auch einmal eine Option war - das hätte sicher zu einer Dominanz des Kreises geführt. Das vermeidet die jetzt vorgesehene Lösung aber voll und ganz.
SPEYER-KURIER: Das heißt also in der Komsequenz, dass hier drei mal eins nicht nur drei, sondern deutlich mehr – einen wirklichen Mehrwert gegenüber der gegenwärtigen Situation – mit sich bringt?
Jürgen Creutzmann: Ja, eindeutig ja – das zeigen ja auch die eingehenden Untersuchungen, die dem jetzt vorliegenden Ergebnis vorausgegangen sind. Überhaupt muss ich sagen, dass die jetzt zur Verabschiedung anstehende Fusion überaus gründlich vorbereitet worden ist. Man hat viel in den unterschiedlichen Gremien diskutiert und hat Gutachten von außen eingeholt - Gutachten, die gezeigt haben, dass man mit dem Zusammenschluss neue Kunden gewinnen kann, die man bisher so nicht erreichen konnte. Das Institut wird dadurch seinen Kunden auch eine höheren Kompetenz bieten können und mittelfristig nicht allein durch die Kostensenkungen wettbewerbsfähiger und dadurch ein starker Partner in der Metropolregion sein können. Wir wollen ja für die Zukunft ein starkes gemeinsames Haus bauen, das noch wettbewerbsfähiger sein wird.
Die ganze Fusion allerdings allein auf die höheren Verdienstmöglichkeiten für die Vorstände zu reduzieren, wie ich es dieser Tage in einer Zeitung gelesen habe, das ist absolut abwegig und völliger Unsinn. Denn auch dort wird es mittelfristig eher zu Einspareffekten denn zu Mehrausgaben kommen.
SPEYER-KURIER: Was könnte bei so vielen positiven Auspizien die Fusion noch verhindern? Vielleicht die Sorge einzelner Gremeinmitglieder, künftig nicht mehr in der Versammlung des Zweckverbandes oder im Verwaltungsrat vertreten zu sein?
 Jürgen
Creutzmann: Das hoffe ich nicht! Natürlich werden bei
einer Zusammenlegung der Sparkassen und damit einer deutlichen
Ausdünnung ihrer Gremien insbesondere die kleineren Parteien und
Gruppen ihre Mandate verlieren. Davon würde übrigens auch ich
selbst als Vertreter einer kleinen Partei betroffen sein Aber ich
denke, es darf doch kein Grund sein, eine vernünftige Regelung für
die Zukunft der Sparkassen daran scheitern zu lassen, dass man
dadurch eine ehrenamtliche Position verliert.
Jürgen
Creutzmann: Das hoffe ich nicht! Natürlich werden bei
einer Zusammenlegung der Sparkassen und damit einer deutlichen
Ausdünnung ihrer Gremien insbesondere die kleineren Parteien und
Gruppen ihre Mandate verlieren. Davon würde übrigens auch ich
selbst als Vertreter einer kleinen Partei betroffen sein Aber ich
denke, es darf doch kein Grund sein, eine vernünftige Regelung für
die Zukunft der Sparkassen daran scheitern zu lassen, dass man
dadurch eine ehrenamtliche Position verliert.
Aber natürlich weiß ich, dass Politik manchmal so funktioniert – dass der eine oder andere – ich will hier wirklich niemandem etwas unterstellen - mehr an sich selbst denkt als an das Wohl der Sache. So schön es ist, im Verwaltungsrat einer Bank gegenüber dem Vorstand auf die Poltik des Instituts einwirken zu können - so interessant und spannend eine solche Aufgabe auch sein mag, so wenig kann und darf es doch sein, dass man aus rein egoistischen Gründen eine solche Fusion verhindert.
SPEYER-KURIER: Wie soll denn überhaupt die Sitzverteilung in der Zweckverbands-Versammlung der neuen Sparkasse Vorderpfalz aussehen?
Jürgen Creutzmann: Hier soll die Stadt Ludwigshafen das Vorschlagsrecht für sieben Mitglieder, die Stadt Speyer für zwei und der Rhein-Pfalz-Kreis für fünf Mitglieder haben. Hinzu kommen noch vier „geborene“ Mitglieder – die Oberbürgermeister von Ludwigshafen und Speyer, der Landrat des Rhein-Pfalz-Kreises und im übrigen auch die Bürgermeisterin von Schifferstadt, weil Schifferstadt ja auch noch zum Zweckverband gehört. Für Speyer würde das wohl bedeuten, dass neben dem Oberbürgermeister noch je ein Vertreter der beiden großen Parteien CDU und SPD in dieses Gremum einziehen würden.
Als geborener Speyerer habe ich stets ganz besonderen Wert darauf gelegt, dass gerade auch die Interessen von Speyer in den zukünftigen Gremien gewahrt werden. Es soll deshalb darüber einen gesonderten Vertrag geben, in dem das alles geregelt wird. Daneben soll auch noch ein Beirat aus weiteren 14 Mitgliedern eingerichtet werden, in den dann durch entsprechende parteiübergreifende Vereinbarungen auch noch einmal Persönlichkeiten berufen werden können, die bei der Zweckverbandsversammlung nicht zum Zuge kamen. Dieser Beirat wird zwar keine Entscheidungs-, wohl aber eine Beratungsfunktion haben und in alle wichtigen Entwicklungen mit einbezogen werden.
SPEYER-KURIER: Lieber Herr Creutzmann, dann kann man eigentlich nur hoffen, dass der berühmt-berüchtigte Engel Aloysius, der einst die „göttlichen Eingebungen“ an die bayerische Regierung überbrachte, die damals ja auch noch für die Pfalz zuständig war - dass dieser Engel jetzt auch über die Entscheidungsgremien für die Sparkassenfusion in der Vorderpfalz kommen möge, auf dass sie eine der Sache und der Region dienliche Entscheidung treffen mögen.
Herr Creutzmann, namens der Leserinnen und Leser des SPEYER-KURIER bedanken wir uns für dieses ausführliche und informative Gespräch.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler/ Fotos: gc
19.05.2013
Interview der Woche
 Neugier auf
Neues und auf das Besondere wecken – 61. Schwetzinger Festpiele mit
neuen Programm-Akzenten werden heute eröffnet
Neugier auf
Neues und auf das Besondere wecken – 61. Schwetzinger Festpiele mit
neuen Programm-Akzenten werden heute eröffnet
Dazu heute im „Interview der Woche“:
Dr. Marlene Weber-Schäfer (61) Künstlerische Leiterin des Konzertprogrammes der Schwetzinger SWR Festspiele.
 An diesem
Freitag beginnen mit Henry-Purcells Oper „The Indian
Queen“ die 61. Schwetzinger SWR
Festspiele. Sechs Wochen lang werden sich jetzt wieder
hochrangige internationale Künstler im Schloss und in der Region
ein Stelldichein geben – bedeutende Musikereignisse werden dank des
Mediums Hörfunk von hier aus in die ganze Welt gehen.
An diesem
Freitag beginnen mit Henry-Purcells Oper „The Indian
Queen“ die 61. Schwetzinger SWR
Festspiele. Sechs Wochen lang werden sich jetzt wieder
hochrangige internationale Künstler im Schloss und in der Region
ein Stelldichein geben – bedeutende Musikereignisse werden dank des
Mediums Hörfunk von hier aus in die ganze Welt gehen.
Viel Bewährtes wird – wohl wie immer in allerhöchster Qualität - auf dem Konzertpodium, auf der Opernbühne und in den Kirchen im benachbarten Speyer zur Aufführung kommen, aber auch manch neuer Akzent wird auf die Besucher warten.
Neu ist in diesem Jahr aber auch die Leiterin des Konzertprogramms der Festspiele, Dr. Marlene Weber-Schäfer. Die Musikwissenschaftlerin, die seit vielen Jahren als Musikredakteurin für den SWR und seinen Vorgänger, den Süddeutschen Rundfunk, tätig war und dabei auch immer wieder in unterschiedlichen Funktionen für das Schwetzinger Festival Verantwortung trug, trat damit die Nachfolge von Peter Stieber an, der mit Ende der letzten Spielzeit der Festspiele in den Ruhestand trat.
Mit Dr.Marlene Weber-Schäfer hat der SPEYER-KURIER im Vorfeld der Festspiele ein Gespräch geführt, in dem sie ihre Vorstellungen von der Weiterentwicklung dieses hochrangigen Festivals erläuterte.
26.04.2013
 SPEYER-KURIER:
Frau Dr. Weber-Schäfer, was bedeutet es denn für eine erfahrende
Musikredakteurin, wenn ihr angetragen wird, die künstlerische
Leitung der Schwetzinger SWR Festspiele zu übernehmen, die
inzwischen zum bedeutenden klassischen Musikfestival der Welt
aufgestiegen sind?
SPEYER-KURIER:
Frau Dr. Weber-Schäfer, was bedeutet es denn für eine erfahrende
Musikredakteurin, wenn ihr angetragen wird, die künstlerische
Leitung der Schwetzinger SWR Festspiele zu übernehmen, die
inzwischen zum bedeutenden klassischen Musikfestival der Welt
aufgestiegen sind?
Dr. Weber-Schäfer: Das ist natürlich der Höhepunkt meiner Laufbahn und ich freue mich sehr, dass mir diese Aufgabe übertragen wurde. Ich bin ja schon seit vielen Jahren mit den Schwetzinger Festspielen eng verbunden und war schon zu Beginn meiner Redakteurstätigkeit beim Süddeutschen Rundfunk für alle Sendungen von den Festspielen verantwortlich. Ich war schon damals Abend für Abend in Schwetzingen, habe mir die Konzerte angehört und Sendungen daraus „gebastelt“. Dadurch ist eine ganz große und starke Identifikation entstanden mit diesen Festspielen.
SPEYER-KURIER: Sie haben ja neben Ihrer Redakteurstätigkeit auch andere Funktionen im Rahmen der Festspiele ausgefüllt...
Dr. Weber-Schäfer: Ja, angefangen habe ich, wie bereits gesagt, als Redakteurin beim damaligen Studio Heidelberg des Süddeutschen Rundfunks, das ja jetzt nach Mannheim abgewandert ist. Damals, in den achtziger Jahren, ist auch meine enge Verbundenheit mit den Schwetzinger Festspielen entstanden. In den neunziger Jahren bin ich dann nach Stuttgart versetzt worden und war in dieser Zeit dort auch einmal drei Jahre lang Geschäftsführerin der Festspiele und damit für den gesamten organisatorischen Ablauf zuständig. Dann habe ich in Stuttgart die Kammermusik-Redaktion übertragen bekommen und war auch dort für Konzertreihen, z.B. in Bruchsl und Ettlingen zuständig – kurz: Das Konzertmanagement gehörte eigentlich immer zu meinen Tätigkeitsbereichen.
SPEYER-KURIER: Alte Musik, zeitgenössische Musik, dazu viele arrivierte, aber auch viele junge Künstler an der Schwelle zu einer großen Karriere – das waren eigentlich immer die Eckpunkte dieses Festivals. Wird das auch unter Ihrer Ägide so weitergehen?
 Dr.
Weber-Schäfer: Das wird so bleiben, wobei diese Trias, die
Sie eben erwähnen, ja schon seit der Gründung der Schwetzinger
Festspiele auch ohne die Beteiligung des Süddeutschen Rundfunks
ihre Gültigkeit hatte. Man hat damals schon die Grundstruktur
geschaffen mit Alter Oper, Neuer Oper – also Auftragswerken – und
Kammerkonzerten verschiedenster Art. Die „Jungen Musiker“ kamen
dann im Laufe der Zeit dazu . Das ist eine Dramaturgie, die sich in
Schwetzingen sehr bewährt hat und die ich auch ganz wichtig finde,
denn bei der Alten Musik ist es ja so, dass wir da auch wirklich
„ausgraben“, was dann in Schwetzingen überhaupt zum allerersten Mal
oder seit langem erstmals wieder zu hören ist.
Dr.
Weber-Schäfer: Das wird so bleiben, wobei diese Trias, die
Sie eben erwähnen, ja schon seit der Gründung der Schwetzinger
Festspiele auch ohne die Beteiligung des Süddeutschen Rundfunks
ihre Gültigkeit hatte. Man hat damals schon die Grundstruktur
geschaffen mit Alter Oper, Neuer Oper – also Auftragswerken – und
Kammerkonzerten verschiedenster Art. Die „Jungen Musiker“ kamen
dann im Laufe der Zeit dazu . Das ist eine Dramaturgie, die sich in
Schwetzingen sehr bewährt hat und die ich auch ganz wichtig finde,
denn bei der Alten Musik ist es ja so, dass wir da auch wirklich
„ausgraben“, was dann in Schwetzingen überhaupt zum allerersten Mal
oder seit langem erstmals wieder zu hören ist.
Bei der Neuen Musik ist das Innovative eigentlich immanent - das ist klar – etwas Neues ist immer neu. Wir haben in diesem Jahr das Georg Friedrich Haas-Projekt, ein Komponist, der gerade jetzt ganz große Karriere macht und von dem hier in Schwetzingen Werke gespielt werden, die zuvor noch nie erklungen sind. Neben einer Opern-Uraufführung stellt Haas auch sein neues Kammermusikwerk vor, das er für diesen Anlass, dieses „Composer in residence“-Projekt, geschaffen hat. Junge Musiker zu fördern ist etwas, was wir vom Rundfunk, vom SWR, übernommen haben, denn es ist eine ganz wichtige Aufgabe des Rundfunks, Talente zu fördern. Und wo könnte man das besser machen als in einem solchen hauseigenen Festival.
Ich weiß nicht, ob Ihren Lesern schon bekannt ist, dass wir in SWR 2 mit den „SWR 2 New Talents“ eine neue Initiative gestartet haben, mit der wir in jedem Jahr zwei neue Talente suchen, die wir dann mit allen Möglichkeiten, die der Rundfunk hat, ganz intensiv fördern. Und dazu gehören natürlich auch die Möglichkeiten, die sich mit einem so großen Festival ergeben. Diese beiden „New Talents“ werden Sie deshalb in den sonntäglichen Matinee-Reihen finden: Das sind in diesem Jahr die Sopranistin Hannah Elisabeth Müller, die aus Mannheim kommt und damit ein Kind dieser Region ist, und der Pianist Alexeij Gorlatch. Also solche außergewöhnlichen Talente wollen mit dieser Maßnahme zur Förderung junger Musiker, die wir sehr ernst nehmen, ganz gezielt fördern.
Dazu gehört aber auch unser „Tag der ARD-Preisträger“ - auch das ist etwas neues, was ich etablieren möchte und wo wir die ARD-Preisträger quasi „gebündelt“ nach Schwetzingen einladen. Der ARD-Wettbewerb ist ja ein Wettbewerb der Rundfunkanstalten Deutschlands. Was also liegt da näher, als zu sagen: Die sollen nach Schwetzingen kommen und hier ihr Können zeigen. Am Pfingstmontag werden sie das mit drei Konzerten tun, wo sie in unterschiedlicher Zusammensetzung wunderbare, spannende Kammerkonzert-Programme bieten.
SPEYER-KURIER: Eine Möglichkeit, solche Talente zu finden, war ja bisher auch der Workshop „Junge Musiker“, zu dem sich Studierende aus vielen Ländern trafen, um dann am Ende einer Arbeitswoche die künstlerischen Ergebnisse dieser Arbeit zu präsentieren. Wird dieses Projekt auch weiterhin fortgesetzt?
 Dr.
Weber-Schäfer: Dieses Projekt wird nicht fortgesetzt,
sondern modifiziert durch ein doch ziemlich anderes Projekt, das
auch etwas mit der Förderung junger Musiker zutun hat. Hintergrund
dieser Entscheidung war zum einen die Tatsache, dass die
„Begegnungen junger Musiker“ die Länder Europas inzwischen so
ziemlich alle „abgeklappert hatten, zum anderen wollte ich eines
meiner Herzensanliegen für meine Programmgestaltung realisieren,
die Musik, die in Schwetzingen und in der „Mannheimer Schule“
entstanden ist, wieder hierher nach Schwetzingen zurückzuholen. Es
ist mir dabei ganz, ganz wichtig, festzustellen: Wir stärken damit
den 'genius loci“ und sagen: Hier ist diese Musik entstanden und
hier muss sie auch weiter erklingen.
Dr.
Weber-Schäfer: Dieses Projekt wird nicht fortgesetzt,
sondern modifiziert durch ein doch ziemlich anderes Projekt, das
auch etwas mit der Förderung junger Musiker zutun hat. Hintergrund
dieser Entscheidung war zum einen die Tatsache, dass die
„Begegnungen junger Musiker“ die Länder Europas inzwischen so
ziemlich alle „abgeklappert hatten, zum anderen wollte ich eines
meiner Herzensanliegen für meine Programmgestaltung realisieren,
die Musik, die in Schwetzingen und in der „Mannheimer Schule“
entstanden ist, wieder hierher nach Schwetzingen zurückzuholen. Es
ist mir dabei ganz, ganz wichtig, festzustellen: Wir stärken damit
den 'genius loci“ und sagen: Hier ist diese Musik entstanden und
hier muss sie auch weiter erklingen.
Wir haben uns deshalb mit der „Forschungsstelle Hofmusik“ der Heidelberger Akademie der Wissenschaften zusammengetan und eine „Akademie für Hofmusik“ ins Leben gerufen. Dazu haben wir junge Musiker von ganz vielen Hochschulen angeschrieben, die kommen sollen, um eine Woche lang ein vorgegebenes Programm mit Werken der Mannheimer Schule zu studieren, begleitet von hochberühmten Dozenten, die Kapazitäten bei der Interpretation dieser Musik sind – die eine Woche lang zusammenarbeiten und das Ergebnis dieser Arbeit am Ende dieser Woche in einem großen Konzert im Rokoko-Theater darbieten. Dieses Konzert – und das steht bislang in unseren Veröffentlichungen noch nicht drin – wird von einem sehr bekannten Moderator, Michael Kraft, geleitet und präsentiert. Dieses Konzert war übrigens im Nu ausverkauft, was zeigt, wie groß der Bedarf der Menschen ist, diese Musik wieder in Schwetzingen zu hören.
SPEYER-KURIER: Frau Dr. Weber-Schäfer – am Anfang Ihrer Verantwortlichkeit für dieses Festival an Sie die Frage: Was ist das denn für ein Publikum, das es hierher nach Schwetzingen zieht? Was zeichnet dieses Publikum aus?
Dr, Weber-Schäfer: Das ist schwer zu sagen. Ich denke, das Publikum weiß, dass es Neugier mitbringen muss, wenn es nach Schwetzingen kommt, denn es wird hier mit Musik konfrontiert, die sie zuvor noch nicht gehört haben. Natürlich gibt es hier auch die berühmten Ensembles, die die Beethoven-Streichquartette spielen, aber ich glaube, das Publikum, das nach Schwetzingen kommt, weiß, hier gibt es Besonderes zu hören.
Fangen wir mal mit den Opern an: Dieses Jahr haben wir die „Indian Queen“ , die wird kaum einmal aufgeführt. Ein in der Musikgeschichte zwar recht bekanntes Werk, typisch englischer Stil, aber hierzulande wird so etwas kaum gemacht. Dann haben wir eine Opern-Uraufführung von Georg Friedrich Haas – das ist auch etwas komplett neues.
Dann gibt es ein Projekt, auf das ich auch ganz persönlich sehr gespannt bin: Die Aufführung sämtlicher Klavier-Sonaten von Joseph Haydn – 55 Sonaten, die wir kennen - in neun Konzerten an zwei Wochenenden, in denen wirklich nur Haydn gespielt wird. Da muss man schon offene Ohren und ein offenes Herz mitbringen, um das wirklich genießen zu können. Aber da wird offenbar, welch spannende Musik Haydn geschrieben hat....
SPEYER-KURIER: ...und wie er sich im Laufe seines Lebens entwickelt und verändert hat...
Dr. Weber-Schäfer: …und welch facettenreicher Komponist Haydn war, der doch bis heute so sehr unterschätzt wird..
SPEYER-KURIER: Sie haben sich für die kommenden vier Jahre Ihrer Amtszeit - quasi als Oberthema - „Europa“ ausgesucht, Wie wird sich das in Ihren Programmen niederschlagen?
 Dr.
Weber-Schäfer: Ich möchte damit zunächst einmal Europa als
ein ganz wichtiges Projekt unseres Jahrhunderts ins Bewußtsein
rufen und ich möchte damit sagen: Europa ist nicht nur ein
wirtschaftliches Projekt, sondern vor allem ein ideelles Projekt.
Und es ist auch ein kulturelles Projekt, mit dem man sich
identifizieren kann, auch wenn man nicht die ganzen Finanzströme
verfolgt, um die es heute in den Medien leider Gottes ja fast
ausschließlich geht. Nein, es geht dabei auch um das
Zusammenwachsen Europas auf kulturellem Gebiet. Das aber kann man
nur, wenn man sich gegenseitig kennt und auch die Kulturen der
anderen europäischen Völker kennt.
Dr.
Weber-Schäfer: Ich möchte damit zunächst einmal Europa als
ein ganz wichtiges Projekt unseres Jahrhunderts ins Bewußtsein
rufen und ich möchte damit sagen: Europa ist nicht nur ein
wirtschaftliches Projekt, sondern vor allem ein ideelles Projekt.
Und es ist auch ein kulturelles Projekt, mit dem man sich
identifizieren kann, auch wenn man nicht die ganzen Finanzströme
verfolgt, um die es heute in den Medien leider Gottes ja fast
ausschließlich geht. Nein, es geht dabei auch um das
Zusammenwachsen Europas auf kulturellem Gebiet. Das aber kann man
nur, wenn man sich gegenseitig kennt und auch die Kulturen der
anderen europäischen Völker kennt.
Es geht dabei nicht darum, alles zu vermischen, sondern vielmehr darzustellen: So hat Europa im 17. Jahrhundert z.B in Polen geklungen. Das drückt sich in unserem Programm z.B. in dem Speyerer Konzert mit der „Capella Crakoviensis“ aus – oder: so hat Europa im 19, Jahrhundert in Tschechien geklungen. Und so gehen wir durch die verschiedenen Länder, setzen Spotlights auf die Musikkultur dieser Länder und stellen auch Querbezüge zur Philosophie und den Geistesströmungen dieser Länder her. Das finde ich ganz spannend und ganz wichtig und ich hoffe, dass das rüber kommt in unseren Programmen.
SPEYER-KURIER: In Schwetzingen spielt ja auch die zeitgenössische Musik immer wieder eine große Rolle Nun hat der SWR mit den „Donaueschinger Musiktagen“ ja noch ein weiteres bedeutendes - vielleicht sogar das bedeutendste Festival für zeitgenössische Musik überhaupt - in seinem Portfolio. Kommen Sie sich da nicht gegenseitig ins Gehege?
Dr. Weber-Schäfer: Nein, ganz und gar nicht. Zum einen stehe ich mit dem Kollegen, der die „Donaueschinger Musiktage“ leitet, mit Armin Köhler, im ständigen Gespräch, zum anderen verfolgen wir hier auch einen anderen Ansatz: Was ich mir für den Schwerpunkt „Neue Musik“ gedacht habe: ich möchte den jeweiligen Komponisten der Opern-Uraufführung in einer größeren Bandbreite – in einem größeren musikalischen Zusammenhang darstellen. Das war im vergangen Jahr die Oper von Enno Poppe, in diesem Jahr eine von Georg Friedrich Haas. Und für diesen Georg Friedrich Haas wird es einen ganzen Tag geben mit Kammermusik und Vokalwerken verschiedenster Art und etwas ganz Spektakuläres wird dabei sein Streichquartett sein, das nur im ganz, ganz Dunkeln stattfinden darf. Komplette Dunkelheit ist die Voraussetzung für die Aufführung dieses Werkes. Und das wird im Rokoko-Theater gemacht. Und es wird an einem anderen Tag noch ein ganz spektakuläres Orchesterkonzert geben, bei dem Georg Friedrich Haas auch persönlich anwesend sein und sprechen wird.
Ich hoffe, dass es auch in den nächsten Jahren so weiter gehen kann und dass die Komponisten auch dazu bereit sein, diese Arbeit zu investieren und dass wir in der Lage sind, das auch zu finanzieren, denn Neue Musik ist immer eine sehr teure Sache.
SPEYER-KURIER: Das Rokoko-Theater ist ja ein ganz besonders bezaubernder Spielort für Oper und gerade die Barockoper drängt sich hier ja geradezu auf. Wie wird sich dieses Genre in Schwetzingen weiterentwickeln?
 Dr.
Weber-Schäfer: Die von mir schon beschriebene
Polarisierung soll bleiben. Hier eine „Ausgrabung“ - das kann
Barock sein oder bis in die frühe Klassik gehen - und hier die
Moderne - die Uraufführung einer Neukomposition. So planen wir bei
den Ausgrabungen die Aufführung einer Oper von Johann
Adolph Hasse – ein ganz spannendes Projekt – mehr will ich
aber noch nicht verraten....
Dr.
Weber-Schäfer: Die von mir schon beschriebene
Polarisierung soll bleiben. Hier eine „Ausgrabung“ - das kann
Barock sein oder bis in die frühe Klassik gehen - und hier die
Moderne - die Uraufführung einer Neukomposition. So planen wir bei
den Ausgrabungen die Aufführung einer Oper von Johann
Adolph Hasse – ein ganz spannendes Projekt – mehr will ich
aber noch nicht verraten....
SPEYER-KURIER: Unter Ihrem Vorgänger Peter Stieber haben die Schwetzinger Festspiele dann ja auch über den Rhein ausgegriffen und in den großen Kirchen in Speyer - im Dom, der Gedächtniskirche und der Dreifaltigkeitskirche - Fuß gefasst. Werden wir – vielleicht auch im Sinne des auch von uns favorisierten „einheitlichen kurpfälzischen Kulturraumes“ in der Zukunft vielleicht noch mehr Aufführungen an weiteren Spielorten in der Pfalz erleben?
Dr. Weber-Schäfer: Ja, wir haben darüber schon einmal nachgedacht und ich habe mich darüber mit dem neuen Leiter der Festspiele, Gerold Hug, auch schon einmal ausgetauscht - ich denke aber, wir sollten derzeit bei der bisherigen Zweiteilung bleiben, zumal es auch in der Pfalz nur wenige Räumlichkeiten gibt, die eine solche Ausstrahlung haben wie Speyer mit der wunderbaren Barockkirche, der Dreigfaltigkeitskirche, mit der monumentalen Gedächtniskirche und natürlich vor allem mit dem einzigartigen Dom. Da ist es schwierig, Gleichwertiges zu finden. Und die Schwetzinger Festspiele wollen sich auch nicht verzetteln, indem sie sich über mehrere Örtlichkeiten verbreiten.Ich finde: Schwetzingen auf der einen Seite des Rheins - Speyer auf der anderen Seite - das ist eine wunderbare Sache – da baut man sozusagen eine Brücke über den Rhein in ein anderes Bundesland, das ja auch zum Sendegebiet des SWR gehört – deshalb ist die . gegenwärtige Aufteilung meines Erachtens optimal.
SPEYER-KURIER: Frau Dr. Weber-Schäfer, Sie stellen auch in diesem Jahr wieder ein Programm für Ihre 'Festspiel-Gäste von morgen', für die Kinder, vor. Das ist jedoch sicher kein ganz neuer Ansatz mehr: Festspiele für Kinder sprießen überall aus dem „Festivalboden“ - „Zauberflöte für Kinder“, „Weihnachtsoratorium für Kinder“, „Schöpfung für Kinder“ sind nur Beispiele für viele. Wollen Sie in Schwetzingen Vergleichbares realisieren oder wie sehen da Ihre Pläne aus?
Dr. Weber-Schäfer: Wir zeigen hier neue Stücke, die speziell für Kinder geschrieben wurden. In diesem Jahr wird das RSO Stuttgart die Geschichte von einer verlorenen Melodie aufführen , die nach langen Irrwegen durch verschiedene Instrumente und durch das ganze Orchester letztendlich wieder nach Hause kommt. Das ist eine sehr hübsche, sehr charmante Geschichte. Ich jedenfalls finde solche eigens für Kinder geschriebene Stücke geeigneter als z.B. „die Zauberflöte für Kinder“ oder, wie Sie sgaten, „Weihnachtsoratorium für Kinder“. Da habe ich immer so meine Bedenken.
SPEYER-KURIER: Schwetzingen hat ja traditionell auch immer wieder junge Künstler an der Schwelle zur Weltkarriere zu Gast – letztes Jahr z.B die bulgarische Soparnistin Vesselina Kasarova – dürfen wir uns auf solch wunderbare Stimmen auch weiterhin freuen?
 Dr.
Weber-Schäfer: Oh Ja! Da kann ich Ihnen schon für diese
Spielzeit eine weitere Bulgarin ankündigen – die wunderbare
Kasimira Stojanova. Kasimira Stojanova – ist – ich habe
das einmal an anderer Stelle gesagt – für mich so etwas wie „ein
heimlicher Star“. Sie wird im Rahmen ihres Konzertes bei den
Schwetzinger Festspielen den „Preis der deutschen
Schallplattenkirtik“ erhalten und ist eine der wirklich
ganz großen Sänerginnen unserer Zeit, die aber nicht zum
glamourösen Star geworden ist, weil sie sich dem ganzen
Medienbetrieb verweigert. Sie möchte einfach singen und zeigen, was
sie kann. Sie will nicht auf den Covern der Glanzbroschüren
erscheinen – das ist nicht ihre Welt. Aber sie ist eine großartige,
sympathische Sängerin und ich empfehle jedem, sich dieses Konzert
anzuhören.
Dr.
Weber-Schäfer: Oh Ja! Da kann ich Ihnen schon für diese
Spielzeit eine weitere Bulgarin ankündigen – die wunderbare
Kasimira Stojanova. Kasimira Stojanova – ist – ich habe
das einmal an anderer Stelle gesagt – für mich so etwas wie „ein
heimlicher Star“. Sie wird im Rahmen ihres Konzertes bei den
Schwetzinger Festspielen den „Preis der deutschen
Schallplattenkirtik“ erhalten und ist eine der wirklich
ganz großen Sänerginnen unserer Zeit, die aber nicht zum
glamourösen Star geworden ist, weil sie sich dem ganzen
Medienbetrieb verweigert. Sie möchte einfach singen und zeigen, was
sie kann. Sie will nicht auf den Covern der Glanzbroschüren
erscheinen – das ist nicht ihre Welt. Aber sie ist eine großartige,
sympathische Sängerin und ich empfehle jedem, sich dieses Konzert
anzuhören.
Dann haben wir Michael Nagy, den großartigen Bariton oder die vorhin schon erwähnte wunderbare Hanna Elisabeth Müller, die junge Mannheimer Sopranistin, die an der Schwelle zu einer Weltkarriere steht. Dann Christiane Karg, die mit einem Liederabend zu Gast sein wird, den sie exklusiv für uns zusammengestellt hat. Also diese Namen werden Sie unter den Liedsängern in diesem Jahr finden.
SPEYER-KURIER: Vielleicht noch einmal abschließend gefragt: Wie stellen Sie sich das Profil der Schwetzinger SWR Festspiele für die nächsten Jahre vor?
 Dr.
Weber-Schäfer: Also da wird es den erwähnten
Europa-Schwerpunkt weiter geben: Quer durch die Windrose – in
diesem Jahr Osten, dann Süden, Westen und Norden – das ist das
Projekt für die nächsten vier Jahre - dann wird es Einzelprojekte
geben wie jetzt die Haydn-Sonaten – vielleicht orientiert an
speziellen Musik-Gattungen - dann wird es aber auch weiterhin die
ganz großen Interpreten geben – wie in diesem Jahr das
„Artemis-Quartett“, Frank Peter Zimmermann, Isabele
Faust und Sabine Meyer – also trotz der
vielen 'Spezialprojekte' werden wieder eine ganze Menge
„Welt-Klasse-Interpreten“ bei uns zu Gast sein. Das
Schwetzinger Publikum erwartet von uns, dass wir höchste Qualität
bieten - und auch die anschließenden Ausstrahlung der Konzerte in
aller Welt lassen da keine Kompromisse zu.
Dr.
Weber-Schäfer: Also da wird es den erwähnten
Europa-Schwerpunkt weiter geben: Quer durch die Windrose – in
diesem Jahr Osten, dann Süden, Westen und Norden – das ist das
Projekt für die nächsten vier Jahre - dann wird es Einzelprojekte
geben wie jetzt die Haydn-Sonaten – vielleicht orientiert an
speziellen Musik-Gattungen - dann wird es aber auch weiterhin die
ganz großen Interpreten geben – wie in diesem Jahr das
„Artemis-Quartett“, Frank Peter Zimmermann, Isabele
Faust und Sabine Meyer – also trotz der
vielen 'Spezialprojekte' werden wieder eine ganze Menge
„Welt-Klasse-Interpreten“ bei uns zu Gast sein. Das
Schwetzinger Publikum erwartet von uns, dass wir höchste Qualität
bieten - und auch die anschließenden Ausstrahlung der Konzerte in
aller Welt lassen da keine Kompromisse zu.
SPEYER-KURIER: Es lohnt sich also, noch einmal tief ins Programm der Schwetzinger SWR Festspiel einzusteigen und sich seine individuellen „Rosinen herauszupicken“.
Frau Dr. Weber-Schäfer, wir bedanken uns für diesess Gespräch und wünschen Ihnen für Ihre erste Spielzeit als Programm-Verantwortliche viel Erfolg und – da sind wir uns aber sicher, wenn wir erleben, wie sehr Sie selbst für dieses herrliche Medium 'Musik' brennen – viel Freude bei den Konzerten der nächsten sechs Wochen.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler/ Fotos gc.
26.04.2013
Interview der Woche
 heute mit
Jürgen Creutzmann MdEP, FDP, Speyer/Dudenhofen
heute mit
Jürgen Creutzmann MdEP, FDP, Speyer/Dudenhofen
Schutz „Geistigen Eigentums“ - ein aktiver Beitrag zum Verbraucherschutz
Der Diebstahl von „Geistigem Eigentum“, das „Abkupfern“ von Erfindungen und Patenten, insbesondere im naturwissenschaftlichen und technologischen Bereich, er wird immer mehr zu einer Bedrohung für innovative Unternehmen der mittelständischen Wirtschaft und der Großindustrie - am Wirtschaftsstandort Deutschland ebenso wie in Europa.
Experten sprechen zwischenzeitlich bereits von Schäden im dreistelligen Milliardenbereich, die Jahr für Jahr durch das unrechtmäßige „Absaugen“ von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen aus den Laboren in Europa und Nordamerika entstehen.
Der SPEYER-KURIER hat darüber jetzt mit Jürgen Creutzmann MdEP, wirtschaftspolitischer Sprecher der Liberalen im Europäischen Parlament und Berichterstatter seiner Fraktion zur Reform der entsprechenden EU-Richtlinie, gesprochen.
06.01.2013
SPEYER-KURIER: Herr Creutzmann, Sie haben ja noch bis unmittelbar vor Weihnachten als Berichterstatter Ihrer Fraktion der Liberalen im EU-Parlament für eine sachgerechte Reform der EU-Richtlinie zur Wahrung des Geistigen Eigentums gestritten. Sind Sie heute mit dem dabei erzielten Ergebnis zufrieden?
Jürgen Creutzmann: Ja, ich bin eigentlich sogar sehr zufrieden, konnte ich mich doch in der ersten Lesung dieser Verordnung im Parlament mit relativ breiter Mehrheit mit meinen eingebrachten Änderungsvorschlägen gegenüber dem von der Kommission vorgelegten Entwurf durchsetzen.
Wie Sie wissen, behandelt das EU-Parlament ja jede Verordnung im sogenannten Trilog-Verfahren, d.h. die drei gesetzgebenden Körperschaften der EU, die Kommission, das Parlament und der Ministerrat, müssen jede Verordnung beraten und dort, wo es inhaltlichen Dissens gibt, versuchen, zu einem von allen zu tragenden Kompromiss zu kommen.Das läuft dann konkret so ab, dass ich mich als Berichterstatter mit den sogenannten „Schattenberichterstattern“ der anderen Fraktionen zusammensetze und eine gemeinsame Linie entwickle. Das war in diesem Fall relativ einfach, weil dem ganzen ja schon in der Mitte des letzten Jahres eine Abstimmung im Parlament vorausgegangen war, in der wir uns bereits der jetzt erzielten Einigung angenähert hatten. Das hat jetzt auch mir geholfen, weil ich auf diese doch klare Linie des Parlamentes verweisen konnte.
SPEYER-KURIER: Worum geht es denn in dem Papier wirklich? Geht es da z.B. darum, dass die Leistungsschutzrechte von Schriftstellern und Autoren, von Komponisten und anderen Künstlern gestärkt werden oder geht es nicht vielmehr darum, dass plumpe Fälschungen und die Verbreitung von mehr oder weniger leicht erkennbaren Plagiaten verhindert werden sollen, mit denen erfolgreiche Erfindungen ausgehebelt werden sollen?
 Jürgen
Creutzmann: Hier geht es vor allem natürlich um das Aufspüren
gefälschter Produkte und darum, die Arbeit der Zollbehörden
innerhalb der EU so zu stärken, dass sie künftig solche Fälschungen
noch leichter erkennen können. Zugleich soll ihnen damit auch die
Beschlagnahme gefälschter Produkte erleichtert werden.
Jürgen
Creutzmann: Hier geht es vor allem natürlich um das Aufspüren
gefälschter Produkte und darum, die Arbeit der Zollbehörden
innerhalb der EU so zu stärken, dass sie künftig solche Fälschungen
noch leichter erkennen können. Zugleich soll ihnen damit auch die
Beschlagnahme gefälschter Produkte erleichtert werden.
Das Ziel der Reform der Verordnung war es deshalb, drei Dinge zu erreichen:
Zum ersten den Bürokratieabbau für den Zoll: Wir müssen dem Zoll dabei helfen, in dem Wust von Millionen Päckchen, die inzwischen nach Europa hereinfluten, Fälschungen aufspüren zu können und dadurch zu verhindern, dass diese zu anderen Händlern in Europa gelangen, denn die Einfuhr von Plagiaten erfolgt fast ausschließlich von Händler zu Händler.
Das zweite Ziel, das ich hatte, war die Stärkung der Rechteinhaber. Das bedeutet, dass derjenige, dessen Produkte gefälscht wurden, leichter dagegen vorgehen kann und er am Ende nicht auch noch auf den Kosten sitzen bleibt, die mit der Vernichtung dieser Fälschungen verbunden sind.
Und das dritte Ziel war, im Rahmen dieser Reform auch den Datenschutz zu stärken, werden doch die meisten Informationen über aussichtsreiche Erfindungen durch Angriffe auf die Datennetze dieser Unternehmen in Europa illegal „abgesaugt“.
Bei den gefälschten Produkten geht es ja nicht allein um gefälschte Designer-Produkte, sondern z.B. auch um Medikamente, wo Fälschungen, die bei uns auf den Markt gelangen,.unter Umständen eine Lebensgefahr für die damit behandelten Patienten heraufbeschwören können. Wir haben bei unseren Anhörungen hierzu erschütternde Beispiele erlebt: z.B. Menschen, die durch die Einnahme gefälschter Medikamente alle Zähne verloren haben.
Da geht es dann sogar oft darum, wirklich Leben zu retten - zum Beispiel, wenn die Einfuhr einer gefälschten Bremsanlage für einen LKW verhindert wird, wie ich es zuletzt bei einem auch in unserer Region vertretenen deutschen Nutzfahrzeughersteller erlebt habe, dem eine in China gefälschte Bremse ausgeliefert wurde, die – vom Original nicht zu unterscheiden – allerdings einen wesentlich längeren Bremsweg aufweist als das Oeriginal. Das kann dann Menschenleben kosten!
Deshalb sind die gefälschte Vuitton-Tasche oder die plagiierte Rolex-Uhr zwar für die Betrogenen höchst ärgerlich – so richtig kriminell wird es aber dann bei gefälschten Medikamenten oder bei sicherheitsrelevanten technischen Bauteilen von Maschinen.
SPEYER-KURIER: Natürlich muss hier der Schutz von Menschenleben Vorrang vor allem anderen haben – dennoch meine Frage. Wie groß quantifizieren Sie denn die materiellen Schäden, die durch solche „Diebstähle Geistigen Eigentums“ verursacht werden?
 Jürgen
Creutzmann: Das ist nur ganz schwer zu quantifizieren – wir
reden allerdings von Schäden im mehrstelligen Milliardenbereich,
insbesondere wenn wir es aus dem gesamteuropäischen Blickwinkel
betrachten. Gerade aber auch für den Wirtschaftsstandort
Deutschland ist es besonders wichtig, solche Fälschungen und ihre
Einfuhr zu verhindern, weil wir in besonderem Maße von den
Innovationen leben, die in den Forschungsabteilungen unserer
Unternehmen entwickelt werden. Solche Produkte stellen für ihre
Hersteller ja immer auch einen technologischen Vorsprung dar.
Diesen Vorsprung durch „Produkt-Piraterie“ einzubüßen, bedeutet für
die Betroffenen ja nicht nur einen materiellen Schaden, sondern
kann am Ende sogar zum Verlust von Arbeitsplätzen führen.
Jürgen
Creutzmann: Das ist nur ganz schwer zu quantifizieren – wir
reden allerdings von Schäden im mehrstelligen Milliardenbereich,
insbesondere wenn wir es aus dem gesamteuropäischen Blickwinkel
betrachten. Gerade aber auch für den Wirtschaftsstandort
Deutschland ist es besonders wichtig, solche Fälschungen und ihre
Einfuhr zu verhindern, weil wir in besonderem Maße von den
Innovationen leben, die in den Forschungsabteilungen unserer
Unternehmen entwickelt werden. Solche Produkte stellen für ihre
Hersteller ja immer auch einen technologischen Vorsprung dar.
Diesen Vorsprung durch „Produkt-Piraterie“ einzubüßen, bedeutet für
die Betroffenen ja nicht nur einen materiellen Schaden, sondern
kann am Ende sogar zum Verlust von Arbeitsplätzen führen.
Deshalb ist gerade für den Industriestandort Deutschland ein konsequentes Vorgehen gegen jede Form der Produkt-Piraterie und des Diebstahls Geistigen Eigentums so ungemein wichtig.
SPEYER-KURIER: Ist denn aber angesichts der gewaltigen Mengen an Waren, die von außen auf unsere Märkte strömen, eine wirksame Kontrolle überhaupt möglich?
Jürgen Creutzmann: Natürlich ist das schwierig – es müssen deshalb auch die Rechteinhaber eng mit dem Zoll zusammenarbeiten Sie, die ja auch selbst in hohem Masse am Schutz ihrer Produkte interessiert sein müssen, sollten dem Zoll Tipps geben, wenn Fälschungen ihrer Produkte auf dem Markt auftauchen oder wenn sich entsprechende Verdachtsmomente wie z.B. erkennbare Angriffe auf ihre Datennetze ergeben.
Dazu war es im übrigen auch besonders wichtig – und ich bin froh, dass ich mich dabei mit meinen Vorstellungen durchsetzen konnte – dass wir zu einer eindeutigen Definition darüber gekommen sind, was „kleine Mengen“ sind. Das war besonders wichtig, weil, wie gesagt, die meisten Fälschungen in Päckchen oder Paketen ins Land geschleußt werden. Da war die Definition „kleiner Mengen“ insbesondere für die Arbeit der Zollbeamten, die ja mit großer Erfahrung und mit großem Gespür ihrer Arbeit nachgehen, von großer Wichtigkeit. Hierzu aber wollte die EU- Kommission in ihrem Entwurf überhaupt keine Festlegung treffen; wir waren uns dann allerdings in unseren parlamentarischen Beratungen über die Notwendigkeit solcher Definitionen einig und auch der Rat hat am Ende meinem Vorschlag zugestimmt.
SPEYER-KURIER: Auf großen Industrie- und Verbrauchsgütermessen erlebt man es ja immer öfter: Ermittler führen dort Razzien durch und beschlagnahmen Waren und stellen Produkte sicher. Kann das aber wirklich „der Weisheit letzter Schluss“ sein – entspricht das der Vorstellung der Europäer, insbesondere auch der liberalen Europäer von freiem Handel und freiem Wettbewerb?
 Jürgen
Creutzmann: Also, wenn die Liberalen eine Aufgabe haben,
dann ist es die, einzutreten für den Schutz des Eigentums. Und
darunter verstehen wir nicht nur Eigentum, das Sie anfassen können,
sondern auch und vor allem auch Geistiges Eigentum. Wir reden so
viel von unserem Vorsprung bei Forschung und Wissenschaft – das
aber ist unser geistiges Eigentum - das ist unsere
wichtigste Ressource.
Jürgen
Creutzmann: Also, wenn die Liberalen eine Aufgabe haben,
dann ist es die, einzutreten für den Schutz des Eigentums. Und
darunter verstehen wir nicht nur Eigentum, das Sie anfassen können,
sondern auch und vor allem auch Geistiges Eigentum. Wir reden so
viel von unserem Vorsprung bei Forschung und Wissenschaft – das
aber ist unser geistiges Eigentum - das ist unsere
wichtigste Ressource.
Überlegen Sie nur einmal, wie viel Geld in Deutschland Jahr für Jahr für Forschung und Entwicklung ausgegeben wird! Das muss dann aber auch wirksam geschützt werden durch Patentschriften und Gebrauchsmuster und was immer es sonst noch an Schutzmöglichkeiten gibt. Und deshalb müssen wir als Parlament auch die Instrumente dazu bereit stellen, um gegen die vorgehen zu können, die diese Schutzrechte verletzen.
Und dabei nimmt eben der Zoll eine entscheidende Schlüsselrolle ein, wenn es darum geht, unsere diesbezüglichen Grenzen abzusichern.
Wenn die gefälschten, unter Umständen sogar gesundheits- oder gar lebensbedrohenden Produkte erst einmal ihren Weg in den europäischen Markt gefunden haben, dann ist es ungemein schwierig , sie noch aufzuspüren. Wir müssen deshalb dafür Sorge tragen, dass solche Produkte erst gar nicht auf den europäischen Markt gelangen können, denn das ist zugleich auch direkter und unmittelbarer Verbraucherschutz!
Leider haben die europäischen Behörden keine Handhabe dagegen, wenn der nationale Zoll unterbesetzt ist, so wie dies leider auch in Deutschland noch immer der Fall ist. Auch Deutschland hat entschieden zu wenige Zollbeamte. Hier müssen die Mitgliedsländer ihrer Verantwortung noch besser gerecht werden.
Ich hatte unlängst ein Gespräch mit Verantwortlichen eines großen Sportschuhherstellers in Herzogenaurach, dessen Produkte inzwischen in China in großem Umfang gefälscht werden. Die erzählten mir, dass der Hafen von Piräus inzwischen fest in chinesischer Hand sei. Wenn dann dort nicht konsequent kontrolliert wird, dann wissen natürlich diejenigen, die solche Waren auf unsere Märkte bringen wollen, ganz genau, wo die Schlupflöcher sind und wo sie ansetzen müssen..
Ich hatte deshalb ja in anderem Zusammenhang schon einmal vorgeschlagen, so etwas aufzubauen wie die FRONTEX – das ist die Sicherheitsbehörde, die Italien und Griechenland bei der Bewältigung der Flüchtlingsströme aus Afrika und Vorderasien unterstützt – eine Einrichtung also, die auf europäischer Ebene in gemeinsamem Bemühen die Einfuhr gefälschter Waren verhindern könnte. Ob man diese Idee einmal aufgreifen wird, weiß ich nicht.
Damals ging es mir um den Verbraucherschutz im Zusammenhang mit der Abwehr gefährlicher Weihnachtsdekorationen und mit Giften belasteter Spielwaren, die nicht unseren Sicherheitsstandards entsprechen. Zuletzt erlebten wir diese Diskussion ja auch rund um die Einfuhr von Silvester-Krachern und Neujahrsraketen.
Eine solche, gemeinsam operierende Behörde könnte ich mir auch gut zur Abwehr der Einfuhr von Fälschungen und Plagiaten vorstellen.
SPEYER-KURIER: Die westlichen Wirtschaftsmächte – also auch die EU und ihre Mitgliedsländer – sind ja in der Situation, im Umgang mit China, Indien und vielleicht zukünftig auch mit anderen Schwellenländern, eine Art „Eiertanz“ aufführen zu müssen: Denn einerseits möchten sie ihre eigenen Entwicklungen geschützt sehen - andererseits müssen sie aber auch als Nationen, die auf den Export ihrer Produkte angewiesen sind, an einem guten Verhältnis zu diesen übermächtigen Wirtschaftspartnern interessiert sein. Kann dieser Spagat am Ende überhaupt aufgehen oder droht unserer Volkswirtschaft nicht mittel- und langfristig doch der Abfluss der bei uns entwickelten Innovationen und am Ende gar die Überflutung unserer eigenen Märkte mit den dann in den Schwellenländern aus diesen europäischen Patenten ohne eigenen Entwicklungsaufwand erzeugten Wirtschaftsgüter.?
 Jürgen
Creutzmann: Wir können heute feststellen, dass gerade die
Chinesen in der letzten Zeit offensichtlich erkannt haben, dass der
Schutz geistigen Eigentums auch Ihnen dient, weil sie auch selbst
immer mehr eigene Produkte entwickeln und eigene Forschung
betreiben. Und diese Produkte möchten sie natürlich auch gesichert
wissen.
Jürgen
Creutzmann: Wir können heute feststellen, dass gerade die
Chinesen in der letzten Zeit offensichtlich erkannt haben, dass der
Schutz geistigen Eigentums auch Ihnen dient, weil sie auch selbst
immer mehr eigene Produkte entwickeln und eigene Forschung
betreiben. Und diese Produkte möchten sie natürlich auch gesichert
wissen.
Wir müssen deshalb die Zusammenarbeit zwischen den Wirtschaftsmächten in der Welt stärken – z.B. muss Europa seine Kooperation mit den USA ausbauen, damit wir uns transatlantisch bei unseren Entdeckungen und Erfindungen verstärkt austauschen. Solche Kooperationen müssen aber auch mit China und allen anderen Schwellenländern verstärkt werden. Das ist zwar nicht ganz einfach, wir verspüren in diesen Ländern aber schon so etwas wie ein langsames Umdenken.
Andererseits müssen die Unternehmen aber auch verstärkte Anstrengungen unternehmen, um ihre eigenen Forschungsergebnisse vor Diebstahl zu schützen – Diebstahl, der ja – das möchte ich ausdrücklich betonen - durchaus als kriminell eingestuft werden muss. Ansonsten haben die Unternehmen vielleicht Millionen investiert und die anderen „kupfern“ es einfach nur ab und machen so den gewonnenen Zeitvorsprung zunichte.
SPEYER-KURIER: Gibt es denn in unseren Unternehmen heute schon ein Bewusstsein für diese Gefahren?
Jürgen Creutzmann: Bei den Großunternehmen sicher. Die unterhalten heute ganze Abteilungen, um sich vor Betriebsspionage und dem Ausspähen ihrer Entwicklungsergebnisse zu schützen. Anders ist das aber sicher bei vielen mittelständischen und kleineren Unternehmen: Die müssen auf der Hut sein. Denn gerade von denen investieren ja viele in großem Umfang in Forschung; da könnte das Eindringen von Spionen in ihre Datensysteme ein Unternehmen durchaus in seiner Existenz gefährden.
SPEYER-KURIER: Wie wird es jetzt mit der Umsetzung dieser wichtigen Verordnung weitergehen?
Jürgen Creutzmann: Ja, dazu wird es vor allem wichtig sein, dass die Mitgliedsstaaten unverzüglich an die Umsetzung dieser Verordnung gehen.Wir hatten z.B. gefordert, dass wir jetzt auch zeitgleich über die Einbeziehung der Schutzmaßnahmen für die Datenverarbeitung befinden. Da waren die Mitgliedsstaaten zunächst nicht bereit, einen Endtermin zu vereinbaren. Wir haben uns dann in einem Kompromiss darüber geeinigt, dass das bis zum 1. Januar 2014 umgesetzt sein muss. Denn jede EU-Verordnung ist nur so gut, wie sie dann auch in den Mitgliedsstaaten umgesetzt wird.
Zuversichtlich für die Bundestagswahl im Herbst – skeptisch über derzeitiges Führungspersonal
SPEYER-KURIER: Herr Creutzmann, wir können heute ja nicht zusammensitzen, ohne zumindest einen kleinen Blick auf den gegenwärtigen Zustand Ihrer Partei, der FDP, zu werfen. Was ist Ihre Prognose: Wird Wirtschaftsminister Philipp Rösler nach der niedersächsischen Landtagswahl noch Vorsitzender Ihrer traditionsreichen Partei sein und wird er sich im Mai noch einmal zur Wahl stellen?
 Jürgen
Creutzmann: Man kann natürlich nicht n einen Menschen
hineinschauen und deshalb auch nur schwer vorhersagen, wie er sich
entscheiden wird. Jedenfalls wünschen wir den Freunden in Hannover
ein gutes Wahlergebnis, auch wenn das Umfeld für die Liberalen
derzeit nicht gut ist. Philipp Rösler weiß, dass er in der Partei
nicht unumstritten ist und dass es Untersuchungen gibt, die zeigen,
dass die Partei ohne ihn ein Potential zwischen sieben und
acht Prozent hätte.
Jürgen
Creutzmann: Man kann natürlich nicht n einen Menschen
hineinschauen und deshalb auch nur schwer vorhersagen, wie er sich
entscheiden wird. Jedenfalls wünschen wir den Freunden in Hannover
ein gutes Wahlergebnis, auch wenn das Umfeld für die Liberalen
derzeit nicht gut ist. Philipp Rösler weiß, dass er in der Partei
nicht unumstritten ist und dass es Untersuchungen gibt, die zeigen,
dass die Partei ohne ihn ein Potential zwischen sieben und
acht Prozent hätte.
Ich denke, wir sollten deshalb das Wahlergebnis in Niedersachsen abwarten – Rösler hat ja selbst erklärt, er wolle einen Schritt nach dem anderen gehen - und vielleicht tritt er dann ja im Mai erst garnicht mehr an.
Ich selbst plädiere jedenfalls heute dafür, den Bundesparteitag vom Mai vorzuziehen und so bald nach der Niedersachsenwahl darüber zu entscheiden, mit wem wir in den Bundestagswahlkampf im Herbst dieses Jahres ziehen werden.
SPEYER-KURIER: Aber was ist denn Ihre politische Analyse – was hat die FDP nach ihrem überragenden Ergebnis bei der letzten Bundestagswahl falsch gemacht, dass sie so heruntergezogen wurde – dass dem kleineren Koalitionspartner alle Fehler, die die Bundesregierung sicher auch gemacht hat, ihr angelastet werden?
Jürgen Creutzmann: Erster Fehler – man hat nicht lange genug verhandelt, man hat zu viele Prüfaufträge vergeben. Ich habe in Rheinland-Pfalz selbst drei Koalitionsverhandlungen mitführen dürfen – eine mit der CDU, zwei mit der SPD – daraus habe ich gelernt: Sie werden als kleinerer Partner immer nur bis zur Wahl des Regierungschefs gebraucht – des Ministerpräsidenten im Land, des Kanzlers oder der Kanzlerin im Bund.
Zweiter Fehler: Die Union hat – ohne dass ich ihr die alleinige Schuld zuweisen möchte – alle Vorschläge der FDP zur Steuervereinfachung – ich spreche gar nicht von Steuererleichterungen, obwohl diese Koalition Steuererleichterungen von 24 Milliarden Euro durchgesetzt hat – blockiert.
Und der dritte Fehler, den man gemacht hat: Trotz der Schuldenkrise - ausgelöst durch die Lehman-Pleite - hat die FDP immer noch auf Steuersenkungen gepocht, als sich die Bürger längst darüber einig waren, dass es jetzt darauf ankommt, auf breiter Front zu sparen und Schulden abzubauen.
Und dann kommt dazu, dass Politik immer durch Personen vermittelt wird. Und wenn diese Personen kein Ansehen genießen – ob zu Recht oder zu Unrecht – dann wird es ganz, ganz schwierig. Es gab eine Vertrauenskrise in die FDP und wir haben diese Vertrauenskrise noch immer nicht ganz überwunden. Vertrauen ist halt immer schneller verspielt als wieder zurück gewonnen. Daran müssen wir arbeiten, aber ich bin sicher: Wir schaffen das!
SPEYER-KURIER: Mit den absehbaren Strompreiserhöhungen steht der nächste Prüfstein für die FDP ja schon bereit. Da ist auf der einen Seite der „gute“ Umweltminister, der sich um die regenerativen Energien kümmert und auf der andren Seite der „böse“ Wirtschaftsminister, der für die Strompreiserhöhungen verantwortlich gemacht wird....
Jürgen Creutzmann: Für die Preiserhöhungen sind wir alle gemeinschaftlich verantwortlich, weil wir das Energie-Einspeisungsgesetz EEG gemeinsam beschlossen haben. Wie Sie wissen, sind fünfzig Prozent des Strompreises Belastungen, die von den Regierungen seit der rot-grünen Koalition – wir haben sie allerdings auch nicht wieder abgeschafft - administriert wurden. Das EEG muss deshalb meines Erachtens dringend überarbeitet werden, weil wir – und ich finde das völlig idiotisch – für Stromeinspeisungen Geld bezahlen, damit wir diese erzeugte Energie gar nicht erst nutzen können. Das kann man dem Stromkunden nicht mehr länger vermitteln.
Es war auch ein Fehler und Planwirtschaft pur, wenn wir den Erzeugern von Solar- und Windenergie für zwanzig Jahre feste Garantien für ihre Einspeisevergütungen gaben, gleichzeitig aber diese Strommengen überhaupt nicht abgenommen werden können und wir gleichzeitig noch Kraftwerkskapazitäten für wind- und sonnenarme Zeiten aufbauen müssen.
SPEYER-KURIER: Wenn die Situation eintreten sollte und die FDP den Wiedereinzug in den Landtag von Niedersachsen nicht mehr schafft, besteht dann für Ihre Partei noch Hoffnung, im Herbst den Sprung in den Bundestag zu schaffen?
 Jürgen
Creutzmann: Ich denke, wir müssen den Menschen einfach nur klar
machen, was die Alternativen sind. Lassen Sie mich ein Beispiel
aufzeigen: Die Grünen haben im Deutschen Bundes einen Gesetzentwurf
eingebracht, der eine Vermögensabgabe von 15 Prozent vorsieht. Die
erste Million soll dabei frei bleiben, doch dann würde dieses
Gesetz den Freibetrag auf Null abschmelzen. Das bedeutet, dass Sie
bei einem Betriebsvermögen von zwei Millionen Euro jährlich eine
Vermögensabgabe von 300.000 Euro zahlen – gleichgültig, ob Sie
einen Gewinn gemacht haben oder nicht.
Jürgen
Creutzmann: Ich denke, wir müssen den Menschen einfach nur klar
machen, was die Alternativen sind. Lassen Sie mich ein Beispiel
aufzeigen: Die Grünen haben im Deutschen Bundes einen Gesetzentwurf
eingebracht, der eine Vermögensabgabe von 15 Prozent vorsieht. Die
erste Million soll dabei frei bleiben, doch dann würde dieses
Gesetz den Freibetrag auf Null abschmelzen. Das bedeutet, dass Sie
bei einem Betriebsvermögen von zwei Millionen Euro jährlich eine
Vermögensabgabe von 300.000 Euro zahlen – gleichgültig, ob Sie
einen Gewinn gemacht haben oder nicht.
Wenn Sie sich vorstellen, dass ein Winzerbetrieb in der Pfalz mit ein paar Wingert und einer Betriebseinrichtung rasch einen Verkehrswert von zwei Millionen erreicht, dann kann ich Ihnen sagen, dass das ein echtes Mittelstands-Vernichtungsprogramm und damit – was noch weitaus schlimmer wäre – ein Arbeitsplatz-Vernichtungsprogramm wäre. Da reden wir noch garnicht über höhere Steuern, wie sie die SPD oder über eine höhere Vermögenssteuer, wie sie die Grünen wollen.
Das bedeutet, wir müssen den Menschen einfach nur klar machen, dass sie sehr rasch ihren Arbeitsplatz verlieren werden, wenn sie rot-grün wählen, weil die Unternehmen – gerade auch im Mittelstand – nicht mehr in der Lage sein würden, ihre Arbeitseinkommen zu erwirtschaften.
Und wenn man das den Menschen in aller Klarheit sagt, dann bin ich recht zuversichtlich, dass die Bundestagswahl noch nicht verloren ist – auch für die FDP nicht, die zudem ja auch immer wieder aufkommenden Sozialdemokratisierungstendenzen in der Union entgegenwirken muss,
Ich möchte hierzu beispielhaft nur den 'Mindestlohn' anführen: Wir haben im Rheinpfalz-Kreis rund 600 Gemüseanbauer, Die zahlen ihren Erntehelfern einen Lohn von 7 Euro/Stunde. Bei einem Mindestlohn von 8,50 Euro, wie Rot-Grün ihn fordern, können Sie davon ausgehen, dass die 200 Betriebe, die heute schon Probleme haben, dann „über die Wupper“ gehen werden. Das ist ein Beispiel, dass Mindestlohn nicht immer ein Segen sein muss, sondern auch Arbeitsplätze kosten kann.
Deshalb noch einmal: Wir müssen den Menschen die Alternativen aufzeigen. Dann bin ich zuversichtlich, dass auch die FDP wieder ein gutes Ergebnis bei der Bundestagswahl erzielen kann und diese Koalition über das Jahr 2013 hinaus ihre Regierungsarbeit fortsetzen wird.
SPEYER-KURIER: Was prognostizieren Sie denn Ihrer Partei für die Bundestagswahl im September?
Jürgen Creutzmann: Wir müssen uns zunächst einmal gut aufstellen und mit sympathischen Leuten unsere Politik erläutern. Dann werden wir das Potential ausschöpfen können, das Herr Güllner von „Forsa“ uns zuletzt prophezeit hat – und das waren eben jene sieben bis acht Prozent. Und wenn dann die Union vierzig Prozent schafft, dann haben wir eine ausreichende, regierungsfähige Mehrheit.
Mit den niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit langem und den höchsten Beschäftigtenzahlen in der Geschichte des vereinigten Deutschlands sollte eine solche Mehrheit machbar sein. Da bin ich ganz optimistisch !
SPEYER-KURIER: Herr Creutzmann, wenn dann im Herbst die Bundestagswahlen gelaufen sind, steht schon wenige Monate später die Wahl zum Europäischen Parlament auf dem politischen Terminkalender. Angesichts der Komplexität und des doch noch großen zeitlichen Abstandes zu diesem Wahltermin will ich Sie jetzt nicht um eine Progtnose für diese Wahlen bitten; deshalb nur so viel: Wird Jürgen Creutzmann auch dem nächsten EU-Parlament angehören? Sind Sie – und das wäre natürlich die erste Voraussetzung dafür – bereit, noch einmal für Brüssel und Straßburg zu kandidieren?
 Jürgen
Creutzmann: Es gibt viele Parteifreunde, die mich immer wieder
ermuntern, erneut zu kandidieren. Die Entscheidung darüber ist aber
noch nicht gefallen. Die Landes-FDP in Rheinland-Pfalz wird am 30.
November ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl 2014
nominieren. Bis dahin habe ich Zeit, gemeinsam mit meiner Familie
zu überlegen, ob ich noch eine Legislaturperiode mache. Ich bin
dann im 69. Lebensjahr, und wie heißt es? „Es gibt auch noch ein
Leben vor dem Tod“.... Immerhin mache ich seit meinem 20.
Lebensjahr ehrenamtlich Politik und dass es sich am Schluss noch in
'Berufspolitik' ausweiten würde, war am Anfang so nicht abzusehen.
Ich bin zum Ende der laufenden Legislaturperiode 40 Jahre im
Verbandsgemeinderat, 25 Jahre im Kreistag, zehn Jahre im Bezirkstag
– habe also immer ehrenamtlich für die Menschen Politik gemacht –
das hat mir immer viel Freude bereitet.
Jürgen
Creutzmann: Es gibt viele Parteifreunde, die mich immer wieder
ermuntern, erneut zu kandidieren. Die Entscheidung darüber ist aber
noch nicht gefallen. Die Landes-FDP in Rheinland-Pfalz wird am 30.
November ihren Spitzenkandidaten für die Europawahl 2014
nominieren. Bis dahin habe ich Zeit, gemeinsam mit meiner Familie
zu überlegen, ob ich noch eine Legislaturperiode mache. Ich bin
dann im 69. Lebensjahr, und wie heißt es? „Es gibt auch noch ein
Leben vor dem Tod“.... Immerhin mache ich seit meinem 20.
Lebensjahr ehrenamtlich Politik und dass es sich am Schluss noch in
'Berufspolitik' ausweiten würde, war am Anfang so nicht abzusehen.
Ich bin zum Ende der laufenden Legislaturperiode 40 Jahre im
Verbandsgemeinderat, 25 Jahre im Kreistag, zehn Jahre im Bezirkstag
– habe also immer ehrenamtlich für die Menschen Politik gemacht –
das hat mir immer viel Freude bereitet.
Ich habe also noch ausreichend Zeit, mir zu überlegen, wie es weitergehen soll. Ich bin aber überzeugt, wenn ich mich dafür entscheiden sollte, dass mich die rheinland-pfälzischen Freunde auch wieder nominieren würden. Dann kommt es natürlich auch darauf an, wie ich auf einer Bundesliste platziert würde und – das ist dann das allerwichtigste: Entscheidend ist immer, wie das der Wähler an der Wahlurne sieht. Da sind also noch mehrere Fragezeichen und fast anderthalb Jahre Zeit dazwischen....
SPEYER-KURIER: Aber man merkt Ihnen an, dass Ihnen diese Arbeit noch immer viel Spaß macht.....
Jürgen Creutzmann: Ja, es macht in der Tat Spaß und es macht deshalb so viel Spaß, weil es kein Parlament gibt, wo Sie als Individuum so viel erreichen können wie im Europaparlament.
SPEYER-KURIER: Dann dürfen wir uns im Namen der Leserinnen und Leser des SPEYER-KURIER sehr herzlich für dieses ausführliche und offene Gespräch bedanken und Ihnen für Ihre politische Arbeit in Brüssel und Straßburg auch für die restliche Legislaturperiode noch viel Erfolg wünschen.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler/Fotos: gc.
06.01.2013
Interview der Woche
 heute mit dem
Schauspieler, Rezitator, Regisseur und Theaterintendanten
heute mit dem
Schauspieler, Rezitator, Regisseur und Theaterintendanten
Curt Timm (86)
geb. 1926 in Hamburg
verheiratet
1943 bis 1946 Studium an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg
Schauspiel und Regie für Schauspiel und Oper
Zwischendurch Kriegsdienst
Danach Engagements als Schauspieler, Regieassistent und Dramaturg - Chefdramaturg und Oberspielleiter am Theater der Stadt Stralsund.
1953 Berufung zum Intendanten am Theater der Stadt Stralsund
Parallel dazu Dozent für dramatischen Unterricht und Sprechtechnik an der Staatlichen Schauspielschule Stralsund.
Ab 1960 Engagement als Schauspieler am Hamburger Thalia-Theater bei Willy Maertens sowie als Regisseur am Künstlertheater Hamburg. Als Regisseur beim Norddeutschen Rundfunk und bei Radio Bremen produzierte er mehr als 60 Hörspiele.
1974 bis 1986 Intendant des Theaters in Flensburg.
Neben seinen vielen Bühnenrollen immer wieder auch Auftritte im Fernsehen - u.a. in Serien wie “Tatort” oder “Bella Block”.
Seit 1986 ist Timm verstärkt als Gastregisseur und Rezitator in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs.
Mit seiner CD-Reihe „Spuren des Wortes“ trägt er zu einer neuen Auseinandersetzung mit der Bibel bei. Jedes biblische Thema wird in Dialog zu seiner literarischen Aufarbeitung gesetzt. Musikalische Interpretationen runden den jeweiligen Themenkomplex ab. Bisher sind erschienen:
“Die Schöpfung“ mit Martin Bruchwitz an der Orgel
“Das Paradies“ mit Matthias Janz an der Orgel
2007 Rezitator in „Klaus Störtebeker“ nach dem Roman von Wilhelm Lobsien.
2008 Mitwirkung in demHörbuch zu dem Roman „Der Fall von Paris“ von Gerdt Fehrle. Seine neue Wahlheimat ist Speyer am Rhein.
Inszenierungen
1964 “Babel“ von Günther Weißenborn, deutsche Erstaufführung des Schauspiels
1974 “Vorstadtlegende“ des tschechischen Dichter Bruno Vlahek
“Don Giovanni“ von W.A. Mozart an der Staatsoper Berlin mit Vlasta Urbanova und Manfred Schmidt - Musikalische Leitung: Staatskapellmeister Hans Löwlein
„Jedermann“ - Urfassung von Hans Stricker ( 1584 ) zur 700-Jahrfeier der Stadt Flensburg in der Marienkirche -
Musikalische Leitung Prof. Matthias Janz
„Thomas Chatterton“ von Hans Henny Jahnn ( erste Inszenierung nach der Uraufführung der Gründgens-Inszenierung )
Filmografie
1964: Der Fall Nebe
1965: 1939 – Ein Tag – Bericht aus einem deutschen Konzentrationslager
1969: Ida Rogalski
1969: Percy Stuart
1971: Fluchtweg St. Pauli – Großalarm für die Davidswache
1978: Tatort – Himmelfahrt
1982: Mein Sohn, der Minister
1998: Ufos über Waterlow
Hörbücher
Spuren des Wortes. Die Schöpfung. Die Bibel und Literatur im Dialog. Audio-CD, ISBN 3-87503-117-2.
Spuren des Wortes. Das Paradies. Die Bibel und Literatur im Dialog. Audio-CD
05.09.2012
 SPEYER-KURIER:
Herr Timm, vor drei Jahren erst sind Sie aus der Ebene
Norddeutschlands, wo Sie geboren wurden und wo Sie Ihr ganzes Leben
verbracht und gearbeitet haben, nach Speyer gezogen. Was hat Sie
denn damals zu diesem späten “Standortwechsel” veranlasst?
SPEYER-KURIER:
Herr Timm, vor drei Jahren erst sind Sie aus der Ebene
Norddeutschlands, wo Sie geboren wurden und wo Sie Ihr ganzes Leben
verbracht und gearbeitet haben, nach Speyer gezogen. Was hat Sie
denn damals zu diesem späten “Standortwechsel” veranlasst?
Curt Timm: Das hatte rein familiäre Gründe. Die Tochter meiner Frau wohnt hier - ihr Mann ist Architekt und er hat dieses Haus hier komplett restauriert. Und eines Tages riefen die Kinder bei uns an und boten uns an: “Wenn ihr wollt, könnt ihr nach Speyer kommen und hier wohnen”.
SPEYER-KURIER: Das ist aber doch sicher eine große Umstellung, stelle ich mir vor.....
Curt Timm: Das ist eine ungeheure Umstellung - dennoch haben wir das rasch geschafft: Es ist einfach viel leichter hier, Kontakt zu bekommen als oben im Norden. Wir waren gerade einmal zwei Tage hier, da rief uns ein Nachbar an und lud uns ein, mit ihm zusammen einen Wein trinken zu gehen. Wir gingen dann zusammen in das Weinlokal von Inge Fleischmann, ins “Narrenstübel” - mein Nachbar traf dort einen alten Bekannten - sie unterhielten sich in Pfälzisch - und ich habe kein Wort mehr verstanden. (lacht)
SPEYER-KURIER: Eine Stadt und eine Landschaft definieren sich ja auch immer und vor allem durch ihr kulturelles Leben. Was haben Sie denn da in Speyer angetroffen?
Curt Timm: Phantastisch - das war eine riesige Überraschung, weil die Kultur hier so lebendig war. Ich hatte dann schon bald eine sehr interessante Unterhaltung mit Herrn Brohm (damals noch Kulturdezernent der Stadt - d.Red.), aus dem sich ein sehr schöner Kontakt entwickelt hat. Von da an konnte ich jedes Jahr meine sechs literarischen Abende machen - das war sehr angenehm - und auch der gesellschaftliche Verkehr hat sich sehr schön entwickelt.
Also kurz gesagt: Die Kultur hier in Speyer ist einfach fabelhaft.
SPEYER-KURIER: Sie haben sich ja über viele Jahre hinweg als Schauspieler, Rezitator, Regisseur und vor allem auch als Intendant darum bemüht, die Werte, wie sie insbesondere im Schauspiel, aber auch im Musiktheater vermittelt werden, den Ihnen anvertrauten Menschen in Hamburg, in Schwerin, in Flensburg und an vielen anderen Stationen zu vermitteln. Rückblickend: Welche Unterschiede zwischen dem Theaterpublikum an diesen Orten sind Ihnen aus diesen mehr als sechs Jahrzehnten ihres Bühnenschaffens besonders erinnerlich?
 Curt Timm:
Ich hatte - wenn wir bei Stralsund anfangen - stets ein sehr
interessiertes Publikum - immer volle Häuser und einen sehr großen
Etat, so dass ich damals namhafte Gäste engagieren konnte, wie für
die Oper den Tenor Manfred Schmidt, der später an die Münchener
Staatsoper ging, die tschechische Sopranistin Vlasta Urbanova oder
den berühmten Dirigenten und Berliner Staatskapellmeister Hans
Löwlein, mit dem ich mehrere Produktionen gemeinsam machen durfte.
Der “Don Giovanni”, den wir damals gemeinsam machten, war eine
sensationelle Aufführung.
Curt Timm:
Ich hatte - wenn wir bei Stralsund anfangen - stets ein sehr
interessiertes Publikum - immer volle Häuser und einen sehr großen
Etat, so dass ich damals namhafte Gäste engagieren konnte, wie für
die Oper den Tenor Manfred Schmidt, der später an die Münchener
Staatsoper ging, die tschechische Sopranistin Vlasta Urbanova oder
den berühmten Dirigenten und Berliner Staatskapellmeister Hans
Löwlein, mit dem ich mehrere Produktionen gemeinsam machen durfte.
Der “Don Giovanni”, den wir damals gemeinsam machten, war eine
sensationelle Aufführung.
Dann hatte ich eine japanische Sängerin für eine Produktion von Puccinis “Madame Butterfly” - ebenfalls eine großartige Produktion. Ich hatte aber auch ein sehr passables Ensemble in Stralsund.
SPEYER-KURIER: Stralsund - das war ja schon DDR. Wie war denn nach Ihrer Erinnerung der Unterschied im Theaterbetrieb der DDR und in Westdeutschland?
Curt Timm: Das ging bis 1958/59 auch in der DDR eigentlich ganz gut - doch dann fing man an, mir in den Spielplan hineinreden zu wollen - vor allem im Schauspiel. Ich machte damals eine Aufführung von “Oberst Chabert” von Hans José Rehfisch - der lebte damals in Hamburg - und der fragte mich, ob ich nicht lieber wieder nach Hamburg zurück wollte. Und da mein Vertrag in Stralsund ohnedies gerade auslief, bin ich dieser Einladung gerne gefolgt.
Ich habe dann wieder sehr viel gespielt - zuerst im “Revisor” von Gogol - habe dann sehr viel bei Ida Ehre gespielt - das war für drei Jahre mein Stammhaus. Danach bekam ich das Angebot für die Intendanz in Flensburg, das mich sehr gereizt hat. Da blieb ich dann volle zwölf Jahre.
SPEYER-KURIER: Stralsund und Flensburg waren ja schon damals etwa gleich große Städte mit vergleichbaren Theatern. Gab es denn da Unterschiede im Publikum?
Curt Timm: Eigentlich nicht - die Leute waren immer zufrieden mit dem, was ich machte. Es gab in beiden Städten einen lebhaften gesellschaftlichen Diskurs darüber. In Flensburg brachte ich dann zur 700-Jahrfeier der Stadt die Urfassung des “Jedermann” von Hans Stricker aus dem Jahr 1584 heraus, was - in der Marienkirche aufgeführt - ein ganz großer Erfolg war. Das lief und lief und lief und wurde damals auch im Fernsehen aufgezeichnet.
Deshalb mein Fazit: Es kommt immer darauf an, dass das Publikum zufrieden ist - dann macht es keinen Unterschied zwischen den Regionen und Landsmannschaften - und wenn man etwas Gutes abliefert, dann sind die Menschen zufrieden - wenn man aber “Bödsinn” abliefert, dann sind sie zurecht unzufrieden. Pfeifen und buhen einem aus.
Ich bin immer davon ausgegangen - und das habe ich auch so gelernt - dass es zuerst darauf ankommt, das Stück zu inszenieren und nicht mich selbst. Heute inszenieren viele Regisseure erst einmal sich selbst und das Stück bleibt dann oft auf der Strecke.
SPEYER-KURIER: Viele Regisseure - gerade auch im Musiktheater - scheinen ja heute geradezu zwanghaft von dem Gedenken bestimmt zu sein, etwas abliefern zu müssen, was so noch nie “da” war. Da aber gerade das Gute fast schon alles “da” war, ist das Ergebnis dann oft entsprechend...
 Curt Timm:
Ja, das ist genau diese Tendenz, sich selbst in Szene zu setzen.
Das ist und war noch nie mein Ding. Früher nannte man es
“Werktreue” - das war schon das Credo an der Hochschule: “Wenn ihr
inszeniert, müsst ihr dem Publikum das Werk verständlich
machen” und nicht Euch selbst. Das war meine Zeit...
Curt Timm:
Ja, das ist genau diese Tendenz, sich selbst in Szene zu setzen.
Das ist und war noch nie mein Ding. Früher nannte man es
“Werktreue” - das war schon das Credo an der Hochschule: “Wenn ihr
inszeniert, müsst ihr dem Publikum das Werk verständlich
machen” und nicht Euch selbst. Das war meine Zeit...
SPEYER-KURIER: Halten solche Tendenzen auch heute noch an?
Curt Timm: Zum Teil ja - aber ich sehe in letzter Zeit mit wachsender Freude, dass das so nicht mehr läuft, dass diese überdrehten und unsinnigen Ansätze heute so nicht mehr funktionieren. Ich habe zuletzt eine Kritik über eine Schauspielpremiere bei den “Salzburger Festspielen” in der “Süddeutschen Zeitung” gelesen, da lautete die Überschrift “Quatsch mit Sauce”....
Natürlich kann ich heute einen “Giovanni” oder einen “Figaro” nicht mehr so inszenieren wie 1955 - wir haben eine andere Zeit und das Publikum hat eine andere Erwartung. Es will auch die heutigen gesellschaftlichen Zusammenhänge in der Inszenierung reflektiert sehen. Dem versuche auch ich immer wieder gerecht zu werden.
SPEYER-KURIER: Herr Timm, man sagt ja gerne “Der Künstler kann die Kunst nie lassen - der Künstler geht auch nie in den Ruhestand”. Das haben wir auch bei Ihnen immer wieder feststellen dürfen, der Sie sich auch in Speyer mit wunderbaren Rezitationsabenden zu Wort gemeldet haben und damit ein Genre wieder belebt haben, das in der Stadt fast schon verloren schien. Welche Rolle spielen denn aus Ihrer Sicht heute Kunst und Kultur für den Zusammenhalt und die Entwicklung einer Gesellschaft?
Curt Timm: Eine Gesellschaft ohne Kultur ist eine Katastrophe. Die Kultur hat - jenseits ihres Bildungsauftrags - die Aufgabe, der Menschlichkeit zum Durchbruch zu verhelfen, die Menschen zusammenzuführen und so im geistigen Sinne für Ordnung zu sorgen. Das ist eine der wesentlichen Aufgaben von Kultur.
SPEYER-KURIER: Das gilt ja insbesondere auch für die nachwachsende Generation, für unsere Kinder. Was muss denn hier geschehen, um gerade ihnen die den Künsten innewohnenden Werte zu vermitteln?
Curt Timm: Sie müssen an die Kunst herangeführt werden - und das mit Qualität und nicht mit irgendwelchem Unsinn, wie man ihn heute nur allzu oft sieht. Sehr schön sind dafür Kinderstücke wie “Räuber Hotzenplotz” geeignet - aber auch die müssen gut gemacht sein - das ist die Voraussetzung - denn da wird der erste Schritt zum regelmäßigen Theaterbesuch getan. So lernen die Kinder über das Theater das Leben kennen. Insofern hat Theater auch heute noch eine erzieherische Funktion, obwohl mir der Begriff “Erziehung” eigentlich in diesem Zusammenhang zu streng ist - ich verstehe das eher anders...
SPEYER-KURIER: ..eher im Schiller’schen Sinne “Theater als moralische Anstalt”? - gilt das auch heute noch?
Curt Timm: Ja, absolut ja.
SPEYER-KURIER: Welche Kriterien muss da heute das Theater erfüllen?
-01-01.jpg) Curt Timm:
Theater muss auch heute wahr sein, es muss in der Lage sein,
Emotionen zu wecken. Und Emotionen kann man nur wecken, wenn man
sie selbst hat. Es kommt nichts über die Rampe, wenn man einen nur
Text loslässt, ohne seinen Inhalt gleichzeitig in seinem Inneren zu
empfinden.
Curt Timm:
Theater muss auch heute wahr sein, es muss in der Lage sein,
Emotionen zu wecken. Und Emotionen kann man nur wecken, wenn man
sie selbst hat. Es kommt nichts über die Rampe, wenn man einen nur
Text loslässt, ohne seinen Inhalt gleichzeitig in seinem Inneren zu
empfinden.
Dieses Ziel versuche ich auch bei meinen literarischen Abenden zu verwirklichen.
SPEYER-KURIER: Da war es sicher ein Glücksfall, dass Sie Ihr ganzes Leben auf beiden Seiten der Rampe zuhause waren: Als Schauspieler auf der Bühne - als Regisseur und Dramaturg am Regiepult davor. Einem anderen zu sagen, wie’s geht, ohne es je selbst gemacht zu haben, ist oft genug zu Scheitern verurteilt und muss schief gehen...
Curt Timm: So ist es - ein Regisseur, der selbst Schauspieler ist, hat’s leichter, weil er eine Szene einfach vorspielen kann. Ein Regisseur, der nur von der Theorie ausgeht und seinem Schauspieler nur sagt “das musst Du so und so machen” - das klappt manchmal, aber nicht immer.
SPEYER-KURIER: Das hat mich zum Beispiel auch immer wieder bei George Tabori fasziniert - diese Empathie - diese Fähigkeit, eine Situation mit der Figur mitzuempfinden.
Curt Timm: Ja, das ist eigentlich die Voraussetzung für jede gute szenische Darstellung.
SPEYER-KURIER: Kunst und Kultur werden ja in der öffentlichen Diskussion - gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie diesen - oft genug nur noch unter dem Kostenaspekt bewertet. Ist das gerechtfertigt, oder sind Investitionen in die Kultur nicht zugleich auch Investitionen in die Zukunft?
Curt Timm: Ja, genau so ist es - das letztere ist richtig. Wenn bei den Schulen gespart werden muss, dann ist das eine Katastrophe - wenn bei den Theatern gespart wird, ist das die nächste Katastrophe. Alles, was Menschlichkeit vermitteln soll, wird weggespart. Menschlichkeit scheint im Moment nicht gefragt - und das ist falsch. Warum haben wir denn diese furchbaren Dinge, diese Gewalttätigkeiten, die Jugendliche zum Teil in aller Öffentlichkeit anstellen? Weil die nie in einem Theater waren, weil die erlebt haben, was Menschlichkeit sein kann. Deshalb ist Theater auch heute so wichtig wie das Mittagessen, das täglich auf unseren Tisch kommt.
SPEYER-KURIER: Auch in Speyer klagen zur Zeit viele Künstler über die Einsparzwänge, die auf diesem Feld - in allen Kunstgattungen - als “alternativlos” bezeichnet werden. Wie ist da Ihre Meinung? Ist Sparen überhaupt ein gangbarer und verantwortbarer Weg, um Kunst zukunftssicher zu machen?
 Curt Timm:
Ich sehe das anders und will mich dazu auch verstärkt öffentlich
äußern: Es gibt Erhebungen des Deutschen Bühnenvereins, die zeigen,
dass am Ende einer jeden Spielzeit eines Theaters mehr
hereingekommen ist, als hineingesteckt wurde. Das gilt natürlich
nicht für das Theater selbst, sondern muss mit seiner gesamten
Umgebung zusammen bewertet werden. Da werden Hotels gebucht und die
Gastronomie und der Einzelhandel angekurbelt, um nur einiges wenige
zu nennen - das sind alles Dinge, die üblicherweise nicht in die
immer wieder verbreiteten Defizitrechnungen mit einbezogen
werden.
Curt Timm:
Ich sehe das anders und will mich dazu auch verstärkt öffentlich
äußern: Es gibt Erhebungen des Deutschen Bühnenvereins, die zeigen,
dass am Ende einer jeden Spielzeit eines Theaters mehr
hereingekommen ist, als hineingesteckt wurde. Das gilt natürlich
nicht für das Theater selbst, sondern muss mit seiner gesamten
Umgebung zusammen bewertet werden. Da werden Hotels gebucht und die
Gastronomie und der Einzelhandel angekurbelt, um nur einiges wenige
zu nennen - das sind alles Dinge, die üblicherweise nicht in die
immer wieder verbreiteten Defizitrechnungen mit einbezogen
werden.
SPEYER-KURIER: Nun ist das in Speyer doch eine andere Situation, weil Speyer über kein eigenes Theater verfügt. Das wäre ja vielleicht auch ein etwas zu großer Anspruch...
Curt Timm: ...obwohl es natürlich sehr schön wäre....
SPEYER-KURIER: So etwas aufzuziehen, wird heute wohl nicht mehr gelingen. Was würden Sie denn aber einem verantwortlichen Kommunalpolitiker raten - wie sollte er heute mit seinem Kulturetat umgehen?
Curt Timm: Er sollte vor allem nicht alles, was in der Kultur Geld kostet, streichen. Er muss es vielleicht - gezwungenermassen - einschränken, aber es müssen dann dafür andere Impulse kommen. Da ist dann - so möchte ich es einmal etwas pathetisch sagen - die Verantwortung des Politikers für jeden Einzelnen in unserer Gesellschaft gefragt. Ich halte es deshalb für unabdingbar, dass auch künftig Theater in unserer Stadt stattfindet - auch wen keine Gastspiele mehr in die Stadthalle kommen.
Denn Theater muss sein - auch in Speyer! Theater ist, wie man so sagt, “die Seele einer Stadt”!
SPEYER-KURIER: Nun wird man in Speyer sicher keine “große Oper”, kein aufwändiges “Sprechtheater” produzieren können. Welche Alternativen dazu würden Sie denn sehen, um dennoch qualitätvolles Theater auch in Speyer stattfinden zu lassen?
Curt Timm: Das ist ganz schwierig. Ich habe ja eine Inszenierung im Zimmertheater gemacht. Aber da wurde rasch deutlich, dass wir in Speyer eigentlich keinen wirklich geeigneten Saat für Theater haben. Der alte, historische Saal im Rathaus - da stimmt das Verhältnis der Größe von Bühne und Saal nicht - die Bühne ist viel zu klein für den Saal, oder der Saal zu groß für die Bühne. Aber auch die Stadthalle ist für diesen Zweck eigentlich völlig ungeeignet. Also komme ich wieder zurück auf das Zimmertheater, wo ich mir ein Stück von Strindberg oder etwas in der Art sehr gut vorstellen könnte.
Auch dort, wo jetzt das Kindertheater spielt, wäre mit etwas Aufwand etwas zu machen. Denn das ist zwar alles gut gemeint, aber dennoch unzulänglich. Nur gut gemeint, ist halt auch nicht abendfüllend....
SPEYER-KURIER: Welche Rolle kommt denn aus Ihrer Sicht bei der Finanzierung von Kunst heute privaten Sponsoren - früher nannte man sie treffsicherer Mäzene - zu?
-01.jpg) Curt Timm:
Da sind heute sicher ganz vorne weg die großen Unternehmen gefragt
- die großen Banken, die meines Erachtens bisher nicht genug tun.
Die haben zuletzt soviel Schaden angerichtet und die Gesellschaft
Geld gekostet, sodass sie jetzt hier eigentlich einspringen müßten.
Daher sollten Sponsorengelder in erster Linie von dort fließen.
Curt Timm:
Da sind heute sicher ganz vorne weg die großen Unternehmen gefragt
- die großen Banken, die meines Erachtens bisher nicht genug tun.
Die haben zuletzt soviel Schaden angerichtet und die Gesellschaft
Geld gekostet, sodass sie jetzt hier eigentlich einspringen müßten.
Daher sollten Sponsorengelder in erster Linie von dort fließen.
SPEYER-KURIER: Was halten Sie denn von dem Ansatz in den USA, Kunst und Kultur über Stiftungsmodelle zu finanzieren?
Curt Timm: Das wäre sicher ein Ansatz, aber bei weitem nicht ausreichend, zumal uns dazu in Europa auch die Tradition und die Erfahrung fehlen.
Ich sage Ihnen mal, was ich jetzt vorhabe: Die Sparkasse hat einen Fonds - die Sparkassen-Stiftung - da will ich jetzt einen Antrag stellen, um im kommenden Jahr für die Stadt ein Stück inszenieren zu können, damit in Speyer wieder ein schönes Schauspiel gezeigt werden kann. Das ist mit professionellen Schauspielern unter 15.000 - 20.000 Euro nicht auf die Beine zu stellen. Die Stadt aber kann das nicht mehr finanzieren und deshalb hoffe ich auf die Stiftung, für die das eine tolle Sache wäre.
SPEYER-KURIER: Darf es aber am Ende so sein, dass der Staat - quasi im Wege der Subsidiarität - sich immer mehr zurückzieht und die Finanzierung von Kunst und Kultur Schritt für Schritt auf Private verschiebt?
Curt Timm: Nein, nein - die Tradition, die wir hier in Deutschland haben - auch die Tradition der Grundfinanzierung von Kunst und Kultur durch die öffentlichen Hände - die muss unbedingt erhalten bleiben. Wenn das anders würde, müssten jedes Jahr einige weitere Theater sterben. Und das darf nicht passieren - Deutschland ist das einzige Land, das eine so breit aufgestellte und tief wurzelnde Theatertradition hat. Und das ist ein ganz hohes Gut, das erhalten werden muss.
SPEYER-KURIER: Altbundespräsident Richard von Weizsäcker hat in einem bemerkenswerten Vortrag - der SPEYER-KURIER berichtete darüber - festgestellt, dass Kunst kein Luxus sei, “den wir und leisten oder nach Belieben auch streichen können, sondern der geistige Boden, der unsere innere Überlebensfähigkeit sichert” - Soweit das Zitat des Bundespräsidenten. Wenn das auch Ihre Überzeugung ist - was kann dann der einzelne tun - was will Curt Timm tun, um diesem Anspruch zur Durchsetzung zu verhelfen?
Curt Timm: Also ich will im kommenden Jahr in Speyer ernsthaftes, gutes Theater machen - mit guten und überzeugenden Schauspielern, so dass die Bevölkerung die Verbindung zum Theater erhält und auch die Speyerer wieder Lust auf Theater bekommen und sagen: “Das ist schön”.
SPEYER-KURIER: Haben Sie für dieses Projekt schon ein Stück im Sinn?
Curt Timm: Ja, ich denke da besonders an einen Skandinavier - Strindberg oder Ibsen vielleicht - die haben eindrucksvolle, klein besetzte Stücke geschrieben.
SPEYER-KURIER: Haben Sie schon eine Vorstellung, wie Sie ein solches Stück besetzen könnten?
 Curt Timm:
Das geht eigentlich recht einfach über eine der einschlägigen
Agenturen. Es gibt aber auch bei den Hobby-Theatergruppen immer
wieder talentierte Kräfte - so habe ich in Neustadt jetzt ein
Laien-Ensemble gesehen, da waren zwei, drei dabei, die ich sofort
engagieren würde. Und solche Gruppen gibt es ja auch in Speyer.
Curt Timm:
Das geht eigentlich recht einfach über eine der einschlägigen
Agenturen. Es gibt aber auch bei den Hobby-Theatergruppen immer
wieder talentierte Kräfte - so habe ich in Neustadt jetzt ein
Laien-Ensemble gesehen, da waren zwei, drei dabei, die ich sofort
engagieren würde. Und solche Gruppen gibt es ja auch in Speyer.
SPEYER-KURIER: Dann wünschen wir Ihnen - auch im Namen der Leserinnen und Leser des SPEYER-KURIER - viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Pläne und Ihnen und Ihrer verehrten Gattin auch weiterhin Gesundheit und alles Gute.
Das Gespräch führte Gerhard Cantzler/Fotos: gc.
05.09.2012





















